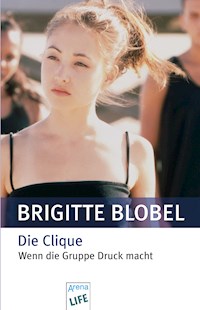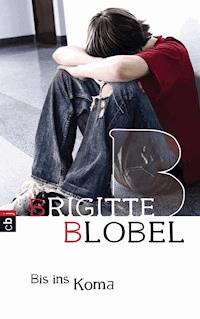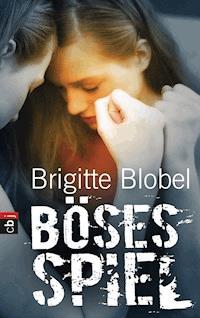4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Kitty hat vor allem Angst - vor der Schule, vor den Lehrern &dots; Sven ist der Einzige, der merkt, dass Kitty wirklich Hilfe braucht. Aber da ist es schon fast zu spät. Brigitte Blobel erzählt in ihrem packenden Roman die Geschichte eines Mädchens, das sich "ritzt". Was harmlos anfängt, nimmt schließlich fast ein tödliches Ende. Ein packender Roman zum einen sehr wichtigen Thema - ca. 800.000 Jugendliche in Deutschland - meistens Mädchen - reagieren auf Probleme, indem sie sich selbst verletzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
BRIGITTE BLOBEL
Rote Linien
Ritzen bis aufs Blut
Weitere Titel von Brigitte Blobel im Arena Taschenbuch:
Jeansgröße 0 – Kein Gramm zu viel (Band 2772) Alessas Schuld – Geschichte eines Amoklaufs (Band 2766) Die Clique – Wenn die Gruppe Druck macht (Band 2773) Herzsprung – Wenn Liebe missbraucht wird (Band 2774) Liebe wie die Hölle – Bedroht von einem Stalker (Band 2734) Getrennte Wege – Wenn eine Familie zerbricht (Band 2755) Blind Date – Wenn Liebe sehen lässt (Band 50385) Meine schöne Schwester – Der Weg in die Magersucht (Band 2735) Eine Mutter zu viel – Adoptiert wider Wissen (Band 2745) Drama Princess – Topmodel, um jeden Preis? (Band 50177) Shoppingfalle (Band 2909) Liebe passiert (Band 50112) Party Girl (Band 50291)
Brigitte Blobel, 1942 geboren, studierte Politik und Theaterwissenschaft. Heute arbeitet sie als erfolgreiche Journalistin und schreibt Drehbücher für Film und Fernsehen sowie Romane für Erwachsene und Jugendliche, für die sie bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Sie ist eine der beliebtesten deutschen Autorinnen.
10. Auflage als Arena-Taschenbuch 2013© 1999 Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: knaus. büro für konzeptionelle und visuelleidentitäten, Würzburg, unter Verwendung eines Fotos vonLena Marh © gettyimagesISSN 0518-4002ISBN 978-3-401-80362-3
www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
1. Kapitel
Sie sitzen auf der Bank in der Lietzenauer Straße und warten. Weil die Bank – drei zusammengenagelte Bretter auf zwei Betonklötzen – vom Regen nass ist, hat Sven eine Zeitung aus der Tasche gezogen und sie ausgebreitet. »Damit deine Klamotten nicht nass werden«, hat er zu Kitty gesagt.
Kitty hat gelächelt und sich brav hingesetzt. Es wäre ihr egal gewesen. Jeans werden auch wieder trocken. Sie sind an diesem Tag schon zweimal in den Regen gekommen.
Sven hat zwei Currywürste für sie besorgt, schon klein geschnitten, auf einem Pappteller, mit Currysoße und einem Klecks Mayo. Dazu für jeden ein trockenes Brötchen. Die Krumen sitzen Kitty immer noch in der Kehle. Sie hat Durst, aber keine Lust, aufzustehen und am Kiosk eine Cola zu kaufen, sie hat eigentlich zu überhaupt nichts Lust. Sie sitzt da, die Schultasche zwischen den Füßen, die Arme auf die Knie gestützt, und starrt vor sich hin. Im Rinnstein hat sich Wasser angesammelt, der Gully ist verstopft. Auf der Pfütze schwimmt ein kleines Papierschiff. Das hat Sven gebastelt, aus einer Viertel Zeitungsseite. Das Schiffchen saugt sich voll Wasser, wird immer schwerer. Kitty rechnet jeden Augenblick damit, dass es untergeht. Der Bug ist schon unter Wasser. Sie weiß, dass sie losheulen wird, wenn das Schiff untergegangen ist. Und sie weiß auch, dass sie das nicht zulassen darf. Wegen so einer Sache heulen. Aber ein kleines Papierschiff, das so tapfer auf dem Wasser herumsegelt, um dann doch unterzugehen, das ist doch todtraurig …
Sven stößt Kitty sanft in die Seite. »Mensch«, sagt er, »mach nicht schon wieder so ein Gesicht!«
»Ich mach doch gar kein Gesicht«, Kitty reißt sich zusammen. Sie lächelt Sven an. »Ehrlich, es geht mir gut.«
»Haha«, sagt Sven, »du hast schon mal bessere Witze gemacht.«
»Dein Schiff geht gleich unter«, sagt Kitty, um ihn abzulenken.
»Klar, ist ja Zeitungspapier. Das saugt sich schnell mit Wasser voll.« Er mustert Kitty. Er runzelt die Stirn, überlegt. »Soll ich es retten?«
Kitty nickt. Sofort steht Sven auf, schiebt den Ärmel seiner Jeansjacke zurück und fischt das Segelschiff aus der Pfütze. Er setzt es auf dem Kopfsteinpflaster neben Kittys rechten Fuß ab. »Okay?«, fragt er.
Kitty beugt sich vor, nimmt das Schiff, kippt es um und lässt das Wasser herauslaufen. »Ja, okay«, sagt sie. Sven atmet tief durch. »Oh Mann. Du bist ganz schön kompliziert, weißt du das? Ich hab schon gedacht, du würdest wegen diesem Schiffchen anfangen zu heulen. Bloß, weil das in der Pfütze absäuft.«
»Quatsch«, sagt Kitty. »Ich heul doch nicht wegen so was.« Gegenüber der Mietblocks, in dem Kitty wohnt. Roter Klinker, weiße Fenster, der Eingang mit grauen Granitsteinen eingefasst. Die Eingangstür hat oben Glasscheiben, eine ist zersprungen. Der Glaser sollte schon vor Wochen kommen, die Mieter sind alle sauer deswegen. Aber dem Besitzer ist es offenbar egal. Manchmal geht in dem Flur das Licht an. Im Dreißigsekundentakt geht es dann wieder aus. Der Hausbesitzer spart Strom. Es ist Anfang März, fünf Uhr Nachmittags und fast schon dunkel. Es ist den ganzen Tag nicht richtig hell geworden. Die Nebelschwaden hängen so tief, dass man nicht einmal die Spitze des Kirchturmes sieht. Kitty hat an diesem Vormittag eine Englischarbeit geschrieben. Man sollte eine Geschichte, die im Präsens geschrieben war, in die Vergangenheit übertragen. Der Titel: »Sunshineparadise«. Eine Geschichte über Kalifornien und das tolle Leben da am Pazifik, meterhohe Wellen und Kids, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als mit ihren Surfbrettern gegen die Wellen anzuschwimmen, sich dann eine Weile treiben lassen, auf eine Riesenwelle warten, auf dem Wellenkamm mitkraulen, aus der Hocke aufstehen und an den Strand reiten. Wie Cowboys. Kitty kann sich unter einem Sunshineparadise nichts vorstellen. Eines weiß sie aber genau: Leipzig ist nicht so. Kein Sunshineparadise, da, wo sie geboren wurde, wo sie immer noch lebt. Ohne Chance, dass sich daran je etwas ändern würde.
Nur einmal hat sie eine Ahnung gehabt, wie das Leben auch sein könnte. Wenn es schön ist. Wenn man sich gut fühlt, vollkommen mit sich und der Welt im Reinen ist. Wenn man morgens aufwacht und das Fenster aufreißt, die Arme ausbreitet und einfach nur lächelt, weil alles so schön ist.
Das war in Ahrenshoop gewesen, auf Hiddensee. Dem schönsten Fleckchen von Europa, wie ihre Mutter immer sagte. Dabei hatte sie von Europa nichts anderes gesehen als Deutschland. Aber vielleicht stimmte es sogar: Sie waren in den Sommerferien nach Hiddensee gefahren, auf einem alten Pferdefuhrwerk über den Deich und dann in die Pension, in der sie die Zimmer gemietet hatten. Ihr Zimmer war im Erdgeschoss und hatte eine Tür in den Garten und eine andere Tür in ein Zimmerchen, das die Vermieterin »Waschkabinett« nannte. Mit blau-weißer Tapete und einer Badewanne auf Füßen. Über der Badewanne ein Messingring, an dem der Badevorhang herunterfiel. Wenn sie morgens aufwachte, stieß sie als Erstes die Holzklappen vor dem Fenster auf. Um zu sehen, ob die Sonne schien. Und sie schien immer, jeden einzelnen Tag in diesen Ferien. Der Raps blühte und durch das Weizenfeld ging ein Wind. Man hörte das Wiehern der Pferde auf der Nachbarkoppel und oben am Himmel die Möwen, die sich vom Seewind tragen ließen, höher und höher, und ihre heiseren Schreie. Das war wunderbar gewesen. Das Frühstück unter dem Apfelbaum. Ihre Mutter immer so vergnügt, in bunten Kleidern und barfuß. Und ihr Vater fuhr mit den Fischern aufs Meer, zum Dorschefangen. Frühmorgens verließ er das Haus, wenn es dämmerte, und kam Mittags zurück. Stolz wie Oskar, wenn sie einen guten Fang gehabt hatten. Wie sie stundenlang am Meer entlanggegangen war. Muscheln sammeln. In den Dünen sitzen und träumen, dieses kleine Haus hinter den Dünen, mit dem Strohdach, wäre das eigene. Und dann müsste sie nie wieder zurück nach Leipzig. Nie wieder Schule. Nie wieder graue Häuser, grauer Himmel und graue Gedanken …
»Also«, sagt Sven entschlossen, »packen wir’s?«
Er steht auf und knöpft die Jeansjacke zu.
Kitty rührt sich nicht. Sie blickt auf die Fenster im dritten Stock, rechts vom Treppenaufgang. Das ist ihre Wohnung. Da sind jetzt ihre Eltern. Ihre Mutter in der Küche. Das Küchenlicht brennt. Manchmal sieht sie den Schatten ihrer Mutter. Im Wohnzimmer flimmert der Fernseher. Dies bläulich flackernde Licht, das nur Fernsehbildschirme aussenden, kann man immer von allen anderen Lichtquellen unterscheiden.
Kitty hat gesehen, wie ihre Eltern nach Hause gekommen sind. Zuerst ihre Mutter. Das war gegen zwei. Sie hatte zwei Plastiktüten von ALDI dabei. Vielleicht hatte sie Kittys Lieblingsjoghurt gekauft. Joghurt mit Vanillegeschmack. Mittwochs ist immer Einkaufstag. Da hat sie früher Feierabend. Ihre Mutter in der schwarzen Uniform. Kittys Mutter arbeitet bei den schwarzen Sheriffs. Vorher war sie bei der Polizei, noch vor der Wende. Volkspolizistin. Jetzt arbeitet sie für eine private Sicherheitsfirma. Sie kontrollieren den Eingangsbereich eines großen Kaufhauses. »Was glaubst du, was da für Kriminelle rumhängen«, sagt ihre Mutter … Eine Pistole trägt sie nicht bei der Arbeit, nur einen Schlagstock. Die Pistole liegt zu Hause im Nachttisch. Der ist immer abgeschlossen. Zu der schwarzen Uniform trägt ihre Mutter weiße Hemdblusen, die wie Männeroberhemden geschnitten sind. Aus Baumwolle. Jeden Abend bügelt sie eine Bluse für den nächsten Tag und ein T-Shirt oder ein Hemd für Kitty. Kitty liebt XXL-Leinenhemden. Morgens, wenn sie das Haus verlässt, stellt Kittys Mutter die Waschmaschine an. Einmal hat es im Haus einen Wasserschaden gegeben, weil die Waschmaschine der Nachbarn kaputt war. Aber Kittys Vater sagt, das kann bei ihnen nicht passieren. Das ist eine Markenwaschmaschine. Mit Garantie.
Die Uniform musste Kittys Mutter nicht selber kaufen, sie wird von der Firma gestellt.
Jeder Mitarbeiter erhält zwei Hosen, eine Jacke und einen Regenmantel. Im Winter trägt ihre Mutter eine dicke Strickjacke unter der Uniformjacke. Ein Mantel, sagt sie, würde das Bild verfälschen. Dann sieht ja keiner, wer ich bin. Dann hat keiner Respekt.
Um drei Uhr ist Kittys Vater von der Arbeit gekommen. Er ist bei der Bahn beschäftigt, im Rangierwerk. Leute wie er, sagt er immer, sorgen dafür, dass die Menschen sicher von A nach B kommen. Dass Züge nicht aufeinander losrasen, sondern aneinander vorbei. Früher hat Kitty oft von zwei Zügen geträumt, die direkt aufeinander zurasen. Und dann gab es einen Knall und einen Feuerball und sie ist mit einem Schrei aufgewacht. Als sie klein war, hatte ihr Vater sie oft mitgenommen ins Stellwerk. Und ihr die Pläne von all den Zügen gezeigt und die kleinen Tafeln mit all den Lämpchen und Glühbirnen, die angaben, wo gerade welcher Zug unterwegs war. Er hat gelacht und Kitty geküsst, wenn sie gesagt hat »wenn ich groß bin, werde ich Lokführerin«. Aber dann hat es einen Unfall gegeben. Da ist ihr Vater drei Tage und drei Nächte nicht nach Hause gekommen, es hat das totale Chaos geherrscht. Nachher haben sie in den Zeitungen geschrieben, dass es »menschliches Versagen« gewesen sei. Drei Tote und zehn Schwerverletzte. Mit ihrem Vater durfte man darüber nicht reden. Es war tabu, dieses Unglück auch nur zu erwähnen. Dabei hatte ihr Vater keine Schuld. Nicht die geringste. Er hat an dem Tag ein Seminar geleitet, für Auszubildende. Er ist überhaupt nicht im Stellwerk gewesen. Aber die Nachbarn haben eine Zeit lang komisch geguckt und Kittys Mutter hat sich kaum aus der Wohnung getraut und Kitty immer mit einem Zettel zum Einkaufen geschickt. Da war Kitty erst sechs gewesen und konnte noch nicht lesen, was auf dem Zettel stand. Und wenn sie was Falsches mitbrachte, gab es Krach.
Wie oft ihr Vater wohl noch an das Unglück denken muss, weiß Kitty nicht.
»Hey, wo bist du mit deinen Gedanken?« Sven baut sich vor Kitty auf. Er stemmt die Hände in die Hüften. »Träumst du, oder was? Los, wir gehen rüber!«
»Ich weiß nicht. Ich will noch nicht. Setz dich noch mal hin, Sven, ja?«
»Nein«, sagt Sven, »ich setze mich nicht mehr hin. Wir sitzen hier seit drei Stunden. Weißt du das? Das ist doch bescheuert. Wir können hier doch nicht die ganze Nacht sitzen.«
»Es ist doch erst fünf.« Kitty bettelt. »Wir können doch noch ein kleines bisschen warten. Bitte.«
»Und was soll das bringen?«, fragt Sven. Er seufzt, aber setzt sich wieder. Kitty kuschelt sich an ihn. Seine Jacke ist feucht und riecht nach kaltem Tabak. Sie riecht das gern. Sie riecht Sven überhaupt gern. Sie schiebt ihre Hand schüchtern unter seinen Jackenärmel. »Nur eine winzige kleine Minute, ja?«
»Okay.« Sven schaut auf seine Uhr. »Eine winzige kleine Minute.«
Dann schweigen sie. Kitty spürt, wie ihr Herz schlägt. Sie starrt auf die Fenster ihrer Wohnung. Ihr eigenes Zimmer geht nach hinten, in den Hof. Ebenso wie das Schlafzimmer ihrer Eltern. Nach hinten ist es ruhig. Da hört man keinen Straßenverkehr, nur die Garagentore, wenn sie zufallen. Die Garagentore sind aus Aluminium. Sie vibrieren richtig, wenn sie ins Schloss fallen. Manchmal hört man einen Hund bellen. Oder wie Leute sich anschreien, auf dem Balkon. Am offenen Fenster. Im Sommer hört man sie auch manchmal lachen und man hört Musik. Im Sommer ist es sowieso besser. Alles.
Jetzt ist Anfang März. Es dauert noch eine Ewigkeit, bis man wieder barfuß gehen kann. Auf einer Bank sitzen kann, ohne zu schlottern. Ihr ist eiskalt. Sie merkt erst jetzt, dass ihre Zehen fast abgestorben sind. »Wie viel Grad sind es wohl?«, fragt sie.
»Keine Ahnung, sechs oder sieben, schätze ich.«
»Heute Morgen waren die Autoscheiben alle vereist«, sagt Kitty, »hast du das gesehen?«
»Ich hab’s gesehen, aber es hat mich nicht interessiert«, sagt Sven. »Ich habe kein Auto. Wenn ich ein Auto hätte, dann würde es mich interessieren. Die Minute ist rum.« Er steht auf und zieht Kitty hoch. Er zieht sie an den Schultern zu sich heran und schaut ihr in die Augen. »Wir gehen da jetzt rüber, schließen auf, steigen die Treppe hoch in den dritten Stock und klingeln. Klar?«
Kitty nickt. Sie zittert.
»Und dann öffnet entweder dein Vater oder deine Mutter und dann weißt du ja, was du sagen willst.«
Kittys Lider flattern. Aber sie nickt tapfer.
»Oder hast du es vergessen?«, fragt Sven.
»Quatsch«, murmelt Kitty. »Wieso soll ich das vergessen haben.«
»Vielleicht hast du es dir ja anders überlegt?«
»Quatsch«, sagt Kitty erneut. Sie schaut an ihm vorbei auf die Hausfassade. In der Küche geht gerade das Licht aus. Möglicherweise trägt ihre Mutter das Tablett mit dem Teegeschirr ins Wohnzimmer. Ihre Eltern trinken oft nachmittags einen heißen Tee. Das wärmt das Herz, sagt ihre Mutter immer. Kitty hatte eine Weile auch eine Teephase. Aber die war vorbei, als sie gemerkt hat, dass ihr Herz davon nicht warm wurde.
»Ich weiß nicht«, sagt Sven misstrauisch, »kommt es mir auf einmal nur so vor, als wenn du das gar nicht mehr willst, oder ist das Tatsache?«
»Was?«, fragt Kitty.
Sie sieht die Schatten ihrer Eltern. Sie wandern die Zimmerdecke entlang, in dem bläulichen Licht, das vom Bildschirm kommt. Dann flammt ein anderes Licht auf. Das ist gelber. Wärmer. Die Stehlampe, denkt Kitty.
»Was wir besprochen haben. Worüber wir die ganze Zeit reden, Mann, bin ich verrückt? Wieso muss ich alles hundert Mal wiederholen? Wieso hörst du nie zu?«
»Ich hör doch zu«, sagt Kitty.
»Und wieso antwortest du nicht?«
»Ich antworte doch«, sagt Kitty. In der Küche geht das Licht schon wieder an. Sie hat den Süßstoff vergessen, denkt Kitty. Sie nehmen neuerdings Süßstoff statt Zucker. Das hat ihre Mutter in einer Zeitschrift gelesen. Aber sie kann sich immer noch nicht daran gewöhnen. Meistens vergisst sie, das Döschen mit aufs Tablett zu stellen. Dann muss sie eben noch mal los.
»Also«, sagt Sven, »wir gehen jetzt da rüber.«
Kitty nickt. »Ja.«
Sven starrt sie an. »Du willst, dass ich mitkomme?«
»Ja«, sagt Kitty.
»Oder willst du das lieber allein mit deinen Eltern ausmachen?«
»Nein«, sagt Kitty, »nicht allein. Ich möchte, dass du mitkommst. Allein schaff ich das nicht.«
Sven holt tief Luft. »Okay. Dann los.«
Er nimmt ihren Ellenbogen und schiebt sie vor sich her zwischen den parkenden Autos hindurch auf die Straße. Hält sie zurück, als ein Lastwagen vorbeidonnert. Schiebt sie weiter, als die Straße frei ist. Auf der anderen Seite parken auch Autos. Sven findet eine Lücke. Sie stehen auf dem Bürgersteig. Neben dem Eingang parken zwei Räder. Sie gehen an den Rädern vorbei zum Eingang. Die Tür ist verschlossen. Kitty deutet mit dem Kopf auf den Schalter. »Da ist der Lichtschalter.«
Sven macht Licht. Man sieht, dass der Flur hellgrün gefliest ist. Die Wände leuchten weiß. Im Hintergrund die Tür, die zum Keller führt. Die ist aus Stahl. Ihr wird wieder so kalt. Wie früher.
Sven streckt die Hand aus. »Der Schlüssel«, sagt er. »Oder schließt du auf?«
»Nein, du«, sagt Kitty. Sie zieht den Schlüsselbund aus der Jackentasche, sucht den Haustürschlüssel und reicht ihn Sven. Sven schließt auf. Sie zittert vor Kälte, ihre Kiefer schlagen aufeinander. Sie presst die Zähne zusammen, fest, sie streift mit den Händen die nassen Haare aus dem Gesicht. Wenn sie mit der Zunge über die Lippen fährt, schmeckt es nach Himbeere. Ihr Lippenstift hat Himbeergeschmack.
2. Kapitel
Sven schließt die Haustür auf und sie gehen ins Treppenhaus. Es riecht nach einem Putzmittel, nach Essig. Wenn Frau Müller aus dem ersten Stock Treppenhausdienst hat, riecht es immer nach Essig. Frau Müller benutzt immer biologische Putzmittel, auf Essig- oder Zitronenbasis. Kittys Mutter sagt »Ich nehme, was am besten putzt. Ob das biologisch ist oder nicht, ist mir egal.«
»Mann, wie das hier riecht«, sagt Sven, als sie die Treppe hinaufsteigen.
»Wie denn?«, fragt Kitty.
»Na, wie im Altersheim. Oder im Krankenhaus!« Er grinst, verzieht das Gesicht. »Ich weiß nicht. So steril irgendwie.« »Sauber«, sagt Kitty. »Meine Mutter sagt immer, Sauberkeit kann man riechen.«
Kitty geht zwei Stufen hinter Sven. Er dreht sich zu ihr um. Grinst. »Sauberkeit kann man riechen? Was ist das denn für ein Schwachsinn.«
»Kein Schwachsinn«, sagt Kitty, »das stimmt wirklich.«
»Und? Riechst du das gerne?«, fragt Sven.
Kitty hebt die Schultern. »Weiß nicht. Ist mir egal, glaube ich.«
Im zweiten Stock müssen sie eine Pause machen. Kitty hat das Gefühl, dass sie auf einmal keine Luft mehr bekommt. Ihr ist ganz schwarz vor Augen. Sven macht ein besorgtes Gesicht. »Geht’s schon wieder los?«, fragt er.
Kitty lächelt, nickt, schüttelt den Kopf.
»Ja. Nein.«
»Also was nun? Ja oder nein?«, fragt Sven.
»Ich weiß nicht«, flüstert Kitty.
Sven seufzt. »Weißt du eigentlich, wie oft am Tag du ›ich weiß nicht‹ sagst?«
»Ich weiß nicht«, flüstert Kitty. Dann muss sie selber lachen.
»Nur noch zwanzig Stufen«, sagt Sven, um sie aufzumuntern. »Das schaffst du leicht.«
»Klar«, sagt Kitty. »Schaff ich leicht.«
Schließlich stehen sie vor der Wohnungstür. An dem Schild steht: SEMRAU.
So heißen ihre Eltern. Elisabeth und Ernst Semrau. Sie heißt Kitty Semrau. Eigentlich Katharina. Aber das hat nie einer zu ihr gesagt. Immer nur Kitty. Solange sie denken kann. Im Kinderhort, in der Schule, bei den Nachbarn, den Verwandten. Immer nur Kitty. Die süße Kitty. Als sie klein war, hatte sie Zöpfe wie Pippi Langstrumpf. Und genau solche Sommersprossen auf der Nase. Alle sagen, sie sei so ein süßes Baby gewesen. Habe nie geweint. Immer nur alle Leute angelacht. Auch wenn es Fremde waren. »Die haben um deinen Kinderwagen herumgestanden«, hatte Kittys Mutter erzählt, »und dich angehimmelt. Du warst wie ein Sonnenschein. Unser kleiner Sonnenschein. Unsere Kitty. So was kann man doch nicht Katharina nennen, so was Sonniges.«
»Klingeln?«, fragt Sven.
Kitty nickt.
»Du oder ich?«, fragt Sven.
»Du«, sagt Kitty.
Sven grinst. »Feigling.« Aber er sagt es freundlich. Er drückt auf den Klingelknopf und Kitty hat das Gefühl, als wenn ihr jemand ein spitzes Messer in den Magen drückt. Es nimmt ihr die Luft. Sie fasst mit der Hand an die Kehle. Reißt den Mund auf. »Was ist?«, fragt Sven erschrocken.
Kitty hat die Augen weit aufgerissen. Sie starrt auf die Tür, die verschlossen ist. Vor der Tür ein Fußabtreter, auf dem zwei Gänse zu sehen sind. Beide haben eine rote Schleife um den Hals. Ihre Mutter schrubbt den Fußabtreter einmal in der Woche. Die Gänse sind immer noch richtig weiß, obwohl sie den Fußabtreter schon zwei Jahre haben. Alles bei ihnen ist immer noch wie neu.
Sie hört Schritte. Es sind die Schritte ihres Vaters. »Ja?«, ruft er von innen. »Wer ist da?«
Sven schaut Kitty an. Kitty nimmt die Hand von der Kehle, räuspert sich, »ich«, flüstert sie.
Sven stößt sie an. »Lauter!«
Kitty räuspert sich wieder. »Ich bin’s, Kitty.«
Einen Augenblick ist es still. Dann hört sie, wie die Schritte sich wieder entfernen, wie jemand flüstert. Sven und Kitty schauen sich an.
»Die machen nicht auf«, sagt Sven. Seine Stimme ist rau. Er sieht blass aus. Sven ist einen Kopf größer als Kitty, er hat sehr kurz rasierte Haare, ein ziemlich scharfes Profil mit vorstehendem Kinn und großer Nase. Eine hohe Stirn, fast, als habe er schon Geheimratsecken. Mit siebzehn Geheimratsecken. Das ist komisch. Weil er früher viel Fußball gespielt hat, ist er ein muskulöser Typ. Er trägt immer Turnschuhe und in den Turnschuhen hat er einen federnden Gang. Richtig dynamisch. Das ist Kitty zu allererst aufgefallen, dass Sven immer geht, als habe er Sprungfedern unter den Schuhen. Und wie er mit den Armen wedelt, wenn er geht, als hole er sich Schwung für jeden Schritt, noch eine Portion extra Schwung.
Seine kurzen Haare sind gefärbt. Gebleicht. Strohblond. Zu seinen braunen Augen sieht das toll aus, findet Kitty. Es war ihre Idee, dass er sich die Haare blond färben sollte. Sie hatte sich aber eine Farbe vorgestellt, die nicht ganz so gelb ist. Seine Haare haben exakt die Farbe von Ringelblumen. Nächstes Mal wollen sie ein bisschen Silber ins Färbemittel geben, um das Gelb wegzukriegen. Damit es mehr Weizenblond aussieht. Weizenblond ist nicht richtig gelb. Daran hatten sie nicht gedacht.
Jetzt kommen wieder Schritte. Das ist ihre Mutter. Sie sagt nichts. Sie zieht einfach die Tür auf. Ihre Augen leuchten auf, als sie Kitty sieht. Und werden dunkel, als sie entdeckt, dass Kitty nicht allein gekommen ist.
»Hallo, Mami«, sagt Kitty.
Sven bleibt stumm. Er steht nur da. Aufrecht, fast steif. Kitty lehnt sich ein bisschen an ihn, um seinen Körper zu fühlen. Eine Stütze.
»Oh«, sagt ihre Mutter. »Du kommst auch noch mal nach Hause. Wir haben die Hoffnung schon aufgegeben.«
Kitty lächelt unsicher. »Trinkt ihr gerade Tee?«
Sie sieht, dass ihr Vater hinten in der Wohnzimmertür steht.
»Interessiert es dich auf einmal, ob wir Tee trinken?«, fragt ihre Mutter.
Kitty hebt verlegen die Schultern. »Ich weiß nicht. War nur so eine Frage.«
»Und sonst hast du keine Fragen?«, fragt ihre Mutter.
»Zum Beispiel, ob wir uns Sorgen machen, wenn du einfach verschwindest. Wie wir diese Situation aushalten, das möchtest du nicht wissen? Nur, ob wir gerade Tee trinken?«
Kitty sieht, dass ihr Vater den Flur entlangkommt. Jetzt steht er hinter ihrer Mutter, schaut an ihr vorbei auf Sven.
»Und wer ist das?«, fragt er.
Sven räuspert sich. »Hi.« Er streckt die Hand aus. »Ich bin Sven.«
»Er ist der Bruder von Nadine«, sagt Kitty. »Er hilft mir, ein paar Sachen tragen.«
Kittys Vater mustert Sven misstrauisch. »Der Bruder? Seit wann hat Nadine einen Bruder? Von dem hast du nie erzählt.«
»Dann tu ich es eben jetzt«, sagt Kitty trotzig. »Außerdem ist es doch egal, oder?«
»Und Nadines Mutter, was sagt die, wenn du ständig dort übernachtest?«, fragt Kittys Mutter.
Sven grinst. »Die freut sich.«
»Wirklich?«, der Vater macht ein ungläubiges Gesicht. Kitty möchte am liebsten sagen, es sind nicht alle so wie ihr – so zurückweisend gegenüber Fremden. Manche Leute freuen sich, wenn Leben und Lachen in der Bude ist. Aber sie sagt es nicht.
»Wollt ihr einen Tee trinken?«, fragt die Mutter. »Vielleicht sollten wir einmal mit Nadines Mutter telefonieren. Die denkt womöglich, uns sei es egal, was unsere Tochter macht.«
Kitty und Sven werfen sich einen Blick zu. »Sie ist heute nicht zu Hause«, sagt Sven.
»Ich wollte nur ein paar Sachen holen. Meine Sachen. Schulsachen. Klamotten und so. Und mein Bettzeug.«
»Was?« Ihre Mutter weicht einen Schritt zurück. Sie stößt gegen den Garderobenständer. Tut sich weh. »Heißt das, du willst hier ganz ausziehen?«
»Oh, entschuldige Mami«, sagt Kitty erschrocken.
»Schon gut, nichts passiert.« Ihre Mutter reibt sich den Hinterkopf. »Du willst all deine Sachen holen?«
Kitty hebt verlegen die Schultern. Sven schaut sich im Flur um. Er sieht Kittys Wildlederjacke am Haken. »Die soll doch auch mit, oder?« Er nimmt die Jacke vom Haken. Er weiß, dass das Kittys Lieblingsjacke ist. Im Secondhandladen gekauft. Von dem Geld, das sie gekriegt hat für ihre alten Kinderbücher. Samstags auf dem Flohmarkt hat sie alles verkauft: ihre Kinderbücher, ihre Kassetten mit den Songs, die sie heute albern findet, ihre Puppen. Das hat mehr als hundert Euro gebracht. Und die Jacke hat hundertzwanzig Euro gekostet. Kitty findet immer noch, dass sie ein gutes Geschäft gemacht hat. Mit den Puppen hat sie sowieso nie wirklich gern gespielt, und wenn man in einem gewissen Alter ist, rührt man Kinderbücher nicht mehr an. Aber die Jacke, die ist für sie wie ein Ersatz für eine Kuscheldecke.
»Mami«, sagt Kitty, »es ist nur für ein paar Tage. Ich hol nur meine Sachen. Dann seid ihr mich los fürs Erste.«
»Wer hat gesagt, dass wir dich los sein wollen?«, ruft ihr Vater. »Du bist unsere Tochter. Unser Kind. Wir wollen dich nicht los sein. Oder haben wir das je gesagt?«
Er baut sich vor ihr auf. Er zwingt Kitty, ihm in die Augen zu schauen. Kitty ist kreidebleich. Sie zittert. »Nein«, flüstert sie, »das habt ihr nie gesagt.«
»Na also.« Ihr Vater atmet tief durch, dann schaut er Sven an. »Ich weiß nicht, was Kitty über uns erzählt. Aber Sie können mir glauben, es ist nicht wahr.«
»Wir lieben Kitty. Aber es ist auch schwierig mit ihr«, sagt die Mutter.
Wie oft hat Kitty das in der letzten Zeit gehört: Du bist so kompliziert.
Er siezt Sven, denkt Kitty, wie komisch. Was anderes kann sie nicht denken.
»He, Kitty, sag, was mit dir los ist!«
»Mir geht’s nicht gut«, sagt Kitty flehend. »Das wisst ihr. Das ist doch schon lange so. Vielleicht wird es besser, wenn ich eine Weile woanders bin. Sven glaubt das auch.« Sie läuft in ihr Zimmer. Sie zerrt die Bettdecke vom Bett, das Kopfkissen. Ihre Mutter hat das Bett frisch bezogen. Es riecht nach Lavendel. Die Bettwäsche riecht immer nach Lavendel. Ich muss das raushängen, denkt Kitty. Von dem Geruch wird mir übel.
Sie öffnet den Kleiderschrank, zerrt ein paar Sachen heraus. Dann den Campingsack, stopft alles rein. Sie hört, wie ihre Eltern im Flur mit Sven reden. Wütend. Heftig.
»Sven!«, ruft Kitty, »kannst du mir helfen?«
»Komme!«
Sven steht in der Tür. Er sieht, wie Kitty, wachsbleich, schwankt, als wanke der Boden unter ihren Füßen.