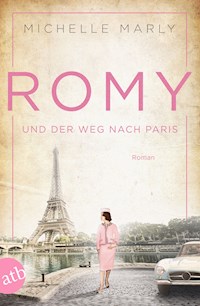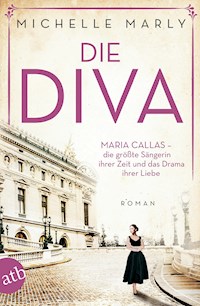11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte von Yves Saint-Laurents größter Inspiration – eine Frau, die alles für die Liebe riskiert
Paris, 1968: Als die junge Loulou zu einer Teestunde in illustrer Gesellschaft eingeladen wird, könnte sie sich nichts Langweiligeres vorstellen – und allgemein fällt es der in London geborenen jungen Frau schwer, in Frankreich anzukommen. Endlich hat sie es geschafft, aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter herauszutreten, alles in ihr wehrt sich dagegen, sich von ihrem bunten, ausufernden Stil abzuwenden und der hier vorherrschenden kühlen Eleganz anzupassen. Doch dieser Nachmittag soll nicht ohne Folgen bleiben: Eine Begegnung verändert ihr Leben für immer, denn hier trifft sie Yves Saint Laurent. Er ist fasziniert von der jungen Frau, die selbst am liebsten Flohmarkt-Klamotten trägt, aber nichts auf der Welt so liebt wie Mode. Loulou und Yves werden gute Freunde, und schließlich macht er ihr das Angebot ihres Lebens – doch lediglich eine »Muse« wollte sie nie sein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Originalausgabe © 2023 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749906000www.harpercollins.de
PROLOG
Mode vergeht, Stil bleibt ewig.
Yves Saint Laurent
Paris
25. Januar 1973
Paris
Der Beginn fast jeder Modenschau im Salon der Rue Spontini Nummer 30 lief nach demselben Muster ab: Einhundertzwanzig ausgewählte Gäste, vornehmlich Damen der besseren Gesellschaft, Vertreterinnen der Presse sowie Prominenz aus Film und Fernsehen, wurden von den Saaldienern zu ihren Plätzen geleitet. Am Rande des mit einem cremefarbenen Teppich bespannten Laufstegs standen goldene, mit rotem Samt bezogene Stühle aufgereiht, auf denen mit Namen versehene Kärtchen für die entsprechende Zuordnung sorgten. Von vorn nach hinten wurden die in Kategorien – und nach Wichtigkeit – eingestuften Besucherinnen und Besucher gesetzt. Doch bevor alle ihre Plätze einnahmen, herrschte wie immer, so auch an diesem Morgen, ein reges Treiben, Gespräche hallten von den saalartigen Wänden des Salons wider. Begrüßungen wurden ausgerufen, und die meisten Gäste tauschten sich mit gedämpfter Stimme über ihre jeweiligen persönlichen Erwartungen an die neue Haute-Couture-Kollektion von Yves Saint Laurent aus.
Hinter dem großen Torbogen am Ende von Raum und Laufsteg knisterte die Luft vor Lampenfieber und angespannter Erwartung. Dabei hatten sie die Präsentation gestern noch einmal genau durchgespielt: der Modeschöpfer, sein Partner Pierre Bergé, die Atelierleiterin Anne-Marie Muñoz – und Loulou de la Falaise, Freundin, Muse und Assistentin, die mit einer Sofortbildkamera Fotos von den Modellen und Kleidern geschossen hatte. Eine Wolke aus Haarspray, Puder und Zigarettenrauch schwebte über den Köpfen der Männer und Frauen, gestern wie heute.
Wie ein Dompteur würde Pierre Bergé die Mannequins gleich nach draußen schicken und sich dabei oftmals eines etwas harschen Tones bedienen, den die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung allerdings schon gewohnt waren. Indes kam es Loulou zu, trotz der allgemeinen Nervosität Ruhe und gute Laune zu verbreiten. Bevor Pierre seines Amtes waltete, würde sie ein letztes Mal Hand anlegen, Hüte auf den Köpfen der Vorführmädchen richten, Schals zurechtzupfen, Ketten arrangieren, Falten oder Manschetten überprüfen und dabei ausführen, was sich Yves Saint Laurent wünschte: Nichts sollte die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Detail ziehen, die Blicke mussten gleichmäßig von den Schultern bis zum Saum wandern. Gerade Linien zeichneten seine Entwürfe für Frühjahr und Sommer aus, zum ersten Mal brachte er elegante Seidenpyjamas für drinnen und draußen, Tag und Abend.
Durch einen Spalt im beigen Vorhang, der an dem Triumphbogen befestigt war, spähte Loulou zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Deren Urteil entschied über Erfolg oder Niederlage in jeder Saison. Benahmen sich alle gelassen? Oder herrschte eine negative Stimmung? Lag eine gewisse Vorfreude über der Szenerie? Was war das nur für ein plötzlich hektisches Flüstern zwischen manchen Leuten?
Loulou fiel Eugenia Sheppard vom International Herald Tribune auf einem der bestplatzierten Stühle auf. Die über siebzigjährige Ikone des Modejournalismus wirkte mit ihrer blondierten, toupierten Frisur über einem freundlichen Gesicht und in einem pastellfarbenen Kostüm von Chanel einfach nur wie irgendeine nette wohlhabende Dame. Doch der Schein trog – Loulou wusste, wie bissig gerade diese Kolumnistin sein konnte: Vor zwei Jahren hatte die Amerikanerin Yves’ Mode »abscheulich« genannt, was einen verheerenden Misserfolg nach sich zog. Nicht nur die Saison damals war schlecht gelaufen, Yves hatte sich daraufhin zunächst geweigert, jemals wieder Haute Couture während der Pariser Modewoche zu präsentieren, und sich erst vor Kurzem umstimmen lassen. Aber heute, bei der ersten Show seit jener schicksalhaften Saison, wirkte Eugenia entspannt, als könnte nichts ihre Laune trüben, und sie lächelte versonnen. An welch glückliches Ereignis sie sich auch erinnern mochte, es war ein gutes Zeichen, dass sie keine schlechten Gedanken hegte. Eine stille Heiterkeit lag auf den Zügen der alten Dame, und das beruhigte auch Loulou.
»Offensichtlich hat Madame Sheppard die Neuigkeit noch nicht erreicht«, flüsterte eine Frauenstimme in Loulous Rücken.
Überrascht fuhr Loulou herum. »Was ist los, wovon sprichst du?«
Clara Saint stand hinter ihr, eine klassisch schöne, etwas herbe Blondine, ihres Zeichens Pressechefin der Prêt-à-porter-Kollektion Rive Gauche und enge Freundin. Sie schlug sich die Hand vor den Mund. »Oh, du weißt es auch noch nicht? Dann habe ich ja Hoffnung, dass Yves erst nach der Show erfährt, was passiert ist.«
Stumm hob Loulou die Schultern.
»Es geht um den Tod von Talitha«, raunte Clara. »Die Behörden in Rom haben eine neue Untersuchung eingeleitet. Paul Getty soll zur Befragung vorgeladen werden.«
»Aber die Staatsanwaltschaft hat ihn doch bereits …«
»Die italienische Presse setzte die Ermittler wohl unter Druck«, unterbrach Clara leise. »Es scheint neue Erkenntnisse zu geben, wie sie verstorben ist und dass der Totenschein zu leichtfertig ausgestellt wurde. Die Vermutungen, dass irgendjemand ihr eine tödliche Dosis Heroin gespritzt haben könnte, werden in den Klatschspalten so oder so wieder hochkochen, was auch immer die Polizei herausfindet.«
Mit ihrem unerschütterlichen Hang, selbst schlechte Nachrichten in ein positives Licht zu wenden, erwiderte Loulou: »Ich bin sicher, Paul wird beweisen können, dass an den Gerüchten kein Funken Wahrheit ist.«
»Keine Ahnung, ob er das kann. Jedenfalls befindet er sich auf der Flucht.«
Loulou schnappte nach Luft. Was immer John Paul Getty II. bewogen haben mochte, sich einer Aussage vor den italienischen Behörden zu entziehen, es war fatal. Alles Mögliche konnte in sein Verhalten hineininterpretiert werden, und sicher betrachteten es manche Leute als ein Schuldeingeständnis. War Paul verantwortlich für den Tod seiner Frau? Nur er wusste, was damals geschehen war, aber bisher schwieg er beharrlich. Falls sich Yves Saint Laurent so kurz vor seiner Präsentation mit dieser Frage auseinandersetzen müsste, käme dies einer Katastrophe gleich. Immerhin waren Talitha und Paul seine besten Freunde gewesen. Der plötzliche Tod von Talitha vor eineinhalb Jahren hatte ihn stark mitgenommen. Wenn man den Fall nun neu aufrollte, war ein Zusammenbruch des nicht sonderlich nervenstarken Modeschöpfers unausweichlich.
Unwillkürlich flogen Loulous Augen zu dem nur mittelgroßen Mann in einem exzellent geschnittenen Blazer, der zwischen den Mannequins stand und Nummern verteilte wie ein Oberster Richter Gesetzesblätter. »Weiß Pierre es schon?«
»Er bat mich, die Sache von Yves fernzuhalten.«
Loulou ließ sich nicht anmerken, wie schockiert sie selbst über die Nachricht war. Nicht nur die Sorge um das Seelenheil ihres Freundes Yves trieb sie um. Die unter mysteriösen Umständen verstorbene Talitha Getty hatte Loulous Leben lange begleitet. Anfangs war sie allgegenwärtig wie ein langer Schatten gewesen, später wurde sie zur Freundin und schließlich zu einem ersten Bindeglied zu Yves Saint Laurent. Angefangen hatte alles lange vor ihrer ersten persönlichen Begegnung in einem wenig aussichtsreich scheinenden Winter …
ERSTER TEIL
Die meisten Frauen wählen ihr Nachthemd mit mehr Verstand aus als ihren Mann.
Coco Chanel
London
1966
London
1
»Ich verstehe wirklich nicht, warum du nicht ein wenig mehr Interesse an deinen Ballettstunden zeigst«, meinte Lady Rhoda Birley empört, während sie ihre Teeschale so energisch auf der Untertasse absetzte, dass das Porzellan klirrte.
Durch das Geräusch aus ihrer Lethargie geweckt, zuckte ihre Enkeltochter zusammen. Für die achtzehnjährige Louise Le Bailly de la Falaise war die Teestunde mit ihrer Großmutter immer ein wenig ermüdend – aber andererseits hatte sie in ihrem Alltag ansonsten wenig Ablenkung. Von dem, was alle Welt das SwingingLondon nannte, war sie in diesem Haus in St John’s Wood im Norden der Stadt weit entfernt. Und Rhoda war so exzentrisch, dass sie gar nicht wahrnahm, was sich ein junges Mädchen wie Loulou eigentlich wünschte. Die Ballettstunden waren es jedenfalls nicht …
Gemeinsam mit einer Freundin, der vor vierzig Jahren berühmten Ballerina Marie Rambert, hatte Rhoda eine Ballettausbildung für Loulou beschlossen, ohne sich um deren Zustimmung zu scheren. Ihre zarte Gestalt sei wie geschaffen dafür, ihr schönes Gesicht zudem eine Augenweide für jeden Zuschauer. Bla, bla, bla! In wohlwollenden Momenten dachte Loulou, dass Rhoda ihr auf diese Weise eine geregeltere Zukunft schenken wollte als das, was ihr ihre unstete Mutter vorlebte. Was genau Maxime de la Falaise zurzeit machte, war Loulou nämlich nicht ganz klar: Sie war Fotomodell, Autorin, Muse, Schauspielerin … Dass der berühmte Cecil Beaton sie einmal »die einzig wirklich elegante Frau Englands« genannt hatte, fand sie allerdings beeindruckend – vor allem da er Hoffotograf war und sowohl Königin Elizabeth als auch Prinzessin Margaret vor der Kamera gehabt hatte. Maxime war wunderschön, aber ichbezogen und flatterhaft, ihre Ehe mit dem französischen Grafen Alain de la Falaise wurde nach vier Jahren, zwei Kindern und etlichen Affären geschieden. Unbeeindruckt von irgendwelchen familiären Verpflichtungen zog Maxime nach New York, wo sie sich inzwischen als Förderin der Pop-Art hervortat.
Jedenfalls wollte das Ansinnen von Madame Rambert und Rhoda hinsichtlich Loulous beruflicher Zukunft nicht so recht fruchten, und das größte Problem war nicht einmal mangelndes Talent oder Loulous geringe Begeisterung, sondern ihr Alter. In den Jahren, in denen kleine Mädchen üblicherweise mit dem Ballettunterricht begannen, hatten sich ihre Eltern scheiden lassen und sie in ein kleinbürgerliches Internat gesteckt, wo niemand an klassischen Tanz dachte. Und nun war sie deshalb im Anfängerkurs mehr als doppelt so alt wie die anderen Elevinnen, mit denen sie an der Stange Pliés übte. Nicht nur dass sie sich im Training mit süßen Ballettratten wiederfand, sie wurde von Rhoda jeden Abend um neun Uhr ins Bett geschickt, als wäre sie ein Kind wie die anderen. Der Hintergrund war wohl, dass die Großmutter um Loulous Tugend fürchtete. Nur ein unberührtes junges Mädchen würde eines Tages einen geeigneten Mann finden.
Seit einigen Monaten wohnte Loulou in dem viktorianischen Haus der Birleys und fühlte sich einsam – sie kannte keine Gleichaltrigen von gemeinsamen Schulbesuchen, aus Sportclubs oder Ähnlichem. In den gehobeneren Kreisen ihrer Großmutter sorgten üblicherweise aufmerksame Familienmitglieder für einen passenden Umgang, aber Rhoda verschwendete keinen Gedanken an so etwas – sie hatte das Debüt ihrer Enkeltochter schlichtweg vergessen. Deshalb befand sich Comtesse Louise Le Bailly de la Falaise auch nicht auf der relevanten Liste der Times, wo die in dieser Saison eingeführten Debütantinnen aufgeführt wurden. Loulou erhielt somit auch keine Einladungen zu Partys und Picknicks, Pferderennen und Ausstellungseröffnungen. Es wusste ja niemand von ihrer Existenz.
»Ich habe keine Lust auf die Ballettstunden«, schmollte sie.
»Hm.« Rhoda musterte sie mit demselben charakteristischen scharfen Blick, mit dem sie auch die Rosen im Garten ihres Landsitzes in Sussex nach Schädlingen absuchte. Ihre Pflanzen waren ihr Ein und Alles, und in den dunklen Monaten des Winters kompensierte sie das Fehlen ihrer geliebten Blüten mit schrillen Farben, in die sie sich kleidete. Während eines Aufenthalts in Indien, als ihr Mann Mahatma Gandhi porträtierte, hatte sie ein Faible für leuchtend bunte Stoffe entwickelt. Doch nicht einmal all das Smaragdgrün und Purpur täuschten über das britische Wetter hinweg, und die Farben kaschierten auch nicht die kühle Distanz, die sie zu ihren Mitmenschen aufbaute, auch zu Tochter und Enkelin.
»Dann werden wir uns auf deine anderen künstlerischen Fähigkeiten konzentrieren müssen. Sofern vorhanden.«
Natürlich, dachte Loulou grimmig, ich kann nichts und bin ein Niemand.
Schlimmer noch: Sie selbst wusste nicht so richtig, wohin mit sich. Mit vierzehn Jahren war sie aus dem x-ten Internat geflogen, diesmal im schweizerischen Gstaad, weil sie einen verletzten Berner Sennenhund von der Straße aufgelesen und in den Schlafsaal mitgenommen hatte. Dann hatte sie auf Veranlassung ihres Vaters das nächste Flugzeug nach New York bestiegen, um fortan bei ihrer Mutter zu leben. Diese Lösung war Alain Le Bailly de la Falaise lieber gewesen, als sich selbst um seine Tochter zu kümmern. Maxime schenkte Loulou zwar keine Geborgenheit, aber sie führte sie in Manhattan ein: Trotz ihres Schulbesuchs im Lycée Français jobbte sie in der Galerie von Alexander Iolas, dem Kunsthändler von Max Ernst, René Magritte, Andy Warhol und anderen. Für einen Teenager eine tolle Zeit, die zudem ihr Auge für die schönen Künste sowie für Farben und Formen schulte. Doch dann schickte Maxime Loulou nach London – und hier saß sie nun, beim Tee mit Rhoda, deren großmütterliche Fürsorge noch weniger ausgeprägt war als Maximes Hinwendung als Mutter.
»Du schreibst doch Gedichte, nicht wahr?«
Alles in Loulou bereitete sich auf eine Gegenwehr vor. Was immer ihre Oma von ihren Schreibversuchen hielt, sie wollte es nicht wissen. Die Zeilen waren nur für sie selbst bestimmt, ein Ausdruck ihrer Gefühle – und teilweise ziemlich rebellisch. Ihre Gedichte waren wie ein Ventil für ihr unglückliches Dasein, allein Rhoda beschrieb sie darin häufig nicht gerade schmeichelhaft. Es waren Worte, die sie an einen imaginären Zuhörer richtete, sie waren nicht für reale Ohren bestimmt.
»Ich frage mich«, fuhr Rhoda fort, »ob es nicht eine gute Idee wäre, wenn wir dein Talent als Autorin präsentierten. Eine Lesung scheint mir eine gute Idee.«
Blankes Entsetzen erfasste Loulou. »Nein, bitte nicht!«
»Warum denn nicht? Alle möglichen Schriftsteller halten andauernd Lesungen. Leider auch solche, die es besser bleiben lassen sollten.«
»Eben!«, gab Loulou patzig zurück, »deshalb lasse ich es.« Sie wusste nicht, was schlimmer war: Sätze zu rezitieren, die sie nur für sich geschrieben hatte, oder ihre intimsten Gedanken vor Wildfremden auszubreiten. »Ich schreibe nicht für die Öffentlichkeit!«
»Sei nicht albern.« Wieder klapperte das Porzellan. »Wenn du nur für dich schreiben willst, führe ein Tagebuch. Gedichte sind nichts, was man für sich behält. Im Grunde ist doch jeder künstlerische Ausdruck für die Öffentlichkeit bestimmt, oder?« Die Frage war reine Rhetorik, Rhoda erwartete gewiss keine Antwort.
»Nein!«, stieß Loulou hervor.
»Wovor hast du Angst? Oscar Wilde sagte einmal: ›Sich durch Poesie ruiniert zu haben, ist eine Ehre.‹ Halte dich daran und werde eine Frau von Ehre!«
Loulou war bewusst, dass sie der einmal gefassten Meinung ihrer Großmutter nur wenig entgegensetzen konnte. Woher wollte Rhoda überhaupt wissen, dass Loulou sie nicht furchtbar blamieren würde?
»Du hast neulich ein Heft im Wintergarten liegen lassen, und ich habe ein wenig darin geblättert. Das war gar nicht so schlecht. Ich würde sogar sagen, dass deine Gedichte in Teilen wundervoll waren. Sofern man moderne Literatur mag.«
»Trotzdem möchte ich nichts daraus lesen«, beharrte Loulou. Sie war hin- und hergerissen zwischen ihrer trotzigen Unsicherheit und dem Stolz über das unerwartete Lob.
»Mein liebes Kind, sei nicht so egoistisch. Irgendetwas musst du schließlich tun, und die Birleys haben die Kunst im Blut. Überdies bin ich bekannt dafür, junge Talente zu entdecken.«
Das stimmte, räumte Loulou in Gedanken ein. Lady Birley veranstaltete seit dreißig Jahren auf ihrem Landsitz Charleston Manor das mehrwöchige Sussex Festival für Literatur. Doch wäre es nicht ein Imageverlust, wenn ausgerechnet die Lyrik ihrer Enkeltochter bei ihrem handverlesenen Publikum durchfiele? Loulou hoffte, endlich ein Argument gefunden zu haben, das gegen ihren Vortrag sprach.
»Ach was!«, wehrte Rhoda ab. »Wenn du gemeinsam mit meiner Freundin Iris Tree auftrittst, wird die Qualität deiner Gedichte gar nicht auffallen. Die allgemeine Aufmerksamkeit wird sich auf Iris richten. Es ist also abgemacht. Möchtest du noch etwas Tee, meine Liebe?«
Wenn es etwas gab, das sich in den Frauen ihrer Familie weitervererbte, so war es der Eigensinn. Loulou hatte nicht die Absicht, aufzugeben – ihr gingen nur langsam die Ideen aus, womit sie ihrer Großmutter widersprechen konnte.
Ein Gedanke blitzte in ihrem Kopf auf. Während sie die Möglichkeiten erwog, strich sie sich das glatt gebürstete kupferrote Haar hinter das Ohr und erklärte: »Ich bin mit einer Lesung nur einverstanden, wenn du außer deinen Freunden genauso viele Leute in meinem Alter einlädst!« Niemals würde ihre Großmutter in ihrem Haus eine Horde unbekannter Teenager bewirten.
Rhoda sah sie verblüfft an. Sie zog die Augenbrauen zusammen und überlegte. Es dauerte eine Weile, bis sich ihre Züge entspannten, aber dann lächelte sie. »Das ist eine vortreffliche Idee, Louise. Ich werde mir gleich ansehen, wer für die Gästeliste infrage kommt. Erinnerst du dich, wo ich die neue Ausgabe des London Life-Magazins mit den Fotos dieser unsäglichen Debütantinnenbälle hingelegt habe?«
Unwillkürlich wartete Loulou darauf, dass Rhoda über ihren eigenen Witz zu lachen begann. Doch hatte sie den Humor ihrer Großmutter überschätzt.
2
Nach dem ersten Schrecken war Loulou überzeugt davon, dass es undenkbar war, so viele fremde junge Leute um sich zu versammeln. Das war genauer betrachtet noch schlimmer als eine Lesung ihrer Gedichte vor den Freunden ihrer Großmutter.
Worüber sollte sie mit der Londoner Jugend sprechen? Sie war unter völlig anderen Bedingungen aufgewachsen, ihre Mutter war in keinem der bekannten Wohltätigkeitskomitees aktiv, Loulou hatte keines der altehrwürdigen Internate besucht, kannte sich kaum mit Pferderennen aus, und ihr höchstes Ziel war nicht die Vorstellung bei Hofe. Sie befürchtete, die Aussätzige auf ihrer eigenen Party zu sein. Allerdings: War es wirklich vorstellbar, dass die jungen Leute der Einladung einer ihnen unbekannten alten Frau einfach so folgten? Es waren immerhin Teenager aus den vornehmsten Familien, deren Namen Rhoda aus einem Gesellschaftsmagazin herausgesucht hatte.
Loulou beschloss, sich keine Sorgen mehr zu machen. Wahrscheinlich kam ohnehin niemand – und am Ende war das die Pointe, über die Rhoda herzlich lachen würde.
*
Schwankend zwischen Hoffnung und Unsicherheit trug sie an jenem frühen Abend ihre Gedichte artig vor den Freunden ihrer Großmutter vor. Die bekannte Poetin Iris Tree war so liebenswürdig, Loulous Lyrik als »vielversprechend« zu bezeichnen, was nett gemeint war, aber vermutlich niemanden überzeugte. Für Loulou war Iris ein ebenso alter Kauz wie die anderen recht betagten Gäste der Lesung. Die Dame war fast siebzig und hatte ihre abenteuerlichste Zeit lange vor dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Selbst ihre Rolle in Federico Fellinis La Dolce Vita lag schon eine Weile zurück.
In Loulous eigenen Ohren klangen ihre Verse plötzlich wie die kitschigen Ergüsse eines aufsässigen Teenagers ohne Ziel und Vernunft, von Verstand ganz zu schweigen. Da war nichts mehr von hehrer Rebellion, wie sie ursprünglich gedacht hatte, sondern nur noch Depression. Der Ehrengast von Lady Birley, der aktuelle Vorsitzende der Konservativen Partei, Edward Heath, lächelte zwar wohlgesinnt, doch Loulou war überzeugt, sich nach der Peinlichkeit ihres Vortrags für eine spätabendliche Party wappnen zu müssen, zu der niemand kam.
Zwei Stunden später stand sie wider Erwarten im Mittelpunkt einer großen Gruppe Gleichaltriger und etwas älterer Begleiter – und fühlte sich so schüchtern wie nie zuvor. Die meisten jungen Frauen und Männer waren wohl aus Neugier auf die unbekannte Comtesse gekommen. Vielleicht nutzten die Teens und Twens aber auch nur jede Gelegenheit zu einem Treffen in einer für ihre Eltern respektablen Umgebung. Jedenfalls begann ein rauschendes Fest im alten Atelier ihres Großvaters, bei dem Loulou zunächst mehr staunend zusah als mitwirkte.
In der gleichaltrigen Camilla Shand hatte sie gleich zu Beginn der Party eine Schwester im Geiste gefunden. Dabei verband sie eigentlich nichts: Camilla war die Tochter eines Landadeligen, schien wenig an Kunst und Mode interessiert und war auch nicht besonders auf ihr Äußeres bedacht, dafür besaß sie aber eine von Herzen kommende Fröhlichkeit, war neugierig auf das Leben und scherte sich wenig um Konventionen; über ihr Debüt in der vorigen Saison und ihren derzeitigen Job bei einem Raumausstatter sprach sie wenig, dafür aber umso mehr über ihre Pferde, ihre Neugier auf das Leben und die Liebe. Und dann waren da noch die Geschichten über ihre Urgroßmutter Alice Keppel, die als einflussreiche Mätresse König Edwards VII. von England berühmt geworden war. »Sie sagte immer, eine königliche Geliebte gehört ins Bett«, erzählte Loulous neue Freundin, »und ich möchte gerne herausfinden, was das ist, durch das große Männer so verzaubert werden. Wer weiß, vielleicht macht es ja sogar Spaß.«
»Ohne verheiratet zu sein?«, entfuhr es ihr.
»Natürlich. Wir leben in den Sechzigern!«
Loulou war so damit beschäftigt, sich von dem ungewöhnlichen Hinweis zu erholen, dass sie den Hünen nicht gleich bemerkte, der verspätet eintraf. Er füllte den Raum mit seiner Persönlichkeit aus, war groß, blond und attraktiv auf eine erwachsene Art, nicht so glatt und angepasst wie die anderen Jungen und Mädchen, die alle aussehen wollten wie Paul McCartney oder John Lennon. Er schien älter als die meisten anderen Gäste zu sein, wirkte auf eine altmodische Art aristokratisch, dabei gelassen und fast überheblich. Sein Anzug sah aus wie ein Requisit aus einem Film über den britischen Landadel der Zwanzigerjahre. Viele der Anwesenden kannten ihn offenbar und begrüßten ihn mit einer Wiedersehensfreude, als wäre er gerade von einer ebenso langen wie weiten Reise zurückgekehrt.
»Das ist Desmond FitzGerald«, flüsterte Camilla in Loulous Ohr. »The Knight of Glin. Sein Anwesen liegt irgendwo im Nirgendwo in Irland. Nimm dich in Acht vor ihm: Er steht auf so fragile Frauen wie dich. Zuletzt hatte er eine Affäre mit Jane Birkin. Und davor mit Talitha Pol.«
Loulou hörte kaum hin, fasziniert von dem hochgewachsenen Mann, der just in diesem Moment direkt auf sie zukam. Stimmengewirr, Gelächter und Gläserklirren schienen weit weg, Camillas raue Stimme klang wie durch Watte. »Wer ist Jane Birkin?«, murmelte Loulou. Der andere Name klang zu fremd, um sich in diesem Moment der Verwirrung in ihr Hirn einzugraben.
»Eine Schauspielerin von hier, die gerade für ihre erste oder zweite Rolle gefeiert wird.«
»Oh …!« Loulou brach vor Verlegenheit in schallendes Gelächter aus. Sie lachte und lachte, als hätte Camilla einen vortrefflichen Witz gemacht.
»Guten Abend, Comtesse Le Bailly de la Falaise.« Desmond FitzGerald verneigte sich formvollendet. Dann nickte er Camilla zu: »Miss Shand.«
»Ich bin Loulou«, kicherte sie.
»Man sagte mir, dass Sie Louise heißen.«
»Loulou genügt völlig.«
»Meine Freunde nennen mich Knighty.«
Sie blickte in seine meerblauen Augen. »Hallo, Knighty.«
Der Ritter lächelte charmant – und drehte sich einen Joint. Loulou war hingerissen.
»Bitte entschuldigen Sie meine Verspätung, ich musste leider noch auf eine Telefonverbindung mit den Staaten warten. Ein Freund in New York brauchte meinen Rat.«
Loulou hing an Desmond FitzGeralds Lippen, als er von seinem kürzlich beendeten Studium in Harvard erzählte, das mit vielen Besuchen in Manhattan verbunden gewesen war. Sie stellte fest, dass er viele Orte, die ihr vertraut waren, ebenfalls kannte. Vor allem die Galerien im East Village hatten sie beide – jeder für sich – irgendwann besucht, und sie tauschten sich über besondere Ausstellungen aus. Dann forschten sie in ihren Erinnerungen, ob sie womöglich schon einmal zur selben Zeit am selben Ort gewesen waren, vielleicht als Gäste einer Vernissage. Einer von Desmonds besten Freunden war Kurator im Metropolitan Museum of Art, und Desmond selbst würde demnächst im Victoria and Albert Museum in London anfangen: John McKendry arbeitete in der Abteilung für Fotografie, Desmond indes bei den antiken Möbeln.
Sie redeten und redeten, und Loulou wunderte sich, wie viel sie einem Fremden erzählen konnte. Dabei bemerkte sie nicht, dass sich Camilla diskret entfernte. Erst viel später in dieser Nacht wurde ihr bewusst, dass sie ihre Pflichten als Gastgeberin verletzte, indem sie ausschließlich dem ihrer Ansicht nach bewundernswertesten Mann diesseits und jenseits des Atlantiks ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte.
3
Als Loulou am darauffolgenden Nachmittag erwachte, drehte sie sich in ihrem Bett auf den Rücken, blickte sich in ihrem Zimmer um und fühlte sich zum ersten Mal in London zu Hause.
In ihrer Kindheit war es einmal ähnlich gewesen, als sie beim Bruder ihrer Mutter und vor allem dessen Frau Geborgenheit und Zuwendung erfahren hatte. Ihre Ferien während der frühen Jahre im Internat waren stets wundervoll – bis ihr Vater dafür sorgte, dass sie Mark und Annabel Birley nicht mehr besuchen durfte. Dieser Anfall von Eifersucht bedeutete freilich nicht, dass er sich anschließend um Loulou kümmerte; es ging Alain nur darum, dass sie niemanden zu sehr in ihr Herz schloss, schon gar nicht mehr als ihn. Er erwarb sich damit jedoch nicht ihre Liebe, und die Einsamkeit aufgrund seines unsinnigen Handelns vergaß sie ihrem Vater nie.
Seit gestern Abend besaß sie neue Freunde, die ihr Alain nicht nehmen konnte. Die meisten ihrer Gäste hatten zum Abschied mit schwerer Zunge genuschelt, dass Loulou mit einer Gegeneinladung rechnen könne und man sich auf der einen oder anderen Cocktailparty wiedersehen werde. Zwar waren alle betrunken oder anderweitig benebelt gewesen, aber sie bezweifelte nicht die Ernsthaftigkeit der Versprechen. Am nachhaltigsten war ihr der altmodische Handkuss in Erinnerung geblieben, mit dem sich Desmond FitzGerald verabschiedet hatte. Wenn sie sich Mühe gab, spürte sie noch Knightys Lippen auf der Haut.
Die Teestunde mit Rhoda wurde zu Loulous Frühstück. Entzückt betrachtete sie die vielen Blumen, die im Lauf des Tages für Lady Birley geliefert und von dem Hausmädchen auf dem Kaminsims, dem Sideboard und auf Beistelltischen arrangiert worden waren. Es war wie der Einzug des Frühlings an einem grauen Wintertag. »Das sind die Danksagungen meiner Gäste«, erklärte Loulous Großmutter. »In den beiliegenden Karten wird deine Lesung stets sehr wohlwollend bedacht.«
Loulou nickte geistesabwesend. Eigentlich hatte sie nicht nur den alten Knackern gefallen wollen …
Die Teekanne war fast leer, die Kerze im Stövchen heruntergebrannt, als der Butler einen Strauß leuchtend gelber Rosen brachte. Er überreichte Lady Birley die Karte und stellte die Vase auf die Fensterbank.
»Oh!« Rhoda rückte ihre Brille zurecht. »Wie nett! Der Knight of Glin bedankt sich für einen bezaubernden Abend. Bezaubernd ist ein Zitat.« Sie legte das Billett neben ihr Gedeck auf den Tisch.
Loulou schnappte sich die Nachricht, warf einen Blick darauf und legte sie mürrisch wieder weg. »Desmond war mein Gast! Warum bedankt er sich nur bei dir?«
»Weil er Stil hat, mein Kind.«
»Er erwähnt mich mit keinem Wort!« Die Enttäuschung nagte an ihr. »Ich finde das sehr unfreundlich von ihm.«
»Das ist Ansichtssache.« Rhoda erhob sich von ihrem Platz. »Ich habe noch zu tun. Willst du dir nicht auch eine sinnvolle Beschäftigung suchen?«
*
Loulou verbrachte den Rest des Nachmittags im Bett. Sie blätterte in einem neuen Exemplar des Queen-Magazins und in der britischen Ausgabe von Harper’s Bazaar. Sie sah sich Fotos der jungen amerikanischen Filmschauspielerin Sharon Tate an, die gerade von ihren ersten Dreharbeiten mit Deborah Kerr und David Niven aus London abreiste. Was für eine wunderschöne Frau! Auch Loulou sehnte sich so sehr nach Schönheit und Erfolg. Doch kam es ihr vor, als wäre ihre Mutter mit diesen Attributen dermaßen im Überfluss beschenkt worden, dass das Schicksal nichts mehr für sie übrig hatte.
Vor allem aber wünschte sie sich die Aufmerksamkeit von Desmond FitzGerald.
Doch allzu lange musste sie nicht warten, schon der nächste Vormittag lehrte sie, auf die Kraft ihrer Gedanken zu vertrauen: Ihr wurde eine einzelne rote Rose gebracht, an deren Stiel ein kleines Kuvert gebunden war. Loulou zog die Seidenschleife auf, um die Karte zu entnehmen. Unter einem in das schwere Büttenpapier geprägten Wappen hatte Desmond in flüchtiger Schrift mit dem Füller eine Einladung hingeworfen: »Louise, wollen wir heute Abend acht Uhr im Star of India essen? Ich hole dich ab. D.«
Im Grunde nahm er seiner Frage die Antwort voraus. Seine höfliche Direktheit ließ ihr keine Wahl – und sie wollte es auch nicht anders. Vielleicht war diese Deutlichkeit ja ein Ausdruck der Sechzigerjahre, über die Camilla gesprochen hatte. Unwillkürlich fragte sich Loulou, ob sie gleich mit Desmond ins Bett gehen würde. Sie kannte ihn kaum, aber spontan ging ihr ein lautes JA durch den Kopf.
Als würde sie ihn auf diese Weise besser kennenlernen, unterzog sie die Heraldik seiner Familie einer genauen Betrachtung. Der bewaffnete Eber und daneben zwei Greifvögel mit Kragen und Ketten vor einem normannischen Schild wirkten ziemlich martialisch. Sie rief sich Desmonds länglich-schmales Gesicht ins Gedächtnis, erinnerte sich an die weichen Züge um seinen Mund. Obwohl seine Persönlichkeit allein durch die Körpergröße raumfüllend war, stand sein sanfter Blick in einem deutlichen Kontrast zu seiner anscheinend düsteren Familienchronik.
Beim Tee erklärte Loulou ihrer Großmutter, dass sie am Abend ausgehen würde.
»Achte auf deinen Ruf«, erwiderte Rhoda, »schließlich bist du gesellschaftlich seit ein paar Tagen kein unbeschriebenes Blatt mehr. Wer hat dich eingeladen?«
Stumm reichte Loulou ihr die Karte, die sie fast den ganzen Tag lang in der Hand gehalten und mit sich herumgetragen hatte.
»Ah, sehr gut!«, sagte Rhoda. »Gegen deinen Umgang ist nichts einzuwenden. Die FitzGeralds sind eine der ältesten Familien Irlands. Es gab Gerede, als sich Desmond diese wunderschöne Schauspielerin … Wie hieß sie doch gleich …?« Rhoda legte die Stirn in Falten, was anscheinend hilfreich war, denn sie fuhr sogleich fort: »William Pol ist ihr Vater. Ja. Jetzt erinnere ich mich: Sie heißt Talitha. Ungewöhnlicher Name, nicht wahr? Nun ja, eigentlich ist sie Holländerin, ist aber hier aufgewachsen. Also, es gab Gerede, als sich Desmond FitzGerald dieses Mädchen von John Paul Getty ausspannen ließ. Aber ein Ölimperium hat auf manche Mädchen vermutlich eine größere Anziehungskraft als ein altes Schloss im Südwesten Irlands. Immerhin soll dieser Getty blendend aussehen.« Ihre Sicht der Dinge war nicht nur durch ihren abfälligen Ton erkennbar, sondern wurde mit Kopfschütteln bekräftigt.
Zweifellos besaß Desmond eine Neigung zu sehr schönen jungen Frauen, Leinwandstars waren ja eigentlich immer schön. Loulou indes fühlte sich im Angesicht dieser Konkurrenz mehr wie ein hässliches Entlein als jemals zuvor.
Sie überlegte sich, was Desmond bloß an ihr finden konnte. War er nur auf der Suche nach ein wenig Ablenkung, nach einer Alternative zu der Leere, die erst eine neue Freundin von der Bühne oder vom Film ausfüllen könnte? Flirtete er mit ihr, weil er sich langweilte? Sie war hin- und hergerissen zwischen einem inneren Glühen und lähmender Unsicherheit und ärgerte sich, weil sie sich als Lückenbüßerin fühlte. Vor allem aber beschäftigte sie länger als nötig die Frage, was sie zu ihrer Verabredung anziehen sollte. Stundenlang probierte sie Kleider, Röcke und Blusen, tauschte eigentlich zusammengehörende Ensembles zu bunten Mischungen und war letztlich doch nicht zufrieden mit ihrem Spiegelbild. Rhoda hatte ihr erklärt, dass das Star of India ein ebenso ausgezeichnetes wie respektables indisches Restaurant im noblen South Kensington war, weshalb sich Loulou schließlich für eine etwas konservativere Garderobe entschied. Ihr Minikleid war nicht ganz so kurz wie der letzte Schrei und der Stoff nicht so farbenfroh, dazu wählte sie als kleinen Stilbruch hohe Lederstiefel. Sie striegelte ihre Locken, bis ihr halblanger, von einem Mittelscheitel geteilter Bob ihr blasses Gesicht glatt und seidig umrahmte.
Bei der erneuten Betrachtung ihres Spiegelbildes war sie noch immer nicht zufrieden. Ich sehe aus wie eine langweilige Britin, stellte sie fest. Am liebsten hätte sie sich noch einmal umgezogen – doch dafür blieb keine Zeit. Das Hausmädchen klopfte und meldete, Mr. FitzGerald sei eingetroffen und warte im Salon.
*
Loulou nahm das Aufleuchten in seinen hellen blauen Augen wahr und mochte kaum glauben, dass es ihrer Erscheinung galt. Seine Begrüßung im Beisein ihrer Großmutter indes war so formvollendet wie die eines Kavaliers aus der Regency-Ära.
Als er sie in seinem Cabriolet von Nord nach Süd durch die Stadt fuhr, war Loulou zu schüchtern und zu aufgeregt für Konversation. Desmond spürte das wohl und machte sie in einer leutseligen Art auf die Sehenswürdigkeiten aufmerksam, die sie passierten: das Abbey Road Studio etwa, wo das London Symphony Orchestra ebenso Platten aufnahm wie die Beatles oder Cliff Richard und Shirley Bassey. Vor dem Gebäude, das im gelben Licht der Straßenlaternen wie ein Wohnhaus aussah, lungerten ein paar Jugendliche herum, Fans, deren Zigarettenspitzen in der Dunkelheit wie Glühwürmchen in heißen Sommernächten leuchteten. Kurz darauf in der Edgware Road erzählte Desmond von vielen Franzosen, die sich hier im 18. Jahrhundert niedergelassen hatten. Sie verstand diesen Ausflug in die Geschichte als Nettigkeit gegenüber dem französischen Zweig ihrer Familie. Wie nebenbei wollte Desmond wissen, ob Loulou Protestantin sei, und sie stellten fest, dass sie beide römisch-katholisch getauft worden waren. Als dies geklärt war, berichtete er, dass sich die Anwohnerschaft der Edgware Road inzwischen gewandelt hatte und hier mehr Araber als Hugenotten lebten.
Dann passierten sie den Bahnhof Paddington, und Desmond zitierte aus der berühmten Geschichte des kleinen Bären, der an dieser Haltestelle ausgesetzt worden war: »Mrs. Brown sagt, dass in London jeder anders ist, und das bedeutet, dass jeder anders sein darf …«
»Mir gefällt, dass Paddington-Bär für den Notfall immer ein Marmeladenbrot unter seinem Hut versteckt hat«, antwortete Loulou lächelnd.
»Und was befindet sich unter deiner Kopfbedeckung?«
Sie hob ihre Hand zu dem Turban, den sie sich vor Verlassen des Hauses noch rasch aus einem Schal geschlungen hatte. »Nur mein Kopf«, gab sie lachend zurück.
»Der ganz entzückend ist«, flirtete er.
Langsam verlor Loulou ihre Scheu und traute sich, etwas mehr von sich zu erzählen: »Als ich ein kleines Mädchen war, nahm mich meine Tante Gloria Swanson in Paris mit zu einer Modenschau …«
»Der Hollywoodstar Gloria Swanson ist deine Tante?«, unterbrach Desmond.
»Sie war eine Zeit lang mit dem Bruder meines Vaters verheiratet. Ich habe keine Ahnung, der wievielte ihrer Ehemänner Onkel Henri war, sie hatte so viele.« Sie freute sich, dass Desmond in ihr Lachen einfiel. Und sie war ein bisschen stolz, dass ihn die Filmschauspielerin in ihrer Familie beeindruckte, auch wenn Gloria Swanson schon sehr alt war. Er hörte ihr interessiert zu und gab ihr das Gefühl, nichts Falsches sagen zu können. »Jedenfalls waren wir bei der Präsentation von Madame Grès, und da sah ich zum ersten Mal diese Turbane aus Samt. Danach habe ich mir meine Schals immer so umzubinden versucht, wie ich es damals bei den Mannequins gesehen hatte.«
Es war leicht, sich auf Anhieb in ihn zu verlieben. Desmond war zehn Jahre älter als Loulou, ihn umgab jene Aura von Grandezza, die sie bereits auf den ersten Blick bewundert hatte. Er benahm sich kultiviert, wirkte dabei inzwischen jedoch überhaupt nicht mehr altmodisch, höchstens angenehm distinguiert. Während des Essens sprach er offen vom Erbe seines früh verstorbenen Vaters, das aus dem Titel und Glin Castle in der südwestirischen County Limerick bestand, erbaut im 13. Jahrhundert, dessen Park und Landwirtschaft jedoch wenig mehr als Schulden abwarfen. Der Ritter war kein Millionär, aber das machte ihn nicht weniger sympathisch, sie besaß ja selbst nicht viel mehr als einen klangvollen Namen. Ein wenig sarkastisch fügte er an, dass es die vielen Partys während einer Saison jedem leicht machten, sich kostengünstig zu betrinken. Jede Einladung bedeutete darüber hinaus einen Imbiss, und so zogen die Teens und Twens von Party zu Party. Zumindest wusste Loulou nun, was ihre Gäste angezogen hatte. Aber es störte sie nicht, wenn es nur die Drinks gewesen sein sollten, andernfalls wäre sie Desmond nicht begegnet.
An das Abendessen und ihre stundenlange Unterhaltung schloss sich kein Clubbesuch an, wie Loulou insgeheim gehofft hatte. Als Erwachsener hätte Desmond sie, die noch nicht volljährig war, bis zweiundzwanzig Uhr in eine Bar mitnehmen können, doch er brachte sie nach Hause. Immerhin meinte er auf dem Weg zu ihrer Großmutter, sie sei bestimmt schon einmal im Annabel’s gewesen. Alle Welt wusste, dass der exklusive Nightclub Mark Birley gehörte, Rhodas Sohn, und trotz ihres Alters hatte Loulou gewiss Zugang zu dem Etablissement ihres Onkels, so vermutete er.
»Wegen meines Alters gerade nicht«, erwiderte sie und wunderte sich über sich selbst, weil sie kichern musste. »Onkel Mark möchte nicht ausgerechnet meinetwegen Ärger bekommen. Das ist in Ordnung. Ich mag ihn sehr. Als kleines Mädchen habe ich die Ferien am liebsten bei ihm und Tante Annabel verbracht. Leider war das viel zu selten der Fall.«
»Deine Mutter …«
»Meine Mutter hatte nie viel Zeit«, fiel sie ihm ins Wort.
»Das kenne ich. Das kenne ich sogar sehr gut.«
Sie sah ihn von der Seite an, konnte seine Gesichtszüge im dunklen Wageninneren aber nicht erkennen. Er hatte so traurig geklungen, dass sie ihn am liebsten in den Arm genommen hätte, doch sie wagte nicht einmal, ihre Hand über die seine zu legen, die auf dem Schalthebel am Steuerrad lag.
Vor Rhodas Haus angekommen, nahm er jene Hand und führte sie an seine Lippen. »Schlaf gut und bis bald, kleine Loulou.«
»Gute Nacht, Desmond.« Sie würden sich wiedersehen, das war sicher und mehr wert als der fehlende Abschiedskuss auf den Mund, den sie jedoch schmerzlich vermisste.
Er wartete, bis der Butler öffnete. Als sie die Villa betrat, hörte Loulou in ihrem Rücken den Motor aufheulen.
4
Auf die formelle Einladung zu dem Dinner folgten Anrufe und Verabredungen, Briefe und Blumen, Besuche in Museen und Streifzüge durch Galerien, Abende in Restaurants, Theatern und Konzerten. Der illustre Titel schien Desmond mehr Türen zu öffnen, als es lediglich ein prall gefülltes Bankkonto ermöglicht hätte. Loulou war begeistert von diesem Hin und Her zwischen dem Glanz der Upperclass und dem Rausch des Swinging London der bürgerlichen Jugend. Er zeigte ihr genau die Welt, nach der sie sich gesehnt hatte.
Durch ihre Gespräche wob sich rasch ein Band um Loulou und Desmond. Ihre einsame Kindheit spiegelte sich in seinen Erinnerungen wider. Seine Mutter schien in ihrer Egozentrik eine Zwillingsschwester von Maxime zu sein, seine frühen Erfahrungen mit Kindermädchen und wechselnden Schulbesuchen deckten sich mit ihren: »Vermutlich habe ich mehr Schulen besucht, als ein Durchschnittsengländer eine warme Mahlzeit zu Abend isst«, behauptete er. Immerhin war er eine Zeit lang Internatszögling in Eton gewesen und hatte dort, ebenso wie später während seines Studiums in Harvard, viele Freunde gefunden. Atemberaubend skandalös klang seine Beziehung zu Dorothy Dean, einer dunkelhäutigen Kommilitonin, und was er von den gemeinsam verfassten Aufsätzen berichtete. Seit diesen ersten Erfahrungen schrieb er gelegentlich Texte für Zeitungen, und er bat Loulou, ihm aus ihren Gedichten vorzulesen. Von Talitha Pol, Jane Birkin oder anderen schönen Filmschauspielerinnen erzählte er nichts, sodass sich Loulous anfängliche Eifersucht vorübergehend in den Nebelschwaden auflöste, die über dem See im Hyde Park waberten, als sie sich dort zum ersten Mal aneinanderschmiegten und küssten.
Eine andere Geschichte waren seine ebenfalls an der Universität geknüpften Kontakte zu berühmten Kunstsammlern und – händlern. Trotz großer Bemühungen seinerseits wurde Desmond das Anwesen in Irland zwar nicht los, aber durch seine Bekannten in der Provence, in Florenz und auf Capri konnte er einige Wertgegenstände verkaufen, die so geschickt ausgewählt wurden, dass sein Besitz nicht an Glanz verlor, sein finanzielles Überleben aber gesichert war. Während er ihr das erzählte, saßen sie in dem italienischen Restaurant La Famiglia, und trotz der hervorragenden Küche schlich sich eine gewisse Schwermütigkeit in Desmonds Tonfall. Flüchtig befürchtete Loulou, er könnte die Rechnung nicht bezahlen, doch nach dem ersten Schrecken begegnete sie seinen Stimmungsschwankungen mit Verständnis. Wer wollte schon einen Freund, der so glatt war wie das Cover einer Schallplatte? Seine Ecken und Kanten machten ihn anziehender, und Loulou war zweifellos bereit, für ihn Teller zu waschen, wenn nötig.
Sie gingen seit etwa vier Wochen miteinander aus, als Desmond beschloss, eine Party zu veranstalten, um Loulou seinen Freunden vorzustellen. Er bewohnte eine kleine Wohnung, deren noble Adresse an der Pont Street in Belgravia über den Zustand des Anwesens hinwegtäuschte: Desmond besaß keine Küche, und es gab nur einen offenen Kamin. Das Fehlen einer Heizung tat er mit dem Argument ab, das Schloss seiner Vorfahren habe dergleichen auch nicht. Loulou konnte sich kaum vorstellen, dass sich irgendjemand aus der Jeunesse dorée in dem karg ausgestatteten Junggesellenapartment einfinden würde, aber sie hatte sich ja bereits vorher in den Partygängern Londons getäuscht. Alles schien möglich in dieser Stadt, und Aufregung und Vorfreude bescherten ihr mehrere schlaflose Nächte. Was sollte sie bloß anziehen?
Nachdem sie feststellen musste, dass sie sich die schrillen Kreationen in den Modeläden der Carnaby Street nicht leisten konnte, verbrachte sie Stunden auf dem Flohmarkt an der Portobello Road, um sich für den besonderen Anlass einzukleiden. Mit wachsender Begeisterung wanderte sie an den bunt gestrichenen oder mit rohem Backstein belassenen Häusern von Notting Hill entlang, bestaunte die Angebote von Gemüse und Obst aus dem Commonwealth, bemitleidete die exotischen Vögel in ihren Käfigen, duckte sich unter Kleiderstangen hindurch und wühlte in großen Körben mit Hüten, Schals und Tüchern unterschiedlichster Qualität. Loulou konkurrierte mit Hausfrauen aller Hautfarben sowie mit modebewussten Teens und Twens um die besten Angebote. Körperlich ging sie unter in der Menge, auch ihre Fähigkeit zu handeln war begrenzt, aber irgendwie schaffte sie es schließlich doch, sich in dem bunten Treiben zu behaupten.
An dem Stand eines alten Mannes, der eine Uschanka trug und so aussah, wie sie sich einen Russen aus dem Zarenreich vorstellte, hielt sie sich länger auf. Ein leicht von Motten befallener, aber immer noch prächtiger Persianermantel hatte es ihr angetan. Sie strich über die langen Grannen des breiten Fuchskragens, betrachtete die Nähte. Die Qualität schien gut zu sein, er würde nicht sofort in alle Teile zerfallen, wenn sie ihn trug. Der Mantel war elegant und wäre mit den richtigen Accessoires ungewöhnlich. Vor allem aber war er warm genug für den längeren Aufenthalt in einer ungeheizten Wohnung. Entschlossen zog sie ihn über, dann betrachtete sie sich in dem fleckigen, an einer Ecke zersplitterten Standspiegel, den der Händler aufgestellt hatte. Jede Skepsis war bei ihrem Anblick dahin.
»Sie sehen aus wie eine echte Lady«, schmeichelte der Mann.
Loulou erwiderte nicht, dass sie von adeliger Herkunft war. Aber er hatte recht: In der knöchellangen Hülle wirkte sie wie eine Wiedergeburt Katharinas der Großen. Oder wie Elisabeth I. von England. Die hatte, wenn sie die Porträts der Königin richtig in Erinnerung hatte, sogar dieselbe Haarfarbe wie sie. Der Gedanke an das Empire brachte Loulou plötzlich auf Ideen, als würde ihre Kreativität von den historischen Vorbildern angekurbelt wie die Musik in einem Leierkasten.
Ihre neue Errungenschaft über den Arm geworfen, stürzte sie sich nach der wahrscheinlich viel zu großzügigen Bezahlung mit einem gewissen Glücksgefühl wieder ins Getümmel. Auf der Portobello Road herrschte ein schier unübersichtliches Schieben und Drängen. Dennoch stach ihr ein kleiner Stand sofort ins Auge – vielleicht lag das an dem hochgewachsenen Mann mit dem schön geschnittenen Gesicht unter dem roten Tarbusch und an seinem breiten Lächeln, das eine gerade Reihe schneeweißer Zähne freigab.
Jedenfalls fanden sich auf seinem Tisch Armbänder und Ketten, die Loulou magisch anzogen. Materialien wie Glasperlen, Leder, Holz, Kupfer und Messing waren zu ungewöhnlichen Kreationen verarbeitet. Die Schmuckstücke mochten für eine zierliche Person wie sie zu klobig sein, doch Loulou freute sich über den Kontrast. Obwohl ihr Budget den Kauf eigentlich nicht zuließ, erstand sie ein paar dicke Reife aus Ebenholz für ihre Handgelenke und große Ohrringe aus bunten Steinen, den dazu passenden Halsschmuck konnte sie sich leider nicht leisten. Der Verkäufer bot ihr zwar einen Nachlass an, aber sie lächelte entschuldigend und versprach, so bald wie möglich wiederzukommen.
Der Bummel über den Flohmarkt war für Loulou viel mehr als der Einkauf von Garderobe. Sie ertappte sich dabei, wie sie aus einer unzähligen Menge an Waren ihren eigenen Stil zu entwickeln begann. Es war nicht die blanke Not oder der bloße Wunsch, zu provozieren, die sie antrieben. Ein sehr kurzer Minirock oder eine durchsichtige Chiffonbluse bedeuteten natürlich Rebellion, aber Loulou stellte fest, dass es ihr darauf nicht ankam. Es war ein Gefühl, das aus ihrer Seele kam, das sie mit ihrer Garderobe vermitteln wollte – und im Moment passte ein Rausch von Farben am besten dazu. Schwarz, dachte sie, als sie ein Kleid zur Seite legte, das ihr auf den ersten Blick recht gut gefallen hatte, Schwarz trägt man nur, wenn man unglücklich ist.
Sie erstand einen violetten Turban und eine wie von Mozart getragene Weste aus hellblauem Samt mit goldener Stickerei, die wunderbar zu dem lässigen Herrenhemd aussehen würde, das bereits in ihrem Schrank hing. Doch immer wieder zog es sie zu den Auslagen mit traditioneller Kunst. Ob orientalischer Silberschmuck oder Taschen aus Marokko, sie war fasziniert von den Handarbeiten. Aufmerksam betrachtete sie jedes Angebot, während die Ellenbogen anderer potenzieller Kunden sie in den Rücken stachen.
Aus den Lautsprechern eines tragbaren Plattenspielers irgendwo in der Nähe übertönten die Beach Boys den üblichen Lärm aus Feilschen, Begeisterung und wortreichen Empfehlungen. Loulou horchte für einen Moment auf den Text und dachte unwillkürlich an Desmond: »God Only Knows …« Ja, nur Gott wusste, was sie ohne ihn war. Letztlich war sie nur wegen ihm hierhergefahren, um auf seiner Party als seine Freundin zu glänzen. Doch es kam ihr nun vor, als fände sie auf seltsame Weise zu sich selbst. Ein Mysterium aus Farben, Mustern, Materialien und auch Fremdländischem sollte sie umgeben. So war es richtig!
Beschwingt trat sie den Heimweg an. In den U-Bahn-Stationen wechselten sich die Wahlplakate der Bewerberinnen und Bewerber um die Parlamentssitze Ende des Monats mit den Werbungen für Schallplatten und Kinofilme ab. Doch Loulou sah nichts davon. Sie strich zärtlich über den Fuchskragen ihres neuen Mantels, fühlte die anderen gerade erstandenen Besitztümer in ihrem Einkaufskorb und vergaß die Welt um sich herum.
5
Zu Desmonds Freundeskreis zählten so viele Leute, dass das Fehlen einer Heizung von niemandem bemerkt wurde, denn durch die Menge wurde es trotz des feuchten, kühlen Wetters an diesem Märzabend unglaublich schnell warm. Loulou schwitzte in ihrem Pelzmantel, aber sie legte ihn nicht ab, weil ihr der modische Effekt gefiel – und auch weil Desmond gesagt hatte, dass sie toll aussah. Sie trug den Turban, hatte aber ein dezenteres Minikleid übergeworfen als die schrille Weste. Sie wollte Desmond nicht durch ein zu gewagtes Outfit verstören.
Sie versuchte charmant zu plaudern, blieb jedoch trotz der spektakulären Hülle das scheue Reh in einem lärmenden Umfeld. Bald schwirrte ihr der Kopf von den vielen Namen und dazugehörenden Gesichtern, die Desmond ihr vorstellte. Oder besser, denen er sie