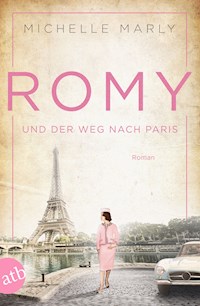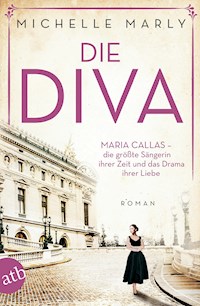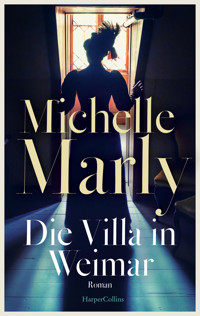10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach l’eau d‘amour.
Paris, 1919: Coco Chanel ist es gelungen, ein erfolgreiches Modeunternehmen aufzubauen. Doch als ihr Geliebter Boy Capel bei einem Unfall stirbt, ist sie vor Trauer wie gelähmt. Erst der Plan, ihrer Liebe zu ihm mit einem Parfüm zu gedenken, verleiht ihr neue Tatkraft. Auf ihrer Suche danach begegnet sie dem charismatischen Dimitri Romanow. Mit ihm an ihrer Seite reist Coco nach Südfrankreich, in die Wiege aller großen Düfte, und kommt schon bald dem Duft der Liebe auf die Spur ...
Coco Chanel – eine einzigartige Frau und eine große Liebende. Dies ist ihre Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Über Michelle Marly
Hinter Michelle Marly verbirgt sich eine deutsche Bestsellerautorin, die in der Welt des Kinos und der Musik aufwuchs. Lange Jahre lebte sie in Paris, heute wohnt sie mit Mann und Hund in Berlin und München.
Informationen zum Buch
Auf der Suche nach l’eau d‘amour
Paris, 1919: Coco Chanel ist es gelungen, ein erfolgreiches Modeunternehmen aufzubauen. Doch als ihr Geliebter Boy Capel bei einem Unfall stirbt, ist sie vor Trauer wie gelähmt. Erst der Plan, ihrer Liebe zu ihm mit einem Parfüm zu gedenken, verleiht ihr neue Tatkraft. Auf ihrer Suche danach begegnet sie dem charismatischen Dimitri Romanow. Mit ihm an ihrer Seite reist Coco nach Südfrankreich, in die Wiege aller großen Düfte, und kommt schon bald dem Duft der Liebe auf die Spur.
Coco Chanel – eine einzigartige Frau und eine große Liebende. Dies ist ihre Geschichte.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michelle Marly
Mademoiselle Coco
und der Duft der Liebe
Roman
Inhaltsübersicht
Über Michelle Marly
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog: 1897
Erster Teil 1919–1920
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Zweiter Teil: 1920–1921
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Dritter Teil: 1921
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Vierter Teil: 1922
Kapitel 1
Kapitel 2
Nachwort der Autorin
Dank
Impressum
Leseprobe aus: Mary Basson – Die Malerin
Geschrieben im Gedenken
an meine wunderschöne Mutter,
die mir den Blick für die Welt der Mode öffnete.
Eine Frau, die kein Parfüm trägt,hat keine Zukunft.
COCO CHANEL
Prolog 1897
Eins, zwei, drei, vier, fünf… eins, zwei, drei, vier, fünf…
Kein Laut drang aus ihrem Mund, nur ihre Lippen bewegten sich. Tonlos zählte sie die Mosaiksteine zu ihren Füßen ab. Unebene, ein Jahrtausend lang abgetretene Flusskiesel, die in geometrischen Formen oder mystischen Bildern in den Boden eingelassen worden waren.
Hier waren es fünf Sterne, dort fünf Blumen, irgendwo auch ein Fünfeck. Diese Anordnung war kein Zufall. Sie hatte gelernt, dass für die Mitglieder des Zisterzienserordens die Fünf eine symbolische Zahl war: Sie galt als reine und vollkommene Verkörperung der Dinge, Rosen etwa wiesen fünfzählige Blüten auf, Äpfel und Birnen waren fünfstrahlig strukturierte Früchte. Der Mensch besaß fünf Sinne, und die fünf Wundmale Christi wurden in jeder Andacht thematisiert. Die Nonnen hatten ihr allerdings nicht beigebracht, dass die Fünf auch die Zahl der Liebe und der Venus war, die unteilbare Summe der männlichen Zahl Drei und der weiblichen Zahl Zwei. Diese für ein vierzehnjähriges Mädchen durchaus interessante Tatsache hatte sie in einem Buch gefunden, das sie heimlich auf dem Dachboden las.
Die Klosterbibliothek barg die erstaunlichsten Schätze: Weniger skandalös, aber ebenfalls nicht für die Augen eines Backfisches bestimmt, waren jene aus dem Mittelalter überlieferten Predigten Bernhard von Clairvaux’, in denen er seine Mönche daran erinnerte, welche Bedeutung Duftstoffen bei Gebeten und rituellen Waschungen zukam. Der Gründer des Zisterzienserordens riet seinen Glaubensbrüdern sogar, sich für den spirituellen, nach innen gerichteten Blick die parfümierten Brüste der Jungfrau Maria vorzustellen, die im Hohelied besungen wurden. Weihrauch und Jasmin, Lavendel und Rosen auf dem Altar sorgten dafür, die Kontemplation mit Hilfe des Geruchssinns zu vertiefen.
Für Waisenkinder wie das einsame junge Mädchen, das sie selbst war, blieben die aus den Pflanzen im Klostergarten gewonnenen Aromen jedoch nur ein ferner Traum, ebenso wie die Vorstellung, sich an die üppigen Brüste einer liebevollen Mutter zu werfen. Die Zöglinge wurden regelmäßig in einem Waschzuber mit billiger Kernseife abgeschrubbt, so dass sie nicht mehr schmutzig von der Arbeit auf dem Feld oder in der Küche waren und nach Sauberkeit statt nach Angstschweiß und Erschöpfung rochen – von duften konnte keine Rede sein. Die groben weißen Laken, die sie waschen, gegebenenfalls flicken und ordentlich zusammengelegt in der Wäschekammer stapeln musste, wurden mit mehr Fürsorge behandelt als die Haut der Waisenkinder.
Eins, zwei, drei, vier, fünf…
Sie vertrieb sich die Zeit mit Zählen, während sie in einer Reihe mit den anderen Mädchen darauf wartete, dass ihr der Pfarrer die Beichte abnahm. Nachdem sie in ewig dauernder Monotonie wie Soldaten auf einem Kasernenhof strammgestanden hatten, betrat eine nach der anderen den Beichtstuhl. Sie nahm an, dass die Nonnen diese stille, gerade Haltung verlangten, die kein Kind über lange Zeit aushalten konnte, damit die Kleinen anschließend etwas zu gestehen hatten. In der Regel hatte seit der letzten Beichte am vorigen Sonnabend keine von ihnen gesündigt. Hier oben auf dem windumspielten Felsen, auf dem im zwölften Jahrhundert das Kloster von Aubazine errichtet worden war, gab es gar keine Gelegenheit für Sünden.
Seit rund zwei Jahren lebte sie nun schon in dieser abgeschiedenen Welt in der Mitte Frankreichs, weit genug von der Hauptstraße nach Paris entfernt, um nicht auf den Gedanken zu kommen fortzulaufen. Über siebenhundert Tage waren seit dem Tod ihrer Mutter und der Stunde vergangen, als der Vater sie auf einen Pferdewagen gesetzt und bei den Zisterzienserinnen abgeliefert hatte. Einfach so. Als wäre sie eine Last. Danach war er für immer verschwunden, und für die zerbrechliche Seele der Kleinen öffnete sich die Hölle. Sie begann nach dem Augenblick zu lechzen, an dem sie alt genug war, um das Kloster verlassen und ein eigenständiges Leben beginnen zu dürfen. Vielleicht war die Nähnadel der Schlüssel dorthin. Wer nähen konnte und zäh war, kam womöglich bis nach Paris und dort in einem großen Modehaus unter. Sie hatte davon reden hören, aber im Grunde wusste sie nicht, was damit wirklich gemeint war.
Es klang jedoch verheißungsvoll. Modehaus war ein Wort, das in ihr eine Erinnerung zum Klingen brachte. An schöne Stoffe, knisternde Seide etwa, duftende Volants und feinste Spitze. Nicht, dass ihre Mutter jemals eine Dame gewesen wäre. Sie war Wäscherin gewesen und ihr Vater ein Hausierer. Niemals hatte er so feine Sachen verkauft, dennoch verband sie jeden Gedanken an schöne Dinge mit Maman. Sie vermisste sie so sehr, dass ihr manchmal schwindelig wurde vor Sehnsucht nach der Geborgenheit, die sie bei ihr stets empfunden hatte.
Doch sie war auf sich allein gestellt, erlebte Härte und Drill, Strafe und gelegentlich göttliche Absolution. Dabei wünschte sie sich nichts mehr als ein bisschen Zuneigung. War das eine Sünde, die sie beichten sollte? Würde dieses Geheimnis jemals zu schwer auf ihr lasten, um ihrer Seele Frieden zu geben? Vielleicht, sinnierte sie stumm. Vielleicht aber auch nicht. Sie würde ihrem Beichtvater nicht gestehen, dass sie einfach nur Liebe wollte im Leben. Heute nicht. Und wahrscheinlich auch an keinem anderen Tag.
Stumm zählte sie die Mosaiksteinchen im Fußboden auf ihrem Weg zur Kathedrale von Aubazine: Eins, zwei, drei, vier, fünf…
Erster Teil 1919–1920
Kapitel 1
Die gelben Scheinwerfer durchschnitten den Nebel, der von der Seine aufstieg und Eschen, Erlen und Buchen an der Uferstraße umhüllte wie ein weißes Tuch aus Leinen. Wie ein Leichentuch, fuhr es Étienne Balsan durch den Kopf.
Vor seinem geistigen Auge formte sich das Bild eines aufgebahrten Toten: zerschmetterte Glieder, verbrannte Haut, von Linnen bedeckt. Zu Füßen des Verstorbenen lag ein Buchsbaumzweig, auf seiner Brust ein Kruzifix. Neben seinem Kopf stand eine Schale mit Weihwasser, das den Geruch des Todes dämpfte. Das Licht von Kerzen warf gespenstische Schatten auf die Leiche, die von Nonnen so hergerichtet worden war, dass der Anblick nicht allzu verstörte.
Unwillkürlich versuchte sich Étienne vorzustellen, wie das schöne Gesicht seines Freundes entstellt sein mochte. Er kannte es fast ebenso gut wie sein eigenes.
Wahrscheinlich ist nicht viel übrig geblieben von den ebenmäßigen Zügen, den elegant geschwungenen Lippen und der geraden Nase, beantwortete er sich seine Frage. Wenn ein Automobil ungebremst eine Böschung hinabraste, gegen eine Felswand schlug und Feuer fing, blieben nicht viele Knochen an Ort und Stelle. Es bedürfte gewiss einiger Kunstfertigkeit, die Ansehnlichkeit des tödlich Verunglückten wiederherzustellen.
Er spürte ein feuchtes Rinnsal seine Wange hinablaufen. Regnete es in den Wagen? Er wollte den Scheibenwischer einschalten, wobei er so hektisch danach suchte, dass das Automobil seitlich ausbrach. Als er panisch auf die Bremse trat, spritzte Matsch gegen das Seitenfenster. Endlich quietschte das Gummi über die Scheibe. Es regnete nicht. Tränen rannen aus seinen Augen, eine Welle der Müdigkeit und Trauer lastete auf ihm, drohte über ihm zusammenzubrechen. Wenn er jedoch nicht enden wollte wie sein Freund, musste er sich auf die Straße konzentrieren.
Der Wagen stand quer zur Fahrbahn. Étienne zwang sich zu einem ruhigen Atemrhythmus, schaltete den Scheibenwischer ab, umfasste das Steuerrad mit beiden Händen. Der Motor heulte auf, als er auf das Gaspedal trat, die Räder drehten durch. Nach einem Rucken fand das Automobil in seine Spur zurück. Er spürte, wie sich sein Herzschlag normalisierte. So spät nach Mitternacht gab es glücklicherweise keinen Gegenverkehr.
Er zwang sich, den Blick starr auf die Straße zu richten. Hoffentlich kreuzte kein Nachttier seinen Weg. Er hatte keine Lust, einen Fuchs zu überfahren, wenn, dann entsprach die Fuchsjagd hoch zu Ross schon mehr seinem Naturell. Genauso hatte sein Freund gefühlt, die Liebe zu Pferden hatte sie verbunden. Arthur Capel, der ewig Jugendliche, der seinen kindlichen Spitznamen Boy niemals hatte ablegen können, war ein phantastischer Polospieler – gewesen. Boy war ein Bonvivant gewesen, ebenso intellektuell wie charmant, durch und durch Gentleman, ein britischer Diplomat, im Krieg zum Hauptmann befördert und ein Typ, den jeder gern seinen Kameraden nannte. Étienne konnte sich glücklich schätzen, einer seiner ältesten und besten Freunde zu sein. Gewesen zu sein …
Wieder rollte eine Träne über Étiennes sonnengegerbte Wange. Doch er nahm seine Hand nicht vom Lenkrad, um sie wegzuwischen. Er sollte sich nicht mehr ablenken lassen von den eigenen Gedanken, wenn er mit heiler Haut in Saint-Cucufa ankommen wollte. Diese Fahrt war der letzte Dienst, den er dem Toten erweisen konnte. Er musste Coco die furchtbare Nachricht überbringen, bevor sie es morgen aus den Zeitungen oder durch den Anruf einer Klatschbase erfuhr. Es war wahrlich keine schöne Aufgabe, aber eine, die er mit dem Herzen erledigte.
Coco war Boys große Liebe – gewesen. Daran bestand kein Zweifel. Für niemanden, und für Étienne schon gar nicht. Er hatte die beiden bekannt gemacht. In jenem Sommer auf seinem Anwesen. Boy war wegen der Pferde nach Royallieu gekommen – und mit Coco gegangen. Dabei war sie eigentlich Étiennes Freundin. Na ja, genau genommen war sie damals nicht einmal das. Sie war ein Mädchen, das in der Garnisonsstadt Moulins mit zweideutigen Liedern im Tingeltangel auftrat und tagsüber die Hosen der Offiziere flickte, mit denen sie sich nachts vergnügte. Zart, knabenhaft, bildhübsch, lebensfroh, zerbrechlich und dabei unfassbar mutig und energisch. Das genaue Gegenteil jenes Typs der grande dame, den so viele junge Frauen der Belle Époque anstrebten zu sein.
Étienne hatte sich mit ihr amüsiert und sie aufgenommen, als sie unerwartet vor seiner Tür stand, hatte aber ihretwegen nichts in seinem Leben geändert. Anfangs wollte er sie nicht einmal um sich haben, aber sie war stur und einfach geblieben. Ein Jahr, zwei Jahre … Er konnte sich nicht einmal erinnern, wie lange sie an seiner Seite gelebt hatte, ohne dass er sie als Gefährtin wahrnahm. Eigentlich hatte ihm erst Boy die Augen für Cocos innere Schönheit und Stärke geöffnet. Doch da war es schon zu spät. Da hatte er seine Mätresse, die nicht einmal seine ständige Geliebte war, abgetreten, wie man das in seinen Kreisen in der Zeit vor dem Großen Krieg eben so machte. Aber er war ihr Freund geworden. Und würde es über Boys letzten Atemzug hinaus bleiben. Das schwor er sich.
* * *
Sie musste endlich aufhören, sich verrückt zu machen.
Seit Stunden warf sich Gabrielle in ihrem Bett herum. Hin und wieder fiel sie in einen scheinbar tiefen Schlaf, aus dem sie bald wieder aufschreckte, verwirrt und noch in einem Traum gefangen, an den sie sich nicht erinnern konnte. Dann tastete sie nach der anderen Bettseite, um den vertrauten Körper zu fühlen, der ihr so viel Geborgenheit schenkte. Doch das Kissen war leer, das Lager unberührt – und Gabrielle wieder hellwach.
Natürlich. Boy war nicht da. Er hatte sich gestern – oder war es schon vorgestern? – auf den Weg nach Cannes gemacht, um ein Haus zu mieten, in dem sie gemeinsam die Feiertage verbringen wollten. Es war eine Art Weihnachtsgeschenk. Sie liebte die Riviera, und es bedeutete ihr unendlich viel, dass er Weihnachten mit ihr und nicht mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter verbrachte. Er hatte sogar davon gesprochen, sich scheiden zu lassen. Sobald er eine geeignete Villa gefunden hatte, sollte sie nachkommen. Aber er hatte noch nicht angerufen, nicht einmal ein kurzes Telegramm aufgegeben und sie auf diese Weise wissen lassen, dass er wohlbehalten in Südfrankreich eingetroffen war.
Hatte er es sich womöglich anders überlegt?
Seit seiner Hochzeit vor rund eineinhalb Jahren nagten immer wieder Zweifel an Gabrielle. Anfangs war sie fassungslos gewesen, weil er ihr eine Frau als Gemahlin vorzog, die all das verkörperte, was Gabrielle nicht war: eine hochgewachsene Blondine, ebenso blass wie blasiert, wohlhabend, eine Angehörige des britischen Hochadels, die Boy den gesellschaftlichen Aufstieg in die britische Oberschicht ermöglichte. Dabei hatte er auch ohne eine solche Verbindung so viel erreicht. Als Sohn eines bürgerlichen Schiffsmaklers aus Brighton hatte er es immerhin zum Berater des französischen Präsidenten Clemenceau und zum Mitglied der Friedenskonferenz von Versailles gebracht. Wozu brauchte er da noch eine noble Angetraute?
Vor allem: Seit zehn Jahren lebten er und Gabrielle zusammen. Sie hatte fest damit gerechnet, dass sie eines Tages heiraten würden. Und war sie etwa keine gute Partie? Nun ja, über ihre einfache Herkunft warf sie am liebsten ein dunkles, undurchdringliches Tuch. Aber sie hatte sich zu einiger Berühmtheit hochgearbeitet. Als Coco Chanel war sie eine überaus erfolgreiche Modeschöpferin, inzwischen sogar eine wohlhabende Frau.
Angefangen hatte sie als Hutmacherin mit einem Kredit ihres alten Freundes Étienne Balsan, und ihre so schlichten wie eleganten Kreationen erregten schon bald die Aufmerksamkeit der Pariserinnen. Keine Federn oder andere Hutaufbauten – das gefiel den Damen nach einer langen Zeit der üppigen Dekorationen. Furore machten schließlich die locker fallenden Matrosenblusen, die sie in Deauville entwarf. Gabrielle verbannte das Korsett und schneiderte Hosen für Frauen. Dann waren die Hungerjahre des Großen Krieges gekommen, und – ganz pragmatisch – hatte sie es gewagt, schlichte, funktionale Kleider aus preiswertem Seidenjersey und Nachtanzüge zu kreieren, mit denen die Frauen ebenso bequem wie schick vor den Angriffen der Deutschen in den Keller fliehen konnten. Die noblen Damen rissen ihr die Sachen geradezu aus den Händen. Fast jede von Rang, ja der gesamte Hochadel kam zu Gabrielle, um von Coco Chanel angezogen zu werden.
Wozu benötigte Boy noch den Trauschein mit der Vertreterin dieses Standes? Gabrielle hatte sich nach oben gearbeitet und sich einen Namen gemacht. Wie konnte er ihre große Liebe für eine Karriere opfern, auf deren Höhepunkt er sich doch längst befand? Gabrielle verstand es nicht – und würde es niemals verstehen. Und der Kummer darüber fraß sich in ihre Knochen wie die Schwindsucht.
Doch dann war er zu ihr zurückgekehrt. Das Band, das Boy und Gabrielle verband, war stärker als die goldenen Ringe, die er mit Diana Wyndham, Tochter von Lord Ribblesdale, getauscht hatte. Natürlich hatte sie gezögert, aber dann war Gabrielle in seine Arme gesunken. Lieber die neue Rolle als Mätresse akzeptieren als ganz auf ihn verzichten, lautete ihre Devise. Was sprach gegen ihr Arrangement? Nichts. Oder? Es ging ja alles gut, aber die Zweifel nagten im Geheimen weiter an ihr wie die Motten.
Boy lebte faktisch von seiner Frau getrennt, war die meiste Zeit in Paris. Dennoch war es natürlich gelegentlich nötig, dass er sich an der Seite seiner Gattin zeigte. Gabrielle ließ ihn gehen, weil sie inzwischen sicher war, dass er wiederkam. Ihre Liebe war größer als alles andere. Diese Liebe hielt – allen Stürmen zum Trotz – seit zehn Jahren und würde nie vergehen. Wenn etwas für die Ewigkeit bestimmt war, dann die Verbindung zwischen ihnen beiden. Davon war Gabrielle überzeugt. Dennoch zogen beizeiten die dunkelsten Gedanken auf und ließen sie wie Luzifer aus dem Himmel stürzen. So wie in dieser Nacht.
Sie wälzte sich auf die andere Seite, strampelte das Laken weg, fröstelte, zog ihre Decke wieder bis unter das Kinn.
Warum hatte Boy sich seit seiner Abfahrt nicht bei ihr gemeldet? Erinnerte ihn der Zauber von Weihnachten an seine neun Monate alte Tochter? War er so beseelt von dem Gedanken an seine Familie, dass er die Erinnerung an seine in ihrem Landhaus bei Paris zurückgelassene Geliebte von sich schob? Fuhr er nicht nach Südfrankreich, um ein Haus für Gabrielle und sich zu suchen, sondern um sich in Cannes mit seiner Frau zu versöhnen? Er hatte doch vor seiner Abreise noch von Scheidung gesprochen. Panik wallte in Gabrielle auf. Nun konnte sie erst recht nicht mehr einschlafen.
Doch sie stand nicht auf, knipste nicht einmal das Licht auf ihrem Nachttisch an, griff nicht nach unterhaltsamer Lektüre, die sie ablenken könnte. Sie überließ sich den Dämonen, zu müde, um irgendetwas anderes zu tun. Irgendwann zog die Erschöpfung sie wieder in die tiefe Dunkelheit eines unruhigen Traums …
Ein Knirschen weckte Gabrielle. Es war das unverwechselbare Geräusch von Gummi auf Kies. Die ausrollenden Reifen eines Automobils, das abgebremst worden war. In der Stille der Nacht drangen die Laute deutlich durch das geschlossene Fenster in Gabrielles Schlafzimmer. Dann schlugen die Hunde an.
Noch im Halbschlaf dachte sie: Boy!
Innerlich jubilierend überlegte sie, dass er zurückgekommen sein musste, um sie abzuholen. Er wollte sie nicht einfach nachkommen lassen. Ihr Körper erzitterte vor Freude. So verrückt konnte nur Boy sein. Sie liebte ihn so sehr. Ganz gleich, ob sie Weihnachten in Südfrankreich oder in dieser abgelegenen Villa in Saint-Cucufa feierten. La Milanaise, wo es im Sommer nach Flieder und Rosen duftete, war im nordfranzösischen Winter ein wenig trostlos. Deshalb hatten sie sich für einen Aufenthalt an der Côte d’Azur entschieden. Düster konnte es jedoch nur dort sein, wo sie nicht zusammen waren. Warum hatte Gabrielle das nicht gleich begriffen?
In diesem Moment klopfte es an ihrer Tür. »Mademoiselle Chanel?« Es war die Stimme von Joseph Leclerc, ihrem Diener. Nicht das erwartete Flüstern ihres Liebhabers.
Plötzlich war sie hellwach.
* * *
Étienne Balsan kannte nicht nur Boy Capel fast so gut wie sich selbst, auch Coco war ihm ebenso vertraut, wie sie es seinem Freund gewesen war. Als sie den Salon betrat, in dem zu warten er von Joseph gebeten worden war, dachte er im ersten Moment, wie wenig sie sich in den dreizehn Jahren, die seit ihrer ersten Begegnung vergangen waren, verändert hatte. Sie wirkte auch als Sechsunddreißigjährige noch immer wie eine Kindfrau. Fast sah sie jetzt aus wie ein Junge, klein und zierlich, flachbrüstig und mit schmalen Hüften, das kurzgeschnittene lackschwarze Haar zerwuschelt wie nach einer leidenschaftlichen Umarmung. Erinnerte er sich nicht, wie heiß der kleine Körper in dem weißen Seidenpyjama war, er hätte sie für ein unerotisches, androgynes Wesen gehalten.
Einen Atemzug später erschrak er. Er blickte in ihre Augen – und sah den Tod.
Sie hatte ihre Gefühle immer gut unter einer Fassade der Gleichgültigkeit verbergen können, doch ihre dunklen Augen boten bisweilen Einblick in die tiefe Seele dieser Frau. Jetzt lag Schmerz in ihrem Ausdruck, verzweifelte, verstörende Pein. Doch keine Träne schimmerte darin.
Und sie schwieg. Stand stumm vor ihm in ihrem weißen Gewand, Haltung bewahrend wie einst Marie Antoinette vor der Guillotine. Es war furchtbar. Hätte sie geschluchzt, Étienne hätte gewusst, wie er mit ihr umgehen sollte. Er hätte sie in den Armen halten können. Doch ihr stilles Leiden, ihre trockenen Augen schnitten ihm ins Herz.
»Es tut mir leid, dass ich dich mitten in der Nacht störe«, hob er an. Sich immer wieder leise räuspernd, fuhr er stockend fort: »Ich dachte, ich bin es Boy schuldig, dir die Nachricht zu überbringen … Lord Rosslyn telefonierte aus Cannes …« Er holte tief Luft. Es fiel ihm unfassbar schwer, Coco die traurige Nachricht zu überbringen. »Boy hatte einen schrecklichen Unfall. Der Wagen kam von der Straße ab. Boy fuhr selbst, sein Mechaniker saß auf dem Beifahrersitz. Mansfield wurde schwer verletzt … Für Boy kam jede Hilfe zu spät.«
Es war gesagt. Doch von ihr kam keine Reaktion.
Mit einiger Verzögerung wurde Étienne sich bewusst, dass der Diener Coco die schlechte Nachricht bereits überbracht hatte. Natürlich. Joseph hatte erklären müssen, warum er mitten in der Nacht einen Fremden einließ und Mademoiselle aus dem Bett holte. Aber warum sagte sie nichts?
Um die Stille zu durchbrechen, redete Étienne weiter: »Die Polizei ermittelt wohl noch … Bislang ist nicht bekannt, was genau passiert ist. Jedenfalls hat sich noch nichts in Paris herumgesprochen. Nur so viel: Der Unfall war irgendwo an der Riviera. Die Bremsen seines Wagens haben – wie es scheint – versagt …«
»Mademoiselle hat verstanden, Monsieur«, fiel ihm Joseph ins Wort.
Étienne nickte beklommen. Noch nie hatte er sich so unbehaglich gefühlt. Er sah die Frau an, die schluchzte, ohne eine Träne zu vergießen. Jede Faser ihres Körpers schien Fassungslosigkeit und Verzweiflung auszustrahlen. Er konnte förmlich sehen, wie das Unglück immer stärker von ihr Besitz ergriff. Doch noch immer weinte sie nicht.
Ohne ein Wort drehte sie sich um und verließ das Zimmer. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss.
Ratlos blieb Étienne zurück.
»Darf ich Ihnen etwas anbieten, Monsieur?«, fragte Joseph. »Möchten Sie vielleicht einen Kaffee?«
»Ich hätte gern einen Cognac. Einen doppelten, bitte.«
Das Getränk war gerade großzügig eingeschenkt, Étienne schloss die Finger um das bauchige Glas, um sich und den Weinbrand zu wärmen, da flog die Tür des Salons wieder auf.
Coco war zurück. Diesmal in einem knöchelkurzen Reisekostüm, ihren Mantel über dem Arm, eine offenbar mit dem Nötigsten gepackte Tasche in der Hand. Sie hielt den Griff so fest umschlossen, dass ihre Fingerknöchel weiß hervortraten. Doch das war das einzige sichtbare Zeichen ihrer Anspannung. Ihre Miene war nach wie vor eine starre Maske, ihre Augen waren leer.
»Wir können fahren«, erklärte sie mit fester Stimme.
Verblüfft schüttelte Étienne den Kopf.
Sie erwiderte seinen Blick, sagte aber nichts.
In einem Akt völliger Hilflosigkeit nickte er. Als wüsste er, wohin sie wollte. Aber er hatte nicht die geringste Ahnung, was sie mitten in der Nacht unternehmen wollte. Er ließ einen großen Schluck Cognac in seine Kehle rinnen, hoffte, dass der Alkohol eine beruhigende Wirkung auf ihn hätte. Vergeblich. Er bemerkte, dass seine Hand, die das Glas hielt, zitterte.
»Meinst du mich?« Er zögerte, irritiert, unsicher, ob sie nicht lieber mit ihrem Chauffeur reiste – an welchen Ort es sie auch immer trieb.
»Wir fahren an die Riviera.« Wieder diese Entschlossenheit in ihrem Ton, die so gar nicht zu der geisterhaften Erscheinung passte. »Ich möchte ihn sehen. Und ich möchte unverzüglich aufbrechen, Étienne.«
»Was?« Er schnappte nach Luft, kippte eine weitere Ladung Cognac in seine Kehle. »Es ist gefährlich da draußen. Auf den Straßen ist es finster und neblig und …«
»Die Dämmerung bricht bald herein. Wir sollten keine Zeit verlieren. Bis an die Côte d’Azur ist es ein weiter Weg.« Sie wandte sich zum Gehen.
Er wechselte einen hilflosen Blick mit Joseph. Warum ließ sie ihren Chauffeur nicht die nötigen Vorbereitungen für eine Abreise im Morgengrauen treffen? Ging die Freundespflicht so weit, dass Étienne Cocos Verrücktheit unterstützen sollte? Sie ist nicht verrückt, stellte er traurig fest.
Ohne einen weiteren Kommentar folgte er ihr in die Nacht.
Kapitel 2
Die fröhliche Weihnachtsstimmung, die Gabrielle in Cannes empfing, erschien ihr schmerzlich grell und laut. Aus den Cafés und Restaurants wehten die Klänge von englischsprachigen Weihnachtsliedern und schmissigen Jazzsongs auf die Uferpromenade hinaus. Eine Verbeugung vor den zahlreichen Touristen von den britischen Inseln und aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Damit die Ausländer sich an der Riviera heimisch fühlten, waren neben den in Frankreich üblichen Glocken sogar Sterne aus Papier an den Palmen befestigt worden.
Es war mild, fast windstill, und über der Bucht erstreckte sich der Sternenhimmel funkelnd wie tintenblauer, mit durchsichtigen Pailletten bestickter Tüll. Eleganz bestimmte die Croisette, teure Automobile spuckten in teure Abendmode gehüllte Herrschaften vor den teuren Luxushotels aus. Es war Heiligabend: Überall knallten Champagnerkorken, waren mit erlesenem Porzellan, Kristall und Silber eingedeckte Tische mit Stechpalmenzweigen und Misteln dekoriert, wurden Austern geöffnet und warteten Weihnachtskuchen in Kühlkammern darauf, zum Dessert serviert zu werden.
Der Gedanke an ein Festmahl bereitete Gabrielle Übelkeit. Sie war seit annähernd zwanzig Stunden unterwegs, doch an ihrer Fassungslosigkeit, der inneren Verzweiflung, ihrem Schmerz und ihrer inneren Erstarrung hatte sich seit ihrer Abfahrt nichts geändert.
Als Joseph an ihrer Tür geklopft hatte, war Angst in ihr aufgestiegen. Boy hätte nicht den Diener geweckt, er hätte seinen eigenen Hausschlüssel benutzt und wäre natürlich auch ohne fremde Hilfe in ihr Schlafzimmer gekommen. Irgendetwas war geschehen, das die Ordnung zerstörte. In ihrem Hinterkopf regte sich bereits der Verdacht, dass etwas passiert sei, aber sie schüttelte ihn ab. Boy besaß die Aura eines Helden, einem Mann wie ihm konnte nichts zustoßen. Doch dann hatte ihr der gute, treue Joseph den Schlag versetzt. Vorsichtig, rücksichtsvoll, Anteil nehmend. Natürlich. Ihr Diener verlor zu keinem Zeitpunkt die Contenance, obwohl auch er zweifellos erschüttert war über die Nachricht, die Monsieur Balsan brachte. Mit einem Mal war alles anders. Gabrielle spürte fast körperlich, wie ihr Leben in Stücke zerbrach.
Auf das Verstehen folgte die Hoffnung, dass es sich um einen Irrtum handelte. Einige groteske Minuten lang klammerte sie sich an diesen Gedanken. Ebenso schnell wurde ihr bewusst, dass Étienne nicht mitten in der Nacht von Royallieu nach Saint-Cucufa führe, um einen Scherz zu machen. Und Joseph beträte nicht aus einer albernen Laune heraus zur selben Stunde ihr Schlafzimmer. Nein, Boy war nicht mehr da. Und mit einem Mal war nichts mehr so wichtig wie ihr Wunsch, ihn zu sehen. Vielleicht musste sie begreifen, dass er wirklich gestorben war. Wahrscheinlich wollte sie sich davon überzeugen, dass er nicht gelitten hatte. Sie wollte die Totenwache an seinem Sarg halten. Er war ihr Mann, wenn auch nicht ihr Ehemann und doch der wichtigste Teil ihres Lebens. Nein, kein Teil – er war ihr Leben.
Ohne Boy war nichts mehr von Bedeutung.
Sie aß nichts, und als Étienne unterwegs an einer Auberge anhielt, trank sie nur widerstrebend den Kaffee, den er ihr brachte, mehr jedoch wollte sie nicht. Sie stieg nicht einmal aus seinem Wagen aus. Sie kauerte auf dem Ledersitz wie versteinert. Dabei blieb sie so wortkarg wie in La Milanaise. Ihr Freund verdiente ihr Schweigen nicht, das wusste sie. Aber sie hatte das Gefühl, nicht mehr als nötig sprechen zu können – als habe Boy auch ihre Sprache mit sich genommen. Fort von ihr. Für alle Ewigkeit.
Étienne lenkte sein Automobil nicht die geschwungene Auffahrt zum Haupteingang des Hotel Carlton hinauf, sondern hielt direkt unterhalb an. Der Motor erstarb. Einen Moment herrschte Stille im Wagen, von draußen wehte gedämpft durch die hochgekurbelten Scheiben der Festtagslärm herein. Étienne atmete tief durch, bevor er sich zu ihr umwandte. »Ich hoffe, dass wir Bertha finden können. Meines Wissens logiert sie hier. Seine Schwester wird am besten wissen, was mit Boy geschehen ist und wo sein Leichnam aufgebahrt wird.«
»Ja«, stimmte sie schlicht zu. Gabrielle schlug ihren breiten Mantelkragen hoch und verbarg ihr bleiches Antlitz dahinter.
In einer fast väterlichen Geste berührte Étienne ihren Arm. »Du musst unbedingt ein wenig schlafen. Es sind bestimmt noch zwei Zimmer frei und …«
Schlafen? Was für ein alberner Vorschlag. Als müsste sie akzeptieren, dass ihr Leben weiterging. Wie sollte sie schlafen können, ohne Boy noch einmal gesehen zu haben?
»Nein.« Sie schüttelte vehement den Kopf. »Nein. Bitte nicht. Ruh du dich aus. Du hast dir ein Hotelbett verdient. Ich werde hier auf dich warten.«
Schweigen.
Gabrielle sah ihrem Freund an, dass er mit sich kämpfte. Seine Kieferknochen bewegten sich, als würde er die Zähne zusammenbeißen und dazwischen den Zorn zermahlen, den er möglicherweise gegen sie hegte. Natürlich war er nach der langen Reise müde. Die zweite Nacht ohne Schlaf zehrte auch an einem Lebemann wie Étienne Balsan. Doch sie erlöste ihn nicht von seiner Qual.
»Ich komme gleich wieder«, versprach er schließlich. Er zögerte noch einmal kurz, dann stieg er aus.
Mit federnden Schritten marschierte er die Auffahrt hinauf. Er war ungewöhnlich groß für einen Franzosen, hatte sogar Boy um eine halbe Haupteslänge überragt. Étiennes Gardemaß hatte Gabrielle am Anfang am meisten beeindruckt. Es passte zu dem schneidigen Offizier der Kavallerie, zu dem Polospieler und Pferdezüchter. Ein Mann von größtmöglicher Haltung. Ein besserer Freund, als sie jemals erwartet hatte.
Während sie Étienne nachsah, begann sie wie automatisch in ihrer Handtasche nach ihrem Zigarettenetui zu fingern. Es war wie ein Reflex. Sie rauchte ständig, hatte schon zu Zigaretten gegriffen, als das Rauchen noch nicht als comme il faut für eine Dame galt. Nikotin beruhigte sie. Den Glimmstängel oder eine Elfenbeinspitze in der Hand zu halten gab ihr eine sonderbare Sicherheit. Anfangs hatte es ihr Spaß gemacht, etwas zu tun, das unkonventionell war und die Moralapostel schockierte. Inzwischen waren Zigaretten ihre selbstverständlichen Begleiter. Und niemand regte sich mehr über Frauen auf, die Reithosen trugen oder rauchten. Coco Chanel hatte neuen Wind in die Mode gebracht.
Das Taschenfeuerzeug war ebenfalls rasch gefunden. Sie betätigte den Zündmechanismus, und eine blaue Gasflamme flackerte in der Dunkelheit des Wagens.
Vor ihrem geistigen Auge flammte plötzlich ein Streichholz auf. Ein kleines gelbes Licht in der blaugrauen Dämmerung eines Sommerabends auf dem Land. Auf der Terrasse war es schon fast dunkel, doch Gabrielle konnte die schmale, gepflegte Hand mit den polierten Fingernägeln in dem Feuerschein deutlich ausmachen …
»Eine Frau wie Sie sollte sich eine Zigarette niemals selbst anzünden müssen«, behauptete eine raue Männerstimme mit einemkleinen Akzent, der klang, als habe der Sprecher einen Korken verschluckt.
Sie ging nicht auf seine Bemerkung ein, sondern inhalierte kommentarlos den ersten Zug. Den Blick auf die Finger des Fremden gerichtet, die jetzt das Streichholz ausschüttelten, stellte sie fest: »Sie besitzen die Hände eines Musikers.« Bei jedem Wort stieß sie winzige weiße Rauchkringel aus.
»Ich spiele ein bisschen Klavier.« Obwohl sie es nicht sah, wusste sie, dass er schmunzelte. »Aber sehr viel besser spiele ich Polo.«
»Sind Sie deswegen hier?« Sie beschrieb mit ihrer Hand einen Kreis, der das gesamte Schloss von Royallieu, die Stallungen mit Étiennes Vollblütern und das Spielfeld am Rande des Parks einschloss.
Er schüttelte den Kopf. »Ich denke, das Schicksal hat mich hierhergeführt, um Ihnen zu begegnen, Mademoiselle Chanel.«
»Tatsächlich?« Sie lachte ihn auf eine überhebliche Weise aus, in der nichts Kokettes lag. Sie hatte auch nicht die Absicht, mit dem Unbekannten zu flirten. »Da Sie meinen Namen kennen, sollte ich eigentlich wissen, mit wem ich es zu tun habe.«
»Arthur Capel. Meine Freunde nennen mich Boy.«
»Coco?«
Sie zuckte zusammen.
Es dauerte eine Weile, bis Gabrielles Verstand in die Wirklichkeit zurückkehrte. Die Erinnerung an jenen Sommerabend in Royallieu hatte sie überwältigt. Sie hatte Boys Gegenwart deutlich gespürt, jede Sekunde ihrer ersten Begegnung. Er war bei ihr gewesen. Schmerzlich wurde ihr bewusst, dass sie sich in Étiennes Automobil und nicht auf Étiennes Terrasse befand – und nicht am Anfang ihres Lebens mit Boy stand, sondern an dessen Ende.
Schweigend kurbelte sie das Seitenfenster hinunter und warf die Kippe auf die Straße.
»Ich habe mit Bertha gesprochen«, sagte Étienne. »Sie ist untröstlich …« Er brach ab, legte eine Pause ein, bevor er hinzufügte: »Natürlich ist sie das.«
Ein laues Lüftchen wehte herein, das Rauschen der Wellen war zu hören. In der Nähe erklang der Bariton eines Angelsachsen, der nicht mehr ganz genau die Melodie traf, aber mit großem Eifer »Jingle Bells« schmetterte:
»Dashing through the snow
in a one-horse open sleigh…«
Gabrielle kurbelte das Fenster wieder hoch.
»Wo kann ich ihn sehen?«, fragte sie tonlos.
Étienne seufzte. »Du … Wir … Ich …« Er beendete sein hilfloses Stammeln, wischte sich über die Augen. »Entschuldige, Coco. Wir sollten uns beide ein paar Stunden hinlegen. Wenigstens bis zum Sonnenaufgang. Bertha lädt dich in ihre Suite ein …«
»Wo ist Boy?«, insistierte sie.
Zunächst antwortete er nicht, dann brach es aus ihm heraus. Es schien, als brülle er eine Person an, die nicht anwesend war: »Der Sarg ist bereits geschlossen und auf ein Schiff gebracht worden. Heute Vormittag fand eine Trauerfeier mit allen militärischen Ehren in der Kathedrale von Fréjus statt. Madame Capel hatte es eilig. Sie hat dafür gesorgt, dass die britische Gemeinde der Côte d’Azur anwesend war, aber keiner seiner französischen Freunde Abschied nehmen konnte.« In einem kurzen Moment des Kontrollverlustes hieb er mit der Faust auf das Lenkrad, fasste sich jedoch rasch wieder. Als verstünde er selbst nicht, wie das passieren konnte, murmelte er: »Es tut mir leid, Coco. Wir sind zu spät gekommen.«
Diana wollte verhindern, dass ich bei der Trauerfeier dabei bin, fuhr es ihr durch den Kopf. Im Leben gehörte Boy zu mir, aber im Tod nimmt sie ihn mir weg.
Auf diesen Gedanken folgte der Schock. Sie begann zu zittern. Wie bei einem starken Schüttelfrost. Sie fror tatsächlich. Gleichzeitig wurde ihr schwindelig. Die Kulisse vor der Windschutzscheibe verschwamm zu einer dunklen Masse. Kopfschmerzen trommelten gegen ihre Stirn, Übelkeit erfasste ihren Leib, Ohrensausen bemächtigte sich ihres Gehörs. Ihre Finger tasteten haltsuchend nach dem Armaturenbrett und griffen ins Leere. All ihre Sinne schienen mit einem Mal aus dem Gleichgewicht. Nur die erlösenden Tränen bildeten sich nicht.
Étienne nahm ihre eiskalte Hand. »Dass du zusammenbrichst, bringt Boy nicht zurück. Bitte, Coco, lass uns reingehen und ein wenig schlafen. Wenn du nicht bei Bertha bleiben möchtest, werde ich ein Zimmer für dich mieten …«
Ihr Gehirn funktionierte noch. »Weiß Bertha, wo sich der Unfall ereignete?«, kam es schwach über ihre Lippen.
»Ja. Sie sagte, es sei an der Nationalstraße 7, zwischen Saint-Raphaël und Cannes passiert, irgendwo in der Gegend von Fréjus, in der Nähe eines Dorfes namens Puget-sur-Argens.«
»Ich möchte dorthin.«
»Morgen«, versprach er, sein Ton war verzweifelt. »Ich bringe dich dorthin, sobald es hell geworden ist. Bitte sei so gut und komm bis dahin mit mir ins Hotel.«
Sie widersprach nicht. Was sollte sie auch einwenden? Sie durfte nicht für die nächsten Stunden in Étiennes Automobil am Straßenrand mitten in Cannes sitzen bleiben. Irgendwann würde unweigerlich die Polizei auftauchen, und es gäbe einen Skandal, weil Coco Chanel die Nacht in einem Fahrzeug verbrachte statt in einem Hotel. Ihre Gefühle drängten sie zwar sofort an den Unglücksort, aber eine weitere gefährliche Nachtfahrt konnte sie Étienne nicht zumuten. Er war so liebevoll mit ihr umgegangen, mehr als ein Freund, fast wie ein Bruder. Er verdiente, dass sie sich einsichtig zeigte und ihm ein paar Stunden Schlaf gönnte. Dass sie selbst nicht zur Ruhe kommen würde, war eine andere Sache.
Ihre Beine drohten, ihr den Dienst zu versagen, doch Gabrielle stieg endlich aus dem Wagen. Ihre Muskeln waren verspannt vom langen Sitzen, ihre Knochen schmerzten. Bei ihrem ersten Schritt knickte sie um, aber Étienne nahm ihren Arm und gab ihr Halt.
Dem Portier erklärte Étienne, Lady Michelham erwarte Mademoiselle, dann mietete der Freund für sich ein Zimmer auf demselben Stockwerk.
Gabrielle sprach kein Wort. Nicht, als sie durch die marmorne Halle zu dem Fahrstuhl gingen, misstrauisch beäugt von anderen Gästen, die sich über die fehlende Abendgarderobe und das mangelnde Gepäck wundern mochten wie auch über ihre geisterhafte Erscheinung. Gabrielle nahm keine Notiz von den Leuten.
Was interessierten sie die Lebenden? Ihre Gedanken galten einzig einem Toten. Sie sprach nicht, als sie der Page zu Berthas Suite geleitete. Still marschierte sie neben Étienne durch den langen Hotelflur, ihre Absätze versanken tonlos in dem dichten Flor des Teppichs.
Im Gegensatz zu Gabrielle war Boys Schwester in Tränen aufgelöst. Sie küsste Gabrielles trockene Wangen und hinterließ einen feuchten Film auf ihrer Haut.
»Es ist furchtbar«, schluchzte Bertha. »Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen wiedergesehen.«
»Ja«, erwiderte Gabrielle schlicht.
»Du musst dich ausruhen, meine Liebe. Ich habe nebenan das Bett machen lassen …«
»Nein«, fuhr Gabrielle dazwischen. »Ich brauche kein Bett.« Sie blickte sich in dem mit eleganten Louis-seize-Möbeln ausgestatteten Salon um, bis ihre Augen an der Chaiselongue am Fenster hängenblieben. »Wenn es dir recht ist, würde ich mich gern dorthin setzen.«
Irritiert sah Bertha zur Tür des zweiten Schlafzimmers. Ihre mit Tränen benetzten Wimpern flatterten. »Wie willst du dort schlafen? Nimm das Bett, es ist viel bequemer.«
Gabrielle schüttelte den Kopf und ging ohne eine weitere Erklärung zu dem Polstermöbel. Steif setzte sie sich hin. Dankbar, dass Étienne in seinen eigenen Räumlichkeiten verschwunden war. Seiner Überredungskunst würde sie womöglich weniger gut standhalten können als Berthas hilflosen Attacken.
Sie zog sich nicht aus, lehnte das seidene Nachtgewand und den Morgenmantel ebenso ab wie eine leichte Decke, die Bertha bringen ließ. Komplett angezogen blieb sie auf ihrem selbstgewählten Platz, den Blick auf das Fenster gerichtet.
Von hier aus konnte sie in den Himmel schauen. Es war der bestmögliche Ort für ihre Totenwache. Nachdem ihr ein letzter Blick auf den Geliebten verweigert worden war, gelänge es ihr vielleicht, wenigstens Boys Seele ins Paradies aufsteigen zu sehen.
* * *
Die aufgehende Sonne tauchte die zerklüfteten Felsformationen in purpurnes Licht, in der Dämmerung ragten die Seekiefern wie schwarze Paspeln auf einem hellblauen Kleid in den Morgenhimmel, das Meer zur Linken der sich in engen Kurven aufsteigenden und dann wieder hinabwindenden Straße glänzte wie ein ferner Teppich aus Platin.
Der Chauffeur, den ihnen Bertha Michelham zur Verfügung stellte, lenkte das Automobil langsam über die gefährliche Strecke. Er war wohl auch deshalb so konzentriert, weil er ebenso wie seine Fahrgäste an den Unfall dachte, der sie hierherführte. Bertha hatte Gabrielle und Étienne vorgeschlagen, sie in ihrem Wagen zum Unglücksort fahren zu lassen. Eine umsichtige Lösung, da sie Étienne auf diese Weise die Last der Suche abnahm – ihr Diener kannte die Stelle bereits.
Doch trotz aller Vorsicht konnte der Fahrer nicht verhindern, dass das Auto ins Schlingern geriet, als er das von einem Maultier gezogene Fuhrwerk überholte und im selben Moment ein Hase aus dem Dickicht eines Wacholderstrauchs auf die Fahrbahn hoppelte, dem er auszuweichen versuchte.
Gabrielle, die zusammengesackt im Fond saß, wurde gegen Étiennes Schulter geschleudert. Unwillkürlich hielt sie den Atem an, fragte sich ein paar Herzschläge lang, ob dies ihr Ende sei. Ein zweiter Unfall auf der Straße zwischen Cannes und Saint-Raphaël binnen kürzester Zeit. Eine große Liebe, die in diesem Gebirgsmassiv ihr Ende fand. Wahrscheinlich war es die beste Lösung, wenn sie Boy folgte.
»Es ist nichts passiert«, sagte Étienne und strich sanft über ihren Arm, bevor er sie auf ihren Platz zurückschob. Der Wagen glitt wieder ruhig durch die einsame Landschaft.
Nein, dachte Gabrielle, während sie aus dem Fenster starrte, mein Tod wäre nicht die beste Lösung. Es wäre der einfachste Weg, aber nicht der, den Boy gewollt hätte. Wie sie ohne ihn weiterleben sollte, wusste sie nicht. Aber sie würde einen Weg finden müssen. Sie würde später darüber nachdenken, wie sie ohne den Mann leben sollte, der ihr das Leben überhaupt erst geschenkt hatte. Das Leben Coco Chanels. Er war nicht nur ihr Liebhaber gewesen, sondern auch ihr Vater, ihr Bruder, ihr Freund.
»Mademoiselle, Monsieur, wir sind da.« Der Chauffeur bremste den Wagen ab, ließ ihn am Straßenrand ausrollen, der Motor erstarb. Dann stieg er aus, um seinen Fahrgästen den Schlag zu öffnen.
Gabrielle fühlte sich, als würde sie sich selbst zuschauen. Als würde sie eine Frau von Mitte dreißig beobachten, die ihren Hut festhielt, der von dem in dieser Höhenlage auffrischenden Wind fortgeweht zu werden drohte. Deren Reisekostüm zerknittert war, die sich mit tastenden, unbeholfenen Schritten voranbewegte.
Da waren die Überbleibsel eines ausgebrannten Automobils, das die Böschung hinauf an den Straßenrand gezogen worden war. Dahinter fielen die Felsen scharfkantig ab, Eukalyptus und Heidekraut waren umgeknickt, wo das Fahrzeug ursprünglich gelegen hatte.
Gabrielle war allein, die beiden Männer in ihrer Begleitung hielten sich taktvoll zurück. So sah sie aus ihrer inneren Distanz auf diese Frau, die zu dem ausgebrannten, verbeulten Klumpen aus Blech, Holz, Leder und Gummi trat, der einmal ein teures Cabriolet gewesen war. Es war so unwirklich wie eine Sequenz aus einem Film.
Erst als sie direkt neben dem Wrack stand, wurde sie sich der Wirklichkeit bewusst. Ein scharfer Geruch stieg ihr in die Nase. Noch immer schwebte der Gestank von Benzin, Schwefel und verbranntem Gummi über dem Wagen, und seltsamerweise vermittelte ihr der Geruchssinn stärker als ihre visuelle Wahrnehmung die Realität des schrecklichen Unfalls. Mit einem Mal war greifbar, was sie bislang nicht hatte fassen können.
Rasch aufflammende Sonnenflecken wechselten sich mit länger gewordenen dunklen Schatten ab und blendeten den Fahrer. Der Wind, der ihm entgegenwehte, war feucht und kühl und hinterließ auf seiner Haut ein erregendes Prickeln, verband sich mit seinem heißen Atem und beschlug seine Brille. Dennoch fuhr er in rasantem Tempo, eben so, als befände er sich bei klaren Lichtverhältnissen auf gerader Strecke. Er war viel zu schnell unterwegs, aber er war ein Mensch, der nichts besonnen oder langsam tat. Das Aufheulen des Motors war Musik in seinen Ohren, mal Scherzo, dann Rondo. Die Bremsscheiben quietschten. Stahl rieb auf Stahl, Gummi auf Teer. Dann hob sich das Fahrzeug in die Lüfte, knickte Sträucher und Bäume ab, um schließlich auf einer Felskante aufzuschlagen und in einem Feuerball zu explodieren.
Gabrielle streckte vorsichtig die Hand aus, berührte die zerbeulten Überreste des Rolls-Royce, in Erwartung, sich zu verbrennen. Doch das Metall war schon so kalt wie Boys Körper in seinem Sarg.
In diesem Moment brach sie zusammen. Die Tränen, die seit Étiennes Ankunft in La Milanaise nicht hatten fließen wollen, brachen sich Bahn. Als würden alle Schleusen ihres Körpers, ihrer Seele, ihres Herzens geöffnet, begann Gabrielle bitterlich zu weinen.
Kapitel 3
Marie Sophie Godebska, geschiedene Natanson, geschiedene Edwards, war im Alter von siebenundvierzig eine unverändert schöne Frau von atemberaubender Eleganz. Die musische Erziehung im Haus ihrer Großmutter bei Brüssel und der Umzug des Backfisches mit seinem polnischen Vater nach Paris sowie der frühe Kontakt zu den bedeutendsten Künstlern der sogenannten Belle Époque hatten ihren Geschmack geprägt. Dieser Schönheitssinn gepaart mit großer Intelligenz machte Misia, wie sie genannt wurde, zu einer Ausnahmeerscheinung. Durch das Vermögen ihres zweiten Mannes und die Beziehung zu dem berühmten spanischen Maler José Sert avancierte sie schließlich von der Muse zur Königin der Pariser Gesellschaft und zur Mäzenin. Es waren indes ihre Liebenswürdigkeit und ihr Freiheitsdrang, die sie zwei Jahre nach ihrer ersten Begegnung zur engsten Freundin von Gabrielle Coco Chanel machten.
Als sie sich an diesem trüben Winternachmittag von ihrem Chauffeur nach Saint-Cucufa fahren ließ, war sie nicht nur auf dem Weg zu einem Kondolenzbesuch, sie sah sich eher auf einer Mission als Lebensretterin. Alles, was sie über das Seelenheil der Trauernden gehört hatte, war beängstigend. Natürlich brauchte Coco Zeit, sich ein Leben ohne Boy einzurichten. Aber deshalb sollte sie nicht zu einem Schatten ihrer selbst werden.
Ihr Zustand war offenbar so alarmierend, dass sich Joseph mit einem Hilferuf an Misia gewandt hatte. Wenn Coco schwarze Messen abgehalten oder Geisterbeschwörungen betrieben hätte, wäre Misia nicht so aufgebracht wie über den Hinweis, dass Mademoiselle ihren Verstand verlöre. Wie verzweifelt musste der Diener sein, sich so zu äußern? Außer Étienne Balsan wusste keiner über Cocos Zustand Bescheid. Seit ihrer Rückkehr von der Côte d’Azur hatte sie niemand gesehen, ihr Modehaus blieb in den Weihnachtsferien geschlossen.
Von größten Sorgen getrieben, wollte Misia die Vorgänge in La Milanaise selbst in Augenschein nehmen. Während ihr Wagen die Auffahrt hinaufglitt, betete sie, dass sie nicht zu spät kam. Wofür auch immer. Vor allem wahrscheinlich, um Coco vor sich selbst zu schützen.
Joseph öffnete die Tür. »Gut, dass Sie da sind, Madame«, stieß er erleichtert hervor. Seine gepressten Worte waren trotz des anschwellenden Bellens und Winseln hinter ihm deutlich vernehmbar.
Er nickte Misia entschuldigend zu, bevor er die Stimme hob, um die Hunde zurechtzuweisen: »Couche! A place!«
Die zwei Schäferhunde gaben sofort Ruhe und traten den Rückzug zu ihren Decken im hinteren Bereich der Villa an, nur die beiden kleinen Terrier, ein Geschenk von Boy an die Hausherrin, kläfften weiter und strichen neugierig um die Beine der eintretenden Besucherin.
»Wie geht es Mademoiselle Chanel?«, fragte Misia, den Blick auf Pita und Popee gesenkt.
Joseph half ihr aus dem Pelzmantel. »Mademoiselle erscheint mir gänzlich von Sinnen. Bei ihrer Rückkehr aus Südfrankreich verlangte sie, die Wände ihres Schlafzimmers schwarz zu streichen. Stellen Sie sich das bitte vor, Madame! Schwarz. Pechschwarz.« Er schüttelte den Kopf. »Sie lebte in ihren Gemächern wie in einer Gruft. Sie schloss sich ein und wollte keine Mahlzeit zu sich nehmen. Es war schrecklich.«
»Lebte?« Die von Joseph benutzte Vergangenheitsform ließ Misia sogar die Sorge um ihre Seidenstrümpfe vergessen, die gerade den Krallen einer Terrierpfote ausgesetzt waren. »Was ist mit Mademoiselle geschehen?«
»Eben kam sie herunter und wies mich an, den Maler zu bestellen. Jetzt soll er ihr Schlafzimmer rosarot streichen. Bis dahin will sie es nicht mehr betreten. Doch ich frage mich, ob ein Pink die bessere Wahl für Mademoiselles Gemüt ist …«
»Wo ist sie jetzt?«, schnitt Misia die Überlegungen des Dieners ab.
»Im Salon, Madame.« Joseph bückte sich und klemmte sich unter jeden Arm einen kleinen, zappelnden Hund. »Wenn Sie mir bitte folgen möchten.«
Misia warf einen flüchtigen Blick auf ihre schmale Fessel, die unter ihrem knöchelkurzen Rock hervorlugte. In ihrem Seidenstrumpf breitete sich ein kleines Loch zu einer Laufmasche aus. Ein ärgerliches Malheur. Aber natürlich vollkommen unwichtig angesichts des Elends jenseits der Salontür, die Joseph nun umständlich öffnete.
Misia fühlte sich innerhalb von Sekunden wie in einem Eiskeller gefangen. Obwohl im Kamin des Wohnzimmers ein frisch geschürtes Feuer loderte – Joseph oder seine Frau Marie kümmerten sich fürsorglich um Coco –, herrschte eine Atmosphäre, die sie unverzüglich frösteln ließ.
Coco saß – nein, kauerte – in einem Sessel und starrte vor sich hin. Blicklos. Leblos. Bei Misias Eintreten flatterten ihre Lider kurz, aber sie sah nicht wirklich auf, ihre Augen wirkten trübe. Ihr Gesicht war so weiß wie die Seide ihres Schlafanzugs, den sie trotz der späten Tageszeit noch trug. Sie war schon immer sehr schlank gewesen, aber jetzt erschien sie Misia einfach nur dünn. Ausgemergelt. Wahrscheinlich hatte Coco seit Tagen nichts gegessen.
»Liebste, ich bin untröstlich«, Misia beugte sich hinunter, um ihre Wange kurz gegen Cocos Wange zu legen und einen Kuss in die Luft zu hauchen. »Es tut mir so leid«, fügte sie hinzu, als sie sich wieder aufrichtete und sich nach einem Sitzplatz umsah. Schließlich ließ sie sich auf dem Sofa nieder. Sie drehte das Bein in dem kaputten Strumpf so, dass man den Schaden nicht gleich bemerkte.
Doch Coco hatte kein Interesse an Äußerlichkeiten. »Danke, dass du gekommen bist«, erwiderte sie matt. »Was kann Joseph dir bringen? Kaffee? Ein Glas Wein?« In ihrer Reichweite stand eine unberührt wirkende Tasse Tee auf einem Beistelltisch, der Inhalt war vermutlich bereits kalt.
»Solange du nichts zu dir nimmst, möchte ich auch nichts.«
Coco nickte stumm.
»Es ist schwer für dich. Natürlich. Aber, Liebes«, Misia suchte nach Worten, dann: »Du musst wieder zu dir kommen. Wir machen uns alle schreckliche Sorgen um dich.« Sie sagte nicht, wen sie in das Personalpronomen mit einschloss.
Wieder nickte Coco, doch diesmal sprach sie: »Heute Morgen war die Trauerfeier für ihn in der Kirche an der Place Victor Hugo.« Sie starrte weiter vor sich hin, blickte nicht einmal zu Misia hin, sondern sah vermutlich irgendwo in der Ferne ihrer Gedanken Boy vor sich. »Étienne sagt, die Beisetzung findet auf dem Friedhof von Montmartre statt …«
»Ich weiß«, sagte Misia leise. Sie hatte kurz vor ihrer Abfahrt nach Saint-Cucufa von einer anderen Freundin gehört, dass Boys Witwe dem Gottesdienst ferngeblieben war. Wahrscheinlich hatte Diana damit gerechnet, dass Coco kommen würde, doch auch die hatte nicht an der Gedenkfeier teilgenommen.
Als habe sie ihre Gedanken gelesen, fuhr Coco fort: »Ich wollte nicht hingehen, weil mein Platz irgendwo weit hinten in der Trauergemeinde gewesen wäre. Diesen Triumph über unsere Liebe habe ich ihr nicht gegönnt … War das ein Fehler, Misia?« Endlich sah sie zu der Freundin auf.
Misias Herz zog sich zusammen, als sie des Schmerzes, der Verzweiflung in Cocos Blick gewahr wurde. »Sicher nicht«, meinte sie und rutschte auf die Sofakante, um die Hand ihrer Freundin zärtlich zu streicheln. »Du hast immer getan, was du in dem jeweiligen Moment für richtig gehalten hast, und es hat sich tatsächlich im Nachhinein immer als richtig erwiesen. So wird es diesmal auch sein. Deine Intuition ist eine deiner größten Stärken. Ich bewundere dich dafür.«
»Boy war das Wichtigste für mich. Wir waren eine Einheit, wir verstanden einander ohne Worte.«
»Ich weiß«, wiederholte Misia. Die beiden Freundinnen waren etwa zur selben Zeit der Liebe ihres Lebens begegnet. Als Coco und Boy sich verliebten, kannte Misia die beiden zwar noch nicht, aber damals – vor zehn oder elf Jahren – hatte sie sich in José Sert verliebt. José war für Misia, was Boy für Coco gewesen war – und die Vorstellung, dass sie den Geliebten von einem Tag auf den anderen für immer verlieren könnte, war so furchtbar, dass sie Cocos Qualen nicht nur nachvollziehen konnte, sondern mit ihr litt.
Sie musterte die Freundin, die mit jedem Moment, der verstrich, kleiner zu werden drohte. Da war dieser körperliche Verfall, aber dem Wahnsinn schien Coco nicht nahe. Was immer sie sich dabei gedacht hatte, die Wandfarbe in ihrem Schlafzimmer so drastisch zu verändern, den Verstand hatte sie anscheinend nicht verloren. Doch ganz offensichtlich befand sie sich in einem beängstigenden Zustand. Wie viele Frauen waren schon an einem gebrochenen Herzen gestorben?, sinnierte Misia. Im Großen Krieg hatte es nicht annähernd so viele tote Frauen gegeben wie gefallene Soldaten. Jedenfalls war nichts darüber bekannt. Es ist unsere Pflicht, zu überleben, fuhr es ihr durch den Kopf. Nur durch unsere Liebe können die Toten in unserer Erinnerung lebendig bleiben.
»Boy war großartig«, hob sie an. »Daran besteht kein Zweifel. Deshalb würde er wollen, dass du dort weitermachst, wo ihr gemeinsam aufgehört habt. Um seinetwillen.«
Aus Coco sprach die pure Verzweiflung, als sie aufbegehrte: »Aber wie sollte ich irgendetwas ohne ihn tun können? Ich bin nichts ohne ihn!«
»Du bist noch immer alles, was Boy geliebt hat.«
Coco sah Misia verwundert an. Als sei ihr noch gar nicht bewusst gewesen, dass Boy auf gewisse Weise in ihr, durch sie weiterleben könnte.
Froh, die starre Fassade der Trauer zumindest für diesen Moment durchbrochen zu haben, redete Misia rasch weiter: »Du hast erst kürzlich das Haus Nummer einunddreißig in der Rue Cambon bezogen – fünf Etagen Chanel, und es ist noch nicht einmal alles eingerichtet. Boy hat mir erzählt, dass du mit der neuen Adresse erstmals im Handels- und Gesellschaftsregister als Couturier und nicht als Putzmacherin gelistet bist. Er war so stolz auf dich. Du kannst das nicht aufgeben, weil dich deine Trauer lähmt …«, sie unterbrach sich, drückte kurz Cocos Hand und fuhr dann fort: »Natürlich ist dir Schreckliches widerfahren. Aber siehst du es nicht als Pflicht an, eure gemeinsamen Pläne zu verwirklichen? Du musst es allein tun. Ja. Aber du musst es tun. Schau nach vorne, Coco!«
Sie legte eine Pause ein, wartete auf Cocos Zustimmung, doch die Freundin schwieg, sah sie aus ausdruckslosen Augen an. Deshalb setzte sie nach einer Weile eindringlich hinzu: »Liebes, ich lasse dich auf diesem Weg nicht allein. Wenn du mich brauchst, werde ich für dich da sein. Das verspreche ich dir.«
Cocos Blick schweifte ab, als suche sie irgendwo in der Ferne nach einer Antwort. Ihr Körper schien sich aufrichten zu wollen, doch es gelang ihr unter der Last ihrer Trauer noch nicht.
»Worüber habt ihr zuletzt gesprochen?«, fragte Misia. Sie schickte ein stilles Gebet in den Himmel, Gott möge ihr die Eingebung schicken, mit der sie Coco aus ihrer Lethargie befreite. Auf gut Glück fügte sie hinzu: »Ich meine, welche geschäftlichen Pläne hattet ihr?«
»Ich weiß es nicht mehr. Misia, ich erinnere mich nicht mehr, worüber wir im Detail gesprochen haben. Da war so vieles …« Verzweifelt versuchte Coco, nach etwas in ihrer Erinnerung zu greifen, aber es gelang ihr nicht. Eine Träne stahl sich aus ihren Augen, und sie wischte über ihr Gesicht, als wollte sie ein lästiges Insekt entfernen. Plötzlich kam ein wenig Leben in ihre Züge. »Es ging um ein Parfüm. Doch, ja, wir unterhielten uns über ein Toilettenwasser.«
Misia sprach ein stummes Dankesgebet und wartete.
Cocos Stimme klang seltsam monoton, fast erstaunt, als wunderte sie sich, wie gut ihr Gedächtnis mit einem Mal funktionierte: »In der Zeitung stand etwas über diesen Frauenmörder, der nur deshalb gefasst wurde, weil ihn eine Zeugin an seinem Duft erkannte. Der Mann benutzte Mouchoir de Monsieur von Jacques Guerlain, und Boy und ich sprachen über die Einzigartigkeit dieses besonderen Parfüms. Wir überlegten, ob ich meinen Kundinnen nicht ein Eau de Chanel anbieten sollte. Nicht in den Boutiquen, sondern als Präsent zu Weihnachten. Eine Auflage von einhundert Flakons …« Ihre Stimme brach.
Misia war sich im Klaren darüber, dass es für Coco niemals wieder ein sorgloses Fest geben könnte, an dem sie nicht an Boys Unfall erinnert würde. Aus Furcht, die Freundin würde wieder in ihrem Meer aus Traurigkeit versinken, plapperte sie munter drauflos: »Nun, ein Duft ist ein Geschenk für alle Zeiten. Das ist eine wunderbare Idee. Sieh dir nur François Coty an: Mit Chypre hat er ein Vermögen verdient, weil die amerikanischen Soldaten den Flakon millionenfach als Souvenir aus Frankreich nach Hause schickten oder beim Truppenabzug mitnahmen. Deine Kundinnen werden ein Eau de Chanel lieben …«
»Monsieur Coty ist Parfümeur. Er besitzt eine Fabrik. Ich bin nur eine kleine Schneiderin.«
»Sei nicht albern, Liebes.« Misia begann sich zunehmend für das Thema zu erwärmen. Sie ließ Cocos Hand los, um aufgeregt gestikulierend fortzufahren: »Paul Poiret ist auch nur Modeschöpfer …«
»Aber der größte …«
»Poirets Prominenz hat bisher nichts an deinem Ehrgeiz geändert und sollte es auch in Zukunft nicht tun. Wichtig wäre, eine Duftnote zu finden, die so einzigartig wie deine Mode ist. Keine schweren Parfüms, die vor allem nach Rosen riechen. Paul Poirets Parfum de Rosine ist nichts anderes als ein anderer Sinneseindruck seiner Kreationen. Das ist nicht mehr der letzte Schrei. Du bist erfolgreich, Coco, weil …«
»… weil ich Boy an meiner Seite hatte.«
Misia stöhnte innerlich auf. »Ja, natürlich, auch. Aber mit Verlaub, Coco, er hat deine Kleider nicht entworfen. Es sind deine Ideen, die so modern sind. Vor allem deshalb bist du erfolgreich. Und wenn du bei der Wahl der Aromen für ein Toilettenwasser die Besonderheit deines Stils berücksichtigst, wirst du Boys Andenken ein Denkmal setzen.« Atemlos hielt Misia inne, verknotete die Finger in ihrem Schoß und wartete auf Cocos Reaktion.
»Du hast recht. Den Gedanken hatte ich auch schon: Ich werde ein Denkmal für Boy errichten lassen. Aus Stein. Am Unglücksort. Ich möchte einen Platz des Erinnerns für ihn schaffen.«
»Sieh in die Zukunft, Coco! Bitte, wende den Blick nicht zurück. Für Boy. Für mich. Du kannst nicht einfach aufgeben.«
Gedankenverloren fuhr sich Coco mit der Hand durch das Haar. »Ich sage ja nicht, dass ein Eau de Chanel keine gute Idee wäre. Meine Güte, es war Boys Vorschlag – wie sollte ich annehmen, dass er nicht wunderbar war? Aber ich kann das nicht tun. Ich kann Hüte entwerfen und Kleider nähen, aber ich habe nicht die geringste Ahnung von der Arbeit eines Parfümeurs. Das ist ein besonderes, ein ganz spezielles Fach. Ich schaffe das nicht allein. Und ich wüsste niemanden, der mich in dieser Sache unterstützen könnte. Ich müsste dieser Person unbedingtes Vertrauen schenken. Boy hätte mir geholfen. Aber Boy ist nicht mehr da, um mit mir gemeinsam herauszufinden, wie mein Duft sein soll.«
Misia bezweifelte, dass der kunstinteressierte, literarisch gebildete Arthur Capel die geeignete Person gewesen wäre, Coco mit den Arbeitsprozessen in einem chemischen Laboratorium vertraut zu machen. Sie überging ihre Bedenken und entschied sich, die Sache in die Hand zu nehmen. »Yvonne Coty ist eine gute Freundin. Du kennst sie doch auch, nicht wahr? Kauft sie nicht sogar bei dir? Wie auch immer: Ich könnte sie bitten, mit ihrem Mann zu sprechen. François Coty wird dich gewiss unterstützen. Er kann keiner Frau einen Wunsch abschlagen, und niemand kann dich besser in die Geheimnisse der Düfte einweisen als der weltweit größte Fabrikant von Kosmetikartikeln.«
»Als wir darüber sprachen, meinte Boy, François Coty sei der Beste, um ein Eau de Chanel herzustellen«, murmelte Coco.
»Wie recht er hatte.«
Coco sah Misia aus großen, unergründlichen Augen an. »Warum sollte ein vielbeschäftigter Mann wie Monsieur Coty Zeit für mich aufbringen? Man sagt, er sei ein Tyrann.«
»Aber ein sehr charmanter Tyrann.« Misia schmunzelte. »Weißt du, auch ein François Coty hat seine Schwächen. Yvonne erzählte mir, wie wichtig es ihm ist, Eindruck zu ma