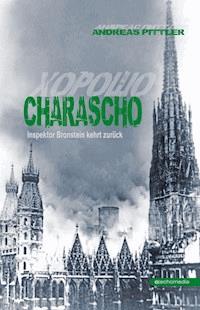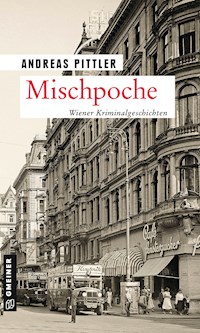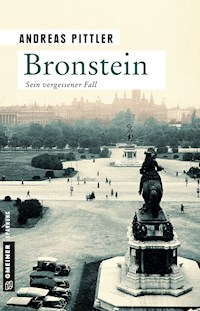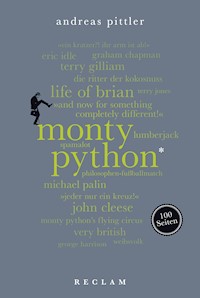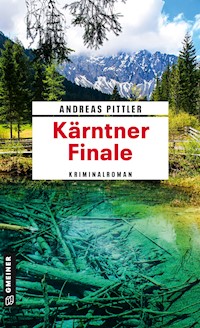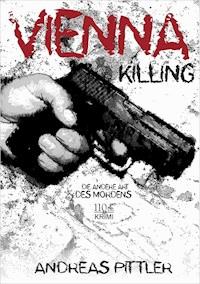Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Andrew O’Connor, irischer Aufständischer gegen Englands Königin, hat alles verloren, was ihm lieb und teuer war. In der katholischen Kirche findet er eine neue Familie, die ihn nach Wien entsendet, um dort einen protestantischen Laienprediger zu verhören, der des Ketzertums angeklagt ist. Die beiden ringen um Glaubenswahrheiten und gehen der Frage nach, welchen Sinn die menschliche Existenz nun wirklich hat. Doch alles, woran Andrew glaubte, wird plötzlich in Frage gestellt, als das Schicksal ihn auf dramatische Weise mit seiner Vergangenheit konfrontiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1334
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Pittler
Der göttliche Plan
Historischer Roman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2016
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relações_anuais_das_coisas_que_fizeram_os_padres_da_Companhia_de_Jesus_nas_suas_Missões_do_oriente,_África_e_Brasil_nos_anos_de_1607_e_1608.jpg
ISBN 978-3-8392-4898-0
Ante Scriptum
Auf den ersten Blick sind der Aufbau und die Leitung der Welt einem Schauspiel äußerst ähnlich, ja es ist wirklich ein Schauspiel, das die Weisheit Gottes auf dem Erdkreis mit den Menschenkindern spielt. Nun ist aber nichts typischer für ein Schauspiel, als dass es die Zuschauer, die am Anfang wenig verstehen, worauf das Stück hinauswill, durch erstaunliche Verwicklungen schließlich dahin führt, dass sich, nachdem sich alle auf eine Katastrophe eingestellt haben, das Vorausgegangene und das gerade Gespielte und der vorbereitete, rettende Schluss dem Verständnis aller immer deutlicher erschließt. So bekommt der dramatische Dichter zuletzt für seine künstlerische Geschicklichkeit Applaus, wenn der glückliche Ausgang, den er für alle Verwirrungen gefunden hat, offen vor aller Augen liegt. Im Ernst, gehört es sich etwa, vom himmlischen Künstler weniger zu erwarten? Was aber darf man dann berechtigterweise von seinem Handeln zum Abschluss des großen Dramas, welches er mit dem Menschengeschlecht spielt, nicht alles erwarten?
Jan Amos Komensky: »Consultatio Catholica« (1645)
I. Teil: Glaube
I.
ROM
25. Dezember Anno Domini 1616
Eine sternenlose, finstere Nacht. Gnadenlos peitschte eisiger Sturmwind schwarze Wolken über den mitternachtsblauen Himmel. Ein Fauchen und Heulen verhieß Unheil. Hilflos taumelten die wenigen Laternen hin und her, Betrunkenen gleichend. Selbst die Häuser schienen Angst zu haben und sich noch enger aneinanderzuschmiegen wie die verunsicherte Herde angesichts jaulender Rufe eines Wolfsrudels. Der Wind flitzte durch die Ritzen, ab und an fiel eine Dachschindel herab auf den froststarren Boden. Und eiskalte Luft fegte vom Tiber her.
Dong.
Die Leuchtfeuer in der Via della Conziliazone wehrten sich gegen das Ungemach der Naturgewalt, flackerten hektisch, setzten immer wieder für einen Wimpernschlag aus, um dann mit verzweifelter Hoffnungslosigkeit erneut aufzuflammen. Stürmisch rannte der Dezemberwind gegen sie an, blies ein Licht nach dem anderen aus, ein letztes Zischen noch, dann nicht enden wollende Dunkelheit. Vereinzelt schlugen Fensterläden gegen die trostlosen Mauern, als begehrten sie Einlass, um Schutz zu finden vor der erbarmungslosen Kälte.
Dong.
Eine hauchdünne Eisschicht bedeckte die ekligen Pfützen auf der Straße. Der steinharte Kot war längst ergraut, ein Meer kleiner Felsen inmitten einer sandigen Wüstenei. Und doch wurde immer wieder ein Stück Dreck vom Sturm erfasst, emporgerissen, hinweggeschleudert, wie eine Mörserkugel im Boden einschlagend, um sich sodann noch das eine oder andere Mal zu überschlagen, endlich wieder Ruhe findend für eine Weile.
Dong.
Sturmumtost schien selbst der Obelisk zu wanken, der einsam vor der schwarzen Silhouette von St. Peter in das dunkle Nichts ragte, ein verlorener Leuchtturm, dessen Feuer verloschen war. Und immer noch jagten die Wolken übers Firmament, flohen vor der Kuppel des Doms, der just in dieser Nacht allen Katholiken Anker der Hoffnung war.
Dong.
Langsam und monoton erklang die große Glocke der Basilika, alle Gläubigen zur Mette zu rufen. Klamme Finger zogen das Seil immer und immer wieder, während sie eifrig angehaucht wurden in der wahnwitzigen Hoffnung, diese Verrichtung würde Erfrierungserscheinungen hintanhalten. Die dicken Mauern mochten vor dem tosenden Wind einigermaßen Schutz bieten, doch vor der Kälte gab es kein Entrinnen, sie schien durch die Steine sogar noch verstärkt zu werden. Doch wer ein gottgefälliges Werk verrichtete, den mochte der Herr in seiner Güte wohl nicht strafen. Und so zogen die froststarren Finger weiter am Glockenseil.
Dong.
In der Ferne ragte die Engelsburg empor, ihr schwarzer Umriss glich einem Berg, von dem der Papst herabgestiegen war, um sich in einer pompösen Kutsche zur Peterskirche fahren zu lassen. Bald schon würde er die Christmette zelebrieren, auf dass sich die Stadt und der ganze Erdkreis freuen möge: Der Herr ist uns geboren.
Dong.
In den engen Gassen kam Bewegung auf. Ein verlorenes Rudel flutete auf die Kirche zu. Zuerst kämpften nur einige wenige gegen die beißende Kälte an, doch bald schon schlossen sich diesen Pionieren weitere Seelen an. Sie strömten auf der Via della Conziliazone zusammen und hielten Kurs auf den Obelisken. Manche dieser Gläubigen trugen nur unzureichendes Schuhwerk, andere wiederum waren durch edle Stiefel einigermaßen geschützt. Gemeinsam war all diesen Menschen das Bemühen, dem erstarrten Dreck zu entgehen. Die Füße marschierten nicht gleichmäßig vorwärts, sie bahnten sich in befremdlicher Schrittabfolge einen möglichst schmutzfreien Weg, dabei immer wieder Lacken, Unrat und Pferdemist überspringend. Ab und an ließ sich ein völlig unchristliches Fluchen vernehmen, wenn jemand dennoch in den Kot getreten war. Doch hatte Christ der Herr ungleich mehr gelitten, als er sich anschickte, die Menschheit von ihren Sünden zu erlösen. Also musste man seine Menschwerdung würdig feiern, wenn es denn sein sollte, auch mit kotverschmierten Füßen.
Dong.
Glo ri a in ex celsis De o. Verzerrte, zerrissene Tonfetzen drangen aus der Kirche nach draußen. Lobgesänge auf den Herrn, die im Inneren des Doms auf das Hochamt einstimmen sollten. Selbst die kräftigsten Stimmen wirkten verloren angesichts des satanischen Geheuls der Elemente, die entschlossen schienen, dem himmlischen Lobgesang ihr höllisches Treiben entgegenzusetzen. Auch die Mitglieder des Chors wussten nicht, ob sie nun aus christlichem Lobpreis sangen oder aus Angst vor dem drohenden Unwetter. Und die himmlischen Chöre blieben stumm in jener Nacht.
Dong.
Langsam wuchs die Menge auf dem Petersplatz an, suchte die Entfernung zur Kirche im Eiltempo zurückzulegen, um schnell der ungeschützten Weite des Platzes zu entkommen. Ein Stoßen und Drängen, murrende zischende Laute, Worte des Aufbegehrens, Entgegnungen der Beschwichtigung. Der Strom der Menschen schmolz zu einer schmalen Kette zusammen, die sich vor dem Obelisken teilte, um sich unmittelbar nach dem Bauwerk wieder zu vereinigen. Und so blieb sie bis zum großen Hauptportal, das allein geöffnet war, die Schar der Betenden einzulassen. Zu viert und zu fünft quetschten sich die frommen Gestalten in das Innere des Gotteshauses, um sich dort entlang der Seitenmauern zwanglos zu verteilen. Kaum jemand blieb in der Mitte des Gebäudes stehen, sondern suchte Schutz in einer der Nischen, mitunter steuerten einige den Altar ihres Heiligen an und hielten an einer von ihnen gestifteten Votivtafel, dort schweigend ins Gebet vertieft.
Dong.
Kirchendiener waren damit beschäftigt, das Heer der Kerzen zu entzünden, vor dem Hauptalter wurden noch die Blumen arrangiert, Edelmänner legten Gaben vor Petri Grab nieder, Handwerker taten es ihnen vor der Statue des Apostels Andreas gleich, Bürgerfrauen knieten vor der Heiligen Helena, doch dickleibige Gestalten in bischöflichem Ornat scheuchten sie zurück ins Hintere des Kirchenbaus. Selbst am Geburtstag des Herrn war dieser Bereich den geistlichen Herren vorbehalten. Mit eingezogenen Köpfen leisteten die Laien den herrischen Gesten der Ordinierten Folge.
Dong.
Vor dem Portal herrschte immer noch großes Gedränge. Die Schweizergardisten hatten jeden Versuch, irgendeine Ordnung herzustellen, aufgegeben. Ihre Partisanen lehnten an ihren Schultern, und eifrig rieben die Soldaten die klammen Hände gegeneinander, um die Finger wieder ein wenig gelenkiger zu machen. Die Menge war auf eine unüberschaubare Größe angewachsen. Wiewohl sie sich der größten Kirche der Christenheit gegenübersah, war leicht auszurechnen, dass niemals alle Kirchgänger Einlass finden könnten. Wie stets bei solchen Anlässen würde das Gros der Menschen der Messe außerhalb der Kirchenmauern folgen müssen. Ob der schauerlichen Kälte ein nicht zu geringes Opfer zu Ehren des Herrn. Dieses voraussehend, hatten subalterne Kirchendiener für mehrere Lagerfeuer rund um den Platz Sorge tragen lassen, um den Gläubigen Licht und Wärme zu spenden. Doch den Kirchgängern schienen diese Leuchtfeuer wenig vertrauenserweckend zu sein. Hektisch züngelten die Flammen, vom wilden Wind gepeitscht, bald hierhin bald dorthin, leckten gierig nach weiterer Nahrung. Verkohlte Holzreste stoben über den Platz, gefährlichen Granaten gleich. Für einen kurzen Augenblick schienen die Flammen ihre gesamte Umgebung zu versengen, um sie sodann wieder der eisigen Kälte zu überlassen, wenn sich der Wind aufs Neue drehte. Hin- und hergerissen war die Menge, einerseits die Wärme suchend, andererseits sich vor ihr fürchtend. Doch würde der Herr in seiner Gnade just in dieser Nacht seiner Herde ein Leid antun? Ora pro nobis!
Dong.
Das Stundenglas zeigte Mitternacht. Das letzte Sandkorn war durch die Mittelöffnung geronnen. Ein letzter Schlag noch, dann würde der Papst höchstselbst aus der Sakristei in die Kirche schreiten, um das Hochamt zu zelebrieren. Die Nervosität stieg, sogar der Chor wurde in seinem Vortrag unsicher. Alles wartete nur noch. Während am Portal immer noch das umtriebige Gesumm eines Bienenstockes herrschte, faltete Camillo Borghese, der sich als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, als Stellvertreter Christi auf Erden Paul V. nannte, die Hände, um zu beten. Umständlich sank der alte Mann auf die Knie, stützte seine Ellbogen an der Querleiste des Betstuhls ab und übte sich in Demut. Niemand der Umstehenden wusste zu sagen, ob Seine Heiligkeit wirklich Gott um Rat und Hilfe anrief, doch respektvolles Schweigen schien in jedem Fall die geeignete Reaktion auf das päpstliche Tun. Die Kardinäle, die Bischöfe, die Kuraten und all die anderen, die zum Dienst an der Kirche berufen waren, senkten ihre Häupter und warteten auf ein Zeichen ihres Hirten. Dieser schlug ein Kreuzzeichen und rappelte sich schwerfällig wieder auf. Mit kleinen trippelnden Schritten begab er sich zur aufgeschlagenen Prachtbibel und blätterte mit zittrigen Fingern im Lukasevangelium und schlug das zweite Kapitel auf. Wiewohl er die betreffende Stelle in seinem langen Leben als Priester schon unzählige Male rezitiert hatte, schien es ihm dennoch notwendig, sie noch einmal zu memorieren. »Factus est autem in diebus illis, exiit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis. Haec descriptio prima facta est a praeside Syrie Cyrino, et ibant omnes ut profiterentur, singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Joseph Galilaea, de civitate Nazareth in Judaeam in civitatem David, quae vocatur Bethlehem, eo quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnante.« Diese Zeilen würden auch in jener Nacht wieder im Zentrum der Heiligen Messe stehen, und Paul wisperte sie in selbstvergessener Beflissenheit.
Dong.
Mit verstärkter Kraft setzte der Chor mit seinen Lobpreisungen fort, Klingeln verkündete den Beginn des Hochamtes, und in einer langen Reihe, je zwei und zwei, zogen die Ministranten, die Priester, die Bischöfe und Kardinäle, schließlich der Papst selbst in die Kirche ein. Vor dem Grab Petri verbeugte sich Paul, alle anderen fielen auf die Knie. Hunderte Hände schlugen das Kreuzzeichen und fuhren dann zum Mund, um geküsst zu werden. Der Papst verharrte einen Augenblick in Stille und wandte sich dann zur Gemeinde um, bereit, sie zu segnen: »Pax vobiscum.«
»Et cum spiritu tuu.«
Paul schritt zum Hauptaltar und ließ seinen Blick über das Messbuch schweifen.
Die ganze Kirche kam mit einem Mal zur Ruhe. Wo vereinzelt noch ein heiseres Hüsteln zu vernehmen war, wurde der Urheber solchen Lauts sofort mit mahnenden Blicken gestraft, worauf auch der selbstbewussteste Betbruder von weiteren Absonderungen absah – und sollte er auch daran ersticken.
Vorne am Altar verharrte Paul in unbewegter Starre. Er schien sich zu sammeln. Er fühlte, wie Hunderte Augenpaare auf ihm ruhten, und er wusste, die Besonderheit des Augenblicks verlangte von ihm ein ganz besonderes Verhalten. Er, Papst Paul V., war der höchste Würdenträger der gesamten Christenheit, und diese Nacht war die bedeutendste des Jahresumlaufs. Diesem Umstand musste fraglos Rechnung getragen werden, selbst wenn sich gerade heute alle Elemente der Hölle zusammengetan hatten, die Heiligkeit der Stunde herauszufordern. Doch war denn dies verwunderlich? Nichts konnte Satan und seine Heerscharen mehr schmerzen, als dass der Welt der Erlöser geboren ward. Der Herr in seiner unendlichen Güte hatte sich seiner Schäfchen erbarmt und seinen eingeborenen Sohn auf diese Welt entsandt, den Bund des Lebens ein weiteres Mal zu erneuern, ungeachtet der zahllosen Sünden, die die Menschheit Tag für Tag auf sich lud. Christus Jesus war das Lamm, das hinweg nahm die Sünden der Welt. Der Erlöser, der der Welt geschenkt worden war, er gab ihr seinen Frieden. Selbst wenn draußen vor der Kirche die Stürme tobten und einem der Atem gefror. Schon allein bei dem Gedanken an die gnadenlose Kälte begann Paul zu frösteln. Was hätte er jetzt gegeben für ein Glas heiße Milch. Doch die Stunde verlangte nach Erhabenheit, nach einer Predigt, an der das Kirchenvolk sich moralisch emporranken konnte, auch wenn wohl kaum angenommen werden durfte, dass die Menge außerhalb der Kirchenmauern auch nur ein Wort von dem verstehen würde können, was er, Seine Heiligkeit, der Papst, hier von der Kanzel zu verkündigen gedachte. Der Frost wurde, je länger Paul in meditativem Gebet verharrte, immer unerbittlicher, und gerne hätte er das Schließen der Portale angeordnet, doch die Heilige Mutter Kirche durfte sich auch den Armen nicht verschließen, die ihrer Segnungen so dringend bedurften.
So bekreuzigte sich denn der Papst und wandte sich den beiden Kardinälen zu, die ihm bei der Eucharistie zu assistieren hatten. Diese traten in gebotenem Respekt einen kleinen Schritt auf ihn zu. Paul ließ derweilen seinen Blick über die Gläubigen schweifen, und mit Zufriedenheit registrierte er, dass alle Familien von edler Herkunft geschlossen den Weg zur Christmette gefunden hatten. Das Licht kam zwar von Osten, aber es leuchtete in St. Peter.
Der Papst holte tief Luft, und nur wenige Sekunden später begann er förmlich das Hochamt. Ermutigt durch die ersten tröstlichen Worte seiner Heiligkeit wartete nun auch der Chor wieder auf seinen Einsatz, der allein den Gläubigen, die auf dem Platz vor der Kathedrale versammelt waren, vom Fortgang der Messe kündete. Und je länger der Gottesdienst andauerte, umso mehr schienen die höllischen Heere in ihrem Kampf gegen die Christenheit zu unterliegen. Gloria in excelsis Deo!
Die Erhabenheit des Hochamts hatte gleichwohl einen begrenzten Radius. In einer hinteren Ecke der Basilika standen die Brüder des Ordens des Heiligen Franziskus beisammen, und wenn ihnen auch die Größe der Stunde bewusst war, so genügte ein flüchtiger Blick, um zu erkennen, dass sie nicht mit vollem Herzen bei der Sache waren. Immer wieder steckten zwei und zwei die Köpfe zusammen, und wer ihnen bis auf ein paar Schritte nahe kam, der vermochte ein Zischen und ein Wispern zu vernehmen von jenem Gespräch, das die Brüder ungeachtet der Heiligen Messe führten. Dieser Disput hatte schon begonnen, als sich der Zug der Franziskaner in ihrem Hauptquartier formierte. Dem Oberhaupt des Ordens war zu Ohren gekommen, dass der Heilige Vater just an Weihnachten eine Entscheidung getroffen hatte, die in ihren weitreichenden Folgen noch gar nicht abzusehen war. »Stimmt es, was Bruder Sabinus sagt?«, ließ sich ein junges Mönchlein vernehmen, während die Stimme des Papstes nur sehr undeutlich in jenen Bereich der Kirche vordrang.
»Ja«, zischte der Angesprochene zurück.
Ein kollektives Kreuzzeichen unterbrach die Konversation.
»Aber wieso ein Jesuit?«
»Das weiß der Heilige Vater allein.«
Ein Oberer des Ordens, der vor den beiden stand, wandte sich missbilligend um: »Hier ist nicht der Ort zur Disputation.«
»Aber ich verstehe es nicht«, zeigte sich der Jüngere uneinsichtig.
»Und ein Hiverner noch dazu«, setzte der Ältere offensichtlich empört hinzu.
»Ein Hiverner?« Die Information schien einem weiteren Franziskaner, der nur wenig abseits der Gruppe stand, neu. »Wie denn ein Hiverner? Die Jesuiten haben keinen dieser Nation in ihren oberen Reihen.«
»Freilich wahr. Der Heilige Vater schenkt einem Jüngling ein wahres Übermaß an Vertrauen …«
»Nun ja, der Mann zählt wohl schon 36 Jahre«, korrigierte ein weiterer Mann des Ordens, »er kam vor etwa zehn Jahren nach Rom. Im Gefolge des alten Haudegens O’Neill.«
»War das nicht der unchristliche Säufer, der diesen Sommer seine stets betrunkene Seele aushauchte?«
»Ja, und doch hat er der Heiligen Mutter Kirche so manchen Dienst erwiesen. Er kämpfte tapfer gegen das Ungeheuer auf Engelands Thron. Diese Bestie, die in der Hölle schmoren möge und der Gott in seiner Gnade jede Nachkommenschaft versagte.«
Die Begeisterung des Jüngeren war erwacht. Er hatte Kälte, Sturm und Evangelium vergessen: »Erzählt mir mehr, Bruder!«
»Nicht jetzt, konzentriere dich auf die Heilige Messe.«
Paul V. hatte den ersten Teil des Hochamtes hinter sich gebracht. Eben war die Kirchengemeinde am Wort: »Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.« Im Altarbereich nahm die Umtriebigkeit wieder zu, aber auch wenn der Papst mit dem Rücken zur Gemeinde stand, so wusste er dennoch, was die Gemeinde von ihm erwartete. An Tagen wie diesen schien es unangebracht, die Eucharistie unnötig in die Länge zu ziehen, denn mit einer Erkältung war nicht zu spaßen. Wer liebte es schon, zur Ader gelassen zu werden, wer vermochte zu sagen, ob man wieder genas von kränkelndem Ungemach? Die Heilige Mutter Kirche hatte sicher recht, dass dem Rechtschaffenen das Paradies winkte. Doch kaum einer wollte zur Unzeit abberufen werden zu den himmlischen Chören. Die Welt mochte ein Jammertal sein, doch dieses sollte bis zum Ende durchwandert werden. Zumal, wenn man Verpflichtungen den anderen Christenmenschen gegenüber hatte. Und sei es auch nur die erstmalige Erfüllung des allerchristlichsten Gebots der Nächstenliebe. Ja, so wusste auch Seine Heiligkeit, bei einer solch heidnischen Kälte verbot es eben jene Caritas, die Schäfchen unnütz lange den Elementen auszusetzen. Seine Predigt würde kürzer sein als üblich. Amen.
Bei den Franziskanern herrschte immer noch heftiger Aufruhr. Seit Menschengedenken waren sie die Stütze Roms. Und Rom war die Stütze des Heiligen Stuhls. Und auf ihm ruhte der Weltenkreis. Dem Sitz Petri dienten Fürsten wie Freisassen, Könige wie Knappen, Hauptmänner wie Hörige. Gott, der Herr, lenkte den Weltenlauf durch seinen auserwählten Diener. Und dieser wiederum wählte jene Diener aus, die an entlegeneren Orten des Erdkreises das Wort Gottes zu verkünden hatten. Naheliegenderweise waren jene Diener die zuverlässigsten, die der Schoß der Kirche zu bieten hatte: die Mitglieder des altehrwürdigen Ordens des Heiligen Franziskus. Um diese erhabene Rolle waren die Franziskaner immer schon beneidet worden. In erster Linie natürlich von den Jesuiten, deren Geschichte noch keine 100 Jahre zählte. Es mochte schon sein, dass Ignatius ein heiliger Mann gewesen war. Doch war er wirklich Gottes Gnade teilhaftig geworden? Und wenn, so konnte diese sich wohl kaum auf seine Nachfolger in gleichem Ausmaße erstreckt haben. Eine überaus ungewöhnliche Entscheidung des Heiligen Vaters also, ausgerechnet einen Jesuiten mit einer so wichtigen Aufgabe zu betrauen. Wien war nicht irgendein gottverlorener Vorposten in einem jener Länder, wo die Löwen waren. Wien war das Zentrum des Heiligen Römischen Reiches. Wenn Seine Heiligkeit schon geruhte, die Franziskaner bei dieser Aufgabe zu übergehen, so hätte er wenigstens einen Dominikaner damit betrauen können. Und wenn schon partout einen Jesuiten, so doch zumindest deren General und nicht einen völlig unbekannten Iren, der vor seiner Zeit als Ordensmann angeblich ein übler Schwertkämpfer gewesen war. Und dennoch hatte der Papst in seiner unergründlichen Weisheit just diesem Gälen die heikle Mission am Kaiserhof anvertraut. Gottes Ratschluss war in der Tat unergründlich.
Der Papst hatte mittlerweile die Wandlung vollzogen. Als er die Heilige Hostie dem Kirchenvolk zeigte, ließ er seinen Blick über die Herde wandern und registrierte eine steigende Unruhe. Die Hände der Gläubigen waren nicht länger fromm zum Gebet gefaltet, vielmehr wurden sie eifrig gerieben in dem verzweifelten Bemühen, die Kälte zu vertreiben. Erstmals überlegte Paul V., die Predigt überhaupt auf ein paar essenzielle Sätze zu beschränken, denn selbst die ihm zur Seite stehenden Kardinäle begannen, Zeichen der Schwäche zu zeigen. Ein kleiner Ministrant hüstelte nervös vor sich hin, und aus den Mündern der ihn umstehenden Männer sah er dampfenden Atem aufsteigen. Gott der Herr würde seine Nachsicht verstehen. Er verkürzte das Hochamt nicht aus Eigennutz. Nein, die Gläubigen verdienten es, auf schnellstem Wege nach Hause in ihr warmes Bett zu kommen, auf dass ihnen Unheil erspart blieb. Und deshalb entschied sich der Papst dazu, einen Kompromiss zu wagen. Mit für ihn völlig ungewohnter Schnelligkeit leierte er seine Predigt herunter und ersparte dem Kirchenvolk damit wertvolle Minuten.
Die Oberen der Franziskaner hatten sich schon auf dem Weg zu Sankt Peter dahingehend verständigt, dass sie nach der Christmette nochmals zu einer Beratung zusammenkommen wollten. Musste man die Entscheidung des Papstes akzeptieren, oder gab es vielleicht eine Hintertür, durch die man sie eventuell noch revidieren konnte? Und wenn sich der Heilige Vater schon für einen Jesuiten entschieden hatte, musste es dann ausgerechnet dieser Ire sein? Was wusste man schon groß von ihm – außer seiner fragwürdigen Vergangenheit? Womit war es ihm gelungen, sich in die Herzen seiner Brüder einzuschmeicheln, sodass sie ihn dem Papst vorgeschlagen hatten? Einer der Franziskaner wusste zu berichten, dass der Mann an einer »Historia Hiverniae« schrieb, ein Buch von sehr zweifelhaftem historischem Wert also, denn wer brauchte im Zentrum der Christenheit über ein Land Bescheid zu wissen, das seine Hochblüte schon vor 1.000 und mehr Jahren hinter sich gebracht hatte? Sicherlich, in den alten Zeiten hatten der Heilige Kolumban, der Heilige Finnian, der Heilige Kieran, hatten der Heilige Gallus, der Heilige Virgil und der Heilige Colmcille so manch wichtige Tat für die Christenheit vollbracht, und auch heute noch blieb das irische Volk im Glauben standhaft gegen die englische Ketzerei. Doch Irland war ein Nebenschauplatz der Geschichte, unbedeutend, irgendwo fernab im wilden Atlantik. Seine Tage damit zuzubringen, darüber eine Chronik zu verfassen, war wohl sinnfälligster Müßiggang. Und vor allem: Was konnte so jemand von den politischen Problemen verstehen, die sich im Reiche zutrugen? Es mochte ja sein, dass der irische Jesuit sich im Kampf gegen die Ketzerei ausgezeichnet hatte. Doch im Reich ging es um mehr als um blutige Scharmützel im Moor.
Die Heilige Messe war mittlerweile bei der Kommunion angelangt. Endlich bot sich für den Papst die Gelegenheit, ein wenig zu ruhen. Trotz der bitteren Kälte war er froh, sich auf seinen Thron setzen zu können, um ein wenig zu rasten, während die Bischöfe und Kardinäle den Gläubigen den Leib Christi reichten. Pauls Gedanken schweiften ab und kehrten zu der Entscheidung zurück, die er erst kurz vor der Mette getroffen hatte. Dieser Schritt war ihm nicht leichtgefallen, und gerne hätte er sich mit dieser Frage Zeit bis ins neue Jahr gelassen. Doch seine Berater hatten auf einen raschen Entschluss gedrängt. Paul fragte sich, ob er die richtige Wahl getroffen hatte. Seit er vor über zehn Jahren zum Papst einer zerrissenen Welt auserkoren worden war, bemühte er sich, das Erworbene zusammenzuhalten. Intrigen herrschten allüberall, und besonders hier in Rom. Beständig sah er sich mit den Oberen der Dominikaner und der Jesuiten konfrontiert, die den jeweils anderen Orden der Ketzerei bezichtigten und eine Verurteilung der Rivalen einforderten. Andauernd legte man ihm ein neues Problem vor, das eine sofortige Entscheidung von ihm verlangte. Wie ihn das alles ermüdete! Da war es schon erbaulicher, einen neuen Orden zu bestätigen oder einen Baumeister mit der Errichtung einer neuen Kirche zu beauftragen. Und erst die Außenpolitik! Überall wimmelte es von Ketzern und Heiden, und, was noch schlimmer wog, auch im Lager der Heiligen katholischen Kirche verfielen immer mehr Schafe des Herrn der Sünde. War es Gottes Wille, seine Herde solch mannigfacher Gefahr auszusetzen? Warum hatte er dann ihn, Paul, dazu berufen, den Stuhl Petri zu besteigen? Die Lutheraner waren in deutschen Landen auf dem Vormarsch, England unrettbar verloren, und der Türke rüstete zu einem neuen Anlauf, Europa zu überrennen. So viel Verantwortung für einen alten Mann. Paul seufzte.
Und jetzt noch diese Schwierigkeiten in Prag. Was wollten diese böhmischen Bauern überhaupt, dass sie es wagten, sich wider die Obrigkeit zu empören und den Ketzern Gehör zu schenken, die sie mit teuflischen Schalmeienklängen umschmeichelten, wie es Luzifer stets zu tun pflegte, um Gottes Seelen in die ewige Verdammnis zu führen. Die großen Orden, die doch des Papstes Stütze sein sollten, langweilten ihn mit ihrem Gnadenstreit, anstatt die wahren Ketzer zu bekämpfen, und er, Paul, musste all diese weitreichenden Entscheidungen ganz alleine treffen, da sich seine Berater in keiner einzigen Frage einigen konnten und sich ständig zankten, sodass er, der Papst, sie jedes Mal aufs Neue zur Ordnung rufen musste.
Paul dachte an das Dossier, das ihm der Kardinalstaatssekretär erst am Nachmittag bereitgelegt hatte. Er erinnerte sich düster an Böhmen. Ja, er war erst kurz in seinem hohen Amte gewesen, da hatte der Habsburger Rudolf damit begonnen, den Ungarn und den Böhmen Religionsfreiheit zuzusichern und damit das mühevolle Werk des Wiener Kardinals Khlesl mutwillig zu gefährden. Wäre nicht Bayern gewesen, die Ketzer hätten der Heiligen Mutter Kirche ganze Nationen entrissen. Rudolfs Nachfolger Matthias hatte den Böhmen sogar zugestanden, sich ihren König selbst zu wählen, was ihn nun freilich reute, da er seinem Vetter Ferdinand die Erbfolge sichern wollte, was den Böhmen offensichtlich kaum schmackhaft zu machen war. Dazu war Khlesls Eifer in den letzten Jahren sichtlich ermattet, und was an Informationen aus Wien den Weg nach Rom fand, war kaum dazu angetan, die Gemüter zu beruhigen.
So gesehen schien es höchst nötig, einen eigenen Emissär nach Wien zu senden, um sich selbst ein Bild machen zu können und dem Willen des Heiligen Vaters unmissverständlich Geltung zu verschaffen. Und der Vorschlag, damit einen Jesuiten, der fraglos mit der Kunst der Inquisition bestens vertraut war, zu betrauen, hatte auch einiges für sich, auch wenn er die Dominikaner damit vor den Kopf stieß. Aber der Staatssekretär hatte ihm versichert, man habe auch für sie einen Posten gefunden, um sie zu besänftigen, brauche doch der Hof in Paris einen neuen Nuntius.
Überdies war dieser Ire ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, ein einfacher Ordensbruder, der sich bislang noch überhaupt nicht hervorgetan hatte, Angeblich schrieb er an einem Buch über die Geschichte seiner Heimat. Ein Streber also. Nun, dann würde er wohl auch als Legat sehr fügsam sein und tun, was man ihm auftrug. Überdies konnte man den Dominikanern mit dieser Entscheidung das Gefühl vermitteln, nicht wirklich den Jesuiten den Vorzug gegeben zu haben, da ein derart unbedeutendes Mitglied des Ordens kaum als Auszeichnung verstanden werden konnte. In jedem Fall war für den Heiligen Stuhl nichts verloren, wenn der junge Mann an seiner Aufgabe scheitern sollte. Ein kleines Mönchlein, das seine Kompetenzen überschritten hatte, das seine Grenzen nicht kannte, das fehlgeleitet war. Sollte der Hiverner seine Mission nicht erfüllen können, dann warteten die Dominikaner und die Franziskaner nur zu begierig darauf, einen der Ihren an die Stelle des Jesuiten zu senden. In jedem Fall waren die Orden für eine Weile untereinander beschäftigt, und dem Kaiser signalisierte er, Paul, mit seiner Entscheidung, dass ihm als Oberhaupt der Christenheit noch mannigfache Möglichkeiten blieben, auf die Entwicklungen im Reich zu reagieren, wenn die Schafe des Herrn auf ihrem Wege strauchelten. Je länger Paul die einzelnen Aspekte seiner Entscheidung überdachte, umso zufriedener wurde er mit ihr. Er hatte in der Tat nichts falsch gemacht, Gott hatte ihn in seinem Entschluss gut geführt und ließ ihn zuversichtlich in das neue Jahr blicken.
Eine gewisse hüstelnde Unruhe ließ Paul aufblicken. Er erkannte, dass die Kommunion zu einem Ende gekommen war und er daher den Schlussteil der Heiligen Messe zu zelebrieren hatte. Einige Minuten noch, und er konnte sich wieder in seinen Palast zurückziehen, wo endlich Wärme und Behaglichkeit seiner harrten. Und die ihn Umstehenden meinten zu erkennen, dass der Heilige Vater leicht zu lächeln begann.
Muzio Vitelleschi, der Ordensgeneral der Jesuiten, wartete ungeduldig auf den Schlusssegen des Papstes. Erst wenige Augenblicke vor der Christmette war ihm aus der Engelsburg die Nachricht überbracht worden, dass einer seiner Mitbrüder als päpstlicher Emissär nach Wien gesandt werden sollte. Noch dazu ein relativ unbedeutendes Mitglied des Ordens und nicht einer der Oberen. Die Entscheidung war so überraschend gekommen, dass Vitelleschi gar nicht mehr die Möglichkeit besessen hatte, sich mit seinen Brüdern zu beraten. Was mochte Papst Paul mit diesem Schritt bezwecken? Welche Intrige war da gesponnen worden? Vor allem aber, wie sollte der Orden darauf reagieren? Unter anderen Umständen wäre es fraglos eine große Ehre gewesen, mit dieser Aufgabe betraut zu werden. Doch der Papst sandte keinen General in die Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches, sondern einen gewöhnlichen Soldaten, der im Orden der Gesellschaft Jesu nicht einmal eine untergeordnete Rolle spielte. Musste das nicht erst recht als Brüskierung der Gesellschaft gewertet werden? Wer war überhaupt auf den Iverner verfallen? Wer kannte ihn außerhalb des Ordens? Selbst ihm, dem General der Jesuiten, kam der Ire kaum jemals unter die Augen. Noch am Weg zur Christmette hatte er seine Vertrauten im Geheimen nach dem jungen Mitbruder ausfragen müssen, da er sich eingestehen musste, kaum etwas über den Iren zu wissen, der gleichwohl schon seit beinahe zehn Jahren hier in den Domänen des Ordens in Rom weilte und dennoch nie dazu Anlass gegeben hatte, sich auch nur sein Gesicht zu merken. Vitelleschi bekam eine bruchstückhafte Geschichte erzählt, wonach der Ire Anfang Juni des Jahres 1608 an die Pforte des Ordens geklopft und erklärt habe, er sei gewillt, in diesen einzutreten und sich sämtlicher Schritte zu unterwerfen, die dazu nötig seien. Der seinerzeitige Ordensgeneral, dem dieses Begehren hinterbracht worden war, habe damals mit großer Skepsis reagiert, denn wenn auch der Haufe des sogenannten »großen O’Neill« seitens des Heiligen Vaters regelrecht hofiert wurde, so schien ein Mann aus dieser Truppe wohl kaum geeignet, dem Herrn an so exponierter Stelle zu dienen. Man habe den Gefolgsmann O’Neills abgewiesen, erfuhr Vitelleschi, doch dieser habe sich vor die Kirche Il Gesu gesetzt und Nahrung und Trank verweigert, bis man ihn aus Angst um seine Gesundheit doch eingelassen habe. Bruder Benedikt erinnerte sich auf dem Weg zur Christmette daran, dass der Ire damals erklärte, er habe mit seinem weltlichen Leben abgeschlossen. Es seien ihm zu viel Gewalt und Blut untergekommen, als dass er sich den Versuchungen der Welt länger aussetzen wolle. Er sei durchaus bewandert in der Heiligen Schrift und ob seiner adeligen Abkunft des Lateinischen wie ansatzweise auch des Griechischen mächtig, und mit großem Eifer wolle er ein gottgefälliges Leben beginnen, um Buße zu tun für das sündhafte Treiben in seiner Jugend. Er erwies sich gegen alle Anfechtungen, die man seitens des Ordens gegen seine Aufnahme vorbrachte, gewappnet und wurde schließlich als Novize zugelassen. Der Ire galt als wortkarg und suchte kaum den Kontakt zu seinen Mitbrüdern, denen er nur auffiel, wenn die Reihe an ihm war, während der Einnahme des Mahls die Lesung abzuhalten, denn die tragende Stimme des Iren, die die Worte der Schrift so schön modulierte, galt als wundersame Abwechslung im monotonen Singsang sonstiger Vortragender. Ansonsten hielt sich der irische Bruder beständig zurück. Selbst im Kapitelhaus, wo er stets am geringsten Sitz Platz zu nehmen pflegte, schwieg er beharrlich und pflegte sich bestenfalls dann zu Wort zu melden, wenn einer der Mitbrüder ein falsches Zitat gebrauchte. Und war die Rede doch einmal an ihm, dann wählte er den Brüdern nahezu unbekannte Heilige wie Duns Scotus, Johannes Eriguenna oder Colmcille als Inhalt seines Vortrags. Es war eine dieser Gelegenheiten gewesen, da der Ire auch Vitelleschi aufgefallen war, und er, Muzio, konnte sich noch gut daran erinnern, dass er nach diesem Vorfall in die Bibliothek gegangen war, um klammheimlich nachzulesen, ob der Ire nicht etwa der Ketzerei verdächtigte Autoren zitiert hatte, da sie ihm, dem Ordensgeneral, so gänzlich ungeläufig gewesen waren. Nun, da sich das Hochamt allmählich seinem Ende näherte und er, Vitelleschi, vor lauter Kälte schon kaum mehr seine Glieder bewegen konnte, musste er ob seines damaligen Tuns beinahe ein wenig lächeln. Der Ire war ja eigentlich nicht zu unterschätzen. Nur, woher wusste dies der Papst?
Das Oberhaupt des Dominikanerordens ärgerte sich, als sein Blick auf seinen jesuitischen Gegenspieler fiel. Was grinste Vitelleschi so selbstgefällig? Er wollte doch wohl der Kirchengemeinde nicht weismachen, dass sein Tun religiöse Inbrunst sei? Ob dieses Grinsen mit der Entscheidung des Papstes zusammenhing, einen der Jesuiten nach Wien zu schicken? Wusste der Ordensgeneral etwas, das ihm, dem Generalmagister der Dominikaner, entgangen war? Ja, er ärgerte sich. Dabei war er kurz vor der Christmette noch rundum zufrieden gewesen. Schon in den letzten Tagen hatte sich abgezeichnet, dass sich die Dominikaner nicht mit ihrem Begehren durchsetzen würden, einen der Ihren mit der Mission nach Wien zu betrauen. Da war einer seiner Berater auf die Idee verfallen, dem Heiligen Vater den Vorschlag zu unterbreiten, einen jungen unbedeutenden Jesuiten zu entsenden, was jederzeit die Möglichkeit bot, im Bedarfsfall mit einer stärkeren Autorität, als sie ein junger Mönch haben konnte, nachzusetzen. Auf Pauls Einwand, der Kaiser in Wien könnte sich brüskiert fühlen, wenn man eine derart bedeutungslose Person an seinen Hof sandte, hatten die Dominikaner argumentiert, dass der Ruf der Jesuiten so großartig sei in der Welt, dass selbst der Kaiser sich nicht lange mit der Frage herumplagen werde, welchen Rang der päpstliche Emissär genau bekleide. Der Heilige Vater hatte sich durch diese Aussage überzeugen lassen und diesen Iren ausgewählt, der nun in wenigen Tagen in das Reich aufbrechen sollte. In Wirklichkeit aber war der Einwurf Pauls nur zu berechtigt gewesen, und genau darin bestand die Perfidie des dominikanischen Plans. Ein unbedarfter Jüngling, in der Diplomatie völlig unbewandert, konnte nur scheitern – und der Fehlschlag der Mission musste zwangsläufig dem Orden der Jesuiten angelastet werden. Man hatte die Gesellschaft unter Zugzwang gesetzt, denn es war gänzlich unmöglich, die Entscheidung des Papstes zu ignorieren. Und wenn sich der Papst für einen jungen Mönch entschieden hatte, so war es an Vitelleschi, diesen durch eine entsprechende Beförderung innerhalb des Ordens in einen Stand zu versetzen, der seiner heiklen Mission entsprach. Deshalb würde der Ire nicht weniger scheitern, und umso eher würde die Sünde dieses Unvermögens auf dem Haupt der Jesuiten lasten. Wie man die Sache auch drehte und wendete: Beließ Vitelleschi den Iren in seiner derzeitigen Stellung, so hatte er dem Wunsch des Papstes nicht entsprochen, adelte er ihn aber, so war sein Ungemach umso mehr jenes des Ordens. Würde es dem Iren nicht gelingen, erfolgreich zu sein – und an dieser Aufgabe würden selbst höchstrangige Kardinäle scheitern –, dann gab es in jedem Fall nur einen Verlierer – die Jesuiten – und nur einen Gewinner – die Dominikaner. Denn die Jesuiten wären nach einem so zu erwartenden Desaster wohl kaum in der Lage, daran zu erinnern, dass die Dominikaner zu einer solchen Vorgangsweise geraten hatten, denn unterstellten sie dem Orden, gefehlt zu haben, so behaupteten sie damit erst recht, auch der Papst habe gefehlt, da er sich doch der angeratenen Lösung angeschlossen hatte. Keine Frage, grinste jetzt auch der Dominikaner, die Jesuiten waren schwer im Schlamassel, und sie würden lange an dieser Schmach zu schlucken haben, während es den Dominikanern sogar noch gelungen war, im Abtausch dafür den Posten des päpstlichen Nuntius in Paris zu erhalten. Welch ein Triumph!
Der Mann, dem all diese Gedanken während der Christmette galten, kniete in der hintersten Reihe des Blocks der Jesuiten und betete schreckensstarr. Acht lange Jahre war es ihm gelungen, den Versuchungen der Welt zu entfliehen, und zuletzt hatte es fast den Anschein gehabt, als würde er endlich Frieden finden. Umso verstörender war es, jetzt vom Ratschluss des Heiligen Vaters zu erfahren. Er hatte an einen üblen Scherz seiner Mitbrüder geglaubt, die sich solcherart für seine Hoffart rächen wollten, die sie ihm immer wieder unterstellten. Doch als er am Weg nach Sankt Peter den Blick des Ordensgenerals auf sich ruhen fühlte, da begann er zu ahnen, dass die Nachricht, die er während der Messe in Il Gesu erhalten hatte, wohl eine richtige sein musste. Wie, um alles in der Welt, war das möglich gewesen? Er war ja noch nicht einmal mit seiner Ausbildung zu einem Ende gekommen. Erst vor sechs Jahren hatte er sein Noviziat abgeschlossen, seine Studien gingen zwar zügig voran, doch war er, zumindest seiner eigenen Einschätzung nach und wohl auch der seiner Oberen, wie er annahm, noch meilenweit davon entfernt, wirklich ein im Glauben und Wissen gefestigter Mann Gottes zu sein. Vor allem, wenn er in so jungen Jahren schon durch einen derart hohen Auftrag geadelt wurde, dann würde er für den Rest seines Lebens stets im Schatten dieser einen Station seines Lebens existieren müssen. Würde er, was er nicht glauben konnte, erfolgreich sein, so wäre wohl jeder weitere seiner Schritte stets an dieser Mission gemessen. Würde er aber, und für diese Variante sprach eigentlich alles, scheitern, dann bekäme er mutmaßlich niemals wieder nennenswertes Vertrauen entgegengebracht. Nicht, dass er um eine zukünftige Karriere fürchtete – nur an sonderlich eitlen Tagen träumte er in seiner Klause davon, dereinst als Professor für Philosophie an einer der zahlreichen jesuitischen Hochschulen zu lehren –, aber das Gewicht der päpstlichen Entscheidung ruhte schwer auf seinen Schultern.
Ginge es dabei nur um ihn allein, so wäre wenig verloren. Doch er wurde namens seines Ordens nach Wien entsandt. Sein Scheitern wäre auch das Scheitern seiner Brüder. Er trug nun der anderen Last, und diese verließen sich auf ihn. Würde er zusammenbrechen, so risse er alle seine Brüder mit. »Oh Gott, gibt es denn keine Möglichkeit, sich dieser Aufgabe zu entziehen? Weshalb prüfst Du mich dergestalt, oh Herr?« Der Ire erschrak, als er des Umstands gewahr wurde, die letzten beiden Sätze laut ausgesprochen zu haben. Ängstlich blickte er zur Seite, doch Bruder Saverio, der neben ihm saß, schien nichts gehört zu haben. Zumindest besaß er Taktgefühl genug, sich nichts anmerken zu lassen. Und weit vorne, beim Altar, zitierte Papst Paul V. die letzten Worte des Gottesdienstes. In wenigen Minuten würde die Heilige Messe zu einem Ende gekommen sein, und die Brüder des Ordens würden den Heimweg antreten. Dann musste er sich ihren Worten stellen, musste sein Kreuz auf sich nehmen. Er seufzte.
Da saß er, Andrew O’Connor von den O’Connors of Sligo, die ihr Geschlecht vom letzten unabhängigen Hochkönig Irlands, Rory O’Connor, ableiteten, im hintersten Winkel von Sankt Peter und sah sich einer Aufgabe gegenüber, die all die Mühsal und Plagen, die er in seiner Jugend bewältigt hatte, in ihrer Dimension um ein Vielfaches übertraf. Der Stein des Sisyphos war wohl kaum größer als ein Kiesel im Vergleich zu jener Probe, der Andrew sich nun gegenübersah. Er zählte in einer Woche 37 Jahre, doch niemals zuvor war er derart geprüft worden. Was waren die Schrecknisse des Krieges, den er an der Seite des großen O’Neill geführt hatte, gegen das Vertrauen, das seine Brüder nun in ihn setzten? Als er vor acht Jahren in der Gesellschaft Jesu eine neue Heimat gefunden hatte, da glaubte er sich endlich in einem ruhigen Hafen in einer stillen Bucht, sah die Stürme seines Lebens endlich und für immer abgeflaut. Doch jetzt musste er erkennen, dass die größte Bewährung noch vor ihm lag. Nicht länger würde er seine Mußestunden darauf verwenden können, Trost zu suchen in den Schriften seiner großen Landsleute. Es war ihm nicht länger vergönnt, Material zu sammeln für ein Denkmal, das er seiner alten Heimat in Form eines Buches zu setzen gedachte. Vielmehr würde er eine Reise antreten müssen – denn es gab keine wie immer geartete Möglichkeit, den Ratschluss des Papstes infrage zu stellen –, die in ihrer Größe an jene heranreichte, die er anno 1607 an der Seite von O’Neill und O’Donnell angetreten hatte, als die letzten Reste der einst so stolzen und so tapferen Gälenarmee der Heimat für immer Lebewohl gesagt hatten. Und Bruder Andrew seufzte ein weiteres Mal.
Vorne am Altar wandte sich der Papst nun wieder dem Kirchenvolk zu. Er war mit sich zufrieden. Er hatte die Würde des Hochamtes gewahrt, und dennoch war es ihm gelungen, die Heilige Messe binnen einer Stunde zu einem Ende zu bringen. Er würde der Gemeinde noch den Schlusssegen erteilen, und nur wenig später würden alle wieder in ihre Heime gelangen, wo sie die müden Knochen wärmen und der unchristlichen Kälte entrinnen konnten. Er selbst würde sich noch ein Glas warme Milch gönnen und dann in den Schlaf des Gerechten sinken. Den Rest des Weihnachtstages würde er auf seine Weise feiern. Die schwerwiegenden Entscheidungen, die er ständig zu treffen hatte, würden wenigstens für einen Tag nicht auf ihm lasten. Mochte auch die Welt aus den Fugen geraten, bis Sankt Stephan durfte er sich im privaten Gebet üben und die Arbeit ruhen lassen. An diesem Festtag des Herrn gab es keine Audienzen, keine Besprechungen, keine Akten, Urkunden und Schriftstücke. Der Herr der wahren Christenheit blieb an diesem Tage mit sich allein. Er und die Bibel und nichts sonst. Selbst seine Entscheidung, die Gesandtschaft nach Wien betreffend, würde am Christtag niemand zu kommentieren haben. Mochten Benediktiner, Franziskaner, Augustiner und wer immer auch lamentieren und ihn umzustimmen versuchen, sie mussten sich bis Stefani gedulden. An einem solchen Feiertag war auch der Papst ein kleines Christenkind, das sich freuen durfte, dass der Herr geboren war. Und Papst Paul machte das Kreuzzeichen und verkündete: »Gehet hin in Frieden!« Die Gemeinde antwortete: »Dank sei Gott dem Herrn.« Der Chor hob an, der Papst wandte sich nochmals dem Altar zu und verbeugte sich. Die Bischöfe und Kardinäle taten es ihm gleich. In wenigen Augenblicken würden sie sich alle wieder formieren, um feierlich aus der Basilika auszuziehen. Dann erst war die Heilige Messe zu ihrem Ende gekommen, war der Geburt des Herrn in würdiger Form gedacht worden. Und Paul freute sich, wieder eine Eucharistie ohne den geringsten Fehler zelebriert zu haben.
Bruder Andrew merkte nicht einmal, dass die Reihe an das Kirchenvolk gekommen war. Sein Mund blieb beim »Dank sei Gott dem Herrn« stumm. Er hörte auch den Chor nicht, denn immer noch kreisten seine Gedanken um die große Reise, die er nun würde antreten müssen. Und diese verschränkte sich in seinen Sinnen mit jener anderen großen Wanderung, die er keine zehn Jahre zuvor angetreten hatte. Vor seinem geistigen Auge erstand Dunluce Castle, der hochherrschaftliche Herrensitz des noblen Geschlechts der O’Neill, der sich nahe der Giant’s Causeway majestätisch über dem Atlantik erhob. Jener Tag, an dem er Irland für immer verlassen hatte, war auch der Tag des Abschieds von seinem besten Freund Brendan O’Rourke gewesen.
II.
DUNLUCE CASTLE
9. September Anno Domini 1607
Andrew O’Connor und sein Freund Brendan O’Rourke waren auf der Flucht. Ihrer adeligen Würden waren sie schon vor längerer Zeit verlustig gegangen. O’Connor, seit dem Tod seines Vaters nominell Oberhaupt der O’Connors of Sligo, hatte sich in einer Bauernkate in Drumcliff versteckt gehalten, nachdem sein Schloss niedergebrannt worden war. Und Brendan O’Rourke, der ehemalige Earl of Breifni, dessen Schloss sich nun im Besitz eines englischen Offiziers namens Nicholas Parke befand, hatte durch puren Zufall erfahren, dass die Engländer ihn wie O’Connor verhaften und mit dem großen Chieftain, der, geschlagen und gedemütigt noch in Dunluce Castle im Norden von Ulster aushielt, nach London in den Tower bringen wollten.
Abgehetzt und zerzaust traf Brendan bei dem Gehöft in Drumcliff ein. Sollten seine Informationen stimmen, dann hatten sie gegenüber den Engländern höchstens ein paar Stunden Vorsprung. Der Bauer reagierte rasch. Er gab ihnen ein wenig Speck, dazu etwas Brot und Ziegenkäse und riet ihnen, sich auf den Ben Bulben zu flüchten, wo sie die Sachsen am wenigstens vermuten würden.
»Sie werden die Küste nach euch absuchen, weil sie davon ausgehen werden, dass ihr versucht, übers Meer zu entkommen«, sagte der Bauer, »und sie werden die Wege nach Dunluce überwachen, weil es heißt, der große Chieftain versammle noch einmal seine Getreuen. Gebt also acht und meidet die Straßen und das offene Gelände. Vor allem versucht, nachts zu reisen.«
Andrew war gerührt. Vor ihnen stand ein einfacher Bauer, den sie vor zehn Jahren nicht einmal eines Blickes gewürdigt hätten. Und nun erwies sich der Mann als klug und weitblickend, ihnen einen Ratschlag gebend, der sie möglicherweise vor einer großen Dummheit bewahrte. Denn in der Tat hatte Andrew seinem Freund eben vorschlagen wollen, die Küstenstraße nach Ballyshannon und Donegal einzuschlagen. Und doch war es so naheliegend, dass die englischen Patrouillen just dort auf sie warten würden. Der Ben Bulben hingegen gestattete es einer größeren Gruppe von Soldaten nicht, sich frei zu bewegen. Die engen Bergpfade verunmöglichten es, die zahlenmäßige Überlegenheit effizient einzusetzen. Ja, dort waren sie in der Tat sicher.
Doch Brendan dämpfte Andrews Zuversicht. »Es stimmt schon«, meinte er, »dort sind wir vorerst sicher. Aber wir sind da oben auch gefangen. Mag sein, dass sie nicht raufkommen. Aber wir kommen auch nicht mehr runter.«
Andrew musste zugeben, dass Brendan in diesem Punkt recht hatte. Am Ben Bulben konnten sie sich verstecken. Aber es wäre ihnen unmöglich, zum Chieftain Kontakt aufzunehmen. In den Bergen nützten sie dem großen O’Neill gar nichts.
Andrew erinnerte sich an jenen Boten aus Derry, der ihnen vor einigen Wochen erzählt hatte, wie arg die Engländer dem O’Neill mitspielten. Seit seiner Kapitulation vor vier Jahren demütigte ihn der englische Hof in Permanenz. Große Teile seiner Domänen waren konfisziert und just an seine Feinde – allen voran dem Bischof von Derry und dem Erzbischof von Armagh – zu Lehen gegeben worden. Man hatte ihm das Recht genommen, im Bann und im Lough Foyle zu fischen, und seine katholische Religion durfte er nicht einmal mehr privat ausüben. Hugh O’Neill war ein geschlagener Mann. Und jeder wusste es.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!