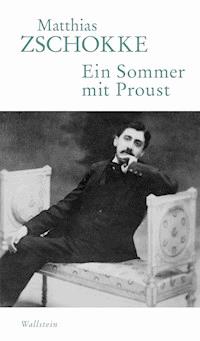Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Blau
- Sprache: Deutsch
Eigentlich müsste Peter ein unglücklicher Mensch sein, aber der Zufall, oder eine gütige Vorsehung, haben dafür gesorgt, dass ihm ein »Empfindungschromosom« fehlt. Schon seine Eltern kamen ihm vor wie fremde Wesen, und seine Frau, vermutet er, wird er bis an sein Lebensende nicht verstehen. Ihr erstes gemeinsames Kind ist bei der Geburt gestorben, und eines unscheinbaren Tages betritt eine Polizistin Peters Verwaltungsbüro, um ihm zu sagen, dass sein zweiter Sohn von einem Lastwagen überrollt wurde. Sein Leben geht weiter, man schickt ihn nach Nancy, um eine belanglose Grußbotschaft zu überbringen. Als auf der Rückreise eine unvorhergesehene Fahrplanänderung angekündigt wird, vertraut eine verzweifelte Mutter Peter ihren Sohn an. Zéphyr, so heißt der Junge mit der orangefarbenen Schwimmweste, werde in Basel von seinem Onkel abgeholt. Auf der Fahrt versucht Peter dem fremden Jungen ein fürsorglicher Begleiter zu sein. Spontan steigen die beiden in Mulhouse aus, um Zéphyrs Tante (und ihre Carrerabahn) zu besuchen. Stattdessen landen sie in einem winterlich kalten Bach, einem 5-D-Film, der Zéphyr den Magen umdreht, einer Umkleidekabine und für die Nacht in einem Hotelzimmer. Von Unwägbarkeit zu Unwägbarkeit wird Peters Hilflosigkeit Zéphyr gegenüber zarter, ja zärtlicher. Eine schwer fassbare, in Momenten irritierende Beziehung entwickelt sich zwischen den beiden, bis sie doch noch in Basel ankommen und die Reise ein abruptes Ende nimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eigentlich müsste Peter ein unglücklicher Mensch sein, aber der Zufall, oder eine gütige Vorsehung, hat dafür gesorgt, dass ihm ein »Empfindungschromosom« fehlt. Schon seine Eltern kamen ihm vor wie fremde Wesen, und seine Frau, vermutet er, wird er bis an sein Lebensende nicht verstehen. Ihr erstes gemeinsames Kind ist bei der Geburt gestorben. Ein paar Jahre später betritt eine Polizistin Peters Verwaltungsbüro, um ihm zu sagen, dass sein zweiter Sohn von einem Lastwagen überrollt wurde.
Sein Leben geht weiter, man schickt ihn nach Nancy, um eine belanglose Grußbotschaft zu überbringen. Als auf der Rückreise eine unvorhergesehene Fahrplanänderung angekündigt wird, vertraut eine verzweifelte Mutter Peter ihren Sohn an. Zéphyr, so heißt der Junge mit der orangefarbenen Schwimmweste, werde in Basel von seinem Onkel abgeholt. Auf der Fahrt versucht Peter dem fremden Jungen ein fürsorglicher Begleiter zu sein. Spontan steigen die beiden in Mulhouse aus, um Zéphyrs Tante (und ihre Carrerabahn) zu besuchen. Stattdessen landen sie in einem winterlich kalten Bach, einem 5-D-Film, der Zéphyr den Magen umdreht, einer Umkleidekabine und für die Nacht in einem Hotelzimmer. Von Unwägbarkeit zu Unwägbarkeit wird Peters Hilflosigkeit Zéphyr gegenüber zarter, ja zärtlicher. Eine schwer fassbare, in Momenten irritierende Beziehung entwickelt sich zwischen den beiden, bis sie doch noch in Basel ankommen und die Reise ein abruptes Ende nimmt.
Matthias Zschokke
Der graue Peter
Mit einem Dank an Marlyse und Maxime Pietri. Was wäre aus mir geworden, hätte ich euch nicht getroffen.
»Évidemment, j’écris toujours le même livre. Puisque personne ne l’a lu, je serais bien sot de me fatiguer à inventer autre chose.« – Éric Chevillard
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.
© 2023 Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
Umschlagbild: steffne / photocase.de
Lektorat: Anina Barandun
Korrektorat: Lydia Zeller
eISBN 978-3-85869-9989-3
1. Auflage 2023
Eine Polizistin betrat sein Büro und sagte – nachdem er bestätigt hatte, derjenige zu sein, den sie suchte –, sie habe ihm die traurige Mitteilung zu machen, dass sein Sohn von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben sei.
Da er nicht gewohnt war, mit der Polizei umzugehen, hatte er sich bei ihrem Eintreten halb von seinem Stuhl erhoben und war so stehen geblieben, leicht eingeknickt, mit – wie er sich das beim Sitzen vor seinem Schreibtisch angewöhnt hatte – geöffnetem Gürtel und geöffnetem oberstem Hosenknopf. Und da er langsam war, langsam auch im Erschrecken, bedeckte er erst jetzt mit seiner flachen rechten Hand den offenen Hosenbund. Dann deutete er eine ungeschickte Verbeugung an und sagte:
»Oh, das … Bitte entschuldigen Sie … Möchten Sie … Aber er war doch noch so klein? Da ist man bestimmt sofort tot? … Klein wie eine Mücke, winzig … Noch nicht einmal eine Sekunde, hoffentlich … Keine Zeit für Schmerzen … Dieser winzige, winzige … Möchten Sie sich setzen? Verzeihen Sie, dass ich nicht danach gefragt habe … Das ist sicher furchtbar unangenehm, solche Nachrichten überbringen zu müssen.«
Dann sagte er zum Mann, der am Schreibtisch gegenübersaß, »bis gleich«, knöpfte seine Hose zu, schloss den Gürtel, richtete sich ganz auf und ging zur Tür, wo an einem Haken sein Jackett an einem Kleiderbügel hing. Er nahm es herunter, wobei er den Bügel mitriss, der krachend zu Boden fiel. »Jedes Mal«, flüsterte er, bückte sich, hob den Bügel auf, hängte ihn an den Haken zurück, schlüpfte ins Jackett und sagte:
»Ich möchte jetzt lieber gehen. Vielen Dank.«
(Ob er übernächtigt war? Vielleicht die Unruhe erwähnen, wenn man ein Kind hat, die Unruhe, die einen nachts immer nur ganz leicht schlafen und zwischendurch aufstehen lässt, weil man den Atem kontrollieren, auf die lauernden Ungeheuer horchen muss? Erwähnen, dass das Wachliegen von nun an ein anderes sein wird?)
Mit gesenktem Blick ging er durch die Flure der Verwaltung, bei der er angestellt war. Die Polizistin folgte ihm. Alle paar Meter schüttelte er den Kopf, ein Zucken eher. Mehrere Male prüfte er mit der rechten Hand, ob sein Jackett zugeknöpft sei. In der Empfangshalle murmelte die Polizistin kurz vor dem Ausgang in seinen Rücken:
»Wenn Sie wünschen, kann ich für Sie psychologische Betreuung beantragen.«
Er sagte leise: »Das geht niemanden etwas an.«
Auf der Straße drehte er sich nach ihr um und fragte unvermittelt, ob ihr auch immer die Füße wehtäten. Dann erklärte er, dass er die Kantine im Haus nicht möge und zwischendurch ganz gern seinen Arbeitsplatz verlasse und an die frische Luft gehe. In seinem Büro könne man die Fenster nicht öffnen. Doch leider würden ihm in letzter Zeit die Füße wehtun, weswegen er nur noch das am nächsten gelegene Café aufsuche, in dem weder der Kaffee noch die Kuchen zu empfehlen seien. Er habe die Schmerzen zuerst nicht ernst genommen und wisse daher nicht, wann genau es mit ihnen angefangen habe, doch seit einiger Zeit drückten ihn seine Schuhe, egal, welche er anziehe. Jetzt auch. Ob sie, der die undankbare Aufgabe der Unglücksbotin zugewiesen worden sei, das auch kenne, schmerzende Füße, und wie sie damit umgehe? Was für Schuhe sie trage? Das sei sicher kaum zu ertragen, solche Nachrichten zu überbringen. Hoffentlich, hoffentlich sei es sehr schnell gegangen, sehr sehr schnell …
(Vielleicht erwähnen, dass er nachmittags um drei Uhr einen Termin bei der Fußpflegerin hatte? Und wie er es hasste, um drei so einen Termin zu haben und sich bei der Verwaltung abmelden zu müssen. Dass jedoch die Fußpflegerin keine Morgen- oder Abendtermine vergab. Dass sie aus Russland kam und sehr schlecht Deutsch sprach und sich der Einfachheit halber deswegen angewöhnt hatte, ihre Termine festzulegen, ohne auf Widersprüche einzugehen, weil es sonst sprachlich zu kompliziert geworden wäre. Dass sie jeweils bloß sagte, du kommen dann und dann. Und dass sie – wenn er fragte, ob es nicht auch in einer Randstunde ginge – sagte, nein, nicht gehen, nur dann und dann gehen. Dass sie die Uhrzeit auf ein kleines Zettelchen schrieb und ihm in die Hand drückte.
Dass er keine Vorstellung gehabt hatte davon, was für ein kompliziertes Gebiet Nagelbetten und Fußsohlen waren. Dass er immer gedacht hatte, Nägel schneide man einfach ab, möglichst gerade, und damit sei die Sache erledigt. Dass ihm mit den Jahren die Füße aber angefangen hatten, Probleme zu bereiten, und dass er sich danach zu sehnen begann, einmal noch beschwerdefrei gehen zu können in seinem Leben, dass diese Hoffnung aber in immer weitere Fernen rückte und sich am Horizont aufzulösen begann.
Dass das Fußbad und das akribische Knipsen, Schaben, Feilen und Eincremen der Russin unabhängig von alldem aber eine Wohltat war und ihn jeweils eine halbe Stunde lang in träumerische Entspannung versetzte, und dass er manchmal sogar dachte, er würde dieses Glück gern jemandem zukommen lassen, dem er gut gesinnt war.)
Dann war’s, als habe ihm jemand einen Schlag in die Kniekehle versetzt. Er knickte ein, fiel in sich zusammen wie die Gliederpüppchen, die von elastischen Bändern so lange aufrecht gehalten werden, bis jemand von unten mit dem Daumen gegen den Boden des Sockelchens drückt, auf dem sie stehen, worauf sie in sich zusammensinken. Und er lag auf dem Bürgersteig.
»Bitte entschuldigen Sie«, sagte er, wälzte sich auf den Bauch und richtete sich halb auf die Knie, »die Gehwegplatten sind auf diesem Abschnitt liederlich verlegt. Es ist bereits gemeldet worden und soll behoben werden. Ich bin vor ein paar Wochen hier schon einmal gestolpert und hingefallen.«
Die Polizistin schob ihre Hände unter seine Achseln, um ihm auf die Beine zu helfen. Er zuckte zusammen, schüttelte sie ab und sagte leise:
»Bitte nicht.« Mit einem raschen Blick zum Zeitungskiosk, vor dem er zu Fall gekommen war, erhob er sich flink wie ein Knabe, klopfte die Hände an den Hosenbeinen ab und sagte:
»Hier kaufe ich jeden Tag meine Zeitung. Heute nicht. Der Inhaber ist Türke. Besitzen Sie ein Funktelefon? Man sollte meine Frau benachrichtigen. Sie ist seine Mutter. Man muss ihn bestimmt abmelden.«
(Bei der Polizei nachfragen, wer im Fall eines tödlichen Autounfalls zu den Angehörigen des Opfers geschickt wird. Gibt es offizielle Redewendungen, die man in der Ausbildung für solche Situationen beigebracht kriegt? Wie finden Verkehrspolizisten heraus, wer die Eltern eines überfahrenen Kindes sind und wo sein Vater tagsüber arbeitet? Tragen Kinder heutzutage Marken um den Hals oder ums Handgelenk, auf denen Name, Telefonnummer und Adresse angegeben sind?)
So trieb er durch sein Leben und realisierte kaum, dass auch ihm große und kleine Dramen begegneten. Er ließ sich ergreifen von herzzerreißenden Abschiedsarien, die andere anstimmten, nachdem sie erfahren hatten, dass ihr Sohn von einem Lastwagen überrollt worden war. Er las dicke, aufwühlende Romane, die andere über Schicksalsschläge verfasst hatten, von denen ihre Helden zu Boden gestreckt wurden, und dachte, so etwas möchte ich um alles in der Welt niemals aushalten müssen. Doch er wusste nicht, was er empfand, als er seinen Sohn verlor, ja, manchmal konnte er sich nicht einmal daran erinnern, überhaupt einen gehabt zu haben, denn das ging schließlich niemanden etwas an.
Als ihm einmal – er war noch ein Kind – hinterm Bahndamm ein Mann auflauerte, der von dort hervorsprang, ihn umklammerte und ihm heiß ins Ohr flüsterte, so, du Marzipan, jetzt rammeln wir miteinander, bis du die Glocken von Jericho bimmeln hörst, dachte er, während er über die Gleise getragen und ins Gestrüpp geworfen wurde, wo mag wohl Jericho liegen?
Nachdem der Mann sich hinterm Bahndamm beruhigt und von ihm abgelassen hatte, erhob sich der Knabe und sagte, bitte lauern Sie mir nie wieder irgendwo auf. Ich möchte Ihnen nicht mehr begegnen und Sie vergessen. Ich fahre lieber Camion.
(Erwähnen, dass damals neben seinem Elternhaus die Straße geteert wurde und dass es für ihn das Schönste war, von den Lastwagenfahrern hochgehoben und auf den Beifahrersitz in der Kabine gesetzt zu werden und dann, dort oben thronend, mitfahren zu dürfen, wenn frischer Teer geholt werden musste.)
Und weil das so war, hatte er sich angewöhnt, sein Augenmerk auf solche zu richten, denen es ähnlich erging wie ihm, denen gewissermaßen auch ein Empfindungschromosom fehlte und deren Angelegenheiten ihrer Überzeugung nach auch niemanden etwas angingen. Und er begann seine Sachen so zu erzählen, wie er dachte, dass sie die ihren erfahren und wiedergeben würden, in der Hoffnung, von ihnen verstanden zu werden und in ihnen Gleichgesinnte zu finden. So fing er an, in zwei Sätzen von einem Brötchen zu berichten, das altbacken war und ihm schlecht geschmeckt hatte, dann in zwei Sätzen davon, dass seine Mutter ihn lieber nicht geboren hätte, dann in zwei davon, wie fein und durchscheinend blau die Haut hinter den Ohren seiner Frau war. Denn was weiß einer schon am Ende, außer dass er auch tot sein möchte.
Eines Tages hatte die Inhaberin des Cafés, das er aufsuchte, seit seine Füße ihn schmerzten, alles umgeräumt und ein Kindertischchen mit zwei winzigen Stühlen neu in den Gastraum gestellt. Auf dem Tischchen lagen Bilderbücher. Sie erzählte, sie habe eine kleine Tochter. Die sei in die Schule gekommen und wolle keine Kindermöbel mehr haben. Die Inhaberin fand es lustig, in ihrem Café diese Miniaturmöbel zwischen die der Erwachsenen zu stellen.
Er war verwirrt von der Umstellung und wusste nicht, wo er sich nun hinsetzen sollte. Er blieb vor der Theke stehen, schaute die Inhaberin ernst an und sagte, seiner Meinung nach dürfe man einen Raum nicht ohne Not ummöblieren. Niemand solle sein tägliches Umfeld mutwillig verändern. Alle würden sich sonst überall immer fremd und unbehaust fühlen. Das erzeuge Unruhe und erschöpfe die Menschen. Die Inhaberin setzte sich auf eines der beiden Stühlchen, ließ sich nach hinten kippen, schaukelte vor und zurück und sagte lachend, das sei doch mal was anderes.
Es gibt solche, die spannende Geschichten zu erzählen haben, und solche, die nichts zu erzählen haben. Oder die möglicherweise viel zu erzählen hätten, das aber nicht von sich wissen, weil sie nichts in sich eindringen, sondern alles an sich abperlen lassen wie an einer Regenhaut. Sie stehen morgens auf und denken, aha, aufgestanden. Dann trinken sie einen Kaffee und denken, voilà, Kaffee getrunken. Und am Abend gehen sie ins Bett und denken, sodele … und werden vom Schlaf übermannt.
Er war einer dieser aussichtslosen Fälle. Ein behütetes Kind aus dem Schweizer Mittelstand und Mittelland, gesund, gerade gewachsen, alltäglich – aus so einem kann niemals etwas der Rede Wertes werden, fürchtete er. Dann schickte er sich in sein Los und sagte sich, schließlich gebe es ja noch andere wie ihn, ja, sie stellten vielleicht sogar die Mehrheit dar, und sie alle, diese unendlich vielen grauen Peters – Peter heißt er – müssten schließlich auch ohne Ausnahme ihr nichtssagendes Leben führen und aushalten, das doch im Grunde genommen ebenso wahr und einmalig sei wie die wenigen Ausnahmeleben, über die Bücher geschrieben oder Filme gedreht würden. Auch die Schicksalslosen hätten doch einen Anspruch darauf, eine Stimme zu bekommen, denn jeder von ihnen sei letztendlich ebenso einmalig wie ein Einmaliger, nur halt auf verwechselbare Art. So wie Kirschblüten in Japan oder Tulpen in einem holländischen Gewächshaus. Die dürfe man doch auch nicht allesamt in die Tonne treten, nur weil sie sich zum Verwechseln ähnlich sähen.
Und eine heiße Welle von Sympathie zu allen Stumpfen, Faden und Empfindungslosen überflutete ihn. Er verstieg sich in die Theorie, es sei gleich spannend, wenn einer aus Mehl, Wasser und Öl einen Teig knete, wie wenn er ein Messer in die weiße Brust seines Geliebten stecke, ja, so wie Vermeer seine Bilder gemalt habe, so müsse er reden, er müsse sich davor hüten, etwas Außerordentliches erzählen zu wollen, er müsse das Ordentliche in seiner Einzigartigkeit versuchen wahrzunehmen und wertzuschätzen.
Aufgewachsen ist er jenseits der Sprachgrenze in einem Dorf mit französischem Namen. (Dorf beschreiben?) Von dort fuhr er in einem kleinen Bummelzug jeden Tag auf die deutschsprachige Seite, wo er die Schule besuchte, in der er von seinen Mitschülern mangels anderer besonderer Merkmale Saint-Blaise genannt wurde, so wie das Dorf, aus dem er kam. Es gab noch einen zweiten Schüler in der Klasse, den man sich auch nur dank des Dorfs, aus dem er kam – ebenfalls eines jenseits der Sprachgrenze –, merken konnten: Rougemont. Dessen Vater fand allerdings bald eine Anstellung in einer entfernten Stadt, weswegen Rougemont die Klasse verließ und dorthin zog. Das war eine Sensation: Rougemont zieht weg. Saint-Blaise träumte von da an lange davon, ebenfalls einmal woanders hinzuziehen. Nicht dass ihm sein Spitzname missfallen hätte, doch die Vorstellung, alle Zelte hinter sich abzubrechen und mit seinen Eltern und Geschwistern zusammen in die Fremde zu ziehen, fand er ergreifend.
(Die Schweinswürste des Metzgers aus Saint-Blaise beschreiben? Würste, die sein ältester Bruder sich, nachdem er längst erwachsen und von zu Hause weggezogen war, noch jahrzehntelang vakuumverpackt überallhin in die Welt hatte nachsenden lassen, weil sie ihm so gut schmeckten.)
Seine Eltern waren ihm ihr Leben lang fremd geblieben. Er beobachtete sie wie Angehörige eines anderen Volksstamms. Er verstand nicht, was sie sagten; er erriet es. Sie verstanden nicht, was er sagte; sie stellten sich etwas darunter vor, das ihnen für sein Alter passend erschien. Wenn sie gut fanden, was er schlecht fand, oder wenn er für richtig hielt, was sie für falsch hielten, sagten sie zueinander, ach, das ist interessant, so habe ich es noch nicht betrachtet. Dann starb der Vater, dann die Mutter. Er weiß heute nicht mehr, wie sein Vater gesprochen hat, ob seine Stimme laut war, leise, tief, hoch, schneidend, weich, warm oder kalt. Er weiß nicht, wie seine Mutter geklungen hat. Sie scheint eitel gewesen zu sein. Sie ertrug es nicht, keine schöne Singstimme zu haben. Als Kind sei sie gelobt worden für ihren Gesang, hatte sie bei verschiedenen Gelegenheiten erzählt. Später klang ihre Stimme laut und grob, wenn sie sang. Niemand kam mehr auf die Idee, sie dafür zu loben. Sie sang keinen Ton mehr und sagte, sie habe die Stimme verloren bei Peters Geburt. Du bist schuld daran, dass ich nicht Sängerin geworden bin, sagte sie. Sie saß stumm da und schaute ihn an, wenn an Weihnachten zusammen gesungen wurde.
Der Vater wollte Abenteuer erleben mit seinen Kindern. Sie verließen sich auf ihn. Wenn er sagte, sie könnten den Fluss schwimmend überqueren, schwammen sie in der Gewissheit los, entweder das andere Ufer zu erreichen oder sonst von ihm aus den Fluten gerettet zu werden. Weil er dieses Vertrauen spürte, gewöhnte der Vater sich an zu glauben, Dinge zu wissen und zu können, die er nicht wusste und nicht konnte. Er verlangte von sich, dass man auf ihn bauen könne. Er traute sich zu, den Himmel in die Höhe zu stemmen, wenn der sich hängen ließ, oder die Sterne wieder anzuzünden, wenn sie ausgingen. Die Anforderungen der Kinder an ihn wurden immer größer. Wenn man jahrelang gefragt wird, warum dies so ist und jenes so, und wenn man jahrelang Antworten und Lösungen zu kennen vorgibt, glaubt man mit der Zeit, auf alles eine Antwort zu haben oder haben zu müssen, für alles eine Lösung zu kennen oder kennen zu müssen. Wenn die Kinder eines Tages über die Antworten und Lösungen zu lachen beginnen, ist es zu spät. Man versteht sie dann nicht mehr. Und sie verstehen einen nicht mehr.
Der Vater hatte große, abstehende Ohren, die er zusammenfalten und sich in den Gehörgang stecken konnte. Mit einer kleinen Muskelanspannung vermochte er sie dann aus ihrer Gefangenschaft zu befreien, sie herausspicken und sich wieder aufrichten zu lassen. Sie waren dann feuerrot. Wie ein Hund, der die Ohren spitzen oder hängen lassen kann. Die Mutter mochte nicht, wenn er das Kunststück vorführte. Die eigenen Kinder schauten gebannt hin mit einer Mischung aus Ekel und Faszination. Fremde Kinder waren begeistert und starrten ihn an wie einen Zauberer. Dann ist er gestorben und niemand kann sich mehr genau erinnern daran, wie der Trick mit den Ohren funktionierte. Es existieren auch keine Filmaufzeichnungen oder Fotos davon.
Außerdem konnte er durch die Finger pfeifen. Durchdringend schrill. Wenn der Pfiff erklang, musste Peter alles stehen und liegen lassen und nach Hause sausen oder dorthin, wo der Pfiff herkam. Noch heute durchfährt ihn ein eisiger Scheck, wenn er diese Art von Pfiff irgendwo hört. Selber hat er nie gelernt, so zu pfeifen. Der Vater legte dazu die Spitze des gebogenen Mittelfingers auf die Spitze des Daumens der linken Hand, hielt sich diesen Fingerbogen zwischen die straff gespannten Lippen und presste kräftig Luft dagegen. Wie der Pfiff eines Schnellzugs.
Ob Menschen Einzelgänger sind? Sein Vater taucht immer allein auf in Peters Kopf, seine Mutter ebenfalls. Es ist Peter unmöglich, sich vorzustellen, wie sein Vater mit seiner Mutter zusammen nackt in einem Bett liegt. Es gelingt ihm auch nicht, sich vorzustellen, wie seine Brüder mit ihren Frauen oder Männern oder seine Schwester mit ihrem Mann oder ihrer Frau zusammen nackt in Betten liegen. Sie tauchen alle immer ganz für sich allein auf in seinem Kopf, und immer sind sie angezogen. Nicht einmal sich selbst kann er sich mit seiner Frau oder einem Mann nackt im Bett vorstellen. Auch nicht seine Freunde, mit denen er redet wie mit Fremden.
Nur ganz wenige gibt es, denen er über den Weg traut. Sein Vater zum Beispiel, der hätte ihn wohl niemals verraten. Wobei, wer weiß. Wenn er, sein Vater, von etwas überzeugt war, dann musste sich dieser Überzeugung alles unterordnen. Er war überzeugt, Kinder müssten erzogen werden. Wenn nötig mit Gewalt. Manchmal bäumte sich die Mutter gegen ihn auf. Wenn er ihre Stärke nicht mehr aushielt, brach er das Gespräch ab, erhob sich, verließ den Raum und redete kein weiteres Wort mehr. Mit niemandem. Das passierte drei-, viermal im Jahr und dauerte jeweils mehrere Tage, manchmal bis zu zwei Wochen lang. Er ging ins Bett, ohne Gute Nacht zu sagen, stand am Morgen auf, sagte nicht Guten Tag, nicht Auf Wiedersehen, nicht Danke, nicht Bitte, einfach nichts. Wenn die Mutter genug hatte davon, begann sie sanft auf ihn einzureden. Sie zeigte sich besorgt, fragte, was er denn habe, sagte versöhnlich, jetzt wollen wir uns aber wieder vertragen, ja? Nach einer Weile begann er dann wieder zu reden.
Einmal schwieg er nicht ihretwegen, sondern weil Peter und seine Schwester ihn wütend gemacht hatten. Peter hatte in der Schule den Bosporus kennengelernt. Seine Schwester war ein Jahr älter und kannte ihn schon. Sie sagten dem Vater, das sei eine Meerenge. Der Vater glaubte ihnen nicht. Er behauptete, der Bosporus sei ein Berg. Als sie den Atlas aufschlugen und ihm die Meerenge zeigten, sagte er, und es ist doch ein Berg. Dann schwieg er drei Wochen lang.
Er trug ein Schweizer Klappmesser in der Leistentasche seiner Hose. Als es nicht mehr selbstverständlich war, dass sich bei Hosen oben rechts neben der Seitentasche der kleine Schlitz mit dem Leistentäschchen fand, ließ er sich so eins nach dem Kauf einer neuen Hose jeweils vom Dorfschneider dort einnähen. Er stülpte das rote, körperwarme Messer jeden Tag mindestens zehnmal aus diesem Schlitz und setzte eine der Klingen ein, schnitt etwas entzwei, schraubte etwas zusammen, holte mit der im Messerrücken versenkten Pinzette einen Splitter aus einem Finger, knipste mit der Schere Hautfetzen oder angerissene Fingernägel weg und sägte Dinge ab. Als sein Taschenmesser von offizieller Seite zur Waffe erklärt wurde und er es nicht mehr mit in Flugzeuge, Gerichtsgebäude und Rathäuser nehmen durfte, brach die Welt für ihn zusammen, und er beschloss zu sterben und starb.
Peter weiß nicht, ob er etwas gelernt hat von ihm. Er bewegt sich wie er. Er wäscht sich wie er. Er denkt wie er. Er bedauert, kein Taschenmesser zur Hand haben zu dürfen wie er. Er hat keine Ahnung, wie sein Vater war, ist aber überzeugt davon, dass alles, was er heute denkt und tut, geprägt ist von ihm. Die Mutter war ihm noch fremder; er ist wie sie.
Den Leuten, denen er traut, will er bis ans Ende seines Lebens trauen können. Denjenigen, denen er misstraut, misstraut er bis ans Ende seines Lebens. Diejenigen, denen er traut, sehen heute alle mitgenommen aus. Ihre Augen sind gerötet. Ihre Haut ist schuppig geworden. Äderchen sind geplatzt. Die Haare sind stumpf und dünn, die Zähne lang und gelb. Sie haben sich Ticks angewöhnt und können sie sich nicht mehr abgewöhnen. Aber er traut ihnen. Sie werden weniger. Denjenigen, denen er nicht traut, traut er zuverlässig nicht. Sie werden mehr. Wie zerrüttet wir inzwischen alle aussehen, wir, die einander trauen.
Seit Menschengedenken lebt Peter in Berlin. Niemand nennt ihn mehr Saint-Blaise, was er fast ein wenig bedauert.
Er tappt halb blind und halb taub durch die Stadt und merkt immer erst sehr viel später, wenn er etwas fürs Leben hätte erfahren können. In seiner Kindheit hatte er eine Parzival