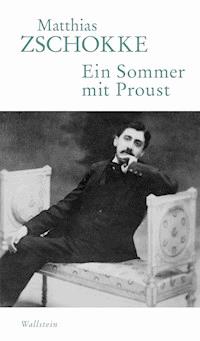Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein halbes Jahr Venedig. Eine Feier der Sinne. Matthias Zschokke berichtet davon so mitreißend, dass man meint, man wäre dabeigewesen. Oder man müsse sofort hin. Solch ein Buch über Venedig ist noch nicht geschrieben worden! Es überwältigt, weil es die Überwältigung durch diese Stadt mit Leidenschaft, Beobachtungsgenauigkeit und hinreißender Lakonie erfahrbar macht. Auf der einen Seite sieht der Autor selbst alles wie zum ersten Mal, andererseits gehört er zu den residenti, den Einheimischen, die im Vaporetto nicht Touristenpreise zahlen und ihren Macchiatone an der Bar im Stehen trinken. Ab Frühsommer 2012 lebt Matthias Zschokke für ein halbes Jahr in Venedig; vielleicht sollte man besser sagen: er lebt diese Stadt und notiert, was er sieht, riecht, schmeckt, hört und erfährt: nicht in ein stilles Tagebuch, sondern in Mails an Freunde, Verwandte, Kollegen. Zschokkes ansteckende Neugier bewahrt ihn vor allem Idyllischen, sie richtet sich auf die ganze Welt, will alles erfahren, was man wissen kann. Ein schillerndes Kaleidoskop entsteht so, handelnd vom großen Ganzen und den kleinsten Marotten, vom Theaterdonner und vom Literaturbetrieb und von den wirklichen Dingen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 560
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Zschokke
Die strengen Frauenvon Rosa Salva
Matthias Zschokke
Die strengen Frauenvon Rosa Salva
Anfang Januar lag in seinem Kasten ein Brief. Darin die Anfrage einer Kulturstiftung, ob er Lust und Zeit habe, zusammen mit seiner Familie ein halbes Jahr in einer venezianischen Wohnung zu residieren. Für alles sei gesorgt. Eine ortsansässige Frau werde ihm die Schlüssel überreichen und sich kümmern um sämtliche praktischen Probleme, die möglicherweise auftauchen könnten.
Er hatte keine Familie. Auch Freunde waren ihm nicht mehr viele geblieben, seitdem sich herumgesprochen hatte, dass er vom Glück auf beunruhigende Weise bevorzugt würde. Er fürchtete, die Einladung nach Venedig werde als weiterer Beweis für diesen Glücksverdacht betrachtet, worauf auch noch die letzten Bekannten den Kontakt zu ihm abbrechen – »sich mit Grausen von ihm abwenden« – würden. Doch I., die Frau, mit der zusammen er in Berlin lebte, hielt das für dummes Zeug. Sie kannte keine Angst vor dem Neid der Götter. Ihr gefiel die Vorstellung, ein halbes Jahr in Venedig zu verbringen. »Etwas Besseres als den Tod findest du überall«, sagte sie. Also nahm er die Einladung an.
01.06.
Letzte Mail aus Berlin an seinen Freund in Köln,
nicht was man tut, wenn man gestochen ist, will ich wissen (Essigwickel, Zitronensäure, Muttispucke, Eiweiß- oder Siliceapaste usw.), sondern wie ich es anstellen soll, nachts nicht umsirrt zu werden, das möchte ich ein für alle Mal erfahren: Lavendelsträuße ins Zimmer, Zitronenbäume vors Fenster, einen Katzenkadaver auf den Fenstersims, Hausfledermäuse halten, Licht brennen lassen, Fenster geschlossen halten, im Durchzug liegen, sich vor dem Schlafengehen mit Franzbranntwein einreiben, mit Lebertran? Was hält Mücken davon ab, mir um die Ohren zu sirren und mich wach zu halten? Ab morgen muss ich die Antwort kennen.
02.06.
Erste Mail aus Venedig an den Freund in Köln,
eingesteckt, und drin war ich. Ein venezianisches Mysterium. Nicht ein einziges Kästchen war anzuklicken. Einfach den Laptop einstecken, anschalten – und drin ist man.
Was für eine Überwältigung! Nachdem ich die Tür zur Wohnung aufgestoßen hatte, blieb ich wie angenagelt stehen, öffnete den Mund und wollte etwas Passendes ausrufen, doch es fiel mir nichts ein, also schwieg ich, stellte die Koffer auf den Boden und ging mit halboffenem Mund – ich hatte vergessen, ihn wieder zu schließen – quer durchs Entree zur Fensterfront, schaute über die Kanäle, die unten vor dem Haus aufeinandertreffen, und rührte mich nicht mehr. Dann kehrte ich zu den Koffern zurück, legte sie stumm auf einen Tisch, packte aus, räumte die Sachen in die Schränke, steckte den Laptop ein, setzte mich auf den Stuhl davor – und halte es nicht aus, hier sitzen zu bleiben und Dir zu schreiben. Muss sofort hinunter, hinaus.
/2
Gleich um die Ecke unten links ist ein Friseur. Durchs Schaufenster habe ich ihn arbeiten sehen, einen jungen Mann. Sein Name ist Valon. Von dem werde ich mir die Haare schneiden lassen. Er hat rabenschwarze Locken und ganz helle Haut. In seiner Kindheit hat er bestimmt als Zanzarotto gedient (ich habe gelesen, in Venedig würden blasse Knaben in Livree abends jeweils zu zweit in den geöffneten Fenstern der Paläste stehen, zu den Sälen hin livriert, auf der Kehrseite nackt, um mit ihrem süßen Blut die Stechmücken – die Zanzare – anzulocken und abzufangen; sogenannte Zanzarotti eben; Valon war mit Sicherheit so einer).
Höchstens zweihundert Meter habe ich geschafft, dann hob es mir die Füße vom Boden, und ich begann zu schweben. Keine Sekunde zu viel werde ich hier in der Wohnung bleiben, auf dem Stuhl sitzend, vor dem Tisch! Wann immer möglich werde ich hinausgehen – wo ich allerdings in der Gosse enden werde: Ein Glas Bier auf der Piazzetta kostete … Ach, koste es, was es wolle, egal, ich kann nicht anders, ich muss sofort wieder runter und noch eins trinken gehen.
An die Frau, die sich um die Wohnung kümmert,
wissen Sie, wie man den Fernseher zum Laufen kriegt? Es liegen zwar diverse Gebrauchsanleitungen und ein handgeschriebenes Blatt neben dem Gerät, aber egal, wie ich es anstelle, es tut sich nichts auf dem Bildschirm. Eingesteckt und zusammengestöpselt ist alles richtig, DVDs kann man sich anschauen, nur in die Ferne sehen, das geht nicht.
03.06.
An den Freund in Köln,
technisch hat alles auf Anhieb geklappt, lebenstechnisch nicht. Ich bin zermartert vom Ungewohnt-im-Bett-Liegen. Außerdem sirrte heute Nacht tatsächlich eine Stechmücke um mein Ohr. Ich erwäge hiermit, das Experiment für gescheitert zu erklären und nach Berlin zurückzukehren. Nicht wegen der Mücke. Auch nicht wegen des verzogenen Rückens. Allein wegen der Finanzen. Ich kann mir Venedig nicht leisten. Man darf hier keinen Kaffee trinken gehen wollen, keinen Aperitif, kein Eis schlecken, nicht auswärts essen. Das ist alles unbezahlbar. Was soll ich denn dann hier? Nichts dürfen fällt in Berlin sehr viel leichter. Dort habe ich meinen Lesesessel und ein Klima, das nichts anderes zulässt als lesen, denken und sich nach woanders sehnen.
Mehrmals am Tag müsste ich, wenn ich bliebe, eine sogenannte Da-Vinci-Treppe runter- und wieder hinaufsteigen, eine Treppe, auf der vor meiner Zeit eine ältere Frau ausgeglitten und schier zu Tode gekommen sein soll. Seither steht oben innen an der Wohnungstür: Attenzione! Scala pericolosa. Im Haus – wenn man den ausgebauten Dachstock dazurechnet, ist es fünfstöckig – hat jeder Mieter seinen eigenen Eingang mit eigenem Treppenhaus. Auch nach längerem Nachdenken gelingt es mir nicht, mir räumlich vorzustellen, wie die Treppen angelegt und umeinander herumgebaut sind. Sie werden nach Leonardo da Vinci benannt, weil der, wie mir die Frau, die sich um die Wohnung kümmert, erklärte, solch verschachtelte Treppenhäuser als Erster entworfen habe. Sie entsprachen offenbar dem Bedürfnis einer gewissen Schicht von Venezianern, die es sich im späten sechzehnten und frühen siebzehnten Jahrhundert nicht haben leisten können, einen ganzen Palast für sich allein bauen zu lassen. Die haben Eigentümergemeinschaften gebildet und Mehrfamilienhäuser in Auftrag gegeben. Um sich abzusetzen von den armen Schluckern, die zusammengedrängt in Mietskasernen wohnten, haben sie sich den Luxus individueller Eingänge geleistet.
I. und ich wohnen in der dritten Etage. Vom Plätzchen vor dem Haus treten wir durch eine eigene Eingangstür ins eigene Treppenhaus. Die Wohnungen unter und über uns haben links und rechts von unserer ebenfalls eigene Eingangstüren zu eigenen Treppenhäusern. Die Treppen winden sich geheimnisvoll umeinander herum, sind relativ steil, die Stufen vom vielen Benutzt-Werden spiegelglatt. Eine große Küche mit einem Tisch für acht bis zehn Personen wartet im hinteren Trakt darauf, in Betrieb genommen zu werden; noch haben wir sie nicht betreten.
Der Kaffee in den Bars schmeckt exzellent. Stehend am Tresen getrunken – was im Grunde genommen die edelste Art ist, Espresso zu trinken, nur mir leider nicht möglich, weil meine Beine jeweils müde sind, wenn ich in einer Bar angekommen bin –, kostet das Tässchen neunzig Cent; das ist freundlich. Wer sitzen will, zahlt das Doppelte.
04.06.
Die Treppenstufen zählen? Warum das denn? Es ist einfach eine Treppe in die dritte Etage, leicht gestaucht, weil – wie erwähnt – nebendran noch die Treppen der Nachbarn Platz finden müssen. Die Stufen sind deswegen ein wenig schmaler und höher als gewöhnlich, aus vierhundert Jahre altem, glatt getretenem Marmor.
Der TV funktioniert nicht, weil wohl der Decoder fehlt (vermutet die ortsansässige Frau, die sich um alles kümmert). Der Gast vor mir, der unter einem mitgebrachten mobilen Moskitonetz im Büro neben dem Arbeitstisch auf dem Fußboden geschlafen habe, weil ihm die Wohnung zu groß und zu unheimlich gewesen sei, habe sich kasteit und den TV nicht anschließen lassen, weil er befürchtet habe, sonst nur immer davorzuhocken und zu glotzen.
Den ganzen ersten Tag war ich wie betrunken. Man tritt vor die Tür und beginnt zu taumeln. Auf jedem Schritt begegnet einem überquellende, verwesende, begeisternde Pracht. Selbst die rumänischen Bettlerinnen drapieren sich neben den Kirchenportalen, als hätten sie vorher sämtliche Maria-Magdalena-Christi-Kreuzabnahme-Darstellungen studiert. (Auf denen gibt es doch immer so eine Frauenfigur, die sich besonders schmerzvoll über den Leichnam beugt oder sich unter dem Kreuz auf die Knie geworfen flehend und jammernd windet? Hier posieren die Bettlerinnen in dieser Haltung stundenlang draußen auf den hellen Steinböden, in Caravaggiofarben, Schwarzbraun, mit dramatischem Faltenwurf.)
Die Stadt ist phantastischer, als man es sich in den kühnsten Träumen auszumalen vermag. Man kommt an und denkt, das kenne man alles von Ansichtskarten. Dann besteigt man einen dieser Wasserbusse, die vor dem Bahnhof anlegen, einen Vaporetto, und kaum legt er ab, beginnt das Glück in einem hochzusteigen. Dicht gedrängt, wie die Sardinen oft (auf den Schiffen, in den Gassen), bleibt man möglichst regungslos senkrecht stehen, um ja nichts von seinem Glück überschwappen zu lassen. Man wird andächtig, als befinde man sich ganz allein in einem riesigen, dämmrigen Dom.
Zum Moskitonetz: Ja, den Erwerb eines solchen habe ich auch erwogen. Es müsste eines sein, das kastenartig an vier Ecken überm Bett hängt. Doch ist die Decke, an der es montiert werden könnte, viel zu hoch dafür, und Nägel in die Wände zu schlagen, das wage ich nicht. Die Wohnung steht unter Denkmalschutz. Letzte Nacht gab es keine Mücken. Tags zuvor hat es ein wenig geregnet. Abends ist es windig gewesen und kühl. Heute scheint wieder die Sonne.
Ich habe diverse Giftverdunster und -verdampfer in einem Schrank entdeckt und das dazugehörige Gift gekauft. Bei der nächsten Zanzaren-Attacke werde ich es damit versuchen.
Obwohl es keinen Taubenschiss gibt, der nicht schon millionenfach von Touristen fotografisch, zeichnerisch oder tagebuchtechnisch festgehalten worden ist, scheißen auch mir die Tauben einmalig beglückend auf den Kopf (wobei – da muss ich mich korrigieren –: das mit den venezianischen Taubengeschwadern ist ein Klischee, das nicht mehr zutrifft; Tauben gibt es hier nicht mehr als in Paris, Zürich oder Berlin auch).
05.06.
Ich glaube, ich werde bleiben und glücklich. Es fängt spätestens unten an, wenn ich die Haustür öffne und auf den sonnenbeschienenen, weißen Platz hinaustrete: Ein erhabenes Gefühl steigt in mir hoch, und ich beneide mich.
Im Telefonbuch habe ich Gaston Salvatores Adresse gefunden. Sogleich machte ich mich auf den Weg und schaute mir das Haus an. Es steht direkt am Canale della Giudecca, dem breiten Kanal, durch den die Kreuzfahrtschiffe geschleppt werden. Jeden Tag wird Salvatore somit mehrmals das Spektakel solch vorübergleitender Kolosse geboten. Außerdem hat er das beste Klima der Stadt; selbst bei größter Schwüle immer eine leichte Brise vom Meer her. Hier würde ich gern leben.
Heute Nacht um zwei eine Mücke. Ich habe den Elektrogiftverdunster in die Dose gesteckt und danach durchgeschlafen in der Überzeugung, keine Mücke mehr gehört zu haben. Wenn’s stimmt, wäre damit auch dieses Problem behoben.
Am Abend zuvor eine Pizza, im Freien sitzend, zwischen einem Kirchlein und einem Kanal. Auf dem Heimweg sind I. und ich über einen romantisch verwinkelten Platz gekommen, wo Tango getanzt wurde, unterm Vollmond. Das ist offenbar Mode in ganz Europa; auch in Berlin gibt es das inzwischen und in Zürich; aber in der venezianischen Kulisse, in diesem milden Klima und dieser Stille, treibt der Anblick einem die Tränen in die Augen. Mindestens eine halbe Stunde lang haben wir dagestanden und ergriffen zugeschaut. Nicht ein einziger Passant kam auf die Idee, trunken vor Seligkeit und Wein nun ebenfalls einen Tango auf den istrischen Kalk zu legen. Man hat einfach zugeschaut, ist weitergegangen, andere sind gekommen, blieben stehen, und die Paare haben getanzt und sich Mühe gegeben, ganz für sich allein. Sie beherrschten es recht gut, eine italienische Variante, nicht ganz so öligsehnig wie Argentinier, ein bisschen improvisierter, leichter, doch ohne falsche Tarantella-Fröhlichkeit, venezianisch zweifelnd, mit verhangenem Blick.
06.06.
Gestern war ich in der Kirche hinter unserem Haus, der Frari. In jeder hängt hier mindestens ein Tintoretto, ein Veneziano, ein So-und-so-o, man schaut sich die Bilder kaum an, nimmt nur einen schnellen allgemeinen Eindruck mit, tritt wieder raus in die Sonne oder in die Nacht (gestern war’s schon dunkel). In der Frari gibt es außer solch berühmten Bildern eine Art Mussolinischrein aus weißem Marmor zu besichtigen, eine Pyramide, links vors alte Gemäuer geklotzt, mit einer dunklen Stahlpforte, die halb offen steht und auf die menschengroße weiße Marmorfiguren zukriechen und -wanken. Unten drunter steht geschrieben, das Ganze sei Canova gewidmet. Ich fragte einen Mönch, der dabei war, die Kirche aufzuräumen und abzuschließen, ob die Figuren von Canova seien. Nein, das sei ein Mausoleum für ihn. Canova sei Präsident der hiesigen Kunstakademie gewesen, und sein Herz werde in diesem Schrein aufbewahrt – eine Gruft, in die man sich am liebsten auf der Stelle dazulegen würde!
An seinen Verleger,
zu den Assises internationales du roman (= internationale Generalversammlung des Romans) in Lyon waren lauter Bestseller und Sieger eingeladen. Ich als einziger deutschsprachiger Vertreter (nein, der Wahrheit zuliebe muss ich leider zugeben, dass außer mir noch Alain Claude Sulzer eingeladen war, der mir die Suppe der Exklusivität versalzte).
Herrlich, wie man als Homme de Lettres in Frankreich auf Händen getragen wird! Ich war in einem schönen Hotel untergebracht, aß und trank vorzüglich (sämtliche die französische Esskultur betreffenden Klischees werden in Lyon mehr als erfüllt), wurde zu den Restaurants chauffiert und danach schwankend zurück ins Hotel, hatte überall charmante Assistenten und Assistentinnen … Meine Arbeit bestand aus einem möglichst eleganten Sitzen an einer Table ronde, mit übereinandergeschlagenen Beinen, und einer Konversation über Le Regard du Promeneur. Mitorganisiert und moderiert wurde das Ganze von Le Monde. Etwa vierhundert Zuhörer hingen an meinen Lippen (nicht meiner Lippen wegen, sondern derer des Mitplauderers Monsieur Bailly, der in Frankreich offenbar berühmt ist). Danach wurde applaudiert, und wir wurden von Hostessen an Signiertische geleitet.
Mit schlechtem Gewissen muss ich gestehen, dass ich vergessen hatte, diesen Abstecher bei Euch anzumelden. Prompt lagen keine deutschen Bücher zum Verkauf aus, und prompt traten verzweifelte Käufer und Käuferinnen an meinen Tisch und fragten, ob ich denn nicht irgendein deutsches Exemplar zum Verkauf dabeihätte? Sie möchten mich unbedingt im Original lesen.
P. S. Es geht kein Weg drum herum: Du musst Dich überwinden und eine Kurzreise nach Venedig buchen. Die Stadt wird auch Dich zum Staunen bringen.
07.06.
An seine Übersetzerin,
auf Deine Empfehlung hin sind I. und ich sofort zu Carpaccio gepilgert. Ich hatte vorher noch nie etwas gehört von diesem Maler und dieser Kirche. Eine verwunschene Gegend, auch heute noch. Die Scuola Dalmata (so der offizielle Name) wurde dann allerdings nicht für uns allein geöffnet – was ich in Venedig im Grunde genommen immer irgendwie erwarte. Es waren noch zwei, drei andere Touristen da, und eine Schulklasse kam später hinzu, lauter etwa Sieben- oder Achtjährige. Der Lehrer erklärte ihnen die Legende vom heiligen Georg, die ich nicht kannte und in Zukunft nun da und dort souverän einflechten werde. Die beiden Räume lagen in schummrigem Rotbraun, das Holz glänzte, die Bilder tauchten nur schemenhaft aus dem Dunkeln auf, viel roter Samt hing an den Wänden – dramatisch schön.
An den Freund in Köln,
hast Du jemals eine Canova-Marmor-Skulptur im Original gesehen? Ich weiß nicht mehr, wo ich zum ersten Mal einer begegnet bin. Sie war überirdisch schön. Der Knabe und die Psyche zum Beispiel … Du würdest Dich unsterblich verlieben in die beiden. Nichts da von leichenstarr (der Name Thorwaldson sagt mir etwas, ja; wahrscheinlich bin ich auch dem längst verfallen).
Nein, Tango kann ich nicht tanzen. Ich habe es zwar in meiner Jugend einmal gelernt, bei einer achtzigjährigen Gesellschaftstanzlehrerin in Berlin. Sie hieß Mädi mit Vornamen und ist längst gestorben. Eine Institution. Tout Berlin tanzte draußen in der Welt jahrzehntelang Mädischritte und wurde damit wahrscheinlich belächelt. Ich buchte bei ihr einen Schnellkurs, weil ich zu einer Hochzeit eingeladen war, von der ich fürchtete, es komme zum Äußersten und ich müsse tanzen – was dann auch der Fall war. Der Tango, den ich tanzte, war unverkennbar fünfziger-Jahre-like. Ich habe ihn auf der Stelle vergessen danach (und alle anderen Tänze gleich dazu); ich tanzte wie Helmut Kohl.
Unter meinen Fenstern gleiten Gondeln vorüber, Lastschiffe mit Klavieren drauf, dazwischen Feuerwehren, Ambulanzen, Taxiboote mit einem Dottore oder einem Onorevole im Fond, die nach Hause oder ins Theater fahren … Nach wie vor haben I. und ich noch nicht damit angefangen, zu Hause zu leben. Das Geld fließt den Kanal runter wie das der Griechen. Ich kann kaum noch schlafen vor lauter Finanzsorgen. Aber es wäre eine Sünde, in dieser Stadt zu Hause zu bleiben und Kartoffeln zu essen.
Im Regal steht eine dreißigteilige Brendel-CD-Kassettensammlung mit unter anderem Mozart-Sonaten. Ich versuchte es mir einmal festlich zu machen mit Klavierklängen im Hintergrund. Bin fast wahnsinnig geworden bei dem enervierenden Geklimper. Dann habe ich Tangos aufgelegt – grauenhaft – dann Die vier Jahreszeiten – entsetzlich. Ich halte es nicht aus, Musik laufen zu lassen. Wenn überhaupt, will ich einen Hauspianisten haben, der mir auf meinem privaten Ibach-Flügel vorspielt (ein solcher steht im Salone und sehnt sich danach, angefasst zu werden).
Muss gleich wieder hinaus in die Pracht. Am Vormittag war ich auf dem Markt am Rialto. Von der Wohnung mit der Linie 1 direkt zur Haltestelle Mercato. Für den Alltag werde ich mich wohl mit dem Campo Santa Margherita begnügen. Fabelhafte Erdbeeren habe ich dort bislang täglich geholt. Zweimal in der Woche bauen auch drei Fischhändler ihre Stände auf. Und einen Bauern mit einem Boot gibt es; bei dem werde ich jeden Freitag eine Überraschungstüte Gemüse für zehn Euro holen (dazu hat mir die Frau geraten, die zur Wohnung schaut; ein Bauer, der die Tüten je nach Saison bepackt; man lässt sich als Kunde überraschen und kulinarisch inspirieren; das Gemüse sei bei ihm garantiert tagesfrisch).
An den Verleger,
wenn Du gern ziellos umherläufst, ist Venedig die ideale Stadt für Dich. Man kann sich hier nicht anders bewegen als zu Fuß oder im Schiff. Sich ein Ziel vorzunehmen ist sinnlos; man verläuft sich unweigerlich. Da man nicht genug kriegen kann von all der Herrlichkeit, geht man so lange herum, bis die Beine versagen. Dann setzt man sich in eine kühle Kirche, um sich ein wenig auszuruhen. Das Erstaunliche ist: Man hat nie Angst, etwas zu verpassen. Immer wird man ausgefüllt von dem, was man gerade sieht. Und wenn man es mal nicht wird, dann spätestens zwanzig Meter weiter, um die nächste Ecke.
Zu den Schiffen: Man muss sich nur die beiden Vaporetto-Linien 1 und 2 merken. Die 1 hält an jeder Station, die 2 nur an jeder zweiten oder dritten. Beide legen unter anderem auch bei San Tomà an, das liegt der Wohnung am nächsten. Wo immer man ist, kann man sich zur nächsten Vaporetto-Station durchfragen und findet sich dann wieder zurecht. Ich werde Dir bei Ankunft eine Dauerkarte überreichen, das lohnt sich, weil man nicht nur dann mit dem Schiff fahren sollte, wenn man’s braucht, sondern manchmal auch einfach so, um sich auszuruhen und in der Schönheit zu baden.
An eine Opernsängerin,
leicht erhitzt und schnaufend, weil ich mich aus den hinteren schattigen Gemächern auf den Weg zum Computer gemacht habe und nun im Arbeitssalon sitze, der ebenfalls schattig ist (die Holzläden halb vorgezogen, um meine Haut vor zu viel Sonne zu schützen – als Dichter darf man schließlich nicht allzu braun sein, weil sonst niemand mehr glaubt, dass man einer ist), lese ich Deine Mail und schüttle verwundert den Kopf über den wilden Norden, aus dem ich komme und in dem Du sitzt, offenbar tatsächlich im ewigen Eis, in Bärenfelle gehüllt …
Die Wohnung hier ist so schön, dass ich sie nicht beschreibe, um Dich nicht grün anlaufen zu lassen vor Neid (nein, ich beschreibe sie nicht, weil ich zu faul bin dazu; man legt sich hier auf Récamièren und döst und beschreibt gar nichts – das könnte ein kleines Problem werden: dass ich hier überhaupt nichts tun werde; Venezianer arbeiten nicht, die sterben langsam und gelassen vor sich hin).
I. und ich sind die erste Woche jeden Tag von früh bis spät durch die Stadt gelaufen und Schiff gefahren und wieder gelaufen, haben Kaffee getrunken und Wein, bis wir nicht mehr konnten, und abends haben wir immer irgendwo draußen auf einer Piazzetta gesessen und gegessen. Es gibt viele kleine Plätze mit einer Trattoria oder einer Pizzeria dran, die ihre Tische im Freien stehen haben.
An den Freund in Köln,
Fronleichnam wird in Italien nicht gefeiert: »… die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie …« Wie bitte?! Viel zu theoretisch. Hier will man’s bunter und konkreter, oder dann richtig schwarz und blutig dramatisch. So wird auch heute Eis gegessen und Wein getrunken.
Auf dem Rialtomarkt habe ich Artischockenböden gekauft und frische Erbsen. Die Artischockenböden sind bekanntlich das Beste an der Artischocke. Aus den Blättern machen sie hier Cynar. Die Böden lösen die Gemüsehändler fein säuberlich raus, legen sie in Zitronenwasser und verkaufen sie stückweise.
Zu Syrien: Wie kommt es, dass die Untergrund-Revolutionäre dort mit neuesten, teuersten, kompliziertesten Waffen ausgerüstet sind und der Armee auf Augenhöhe begegnen und ihr ernsthaften Widerstand leisten können? (Würden Du und ich in den Untergrund gehen und gegen Angela Merkel antreten, würden wir uns doch wohl entweder mit unseren Sackmessern behelfen oder mit einem potenten Partner einen Pakt schließen müssen?) Die syrischen Freiheitskämpfer treten nicht mit Dolchen, Jagdfalken und rostigen Gewehren an. Irgendwer wird sie also munitionieren, ausrüsten, unterstützen? Wer hat ein Interesse, in Syrien einen Umsturz herbeizuführen? Wer will es dort zur »Revolution« kommen lassen? Wer will Assad stürzen? Das Volk? Wer ist das Volk?
Das schreibe ich nicht, weil ich an ausländische Söldnertruppen oder imperialistische Agitatoren glaube. Das schreibe ich, weil es bedacht sein will: Was für Informationen kriegen wir, wer liefert sie uns, was genau erfahren wir? Assad hat jahrelang als besonnener, vertrauenswürdiger Verhandlungspartner gegolten. Ein im Westen ausgebildeter, intelligenter Mann. Kein Eiferer, kein Irrer. Einer, der uns als Stabilitätsfaktor verkauft wurde. Plötzlich fing man an, ihn zu demontieren (im Zusammenhang mit den einstürzenden Nachbarsystemen). Und nun soll er gar ein Kindermörder sein?
Zu diesem Thema: Wer nicht vollkommen verblödet ist, muss selbstverständlich seine Teilnahme an einer TV-Diskussionsrunde mit einem solch grotesken Titel absagen: »Assad lässt Kinder töten – wie lange wollen wir noch zuschauen?« Egal, ob in Syrien im Zusammenhang mit den Kämpfen Kinder getötet worden sind und werden oder nicht: An so einer Sendung nimmt man nicht teil. Das hatten wir schon mal: »Juden töten und essen Christenkinder – wie lange wollen wir dem noch zuschauen?«
An seine Tante in Palermo,
mein neustes Buch wird heißen Der Mann mit den zwei Augen und erzählt von einem Mann mit einer Nase, einem Mund und zwei Augen, weil mir nicht viel mehr eingefallen ist zu ihm als eben, dass er eine Nase, einen Mund und zwei Augen hat. Das wird auf gut zweihundert Seiten mit der Zeit natürlich nicht gerade spannender. Je nun, jeder muss mit dem zufrieden sein, was ihm einfällt. Mir fällt schon lange nichts mehr ein. Darum ist Venedig gerade das Richtige für mich: Dieser Stadt fällt auf jedem Millimeter etwas ein. Unglaublich, wie dicht hier alles beieinanderliegt, wie reich, bunt, verschwenderisch. Wenn ich Phantasie hätte wie Venedig, wären meine Bücher prallvolle Wundertüten und Weltbestseller.
08.06.
An den Freund in Köln,
in der NZZ heißt Assad Asad. Ich habe sie gestern gelesen und mich weitergebildet. Widerständer haben gerade hundert Soldaten der Armee niedergemetzelt und ein paar Panzer vernichtet. Ähnlich effektiv, wie als die US-Forces im Irak ihre neuen Waffen ausprobiert und die Resultate per Video auf unsere Gameboys übertragen haben. Ich hoffe, wir müssen nicht in ein paar Jahren lesen, dass Asad vom CIA ausgelöscht wurde, um in Syrien eine Marionette einsetzen zu können wie damals in Persien, wo sie den Ansatz von Demokratie niedergeschlagen und dem Schah seinen Pfauenthron zurückerobert haben, um mit ihm weiter ihre Geschäfte machen zu können. Worunter der Iran heute noch leidet. Hast Du auch für dieses historische Ereignis Deine eigene Deutung? Der Schah befreite das blutende Volk?
Ja, sicher, Artizschokkenblätter zutzeln – dieses calvinistische Essexerzitium kenne ich bestens (ich esse in Berlin oft Artizschokken; dort sind sie groß wie Blumenkohlköpfe). Für Italiener ist das viel zu mühsam. Die lassen ihre Sklaven die Artischocken zurichten, lassen deren Herzen herausschneiden und sie sich kredenzen, oder sie lassen winzige Sorten züchten, solche, wie sie später in die Dosen kommen und bei uns auf den Pizzen enden. Diesen Babyartischocken werden die Spitzen der Blätter weggeschnitten, dann werden sie in Zitronenwasser gelegt und so verkauft. Man braucht sie nur kurz anzubraten, mit Olivenöl und Knoblauch; sie sind butterzart und kräftig im Aroma – kein Gezutzel, nichts …
Im Büchergestell habe ich eine DVD mit dem Kongress der Pinguine entdeckt. Ein Film, der vor zwanzig Jahren ein Riesenerfolg war in der Schweiz, vielleicht sogar europaweit. Sozusagen die Erfindung des Pinguin-Film-Genres. Den schaute ich mir an und staunte darüber, womit man vor zwanzig Jahren Erfolg haben konnte.
/2
Jetzt soll man nicht einmal mehr Stahlhelm sagen dürfen? Dann lasst uns doch gleich anfangen, Italienisch zu reden miteinander, wenn man die Hälfte unserer schönen deutschen Wörter nicht mehr in den Mund nehmen darf. Günter Grass und Martin Walser sollten sich dieses Problems noch annehmen, bevor sie das Zeitliche segnen: Freiheit für die deutsche Sprache! Natürlich heißt es »sich groß machen und Stahlhelm auf« in einer Rinaldo-Freistoß-Situation. Offenbar schießt er hohe, krumme, scharfe Flanken, die ins Tor gehen, wenn keiner den Kopf hinhält. Sollen sie sich denn Schädelbrüche holen, die armen deutschen Fußballer?
Ich schaue nur TV, wenn ich einen habe. Vorläufig habe ich keinen. Es tut mir gut, nicht zu schauen. Ich sollte lesen (habe Kehlmanns Vermessung der Welt angefangen; der steht in der hiesigen Bibliothek, aber ich habe noch keine rechte Muße zum Lesen).
09.06.
Ach so, Du hast recht, das Zauberwort heißt natürlich public viewing! Hatte ich vergessen. Gerade in Italien, in diesem Klima, wird bestimmt exzessiv vor den Bars auf Plätzen freilicht Fußball geschaut. Ich werde heute Abend rausgehen und das überprüfen. Obwohl das Spiel ja noch nicht wichtig ist, werden es die Italiener gespannt verfolgen, weil sie sehen wollen, wie gefährlich die Deutschen sind. Deutschland wird hoffentlich nicht aus taktischen Gründen schlecht spielen und verlieren, wie sie es so oft gemacht haben, um es dann in letzter Sekunde über rechnerische Mauscheleien doch noch ins Achtelfinale zu schaffen. Spielt Italien bei der diesjährigen Europameisterschaft überhaupt mit, oder sind die schon im Vorfeld rausgeflogen?
Die Gemüsesack-Aktion hat sich gelohnt. Erstens liegt an dem Kanal, an dem ich warten sollte, die schönste Bar, die ich bislang kenne. Mit kleinen belegten Brötchen – besonders gut die Baccalà-Varianten, exzellent: »Mantecato« –, Salamirädchen, Käseecken usw., die man wie in Spanien die Tapas isst, dazu gute offene Weine in kleinen Gläsern. Das ist in Venedig Tradition, man nimmt das schon morgens am Rialto zu sich. Hier, direkt an einem Kanal, auf dem Ufermäuerchen sitzend, gegenüber von einer Gondelbauwerkstatt und einer Kirche, kurz vorm quer liegenden Giudecca-Kanal, auf dem ein riesiges Kreuzfahrtschiff vorüberglitt, während ich wartete. Nach und nach stießen weitere Leute dazu, etwa zehn, fünfzehn, irgendwann kam der Bauer in einem alten Kahn angeschippert, hatte darin etwa dreißig volle Plastiktüten. Er legte an, rief die Namen, die auf den Tüten standen, reichte die Tüten rüber und kriegte dafür je nach Größe fünf oder zehn Euro. Nach wenigen Minuten blieben ein paar Tüten übrig. Ich fragte, ob ich eine haben könne, eine für zehn, und schleppte dann eine etwa sieben Kilo schwere Tüte nach Hause. Darin ein Haufen Gurken (junge, knackige, etwa so groß wie ein erigierter Penis), ein Haufen gleich kleiner Zucchini, ein Haufen kleine Rote Bete, noch mit dem Kraut dran – soll beides sehr gut schmecken –, weiße, saftige Zwiebeln, direkt aus der Erde, süß wie Äpfel, ein Weißkohl, ein Haufen Fenchel – alles knackfrisch, aber viel zu viel. Ich werde die Aktion wohl nicht wiederholen. Was zum Beispiel soll ich mit zwei Kilo Gurken anfangen? Ich suche mir im Internet ein Rezept für Gurkenkaltschale raus.
Apropos Erdbeeren: Die schmeckten am ersten Tag exzellent. Am zweiten weniger. Gestern taugten sie nichts. Heute sind sie hoffentlich wieder exzellent. Das gefällt mir: Was man isst, hängt von der Tagesform, der Witterung und der Herkunft ab. Es gibt hier keine genormte Eurokühlhausware.
/2
Warum Deutschlands schönste Kuh keine Hörner hat, verstehe ich nicht. Kühe brauchen ihre Hörner für die Kommunikation. Hornstellungen werden von den anderen entziffert wie Morsezeichen. Eine Kuh ohne Hörner kann sich nicht gehoben ausdrücken und wird leicht missverstanden. Es gibt Stress und Streitereien untereinander. Ist das vielleicht eine hornlos gezüchtete Rasse? So etwas wie ein Mops der Gattung Vieh?
An eine Freundin in Berlin,
komm einfach und schau Dir das Ganze an. Vielleicht ist es Dir zu voll, zu schwül, zu verwest – vielleicht schmilzt Du hin und möchtest ewig bleiben.
Das Zimmer, das Du kriegst, ist groß und schön. Es wird uns zwar nicht gelingen, uns vollkommen unabhängig voneinander zu bewegen in der Wohnung, aber ich glaube, falls ich bis dann angefangen haben sollte, diszipliniert arbeiten zu wollen, würden wir es mindestens so einrichten können, dass wir aneinander vorbeikämen.
Fünf, sechs Tage vielleicht? Und wenn’s gutgeht, kannst Du entweder verlängern oder im November eine zweite Woche anhängen. Was man hier tut? Man sitzt abends draußen auf den Piazzette, isst Pizze, die Luft ist lau, der Mond scheint, es ist still. Wie in alten Filmen. Ein einziges Schweben.
An den Freund in Köln,
hat Deutschland tatsächlich die Stirn, seine ihm zugeloste Fußballgruppe einmal mehr als »Todesgruppe« zu bezeichnen? Das bringen sie nun schon seit Jahren. Heißen diesmal die Titanen, die es niederzuringen gilt, Irland, Kroatien und Montenegro? Oder müssen sie gar gegen so eine berüchtigte Todesschwadron wie die aus Dänemark oder Österreich antreten?
Ich weiß noch nicht, ob ich schauen gehe heute Abend. Nach einer Gurkenkaltschale bleibt man doch eigentlich zu Hause und liest ein kluges Buch? (Kehlmann ist unterhaltsam.) Ich war noch nie Fußballfan. Warum sollte ich es plötzlich werden?
Lyon? Im Hotel lagen jeden Abend ein Kärtchen mit dem Wetterbericht für den nächsten Tag auf dem Kissen und fabelhafte Karamellen mit Fleur de Sel. Das Bett war riesengroß, hoch (mehrere Matratzen übereinander, ohne Erbse darunter). Zum Frühstück gab’s für jeden Gast frisch in der Küche zubereitete Eier aller Art (von denen ich keins nahm, die Du aber genossen hättest). Abends aß ich panierte, frittierte Weinbergschnecken mit Bärlauchpesto, danach ein Riesenraviolo mit geschreddertem Hecht und karamellisiertem Junggemüse, danach fabelhaften Käse aller Art und eine Süßspeise, die aussah, als sei sie von Fabergé kreiert worden (Törtchen habe ich in den Confiserien gesehen, wie ich sie noch nie irgendwo sonst gesehen habe!). Auf dem Markt gab’s nicht einfach Erdbeeren, sondern mehrere namentlich voneinander unterschiedene Sorten – und die Kunden wussten genau, welche sie wollten … Überhaupt: die Kunden! Mit welchem Ernst sie die Waren prüften und diskutierten! Was für herrliche Austern morgens um elf an den Ständen geschlürft wurden! Was für Hühner da auslagen, was für Enten, was für Steaks und Würste! Die Markthalle (eine architektonische Monstrosität aus den achtziger Jahren) ist nach Paul Bocuse benannt; es gab darin nur Ware allererster Qualität zu kaufen, mit der auch er kochen würde (ich verirrte mich am Sonntagvormittag dort hinein und ging mit offen stehendem Mund, aus dem der Speichel tropfte, durch die Reihen der Stände).
Mein Auftritt in der Bibliothek war erinnerungswürdig. In einem Ort namens Firminy, eine Stunde Autofahrt von Lyon entfernt, in einem ehemaligen Bergbaugebiet, trostloser als Gelsenkirchen, winzig klein, abgehängt, verwahrlost. Dort hatte eine Klasse Sechzehnjähriger meinen Maurice gelesen und daraus eine szenische Lesung zu meinen Ehren vorbereitet. Strahlende Kinder sagten meine Sätze auf, als seien es ihre. Am Schluss wollte sich jeder mit mir fotografieren lassen und mir die Hand geben. Es war herzergreifend.
Der Auftritt am Abend dann, vor vierhundert Zuhörern, war nicht wirklich seriös: Ich sollte frei über den Blick des Promeneurs plaudern. An den Abenden vorher sah ich schon Claudio Magris plaudern und nach ihm zwei Franzosenstars – zur gemütlichen Stammtischrunde hat nur noch Esterházy gefehlt.
Da ich Auftritte ernst nehme und mich vorbereitet, auch die Texte meiner Mitdiskutanten gelesen und mir Notizen zu ihnen gemacht hatte, kam ich den Organisatoren wohl vor wie ein deutscher Wertarbeiter. Sie sprachen hinterher hochachtungsvoll mit mir, mit gedämpfter Stimme. Übrigens saß ich direkt hinter Yasmina Reza, als ihr der erstmalig vergebene Le Monde-Literaturpreis überreicht wurde. Da ich sie so nah vor Augen hatte, sah ich, dass ihr Gesicht ziemlich Botox-verbeult ist. Auf Fotos sieht sie nach wie vor umwerfend aus.
An die Frau, die zur Wohnung schaut,
im ehemaligen Berlusconi-Land kann es doch nicht so schwierig sein, einen Fernseher zum Laufen zu bringen? Ich habe in den Unterlagen die Rechnung des Geräts gefunden. Er wurde hier in der Stadt gekauft. Soll ich mit der Quittung einfach mal ins Geschäft gehen und fragen, ob sie jemanden vorbeischicken können?
10.06.
An den Freund in Köln,
ich war unten und habe die erste Halbzeit gesehen. Das Fußballfieber hat die Italiener noch nicht gepackt. Aber ich merkte, wie die Viren sich auszubreiten begannen. Einer der lebendigsten Plätze ist gleich bei uns in der Nähe der Campo Santa Margherita. Da haben mehrere Bars TVs aufgestellt mit dem Bildschirm nach draußen. Ich stand hinter ein paar Zuschauern, die da saßen und Bier tranken. Beste Bild-/Tonqualität. Nachdem Du mir geschrieben hattest, Ronaldo schminke sich, habe ich ihm besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Frisur hat mich vor allem beeindruckt. Und sein Dribbling ist reine Zauberei.
Eine Freude ist es, die Spiele auf Italienisch zu sehen. Der Kommentator hatte einen Narren an Schweinsteiger gefressen, vor allem am Namen. Kaum berührte Schweinsteiger den Ball, rollte der Kommentator dramatisch den Namen. Jedes Mal gelang es ihm, mich damit zum Lachen zu bringen. Niemand sagt so schön Schweinsteiger wie die Italiener. Auch Badstuber klang gut, aber vor allem Schweinsteiger. Der war wohl eine Zeitlang besonders gefährlich? Man hatte jedenfalls immer den Eindruck, sobald er den Ball bekomme werde es ernst, so wie bei Ronaldo – doch jedes Mal verlor er ihn umgehend oder spielte ihn einem Portugiesen zwischen die Füße.
Ich werde mir die Spiele auf dem Campo ansehen, sobald es um was geht.
Kehlmann ist nicht nur unterhaltsam. Er schreibt spannend und gut. Ich verstehe seinen Erfolg und akzeptiere ihn.
11.06.
Anstatt von Renegatentum zu sprechen, kannst Du Die Vermessung der Welt einfach mal selber lesen. Es ist ein Abenteuerbuch für Erwachsene. Wenn Du niemals in Deinem Leben Abenteuerbücher mochtest (Lederstrumpf usw.), bist Du vielleicht einer der wenigen, die nichts anfangen können damit. Ich mag Reise- und Abenteuerbücher. Mochte Pierre Loti, mochte Ransmayrs Schrecken des Eises und der Finsternis usw. Man kann seine Meinung auch mal korrigieren und muss deswegen nicht gleich seinem Glauben abschwören. Das Buch ist spannend, gut geschrieben, recherchiert und noch dazu lehrreich – ein Coup.
Zum Mann mit den zwei Augen: Seit Jahren versuche ich Dir zu erklären, dass es der Mann ist, von dem ein Zeuge, auf der Polizeiwache nach ihm befragt, sagen würde: Mhmmm, warten Sie mal, also zwei Augen hatte er, doch, ja, daran kann ich mich erinnern, und eine Nase, glaube ich, einen Mund auch, ja, und zwei Ohren – mehr fällt mir beim besten Willen nicht ein … Ich verstehe nicht, warum Du Dich damit so schwertust: Ich erzähle von einem Jemand/Niemand, von einem/keinem/hunderttausend, der alles und nichts erlebt, in einem Nullachtfünfzehnstil. Das Buch ist ein sich selbst auflösendes. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Etwa das erzähle ich, bloß benötige ich ein paar Seiten mehr dafür.
Aus Göttingen höre ich, dass der Text inzwischen bei der Setzerin ist. Ich nehme an, der Verleger will mir das erste Exemplar nach Venedig bringen (und Salvatore seins ebenfalls). Wir liebäugeln mit einer Doppelbuchpremiere im hiesigen deutschen Kulturinstitut, das eine der größten Terrassen auf den Canal Grande hinaus hat. Heute oder morgen werde ich dort meinen Antrittsbesuch machen. Die Terrasse habe ich vom Vaporetto aus schon mehrmals angestaunt, beim Vorüberfahren. Ein Präsentierteller für Dogen auf erster Etage an einer Kanalkreuzung. Der Palazzo führt sie sogar im Namen: »Palazzo Barbarigo della Terrazza«.
Gestern Abend ging ich kurz runter, nachdem ein Stöhnen die Stadt erbeben ließ: Italien hatte offenbar das Anschlusstor geschossen. Es saßen sehr viel mehr Leute vor den Bars als am ersten Abend. Ich schaute bis zum Schluss. Die Spanier sind gut. Doch richtig rund lief es auch bei ihnen nicht. Die beiden Trainer haben mir gefallen; intelligent aussehende, elegant angezogene Herren.
12.06.
Selbstverständlich kommt bei mir Parmesan nur am Stück ins Haus. Und zwar nicht Grana Padano, sondern echter Parmesan. (In der Küche steht ein Kochbuch, Harry’s Bar. Dort kann man alles über diese beiden Käsesorten erfahren. In Zukunft werde ich nie mehr was anderes zwischen meine Zähne lassen als Parmigiano Reggiano.)
Heute kurze, heftige Gewitter mit Hagel und starkem Wind, dann wieder strahlende Sonne. Eben komme ich von der Giudecca zurück. Die Schlüsselbewahrerin verriet mir, wo Ulrich Tukur wohnt (er ist auf der Giudecca, wo auch sie wohnt, bekannt – Venedig sei klein, da kenne jeder jeden). Direkt gegenüber von Venedig. Ein spektakulärer Blick. Im Rücken allerdings die Giudecca, die mir ein wenig wie Moabit vorkommt. Aber der Blick! Und gerade, als ich in der Bar unter seiner Wohnung einen Kaffee trank, wurde wieder ein Kreuzfahrtschiff vorübergeschleppt. Ein Anblick wie eine Fata Morgana.
Das mit dem neuen Buch ist ein grundsätzliches Problem. Je älter man wird (ich nehme an, ein »man« ist hier angebracht; es wird nicht nur mein individuelles Problem sein), desto schwerer fällt es einem, auf seinem Weg weiterzugehen. Die Zweifel werden größer, die Skrupel und die Ängste auch; man wird verkrampfter und verzagter (es sei denn, man ist gestrickt wie Günter Grass oder Martin Walser – die freuen sich wahrscheinlich heute noch über jedes Häufchen, das sie setzen). Was mich beschäftigt, ist also nicht so sehr das neue Buch, sondern mein zunehmendes Wissen um die Vergeblichkeit all meiner Bemühungen. Dazu kommt, dass das Buch keinerlei Chancen hat, eine Vermessung der Welt zu werden. Geschweige denn ein Mann ohne Eigenschaften, den ich natürlich dereinst noch viel lieber geschrieben haben wollte als zehn Kehlmann-Bestseller zusammen.
Zu Lyon noch: Interessanterweise tauchte dort das Rudelproblem nicht auf. Franzosen scheinen keinen Solidaritätszwang zu verspüren. Die kamen zu ihren Rencontres und verschwanden danach ganz selbstverständlich wieder; jeder ging mit seiner Entourage hervorragend essen. Man wechselte vor und nach der Veranstaltung knapp ein paar Sätze Smalltalk miteinander; auf der Bühne dann redete jeder nur für sich – die meisten beneidenswert elegant. Trotzdem profanieren solche Auftritte selbstverständlich. Dass man heute all diese sogenannten Intellektuellen nicht mehr hören und sehen mag, hängt mit deren TV- und Podiumsgespräch-Verschleiß zusammen.
Eine Beobachtung am Rand: Alle zitierten wie die Besessenen. Wer nicht zitiert, gilt in Frankreich offenbar als unkultiviert. Wie Du weißt, leide ich geradezu unter einer Zitatblockade. Ich sage nur, was mir einfällt, und sichere das niemals ab. Nun wussten sie nicht, ob ich’s vielleicht faustdick hinter den Ohren habe oder ob ich ein Naturbursche bin, ein Wilder, den man in den Pariser Salons rumreichen könnte. Bailly zitierte naturgemäß ein paar Passagen-Perlen von Walter Benjamin. Ich sagte, meiner Meinung nach dürfe man die nicht wörtlich nehmen. Bestimmt habe Benjamin wehe Füße gehabt. Der sei kaum allzu viel rumpromeniert, zumal er sich aller Wahrscheinlichkeit nach davor gefürchtet habe, in die grauen Vorstädte zu gehen, zu den Proletariern. Sein Spazierengehen sei vermutlich ein rein zerebrales gewesen. Le Monde hat den Mund beinahe nicht mehr zugekriegt, weil man so nicht über einen Benjamin spricht.
13.06.
Dein Internet-Wetterdienst ist definitiv unbrauchbar. (Übrigens auch in der FAZ ist er unbrauchbar. 20 Grad, R – das heißt in Berlin ungemütlich, windig, nass. In Venedig heißt das: in der Morgendämmerung ein paar Regentropfen; die Luft stallwarm; dann wird es hell, der Himmel blau, darin schweben ein paar weiße Wölkchen. Manchmal verfärben sie sich im Lauf des Tages ins Graue und schauen kurz finster. Manchmal hebt eines sogar das Bein und pinkelt an eine Ecke. Dann ziehen sie weiter, man setzt sich in die Sonne, die sie freigeben, und erholt sich von der garstigen halben Stunde.)
Die paar Tage, die ich nun hier bin, war’s herrlich warm, manchmal heiß (oft schwül). Ich trage seit dem ersten Tag nie ein Jackett, nie ein Unterhemd, nur Hemden. Ich schlafe unter einem Leintuch ohne Decke. Gestern regnete es dreimal kurz hintereinander am Morgen, einmal vermischt mit Hagel – sonst auch gestern schön. In der Zeitung oder im Internet liest sich das so: Venedig, Regen, 22 Grad. Es kann sein, dass die Temperatur irgendwo im Schatten objektiv 22 Grad misst und dass tatsächlich ein paar Tropfen fallen – empfunden wird die Temperatur höher, und der Regen ist ein unterhaltsamer Gast.
Offensichtlich hast Du weder die Vermessung der Welt noch die Atemschaukel gelesen. Du hast in beide nur kurz reingeschaut und entschieden, es sei nicht Deine Literatur. So geht das aber nicht. Hier steht zum Beispiel Der Immune von Hugo Loetscher. Nie hätte ich das Buch angeschaut, da es nicht »meine Literatur« ist. Das weiß ich, ohne auch nur eine Zeile davon zu kennen. Nun überlege ich, ob ich es vielleicht lesen soll. Das würde bedeuten, es vorne zu öffnen und auf der ersten Seite mit Lesen anzufangen und mindestens bis Seite fünfzig durchzuhalten. Dann werde ich vielleicht entdecken, dass er gar nicht so weit weg ist von dem, was ich für lesbar halte. Oder ein dickes Hanna-Johansen-Buch steht da, die Universalgeschichte der Monogamie. Nie wollte ich es lesen. Nun steht es hier, und ich schaute rein und sah: Es ist durchaus eins nach meinem Geschmack.
Heute habe ich vor, an den Lido zu fahren und zu schauen, wo ich ab dem Fünfundzwanzigsten jeden Morgen meine Runden ziehen will. (Habe mir vorgenommen, ab dem Fünfundzwanzigsten frühmorgens den Vaporetto zu besteigen, an den Lido zu fahren – die Linie 2 fährt von unserer Haltestelle direkt hin –, ein paar Züge zu schwimmen, dann einen Espresso zu trinken und ein Cornetto Latte Panna zu essen – dann schwimmt man nach einem Monat von selbst obenauf; diese gefüllten Cornetti sind fett und süß –, dann zurückzufahren und in der schattigen Wohnung die Auferstehung in Venedig zu dichten. Du siehst: rücken- und leserfreundlich, meine Zukunft.)
An die Frau, die zur Wohnung schaut,
verlangen Sie bloß nicht von mir, dem Elektrofachhändler Caputo gegenüber selbstbewusst aufzutreten. Ich habe einen Selbstbewusstseins-Knacks, ein frühkindliches Trauma wohl (ich glaube zwar nicht an frühkindliche Traumata, aber um Knackse schnell und einfach zu erklären, sind sie praktisch). Unabhängig davon habe ich noch den Schweizerknacks und meine immer, ich sei »nur« ich. Kann also niemals jemandem gegenüber Arroganz zeigen, selbst wenn ich sie empfinden würde. Wenn wir Herrn Caputo in seine Schranken verweisen wollen, müssen Sie schon selbst antreten und ihm die Stirn bieten.
An den Freund in Köln,
nun haben I. und ich die Wege zum Lido also getestet. Eine weitere Steigerung: der Lido! Ich dachte immer, dort schwappe Gülle, doch das Wasser ist sauber, und ein südseeinsulanisch flacher, feiner Sandstrand erstreckt sich beidseitig bis an den Horizont. Dazu die unterschiedlichen Badehäuschen der Grandhotels – was für eine Ästhetik! Was für eine gesegnete Stadt! Hier braucht man Kindern nichts zu schenken zum Geburtstag; es reicht, dass sie hier aufwachsen dürfen. Überwältigend. (Du kannst im Internet bei Gelegenheit mal ein Fuder »Überwältigend« für mich bestellen, zum Schnäppchenpreis, in China hergestellt. Ich brauche jeden Tag mindestens zehn davon.)
Ein strahlender Morgen. Ab drei zog sich der Himmel zu, momentan geht ein heftiges Gewitter nieder. Fast noch aufregender als der strahlend blaue Himmel. Ich sitze schwitzend vor dem Computer.
Heute früh einen Fisch gekauft auf dem Campo Santa Margherita. Den braten wir jetzt. Danach geht’s vor den Flatscreen auf dem Campo – bis dann ist es bestimmt wieder warm und trocken. Bin gespannt, ob heute schon Stimmung aufkommt. Mir scheint, vorläufig halten sich alle noch bedeckt. Nur wenn die Italiener spielen, wird’s lauter.
Im Harry’s-Bar-Kochbuch steht mehr Klatsch und Tratsch als Kochkunst. Fische werden darin im Mehl gewendet und in der Pfanne gebraten, dazu Salz und Pfeffer. Dafür brauche ich keine Herren Cipriani. Aber die Anekdoten, die erzählt werden, sind sympathisch.
14.06.
Die Fußballspiele gestern habe ich ausgelassen. Nach dem Gewitter blieb die Luft abgekühlt. Ich ging zwar runter, schaute etwa eine Viertelstunde zu, sah Gomez’ erstes Tor, hatte den Eindruck, die Deutschen werden gewinnen, und kehrte nach Hause zurück. Schweinsteiger war wieder das Lieblingswort des Kommentators (diesmal war’s ein anderer, der’s ein wenig anders aussprach). Das erste Tor scheint er genial vorbereitet zu haben? Ich sah nicht allzu viel, da ich die Brille zu Hause vergessen hatte.
Vor mir saß ein Deutscher, der seiner Freundin erklärte, Gomez sei zwar eine Pflaume, aber immerhin … Und in der Zeitung las ich den schönen Satz, im Spiel gegen Portugal hätte man ihn in der zweiten Hälfte einmal wenden sollen, um ihn davor zu bewahren, sich wund zu liegen. Seine Rolle verstehe ich nicht: Wie kann sich Deutschland einen Mann leisten, der immer nur vor dem Tor rumlungert und wartet, bis ihm jemand den Ball vor die Füße legt, den er dann mit einem Tritt ins Netz befördert? Haben die anderen alle einen Mann weniger auf dem Feld? Im Internet habe ich gelesen, er sei noch ziemlich jung und frisch im Geschäft? Dabei sieht er aus wie ein alter Söldner, der gnadenhalber seine letzte EM spielen darf.
Die Vermessung der Welt ist im letzten Viertel missglückt. Immer wieder erstaunt mich, wie man mit halben Büchern oder mit nur zwei, drei geglückten Passagen – oder mit zwei, drei skandalösen Seiten – einen Welterfolg schaffen kann. Die wenigsten Leute lesen Bücher offenbar zu Ende? Zwanzig spannende erste Seiten – und man hat Chancen, einen Bestseller zu landen.
Es liegt weniger an Kehlmann als an seinen beiden Hauptfiguren: Humboldt scheint in der zweiten Hälfte seines Lebens nur noch seinen tollkühnen Jugendtaten hinterhergehechelt zu sein, und Gauß hat sich verrannt in theoretische Tüfteleien? Bei beiden hält der Lack nicht bis an ihr Ende. Beide scheinen früh ausgebrannt gewesen zu sein. Im Leser regt sich der Zweifel an beider Wichtigkeit. Das ist schlecht. Man will nicht ein Buch über zwei Mittelprächtige gelesen haben (vor allem nicht, wenn einem weisgemacht werden will, sie hätten zur Weltspitze gehört). Ein Buch über zwei Scharlatane, die von Anfang an als solche eingeführt werden, das würde ich bestimmt gern lesen. Aber nicht ein Buch über zwei Titanen, die als selbstgerechte, eitle Spießer enden.
An einen Komponisten,
unbedingt kommen! Gleich buchen und festmachen den Termin! Ich habe ihn umgehend eingetragen in meine Agenda (zwar mit Bleistift, weil ich weiß, wie leicht etwas dazwischenkommen kann, aber eingetragen ist’s, und ich würde, wenn Du’s mir bestätigst, anfangen zu behaupten, am 15. oder 16. November finde hier ein Fest mit Klaviermusik statt).
Der Ablauf? Keine Ahnung. Ein Pièce de résistance wäre auf jeden Fall Deine Klaviersonate. Alles Weitere wird man sehen. Dein Pianist und Du dürft nicht zu streng sein in Euren musikalischen Ansprüchen. Vielleicht gibt es außer der Sonate nichts Seriöses mehr im Programm, weil mir neben Deiner eine Liszt-, Wagner-, Mozart-(oder wer noch alles in Venedig komponiert hat)-Sonate irgendwie albern vorkäme; wobei: Wenn der Pianist es sich vorstellen kann, einen Chopin neben Dein Stück zu setzen, fände ich auch das wunderbar. Vielleicht schlage ich Euch allen Ernstes einen Kessel Buntes vor, mit einem Text von mir dazwischen und zwei, drei Liedern von Zazie, wobei ich Euch auf keinen Fall ins Unterhaltungsfach rüberziehen will. Ich stelle mir wirklich eher ein Fest vor als ein seriöses Konzert.
Die Wohnung ist schön, groß, hell. Sie liegt mitten im Auge des Touristen-Taifuns, durch eine winzige Gasse getrennt von ihm, dadurch in absoluter Ruhe. Mit Blick über Kanäle (vor dem Haus fließen drei zusammen). Inzwischen gehe ich manchmal sogar schon gern auf den Markusplatz, um mich dort von der Gondoliere-Hysterie elektrisieren zu lassen – und dann zurückkehren zu können in die Stille.
An den Freund in Köln,
oh je, noch ein Schweizer, der »seine Erlösung nur im hartnäckigen Weiterschreiben« meint finden zu können: Christoph Schwyzer. Vielleicht sollte ich ihm verraten, dass er einem fatalen Irrtum aufsitzt? Warum bloß kann sich das Gerücht halten, im Schreiben liege irgendein Glück verborgen?
Funtik sollte er werden wollen. Hast Du im TV das polnische Orakelschwein namens Funtik gesehen, das voraussagt, welche Fußballmannschaften weiterkommen werden? Zum Umarmen. Am liebsten würde ich ihm jeden Tag ein wenig zuschauen bei seinen schweren Entscheidungen. Als Orakel in einem Koben zu liegen und undurchschaubar vor mich hin zu blinzeln und schmunzeln, das stelle ich mir schön vor. Und wenn ich nicht mehr schmunzeln mag, mit einem Bolzengewehr vom Dasein erlöst zu werden. Das wäre eine Perspektive, die mich locken könnte. Aber doch nicht, ein weiterer Victor Hugo zu werden!
Noch einmal zu Kehlmann: Er erkannte bestimmt, dass weder Gauß noch Humboldt wirklich Weltformat hatten. Und er wollte diese Tragödie wahrscheinlich sogar mit thematisieren. Deswegen werden die beiden im letzten Drittel zu bedauernswerten, zwiespältigen Alten. Humboldt liebedienert am Berliner Hof, nachdem er realisiert hat, dass er im Grunde genommen nichts anderes war als ein Schmetterlingssammler, dem seine Sammlung über den Kopf gewachsen ist (er sammelte ja offenbar wie ein Besessener einfach alles), und Gauß drehte sich verbittert um sich selbst – und beide realisierten, wie ihr Stern schon zu Lebzeiten sank und wie die Welt sich kaum noch um sie scherte. Das gehört wohl mit zu Kehlmanns Konzept. Bei mir hätte die zweite Hälfte sehr viel mehr Platz eingenommen – womit ich mich einmal mehr in die Erfolglosigkeit hineingeschrieben hätte.
Von Kehlmann haben die Leute die ersten hundert Seiten gelesen, die Abenteuer, den steilen Weg nach oben in die Größe. Wo’s zäh wird, haben sie das Buch weggelegt, und nachdem es zwei Monate rumlag, haben sie’s ins Regal gestellt und für sich gemurmelt: Irres Teil …
An die Frau, die zur Wohnung schaut,
falls Cavaliere Caputo kommt, nehme ich an, er wird feststellen, dass er auf jeden Fall noch ein zweites Mal kommen muss. So einen Eindruck hat er mir gemacht. Und er wird wohl aufs Dach steigen und unsere Antenne suchen und ausrichten müssen. Da ich nicht weiß, wie man auf unser Dach gelangt, werde ich Sie so oder so anrufen müssen, um nächste Schritte unternehmen zu können. Sie brauchen sich daher um nichts zu kümmern, sollten einfach wenn möglich telefonisch erreichbar sein ab neun (das mit dem Bezahlen ist kein Problem; falls er heute alles erledigen kann, bezahle ich, und Sie geben mir das Geld irgendwann zurück).
Die Stifter überlegen, ob sie einen oder zwei Ventilatoren anschaffen wollen für die Wohnung. Da sie so schön ist, finde ich, hier müssten exklusive Exemplare rein. Ich habe ihnen geschrieben, sie sollen sich einen Dyson anschaffen. Das ist ein technisches Wunderding. Nun wollte ich mich erkundigen, ob und wo man ein solches hier kriegt. Das überfordert aber meine Fähigkeiten. Können Sie rausfinden, wo es die allenfalls geben könnte? Die Firma heißt Dyson. Ich bin sicher, auch in italienischen Edeldesign-Läden gibt es sie zu kaufen. Vielleicht sind sie blödsinnig teuer. Dann soll man natürlich darauf verzichten. Vielleicht kosten sie aber nicht viel mehr als normale Lüfter, dann fände ich es passend für die Wohnung. (Ob ich jemals einen hier brauchen werde, weiß ich nicht. Die Räume sind so hoch und groß, dass ich denke, man kann’s auch bei größter Hitze und Windstille gut ohne aushalten.)
15.06.
An eine Mitarbeiterin im Verlag,
bloß vorher nichts lesen über Venedig! Sonst verzweifelt man hier, weil man immer denkt, man müsse noch dies und das besichtigen. Ich habe bis heute noch nichts gesehen von dem, was man gesehen haben muss, und fürchte, das wird bis zuletzt so bleiben.
Das Überraschende ist, dass man am Bahnhof Santa Lucia aus dem Zug steigen und losgehen kann und immer nur staunt. Es ist unmöglich, irgendwohin zu gelangen, wo der Verdacht einen befallen könnte, nun sei man ins Abseits geraten. Überall ist man immer mittendrin. Und wenn einen das schlechte Gewissen packt und man denkt, man müsse nun etwas für seine Bildung tun, dann betritt man rasch die nächstbeste Kirche, läuft an zwei, drei Tintorettos vorüber, die dort an der Wand hängen, und denkt für sich, aha, Tintoretto – geht wieder raus und freut sich an der nächsten schwermütigen Ecke und am nächsten Espresso. Inzwischen trinke ich manchmal sogar Orzo, weil ich sonst übersäuert werde. Orzo ist Gerstenkaffee. Den trinken hier viele zwischendurch, um sich zu erholen. Man wird nicht verachtet, wenn man einen solchen bestellt, sondern eher mitfühlend angeschaut.
Gestern zum Beispiel bin ich an einem Kanalufer entlanggegangen. Rechts eine Mauer, ungewöhnlich lang. Dahinter in einem kleinen Park ein dezenter Palazzo. An der Mauer hing eine Plakette: Hier hat es dem russischen Nobelpreisträger XY besonders gut gefallen (irgendwas wie Pilnjak oder Pasternak oder was weiß ich – von wegen Bildung! nicht einmal den Namen konnte ich mir merken; muss extra noch einmal hingehen und ihn abschreiben, um dann im Internet raussuchen zu können, was der in Venedig gemacht hat), jedenfalls stand oben auf der langen roten Backsteinmauer (die untenrum standesgemäß ins Grünliche, Salpetrige überging) ganz allein, vollkommen asymmetrisch, eine vom Salzwasser angenagte steinerne Putte, so unglaublich frei, überraschend, wie ein Reh im Wald, das kurz auftaucht, völlig unsinnig, wunderschön, ganz allein oben auf einer Mauer mit Blick über den weiten Kanal. Das reicht einem für die nächste Viertelstunde an Schönheit. Da ist kein Platz mehr für einen Tizian.
An seinen Bruder A.,
dass Du von Dan Brown die ersten zwanzig Seiten fotokopiert und gemailt hast, hat mich gerührt. Doch nicht einmal die Rührung schaffte es, mich dazu zu bringen, das Zeug zu lesen. Ich hab’s immerhin versucht (was auf meinem Laptop eine Leistung ist; die trübfarbenen Seiten nehmen das untere Drittel meines Bildschirms ein und müssen eine nach der anderen abgescrollt werden; als meine Augen zu brennen und der Rücken zu zwicken begannen, gab ich’s auf, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen). Es ist keine Literatur. Was Literatur ist, weiß ich nicht, habe aber zufällig vor meiner Abreise in Berlin wieder einmal ein Lektüreglück erlebt und realisiert, was Literatur bewirken kann. Und zwar habe ich endlich einmal Den großen Gatsby gelesen. Ein dünnes Buch, das an mehreren Stellen und als Ganzes eigentlich verunglückt ist, das aber viele Passagen von großer Dichte und Schönheit enthält. Dass sie das Buch verfilmt haben und immer wieder zu verfilmen suchen, verstehe ich. Und auf der anderen Seite denke ich, was wollt ihr? Es ist ein Buch. Es ist Literatur; die hat – wenn sie funktioniert – eine unvergleichliche Kraft. Am liebsten würde ich mich nach so einem Leseerlebnis sofort an den Tisch setzen und noch einmal ganz von vorne anfangen. Was für eine ergreifende Kunst Literatur sein kann!
An den Freund in Köln,
gestern und heute ein dünnes Büchlein von Koeppen gelesen: Ich bin gern in Venedig warum. Kurze Texte, die offenbar für eine TV-Dokumentation als Kommentar geschrieben wurden. Ich glaube, Koeppen hätte mir gefallen. Unter anderem beschreibt er einmal, wie er rund um den Markusplatz geht und davon erschöpft ist. Junge Rucksacktouristen nehmen ihn wahr: »… Ich war schon groggy. Sie lachten mich aus. Wissen nicht, was ihnen bevorsteht.« (Schluss des Textes.) Selten so lakonisch das Grauen des Alters gelesen.
An R.,
Du kennst die Regel bestimmt auch: Nur in den Monaten mit R darf man Austern essen. Leute wie Du, die ihr R im Namen mit sich führen, sind offenbar privilegiert und dürfen sich auch durch Mai, Juni, Juli und August schlemmen? Ich traue mich hier nicht einmal, Miesmuscheln zu essen. Das tun die Venezianer unverdrossen, die doch auch gehört haben müssten von der R-Regel … Zur Vorspeise steht bei denen hier im Restaurant oft ein gemischter Teller Cozze und Vongole auf dem Tisch, trotz Juni.
Zum passiven Seniorendasein: In das bin ich hier nur allzu leicht und gern hineingeglitten. Tappe langsam durch die Gassen, halte mich an den Geländern fest, wenn’s die Treppchen hochgeht und wieder runter (Brücken), und möchte nur noch beschaulich vor mich hin träumen. Leider darf ich mir das noch nicht leisten. Werde mich zwingen zur Aktivität. Habe vor, jeden Morgen den ersten Vaporetto zu nehmen, an den Lido zu fahren und dort mit anderen Senioren Morgengymnastik (Frühschwimmen) zu absolvieren. Dann zurück im Vaporetto und in mein schattiges Piano nobile, wo ich mich auf den Dichterstuhl setzen und einnicken werde.
16.06.
An die Leiterin des deutschen Studienzentrums Venedig,ein Treffen mit Gaston Salvatore ist eine delikate Angelegenheit. Sie sagten, er erwarte, gelesen zu werden? Ich kenne fast nichts von ihm – nur als öffentliche Person ist er mir ein Begriff. Ich weiß nicht, ob er die Größe hat zu akzeptieren, dass ich ihn ebenso wenig lese, wie er mich liest. Das ist in meinem Fall kein böser Wille. Ich lese grundsätzlich wenig und eher widerwillig. Gehe lieber rum. Wenn er – von Enzensberger verwöhnt – gern mit Hommes de Lettres über (seine) Literatur plaudert, wird ein Treffen mit mir zäh für ihn. Ich rede lieber über Parmaschinken. Vielleicht sollten wir warten, bis unser gemeinsamer Verleger kommt? Bestimmt wird der dann auch Salvatore besuchen wollen. Er ist belesen. An seiner Seite traue ich mich überall hin.
An den Bruder A.,
warum ich Dan Browns Popcorn nicht runterkriege? Nimm als Beispiel die Szene, die Du mir geschickt hast: Eine Zigeunerin setzt sich abends zum Ausruhen vor die Markuskirche, mit dem Rücken an die Mauer gelehnt, neben sich ein vergitterter Schacht, in dem dann passiert, was passiert.
Kurz wird in mir der Jägerinstinkt wach. Ich kriege Lust, an den Markusplatz zu fahren und zu schauen, wo die Szene sich wohl abgespielt haben könnte. Was ich dort vorfinde, ist ein Gitter am Boden, durch das man in einen Schacht hinabschauen kann. Und ich kann daraufhin ausrufen: »Donnerwetter?! Da hat Dan Brown aus Amerika doch tatsächlich ein Kellerfenster am Fuß der Markuskirche entdeckt und hat es abgeschrieben!« Das war’s. Die Wirklichkeit zeigt mir genau das, was er oder einer seiner Assistenten für ihn abgeknipst hat.
Wenn Patricia Highsmith von einer Trattoria erzählt, in der Ripley ein zähes Bistecca isst, am Tisch neben der Eingangstür, die ihm jedes Mal in den Rücken haut beim Auf- und Zugehen, dann erzählt sie eine von ihr empfundene Trattoria, die durch die Beschreibung etwas Düsteres, Sonderbares, Erinnerungswürdiges, Spezielles wird. Wenn ich die Trattoria, von der sie ausgegangen ist, suchen gehe, werde ich sie finden und mich darin an Highsmith’s Stimmung erinnern. Die Trattoria ist in Wirklichkeit eine wie viele andere, durch ihre Übersetzung ins Buch wurde sie aber dräuend, ripleygesättigt, unverwechselbar, aufgeladen.
Es interessiert mich nicht, zu erfahren, dass ein Räuber oder ein Gendarm beim Verlassen des Marco-Polo-Flughafens nach links oder rechts durch einen fünfhundert Meter langen, gedeckten Plexiglas-Korridor zum Taxibootsanleger gegangen ist. Dan Brown soll mir von einem sterilen, fahlen Korridor berichten, in dem es nach etwas roch, das ihn an seine Lehrerin erinnerte, die einen künstlichen Darmausgang hatte oder was weiß ich. Ein Autor soll die Wirklichkeit aus seiner Perspektive schildern, sie fokussieren, verdichten, damit sie für den Leser interessant wird. Dass ich am Marco-Polo-Flughafen draußen nach links oder rechts muss und dass der Weg durch einen Plexiglasschlauch führt, diese Information bietet mir das Leben. Sie sieht für jeden gleich aus. Literatur darf nicht abknipsen, sie muss eine Position beziehen, eine Brennweite wählen, ein Licht, eine Einstellung.
An den Komponisten,
eine praktische Überlegung: Wenn Ihr am 15ten mittags hier ankommt und zuerst an den Lido rausgondeln müsst ins Hotel, dann wieder zurück zu mir, kann das ein ziemliches Gehetz werden. Außerdem: Am Abend, nach dem Konzert zurück an den Lido … Das ist, wie wenn Ihr in Berlin nachts noch nach Pichelsdorf rausfahren müsst und deswegen keinen Alkohol trinken dürft. Es sei denn, Ihr fahrt Wassertaxi (kostet etwa hundertzwanzig Euro zum Lido). Der letzte Vaporetto fährt (im November) wer weiß wann und wer weiß von welcher Anlegestelle aus. Und am 17ten früh wollt Ihr weiter nach Turin? Auch da müsstet Ihr erst vom Lido wieder zum Bahnhof gelangen. Es wäre, glaube ich, vernünftiger, sich für eine Unterkunft in der Stadt selbst zu entscheiden?
Das muss nicht heute festgelegt werden, ich geb’s nur zu bedenken. Wenn Ihr Euch für die Stadt entscheidet, dann kümmere ich mich um die Unterbringung.
An den Freund in Köln,
das mit dem TV soll offensichtlich eine Leidensgeschichte werden. Mir unbegreiflich: In Italien, im TV-Land schlechthin, sind sie nicht in der Lage, mir ein paar lächerliche Sender zuverlässig zu installieren.
Ich kann nun zwar – ohne Witz – 1200 Sender empfangen (davon zwei Drittel nur, wenn ich extra dafür bezahle, die anderen frei). Viele arabische, zum Beispiel alle drei Al-Dschasira. Endlich werde ich anständig informiert über das Geschehen dort unten. (In dem Zusammenhang habe ich übrigens gestern einen behutsamen Artikel über das Massaker in Syrien gelesen, das Dich vor etwa vierzehn Tagen zum endgültigen Todesurteil für Assad gebracht hat: Die FAZ