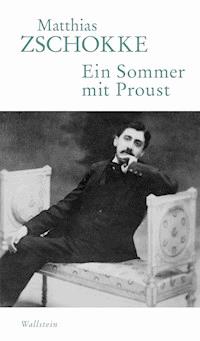Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wie kein Zweiter kann Matthias Zschokke hinter dem Gewöhnlichen das Unheimliche fühlbar machen - er ist ein großer Poetisierer des Alltäglichen. Matthias Zschokke stattet seine Helden nie mit Fähigkeiten aus, die nicht von dieser Welt sind, so dass man bewundernd oder neidisch zu ihnen aufsehen müsste. Im Gegenteil: Er setzt sie neben seine Leser, und er sitzt selbst neben seinen Helden und schaut ihnen in ihrem Alltag mit großem Staunen zu. Und was er dabei alles entdeckt! In seinem neuen Roman geht es um einen, der sich hinlegt, wenn er satt ist; und wenn er Hunger hat, steht er wieder auf. Gern hat er, wenn die Frau, mit der er zusammenlebt, dabei neben ihm liegt und steht. Aber die großen Schicksalsfragen bleiben ihm trotzdem nicht erspart. Er ist ein Held, dessen Mutter sterben will. Auch sein Freund hat keine rechte Lust mehr am Leben. Beide erhoffen sich, dass der Held sie aus dem Jammertal führen möge. Doch der weiß nicht, wie er das anstellen soll. Lieber geht er Kaffee trinken, schaut Hunden, Frauen und Männern beim Leben zu, was ihm manchmal gefällt, manchmal nicht, isst Käse, der ihm manchmal schmeckt, manchmal nicht, sieht nasse Schnürsenkel an Kinderschuhen und Wolkenfetzen, die hinter Möwen herjagen. Das findet er alles so interessant, dass er darüber fast seine Mutter und seinen Freund vergisst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Zschokke
Die Wolken waren großund weißund zogen da oben hin
Roman
Gestern, als der Boden noch frisch war und feucht, lebte in Berlin ein Mann, der sich – in der Hoffnung, mit diesem Namen Erfolg zu haben und glücklich zu werden – Roman nannte.
Seine greise Mutter wohnte tausend Kilometer weiter südwestlich und rief ihn mehrmals in der Woche an, an den Wochenenden fast immer, um zu fragen, wann er endlich bei ihr vorbeikomme und Schluss mache mit ihr; sie lebte nicht mehr gern. Er lachte jedes Mal mit einem kurzen, vernehmlichen Prusten und sagte, das sei nicht so einfach, wie sie sich das vorstelle.
Er hatte noch ein altes, eierschalfarbenes Telefon mit einer Wählscheibe und einem Hörer, der wie ein Knochen aussah und mit einem spiralförmigen schwarzen Kabel am Apparat hing. Auf der Abdeckung der Sprechmuschel klebten vertrocknete Speisereste, die durch den Luftausstoß bei diesem Prusten jeweils zwischen seinen Zähnen hervorspritzten. Sein vernehmliches Prusten war ihm unangenehm, so dass es ihm jedes Mal auf die Stimme schlug und er sich danach oft noch stundenlang räuspern musste, bevor er einen Satz herausbrachte. Irgendwo hatte er gelesen, räuspern helfe nichts, man müsse kräftig husten, um einen belegten Hals frei zu bekommen. Am Telefon traute er sich jedoch nicht zu husten, weil das im Ohr des Gesprächspartners wie eine kleine Explosion klingen würde.
Das Prusten hatte er sich angewöhnt, nachdem zwei seiner Bekannten eine Bemerkung von ihm – die er am Telefon gemacht hatte und die ohne seinen dazu ironisch lächelnden Gesichtsausdruck offenbar als Beleidigung aufgefasst werden konnte – missverstanden hatten, woraufhin sie den Kontakt zu ihm abbrachen. Auch als er einmal zu seiner Mutter sagte, zurzeit gehe es nicht – seine Pistole, die er zu diesem Zweck einsetzen wolle, sei leider verrostet, er müsse sie erst putzen –, trübte das die Atmosphäre zwischen ihnen. Zwar hatte er erschöpft dazu gelächelt und gemeint einen feinen Scherz gemacht zu haben, doch auch die Mutter konnte das stumme Lächeln durch die Telefonleitung hindurch naturgemäß nicht wahrnehmen und hörte nur den Satz, der ihr schroff vorkam und ihr die Sprache verschlug. Danach rief sie ein paar Tage nicht mehr an und redete nicht mehr davon, dass er sie umbringen kommen solle. Die Stille, die darauf folgte, empfand er als wohltuend. Manchmal knisterte seine Geliebte mit einer Cellophantüte – er lebte mit einer Frau zusammen, in deren Nähe er sich wohl fühlte –, oder sie blätterte die Seite in einem Magazin um oder in einem Buch, und er dachte, was für eine himmlische Ruhe, und schaute ihr glücklich beim Knistern und Blättern zu.
Außer seiner Mutter hatte Roman einen Freund, der die Lust am Leben ebenfalls verloren hatte und litaneiartig am Ende ihrer gelegentlichen Telefonate – sie wohnten fünfhundert Kilometer weit auseinander – jeweils wiederholte, er wäre tief enttäuscht, wenn Roman, nachdem er seine Mutter erschossen haben werde, auf dem Weg zurück nach Berlin bei ihm nicht Halt machen und auch ihn erschießen würde.
Und dann war da noch eine Opossumratte, die zu jener Zeit, also gestern, in einem niederösterreichischen Tierpark gehalten wurde und – obwohl noch jung an Jahren – von einem Tag auf den anderen plötzlich den Eindruck erweckte, sich altersschwach zu fühlen und ebenfalls den Tod herbeizusehnen. Man kannte ihr Gesicht in der ganzen Welt, weil sie stark schielte, was bei Opossumratten selten vorkommt, weswegen sie fotografiert und ihr Portrait in vielen, auch seriösen Tageszeitungen auf der Seite mit den vermischten Meldungen abgedruckt worden war und international für Heiterkeit gesorgt hatte.
Ihr Name war Traudel.
Kurz nachdem sie als schielendes Opossum den Gipfel ihrer Berühmtheit erklommen hatte, wurde sie von der besagten Lebensmüdigkeit gepackt. Sie legte sich auf den Bauch, schlang, was man ihr vor die Schnauze legte, lustlos in sich hinein, wurde dick und dicker und rührte sich nicht mehr vom Fleck. Die Direktion des Tierparks schaffte ein junges, hübsches Männchen an und setzte es in Traudels Käfig, in der Hoffnung, damit ihre Lebenslust neu anzuregen. Doch Traudel fauchte das junge, hübsche Männchen wütend an, sobald es sich ihr näherte: Sie lag auf ihrem dicken Bauch und fauchte. Das junge, hübsche Männchen ließ sich davon nicht beirren. Immer wieder näherte es sich in erotischer Absicht vorsichtig der schielenden Traudel. Doch die war des Lebens definitiv überdrüssig und wollte nichts mehr wissen von Liebe und Sex.
Romans Freund hatte Traudel aus der Ferne ins Herz geschlossen. Er berichtete Roman in täglichen Mails die letzten Neuigkeiten aus dem Opossumrattenkäfig, in dem zwischenzeitlich eine Kamera installiert worden war, die rund um die Uhr übers Internet weltweit zeigte, was dort vor sich ging. Am Ende jeder Mail schrieb er, ohne Zusammenhang, er wünsche sich mehr Kinderschänder auf den Straßen, und schloss dann mit dem Satz: Traudel hat recht.
Opossumrattenkäfig, murmelte Roman jeweils vor sich hin, wenn er das Wort las, und musste laut lachen. Um den Freund auf andere Gedanken zu bringen, antwortete er ihm umgehend auf jede seiner Mails und berichtete ihm dies und das aus seinem Alltag.
An den Freund,
hier ist die Hitze angekommen. Berlin trieft aus allen Poren. Überall riecht es wie in einer Lindenschnapsdestillerie. Vor meinem Bürofenster steht ein Baum, der meiner Meinung nach zwar keine Linde ist, aber ähnlich duftet; vielleicht eine Zierlinde oder eine Puszta- oder Tundralinde? Er hat winzige Blütchen, die wie Schnee zu Boden rieseln. Sein Parfüm ist betörend. Allein seinetwegen freue ich mich jeden Tag, zur Arbeit zu fahren.
Nach mehreren Wochen hatte die Direktion des niederösterreichischen Tierparks ein Einsehen und schläferte die lebensmüde Traudel ein.
Menschen ist es nicht erlaubt, lebensmüde zu werden. Sie müssen jauchzen und springen bis ans Ende ihrer Tage, auch wenn das Jauchzen in Wahrheit ein Winseln ist und das Springen eins auf glühenden Kohlen.
An den Freund,
Traudel ruhe in Frieden.
Gestern war es hier mindestens fünfunddreißig Grad warm und hat zwischendurch leicht getröpfelt; die Luftfeuchtigkeit wird hundert Prozent betragen haben. Abends habe ich ein Tomahawk-Steak gegessen und viel Rotwein dazu getrunken. Da es in Berlin ja leider auch nachts nicht abkühlt (das hänge mit dem Binnenklima zusammen), lag ich danach mit schwerem Magen im Bett und konnte kein Auge zutun. Pitschnass lag ich da und bin es jetzt – es ist sechs Uhr früh – immer noch. Zwischendurch werde ich dann wohl doch kurz eingenickt sein und träumte, mit einem Mann in einem Lokal gesessen zu haben, den ich irgendwann wütend anschrie, er solle sich endlich ein Hörgerät anschaffen, worauf der Mann – ich weiß nicht, wer er war, seine Züge waren mir fremd – einen verblüffenden Anfall bekam, wie ein exotisches Tier, das man in eine Ecke getrieben hat und das panisch knurrend und geifernd vor- und zurückschnellt.
Dann und wann meldete sich bei Roman außer seiner Mutter und seinem Freund auch noch eine alte Tante aus Amerika. Sie lebte schon lange dort und hatte sich angewöhnt, ihm Ansichtskarten zu schreiben, auf denen einzelne Sätze in nicht mehr ganz korrektem Deutsch standen, Sätze wie: »Sitze öfters da und schaue blödsinnigerweise in die Gegend herum« oder »Ein Frühling macht noch keinen Sommer« oder »Was sind das für Luders, die mir so etwas nicht acceptieren?! Ich werde noch verrückt oder bin’s schon.« Meistens waren es schwarz-weiße Aufnahmen des in Marmor gehauenen Abraham Lincoln, die sie ihm schickte. Von denen besaß sie offenbar eine ganze Schachtel voll. Hintendrauf war in kursiver Schrift eine Passage aus seiner Gettysburg-Rede abgedruckt, von der sie jedes Mal mit zwei Ausrufezeichen, einem links und einem rechts, die Stelle markierte: »… Die Welt wird wenig Notiz davon nehmen noch sich lange an das erinnern, was wir hier sagen …«
Auch ihr antwortete er jedes Mal postwendend und erzählte, was er gerade tat.
An seine Tante in Amerika,
heute war ein schöner Tag. Die Sonne hat geschienen. Am Morgen, als ich auf dem Fahrrad ins Büro fuhr, waren die Straßen leer. Kaum ein Auto unterwegs. Ich überfuhr sieben (!) rote Ampeln, ohne abzubremsen, nur einen flüchtigen Blick nach links und einen nach rechts werfend, souverän und frei wie ein sibirischer Tiger. An der letzten Kreuzung kam von links, vollkommen unerwartet, dann doch ein Auto, so ein dummes, kleines, rotes, das kein Mensch sehen kann und vor dem sich nicht einmal eine Maus fürchten würde. Es wollte mich erwischen. Mit einem kräftigen (zugegebenermaßen verschreckten, nicht richtig tigermäßigen) Antritt vorwärts entkam ich ihm. Es fuhr hinter mir durch und fiepte aufgeregt (ich nehme an, das war seine Hupe).
Jeden Morgen stieg er um sechs aus seinem Bett und freute sich darauf, seine Taschenuhr aufzuziehen, die seit Jahren Tag für Tag dreiundvierzig Sekunden hinter der Zeit herging. Was für ein zuverlässiges Wunderding, dachte er jedes Mal, wenn er sie richtig stellte, was für eine Treue!
Die Luft, die die Stadt füllte, blieb dick, feucht und warm. Wenn ein Wind sich regte, schob er die Brühe vor sich her, wie eine Teigrührmaschine – es änderte sich nichts dadurch, der Wind brachte keine Kühlung. Roman steckte mittendrin in der Suppe, egal, ob sie umgerührt wurde oder stillstand, er fühlte sich langsam mürbe werden wie Fleisch, das bei niedriger Temperatur gegart wird. Er wusste keinen Ausweg, sehnte sich aus dem Topf hinaus, in den hohen Norden, suchte alte Museen auf, wo er sich in den kühlen Sälen anschaute, was andere stehen und liegen gelassen hatten, Zeug im Schummerlicht, bei geöffneten Fenstern.
Die Nächte verbrachte er in halbwachem Zustand und voller Sorgen. Gelang es ihm endlich, einzuschlafen, schreckte er auch schon wieder hoch, entsetzt von der Sinnlosigkeit seiner Tage. Sah er die leuchtenden Zeiger seines batteriebetriebenen Weckers auf sechs stehen, erhob er sich, tappte vom Schlaf- ins Badezimmer, wo er am Handwaschbecken den Kaltwasserhahn aufdrehte, sich niederbeugte, aus seinen beiden Händen eine Schale formte, sie volllaufen ließ und sich das Wasser ins Gesicht klatschte. Das wiederholte er jeweils zwei, drei Mal. Dann spülte er den Mund aus, trank einen Schluck, drehte den Wasserhahn zu, richtete sich ächzend auf, rieb sein Gesicht trocken, setzte sich aufs Klo … Den weiteren Ablauf wie auch die Mühsal des Anziehens wollen wir überspringen, weil wir Roman sonst schon morgens um sechs verzweifeln und unverrichteter Dinge zurück ins Bett wanken lassen müssten. Was für traurige Unterhosen, in die er stieg, was für eine traurige Hose, die ihm zu eng war, weswegen er den Bundknopf und den Reißverschluss offen stehen ließ, was zur Folge hatte, dass die Hose schon nach zwei Schritten zu rutschen begann, weswegen er mit gespreizten Beinen weiterging, um sie auf diese Weise daran zu hindern, unter die Knie zu geraten, wo sie ihn unweigerlich zu Fall gebracht hätte, benommen wie er war von der Marter der ungezählten durchwachten Nächte.
An seine Mutter,
man soll sich nicht immer selbst beschimpfen. Das ist eine schlechte Angewohnheit übler Sekten: die Selbstgeißelung. Versuche, Freude zu haben an und zufrieden zu sein mit Dir, damit ist der Welt mehr gedient.
An den Freund,
Ein anderer Freund, einer, der ihm vor einiger Zeit abhandengekommen war … Den Grund dafür hatte Roman vergessen. Die zwei, drei Bekannten, die er hatte, munkelten etwas von einer Redewendung, die der Freund sich angewöhnt habe refrainartig einzusetzen und die Roman von einem Tag auf den anderen plötzlich nicht mehr habe vertragen können. Und zwar habe er sich angewöhnt zu sagen … (Das Phänomen, dass er nicht ausdrücken konnte, was ihn an anderen störte, war eins, das Roman seit langem umtrieb. Er dachte dann immer darüber nach, dass er wohl ähnliche Aversionen in den anderen auslöste wie die in ihm. Und da ihn im Grunde genommen alle störten, musste er davon ausgehen, dass auch er alle störte. Das erschütterte ihn: Er löste in allen Aversionen aus? Er?! In solchen Momenten hätte er natürlich gern erfahren, welche Art von Aversion es war, die er auslöste, und ob und wie er das ändern könnte. Dann überlegte er: Mein Bekannter A zum Beispiel ist unerträglich besserwisserisch. Würde ich ihm das eines Tages sagen und ihm erklären, dass er sich zu einem unangenehmen Besserwisser entwickelt habe und davon ablassen solle, dann weiß ich, dass er mit dieser Aussage nichts anfangen könnte und mir vielleicht an den Kopf werfen würde, mein Halbwissen gehe umgekehrt ihm zunehmend auf die Nerven. Dann würde ich überlegen, was genau es ist, das mich an As Besserwisserei stört – und gäbe es auf, darüber nachzudenken, weil ich feststellen würde, dass ich es nicht benennen kann.)
An seine Tante in Amerika,
eigenartig, dass man sich je älter man wird desto mehr über sich selbst ärgert. Man könnte doch irgendwann Frieden schließen mit sich und akzeptieren, dass man ist, wie man ist? Aber nein, man registriert von Tag zu Tag mehr Fehler an sich, und am Ende kann man sich überhaupt nicht mehr ausstehen. Dabei sind wir doch sowieso alle, jeder auf seine Art, verkorkst und schief und krumm. Nur die wenigsten schaffen es, eine einigermaßen aufrechte und in sich ruhende Haltung für sich zu finden. Fang jetzt nicht auch noch damit an, Dich nicht zu mögen. Es ist schon ohne das schwierig genug, seinen Alltag zu meistern. Man kann nur jedem wünschen, borniert genug zu sein, sich selbst für erträglich zu halten. Das ist eine Kunst, die wir üben müssen: es mit uns selbst auszuhalten und nicht bitter zu werden und nicht wütend über uns. Mir fällt das von Tag zu Tag schwerer. Immer neue Situationen entdecke ich, in denen ich mich unmöglich verhalte. Bald mag ich mich überhaupt keiner Situation mehr aussetzen, weil ich fürchte, mich sonst bloß wieder blödsinnig aufzuführen.
An den Namen des Freundes, der ihm abhandengekommen war, konnte er sich ebenso wenig erinnern wie an den Grund ihres Zerwürfnisses. Sie hatten immer nur du zueinander gesagt.
Bloß wenn er ihn seinen Bekannten gegenüber erwähnte, verwendete er einen Namen; er nannte ihn dann Stoffelmeier.
Im Fernsehen lief lange Zeit eine amerikanische Serie mit einem aus dem Polizeidienst entlassenen Inspektor, der panische Angst hatte vor jeglichem Hautkontakt und jeglicher auch noch so kleinen Unordnung im Alltag. Ein zauberhafter Mann, von dem Roman gar nicht genug bekommen konnte. Er schaute jede Folge an, auch jede Wiederholung, viele Folgen also sogar zwei- oder dreimal hintereinander, nur um diesem kontaktscheuen, ordnungsfanatischen freigestellten Inspektor, in den er sich richtiggehend verliebt hatte, bei seinem Tun zuschauen zu können. Der Inspektor arbeitete, nachdem er entlassen worden war, als Privatdetektiv weiter für seinen ehemaligen Vorgesetzten, der ein nicht weniger eigenartiger Mann war und Roman fast ebenso sehr begeisterte. Den Namen des Vorgesetzten konnte er nie richtig verstehen – die Serie lief in deutscher Synchronisation und war da und dort leicht vernuschelt. Manchmal meinte er allerdings, den Schauspieler dabei ertappt zu haben, wie er sich als Hauptkommissar oder Käpt’n Stoffelmeier vorstellte – seine Geliebte beharrte darauf, er habe gesagt Stoddelmeier –, so oder so ein Name, der Roman jedes Mal zum Lachen brachte, weil er im kalifornischen Umfeld, in dem die Serie spielte, so abenteuerlich schief klang.
Um seinen abhandengekommenen Freund nicht mit jenem zu verwechseln, der darauf wartete, von Roman erschossen zu werden, nannte er ihn seinen Bekannten gegenüber – weil er ihn entfernt an den Darsteller des Hauptkommissars in der Serie erinnerte – Stoffelmeier, wozu seine Geliebte jeweils kaum merklich den Kopf schüttelte.
Die Redewendung, um die es gegangen war, soll »Verstehst du, was ich meine« gewesen sein. Das habe sich Stoffelmeier angewöhnt, nach jedem zweiten Satz zu sagen. Vielleicht war er eine Zeitlang in Amerika – möglicherweise sogar in Kalifornien – gewesen. Dieses You know what I mean löste in Roman jedenfalls von einem Tag auf den anderen einen derartig starken Widerwillen aus, dass er Stoffelmeier erklärte – nachdem sie dreißig Jahre lang in bestem Einvernehmen miteinander umgegangen waren –, er habe nicht mehr genug Energie, um sich ein weiteres Mal mit ihm zu treffen.
Zum Geburtstag, ein paar Monate nach ihrer letzten Begegnung, schrieb ihm Stoffelmeier einen Brief. Anzunehmen ist, dass er ihn darin fragte, ob er sein inneres Gleichgewicht inzwischen wiedergefunden habe, ob er, anders gesagt, »aus seiner inneren Emigration zurückgekehrt« und der aus heiterem Himmel in ihn gefahrene Zorn verraucht sei, ob er sich mit ihm wieder vertragen wolle, ob man sich wieder einmal zu einem Bier treffen könne und dass er ihm von ganzem Herzen zu seinem Geburtstag gratuliere, wobei er, wie er eben erst realisiere, gar nicht wisse, wie alt er in diesem Jahr werde, da sie, soweit er sich entsinnen könne, nie davon gesprochen hätten, wann sie geboren worden seien, er werde bestimmt bald sechzig oder sogar schon siebzig?, ob es ihm auch so ergehe, dass er für sein eigenes Alter längst kein Empfinden mehr habe?, ob er sich auch immer noch nicht richtig erwachsen fühle, obwohl er vielleicht auch schon lauter dritte Zähne im Mund trage usw.
Den Brief öffnete Roman nicht. Er legte ihn neben seiner Eingangstür auf ein dort festgeschraubtes Schränkchen und vergaß ihn. Erst ein halbes Jahr später fiel ihm das Couvert wieder in die Hände – er räumte auf und putzte die Wohnung, weil er von den städtischen Elektrizitätsbetrieben einen Brief bekommen hatte, in dem ihm angekündigt wurde, dass sein Stromzähler ausgetauscht werden müsse; er möge bitte am zweiundzwanzigsten zwischen zehn und zwölf Uhr zu Hause sein und den Monteur hereinlassen. Aus Furcht davor, dass die Wohnung auf den Monteur einen verwahrlosten Eindruck machen könnte, ging er mit einem leeren Abfallsack durch die Zimmer und warf alles in ihn hinein, wovon er sich nicht erklären konnte, wozu es zu gebrauchen sein sollte. Den aus der Vergangenheit aufgetauchten Geburtstagsbrief schaute er eine Weile an und versuchte, die von Hand geschriebene Adresse jemandem zuzuordnen, den er kannte. Niemand fiel ihm ein. Er öffnete den Brief, las ihn, doch was da stand, löste keinerlei Empfindungen in ihm aus. Also warf er auch ihn in den Abfallsack.
Stoffelmeier hatte vor vielen Jahren einmal die Hose nicht hochgezogen, nachdem er spätabends nach Hause gekommen war. Er hatte das Jackett und die Schuhe ausgezogen, war direkt ins Badezimmer gegangen und hatte sich dort erschöpft auf die Toilettenschüssel gesetzt, über den Abend nachsinnend, der hinter ihm lag und der ihm, wie so viele vorausgegangene auch schon, vollkommen vergeudet vorgekommen war. Er wollte nur noch ins Bett sinken und alles vergessen, weswegen er die Hose unten ließ, die er ja sowieso gleich auf den Stuhl im Schlafzimmer legen würde. Er hoppelte mit dem Hosenwulst an den Knöcheln zum Handwaschbecken, um dort die Zähne zu putzen. Dabei stolperte er und fiel unglücklich auf den Badewannenrand, was zur Folge hatte, dass drei seiner Rippen brachen. Wie er Roman später erzählte, seien die Schmerzen, die die gebrochenen Rippen verursacht hätten, schier nicht auszuhalten gewesen. Halb ohnmächtig sei er zum Sessel neben dem Telefon gekrochen, an den er sich gelehnt habe, um dort unter Qualen das Morgengrauen abzuwarten und endlich seinen Hausarzt anrufen zu können – er war altmodisch und dachte, wegen eines solch läppischen Ungeschicks müsse man nicht gleich die ganze hochgerüstete Notfalldienstmaschinerie anwerfen. Um neun endlich habe er den Arzt erreicht. Der sei umgehend gekommen, habe sich von der Hauswartsfrau seinen Wohnungsschlüssel geben lassen, ihn gekrümmt an den Sessel gelehnt auf dem Boden liegen sehen, gebrochene Rippen diagnostiziert und eine Ambulanz angerufen, um ihn in eine Klinik bringen zu lassen.
In Erinnerung an Stoffelmeiers Missgeschick ging Roman seither immer mit weit auseinandergespreizten Beinen, die Hose auf diese Weise oberhalb der Knie am Rutschen hindernd, morgens kurz nach sechs zu seinem Schreibtisch, um dort die über Nacht eingegangene E-Mail zu beantworten, die ihm der andere Freund regelmäßig schrieb, derjenige, der hoffte, von ihm erschossen zu werden.
Er war der letzte, der ihm verblieben war. Ihn hatte Roman sogar einmal bei sich in der Wohnung zu einem Besuch empfangen. Als Erstes trat er damals auf den Balkon, der zur Straße hinausführte, schätzte die Distanz bis zum Boden ein und sagte, guter Selbstmordbalkon.
Sein Name? Nachdem er im Fernsehen als Jugendlicher einen Dokumentarfilm über Bernhardinerhunde gesehen hatte, wünschte er sich, von seinen Freunden Barry genannt zu werden wie der gutmütig tapsige Schweizer Lawinenretterhund mit dem Schnapsfässchen unterm Hals, von dem er glaubte, er habe wesensmäßig eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm. Roman brachte diesen Namen jedoch nicht über die Lippen, weswegen sie sich auf B. einigten.
Vor lauter Lebensüberdruss ging B. abends oft gar nicht mehr erst ins Bett, sondern schaute, Weißwein trinkend, finster vor sich hin, bis der Morgen graute und er die paar grimmigen Gedanken, die er in der Nacht gewälzt hatte, zu formulieren in der Lage war, sie in Worte fasste und mit einem abschließenden »Traudel hatte recht« an Roman sandte.
Dass Roman sich morgens nur mühsam erheben konnte, lag – so vermutete er – an seinem Bett. Das hatte ihm vor ein paar Jahren ein auf bioökologische Betten spezialisierter Möbelhändler aufgeschwätzt. Roman war in der Überzeugung erzogen worden, ein Mann müsse auf einer harten Unterlage schlafen. Die Schlafforschung hatte jedoch Fortschritte gemacht und tendierte inzwischen zur These, dass jeder Mensch anders konstituiert sei und man nichts verallgemeinern dürfe. Nach intensiver Befragung stufte der Bettenhändler Roman als Weichschläfer ein und empfahl ihm eine antibakterielle Latexmatratze, die auf einem Fundament aus einzelnen, freistehenden Birkenholzstempelchen ruhte. Diese Stempelchen oder Säulchen waren auf dicken schwarzen Gummischeiben befestigt, welche ihrerseits auf einem Lattenrost fixiert waren. Das Liegen auf dem Bett vermittelte etwas wabernd Unheimliches und weckte in Roman Erinnerungen an einen schottischen Kriminalroman, in dem ein Hochmoor eine zentrale Rolle spielte, das die gesuchte Leiche viel zu spät erst freigab, so dass der Mörder ungeschoren davonkam und bis zum Ende des Romans immer höhnisch triumphierte. Überall gab die Unterlage sanft nach, alles schwankte, nirgends war ein Grund oder ein Rand zu spüren, kein sicheres Ufer, an das man sich retten konnte. Romans Körper wird sich im Schlaf wohl versteift haben aus Angst, sonst unterzugehen und zu ertrinken. Am Morgen waren seine Rücken- und Lendenmuskeln jedenfalls regelmäßig hart und verspannt, als hätte er am Abend davor zu viele ungewohnte Turnübungen gemacht.
Die Hose ließ er offen stehen, weil sie ihn beim Sitzen vor seinem Computer sonst unangenehm eingeengt hätte. Er hatte sich angewöhnt, B., der darauf wartete, von ihm umgebracht zu werden, in allen Dingen, die er ihm schrieb, zu widersprechen, in der Hoffnung, ihn damit in Aufruhr zu versetzen und von seinen düsteren Gedanken abzulenken. Meistens waren es tagesaktuelle Fragen, die er in seinen Antwortmails aufgriff und zu denen er Stellung bezog, wobei er Meinungen vertrat, die denen jeglicher Stammtische diametral entgegengesetzt waren. Zum einen, weil er die Erfahrung gemacht hatte, dass er mit solchen Antithesen den wirtschaftlichen oder politischen Hintergründen des Weltgeschehens – wie sich später jeweils herausstellte – oft sehr viel näher kam als das Gros der Leitartikler. Zum anderen, weil B. sich zwar von Stammtischen seit jeher fernhielt, aber deren Meinungen, die sich auf verschlungenen Internetpfaden trotzdem Zugang zu seinem Denken verschaffen konnten, jeweils vorbehaltlos zu seinen eigenen machte und deswegen mit großer Wahrscheinlichkeit empört aufjaulen würde, wenn er las, was Roman ihm schrieb, um dann den ganzen Tag und die halbe Nacht schwitzend vor seinem Computer zu sitzen und besessen nach Argumenten und Formulierungen zu suchen, mit denen er Roman von seinen falschen Ansichten abbringen und für die Parolen des virtuellen Stammtischs gewinnen wollte. Vor lauter Empörung verwechselte B. dann manchmal die Worte, und er hob beispielsweise an mit einem »um Deine einmal mehr total fehlgeleitete Sicht der Dinge geradezurücken und den Knick in Deiner Optik zu begradigen, muss ich gar nicht erst lange nach Worten finden«.
Das Verblüffende an seinen eigenen morgendlichen Mails war für Roman die Entdeckung, dass er darin – indem er prinzipiell in die entgegengesetzte Richtung dachte – oft ganz einfache, evidente wirtschaftspolitische Zusammenhänge, Absichten und Lügen freizulegen vermochte, die ihm ohne das sich selbst auferlegte Gegen-den-Strom-Denken niemals in den Sinn gekommen wären.
Die Fähigkeit einzuschlafen war ihm nach und nach abhandengekommen. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er sich zum ersten Mal übernächtigt gefühlt hatte. Inzwischen war er von morgens bis abends müde und nickte überall, wo es irgendwie möglich war, ein. Doch immer nur für einen Augenblick. Sekundenschlaf. Dann wachte er auf, ohne sich erholt zu fühlen. Er konnte sein Denken nicht abschalten. Er dachte vor dem Einschlafen nach und auch im Schlaf. Sein Denken war ein Wehklagen, das ihn immer wieder aufweckte. Er legte sich hin, dachte nach über dies oder jenes, döste ein und landete im Zweifel. Egal, worüber er nachdachte, er endete immer im Zweifel und von da auf direktem Weg in der Verzweiflung, die ihn aufschrecken ließ. Er wälzte sich hin, wälzte sich her. Man hatte ihm geraten, wenn er nicht einschlafen könne, solle er aufstehen, sich auf die Toilettenschüssel setzen, urinieren, dann ein Glas zimmerwarmes Wasser trinken und sich wieder hinlegen. Er stand also um zwei auf, um drei, tat, was man ihm empfohlen hatte, legte sich wieder hin, lag wach, dachte nach, geriet in Zweifel, ächzte. Er konnte seine Muskeln nicht lösen. Sein ganzer Körper verhärtete sich. Zweifeln ist körperlich schwere Arbeit. Er schnaufte vernehmlich im Bett. Manchmal gab er seine Suche nach Schlaf auf, erhob sich, setzte sich an den Schreibtisch, um seiner Mutter, dem Freund B. oder seiner Tante in Amerika etwas aus seinem Leben zu berichten und ihnen auf diese Weise ihre Zeit zu vertreiben. Sein ganzer Körper war dabei verspannt. Er stöhnte. Die Vögel begannen zu singen. Die Sonne stieg am Horizont empor. Der Körper wurde weicher. Er war müde. Der Kopf sank ihm auf die Brust. Zweifel ließen ihn emporschrecken. Er kehrte zurück ins Bett oder setzte sich auf seinen Sessel, mit einem Buch in der Hand, nickte ein, schreckte hoch und so weiter, bis es endlich sechs war und er ins Badezimmer gehen konnte, wo er am Handwaschbecken den Kaltwasserhahn aufdrehte, sich niederbeugte, aus seinen beiden Händen eine Schale formte …
An seine Mutter,
es heißt, im Alter werde man geduldiger, nachsichtiger, gütiger. Doch ich merke es an mir selbst: Das Gegenteil ist der Fall. Ich werde immer ungeduldiger und brause wegen jedem Blödsinn gleich auf (je älter, desto schneller sogar; wahrscheinlich ende ich als Choleriker, mit einem zornroten Kopf, an einer vor Wut geplatzten Ader im Hirn).
Offenbar ist es einfach kein Honigschlecken, alt zu werden.
Reib Deine Beine ein. Die Flasche mit der Lotion habe ich losgeschickt. Zieh die Kompressionsstrümpfe an. Probier es wenigstens ein paar Tage lang mit ihnen, bevor Du Dich gegen sie entscheidest.
An B.,
dass Deine Bekannten von ihren Erfolgen erzählen, musst Du ihnen nachsehen. Was sollen sie sonst reden? Das ist doch immer das Problem: Was soll man einander erzählen? Grundsätzlich. Darunter leide ich immer und überall. Das Wetter ist schnell durch, Ferienberichte langweilen, Kinder, Haustiere …? Politik ist heikel – und schon ist Schluss. Manchmal suche ich in der Panik vor so einem Treffen nach irgendwelchen Geschichten, die ich dann – wenn ich meine, die Langeweile in den Augen des Gegenübers besonders tief und schwarz zu gähnen anfangen zu sehen (dieser zu gähnen anfangen zu sehen