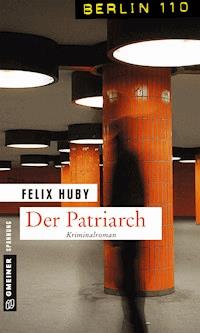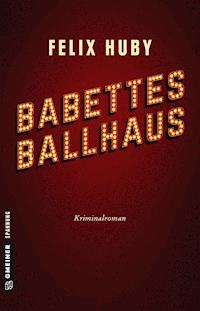8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Peter Heiland ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Peter Heiland ist Anfang 30, alleinstehend und geht auf Anraten seines früheren Chefs, Hauptkommissar Ernst Bienzle, von Stuttgart nach Berlin, damit er nicht zum "verhockten" Schwaben wird, der nichts kennt außer dem Ländle. Sein erster Berliner Fall konfrontiert Heiland mit einem Serienmörder: dem Berliner Heckenschützen. Was bringt den Täter dazu, Menschen, zwischen denen es keine Verbindung zu geben scheint, wahllos und aus dem Hinterhalt wie Wild zu erlegen? Peter Heiland findet Verknüpfungspunkte: Eine Spur führt ihn in seinen schwäbischen Heimatort zurück. Es erweist sich, dass der Polizist und der Heckenschütze sich kennen müssen – das kann ein Vorteil sein, doch für wen? Plötzlich bekommt der Fall eine unerwartete persönliche Brisanz für den schwäbischen Fahnder in Berlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Ähnliche
Felix Huby
Der Heckenschütze
Krimi
FISCHER E-Books
Inhalt
Der U-Bahnhof zog sich von der einen nachtschwarzen Öffnung zur anderen lang hin. Mindestens zweihundert Meter, schätzte Peter Heiland. Ein diffuses gelbes Licht erhellte diesen Teil des unterirdischen Röhrensystems. Er war gleich neben der Treppe stehen geblieben, die von der südlichen Seite herunterführte, und wartete auf die letzte Bahn dieser Nacht. Bei ihm zu Hause nannte man so einen Zug den Lumpensammler. Der fuhr allerdings schon um 22 Uhr ab Tübingen und war zwanzig Minuten später in Mössingen, wo Peter Heilands Fahrrad auf ihn wartete. Als er daran dachte, spürte er einen kleinen Stich in der Herzgegend.
Ganz am anderen Ende stand eine schmale Gestalt, die mit drei Bällen jonglierte und dazu eine Melodie pfiff, die Peter Heiland noch nie gehört hatte, die ihn aber seltsam anzog. Langsam ging er auf die Gestalt zu. Jetzt, da sie sich, immer weiter die Bälle hochwerfend und wieder auffangend, ein wenig zur Seite unter eine Lampe bewegte, erkannte er, dass es ein Schwarzer war. Auf dem Kopf trug er eine bunte gestrickte Mütze. Die Bälle waren ebenfalls bunt. Die Melodie, die der Schwarze pfiff, schien für sein Jonglieren komponiert worden zu sein.
Plötzlich wurde sie rüde überschrien. Die hart und rhythmisch gebrüllten Wörter kamen aus einem Ghettoblaster, den ein junger Mann auf der Schulter trug. Mit ihm kamen zwei weitere junge Männer die Treppe herunter. Unwillkürlich schaute Peter Heiland auf die Uhr über dem Aufgang zur Straße. Es war zwanzig Minuten nach Mitternacht.
Der Schwarze fing den letzten Ball auf und steckte ihn zu den beiden anderen in einen formlosen Rucksack, der an einem Riemen über seiner rechten Schulter hing.
Die jungen Männer umringten den Farbigen. Der Ghettoblaster stand jetzt auf einer Bank aus Gitterstahl und plärrte weiter durch den U-Bahnhof. Peter Heiland verstand unter der stampfenden dröhnenden Musik nur Wortfetzen. »Nur Dreck« und »Raus, raus aus unserem Land«. Die jungen Männer trugen Jeans und Lederjacken, dazu hohe Schnürstiefel, und sie hatten ihre Köpfe kahl geschoren.
Einer von ihnen trat hinter den Schwarzen. »Du willst doch lieber laufen, Nigger«, sagte er und stieß ihn so heftig in den Rücken, dass der Junge bis zur Bahnsteigkante torkelte und nur mühsam das Gleichgewicht wieder fand. »Bitte!«, sagte der Schwarze leise. Ein anderer riss ihm den Rucksack von der Schulter und kickte ihn – wie ein Fußballtorwart den Ball beim Abschlag – über die Gleise hinweg auf den gegenüberliegenden Bahnsteig.
Peter Heiland ging auf die Gruppe zu. Den Kopf hatte er, wie man es oft bei langen Menschen beobachten kann, ein wenig zwischen die Schultern gezogen. Heiland war fast zwei Meter groß.
Die drei Kerle schienen jetzt mit dem Schwarzen Ball zu spielen. Sie stießen ihn einander zu, fingen ihn kurz auf, um ihn sofort wieder mit einem heftigen, ruckartigen Stoß einem ihrer Kumpane zuzuwerfen. Sie sprachen nicht dabei. Sie lachten nur.
Peter Heiland hörte sich sagen: »Würden Sie das, bitte, unterlassen?« Sie schienen ihn nicht wahrzunehmen. Heiland drückte den Stopp-Knopf an dem Ghettoblaster. Die Jungen hielten inne. Es war, als ob man einen Film angehalten hätte. Dann wandten sie sich in einer synchronen Drehung Peter Heiland zu. Der Schwarze duckte sich in einer katzenhaften Bewegung weg. Peter Heiland sah aus den Augenwinkeln, wie er die Treppe hinaufhastete.
»Was bist denn du für einer?« Der Anführer des Trios starrte Peter Heiland an. Er musste zu ihm aufschauen, und unwillkürlich reckte sich Heiland und wirkte dadurch noch ein wenig größer.
»Der hat euch doch nichts getan!«, sagte Heiland.
»Hör ma, schon dass es den gibt, ist ’ne Beleidigung.«
»Jetzt ist er ja weg!« Peter Heiland wendete sich ab und ging davon. Plötzlich ein schneidender Schmerz zwischen Halsansatz und Schulter. Etwas Hartes hatte ihn getroffen, wickelte sich um seine rechte Schulter und seinen rechten Oberarm und biss ihn tief ins Fleisch. Heiland fuhr herum und schaute in drei grinsende Gesichter. Die jungen Männer hatten metallisch blinkende Ketten in ihren Händen.
»Wenn wir mit dir fertig sind, erkennt dich deine Mama nicht wieder«, sagte ihr Anführer, und es war ihm anzusehen, wie er jede Silbe dieses Satzes genoss.
Auf dem anderen Bahnsteig hinter dem Gleis erschien der Schwarze. Er hob seinen Rucksack auf, schrie »Wichser«, streckte den rechten Mittelfinger in die Höhe und schlug hart mit der flachen linken Hand in die Armbeuge seines rechten Arms.
»Auf geht’s, Männer!«, hörte Peter Heiland den Anführer sagen. Vom anderen Bahnsteig schrie der Schwarze: »Faschos! Nazis!«
Die Ketten gaben ein singendes Geräusch von sich, das immer heller und höher klang, je schneller sie rotierten. Peter Heiland wich einen Schritt zurück. Der Anführer holte aus. Heiland zog seine Dienstwaffe unter der Jacke hervor und richtete sie auf den Mann, der im nächsten Augenblick zuschlagen wollte. Der hielt in der Bewegung plötzlich inne. Die Kette schlug gegen seinen Rücken und pendelte dann aus.
Vom Tunnel her hörte man die Tröte der Bahn.
»Ich bin Polizist«, sagte Peter Heiland. »Verschwindet!«
Der Zug hielt an. Eine Tür öffnete sich zischend. Die drei verschwanden in dem Wagen. Eine Frau und ein Mann, die Hand in Hand ausstiegen, starrten Peter Heiland an und machten, dass sie davonkamen.
Das Warnsignal der Wagentüren ertönte. Eine Terz, stellte Heiland fest. C und E vielleicht oder G und H. Er behielt die Waffe in der Hand, bis der Zug wieder angefahren war. Die drei hoben hinter einer wild zerkratzten Scheibe unisono die Mittelfinger in die Höhe, wie es der Schwarze zuvor schon getan hatte.
Der Gegenzug kündigte sich an. Heiland schob seine Dienstwaffe unter seine Jacke und machte sich zum Einsteigen bereit. Der Ghettoblaster stand noch immer auf der Bank. Er würde einen neuen Besitzer finden.
Im gleichen Augenblick meldete sich Heilands Handy. Kriminalrat Ron Wischnewski war dran. »Egal, wo Sie jetzt sind, Schwabe«, sagte er, »Sie kommen in die Gradestraße nach Treptow. Höhe Gebäude Nummer 116.«
Peter Heiland stieg in die U-Bahn und fragte den ersten Fahrgast, den er sah: »Wissen Sie, wo die Gradestraße ist und wie ich da hinkomme?«
»Mann, hat das gedauert«, herrschte Kriminalrat Wischnewski Peter Heiland an.
»Ich musste zweimal umsteigen und dann noch laufen!«
»Heißt das, Sie sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen?«
»Ja.«
»Sie hätten einen Einsatzwagen der Schutzpolizei anfordern können!«
»Na, ob der schneller gewesen wäre …«
Der Kriminalrat sah den Kommissar kopfschüttelnd an. »Ist das eure schwäbische Sparsamkeit?«
Heiland grinste. »Noi, kühle Überlegung, Chef.«
Wischnewski deutete auf die Silhouette eines Menschen, der auf dem Gehsteig lag: »Wenn ich so etwas sehe, möchte ich am liebsten wieder ins Bett.«
Der Schuss musste den Mann genau in dem Moment getroffen haben, als er beim Aussteigen seinen Fuß aufs Trottoir gesetzt hatte. Das Geschoss war in die rechte Schläfe eingedrungen. Um die Stirn hatte sich auf dem körnigen Asphalt eine kleine Blutlache gebildet, die in der Hitze dieser Nacht schon fast getrocknet war.
Der Fahrer, Carsten Pohl, 37, saß auf einem Gartenmäuerchen und starrte über den Gehweg hinweg auf die offene Tür seines Omnibusses. Der Tote war sein letzter Fahrgast gewesen. Seit einer halben Stunde hatte Carsten Pohl eigentlich Feierabend. Aber daran dachte er jetzt nicht.
Wischnewski diktierte in ein Gerät von der Größe einer Streichholzschachtel: »Auffindungsort Gradestraße, Höhe Gebäude 116. Tatzeit 23 Uhr 48. Die Personalien des Toten …«, er starrte auf den Personalausweis, der auf seiner schweißnassen Hand lag. »Kevin Mossmann, geboren 23. September 1978.« Er sah auf den Toten hinunter. Vierundzwanzig Jahre. Der da war so alt wie sein eigener Sohn, von dem er seit zwei Jahren nicht wusste, wo er sich herumtrieb. Nicht mal zu Wischnewskis fünfzigstem Geburtstag im letzten Dezember war er aufgetaucht. Von Weihnachten gar nicht zu reden.
»Wieder so eine sinnlose Tat«, sagte Wischnewski und steckte das Diktiergerät in das Brusttäschchen seines kurzärmeligen Hemdes. »Diese verdammte Stadt«, Wischnewski stöhnte, »nicht mal nachts kühlt es ab.« Er sah zur Spitze einer Platane hinauf. »Und kein Windhauch!«
»Und immer, wenn wir Bereitschaftsdienst hent«, sagte Heiland im gleichen beleidigten Ton.
»Hent?«
»Haben«, verbesserte sich Peter Heiland. Er wischte sich mit einem Papiertaschentuch den Schweiß von der Stirn, knüllte es zusammen und warf es in Richtung eines Papierkorbs neben dem Wartehäuschen. Er verfehlte den Korb um gut einen Meter.
»Ihr könnt ihn wegbringen«, sagte Wischnewski zu zwei Männern, die wartend neben einem Blechsarg standen. »Bei der Hitze fängt er noch an zu stinken.«
Der Busfahrer erhob sich ächzend von dem Gartenmäuerchen. »Und was ist mit mir?«
»Hat sich der Arzt schon um Sie gekümmert?«
»Ich hab keinen Schock«, sagte Carsten Pohl.
»Einer unserer Beamten bringt Sie nach Hause! Den Bus brauchen wir noch für die Spurensicherung.« Peter Heiland reichte dem Busfahrer seine Visitenkarte. »Für alle Fälle.«
Carsten Pohl warf einen Blick auf das Kärtchen. »Heißen Sie wirklich so?«
Heiland nickte: »Scho mei ganzes Leba lang!«
»Und Sie?«
Wischnewski verstand den Wink und reichte dem Busfahrer auch seine Karte.
Carsten Pohl stieg in einen Streifenwagen, dessen Beifahrertür ein junger uniformierter Polizist für ihn aufhielt.
»Von wo er wohl geschossen hat?«, fragte Heiland.
Ron Wischnewski suchte die Straße mit den Augen ab. Die zwei Asphaltbänder zogen sich schnurgerade zwischen Fabrikgebäuden hin. In der Mitte verlief ein schmaler Grünstreifen. Selbst in der Dunkelheit war zu sehen, dass das Gras verdorrt war. Dieser Sommer brachte die Dürre sogar nach Berlin, das doch über einem Urstromtal lag. Am Mittag hatte es 37 Grad gehabt. Ein neuer Hitzerekord. Aber was bedeutete das schon, wenn viele Tage davor 36 Grad gemessen worden waren.
Ron Wischnewski stand unbeweglich auf dem Gehsteig. Seine Hände hatte er hinter dem Rücken verschränkt. Die Füße hatte er breit auseinander gestellt. Wischnewski war knapp 1,80 Meter groß und wog über zwei Zentner. Sein breites, fleischiges Gesicht erinnerte Heiland an eine Bulldogge. Die Mundwinkel hingen tief, und die Lider bedeckten seine Augen fast zur Hälfte, was Wischnewskis Gesicht einen schläfrigen und zugleich traurigen Ausdruck verlieh. Der Kriminalrat wandte Heiland jetzt den Rücken zu, als ob er fühlte, dass der ihn beobachtete. Zwischen seinen Schulterblättern breitete sich ein Schweißfleck auf dem blau karierten Hemd aus.
»Einschusswinkel?«, fragte er.
»Der Schuss muss ungefähr aus gleicher Höhe abgegeben worden sein«, antwortete sein junger Kollege.
Wischnewski hob den ausgestreckten rechten Arm in die Waagrechte, kniff das linke Auge zu und schaute mit dem rechten über seinen Zeigefinger, der auf eine Einfahrt etwa achtzig Meter die Straße hinunter deutete.
Wortlos marschierte Wischnewski los. Heiland holte aus dessen Dienstwagen einen der Suchscheinwerfer und folgte dem Chef. Einmal mehr wunderte er sich, wie so ein schwerer Mann so einen geschmeidigen, ja eleganten Gang haben konnte. Wischnewskis Arme hingen jetzt lose herunter. Die Schultern schwangen leise im Rhythmus seiner Schritte mit.
Peter Heiland war sich bewusst, dass er selbst ungelenk und staksig wirkte neben seinem fast doppelt so alten Kollegen. Normalerweise bemühte er sich, nicht daran zu denken. Aber wenn es ihm in den Sinn kam, wie er auf andere wirken musste, erfasste ihn sofort eine melancholische Stimmung. Seine Augen wurden dann noch dunkler, und seine Schultern sanken noch ein Stück mehr nach vorn. Heiland war 1,93 Meter groß. Seine Arme, so empfand er es, waren zu lang geraten. Seine Beine ebenfalls. Und er konnte essen, so viel er wollte, er nahm nicht zu.
Peter Heiland war noch keine drei Schritte gegangen, da trat er in eine weiche Masse. »Scheiße!«, entfuhr es ihm. Und er hatte Recht damit. Er versuchte seinen Schuh im dürren Gras zu reinigen, was ihm aber nur notdürftig gelang. Als er die Stimme seines Chefs hörte: »Was ist denn?«, rannte er auf ihn zu.
Wischnewski war am linken Stahlpfeiler eines Drahtgittertors stehen geblieben. Als Heiland ihn erreichte, schaltete er den Suchscheinwerfer ein und erntete dafür ein anerkennendes Nicken seines Chefs. Auf dem Gelände standen Silos verschiedener Größe. Dazwischen türmten sich Sand- und Kieshaufen. Im Halbdunkel dieser Sommernacht wirkte die Anlage, offensichtlich ein Bauhof, wie eine Landschaft von einem fremden Kontinent oder gar einem anderen Stern.
Der Asphalt in der Toreinfahrt war mit einer dicken Zementschicht bedeckt. Jetzt war der Kriminalrat froh, dass kein Windhauch ging. Die Reifenspuren konnte man in der dichten grauen Schicht deutlich erkennen. Sie zeigten, dass der Wagen rückwärts in die Einfahrt gefahren worden war bis knapp an das Tor heran. An der Kante des Gehsteigs erkannte man die Stellung der Vorderräder. Demnach war er nach rechts auf die Straße hinausgefahren, als er die Position wieder verlassen hatte. Der Fahrer musste also an dem Bus vorbeigekommen sein, nachdem er geschossen hatte – vorausgesetzt, die Reifenspuren gehörten zu dem Wagen, den der Todesschütze gefahren hatte.
Wischnewski bückte sich. Er fasste mit den Spitzen von Zeige- und Mittelfinger unter das Tor und zog eine Geschosshülse hervor. »Leuchten Sie mal!« Heiland richtete den Scheinwerfer auf Wischnewskis Hand. »Das gleiche Kaliber wie immer!«, sagte der Chef der achten Mordkommission. Er schnüffelte. Bei seiner Suchaktion war er mit der Nase nahe an Heilands Schuh gekommen. »Was riecht denn hier so?«
»Weiß nicht«, sagte Heiland.
Als Wischnewski auf der Fahrerseite des Wagens einstieg, sagte er: »Was für ein Glück, dass die Dienstwagen mit Klimaanlagen ausgerüstet sind.« Er stieß die Beifahrertür von innen auf, um auch Heiland einsteigen zu lassen.
Eine Weile sprach niemand. Schließlich nahm Wischnewski wieder das Wort: »Vier Morde in vier Monaten!« Heiland hatte keine Lust zu reden. Das Wenige, was man zu diesem Fall sagen konnte, war schon hundertmal gesagt worden. Trotzdem wiederholte Wischnewski: »Ein Verrückter, ein Einzelgänger, ein Mann, der tötet, um zu töten. Immer mit derselben Waffe.«
»Das höre ich zum ersten Mal.«
»Sie sind ja bis jetzt auch nicht damit befasst gewesen. Es ist immer ein Mauser-Jagdgewehr. Nach dem Kaliber zu schließen, eine höchst seltene Waffe, vielleicht eine Art Oldtimer. Jedenfalls handelt es sich um eine Munition, die unseren Experten bisher noch nie untergekommen ist. Offenbar ist der Täter ein Scharfschütze. Ein Sniper, wie man so jemanden in Amerika nennt.« Unvermittelt brach Wischnewski ab.
Eine ganze Zeit sprach keiner der beiden. Schließlich sagte Heiland: »Was haben Sie eigentlich gegen uns Schwaben?«
»Ich habe keine guten Erfahrungen mit ihnen gemacht«, knurrte Wischnewski.
»Haben Sie denn mal da unten gelebt?«
»Nein, aber ich bin dreizehn Jahre lang mit einer Schwäbin verheiratet gewesen.«
Heiland sah überrascht zu Wischnewski hinüber. Der Mann redete sonst nie über sich selbst. Heiland wusste nicht einmal, dass er überhaupt schon einmal verheiratet gewesen war. »Und? War das so schlimm?«
»Es war die Hölle!« Mehr sagte Wischnewski nicht. Er schwieg wieder eine Weile, bis er sagte: »Was stinkt hier eigentlich so?«
»Ich glaube, ich bin vorhin in Hundescheiße getreten.«
»Und dann steigen Sie in meinen Wagen ein?« Wischnewski stoppte. »Dort vorne kriegen Sie eine S-Bahn. Sie fahren ja sowieso lieber öffentlich!«
Der Schock kam, als der Busfahrer Carsten Pohl in seiner Küche die Tür des Kühlschranks öffnete, um eine Flasche Bier herauszuholen. Plötzlich trat ihm kalter Schweiß auf die Stirn. Pohl begann zu zittern, er bekam kaum mehr Luft und konnte die Flasche nicht festhalten. Sie zerschellte auf den Steinplatten des Küchenfußbodens. Pohl hielt sich an der Kante des Küchentischs fest und versuchte, seinen Atem zu kontrollieren.
Schlagartig stand die Szene wieder vor seinen Augen. Er sah, wie sein letzter Fahrgast sich erhob, nach vorn kam und sich an der Stange neben der Tür festhielt. »Können Sie denn jetzt auch bald Schluss machen?«, fragte er freundlich.
»Wird auch Zeit!«, antwortete Carsten Pohl und setzte den Blinker, um in die Haltebucht zu fahren.
»Na dann, schönen Feierabend«, sagte der Fahrgast. Die Tür öffnete sich. Er setzte den Fuß auf die Straße. Ein leiser Knall. Der junge Mann stöhnte auf, es klang überrascht, erstaunt vielleicht, aber er schrie nicht etwa vor Schmerz. Dann sackte er zusammen.
Carsten Pohl begriff nicht gleich, was passiert war. »Sind Sie gestolpert?« Aber da sah er das Blut. Er stemmte sich aus seinem Fahrersitz hoch und hörte im selben Moment die quietschenden Reifen eines viel zu schnell anfahrenden Autos, wendete sich um und sah den Ford Capri, der auf seinen Bus zuschoss. Unwillkürlich duckte sich Pohl. Das Auto wischte vorbei. Für einen kurzen Moment konnte Carsten Pohl schräg von hinten den Fahrer sehen. Er trug eine Trainingsjacke mit Kapuze.
Warum hatte er das den Polizisten nicht erzählt? Carsten Pohl schleppte sich ins Wohnzimmer. »Weil es mir grade erst wieder eingefallen ist!«, antwortete er sich selber laut. Dann zog er mit zitternden Fingern die Visitenkarte des Polizisten aus der Hemdentasche und wählte die Privatnummer.
Als Peter Heiland seine Wohnung betrat, klingelte das Telefon. Der Anrufbeantworter sprang an. Heiland stieß seine Slipper von den Füßen, tappte in die Küche, ließ unterm Wasserhahn ein Glas voll laufen und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Die Stimme klang angestrengt. Die Worte kamen stoßweise: »Pohl hier. Der Busfahrer. Mir ist was eingefallen … Ich … ich hab den gesehen …« Plötzlich fiel alle Müdigkeit von Heiland ab, er riss das Telefon aus der Halterung, drückte auf Übernahme und sagte: »Ich komme grade zur Tür herein. Herr Pohl …?«
»Ja«, sagte der Mann am anderen Ende der Leitung, »ich hab keine Ahnung, warum mir das jetzt erst einfällt.«
»Macht doch nichts. Besser spät als nie. Wie geht es Ihnen?«
»Nicht so doll. Dabei hab ich doch gedacht, das macht mir nichts aus.«
Heiland trank das Wasserglas in einem Zug aus.
»Sind Sie noch da?«, fragte Pohl.
»Ja, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich jetzt noch bei Ihnen vorbeikomme?«
»Nein, nein, ich kann sowieso nicht schlafen. Hartmannstraße 16 in Wedding. Hinterhaus. Carsten Pohl, aber das wissen Sie ja!«
Der Mann hatte den Capri in der Baracke unter den Birnbäumen untergestellt, das Tor verschlossen und war ins Haus gegangen. Er hatte eiskaltes Wasser in die Badewanne eingelassen und in der elektrischen Saftpresse eine halbe Kiste Zitronen ausgepresst. Den Saft goss er ins Wasser und warf die ausgepressten Schalen dazu. Dann zog er sich aus und stieg in die Wanne. Langsam schob er seinen Körper in das kalte Wasser. Dann auch den Kopf. Er hielt den Atem an und spannte nach und nach alle seine Muskeln an, so stark er vermochte. Langsam zählte er bis dreißig, löste die Spannung und tauchte wieder auf. Diese Übung wiederholte er fünfmal. Danach stieg er aus der Wanne, hüllte sich in ein weißes, waffelgemustertes Badetuch und ging in den Wohnraum hinüber. Er schaltete das Licht nicht an. Die Havel vor seinem Fenster, die hier wie ein großer stiller See wirkte, spiegelte den Mond, der fast voll war. In solchen Nächten schlief der Mann nicht.
Jedes Klingelschild neben der rissigen zweiflügligen Holztür sah anders aus. Die meisten waren von Hand geschrieben, auch das von Carsten Pohl. »Ich komme runter!«, tönte es aus der Gegensprechanlage. »Ich muss Ihnen aufschließen.« Pohls Stimme klang jetzt ausgeglichener als zuvor am Telefon.
Er führte Heiland über einen Hof, der nur spärlich beleuchtet war. Eine Katze kam zu ihnen gelaufen und miaute sie an. Heiland bückte sich und streichelte das borstige Fell.
»Ihre?«, fragte er.
»Die gehört niemand und allen«, sagte Pohl.
Seine Wohnung bestand aus einem Zimmer, einer geräumigen Küche und einem winzigen Bad, in dem sich Peter Heiland die Hände wusch, um den Katzengeruch loszuwerden. In der Küche roch es nach Bier. Pohl hatte die Scherben der Flasche weggeräumt und das Bier aufgewischt, aber der Geruch verflog nicht so schnell, obwohl das Fenster weit offen stand. Behutsam fragte der Kommissar den Busfahrer aus. Am Ende notierte er: Ford Capri, vermutlich blau, eventuell Ralleystreifen. Tiefer gelegt. Extrabreite Reifen.
»Das ist doch heute schon ein Oldtimer«, sagte Pohl, »so ein Capri.«
Heiland nickte. »Ich bin selber noch in so ei’m g’fahren. Hat einem Freund gehört. Und die Nummer? Haben Sie nicht gesehen?«
»Es ging doch alles so schnell.« Es klang, als wollte sich Pohl entschuldigen.
»Klar, aber manchmal erinnert man sich an einen Buchstaben. Haben Sie denn vielleicht das B für Berlin erkannt?«
Pohl schüttelte den Kopf. »Nicht mal das!«
Heiland gab die Details an den Kommissar vom Dienst in der Zentrale durch und bat darum, sofort die Fahndung nach dem Ford Capri einzuleiten. Pohl überredete ihn, noch ein Bier mit ihm zu trinken. Heiland willigte widerstrebend ein. Er hatte den Verdacht, dass der Mann sich davor fürchtete, allein zu sein.
»Sie haben einen spannenden Beruf«, sagte der Busfahrer, um das Gespräch am Laufen zu halten.
»Manchmal«, gab Heiland einsilbig zurück. Er redete nicht gerne über seine Arbeit. Er redete überhaupt nicht gerne. »Wahrscheinlich erleben Sie viel mehr als ich.«
Als er Pohl verließ, hatte er gut ein Dutzend Busfahrergeschichten gehört, von denen er die Hälfte schon gekannt hatte. Es war vier Uhr, als er in ein Taxi stieg.
Peter Heilands Zweizimmerwohnung lag in der Stargarder Straße so nahe an der Schönhauser Allee, dass er die U-Bahngeräusche von dort hören konnte. Die Bahn hieß U-Bahn, obwohl sie hier keine Untergrundbahn war, sondern hoch über der Straße auf einem Eisengerüst lief und eigentlich hätte Hochbahn heißen müssen. Das Wohnzimmer ging auf die Straße hinaus und hatte einen Balkon. Die Küche lag zum Hof hin, gleich daneben befand sich ein schmales Zimmer, in dem er schlief. Am Ende des Korridors lag ein kleines Bad: Dusche, Waschbecken, Klo und Waschmaschine. Trat man aus dem Badezimmer, ging der Blick zur Wohnungstür, deren Innenseite mit einem Spiegel verblendet war.
Als er jetzt nackt aus dem Bad trat, sah Peter Heiland die blutrote Quetschung auf seiner Schulter. Er drehte seinen Oberkörper so, dass sein Rücken im Spiegel erschien. Das rote Mal zog sich bis über das Schulterblatt hinab.
Peter Heiland klopfte mit den Knöcheln gegen seine spitz hervorstehenden Hüftknochen. Die Beine waren dünn und weiß und bildeten ein kaum wahrnehmbares X. Seine Schultern waren ebenso schmal und knochig wie seine Hüften und hingen leicht nach vorn. Er seufzte. Da konnte er lange hingucken. Es wurde nicht besser. ›Aber‹, dachte er, ›ich habe ein hübsches Gesicht!‹
Nackt, wie er war, setzte er sich in einen Sessel und hob die Post vom Boden auf: zwei nichts sagende Briefe und das »Schwäbische Tagblatt« von vorgestern. In der Zeitung las er gewöhnlich nur den Lokalteil. Im Goldersbachtal zwischen Bebenhausen und Dettenhausen hatte sich ein Mann auf einer Bank mit Benzin übergossen und verbrannt. Aus Liebeskummer. Welche Geschichte verbarg sich wohl hinter der kargen Meldung? Wer war die Frau, deretwegen er sich verbrannt hatte? Wenn Peter Heiland solche Geschichten aus seiner Heimat las, meinte er stets, er müsste alle Leute, um die es ging, kennen. Seitdem er in Berlin wohnte, schaute er auch in jedes Auto mit einer Württemberger Nummer und war jedes Mal enttäuscht, wenn er die Insassen nicht kannte.
Peter Heiland war jetzt ein Vierteljahr in Berlin. Er arbeitete in der Abteilung 8 der Hauptabteilung »Delikte am Menschen«. Deren Chef, Kriminalrat Ron Wischnewski, hatte ihn bislang kaum beachtet. Er behandelte ihn wie einen Azubi. In die Sonderkommission »Sniper« hatte er ihn nicht berufen. Heiland durfte allenfalls zuarbeiten. Er warf die Zeitung weg, schaute auf die Uhr und sprang aus dem Sessel hoch.
Als er auf die Stargarder Straße trat, schlug ihm die dumpfe Hitze entgegen. Seit Tagen stieg das Thermometer schon in den Morgenstunden auf annähernd 30 Grad. An solchen Tagen passierte es ihm, dass er auf dem Straßenschild »Stuttgarter Straße« statt »Stargarder Straße« las. An der Schönhauser Allee stieg er die Stufen zur U-Bahn hinauf.
Es kam nicht oft vor, dass Hanna Iglau im Büro die Erste war. Sie warf den Ventilator, den Computer und die Kaffeemaschine an und nahm die Berichte aus dem Eingangskorb. Obenauf lag der Fahndungsaufruf. »Der Mörder des Bus-Fahrgastes fährt vermutlich einen Ford Capri … Vorsicht, der Mann ist bewaffnet und ein sehr guter Schütze …«
»Woher wissen wir denn das?«, fragte sie laut in den leeren Raum. Sie sah im Computer nach und stieß auf Heilands Bericht aus der vergangenen Nacht. »Macht sich langsam, der Neue«, sagte sie, aber da niemand da war, konnte auch keiner antworten.
Hanna war seit zwei Jahren in der Abteilung. Gleich nach der Abschlussprüfung an der Fachhochschule hatte sie hier angefangen. Damals wurden noch alle Absolventen in den Berliner Polizeidienst übernommen. Dieses Jahr herrschte Haushaltssperre, und keiner der jungen Kollegen wurde eingestellt. Wer nicht in Hamburg, Hannover, Bremen oder sonstwo im westlichen Deutschland unterkam, musste sehen, wo er blieb. Ein paar Stellen gab es bei der Schutzpolizei, aber dafür waren sie überqualifiziert. Umso erstaunlicher, dass Peter Heiland hier eine Stelle bekommen hatte.
Die Tür ging auf. Der Neue kam herein.
»Na?«, sagte Hanna.
»Gibt’s schon Kaffee?«, fragte Peter Heiland.
»Ausnahmsweise«, gab Hanna Iglau zurück. Sie hatte sandfarbenes kurzes Haar und frische rote Wangen. Peter fand, dazu hätten eine niedliche Stupsnase und volle Lippen gepasst. Aber die Kollegin hatte eine schmale, gerade Nase und einen dünnen, geraden Mund, der ihrem Gesichtsausdruck etwas leicht Verkniffenes gab.
»Wir hatten heute Nacht einen Einsatz.« Peter hielt die Luft an. Seine Kollegin trug ein enges T-Shirt und einen sehr kurzen Rock.
»Ja, ich hab’s gelesen.« Hanna schenkte für beide ein.
Peter Heiland wollte rasch zur Kaffeemaschine, stieß aber mit dem Oberschenkel gegen die Ecke eines Schreibtisches. »Au, das auch noch!«, schimpfte er.
Christine Reichert kam hereingestürmt – außer Atem und schweißgebadet. »Tut mir leid …«
»Hör doch endlich auf, dich immer für alles und jedes zu entschuldigen, Christine«, sagte Hanna Iglau, »du bist just in time! Es gibt auch schon Kaffee.«
Christine Reichert war die Abteilungssekretärin, und obwohl sie darunter litt, dass sie sich für unvollkommen hielt, war sie für die Abteilung 8 absolut unentbehrlich.
Erst gegen neun Uhr am Morgen stand der Mann von seinem Stuhl auf. Er verließ das Häuschen und ging die zwanzig Schritte zum Ufer hinunter. Auf dem schmalen Steg ließ er das weiße Tuch von seinem Körper gleiten und sprang mit einem eleganten Hechtsprung ins Wasser. Seine Nachbarin, Cordelia Meinert, stand zwischen zwei Holunderbüschen. Sie hatte schon seit einer Stunde auf diesen Augenblick gewartet, und sie würde rechtzeitig zurück sein, wenn der Mann nach exakt fünfundvierzig Minuten wieder aus dem Wasser stieg.
Doch jetzt lief sie rasch über den leicht ansteigenden Rasen zu ihrer Gartentür, betrat den schmalen Zufahrtsweg und holte noch im Gehen aus ihrer Schürzentasche einen Ring mit drei Schlüsseln. Mit einem schloss sie das Gartentörchen zum Nachbargrundstück auf, mit einem zweiten den Schuppen, in dem sein Auto stand. Die Tür quietschte in den Angeln, als Cordelia Meinert sie hinter sich zuzog. Ihre Augen mussten sich an das Halbdunkel erst gewöhnen. Durch das einzige kleine Fenster, vor dem zudem noch ein dicht belaubter Birnbaum seinen Schatten warf, fiel nur wenig Licht. Sie öffnete den Kofferraum, der nicht verschlossen war. Das in eine Wolldecke gewickelte Gewehr war der einzige Gegenstand darin. Cordelia schlug die Decke zurück, holte aus ihrer Schürzentasche eine kleine Kamera und begann, das Gewehr von allen Seiten zu fotografieren.
Als sie auf ihr eigenes Grundstück zurückkehrte, brachte sie die Kamera in ihr Häuschen und holte aus der Vitrine rechts neben der Eingangstür ein Fernglas. Wieder im Garten, stieg sie eine Leiter hinauf, die an einem Apfelbaum lehnte, und suchte mit dem Feldstecher die Wasserfläche der Havel ab. Der Mann schwamm auf dem Rücken in langen gleichmäßigen Zügen auf das Ufer zu. Cordelias Herz schlug bis zum Hals, als er aus dem Wasser stieg, das weiße Tuch nur locker über die Schulter warf und auf sein kleines Haus zuging.
»Sie teilen sich ab heute das Zimmer mit Hanna Iglau«, sagte Kriminalrat Ron Wischnewski zu Hauptkommissar Heiland, noch bevor er guten Morgen gesagt hatte.
»Wird das nicht ein bisschen eng?«, fragte Hanna. Aber sie bekam keine Antwort.
Die Verwaltung hatte bereits einen zweiten Schreibtisch in den knapp zwölf Quadratmeter großen Raum schieben lassen. Die beiden Tische waren an der Breitseite gegeneinander gestellt worden und bildeten einen Block.
Hanna Iglau sah Peter Heiland an und fragte: »Wie sind Sie denn auf den Ford Capri gekommen?«
»Der Fahrer hat sich plötzlich erinnert. Kaum war ich daheim, da hat er mich angerufen …«
»Sie hätten mir Bescheid geben müssen«, sagte Wischnewski barsch.
»Werde ich deshalb aus meinem Zimmer ausquartiert, weil ich Sie nicht auch noch aus dem Schlaf gerissen habe?«, fragte Peter.
»Nein. Wir bekommen Verstärkung. Einen Psychologen.«
»Als Profiler?«
»Ja, ich glaube, man nennt die so.« Wischnewski ging hinaus und schlug die Tür hinter sich zu.
»Was hab ich ihm denn getan?«, fragte Heiland.
Hanna grinste: »Sie haben Erfolg gehabt. Ganz alleine!«
Heiland grinste zurück. Er setzte sich auf seinen neuen Platz und verschränkte die Hände im Nacken. »Der reinste Kaninchenstall.«
»Die Büros im Kanzleramt sind noch kleiner«, sagte Hanna.
»In Stuttgart hab ich vierundzwanzig Quadratmeter für mich alleine g’habt!«
»Und warum sind Sie nicht dort geblieben?«
»Gute Frage«, gab Heiland zurück, beantwortete sie aber nicht.
Ja, warum eigentlich nicht? Vielleicht war sein Chef, der Leitende Hauptkommissar Ernst Bienzle, daran schuld gewesen. Der hatte immer mal wieder räsoniert, es sei der größte Fehler seines Lebens gewesen, nie die Stadt gewechselt zu haben. »Es gibt zwei Sorten von Schwaben, die weltläufigen und die verhockten«, pflegte er zu sagen. Er selber habe stets zu den verhockten gehört und nehme sich das erst jetzt so richtig übel. Und dann hatte er zu Heiland gesagt: »Passet Se auf, dass es bei Ihne net au eines Tages zu spät ischt, wenn Sie’s merket!«
Aber das allein hätte Peter Heiland wohl kaum dazu gebracht, das Schwabenland zu verlassen.
Eigentlich gab er Ruth die Schuld. Der schönen Ruth. Einsachtzig groß, lange Beine, breite Hüften, breite Schultern, Wespentaille, schulterlange blonde Haare. Aber um die äußere Erscheinung war es ihm bei ihr nie gegangen. Seltsam, dass es doch das Erste war, was ihm einfiel, als er jetzt an sie dachte. Er hatte sich in dem Moment in sie verliebt, als sie durch die Tür des Seminarraums trat. Polizeischule Göppingen. Lehrgang für angehende Kriminalbeamte. Ruth war unter der Tür stehen geblieben, hatte sich umgeschaut und dann, wie selbstverständlich, neben Peter Heiland Platz genommen. »Ich bin die Ruth!«
Später hatte sie ihm erklärt, er sei der einzige gewesen, der halbwegs erwachsen ausgesehen habe. Kunststück. Er war der Älteste im Kurs. Seiteneinsteiger mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Vermessungstechniker. »Und außerdem«, hatte Ruth gesagt, »bist du der einzige, neben dem ich Schuhe mit richtig hohen Absätzen tragen kann.«
Zur Polizei war Peter Heiland gegangen, weil er zu den Raureitern wollte, der Motorradstaffel – benannt nach ihrem Gründer, dem ehemaligen Stuttgarter Polizeipräsidenten Rau. Peter war ein leidenschaftlicher Biker. Es gab Zeiten, da fuhr er nonstop von Stuttgart nach Madrid, nicht weil er Madrid sehen wollte, sondern weil er beweisen wollte, dass man diese Strecke auf einer Arschbacke fahren konnte. In Madrid hatte es ihm dann aber einmal so gut gefallen, dass er drei Wochen geblieben war, obwohl er nur zehn Tage Urlaub hatte. Otto Mädler, der Besitzer des Vermessungsbüros, bei dem er angestellt war, hatte freilich kein Verständnis für derartige Eskapaden. Die Kündigung erfolgte fristlos.
Vor dem Arbeitsgericht kam es zu einem schäbigen Vergleich. Und damit war dann auch die Geometerkarriere Peter Heilands abgeschlossen.
Die Karriere als Polizist sollte nicht bei den Raureitern enden. Ein Vorgesetzter entdeckte Heilands kriminalistische Talente. »Sie können so ums Eck denken, dass Ihnen Sachen auffallen, die anderen ewig verborgen bleiben«, sagte er. »So einer ist der geborene Kriminalist.«
Ruth dagegen hatte andere Talente. Ihre Berichte und Protokolle glichen kleinen Kunstwerken – außerordentlich lesbar, aber für die Ermittlungsarbeit nicht zu gebrauchen. Ernst Bienzle, der damals als Dozent an der Polizeischule lehrte, sagte: »Wenn ich Kurzgeschichten lesen will, kauf ich mir ein Buch von Hemingway oder O. Henry.« Der Hauptkommissar war es dann auch, der Ruth für die Pressestelle vorschlug. Jetzt arbeitete sie bei der »Stuttgarter Zeitung« und wohnte mit dem Lokalchef zusammen.
Peter hatte sie angeboten, ihre Beziehung müsse deshalb nicht zu Ende sein. Sie fühle sich durchaus in der Lage, zwei Männer glücklich zu machen. Das sei schließlich nur eine Frage der Organisation. Nur: Peter Heiland wäre unglücklich gewesen dabei. Und sein Organisationstalent war ziemlich unterentwickelt.
Papa Bienzle, wie sie ihren Chef in der Abteilung heimlich nannten, hatte schnell spitz gekriegt, mit welchen Problemen sich Peter Heiland herumschlug. »Sie brauchet Luftveränderung«, sagte er, »auch wenn ich Sie nicht gern verlier.« Und dann kam der kleine Vortrag über die weltläufigen und die verhockten Schwaben.
Peter Heiland hatte schon bald gespürt, dass der Leitende Hauptkommissar eine gewisse Zuneigung zu ihm gefasst hatte, auch wenn er sie nicht zeigen konnte. Aber das war Peter Heiland gewohnt. In seiner Familie waren alle so, bis auf seinen Opa Henry. Und das war dann auch die allerschwierigste Sache: Opa Henry beizubringen, dass er nach Berlin übersiedeln wollte.
»Was denn, da ’nüber in da Oschte und dann au no ganz da nauf in da Norde? Ja bischt du au no ganz bache?« Der Alte saß auf der selbst gezimmerten Bank vor dem selbst gezimmerten Tisch in seinem Obstgarten hinterm Haus – vor sich einen Krug Most und einen Trinkbecher mit einem Zinndeckel. »Die deutsche Kulturlandschaft beginnt seit Heinrich dem Fünften in Palermo und endet in Tauberbischofsheim!« Den Spruch hatte Peter schon einmal von Bienzle gehört und sagte es seinem Opa.
»Ja, dann hat er ihn ja vielleicht von mir!«
»Ihr kennet euch doch gar net!«, sagte der Enkel.
»Wer woiß, om wie viele Ecke des gange ischt!« Es wäre ja auch das erste Mal gewesen, dass Opa Henry, der eigentlich Heinrich hieß und nur von seinen elf Enkeln Henry genannt wurde, zugegeben hätte, etwas sei nicht auf seinem Mist gewachsen.
Opa Henry war der Anker der Familie. Früher war das seine Frau Marieluise gewesen, doch die war schon vor zweiundzwanzig Jahren gestorben. Peter war damals zehn Jahre alt gewesen. Aber er erinnerte sich an jede Sekunde dieses Sterbens.
Heinrich Heiland hatte darauf bestanden, dass sich alle Kinder und Enkel um das Bett versammelten. Und so war auch Peter Zeuge geworden, wie seine Großmutter nach der Hand des Großvaters fasste und sagte: »Ich sterb nicht gern. Aber ich sterb beruhigt, weil mir niemand einfällt, bei dem ich mich entschuldigen müsst. Und ich danke dem lieben Gott, dass er mir so einen guten Mann gegeben hat.«
Und er hörte, wie sein Opa sagte: »Ich werd so allein sein, ohne dich!«
Und sie: »Guck dich doch um. Wir haben so eine wunderbare Familie.«
Niemand widersprach ihr, obwohl jeder wusste, dass das so auch wieder nicht stimmte. Und dann war sie ganz plötzlich tot. Ihre Schwester, Tante Anna, drückte ihr die Augen zu.
Die Tante Anna. Die altledige Tante Anna. Die war Dienstmädle gewesen von ihrem sechzehnten bis zu ihrem zweiundachtzigsten Lebensjahr, immer in derselben Familie. »Mei Herrschaft«, hatte sie immer gesagt. Wenn Peter in den Sommerferien bei seiner Oma Marieluise und seinem Opa Henry war, hatte ihm die Tante Anna jeden Abend an seinem Bett Geschichten erzählt und Gedichte vorgetragen. Auswendig! »Die Glocke« von Schiller oder »Die Bürgschaft«: »Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich, entgegnet finster der Wüterich …« Und als Peter an dieser Stelle einmal laut dazwischenfuhr: »Kartoffeln schälen, stört es dich …?«, hatte die alte Tante so gelacht, dass sie eine Viertelstunde brauchte, um sich zu erholen. Am schönsten und traurigsten hatte Peter immer »Romeo und Julia auf dem Dorfe« von Gottfried Keller gefunden. Auch diese Erzählung hatte die Tante Anna auswendig gekonnt. Jetzt war sie neunundachtzig, und alle Gedichte und Geschichten hatten sie verlassen. Wenn Peter sie im Altenpflegeheim besuchte, erkannte sie ihn nicht mehr. Manchmal, wenn sie einen hellen Moment hatte, sagte sie: »Alt werden ist eine einzige Beleidigung!«
Sein Großvater Henry dagegen war noch immer voll bei Kräften. Er jammerte nie. »Warum au? Was soll mir das bringen?« Aber als ihn sein Lieblingsenkel Peter besuchte, um ihm mitzuteilen, dass er nun nach Berlin ziehen werde, hatte er dann doch gesagt: »Das kannscht du mir antun? In mei’m Alter? Wer weiß, ob ich dich dann überhaupt noch amal wiedersehe!«
»Ich werd dich noch oft besuchen, Opa Henry, und vielleicht kommst ja du auch mal zu mir nach Berlin.«
»So weit kommt’s noch, was soll ich zu dene da ’nüber? Das ist doch knapp vor Sibirien!«
Peter Heiland hatte die Hände noch immer hinter dem Kopf verschränkt. Jetzt spürte er, dass sie sich verkrampften. Er gab einen leisen Seufzer von sich und löste die Finger voneinander.
Hanna Iglau schaute auf. »Sagen Sie mal, Kollege, nehmen Sie die Akten eigentlich telepathisch auf?«
Peter Heiland grinste. »Ich bin halt net so dienstgeil. Außerdem hab ich quasi die ganz’ Nacht durchg’schafft!«
An der Pforte des Landeskriminalamtes in der Keithstraße gab eine Frau ein Kuvert ab. Es war an die Mordkommission adressiert.
Der Pförtner wollte sie aufhalten. »Moment mal, Mordkommissionen haben wir acht Stück im Haus, um was für einen Fall geht es denn?« Aber die Frau huschte davon wie ein Schatten.
»Na sollen die sehen, für wen das ist«, sagte der Pförtner und nahm das Telefon ab.
Drei Stunden später ließ Ron Wischnewski sieben Fotos aus dem hellbraunen Kuvert rutschen, nachdem er zuvor ein Paar weiße Plastikhandschuhe übergestreift hatte. Die Bilder verteilten sich auf dem Schreibtisch. Und auf allen sah man dasselbe Objekt: ein altes Mauser-Jagdgewehr.
Wischnewski rief seine Leute zusammen. Jeder sollte sagen, was ihm zu den Bildern einfiel. Die Waffe wurde von mehreren Mitarbeitern als Mauser-Jagdgewehr identifiziert. Viel mehr kam aber nicht dabei heraus. Doch dann sagte Peter Heiland plötzlich: »Das ist der Kofferraum eines Ford Capri, und die Wolldecke stammt aus der Weberei Huttenlocher in Tübingen-Derendingen!« Der Rest der Truppe starrte ihn sprachlos an. Peter Heiland hob beide Hände, als ob er sich entschuldigen müsste. »Das mit dem Capri weiß ich, weil ich früher selber mal mit so einem gefahren bin. Und in der Weberei Huttenlocher hat mein Opa Henry früher g’schafft. Es ist die einzige Firma, die solche Mäandermuster weben darf. Da liegt Gebrauchsmusterschutz drauf.«
Einen Augenblick war es still. Dann sagte Kriminalrat Wischnewski: »Drei der Fotos gehen in die Kriminaltechnik!« Dann sah er Peter Heiland an. »Und Sie gehören ab heute zur Sonderkommission Heckenschütze. Beschäftigen Sie sich mit den Akten!« Er deutete auf ein Regal, auf dem sauber angeordnet mindestens fünfzehn Aktenordner standen.
Als sich der Feierabend ankündigte, sagte Peter Heiland zu Hanna Iglau: »Darf ich Sie vielleicht zum Abendessen einladen?«
Hanna musste sehr an sich halten, um nicht sofort spontan zuzusagen. Sie hasste ihre einsamen Abende in ihrer kleinen Wohnung vor dem Fernseher, der in diesen Sommerwochen nichts als Wiederholungen brachte. Trotzdem sagte sie: »Also ich glaube nicht …«
»Ja no«, unterbrach der Schwabe, »da kann mr nix mache!«
»Geben Sie immer so schnell auf?«, fragte Hanna spitz.
Peter Heiland nickte. »Im Allgemeinen schon.«
Hanna versuchte die Situation zu retten. »Na gut, wenn’s nicht länger geht als eine Stunde.«
»Das bestimmen ganz alleine Sie!«
Auf dem Parkplatz stiegen sie in Hannas kleines Auto. Es verfügte über ein Schiebedach, das sich so weit öffnen ließ, dass man sich einbilden konnte, in einem Cabrio zu sitzen. Als Peter Heiland auf Geheiß seiner Kollegin das Dach aufschob, klemmte er den Daumen seiner rechten Hand ein.
»Also wohin?«, fragte seine Kollegin.
»Machen Sie einen Vorschlag. Sie sind die Berlinerin.«
»Essen oder nur trinken?«
»Ich hab richtig Hunger!«
»Und Sie laden tatsächlich ein?«
»Ja natürlich, warum denn nicht?«
»Sie sind doch Schwabe!«
»Mein Gott! Immer diese Vorurteile!«
Während sie den Kudamm hinunterrollten bis zum Adenauerplatz, dort rechts abbogen und wenig später rund um den Stuttgarter Platz nach einem Parkplatz suchten, erzählte Peter Heiland: »Man unterstellt uns ja immer, wir würden so einladen: ›Kommet nachem Kaffeetrinken, damit ihr zum Nachtessen wieder daheim sein könnt.‹ Aber das stimmt halt auch nur manchmal. Neulich war ich bei einem echten Berliner eingeladen. Einem Nachbarn von mir. Der hat eine halbe Flasche Weißwein aus seinem Kühlschrank geholt, hat mir eine bessere Bodendecke in ein Achtelesgläsle eing’schenkt, die Flasche hat er dann wieder zugekorkt und zurückgestellt. Zum Essen gab’s ein paar Kekse, deren Verfallsdatum irgendwann kurz nach der Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz gelegen haben muss. Die Flasche hat er kein zweites Mal aus dem Kühlschrank geholt.«
Hanna lachte: »Jetzt übertreiben Sie aber!«
»Kein Stück! Eine Woche später war ich in Tübingen eingeladen (Tübingen liegt bekanntlich mitten in Schwaben). Als ich nach der dritten Flasche Trollinger mit Lemberger, gerösteten Maultaschen mit Salat und einem leer gegessenen Holzbrett voll Rauchfleisch gehen wollte, sagte mein Gastgeber, Schwabe in der sechzehnten Generation: ›Komm, mir machet no a Fläschle auf, und mei Frau bringt jetzt da Käs. Du wirscht doch ned hongrig ond durschtig vom Tisch aufschtehe wella?!‹ Ich hätte sicher in Berlin auch diese Erfahrung machen können, und umgekehrt hätte ich natürlich auch in Schwaben auf einen echten Entaklemmer, wie man bei uns die Geizigen nennt, treffen können. Das beweist aber nur: Es gibt überall solche und solche, auch wenn’s bei uns in Schwaben vielleicht doch a paar mehr solche als solche gibt.«
Während Peter Heiland erzählte, sah Hanna Iglau immer häufiger zu ihm hinüber. Er hatte seinen Kopf gegen die Kopfstütze gelehnt und die Augen halb geschlossen. Im Profil sah sein Gesicht aus wie das eines römischen Feldherrn, fand Hanna. Oder wie das eines Gladiators. Beide kannte sie aus dem Kino.
Jetzt war er schon ein Vierteljahr in ihrer Abteilung, aber sie hatte immer das Gefühl, dass er sie überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hatte. Vielleicht lag es an ihrem engen T-Shirt und dem kurzen Rock, dass es heute anders war.
Es war ihr auch noch nie passiert, dass sie sich mit einem Kollegen solange siezte. Normalerweise bot man sich das Du gleich am ersten Tag an.
Hanna hatte gerade einen Mercedes passiert, als der aus seiner Parkposition ausbog. Sie bremste und setzte zurück. Der Fahrer des Mercedes hupte. Er fühlte sich offensichtlich behindert. Tatsächlich hätte er noch einmal zurückstoßen müssen, um sicher an dem Heck von Hannas Wagen vorbeizukommen. Aber Hanna wollte sich nicht weiter von der Parklücke entfernen, damit ihr kein anderer zuvorkommen konnte. Der Mercedesfahrer begann laut zu schimpfen und hämmerte mit dem Zeigefinger gegen seine Stirn. Peter Heiland stieg aus und ging nach hinten.
»Hat Ihre Ische den Führerschein in der Baumschule gemacht?«, schrie ihm der Mercedesfahrer entgegen.
Peter beugte sich zu dem offenen Fenster in der Fahrertür hinab und zeigte diskret seinen Dienstausweis. »Das tut mir ja jetzt sehr leid«, sagte er freundlich, »wir sind in einem wichtigen Diensteinsatz, aber wir dürfen keinerlei Aufsehen erregen – Sie verstehen das doch sicher.« Dabei schaute er sich konspirativ nach allen Seiten um, als ob er befürchtete, sie würden beobachtet.
»Ja, Mann, wenn das so ist. Aber woher soll ich det wissen?«
»Fahren Sie einfach möglichst unauffällig weg«, sagte Peter und lächelte dem Mann noch einmal kumpelhaft zu.
»Mach ick doch!«, sagte der eifrig. »Keen Thema!« Er rangierte seine Limousine umsichtig aus der Parklücke und an Hannas Wagen vorbei, machte sogar noch eine entschuldigende Geste und rollte langsam die Straße hinunter.
Hanna parkte schwungvoll ein, was kein Problem war, weil sie nur den halben Platz ihres Vorgängers brauchte. Dann stieg sie aus und sagte: »Wie haben Sie das denn gemacht?«
»Manchmal ist es eben auch ein Vorteil, Polizist zu sein!«
»Sie haben doch nicht etwa … nein, das glaube ich nicht!« Hanna war sichtlich empört.
Peter grinste: »Ich habe, als ich nach Berlin kam, bei Polizeidienststellen hospitiert, und ich habe keine Dienststelle kennen gelernt, bei der die Kollegen nicht mit Blaulicht und Martinshorn gefahren wären, wenn sie Currywurst für die ganze Mannschaft besorgen mussten. Kann man ja auch verstehen, wenn man weiß, wie schnell so eine Currywurst kalt werden kann.«
Der Mann hatte sich gegen zwölf Uhr ein Steak gebraten und einen Rucola-Salat mit Tomaten zubereitet. Während er aß, hörte er Musik. Mozarts Klavierkonzert in A-Dur. Er kannte jede einzelne Note. Danach war er ins Bad gegangen, hatte sich sorgfältig rasiert, die überstehenden Härchen aus den Augenbrauen geschnitten, die Nägel nachgefeilt und ein sommerlich frisches Eau de Cologne aufgetragen.
Als die Sonne hinter der Havel untergegangen war, verließ er das niedrige, schmale Häuschen und ging zu dem Schuppen, den er als Garage benutzte. Er öffnete den Kofferraum und erstarrte. Ihm wären noch viel kleinere Veränderungen aufgefallen. Aber so, wie eine Ecke der Wolldecke eingeschlagen war – das schrie geradezu ›Hier!‹. Es entsprach überhaupt nicht seiner Art, die Mauser einzuhüllen.
Ein paar Augenblicke war er wie paralysiert. Er spürte, wie sich jeder Muskel in seinem Körper spannte. Freilich nicht so wie am Morgen im Bad, als die Muskelpartien ihm alle gehorchten. Jetzt hatten sie sich plötzlich selbständig gemacht. Es fiel ihm schwer, sie unter Kontrolle zu bringen. Das Zittern, das durch seinen Körper lief, beschämte ihn.
Wann konnte das geschehen sein? Nachdem er an der Gradestraße geschossen hatte, war er noch zum »Tresor« gefahren. Er hatte seinen Wagen in einer Seitenstraße abgestellt. In der Disco war er eine knappe Stunde geblieben. Das genügte ihm, um zu registrieren, mit welch geilen Blicken ihn viele der Frauen ansahen. Blicke voller Versprechen. Fordernd zum Teil, was er freilich als verdammt anmaßend empfand. Er hasste es, wie sie ihn zu animieren versuchten, aber er hätte niemals darauf verzichten wollen.
Er war dann gegangen, als es eine von ihnen wagte, ganz dicht vor ihn hinzutreten und nach seiner Hand zu greifen. Was sie sagte, gefiel ihm. »Ey, du, lonesome wolf!« Aber ihre körperliche Nähe konnte er nicht ertragen. Er sagte nichts. Er ging nur. Und er stellte sich vor, was für eine unglaublich starke Wirkung das auf die Frau haben musste.