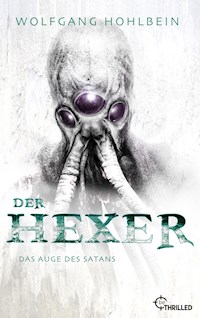
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hexer-Saga von Bestseller-Autor Wolfgang Hohlbein
- Sprache: Deutsch
Nachdem Robert überstürzt durch das Tor der Großen Alten gereist ist, versuchen diese sich in England Rowlfs und Howards zu bemächtigen. Doch das magische Haus am Ashton Place 9 spürt den Angriff und kann Howard mit einem magischen Zeichen vorwarnen. Er ahnt nicht, dass die Attacke weit heftiger ausfallen wird als erwartet ...
Der legendäre Hexer-Zyklus - komplett und in chronologischer Reihenfolge erzählt, mit vielen Hintergrundinformationen des Autors:
Der Hexer - Die Spur des Hexers
Der Hexer - Der Seelenfresser
Der Hexer - Engel des Bösen
Der Hexer - Der achtarmige Tod
Der Hexer - Buch der tausend Tode
Der Hexer - Das Auge des Satans
Der Hexer - Der Sohn des Hexers
Der Hexer - Das Haus der bösen Träume
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1238
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
DAS AUGE DES SATANS
Vorwort
In der Festung des Dschinn
Das Auge des Satans
Die Rache des Schwertes
ENDSTATION HÖLLE
Vorwort
Das unheimliche Luftschiff
Die fantastische Reise
Epilog
Endstation Hölle
DER ABTRÜNNIGE ENGEL
Vorwort
Die vergessene Welt
Revolte der Echsen
Der abtrünnige Engel
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Nachdem Robert überstürzt durch das Tor der Großen Alten gereist ist, versuchen diese sich in England Rowlfs und Howards zu bemächtigen. Doch das magische Haus am Ashton Place 9 spürt den Angriff und kann Howard mit einem magischen Zeichen vorwarnen. Er ahnt nicht, dass die Attacke weit heftiger ausfallen wird als erwartet …
WOLFGANG HOHLBEIN
DER HEXER
DAS AUGE DES SATANS
DAS AUGE DES SATANS
Vorwort
Auch in diesem Buch spielen wiederum die Tempelritter, die Roberts Weg ja schon mehrfach gekreuzt haben, eine bedeutsame Rolle. Anlass genug, ein bisschen näher auf den Orden einzugehen.
Die Templer sind keineswegs nur Ausgeburten der Fantasie, sondern gehen bis auf die Zeit der Kreuzzüge zurück. Gegründet im Jahre 1118 von Hugo von Payens und Gottfried von Saint-Omer war es anfangs lediglich eine Vereinigung kämpfender Mönche, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Karawanenstraße zum Heiligen Grab in Jerusalem zu bewachen und den frommen Pilgern Geleit zu bieten. Dabei waren die Templer in ihren Methoden nicht gerade zimperlich, vor allem, als sie immer mehr an Macht und Bedeutung gewannen. Mit der Zeit stiegen sie zum mächtigsten Kreuzfahrerorden auf.
Von allen Kreuzrittern waren sie bei ihren Feinden besonders gefürchtet, und man sagt ihnen wahre Wunderdinge nach. So haben sie in der Schlacht von Akkon im Jahre 1291 monatelang einer hundertfachen Übermacht von Sarazenen standgehalten.
Die Macht der Tempelritter wurde schließlich so groß, dass selbst Papst und Krone eine Gefahr in ihnen zu sehen begannen. Das Ende des Ordens wurde durch böswillig ausgestreute Gerüchte eingeleitet. Verräter wurden eingeschleust, Belastungszeugen gekauft. Schließlich wandte sich Papst Clemens V. mit der Bitte um aktive Hilfe gegen die Templer an den französischen König Philipp den Schönen. Beiden ging es nicht nur um die Beseitigung eines Machtfaktors, der ihnen über den Kopf zu wachsen drohte, sondern auch um die immensen Reichtümer des Ordens.
Am 13. Oktober 1307 wurden die Tempelritter festgenommen, ihre Güter beschlagnahmt und der Orden offiziell verboten und aufgelöst. Viele der Templer wurden grausam gefoltert und als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Seither halten sich Gerüchte über ein heimliches Fortbestehen des Ordens im Untergrund, wie sie auch im Hexer aufgegriffen werden. Konkrete Beweise dafür gibt es jedoch nicht (sonst wäre es ja auch kein Geheimbund mehr).
Die Struktur des Ordens innerhalb der Hexer-Serie, vor allem die magisch begabten Master, das ist freilich eine reine Fiktion.
Frank Rehfeld
In der Festung des Dschinn
Rot. Alles hier war rot. Angefangen von den schweren Brokatvorhängen, die die Wände bedeckten, über die polierten Bodenplatten bis hin zu dem Kissen, auf das die Krieger Scheik Achmed gestoßen hatten. Und auch der Stoffbezug des vor ihm stehenden Thrones war rot, in allen nur denkbaren Schattierungen und Tönen.
Es war die Farbe Nizars.
Die Farbe frischen Blutes.
Von der gleichen Farbe war auch der weite Umhang Nizars selbst, der wie eine feiste Kröte auf seinem Thron saß und scheinbar gedankenverloren mit einem prächtigen Rubin spielte, der an einer langen goldenen Kette um seinen Hals baumelte. Und obwohl er mit schon übermäßig zur Schau gestellter Teilnahmslosigkeit dahockte und seinen Ring betrachtete, als gäbe es nichts Interessanteres auf der Welt, wirkte diese aufgesetzte Ruhe erschreckender und drohender auf Scheik Achmed als alles, was ihm Nizars Schergen bisher getan hatten. Fast wäre er erleichtert gewesen, hätte Nizar gedroht oder geschrien – oder ihn wenigstens beachtet.
Auch die drei Frauen, die neben dem Thron standen und Achmed keinen Augenblick aus den Augen ließen, trugen rote Gewänder. Nizar schien eine extreme Vorliebe für diese Farbe zu besitzen – und besonders für dieses ganz spezielle Rot. Denn es war nicht das strahlende Rot der aufgehenden Sonne oder Ehrfurcht gebietendes Purpur, sondern das dunkle, satte Rot vergossenen Blutes. So wie alles in diesem Raum mit Blut geschwängert zu sein schien. Selbst die schwülwarme Luft, die zwischen den Vorhängen hindurchwehte, brachte den bedrückenden, süßlichen Geruch von Tod und Sterben mit sich.
Aber vielleicht war es nur seine eigene Angst, die er roch. Scheik Achmeds Magen krampfte sich zu einem festen, schmerzhaften Klumpen zusammen. Seine Finger zitterten. Vergeblich rezitierte er in Gedanken eine Sure des Korans. Die Kraft und Stärke, die ihm die Worte des Propheten sonst immer geschenkt hatten, kamen nicht. Im Gegenteil – seine Angst wuchs mit jedem Schlagen seines Herzens weiter. Er fühlte sich so schwach wie ein neugeborenes Lamm, das sich unversehens dem Löwen gegenübersieht. Doch es war nicht die Angst um sein Leben allein, die seine Glieder und viel mehr noch seinen Willen lähmte, sondern vor allem der Ekel vor dem Mann auf dem Thron.
Dabei sah Nizar mit seinem Kugelbauch, den die lose fallende Jellaba vergeblich zu kaschieren suchte, den kleinen, beinahe hinter den Speckwülsten auf seinen Wangen verschwindenden Augen und seinen über die Maßen mit Ringen beschwerten kurzen Wurstfingern auf den ersten Blick eher lächerlich als gefährlich aus. Ein Mann, den jeder, der ihn nicht kannte und ihm zum ersten Mal begegnet wäre, als harmlosen Spinner abgetan hätte.
Doch Scheik Achmed wusste, wie sehr dieser Eindruck täuschte. Nizar war ungefähr so harmlos wie ein schlecht gelaunter Wüstenskorpion oder ein eisbedeckter Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch stand.
Nizar ließ den Rubin fallen wie ein Spielzeug, dessen er überdrüssig geworden war, wuchtete seinen massigen Leib in eine bequemere Lage und sah Scheik Achmed mit einem fast übertrieben freundlichen Lächeln an. Er wirkte jetzt wie ein arabischer Märchenerzähler, der es sich auf dem Teppich bequem gemacht hatte, um seine Zuhörer zu unterhalten. Nur, dachte Achmed fröstelnd, dass er einzig Geschichten von Tod und Angst zu erzählen hatte.
»Nun, wie lautet deine Antwort, mein Freund?«
Nizars Stimme war – soweit überhaupt möglich – noch eine Spur freundlicher als seine Miene. Doch Scheik Achmed schrumpfte ängstlich ein weiteres Stück in sich zusammen und zermarterte sich das Gehirn, um eine Antwort zu finden, die Nizar zufrieden stellen würde, ohne dass er indes gezwungen war, sich endgültig festzulegen.
»Du … du forderst zu viel von mir«, sagte er schließlich zögernd. Er hatte nicht die Kraft, Nizars Blick dabei standzuhalten. Konnte man einen Mann wie Nizar überhaupt belügen?, dachte er. Laut fuhr er fort: »Ohne die Versammlung der Ältesten zu befragen, kann ich keine für den Stamm so ungeheuer wichtige Entscheidung treffen. Das musst du verstehen!«
Unsicher sah er auf. Und schon der erste Blick in Nizars spöttisch verzogenes Gesicht ließ die vorsichtige Erleichterung, die er empfand, wie eine Seifenblase zerplatzen.
»Ich … ich wollte sagen, dass mir meine Leute nicht gehorchen werden, wenn ich ihnen sage, dass sie ab jetzt dich, mächtiger Nizar, als Herrn anerkennen müssen«, fügte er unsicher hinzu. »Die Krieger der Beni Assar haben niemals einen Herrn über sich anerkannt. Wir haben weder dem Vizekönig von Ägypten noch dem Sultan von Stambul gehorcht oder ihnen Steuern gezahlt. Wir waren immer frei wie der Wind, und die Wüste gehörte stets uns!«
Außerdem würden wir uns noch eher den Ungläubigen aus Inglistan oder Frankistan unterwerfen als dir, du Abschaum des Schejtans. Möge Allah uns vor dir bewahren – oder dich besser gleich mit der Krätze an deinen edelsten Körperteilen schlagen, setzte er in Gedanken hinzu.
In Nizars Augen blitzte es einen Moment zornig auf, fast, als habe er die Gedanken des alten Scheiks verstanden. Doch statt des erwarteten Wutausbruches lächelte er plötzlich wieder, wenngleich mit der Freundlichkeit einer Hyäne, und nahm den Rubin wieder in die Hand, um ihn an seiner Kette kreisen zu lassen.
»Weißt du, Achmed«, begann er versonnen, »ich habe irgendwie den Eindruck, dass du dir über das Ausmaß meiner Macht nicht ganz im Klaren bist. Wenn ich wollte, könnte ich dich und deine Beni Assar so vollständig vom Angesicht der Erde tilgen, dass sich niemand mehr an euch erinnern würde. Da ich heute jedoch ausnehmend gnädig gesinnt bin«, fügte er mit einem süffisanten Lächeln hinzu, »will ich dir eine Stunde Bedenkzeit geben. Dann wirst du meine Hand küssen und mich Herr nennen. Das schwöre ich dir!«
Dass er noch immer mit diesem gleichen, durch und durch freundlichen Lächeln redete, machte alles nur noch schlimmer. Scheik Achmed fühlte sich mehr und mehr wie das Kaninchen vor der Schlange. Nicht, wenn Allah mir hilft, du Sohn einer syphilitischen Spinne, dachte er verzweifelt, während sich Nizar zu den drei Frauen niederbeugte und eine davon im Nacken kraulte, als wäre sie eine große Katze.
»Was seid ihr so müßig, meine Schönen?«, fragte er. »Ich habe einen Gast! Wollt ihr, dass er hungrig bleiben muss und der Durst ihm die Kehle verbrennt – und das Gehirn?«, setzte Nizar hinzu und bedachte Scheik Achmed mit einem ebenso verächtlichen wie spöttischen Blick.
Die Frauen glitten geschmeidig hoch und verbeugten sich mit vor der Brust gekreuzten Armen vor ihrem Herrn. Sie bewegten sich auf höchst sonderbare, schwer in Worte zu kleidende, Furcht einflößende Weise, dachte Achmed. So absolut gleich, als wären sie in Wirklichkeit eins, nicht drei. Ihre kleinen Füße berührten kaum den Boden, als sie mit flinken Bewegungen einen kleinen Tisch und etliche schwer beladene Silberplatten in den Raum trugen und vor Scheik Achmed aufbauten. Und sie bewegten sich lautlos. Nicht leise oder beinahe lautlos, sondern völlig still. Nicht einmal das Rascheln ihrer Kleider war zu hören.
Trotz seiner immer stärker werdenden Furcht zwang sich Achmed, die drei Frauen genauer zu betrachten. Sie waren sehr verschieden, und doch hatten sie etwas an sich, das sie zu Schwestern machte. Die eine war groß und stattlich und besaß Formen, die zu jeder anderen Zeit Scheik Achmeds Herz entzündet und seine Fantasie in Zeiten zurückgeführt hätten, als er noch jung und kraftvoll war. Sie trug weite Pluderhosen und ein eng anliegendes Jäckchen, das der schwellende Busen schier zu sprengen drohte. Ihr Gesicht war braun und hübsch, doch als Scheik Achmed in ihre Augen sah, erinnerten sie ihn an die einer Löwin, die er vor vielen Jahren einmal gejagt hatte. Der gleichen Löwin, der er die handspannlange Narbe auf seinem Rücken verdankte, die ihn in besonders kalten Nächten vor Schmerzen nicht schlafen ließ. Es war sonderbar – die Frau zog ihn an, so stark, wie eine Frau einen Mann nur anziehen konnte, und gleichzeitig stieß sie ihn ab, als hafte ihr ein übler Geruch an, den er nicht wirklich spürte, der aber irgendetwas in seinem Inneren berührte.
Die zweite Frau war so dunkel wie eine Negerin. Auch sie besaß die schräg gestellten Raubkatzenaugen, die eine wilde, ungezähmte Kraft und eine derart unersättliche Gier ausstrahlten, dass Scheik Achmed unwillkürlich vor ihr zurückwich. Die Drohung, die von ihr ausging, war irgendwie direkter.
Die Letzte der drei schließlich war um einiges kleiner und zierlicher als ihre beiden Gefährtinnen. Sie besaß ein kurzes Gesicht, eine kleine, an der Spitze dunkler gefärbte Nase und leckte sich immer wieder mit der Zunge über die Lippen. Wie eine Katze, die an der Sahneschüssel geschleckt hat.
Nachdem die eine Frau einen großen Silberteller bis an den Rand mit gekochter Hirse und gebratenen Fleischstücken angehäuft, die zweite einen silbernen Pokal aus einer bauchigen Kanne gefüllt und die dritte eine Wasserpfeife entzündet hatte, legten sie sich wie zufriedene große Katzen auf den Boden und spielten mit ihren Halsbändern, von denen jedes einen großen Edelstein trug.
Was für eine sinnlose Verschwendung bei Sklavinnen, dachte Scheik Achmed voller Neid, während er den Becher zur Hand nahm und trank. Ein fremdartiger, aber nicht unbedingt unangenehmer Geschmack breitete sich auf seiner Zunge aus. Eine sonderbare Wärme erfüllte ihn, und plötzlich begriff Scheik Achmed, was er da trank!
Mit einem Schrei schleuderte er den Becher von sich und spie die noch im Mund befindliche Flüssigkeit auf den Boden.
»Allah!«, keuchte er, hin und her gerissen zwischen Ekel, Entsetzen und purer Wut. »Willst du mich um das Paradies bringen? Du weißt doch, dass der Prophet Mohammed dieses Teufelsgetränk verflucht hat und alle, die davon trinken!«
»Sagt dir etwa mein Wein nicht zu?«, fragte Nizar fröhlich und hielt seinen Rubin vor das rechte Auge, sodass er Scheik Achmed wie durch ein rotes Monokel ansah. »Tz, tz – du bist sehr undankbar, mein Freund. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, dieses famose Getränk für dich herbringen zu lassen, und du dankst es mir, indem du meinen Boden bespuckst und mich beleidigst.« Seine Stimme wurde um eine Winzigkeit schärfer. »Nun sieh mich wenigstens an, wenn ich mit dir rede.«
Achmed gehorchte – und erstarrte mitten in der Bewegung.
Der durch den Rubin verstärkte Blick des Zauberers traf ihn wie ein Hammerschlag; eine weiß glühende Flamme, die sich sengend in sein Gehirn hineinfraß und eine Spur aus Schmerzen und Lähmung zurückließ. Er versuchte sein Gesicht mit den Händen zu schützen, doch der unsichtbare Feuerstrahl brannte sich unbarmherzig tiefer. Die Schmerzen wurden so stark, dass Scheik Achmed das Gefühl hatte, sein Körper wäre nur noch eine einzige, zuckende Wunde, jeder einzelne Nerv von glühenden Zangen ergriffen und verbrannt. Haltlos stürzte er nach vorne und schlug sich Stirn und Lippen am Boden blutig. Aber er hatte nicht einmal mehr die Kraft für ein Stöhnen.
»Du wirst meinen Wein trinken!«, drang Nizars Stimme in seine Gedanken ein. »Und du wirst auch das Schweinefleisch essen, das auf dem Teller liegt, egal, wie sehr Mohammed den Genuss von Wein und Schweinefleisch verboten hat!«
Der Gedanke, das Undenkbare tun zu sollen, gab Scheik Achmed noch einmal Kraft. Für einen winzigen Moment gelang es ihm sogar, die entsetzliche Lähmung zu überwinden, mit der ihn Nizars Blick erfüllte. »Nein! Niemals!«, heulte er. Mühsam wälzte er sich herum, stemmte sich mit der Kraft der Verzweiflung auf Knie und Ellbogen hoch und versuchte vor Nizar davonzukriechen. Nizar lachte nur und verstärkte die Kraft seines magischen Blickes, bis der alte Araber mit einem letzten Schrei zusammensank und bewusstlos liegen blieb.
Mit einem beinahe bedauernden Seufzen senkte Nizar den Rubin und gab der größten der drei Frauen einen knappen Wink.
Als Scheik Achmed aus seiner feuerverzehrten Ohnmacht erwachte, stand der Becher frisch gefüllt vor ihm, und seine rechte Hand lag auf dem Teller. Er starrte beide Dinge voller Abscheu an und wollte sie wegstoßen, doch seine Hände gehorchten ihm nicht mehr, sondern erwachten zu einem gespenstischen Eigenleben. Die Finger seiner Rechten ergriffen das größte Fleischstück, packten es und führten es zu seinem Mund.
Als das Fleisch seine Lippen berührte, biss er die Zähne zusammen. Doch auch seine Kiefer versagten ihm den Dienst und öffneten sich so weit, dass ihm beinahe die Mundwinkel aufgerissen wurden. Dann stopfte seine Rechte das Fleisch in den Mund. Sofort begannen seine Zähne den Bissen zu zerkauen, die Muskeln in seinem Hals machten sich selbstständig und schluckten gegen seinen Willen. Glühende Lava schien seinen Magen zu erfüllen. Ein kaltes, jeder Beschreibung spottendes Entsetzen erfüllte seinen Geist. Gleichzeitig schloss sich die Linke um den Weinbecher und schüttete den ganzen Inhalt in seine Kehle. Scheik Achmed erstickte fast, da ihm ein Teil des Weines in die Luftröhre geriet, und sank hustend und nach Luft ringend zu Boden.
»Nun kennst du meine Macht!«, sagte Nizar freundlich. »Möchtest du noch mehr? Nur keine falsche Bescheidenheit, mein lieber Freund. Es ist genug da.« Er kicherte böse.
Scheik Achmed starrte ihn aus leeren Augen an. Sein Gehirn war wie betäubt, denn das Entsetzen hatte die Grenzen des Vorstellbaren überstiegen. »Ich kenne sie«, flüsterte er. »Doch ich beuge mich nicht deinem Teufelsspuk.« Er stöhnte, presste die Hände auf den Leib und versuchte den Inhalt seines Magens hervorzuwürgen, aber seine Kraft reichte nicht aus. Schon die wenigen Worte hatten mehr Überwindung von ihm gekostet, als er eigentlich aufzubringen in der Lage war.
Nizars Freundlichkeit verschwand von einer Sekunde auf die andere. »Du bist stark«, sagte er böse. »Du bist ein alter Mann, aber du bist stark. Aber es wird dir nichts nutzen! Du wirst dich mir doch unterwerfen!« Nizar schnippte zornig mit den Fingern.
Sofort griff Scheik Achmeds Rechte wieder zum Teller und stopfte den nächsten Bissen in den Mund. Diesmal spürte er keine Schmerzen mehr, nur einen entsetzlichen Ekel, der ihn beinahe den Verstand verlieren ließ. Aber er würde standhalten, ganz egal, was Nizar ihm antun mochte. Allah würde wissen, dass es nicht seine Schuld war. Er hatte nicht aus freiem Willen gegen die Worte des Propheten gesündigt, auch nicht aus Schwäche, sondern durch schwarze Magie und die Macht des Schejtans, dessen Handlanger Nizar zweifellos war. Nein, dachte er noch einmal, mochte Nizar ihn zu Tode foltern, mochte er ihn zwingen, unaussprechliche Dinge zu tun – er würde standhalten.
Er wusste, dass es Nizar nicht allein um die Herrschaft über seinen Stamm ging. Er wollte vor allem seine unsterbliche Seele beherrschen und versklaven, so wie er schon viele Seelen beherrscht und versklavt hatte, um sie später in die tiefsten Schlünde der Hölle zu versenken, ganz wie er es dem Schejtan als Preis für die ihm verliehenen Zauberkräfte gelobt hatte.
Scheik Achmed war Zeit seines Lebens ein vorsichtiger Mann gewesen, der sich selbst stets den notwendigen Wert zugemessen hatte. Er hätte viel dafür gegeben, noch einige Jahre zu leben und vielleicht noch die Söhne seines Sohnes heranwachsen zu sehen. Doch er war auch ein tiefgläubiger Moslem. Und sein größter Wunsch war es, nach seinem Tod ins Paradies zu gelangen und den Propheten zu sehen.
Doch dies würde niemals geschehen, wenn er Nizar Macht über seinen Stamm und seine Seele gab. Scheik Achmed war nicht einmal traurig, als er sich der einzig möglichen Konsequenz bewusst wurde, die es für ihn noch gab. Um seinen Stamm brauchte er sich keine Sorgen zu machen. Ali würde schon wissen, wie er sich Nizars Zugriff entziehen konnte.
Achmed fragte sich, auf welche Art er sterben würde. Durch einen dieser altertümlich gerüsteten Krieger, die wie vertrocknete Mumien aussahen? Oder würde ihn Nizar mit seinem Zauberblick töten?
Nizar betrachtete den alten Mann lauernd, der schwer atmend vor ihm saß. Er nahm sein Schweigen als Zeichen, dass Scheik Achmed aufgegeben hatte. Er streckte gebieterisch die Rechte aus und erwartete, dass der andere sie ehrfürchtig küssen würde.
Scheik Achmed küsste seine Hand nicht.
Er tat etwas ganz anderes.
Mit einer schier unmenschlichen Anstrengung richtete er sich auf und lachte dem Zauberer ins Gesicht.
»Beim Barte des Propheten und bei meinem eigenen, nein!«, presste er hervor. »Ich werde mich dir niemals unterwerfen. Und auch mein Stamm wird es nicht tun! Möge Allah dich in den tiefsten Schlund der Dschehenna schleudern, wo du hingehörst, du Kreatur des Schejtans!«
Nizars Gesicht nahm ganz langsam die gleich Farbe an wie der Thron, auf dem er saß. Seine Finger krallten sich in die Lehne, als wollten sie das kostbar geschnitzte Holz zermalmen. Dann atmete er hörbar aus und gab den drei Frauen einen kurzen Wink.
Scheik Achmed wunderte sich ein wenig, als die drei auf ihn zukamen und ihm die Hände auf die Schultern legten. Er blickte von einer zur anderen und sah Funken in ihren Augen sprühen, und wieder konnte er an nichts anderes denken als an Raubkatzen. Die Angst packte ihn erneut, schlimmer als zuvor. Er wich langsam zurück, bis sein Rücken die Wand berührte und es nichts mehr gab, wohin er fliehen konnte.
Die Frauen ließen ihn nicht los. Und dann geschah etwas Entsetzliches.
Vor Scheik Achmeds ungläubig geweiteten Augen begannen sie, sich zu verändern. Ihre Fingernägel wuchsen zu scharfen Krallen, die sich schmerzhaft in seine Haut und in sein Fleisch bohrten. Auch die Gesichter veränderten sich, wurden kürzer und breiter und überzogen sich mit feinem, seidig glänzendem Fell; ebenso ihre Körper, die sich in schlanke, geschmeidige Raubkatzenleiber verwandelten.
Einen kurzen Moment kosteten die drei zu einer Löwin, einer schwarzen Pantherkatze und einer Gepardin gewordenen Frauen das Grauen des alten Mannes noch aus.
Dann öffneten sie ihre Rachen zu einem tiefen, gierigen Grollen.
Scheik Achmed sah die langen Reißzähne dicht vor seinem Gesicht blitzen und stieß einen Schrei aus, der im Kreischen der Raubkatzen unterging.
Einige lange Augenblicke vergingen, bis ich begriff, dass alles vorbei war. Und ich glaubte es erst, als ich sah, dass der Knauf meines Stockdegens kein gelbes Licht mehr ausstrahlte, dass der Shoggotenstern darin nur noch schattenhaft erkennbar war.
Und es dauerte noch länger, bis ich allmählich zu begreifen begann, was überhaupt geschehen war …
Ich hatte das geheimnisvolle Transportsystem der GROSSEN ALTEN ja schon mehr als einmal benutzt, doch so schlimm wie diesmal war es noch nie gewesen. Ich erinnerte mich kaum, wie ich in das Tor gekommen war; geschweige denn, was während des Transportes wirklich geschehen war. Hinter mir lag eine nicht zu bestimmende Zeit – Sekunden oder Jahrhunderte, das blieb sich gleich – voll gestaltlosem Schrecken und dumpfem Wahnsinn, der mich gepackt hatte. Meine Kehle war rau und spannte, als hätte ich stundenlang geschrien, und in meinen Muskeln saß die allmählich verblassende Erinnerung an einen sehr tiefgehenden Schmerz. Irgendetwas hatte sich während des Durchgangs an mich geklammert und versucht, mich in der Zwischenzeit festzuhalten. Es hatte nicht viel gefehlt, und es wäre ihm gelungen.
Verwirrt richtete ich mich vollends auf, fuhr mir mit dem Handrücken über die Augen und spürte erst jetzt, dass ich mir bei meiner recht unsanften Landung auf dem Boden die Nase blutig geschlagen hatte.
Außerdem war die Sandrose nicht mehr da.
Außer meiner Nase schien auch mein Gehirn bei dem unfreiwilligen Sprung durch das Tor gelitten zu haben, dachte ich verwirrt. Irgendetwas war … Zum Teufel, irgendetwas war schiefgegangen. Aber was? Ich hatte die Sandrose in der Hand gehalten, als ich das Tor betrat, und jetzt war sie fort, und dies hier war mit Sicherheit nicht das Arbeitszimmer in meinem Haus in London.
Wenn mich nicht alles täuschte, war es nicht einmal mehr London …
Ich versuchte meine Gedanken zu einem einigermaßen vernünftigen Ablauf zu zwingen, presste die Augenlider so fest zusammen, bis ich bunte Kreise sah, und atmete gezwungen tief und ruhig ein.
Als ich die Augen wieder öffnete, war ich zwar immer noch nicht in London, aber ich war wenigstens ruhig genug, mich in meiner neuen Umgebung umzusehen.
So weit es etwas zu sehen gab.
Ich befand mich in einem dunklen Raum, dessen Einrichtung zum größten Teil aus Staub und Leere zu bestehen schien. Hier und da hockte ein Schatten in der graubraunen Dunkelheit, und ein sehr sonderbarer Geruch lag in der Luft, aber es war einfach zu dunkel – und ich war noch immer zu verwirrt –, um auch nur erraten zu können, wohin es mich verschlagen hatte.
Nun war es gewiss nicht das erste Mal, dass ich mich notgedrungen auch auf das Unerwartete einstellen musste, und es gab ein paar recht einfache Tricks, die in Situationen wie diesen halfen.
Ich drehte mich noch einmal um meine Achse – ohne mehr als Dunkelheit und staubverhangene Spinnweben zu sehen –, löste vorsichtshalber die Verriegelung meines Stockdegens und tastete mich im Halbdunkel auf die Tür zu.
Eine Sekunde später war ich so gut wie blind, denn nach dem staubigen Halbdunkel hier drinnen war das gleißende Sonnenlicht, das mir entgegensprang, geradezu unerträglich.
Aber ich sah immerhin genug, um die Hand voll abgerissener Gestalten zu erkennen, die das Knarren der Tür unter einer Dattelpalme hochscheuchte, in deren Schatten sie den Tag verdösten …
Dattelpalme …?
Ich blinzelte, fuhr mir abermals mit der Hand über das Gesicht und zwang meine tränenden Augen, in das grellweiße Licht jenseits der Tür zu blicken.
Vor mir lag eine staubig-heiße Dorfstraße, ein paar halb verhungerte Esel, die sich an einer Dornenhecke gütlich taten, und eine Anzahl schwarz verschleierter Wesen, die mit spitzen Schreien hinter Hofmauern verschwanden, kaum dass sie meiner ansichtig geworden waren.
Nein, nach London sah dieser Ort wirklich nicht aus …
Ich stand da, als hätte jemand einen Kübel Eiswasser über mich ausgeleert, so starr vor Schrecken, dass ich im ersten Augenblick nicht einmal recht begriff, dass der Tumult, der mit einem Male auf der Straße losbrach, keinem anderen galt als mir.
Und als ich es begriff, war es beinahe zu spät.
Die Männer, die bislang phlegmatisch unter der Palme gelegen hatten, sprangen wie von der Tarantel gestochen auf. Andere Männer quollen lärmend aus Toreingängen und Häusern, brüllten durcheinander und schüttelten Fäuste und Knüppel. Sicher nicht durch Zufall standen sie so, dass sie mir auf jeden Fall den Weg versperrten. Schmutzige, sonnenverbrannte Hände schlossen sich um die Holzgriffe krummer Dolche, und aus den mehr überraschten als wirklich zornigen Schreien, die ich im ersten Moment gehört hatte, wurde ein vielstimmiges, feindseliges Murmeln und Raunen.
»Giaur!«, brüllte eine Stimme. »Moscheenschänder!«, eine andere. Ich begriff noch immer nicht, was überhaupt los war, drehte mich aber instinktiv herum – und sah, dass es sich bei dem Gebäude, aus dem ich eben gekommen war, um einen gewaltigen Bruchsteinbau handelte, der die übrigen Häuser des Ortes an Größe weit übertraf. Daneben stand ein etwa zehn Yards hoher, viereckiger Turm, der mich fatal an ein Minarett erinnerte. Moscheenschänder? Hatten sie wirklich Moscheenschänder gerufen?, flüsterte eine dünne, hysterische Stimme in meinen Gedanken.
Wenn ja, war ich nicht unbedingt in einer beneidenswerten Lage.
Als ich mich wieder herumdrehte, war die Menge ein gutes Stück näher gekommen, und der Ausdruck auf den dunklen Gesichtern war nicht unbedingt der orientalischer Gastfreundschaft. In mehr als einer Hand blitzte geschliffener Stahl.
Unschlüssig trat ich der Menge einen Schritt entgegen und blieb wieder stehen. Einen Moment lang spielte ich ernsthaft mit dem Gedanken, mich wieder in die Moschee zu flüchten. Aber nur einen Moment. Ebenso gut konnte ich hier bleiben und mich der mittlerweile auf stolze hundert Seelen angewachsenen Menge stellen.
Ganz allmählich begann mein Verstand wieder wie gewohnt zu arbeiten. Von allen scheinbar ausweglosen Situationen, in denen ich mich je befunden hatte, war dies wohl die am wenigsten scheinbare. Ich hatte eine gewisse Übung darin, mich gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner zur Wehr zu setzen – gegen die hundert fanatischen Araber, die einen Giaur in kleine Fetzchen zerreißen wollten, hatte ich jedoch keine Chance. Vor allem dann nicht, wenn ich mir auch nur das geringste Anzeichen von Angst anmerken ließ.
Also raffte ich das bisschen Mut, das ich in einem Winkel meiner Seele fand, zusammen, zauberte ein geradezu unverschämt freundliches Grinsen auf meine Züge, ging der Menge betont forsch entgegen und versuchte mir selbst einzureden, dass die Behauptung Frechheit siegt einen kleinen Kern Wahrheit enthielt. Nun gut – von den Fällen, in denen sie nicht gesiegt hatte, hörte man wohl seltener.
Den Gedanken, meine hypnotischen Fähigkeiten einzusetzen, um aus dieser prekären Situation zu entkommen, verwarf ich rasch wieder. Gegen diese Menschenmenge waren sie nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.
Ich blieb vor einem alten, graubärtigen Mann stehen, der sich in den Vordergrund geschoben hatte. Trotz seines Alters schien er so etwas wie der Rädelsführer zu sein.
»Salem Aleikum«, sagte ich, streckte ihm die Hand entgegen und lächelte freundlich.
Der Alte sah mich aus zusammengekniffenen Augen an, ohne meinen Gruß zu erwidern. Dann verzerrte er die Lippen, bleckte die braunen Stummel, die vor etwa dreihundert Jahren einmal Zähne gewesen sein mussten, und spie mir vor die Füße. Einige andere kamen näher an mich heran. Eine Hand griff nach meinem Ärmel und zerrte daran, eine andere grabschte wenig sanft nach meiner Schulter.
Ich versuchte, mir mit Ellbogenstößen Raum zu schaffen, und tastete gleichzeitig nach meinem Stockdegen, obwohl er in meiner momentanen Situation wohl eine mehr als erbärmliche Waffe darstellte. Außerdem zermarterte ich mir das Gehirn, auf welche Weise ich diese Orientalen davon abhalten konnte, mich in Stücke zu reißen. Mit meiner zur Schau gestellten Ruhe sah ich mich um, perfekt den überheblichen Gecken spielend, der aus lauter Unwissenheit in ein fünf Meilen tiefes Fettnäpfchen gestolpert war. Lächerlichkeit ist manchmal eine gute Verteidigung. Manchmal auch die letzte.
»Gestatten«, begann ich, »mein Name ist Craven. Robert Craven, aus London, Großbritannien. Ich hoffe, mein Erscheinen hat Ihnen keine Ungelegenheiten bereitet!«
Der Mann sah mich an, als hätte er einen Wahnsinnigen vor sich – was er in diesem Moment zweifellos auch glaubte –, und wich einen Schritt zurück, bis ihn die Menge aufhielt. Doch dann gewann sein Zorn wieder die Oberhand.
»Du verfluchter Giaur!«, radebrechte er in miserablem Englisch. »Du Moscheenschänder!« Er packte mich mit einer Hand am Jackett und fuchtelte mir mit der anderen vor dem Gesicht herum. Ich widerstand im letzten Moment der Versuchung, sie zu packen und zwischen seine Stummelzähne zu schieben. Ein winziger Fehler, und ich war so tot, wie es nur eben ging.
»Schlagt den ungläubigen Hund tot!«, schrie eine Stimme aus dem Hintergrund. Andere fielen in das Geschrei mit ein und drängten nach vorne. Der Alte wurde gegen mich gedrückt und krallte sich mit seinen knochigen Fingern an meiner Kehle fest.
Ich beschloss, meine Taktik zu ändern, trat mit dem Knie zu und stieß ihn zurück, als er zusammenklappte. Doch sofort hängten sich drei, vier der Kerle an mich und versuchten mich zu Boden zu zerren. Ich schüttelte zwei von ihnen ab, packte die Faust des dritten und schlug damit die Nase des vierten Muselmanen blutig. Ein Schatten erschien in meinem Augenwinkel. Ich fuhr herum und trat dem Kerl kräftig in die Seite. Plötzlich hatte ich wieder den Alten am Hals, der vor lauter Zorn geiferte und spie wie ein tollwütiger Dackel. Blitzschnell packte ich ihn, drehte ihn an den Schultern herum und versetzte ihm einen Tritt in den Hintern, der ihn zum zweiten Male in die Menge zurücktaumeln ließ.
Für einen ganz kurzen Moment hatte ich Luft, denn meine unerwartet heftige Gegenwehr hatte die Angreifer wohl doch überrascht.
Nicht, dass ich mir ernsthafte Chancen ausrechnete, mich wirklich halten zu können, wenn sie sich erst zu zehnt auf mich stürzten.
Aber dazu kam es nicht. Einem weiter hinten stehenden Mann dauerte die Sache offensichtlich zu lange. Er bückte sich, hob einen Stein auf und schleuderte ihn über die Köpfe der anderen hinweg.
Der Stein sauste um Haaresbreite an meinem Ohr vorbei und traf einen neben mir stehenden Araber an der Schläfe. Der Mann seufzte, griff sich an den Kopf, blinzelte verwirrt, als er Blut an seinen Fingerspitzen bemerkte, und sah mich eine geschlagene Sekunde lang vorwurfsvoll an.
Dann fiel er steif wie ein Brett nach hinten.
Es war das Signal zum totalen Chaos. Plötzlich regnete es von allen Seiten Steine und Holzstücke. Alles drängte nach vorn, um mich endlich zwischen die Finger zu bekommen. Einige Männer stiegen sogar den vor ihnen Stehenden auf die Schultern und traten sie zu Boden. Es war keine Horde lynchwütiger Männer mehr, sondern ein einziger, aus hundert Körpern und zweihundert wütend ausgestreckten Armen bestehender Mob, der sich auf mich warf.
Ich hob die Fäuste, sprang einen Schritt zurück und spreizte die Beine, um einen festeren Stand zu haben. Ich brachte sogar das Kunststück fertig, die beiden ersten Angreifer abzuwehren, aber dann wurde ich von der Masse der Araber schier begraben und zu Boden gedrückt. Im Liegen schlug, trat und biss ich um mich und wurde selbst geschlagen, gebissen und getreten. Zu meinem Glück behinderten sich die fanatischen Moslems in ihrer Wut gegenseitig, sodass ich zunächst zwar jede Menge Schrammen und Beulen abbekam, jedoch noch keine ernsthafte Verletzung.
Doch es konnte nur noch Sekunden dauern, bis mich die Kerle in Stücke gerissen hatten.
Jeder der drei Männer war so groß, dass Nizar sich bei ihrem Anblick eines raschen, heftigen Anfluges von Neid nicht erwehren konnte. Ihre schlanken, aber trotzdem sehr muskulösen Körper steckten in festen Kettenpanzern, über denen sie weiße, mit einem roten Kreuz geschmückte Waffenröcke trugen. Die gepanzerten Handschuhe lagen auf den Griffen langer Schlachtschwerter, die an einfachen Waffengurten hingen. Eiserne Topfhelme, die nur schmale Augenschlitze besaßen, verbargen ihre Gesichter. Und jeder Zoll ihrer Erscheinung versinnbildlichte alles, was Nizar hasste.
Es war nicht einmal das Kreuz auf ihrer Brust, denn obgleich es das Symbol der Christen und somit seiner Feinde darstellte, war es ihm herzlich egal, welcher Religion die drei angehörten. Ob Kreuz oder Halbmond oder was auch immer, für Nizar waren es allesamt falsche Götzenbilder. Solange Nizar denken konnte, hatte es nur einen Gott gegeben, an den er glaubte, und der war kurzbeinig und dick und hatte eine ausgeprägte Vorliebe für die Farbe Rot.
Nein, das Kreuz war es nicht, was ihn innerlich so sehr vor Zorn brodeln ließ. Zum ersten Mal seit Äonen hatte es jemand gewagt, ihn aufzufordern, sich einer anderen Macht zu beugen! Ihn, der bislang immer andere unterworfen hatte.
Trotzdem ließ er sich von seiner Wut nicht zu unüberlegten Handlungen hinreißen, sondern belauerte die drei Männer mit seinen magischen Sinnen. Es waren keine solchen harmlosen Narren wie der alte Scheik, dessen Blut seine Diener erst Augenblicke vor dem Eintreffen der drei Tempelritter von dem Boden aufgewischt hatten. Jeder der drei war ein Träger großer magischer Kraft und gefährlicher als ein ganzes Heer, das spürte Nizar einfach.
Und entsprechend vorsichtig formulierte Nizar seine Antwort, obgleich er in Wahrheit nicht übel Lust hatte, die Topfhelme der drei samt ihrem Inhalt auf lange Spieße stecken und seine Festungsmauer damit schmücken zu lassen. »Meine Antwort lautet nein, edle Herren«, sagte er und fügte mit einem raschen, freundlichen Hyänenlächeln hinzu: »Ich kann Euer Ansinnen verstehen, doch was Ihr verlangt, ist unmöglich. Es tut mir leid, dass Ihr den langen Weg zu meiner Festung umsonst gemacht habt.«
Auf den Gesichtern der drei war keine Regung zu erkennen – was nicht zuletzt daran liegen mochte, dass ihre Gesichter unter den silbern glänzenden Helmen nicht zu erkennen waren –, aber Nizar spürte ihre Gefühle fast besser, als hätte er ihr Mienenspiel beobachtet. Er fühlte den mühsam unterdrückten Zorn Gouvin du Tourvilles und den heiß lodernden Hass Renard de Banrieux’ so klar, als wären es seine eigenen Gefühle.
Nur Guillaume de Saint Denis, dem dritten Templer, gelang es, seine Gedanken vor den tastenden Geistfühlern des Magiers abzuschirmen. Dennoch war auch ihm anzumerken, dass er verärgert war. Oder den Ärger nur vortäuschte?, dachte Nizar verwirrt.
Instinktiv umklammerte seine Rechte den Rubin auf seiner Brust.
»Lass die Hand von dem Stein!«, sagte Renard de Banrieux. Seine Stimme klang scharf, und die Hand des Templers schloss sich um den Schwertgriff. Der Anblick ließ Nizars Zorn zu heller Wut auflodern. Was bildeten sich diese Ungläubigen ein, mit der Waffe in der Hand an seinen Hof zu kommen und ihm auch noch zu drohen?, dachte er wütend.
Als hätte er seine Gedanken gelesen, legte Guillaume de Saint Denis seinem Kameraden beruhigend die Hand auf den Unterarm. »Lass ihn, Renard. Der Rubin stellt für uns keine Gefahr dar.« Er schüttelte den Kopf, um seine Worte zu bekräftigen, dann wandte er sich wieder an Nizar:
»Du solltest dir unseren Vorschlag noch einmal überlegen«, sagte er ruhig. »Um die Wüstenstämme, die du dir unterworfen hast, unter Kontrolle zu halten, brauchst du das Auge des Satans nicht. Dazu reicht die Kraft deines Rubins allein. Außerdem bieten wir dir die Unterstützung unseres Ordens an, wenn du uns das Auge des Satans übergibst. Du weißt, wir besitzen mehr Macht, als du mit dem Auge jemals erringen könntest. Außerdem«, fügte er in fast – aber eben nur fast – freundlichem Ton hinzu, »wäre es nur eine … nun, sagen wir: Leihgabe. Ein jeder von uns gibt dir sein Wort als Ehrenmann und Ritter, dass du das Auge unbeschädigt zurückerhältst.«
»Würdet ihr mit euren Köpfen dafür haften?«, fragte Nizar lauernd.
»Nein«, fauchte Renard. »Aber vielleicht mit deinem.«
Saint Denis brachte seinen Begleiter mit einer unwilligen Geste zum Verstummen. »Schlag ein«, fuhr er fort, Renards Worte ganz bewusst übergehend, »und wir garantieren, dass ab sofort deine Feinde auch unsere Feinde sind. Wir werden jeden vernichten, der dich und dein Reich bedroht!«
Nizar starrte den Templer an. Das Wort Größenwahn war ihm bisher fremd gewesen, obwohl – oder vielleicht weil – er von Geburt an sehr ausgeprägt an dieser Krankheit litt, aber Guillaume de Saint Denis’ Worte klangen in seinen Ohren mehr als nur großspurig. Er kannte die Macht der Templer, auch wenn er bislang noch nie persönlich mit einem Angehörigen dieses Ordens zusammengetroffen war. Doch was konnten sie von der geheimnisvollen Kraft des Auges schon wissen? Märchen und Gerüchte vielleicht, nichts als das erschreckende und Angst machende Geschwätz, das darüber im Umlauf war – und das er selbst zu einem guten Teil in die Welt gesetzt hatte, um seine Macht noch mehr zu festigen.
Was wussten sie schon, diese Narren! Er hatte seinen Blick in das Auge versenkt und die Kräfte, die es wie ein nie versiegender Quell verströmte, in sich aufgenommen. Nur er allein wusste, was das Auge des Satans vermochte.
»Nein«, sagte er, jetzt ohne die geringste Spur von Freundlichkeit. »Es bleibt dabei. Und es wäre besser, ihr verschwindet jetzt. Aus meiner Burg und aus meinem Reich. Bevor die Wüstensonne eure Knochen bleicht«, fügte er gelassen hinzu.
Renard de Banrieux riss sein Schwert mit einem Wutschrei aus der Scheide und stürmte auf Nizar zu, noch bevor ihn Guillaume zurückhalten konnte. Der Magier wich mit einer Behändigkeit, die man einem Mann seines Aussehens gar nicht zugetraut hätte, einen halben Schritt zurück und zeichnete mit der Hand einen Kreis in die Luft. Wie aus dem Boden gewachsen stand plötzlich ein gutes Dutzend Krieger um ihn herum, reglos, aber bereits mit gezückten Krummsäbeln.
Aber statt stehen zu bleiben, schrie de Banrieux noch wütender auf und schwang seine gewaltige Klinge. Nizars Leibwächter zogen sich hastig zu einem lebenden Schutzwall um ihren Herrn zusammen, eine Mauer aus drohend vorgestreckten Schwertern und Schildern, an der sich der Templer selbst aufspießen musste. Und wahrscheinlich hätte er es, blind vor Wut, auch getan, hätte ihn nicht der scharfe Befehl Saint Denis’ im letzten Moment zurückgerufen.
»Halt, Renard! Das Schwert nieder!«, befahl der Templer scharf. »Wir sind als Gesandte zu Nizar gekommen und nicht, um mit diesen Kreaturen des Teufels zu kämpfen!«
Tatsächlich hielt de Banrieux mitten im Schritt inne und senkte sogar sein Schwert – wenn auch nur um eine Winzigkeit –, aber in seinen Augen blitzte der blanke Hass. »Du befiehlst mir, feige zu sein, de Saint Denis?«, fragte er aufgebracht.
»Ich befehle dir nicht, feige zu sein, sondern klug«, antwortete Guillaume. Er sprach zu seinem Kameraden, aber sein Blick war weiter starr auf Nizar gerichtet; ein Blick, unter dem sich der Zauberer mehr als nur unwohl zu fühlen begann. »Unser Auftrag heißt uns nur, das Auge des Teufels von Nizar zu fordern, nicht jedoch, den Kampf mit ihm zu beginnen!« Einen Moment lang starrte er Nizar noch auf diese unheimliche, beinahe Furcht einflößende Weise an, dann zog er sehr langsam sein eigenes Schwert aus dem Gürtel, trat auf den lebenden Schutzwall aus Kriegern zu und machte eine herrische Bewegung mit der Rechten. Tatsächlich wichen die Krieger ein Stück vor ihm zurück, blieben jedoch mit kampfbereit erhobenen Schwertern stehen.
»Jetzt höre, was ich dir zu sagen habe, Heide«, fuhr St. Denis fort. »Ich kam mit offener Hand hierher, und mit einem Angebot des Friedens. Doch du schlägst es aus, und für diesen Fall soll ich dir dieses sagen: Wenn du uns das Auge des Teufels verweigerst, so wird dich die Macht des Auges selbst vernichten, noch ehe der Mond sich wendet.«
Nizar erbleichte vor Schrecken und Zorn. Nie hatte es jemand gewagt, ihm so unverhüllt zu drohen, noch dazu hier, in den Mauern seines eigenen Palastes! Jeden anderen hätten diese Worte auf der Stelle das Leben gekostet. Nicht so diesen Tempelritter.
Vielleicht war es das erste Mal in seinem Leben, dass Nizar Angst kennen lernte. Die Drohung im Blick des Tempelherrn war bar jeden Zornes, aber von einer Kälte und Entschlossenheit, die ihn schaudern ließ. Es war etwas darin, was ihm vollkommen fremd war.
»Geht«, sagte er nur. Seine Stimme zitterte. Ein schlechter Geschmack war in seinem Mund. Seine Hände waren plötzlich feucht vor Schweiß. »Geht, de Saint Denis, solange meine Langmut noch anhält. Zwischen Euch und mir ist kein Streit, und so soll es bleiben.«
Guillaume lächelte, und obwohl Nizar nur seine Augen erkennen konnte, erschauderte er. »Vergiss den Mond nicht, Nizar«, sagte er. »Bevor er sich wieder rundet, wirst du nicht mehr unter den Lebenden sein!« Und damit stieß er sein Schwert in die Scheide zurück, wandte sich mit einem Ruck um und ging, gefolgt von seinen beiden Ritter-Kameraden.
»Sollen wir diese Hunde verfolgen?«
Nizar hatte Mühe, sich auf die Worte des Kriegers zu seiner Rechten zu konzentrieren. Verwirrt schüttelte er den Kopf und ballte zornig die Fäuste. Nizar wusste es nicht, aber es waren seine eigenen Waffen, mit denen Guillaume ihn angegriffen hatte. Und er verstand sich auf den Umgang damit ungleich besser als Nizar.
Verwirrt schüttelte er den Kopf.
»Lasst sie fliehen«, sagte er zögernd. »Wir haben Besseres zu tun.«
Der Krieger sah ihn erstaunt an, und auch auf den Gesichtern der anderen machte sich Verwirrung breit.
Aber keiner von ihnen wagte es, Nizar auch nur mit einem Wort zu widersprechen.
Es waren nur Sekunden, aber wie oft in solchen Augenblicken zogen sie sich endlos dahin.
Die Menge hatte sich wie eine braungraue Flutwelle über mir geschlossen, und hatte ich im ersten Augenblick noch das Glück gehabt, dass sich die Araber eher darum schlugen, wer mich schlagen durfte – ich verpfände mein Ehrenwort, dass das nicht halb so lustig war, wie es sich anhören mag! –, so vergingen doch nur Augenblicke, bis ein wahrer Hagel von Hieben und Tritten auf mich herunterprasselte. Dem Lärm und den Schreien nach zu urteilen, mussten rings um mich herum die wildesten Raufereien im Gange sein, aber davon hatte ich herzlich wenig. Ich hatte alle Hände und Füße voll damit zu tun, am Leben zu bleiben.
Ein Fuß traf meine Seite und trieb mir die Luft aus den Lungen. Ich packte ihn, verdrehte ihn samt dem daran hängenden Bein und warf den Kerl in hohem Bogen von meiner Brust herunter, bekam in der nächsten Sekunde einen gemeinen Hieb gegen die Kehle und schlug blindlings zurück, während ich würgend nach Luft rang. Eine Hand krallte sich in mein Haar und zog meinen Kopf zurück, und jemand versuchte, mit einem Dolch an meine Kehle heranzukommen.
Ich riss das Knie hoch, trat zu und traf, und der Dolch verschwand – aber nur, um gleich darauf von einer schmutzigen Faust abgelöst zu werden, die mir die Nase blutig schlug.
Ich biss kurzerhand hinein.
Eine Sekunde später bekam ich einen Hieb gegen die Schläfe, der mich halb besinnungslos in die Arme meiner Peiniger sinken ließ.
Plötzlich mengten sich in das Heulen und Toben der entfesselten Araber andere Geräusche; Laute, die ich im ersten Moment nicht zu identifizieren wusste. Aber ich registrierte zumindest, dass sich irgendetwas im Heulen der arabischen Lynchgesellen änderte. Mit einem Male klangen die Schreie mehr erschrocken als zornig. Dann hörte ich ein dumpfes, monotones Stampfen – das mir in diesem Moment herrlicher erschien als der Engelschor, auf den ich eigentlich vorbereitet gewesen war –, den Tritt fester Stiefel und das Klirren von Metall. Dann klang eine harte befehlsgewohnte Stimme auf, so laut, dass sie selbst über dem Kreischen der Muslims deutlich zu verstehen war.
»Achtung! Kompanie rechts schwenkt! Halt! Erstes Glied, legt an! Feuer!«
Der peitschende, lang nachhallende Knall einer Gewehrsalve ließ das Dorf erzittern. Die Araber, die mich gepackt hatten, fuhren heulend herum, erblickten das Karree der Rotröcke, bei dem eben das zweite Glied vortrat und die Gewehre anlegte, und ließen mich endlich los. Von einer Sekunde auf die andere verwandelte sich der Mob in eine kreischende, kopflos flüchtende Menge, die jegliches Interesse an dem Ungläubigen verloren hatte.
Stöhnend richtete ich mich auf, tastete mit den Fingerspitzen über meine geschwollenen Lippen und stöhnte ein zweites Mal, als ein scharfer Schmerz durch meinen Kiefer schoss. Rings um mich verwehte die Staubwolke, die der eilige Rückzug meiner Gegner hinterlassen hatte, aber in der Luft lag noch immer der deutliche Geruch nach Mord und Blut, und für einen Augenblick drohte ich nun wirklich das Bewusstsein zu verlieren.
Ich kämpfte die Dunkelheit zurück, die nach meinen Gedanken greifen wollte, stand mit wackeligen Knien auf und wischte mir mit dem Handrücken das Blut aus dem Gesicht.
Dann blickte ich zu meinen Rettern hinüber und ließ ein überraschtes Keuchen hören. Für einen Augenblick zweifelte ich an dem, was ich da sah. Das britische Empire hatte tatsächlich im richtigen Augenblick eine Kompanie strammer Highlander in die Wüste geschickt, um mich zu retten!
Umständlich klopfte ich mir den Staub von den Kleidern und hob meinen Stockdegen auf. Die Klinge war ein Stück aus der hölzernen Hülle gerutscht, aber die Waffe schien unbeschädigt, was man von ihrem Besitzer nicht unbedingt sagen konnte. Mein Jackett war an zahllosen Stellen zerrissen und mit Blut- und Schmutzflecken übersät, und meine Hose brauchte dringend Faden und Zwirn, denn beide Knie blickten durch große Löcher und von meinem rechten Hosenbein fehlte das untere Stück. Nun gut, dachte ich sarkastisch, besser von ihr als von dem Bein, das darin steckte …
Jetzt erst fühlte ich mich in der Lage, die britische Armee zu begrüßen und mich für die unerwartete Hilfe zu bedanken. Es handelte sich tatsächlich um eine Kompanie schottischer Hochlandsoldaten, die mit ihren Kilts und Pelztaschen in dieser Umgebung reichlich fehl am Platz wirkten. Gott sei Dank.
Sie standen so steif wie bemalte Statuen in drei Reihen gestaffelt vor mir und hatten den Blick starr geradeaus gerichtet. Ein Sergeant mit martialisch aufgezwirbeltem Schnurrbart trat einen Schritt vor und bellte seine Befehle mit einer Lautstärke, als gälten sie den in den hintersten Winkeln des Dorfes versteckten Arabern und nicht den hundert Mann vor ihm.
Die Truppe schwenkte wie ein Mann herum und gab mir den Blick auf ihren Kommandanten frei – wenigstens vermutete ich, dass es ihr Kommandant war: ein hagerer Militär um die fünfzig, der so aussah, als wäre er gerade aus einem Modejournal für Armeeoffiziere entsprungen und nicht aus der Wüste. Sein roter, mit goldenen Tressen und Binsen besetzter Uniformrock war aus bestem Material und saß wie angegossen. Ebenso die dunklen Reithosen, die in blitzblank geputzten Stiefeln steckten, in denen ich mich hätte spiegeln können.
Der Offizier sah mir aus kleinen grauen Augen entgegen, steckte seinen Revolver mit einer eckigen Bewegung in die Gürteltasche zurück und legte beide Hände um den Griff seines prunkvollen Säbels. Seine linke Augenbraue sank etwas herab, als er noch einmal Luft holte und mit schnarrender Stimme zu sprechen begann: »Hatten verfluchtes Glück. Wenn nicht zufällig einer meiner Späher gesehen hätte, wie die verwünschten Eingeborenen über Sie herfielen, wären Sie jetzt ein verdammt toter Mann.«
Ich nickte, versuchte zu lächeln und verzog stattdessen schmerzhaft das Gesicht, als meine Unterlippe abermals aufriss. »Besten Dank«, sagte ich gequält. »Das war wirklich Rettung in letzter Sekunde! Wenn Sie einen Augenblick später gekommen wären …«
Der Offizier blinzelte, kam mit steifen Schritten auf mich zu und maß mich mit der Art von herablassend-abschätzendem Blick, zu der auf der ganzen Welt nur Soldaten der höheren Charge fähig sind. »Sind Sie ein verdammter Yankee oder ein guter Englishman?«, fragte er, sichtlich über meinen amerikanischen Akzent befremdet.
»Ich bin Robert Craven aus London, Ashton Place 9«, antwortete ich automatisch.
Meine Worte zeigten eine größere Wirkung, als ich selbst gehofft hatte, denn der Offizier riss die Augen auf, dass ihm das Monokel herausgefallen wäre, hätte er eines getragen. Ganz offensichtlich kannte er London, und ebenso offensichtlich wusste er, was die Adresse zu bedeuten hatte, die ich ihm nannte. Immerhin gibt es in Old London nur wenige noch feudalere Gegenden als den Platz, an dem Andara House liegt – Schloss Windsor zum Beispiel und die Houses of Parliament gehören dazu. Das Stadtviertel, aus dem der Colonel stammte, mit Sicherheit nicht.
Er räusperte sich mehrmals, bis er sich wieder gefasst hatte, verschränkte die Hände hinter dem Leib und begann abwechselnd auf Zehenspitzen und Absätzen zu wippen, während sein Blick finster über das Dorf glitt. »Man muss diesen verdammten Eingeborenen immer wieder einmal zeigen, dass wir die Herren sind. Sonst werden sie verdammt frech und fallen über unsereins her. Auch wenn wir nicht gerade wie ein Gentleman aussehen!«
Ich ging gutmütig über die kleine Spitze hinweg und überlegte, wie ich die Soldaten jetzt nur noch dazu bringen konnte, mir den Weg in die Moschee frei zu machen, damit ich an das darin verborgene Tor und auf diese Weise wieder nach Hause kam. Das dumme Gesicht, das der Colonel machen würde, wenn ich vor seinen Augen verschwand, konnte ich dann zwar nicht mehr sehen, mir aber jetzt schon lebhaft vorstellen.
Doch der Offizier hatte ganz andere Absichten bezüglich meiner Person. Offensichtlich hatte er mein Schweigen falsch gedeutet, denn er räusperte sich abermals, hörte endlich auf, auf der Stelle zu wippen, und blieb auf den Zehenspitzen stehen, wodurch er mir immerhin fast bis zur Krawattennadel reichte. »McFarlane!«, brüllte er. »Wir marschieren in unser verdammtes Lager zurück!«
Sprach’s, drehte sich auf der Stelle herum und stieg auf sein Pferd, das von einem arabischen Diener herbeigeführt wurde.
»Los, mitkommen!« Der Sergeant schnauzte mich an wie einen seiner Rekruten, als ich dem Colonel nicht sofort folgte.
»Aber ich muss …«, protestierte ich, kam aber nicht weiter, denn McFarlane schnitt mir mit einer herrischen Bewegung das Wort ab.
»Gar nichts müssen Sie! Wir haben sie nicht aus den Klauen dieser Kerle geholt, um Sie jetzt zurückzulassen! Verstanden?«, brüllte er. Gleichzeitig winkte er zwei Soldaten aus dem Glied, die ernsthafte Anstalten machten, mich einfach unter den Armen zu fassen und mitzuschleifen.
Ich verfluchte die Borniertheit des Sergeanten, hatte jedoch keine Chance, dem eisenharten Griff der Soldaten zu entkommen. Es waren baumlange Schotten, die glattweg Brüder Rowlfs sein konnten. Jeder von ihnen sah ganz so aus, als könne er mit bloßen Fäusten einen ausgewachsenen Ochsen niederschlagen; einen ausgewachsenen Robert Craven allemal.
Ich versuchte erst gar nicht, mich zu wehren. Nicht zuletzt, weil ich wenig Lust verspürte, den Kampf mit meinen arabischen »Freunden« gegen eine Prügelei mit einer Kompanie englischer Soldaten einzutauschen.
Gegen Mittag war es so heiß geworden, dass die Pferde einfach nicht mehr weiter konnten. Ein leichter, aber beständiger Wind wehte von Norden und trug Wärme in klebrigen Wogen aus der Wüste heran, und der Sand, der hier fast weiß war, reflektierte das Licht der Sonne wie ein gewaltiger welliger Spiegel.
Nirgends zeigte sich auch nur das mindeste Anzeichen von Leben. Selbst die Staub- und Sandwolken, die die Hufe der Pferde aufgewirbelt hatten und die ihren Weg markierten, erinnerten Guillaume an beigebraune Leichentücher.
Obgleich die Sonne wie ein glühender Fleck geschmolzenen Eisens am Himmel hing und ihm die Tränen in die Augen trieb, zwang er sich, nach oben zu blicken, um die ungefähre Zeit abschätzen zu können. Sie waren den Abend, die ganze Nacht und den halben Tag geritten, bis Hitze und Erschöpfung die Pferde einfach nicht mehr weiterlaufen ließen, und die einzige Linderung, die sie den geschundenen Tieren und sich selbst gönnen konnten, war der allmählich mit der Sonne mitwandernde Schatten des mächtigen Felsbrockens, der drei Manneslängen hoch aus dem Wüstensand ragte. Das Wasser, von dem sie einen mehr als großzügigen Vorrat mitgenommen hatten, war jetzt fast aufgebraucht, und auch Guillaume fühlte sich schwach und kraftlos wie ein neugeborenes Kind, obwohl sie ihre Waffen und die schweren Kettenhemden und Helme abgelegt hatten, kaum dass Nizars Festung außer Sichtweite gekommen war.
Trotzdem wartete er voller Ungeduld darauf, dass die Sonne endlich weiterwanderte und sie ihren Weg fortsetzen konnten. Die große arabische Wüste, an deren Rand sie jetzt seit anderthalb Tagen entlangritten, war nicht ganz so tödlich und leer, wie die meisten Menschen glaubten. Es gab ein Wasserloch, vielleicht noch vier, fünf Stunden entfernt, und wenn sie es erst einmal erreicht hatten, lag das Schlimmste hinter ihnen.
Oder erst vor ihnen, je nachdem.
Guillaume hatte seit dem vergangenen Abend fast ununterbrochen darüber nachgedacht, wie er Philippe de Valois die schlechte Nachricht am besten beibringen konnte, ohne sich seinen Zorn zuzuziehen und in Ungnade zu fallen. De Valois war ein tapferer Streiter Christi, aber er war nicht unbedingt zimperlich in der Wahl seiner Mittel. Und – was schlimmer war – er war ein Choleriker, wie Gott der Herr nur einen geschaffen hatte. Es mochte gut sein, dass Guillaume und die beiden anderen sich beim Reinigen der Latrinen wiederfanden, nachdem sie de Valois die Kunde vom Fehlschlag ihrer Mission überbracht hatten.
Guillaume verfluchte insgeheim Renards aufbrausendes Wesen, dem sie letztlich das endgültige Scheitern ihrer Mission zu verdanken hatten. Er war sicher gewesen, dass es ihm gelingen würde, Nizar zur Herausgabe des magischen Auges zu überreden, irgendwie. Renards Herausforderung hatte alles zunichte gemacht, denn er hatte sich wohl oder übel vor seinen Kameraden stellen müssen, wollte er nicht vor dem Heiden das Gesicht verlieren.
Nicht, dass Guillaume Renard wirklich grollte – er konnte seine Gefühle Nizar gegenüber nur zu gut verstehen, denn er teilte sie, obgleich er weniger Zorn als vielmehr Verachtung für den fettleibigen Möchtegern-Magier empfand. Nizar war kein wirklicher Zauberer. Er gebot über große Macht, aber es war nicht seine eigene, sondern eine Kraft, die er dem Auge entliehen – genauer gesagt, gestohlen – hatte und die ihn eines Tages selbst vernichten würde. Guillaume dagegen kannte Männer mit echten magischen Kräften. Philippe de Valois gehörte dazu, oder André de la Croix, der Storm-Master des Ordens, der sie so überraschend verlassen hatte und auf dessen Rückkehr sie alle schon seit Wochen warteten. Oder er selbst; wenngleich seine eigenen magischen Kräfte eher bescheiden zu nennen waren.
Nein – Nizar war nicht das Problem. Spätestens nach Bruder de la Croix’ Rückkehr aus Paris konnten sie ihn zertreten wie einen Wurm.
Das Problem war, dass sie nicht so viel Zeit hatten.
Es hatte Jahre gedauert, den neuen Standort der Teufelsrose zu finden, und niemand wusste zu sagen, wie lange sie in jenem Wüstental drei Tagesritte nördlich von hier bleiben würde. Und ein Angriff ohne das Auge des Satans würde vielleicht – nur vielleicht – erfolgreich sein, aber ungeheure Opfer fordern.
»Nun, Bruder Guillaume?«
Renards Stimme riss den Templer jäh in die Wirklichkeit zurück. Er sah auf, blinzelte einen Moment gegen die Sonne in das schmale Gesicht Renards hinauf und beschattete die Augen mit der Hand.
»Woran denkst du?«, fragte Renard. »An Bruder Philippe?«
Guillaume lächelte flüchtig. »Nun«, sagte er. »Er wird nicht sehr erbaut sein, wenn wir mit leeren Händen zurückkommen.«
»Hättest du mich nicht zurückgehalten …«, begann Renard, wurde aber von Guillaume unterbrochen:
»… wären wir jetzt alle tot, und zwischen Nizar und unseren Brüdern würde Krieg herrschen.«
Renard spie aus. »Unsinn. Dieser Heide hätte es nicht gewagt, die Hand gegen einen Tempelherrn zu erheben.«
»Er nicht, aber seine Krieger bestimmt«, murmelte Guillaume. Aber dann lächelte er traurig. »Nein, Bruder, das ist es auch gar nicht, was mir Sorge bereitet. Philippe wird vielleicht zornig sein, aber er beruhigt sich auch wieder. Ich denke an unsere Brüder, die fallen werden, wenn wir die Teufelsrose ohne Bruder de la Croix’ Unterstützung angreifen müssen. Und ohne das Auge.«
»Wenn sie fallen, dann für Gott den Herrn«, sagte Renard überzeugt.
Guillaume blickte ihn stirnrunzelnd an. »Ich halte ein Leben für den Herrn für sinnvoller, Bruder«, sagte er ernst. »Wir brauchen das Auge des Satans. Schon, um es nach getaner Arbeit zu vernichten. Es ist ein Werk des Teufels, das nicht sein darf.«
»Dann lass es uns holen.« Renard griff schon wieder zum Schwert. »Reiten wir zurück und erschlagen Nizar.«
»Wir kämen nicht einmal in seine Nähe«, murmelte Guillaume. »Nein, Bruder – er ist gewarnt und wird vorsichtig sein. Wir müssen einen … einen anderen Weg finden.«
Renard erbleichte, denn er begriff sehr wohl, was die Worte Guillaumes zu bedeuten hatten. Und auch Guillaume erschrak über seinen eigenen Vorschlag, denn er hatte ihn ausgesprochen, ohne darüber nachzudenken. Die Worte waren wie von selbst über seine Lippen gekommen. Fast, dachte er schaudernd, als hätte sie ihm jemand eingeflüstert …
»Die … die Schwarze Stadt?«, flüsterte Renard.
Guillaume nickte. »Die Schwarze Stadt.«
»Das ist Ketzerei«, murmelte Renard.
»Unsinn!« Guillaume drehte sich zornig herum und ballte die Faust. »Auch das Auge des Satans ist Teufelswerk, und trotzdem werden wir es benutzen, um das Böse damit zu vernichten. Wir haben keine andere Wahl.«
»Und unsere Seelen?«, fragte Renard.
Diesmal dauerte es länger, bis Guillaume antwortete. »Sie werden keinen Schaden nehmen«, sagte er. »Ich nehme euch die Beichte ab, ehe wir aufbrechen, und werde euch die Absolution erteilen.«
»Wir.« Renard nickte. »Und du?«
»Ich fürchte den Teufel nicht«, erklärte Guillaume überzeugter, als er sich bei diesen Worten fühlte. »Und selbst, wenn ich ihm anheimfallen sollte, so opfere ich mich gerne für das Leben unserer Brüder.«
Renard antwortete nicht mehr.
Aber weniger als eine halbe Stunde später ritten die drei Tempelritter, nun wieder voll gerüstet, weiter.
Ziemlich genau in die entgegengesetzte Richtung, in die sie ihr Weg eigentlich führen sollte.
Nämlich direkt in die Wüste hinein.
Nach einem etwa einstündigen Marsch durch die Wüste erreichten wir das Lager, das aus nur einer Hand voll schmuckloser Militärzelte bestand, die sich im Schatten einiger Palmen drängten. Eine Anzahl Soldaten, die wohl als Wache zurückgeblieben waren, kam uns entgegen, verfolgt von einer lärmenden Horde neugieriger Araber in schreiend bunten Kleidern, die ebenso neugierig wie die Highlander, aber weit weniger zurückhaltend waren, denn sie begannen sofort, den fremden Inglese mit dem sonderbaren Haar anzustarren und zu begrabschen und an seinen Kleidern zu zupfen, bis McFarlane mit einem urgewaltigen Brüllen dafür sorgte, dass ich wenigstens genug Platz zum Atmen behielt. Zu meiner Überraschung gewahrte ich sogar eine junge, sichtlich englische Lady, die jedoch am Rand der Oase zurückblieb und uns mit geziemlicher Zurückhaltung, aber eindeutig erwartungsvoll entgegensah.
Die geordnete Formation, in der wir bisher marschiert waren, löste sich fast augenblicklich auf, kaum dass wir das Lager erreichten. Ich hielt nach dem Offizier Ausschau, der – wie ich von McFarlane erfahren hatte – auf den guten alten englischen Namen Cedric Harold Lucius Mandon Trouwne hörte und im Range eines Colonels stand, konnte ihn aber in dem allgemeinen Durcheinander nicht ausmachen. Das Chaos hielt aber nur wenige Augenblicke an, ehe es von einem zornigen Befehl McFarlanes beendet wurde. Die Hast, mit der die Soldaten Haltung annahmen, bestärkte mich in meiner Überzeugung, dass McFarlane zu mehr Dingen fähig war als zu schreien. Auch wenn er das zweifellos am besten konnte.
Trouwne sprengte auf seinem Hengst heran und zügelte das nervöse Tier neben dem Sergeanten. »McFarlane! Lassen Sie die verdammte Kompanie in das Lager einrücken. Und dann sorgen Sie verdammt noch mal dafür, dass Mister Craven mit ordentlicher Kleidung versorgt wird und einen Platz in einem Zelt erhält!«
Der Sergeant schlug knallend die Hacken zusammen und legte die Hand an den weißen Tropenhelm.
»Verstanden, Sir. Kompanie einrücken lassen und Mister Craven versorgen!« Er drehte sich mit einer eckigen Bewegung um und bellte seine Befehle über die Truppe, etwas gerafft, dafür aber drei Mal so laut wie Trouwne zuvor. Innerhalb weniger Augenblicke hatten sich die Soldaten zwischen den Zelten verteilt und ihre Gewehre zu ordentlichen Pyramiden zusammengestellt.
»Verdammt gut, McFarlane«, sagte Trouwne von der Höhe seines Pferdes herab. »Mister Craven, ich erwarte Sie in einer verdammten Stunde in meinem Zelt zum Dinner!« Er deutete ein Nicken an, riss sein Pferd auf der Stelle herum und hätte dabei um ein Haar McFarlane über den Haufen geritten.
Sein Ziel war die junge englische Lady, die noch immer fast reglos an ihrem Platz unter der Palme stand, mich noch immer von Kopf bis Fuß musterte und dabei ungeduldig ihren Sonnenschirm kreisen ließ. Sie blickte mir noch nach, als der Colonel längst abgestiegen war und sein Pferd einem Diener übergeben hatte. Ich sah noch, wie sie heftig auf ihn einzureden begann, dann baute sich McFarlane vor mir auf.
»Mitkommen!«, brüllte er, in einer Tonlage, die er wohl für ein Flüstern hielt.
Eine Stunde später war ich unterwegs zum Zelt des Colonels. Ich war von einem arabischen Diener, der für die Kompanie als Barbier arbeitete, frisch rasiert und mit Rosenwasser einbalsamiert worden; außerdem hatte McFarlane das seiner Ansicht nach Beste geleistet und mir seine Reserveuniform ausgeborgt. Meine eigene Kleidung befand sich nämlich in einem Zustand, der ein Erscheinen vor den Augen einer Dame nicht mehr zuließ.





























