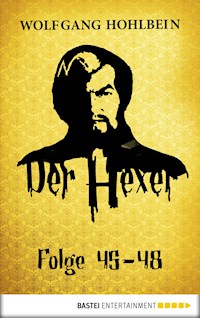
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Das Hirn von London" - Folge 45 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Das Heulen des Windes klang wie das Wehklagen verfluchter Seelen, für immer den schrecklichen Qualen des Höllenfeuers ausgesetzt. Der Sand, vom Sturm hochgewirbelt und tanzend wie ein Schwarm aufgeschreckter Insekten, legte sich einem Schleier gleich vor das rote Auge der sinkenden Sonne und ließ die Wüste grau und düster erscheinen. Dennoch war es nicht dunkel genug, um die Verfolger von ihrer Spur abzubringen. Im Gegenteil: Näher und näher kamen sie heran, unbeugsame Entschlossenheit in den harten Gesichtern und den Tod im Blick...
"In der Festung des Dschinn" - Folge 46 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Rot- Alles hier war rot. Angefangen von den schweren Brokatvorhängen, die die Wände bedeckten, über die polierten Bodenplatten bis hin zu dem Kissen, auf das die Krieger Scheik Achmed gestoßen hatten. Und auch der Stoffbezug des vor ihm stehenden Thrones war rot, in allen nur dehnbaren Schattierungen und Tönen. Es war die Farbe Nizars. Die Farbe des frischen Blutes.
"Das Auge des Satans" - Folge 47 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Die Gesichter der Männer waren verzerrt vor Wut. Die Wüste hallte wider von ihren schrillen, überschnappenden Schreien, dem rasenden Stakkato der Pferdehufe und dem unablässigen Peitschen der Schüsse. Sie waren noch zu weit entfernt, und auf den bockenden Pferde- und Kamelrücken war ein Zielen so gut wie unmöglich, so dass nur dann und wann eine verirrte Kugel in unserer unmittelbaren Nähe in den Boden einschlug oder gegen einen Felsen klatschte, um als heulender Querschläger abzuprallen. Aber sie kamen näher. Unaufhaltsam.
"Die Rache des Schwertes" - Folge 48 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Das Licht blendete mich; gleichzeitig drang es durch meine Haut, sickerte wie flüssiges Feuer in meinen Körper und begann ihn zu verzehren. Obwohl ich fühlte, dass dieses Licht einst ein Teil meiner selbst, etwas Vertrautes und Freundschaftliches gewesen war, brannte es jetzt unerträglich: die Kraft, die es mir einst gegeben hatte, verzehrte mich nun. Schreiend wälzte ich mich herum und versuchte, das Feuer mit meinen Händen zu ersticken. Aber sie glitten durch die Flammen, ohne sie fassen zu können. Waren es überhaupt Hände?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Das Hirn von London
Der Hexer – In der Festung des Dschinn
Der Hexer – Das Auge des Satans
Der Hexer – Die Rache des Schwertes
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 45-48:
Der Hexer – Das Hirn von London
Der Hexer – In der Festung des Dschinn
Der Hexer – Das Auge des Satans
Der Hexer – Die Rache des Schwertes
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 45–48
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1579-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 45
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Hier das Vorwort zu Band 45.
Manchmal gelingt es einzelnen Personen aus Romanen oder Filmen, solche Bekanntheit zu erlangen, dass sie zum Inbegriff einer ganzen Gattung werden und dieser ihren Stempel aufdrücken. Lange Zeit war beispielsweise Mr. Spock der mit Abstand berühmteste Außerirdische, bei einem abenteuerlustigen Archäologen kommt einem automatisch Indiana Jones in den Sinn, bei einem Vampir denkt man sofort an Dracula – und wer verbindet den Begriff des Detektivs nicht unwillkürlich mit dem wohl berühmtesten Vertreter seiner Gattung, dem von Sir Arthur Conan Doyle geschaffenen Meisterdetektiv Sherlock Holmes?
Noch heute besitzt Holmes weltweit eine riesige Anhängerschaft, und viele glauben, dass ihr Idol wirklich gelebt hat. An seine Adresse, die Baker Street 221b in London, werden sogar noch immer zahlreiche Briefe geschrieben, in denen Menschen ihn um Rat und Hilfe bitten.
In diesem Buch trifft auch Robert Craven auf den Meisterdetektiv und hilft diesem, den Kriminalfall um den Hund von Baskerville zu lösen – ein klein wenig anders, als es Conan Doyle in seinem bekannten Buch beschrieben hat. Grund genug, sowohl Holmes wie auch seinen Schöpfer kurz vorzustellen.
Doyle wurde am 22. Mai 1859 in Edinburgh geboren. In jungen Jahren schlug er die Laufbahn des Mediziners ein, widmete sich dann aber ab 1891 ausschließlich der Schriftstellerei. Außerdem war er sogar einmal Boxmeister von England und ein erfolgreicher Amateur-Kriminologe, der viele Fälle unschuldig Verurteilter wieder aufgriff und den Betroffenen zu ihrem späten Recht verhalf. Die Polizei verdankt Doyle etliche moderne Untersuchungsmethoden, zum Beispiel das Ausgießen von Fußabdrücken mit Gips. Die Geschichten um Sherlock Holmes waren sein mit Abstand größter Erfolg, doch schrieb er auch andere Romane und Storys, von denen vor allem »Die vergessene Welt« eine gewisse Popularität erlangte. Sir Arthur Conan Doyle verstarb am 7. Juli 1930 in Crowborough.
Seiner literarischen Schöpfung dichtete er jedoch ein beinahe biblisches Alter an. Laut Doyle wurde Holmes am 6. Januar 1854 in Nord-Yorkshire geboren und starb erst am 6. Januar 1957 – nach 103 Jahren. Beinahe hätte es ihn jedoch schon früher erwischt: Seiner Figur allmählich überdrüssig, ließ Doyle den Detektiv am 4. Mai 1891 zusammen mit seinem Erzfeind, dem verbrecherischen Professor Moriarty, in die reißenden Fluten der Reichenbachfälle im schweizerischen Bergdorf Meieringen stürzen.
Das Echo der Leserschaft war unbeschreiblich: Demonstrationen vor Doyles Haus und dem Verlag, böse Briefe und Drohungen und immer wieder die Forderung: »Gib uns Sherlock Holmes zurück!« Sogar seine eigene Mutter schrieb an Doyle: »Du Bestie, wie konntest du das tun?« Schließlich gab Doyle nach, Holmes tauchte wieder aus den Fluten auf, und der Siegeszug des Meisterdetektivs fand seinen Fortgang.
Unverkennbare Kennzeichen Holmes’ waren seine Deerstalker-Mütze und die Shag-Pfeife; den langen, karierten Mantel trug er hingegen lediglich auf Landpartien. Er spielte mit Leidenschaft Violine und schnupfte und spritzte aus Langeweile zwischen seinen Fällen Kokain.
Begleitet wurde er von seinem Freund und Assistenten Dr. John H. Watson. Dieser schlug – wie Doyle selbst – die Laufbahn des Mediziners ein, war als Militärarzt in Afghanistan und zog sich dort eine schwere Verletzung zu. Nachdem er sich in späteren Jahren von Holmes getrennt hatte, führte er eine eigene Arztpraxis in London. Er war zweimal verheiratet, während Holmes sein Leben lang ledig blieb.
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 45Das Hirn von London
Das Heulen des Windes klang wie das Wehklagen verfluchter Seelen, für immer den schrecklichen Qualen des Höllenfeuers ausgesetzt. Der Sand, vom Sturm hochgewirbelt und tanzend wie ein Schwarm aufgeschreckter Insekten, legte sich einem Schleier gleich vor das rote Auge der sinkenden Sonne und ließ die Wüste grau und düster erscheinen.
Dennoch war es nicht dunkel genug, um die Verfolger von ihrer Spur abzubringen. Im Gegenteil: Näher und näher kamen sie heran, unbeugsame Entschlossenheit in den harten Gesichtern und den Tod im Blick …
Während er sein Pferd antrieb, wandte Henry Baskerville immer wieder den Kopf und versuchte den Abstand abzuschätzen, der ihn und seinen arabischen Diener Chalef noch von den Dharan trennte. Es war nicht eigentlich Furcht oder gar Todesangst, die ihn erfüllten, wohl aber doch mehr als einfaches Unbehagen. Mit diesen Söhnen der Wüste war nicht zu spaßen, und sofern er Chalef glauben durfte, war sein Leben ernsthaft in Gefahr, wenn er den Beduinen in die Hände fiel.
Und warum? Wäre die Situation nicht so ernst gewesen, hätte er gelacht, wenn er an das »Verbrechen«, dachte, das er begangen hatte. Getrieben von nichts anderem als der neugierigen Wissbegierde eines Forschungsreisenden, hatte er im Nomadenlager der Beduinen ein Frauenzelt betreten, um die Schönen des Stammes einmal in unverschleiertem Zustand betrachten und studieren zu können. Dass dieses für ihn als aufgeklärten Europäer des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts völlig harmlose Tun in den Augen der Araber einer gar schändlichen und unverzeihlichen Untat entsprach, war ihm erst in dem Augenblick bewusst geworden, in dem mehrere Beduinenkrieger mit unverblümter Mordlust im Blick auf ihn losgingen. Nur die überstürzte Flucht aus dem Nomadenlager hatte ihn davor bewahrt, gleich an Ort und Stelle umgebracht zu werden.
Aber mit der Flucht allein war die Angelegenheit leider nicht aus der Welt geschafft – ganz und gar nicht. Der halbe Stamm war hinter ihm her.
Mindestens.
»Wenn … uns … werden sie … töten!«
Die Worte Chalefs, der mit verbissenem, von Furcht geprägtem Gesicht an seiner Seite ritt, wurden halb vom Heulen des Windes verschluckt, ließen jedoch an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Und langsam fing Henry Baskerville an, die Unkenrufe seines Dieners ernst zu nehmen. Als Einheimischer kannte sich Chalef mit den Sitten und Gebräuchen des Landes aus. Er wusste wohl, was er sagte. Und die Hartnäckigkeit der Dharan, die trotz des immer heftiger werdenden Sandsturmes offenbar nicht im Traum daran dachten, die Verfolgung aufzugeben, sprach für sich.
Henry Baskerville stieß einen Fluch aus und griff nach dem Gewehr, das im Sattelholster seines Pferdes steckte. Er entsicherte die Waffe, wandte abermals den Blick und feuerte dicht hintereinander mehrere Schüsse ab. Natürlich bestand nicht die geringste Chance, einen der Verfolger zu treffen, aber das war auch gar nicht seine Absicht. Er wollte die Beduinenkrieger erschrecken, nicht verletzen oder gar töten.
Aber seine schwache Hoffnung, die Dharan einschüchtern zu können, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil. Die Schüsse schienen die Beduinen nur noch zorniger zu machen. Fernes Wutgebrüll, so laut, dass es selbst das Heulen des Windes übertönte, erscholl als Antwort auf seine Salve. Und die verschwommenen Silhouetten der Beduinen schienen wieder ein bisschen größer zu werden. Baskerville steckte die Waffe ins Holster zurück und konzentrierte sich darauf, sein Pferd zu noch schnellerem Galopp anzutreiben. Chalef hatte Mühe, nicht den Anschluss an seinen Herrn zu verlieren.
Trotz allen Bemühens jedoch, trotz des wütenden Sturms, trotz des dunkler und dunkler werdenden Himmels, schmolz sein Abstand zu den Verfolgern zusehends. Inzwischen waren sie so nahe herangekommen, dass eine Gewehrkugel jetzt vielleicht doch Aussichten gehabt hätte, ihr Ziel zu treffen. Dennoch machte Henry Baskerville keine Anstalten, abermals nach dem Gewehr zu greifen. Auch wenn er möglicherweise sein Leben aufs Spiel setzte, widerstrebte es ihm zutiefst, auf Männer zu schießen, die letzten Endes nur den Gesetzen ihrer Kultur gehorchten.
Die Dharan machten allerdings ebenfalls keinen Gebrauch von ihren Feuerwaffen. Ein gutes Zeichen? Wohl eher ein böses, dachte Baskerville düster. Offenbar wollten ihn die Beduinen lebend in die Hände bekommen. Und was sie dann mit ihm anstellen würden …
Er beugte sich tief über den Hals seines Reittiers, um dem Wind möglichst wenig Widerstand entgegenzusetzen und das Fortkommen zu verbessern.
Aber es war aussichtslos. Die Wüstensöhne hatten anscheinend die besseren Pferde und waren fraglos auch die besseren Reiter. Dichter und dichter schlossen sie auf. Schon war deutlich ihr heiseres Triumphgeschrei zu vernehmen. Sie wähnten sich ihres Opfers völlig sicher.
Noch zehn Pferdelängen, acht, sechs, vier …
Henry Baskerville war schon im Begriff, sein Reittier zu zügeln und schlichtweg aufzugeben, als es geschah.
Plötzlich zuckte ein gleißender Blitz nieder, begleitet von einem krachenden Donnerschlag, der den Männern fast die Trommelfelle platzen ließ, und schlug genau in der Mitte zwischen Verfolgern und Verfolgten in den Wüstensand ein. Doch es war kein Blitz, wie er bei einem normalen Gewitter vorkam – ein solches hatte den Sandsturm auch gar nicht begleitet. Es war ein Blitz, wie er weder Henry Baskerville und Chalef noch den Beduinen jemals vor Augen gekommen war. Grell zwar und schmerzhaft für die Netzhaut des menschlichen Auges, aber nicht lichtweiß, sondern von einem krankhaft leuchtenden Rot, das unwillkürlich an … Blut denken ließ. Und er ließ in seiner gleißenden Säule scharf umrissene Konturen erkennen!
Die Gestalt eines tanzenden Derwischs, eines Dschinns oder eines rächenden Engels.
Sekundenlang hing der geheimnisvolle Blitz wie zu Eis erstarrt zwischen Himmel und Erde. Die Pferde der Beduinenkrieger bäumten sich auf, als seien sie gegen eine Wand geprallt, und mehr als eines warf seinen Reiter ab und ging schlichtweg durch. Die Dharan, nicht weniger erschrocken als ihre Reittiere, zerrten heftig an den Zügeln, rissen die Pferde herum und jagten in wilder Flucht in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren. Sie schienen Baskerville und seinen Diener völlig vergessen zu haben.
Die grellroten Linien des Blitzes verblassten. Und fast so, als ob das Verschwinden der Leuchterscheinung ein geheimes Zeichen an die Natur gewesen wäre, kam auch der Sturm zum Erliegen. Die hochgepeitschten Sandkörner sanken zu Boden, mit einem Male ihrer Kraft beraubt, das Heulen des Winds wurde zu einem Säuseln, der Schleier vor der untergehenden Sonne zerriss. Plötzlich lag eine friedvolle Wüste im sanften Abendrot vor Henry Baskerville und seinem Diener.
Die beiden brauchten eine ganze Weile, um sich von dem Schock zu erholen. Chalef war der Erste, der wieder Worte fand.
»Allah hat uns gerettet«, sagte er und deutete zum Himmel hinauf. »Er hat uns einen Dschinn gesandt, um die Dharan zu vertreiben.«
»Einen Dschinn?«, wiederholte Baskerville verwirrt. »Nun, ich würde eher sagen, dass es ein guter Engel war.« Dann erst kam ihm richtig zu Bewusstsein, was er da von sich gegeben hatte, und er lachte laut auf.
Dschinns?
Engel?
Er glaubte weder an das eine noch an das andere. Er war ein nüchterner, aufgeklärter Mensch, der mit beiden Füßen fest auf dem Boden der Tatsachen stand. Für übernatürliche Dinge war in seinem Denken kein Platz. Sie gehörten in den Bereich von Ammenmärchen, Aberglauben und krankhafter Einbildung.
»Alles Unsinn«, sagte er. »Es war ein Blitz, sonst gar nichts!«
Chalef schüttelte heftig den Kopf. »Kein Blitz! Die riesenhafte Gestalt, die wir gesehen haben …«
»Eine Luftspiegelung«, erklärte Baskerville überzeugt. »So etwas wie eine Fata Morgana. Schließlich befinden wir uns in der Wüste, nicht wahr?«
»Das war keine Fata Morgana«, widersprach Chalef. »Ich habe schon mehr als eine gesehen. Und wie ist es zu erklären, dass der Sturm so plötzlich abbrach? Eine höhere Macht hat ihm Einhalt geboten!«
»Jeder Sturm geht einmal zu Ende.«
»Aber nicht von einem Augenblick zum anderen«, beharrte Chalef im Brustton der Überzeugung. »Nur eine höhere Macht …«
»Allah!« Baskerville grinste.
Chalef erwiderte das Grinsen nicht. Im Gegenteil; er wurde noch ernster und nickte nur bekräftigend.
Henry Baskerville verspürte keine Neigung, die fruchtlose Diskussion fortzusetzen. Er kannte seinen Diener gut genug, um zu wissen, dass er den braven Burschen doch nicht überzeugen konnte. Chalef war so abergläubisch wie eine irische Waschfrau.
»In Ordnung«, sagte er deshalb. »Danken wir also Allah für unsere wundersame Rettung vor dem heiligen und gerechten Zorn der Wüstenkrieger.«
Und vor diesem Zorn waren sie in der Tat jetzt sicher. Die Dharan hatten sich in ihrer Panik so schnell davongemacht, dass sie längst am Horizont verschwunden waren. Nichts sprach dafür, dass sie ihren Sinn noch ändern und zurückkommen würden.
Erst jetzt wurde sich Henry Baskerville bewusst, dass ihn die wilde Hetzjagd viel von seiner Kraft gekostet hatte. Auch die Pferde ließen erschöpft die Köpfe hängen, flockiger Schaum stand vor ihren Nüstern. Ihnen allen konnte eine Rast nur guttun. Außerdem würde es jetzt sehr schnell dunkel werden. Und mit der Dunkelheit kam die Kälte, die in der Wüste auf sehr unangenehme Grade fallen konnte. Henry Baskerville richtete sich kurz im Sattel auf und ließ seinen Blick über die endlose Weite schweifen.
»Wie weit ist es bis zum nächsten Wasserloch?«, fragte er seinen Diener.
»Mehrere Stunden«, antwortete Chalef sofort. Baskerville sah ihn kritisch an; die Antwort kam ihm etwas zu schnell. Aber er hatte keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Chalef kannte sich in der Arabischen Wüste bestens aus, das hatte er schon des Öfteren bewiesen.
»Schön«, sagte Baskerville. »Weiterreiten hat also keinen Sinn. Bleiben wir gleich an Ort und Stelle und suchen uns einen Platz für das Nachtlager.«
Er war nicht einmal undankbar dafür, dass die nächste Wasserstelle außer Reichweite lag. Man konnte nie wissen, welches Gesindel sich nachts an diesen Lebensadern der Wüste einfand und wonach ihm der Sinn stand. Da sie jedoch ihre Wasservorräte im Zeltdorf der Dharan aufgefüllt hatten, würden sie in dieser Beziehung keinen Mangel leiden müssen.
Chalef erhob keine Einwände gegen Baskervilles Vorschlag. Auch er war davon überzeugt, dass von Seiten der Beduinen keine Gefahr mehr drohte. Mit erhobener Hand deutete er zu einer Düne hinüber, die kaum hundert Yards entfernt lag.
Wenig später hatten die beiden Männer den Fuß der Düne erreicht und stiegen aus den Sätteln. Während Baskerville daran ging, die Pferde aus einem der mitgeführten Wasserschläuche zu tränken, begann Chalef das Zelt aufzubauen. Der arabische Diener hatte noch nicht die zweite Zeltstange in den Wüstensand gerammt, als er einen kurzen, Angst erfüllten Schrei ausstieß.
Baskerville hob den Kopf und blickte zu ihm hinüber. Chalef stand da wie zur Salzsäule erstarrt. Mit weit aufgerissenen Augen und einem Gesichtsausdruck, in dem sich alle Schrecken dieser Welt widerspiegelten, starrte er auf den Boden zu seinen Füßen.
»Was ist passiert?«, fragte Baskerville.
Chalefs Mund bewegte sich, aber es kamen nur unartikulierte Töne hervor, Laute eines Entsetzens, das sich nicht in Worte kleiden ließ.
Aufs Höchste alarmiert, wandte sich Henry Baskerville von den beiden Pferden ab und trat an die Seite seines arabischen Dieners. Weitere Fragen waren überflüssig. Er sah mit eigenen Augen, was Chalef so entsetzt hatte. Und er musste zugeben, dass auch ihn selbst ein eiskalter Schauder überlief.
Vor ihm lag, halb vom Wüstensand begraben, ein Mensch. Er war tot, schon seit langer, langer Zeit. Ganz offensichtlich hatte er all die Jahre über völlig vom Sand bedeckt dagelegen und war erst jetzt durch den Sturm wieder ans Tageslicht gebracht worden. Die Sandschichten hatten seinen Körper völlig mumifiziert, sodass er aussah wie gegerbtes Leder oder Pergament. Dennoch ließ sein verschrumpeltes Gesicht auch jetzt noch einen Ausdruck erkennen, der dem Chalefs auf erschreckende Weise ähnlich sah: Entsetzen, Schrecken und Todesangst hatten sich in seine vertrockneten Züge gegraben.
Der Mann war ermordet worden. Ein Pfeil hatte seinen Hals durchbohrt und seinem Leben ein Ende gesetzt.
Henry Baskerville kratzte sich nachdenklich am Kinn, als er auf den Toten hinabblickte. Der Mann war kein Araber gewesen, sondern ganz eindeutig ein Europäer, doch seine Kleidung war so bizarr, dass Baskerville sich zu dieser Schlussfolgerung nur mühsam durchringen konnte. Er trug einen weißen, weit geschnittenen Umhang, auf dessen Brustteil ein rotes, gleichschenkliges Balkenkreuz prangte. Auf dem Kopf trug er einen metallenen Helm und in einer Scheide an seiner Seite steckte ein Schwert. Baskerville war ein gebildeter und belesener Mensch, und nach den ersten Sekunden der Verwirrung dämmerte es ihm, wen er hier vor sich hatte.
Der Tote war ein Templer. Ein Angehöriger jenes sagenumwobenen geistlichen Ritterordens, den die Kreuzfahrer Anfang des zwölften Jahrhunderts gegründet hatten.
Eine gewisse Ehrfurcht überkam Henry Baskerville, als er sich bewusst wurde, dass der ehemalige Tempelherr wahrscheinlich seit mehr als achthundert Jahren hier lag, in seinem sandigen Grab gefangen …
Er sah auf und wandte sich wieder an Chalef, der den Toten nach wie vor mit starrem Blick und offenkundigem Entsetzen betrachtete. Fast so, fuhr es Baskerville durch den Sinn, als befürchte er, der Templer könne jeden Augenblick von den Toten auferstehen und ihm an die Gurgel fahren.
»Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte er. »Der Mann ist seit vielen Jahrhunderten tot.«
»Seit vielen Jahrhunderten?«, wiederholte Chalef fast tonlos. Dann schüttelte er bedächtig den Kopf. »Nein, er ist vielleicht erst vor wenigen Tagen oder …« Er brach ab und blickte sich gehetzt nach allen Seiten um, wobei sich der angstvolle Ausdruck in seinen Zügen noch verstärkte.
Henry Baskerville lachte. Erst jetzt wurde ihm klar, dass sein Diener keine Furcht vor dem Toten hatte, sondern vor demjenigen, der den Templer einst ermordet hatte. Dass dieser Mörder ebenfalls schon vor Jahrhunderten das Zeitliche gesegnet haben musste, begriff er in seiner Einfalt gar nicht.
»Ja, pass nur gut auf«, spottete Baskerville, noch immer lachend. »Vielleicht sitzt der Killer … da oben?« Er deutete zum Gipfel der Düne empor, die gut dreißig Yards in die Höhe ragte.
Chalef folgte dem Blick seines ausgestreckten Zeigefingers. Offenbar hielt er es tatsächlich für möglich, dass dort oben jemand lauerte, der seinen Pfeil schon auf die Bogensehne gelegt hatte und bereit war, ihn jeden Augenblick losschnellen zu lassen.
Baskerville achtete nicht weiter auf seinen Diener. Der Tempelherr interessierte ihn im Augenblick ungleich mehr. Er ging in die Knie und beugte sich zu dem mumifizierten Gesicht des Toten herab. Natürlich war kein Leichengeruch wahrzunehmen, was er nach achthundert Jahren wohl auch kaum erwarten konnte. Er wagte nicht, den Leichnam zu berühren. Nicht etwa, weil er Ekel oder gar Angst davor verspürt hätte. Nein, seine Bedenken waren rein wissenschaftlicher Natur. Er konnte nicht ausschließen, dass der Mumifizierte bei einer Berührung zu Staub zerfiel. Und das wäre ihm wie ein Sakrileg erschienen. Seit unvorstellbar langer Zeit hatte der Tempelritter körperlich nahezu unversehrt hier im Wüstensand geruht und Baskerville wollte nicht die Ursache dafür sein, dass dieser Zustand ein so abruptes Ende fand. Dennoch drängte es ihn danach, irgendetwas von dem Toten in seinen Besitz zu bringen, diesmal allerdings nicht so sehr aus wissenschaftlicher Neugier, sondern mehr aus dem Wunsch heraus, ein Souvenir zu bekommen, das ihn nach der Rückkehr in sein Heimatland England an diese ungewöhnliche Begegnung erinnern würde.
Von den furchtsamen Blicken Chalefs begleitet, streckte er die rechte Hand aus, um nach dem Schwert des Templers zu greifen. Wenn es ihm gelang, die Klinge ganz vorsichtig aus der Scheide zu ziehen …
Schnell merkte er, dass das Schwert festsaß. Er würde Gewalt anwenden müssen, um es aus der Scheide zu lösen, und den Toten dabei letzten Endes wohl doch in ein Häufchen Staub verwandeln. Er ließ von der Waffe ab und überlegte noch, ob er das Risiko eingehen sollte, als sein Blick auf einen kleinen, eigenartig geformten Gegenstand fiel, der halb unter dem Umhang des Tempelherren verborgen lag. Ohne zu zögern griff Baskerville nach dem Ding und zog es unter dem brüchigen Stoff hervor.
Es war eine … Rose! Eine Rose aus Sand!
Verblüfft zog Henry Baskerville die Augenbrauen hoch. Was für eine seltsame Laune der Natur war dies? Wie hielt die Rose zusammen? Als er sie in die Hand nahm, hätte sie zwischen seinen Fingern zerbröckeln müssen. Aber davon konnte keine Rede sein. Obgleich er keinen Moment daran zweifelte, dass sie tatsächlich aus purem Wüstensand bestand, war ihre Struktur so fest gefügt, als würde es sich bei dem Material um soliden Fels handeln. Und als Baskerville die Rose mit aller Kraft zusammenpressen wollte, stöhnte er vor ungläubiger Überraschung auf. Die Form des Objekts veränderte sich nicht um den Bruchteil eines Zolls! Allenfalls seine Finger schmerzten – ganz so, als habe ihn die Rose gestochen.
Baskerville wandte sich seinem Diener zu. »Chalef, hast du eine Ahnung, was es mit diesem Ding hier auf sich hat?« Er hielt dem Araber die Sandrose hin.
Chalef zuckte zurück, als würde ihm eine hochgiftige Viper entgegenzüngeln. Die Angst in seinen Zügen schien sich noch zu steigern. Er murmelte etwas Unverständliches vor sich hin und machte mit der Hand eine Gebärde, die wohl sinngemäß dem Kreuzzeichen eines Christen entsprach.
»Was?«, fragte Henry Baskerville leicht gereizt. Die völlig unbegründete Furcht seines Dieners ging ihm langsam aber sicher auf die Nerven.
»Sill el Mot«, flüsterte Chalef.
»Sill el … was?«
»Sill el Mot«, wiederholte Chalef nur. Er schien sich nicht weiter über dieses Thema auslassen zu wollen.
Die Arabischkenntnisse Baskervilles waren ziemlich unterentwickelt. Nicht zuletzt aus diesem Grund hatte er ja auf die Dienste eines einheimischen Dieners zurückgreifen müssen. Mit dem Begriff »Sill el Mot« konnte er nicht das Geringste anfangen.
»Wer oder was soll das sein?«, erkundigte er sich.
Wieder murmelte Chalef etwas vor sich hin, das unverständlich blieb. Und Henry Baskerville war eigentlich auch gar nicht mehr interessiert daran, was sein Diener da zum Besten gab. Die Angst Chalefs, die nur von albernem Aberglauben genährt werden konnte, ärgerte ihn über alle Maßen.
»Bau das Zelt weiter auf«, wies er den Araber mit scharfer Stimme an, steckte die geheimnisvolle Sandrose in die Tasche und ging dann wieder zu den Pferden hinüber, um sie weiter zu tränken.
Eine gute halbe Stunde später hatten die beiden Männer ihr Abendessen verzehrt und sich im Zelt zum Schlafen niedergelegt. Was nicht etwa bedeutete dass sie wirklich hätten einschlafen können. Baskerville hörte, wie sich Chalef unruhig auf seiner Decke hin und her warf, glaubte ein paar Mal sogar ein Zähneklappern seines Dieners wahrnehmen zu können. Doch auch er, das musste er sich selbst widerwillig eingestehen, fühlte sich mittlerweile unbehaglich. Immer wieder kreisten seine Gedanken um den toten Tempelritter draußen vor dem Zelt. Und um den geheimnisvollen roten Blitz. Wenn er recht darüber nachdachte, musste er zwangsläufig zu der Erkenntnis gelangen, dass er und Chalef ohne diesen Blitz niemals auf den mumifizierten Leichnam gestoßen wären. So albern er auch war – der Gedanke, dass vielleicht doch eine höhere Macht am Werk gewesen war, wurde für Henry Baskerville zur fixen Idee.
Schließlich, nach Stunden unruhigen Wachens, glitt er doch noch in die dunklen Gefilde des Schlafes hinab. Aber auch noch im Halbschlaf wurde er die Vorstellung nicht los, dass ihn die toten Augen des Templers durch die Zeltwände hindurch drohend anstarrten.
London machte seinem schlechten Ruf wieder einmal alle Ehre. Der Himmel hatte all seine Schleusen geöffnet. Es goss zwar nicht in Strömen, wohl aber in Form jenes penetranten Nieselregens, der einem das ständige Gefühl gab, unversehens in ein klebriges, kühles Dampfbad geraten zu sein. Nebelschwaden trieben durch die Straßen und ließen Passanten und Pferdekutschen zu huschenden grauen Schemen werden. Düstere Wolken verbannten den Gedanken, dass es so etwas wie eine Sonne überhaupt gab, ins Reich der Legende.
Warum es mich ausgerechnet an diesem unfreundlichen Tag aus meinem Haus am Ashton Place getrieben hatte, wusste ich selbst nicht. Wahrscheinlich hatten die Geschehnisse der letzten Woche nicht gerade dazu beigetragen, Andara-House in mein Herz zu schließen. Obgleich das Haus mir das Leben gerettet hatte, war ich von dem Gedanken beseelt, seine düsteren Mauern für einige Zeit zu verlassen und durch die Straßen zu wandern.
London ist eine riesige Stadt. Ich lebte noch nicht lange genug hier, um jederzeit auf Anhieb sagen zu können, in welchem Teil der Millionenstadt ich mich befand. Ich hatte mich allein vom Zufall und meinen Füßen leiten lassen und ging jetzt eine Straße entlang, in der ich noch nie gewesen war.
Es war eine Häuserschlucht irgendwo in der City, trotz des Regens voll von pulsierendem Leben. Die Menschen drängten sich auf dem nassen Trottoir, in den Pubs, Gasthäusern und Geschäften.
Eine seltsame Unruhe erfüllte mich. Es war um die frühe Mittagsstunde; ich hatte gerade ausgiebig gefrühstückt und meinen Butler angewiesen, den Lunch heute ausfallen zu lassen. Ich hatte also genügend Zeit, zumal während der letzten Tage niemand mehr versucht hatte, mir einen Mord in die Schuhe zu schieben oder mich gegen einen mechanischen Doppelgänger auszutauschen. Dennoch hastete ich, ohne es eigentlich bewusst zu wollen, die Straße entlang, wie jemand, der befürchten musste, einen überaus wichtigen Termin zu versäumen. Gewaltsam zügelte ich meine hektische Ungeduld und zwang mich dazu, die Füße so gemessen voreinanderzusetzen, wie es sich für einen Gentleman geziemte. Aus Gründen, für die ich keine Erklärung fand, fiel mir dies ausgesprochen schwer. Und nach wenigen Schritten schon fiel ich erneut in eine schnelle Gangart zurück. Ich wollte mich zur Besinnung rufen … aber es ging nicht mehr! Meine Füße schienen sich förmlich zu verselbstständigen.
Nach etwa zweihundert Yards passierte ich ein Gasthaus. Das heißt, ich wollte es passieren … und blieb, wie von einer unsichtbaren Hand gestoppt, vor der Eingangstür stehen. Und ehe ich mich versah, hatte ich bereits die Schwelle erreicht und die Klinke heruntergedrückt.
Zwischen Tür und Angel kam ich endlich zu Bewusstsein. Was, zum Teufel, machte ich da? Dieses Gasthaus – Harvey’s stand auf einem hölzernen Schild über dem Eingang – war mir völlig unbekannt. Und da ich weder Hunger noch Durst verspürte, lag nicht der geringste Grund vor, es zu betreten. Dennoch war ich im Begriff, eben dies zu tun.
Ich biss die Zähne zusammen, riss mich geradezu von der Tür los und trat wieder auf die Straße. Mühsam Fuß vor Fuß setzend, entfernte ich mich vom Harvey’s.
Ich war vielleicht zehn Schritte gegangen, als mir Übelkeit aus meinem Magen die Kehle hinaufkroch. Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn, und ich merkte, dass ich schwankte wie jemand, der zu tief ins Whiskyglas geschaut hat. Dabei hatte ich heute noch keinen einzigen Schluck Alkohol zu mir genommen.
Alle Kraft zusammennehmend, ging ich weiter. Einige der Passanten warfen mir verwunderte Blicke zu – offenbar sah ich auch so aus, wie ich mich fühlte. Ein junger Mann sprach mich sogar an und fragte, ob er mir irgendwie helfen könnte. Ich schüttelte nur stumm den Kopf und setzte meinen Weg fort.
Aber ich kam nicht weit. Eine Art Magnet schien an mir zu zerren, schien mich zurückreißen zu wollen.
Zurück zum Harvey’s!
Augenblicke lang kämpfte ich noch gegen das unerklärliche Geschehen an. Dann jedoch, als die Übelkeit immer stärker wurde, gab ich den Kampf auf.
Und kaum hatte ich den Widerstand gegen mich selbst eingestellt, als ich mich auch schon auf dem Absatz umdrehte und den Weg zurückging, den ich gerade gekommen war. Schnurstracks steuerte ich auf die Eingangstür des Harvey’s zu und betrat das Gasthaus, diesmal, ohne auch nur eine einzige Sekunde zu zögern.
Auf Anhieb erkannte ich, dass es sich um ein ausgesprochen nobles Restaurant handelte. Ein dicker, dunkelroter Berberteppich bedeckte den Boden, schwere Ölgemälde hingen an den holzgetäfelten Wänden. Das Mobiliar war von feinster Machart und hätte dem Speisezimmer eines vornehmen Schlosses zur Ehre gereicht. Gäste hatten sich wenige eingefunden. Die meisten der weiß gedeckten Tische waren unbesetzt.
Wie es sich für ein erstklassiges Haus gehörte, eilte sofort ein Kellner auf mich zu, um mir aus den regennassen Kleidern zu helfen. Ich übergab dem Bediensteten Hut und Mantel, schüttelte jedoch den Kopf, als er auch nach meinem Spazierstock greifen wollte. Nur wenn es sich gar nicht vermeiden ließ, trennte ich mich von meinem Stockdegen und dem im Knauf eingeschmolzenen Shoggotenstern.
Die Entscheidung, mir einen Tisch auszusuchen, wurde mir von meinen Füßen abgenommen. Ohne dass ich es wollte, schienen sie wieder zu unheimlichem Eigenleben zu erwachen und trugen mich zu einem Tisch hinüber, der bereits von einem einzelnen Herrn besetzt war. Er trug Kleidung, der man auf den ersten Blick ansah, dass sie von einem sehr teuren Schneider stammte. Altersmäßig war er nur schwer einzuschätzen, aber ich täuschte mich wohl nicht, wenn ich ihn für ungefähr dreißig hielt. Er war nicht sehr groß, aber von kräftiger Statur. Das auffälligste Merkmal seines ansprechenden Gesichtes bildeten buschige, schwarze Augenbrauen. Seine Hautfarbe war ungewöhnlich stark gebräunt, was bestimmt nicht von der englischen Sonne herrührte. Instinktiv spürte ich, dass dieser Mann schon viel herumgekommen war und mehr erlebt hatte als die meisten Menschen seines doch noch recht jugendlichen Alters.
»Ja?« Er blickte von der Zeitung, in der er gelesen hatte, hoch, und während er die einsilbige Frage hervorstieß, bildete sich auf seiner Stirn eine scharfe Falte offenkundiger Missbilligung.
Mir wurde bewusst, dass ich ihn fast eine Minute lang angestarrt haben musste. Das gehörte bestimmt nicht zu den Gepflogenheiten eines Gentleman’s, wie man sie in einem solchen Restaurant erwarten durfte, und musste nahezu zwangsläufig Befremden hervorrufen.
Ich räusperte mich und brachte eine leichte, aber durchaus höfliche Verbeugung zuwege.
»Craven«, sagte ich. »Robert Craven.«
Wenn ich gedacht hatte, dass sich der Fremde nun ebenfalls vorstellen würde, sah ich mich getäuscht. Er bedachte mich nur weiterhin mit missbilligenden Blicken.
»Ja?«, fragte er abermals.
Ich kam mir selbst ziemlich albern vor, so dazustehen wie bestellt und nicht abgeholt. Am liebsten hätte ich mich umgedreht und wäre eiligen Schrittes davongegangen. Doch irgendetwas in mir zwang mich dazu, diesen Gedanken nicht einmal ernsthaft in Erwägung zu ziehen.
»Darf ich … darf ich mich zu Ihnen setzen?«, fragte ich stattdessen.
»Warum?« Die steile Falte auf der Stirn des Mannes wurde noch steiler.
Warum? Das war eine gute Frage. Eine Frage noch dazu, auf die ich selbst keine Antwort wusste.
»Nun?«, drängte der Fremde, gereizt und alles andere als freundlich, was ich ihm nach Lage der Dinge nicht einmal sonderlich verübeln konnte.
»Weil … weil ich gerne in Gesellschaft speise«, sagte ich schließlich und fühlte mich dabei genauso einfältig, wie ich vermutlich auch wirkte.
»Nun«, erwiderte der Fremde und verzog mit einem leichten Anzeichen von Arroganz das Gesicht, »ich ziehe es vor, allein zu speisen, Mister.«
Damit war das Thema für ihn erledigt. Er wandte den Blick von mir ab und widmete sich wieder der Times, die aufgeschlagen auf seinem Tisch lag.
Erneut hatte ich einen schweren Kampf mit mir auszutragen.
Ein tief sitzender, unbegreiflicher Trieb wollte mich dazu veranlassen, trotz der unmissverständlichen Abfuhr an seinem Tisch Platz zu nehmen. Mein Verstand sagte mir allerdings, dass der Fremde daraufhin vermutlich die Bediensteten des Gasthauses rufen würde, um mich hinauswerfen zu lassen. Eine solch entwürdigende Behandlung wollte ich mir nun wirklich ersparen, und es gelang mir dann auch, mich gegen mein Innerstes durchzusetzen. Aber es war nur ein halber Sieg, denn statt das Restaurant einfach zu verlassen und meiner Wege zu gehen, schritt ich zum freien Nebentisch hinüber und ließ mich daran nieder; und zwar so, dass ich den Mann mit den buschigen Augenbrauen jederzeit im Blickfeld hatte.
Ein Kellner huschte dienstbeflissen herbei, und ich gab geistesabwesend irgendeine Bestellung auf, die ich Sekunden später bereits wieder vergessen hatte. Meine ungeteilte Aufmerksamkeit galt dem Fremden.
Natürlich war sich der Mann meiner unaufhörlichen Beobachtung wohl bewusst, obwohl er sich den Anschein gab, als würde ich für ihn gar nicht existieren. Eine Weile später bekam er sein Menü. Er begann die Lammkeule mit Pilzen und Rahmsauce zu zerteilen, hatte aber offensichtlich keinen großen Genuss daran. Zweifellos war er irritiert, was ich durchaus verstehen konnte. Auch ich wäre irritiert gewesen, hätte ich fortwährend die Gewissheit gehabt, dass mir jemand Löcher in den Hinterkopf starrte.
Schließlich reichte es ihm. Er ließ Messer und Gabel fallen und wandte sich mit einer ungestümen Drehung zu mir um.
»Was bezwecken Sie damit, Mister?«, fuhr er mich an.
Ich schluckte, um mich des Kloßes zu entledigen, der mit einem Male in meiner Kehle saß.
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, gab ich zur Antwort.
»Sie wissen verdammt genau, was ich meine«, knurrte er. »Sie glotzen mich an, als hätte ich Ihnen die Brieftasche gestohlen!«
»Davon … kann keine Rede sein«, presste ich hervor.
»Natürlich nicht. Also, warum glotzen Sie mich an?«
»Ich …«
Zum Glück wurde ich einer Antwort enthoben, denn in diesem Augenblick brachte der Kellner mein eigenes Essen. Ich murmelte irgendetwas und zwang mich dann, meine Aufmerksamkeit auf das Menü zu richten. Es handelte sich um flambierte Nieren in irgendeiner undefinierbaren, bunten Soße. Der Teufel musste mich geritten haben, so etwas zu bestellen. Dennoch machte ich mich sogleich darüber her, teils, um mich selbst abzulenken, teils, um den wütenden Blicken meines Tischnachbarn zu entkommen.
Auch der Fremde nahm schließlich Messer und Gabel wieder hoch und aß weiter. Was meine Nieren anging, vermochte ich nicht einmal zu sagen, ob sie schmeckten oder nicht. Zu sehr war ich damit beschäftigt, gegen den verrückten inneren Drang anzugehen, der mich zwingen wollte, wieder zu dem Mann am Nebentisch … hinüberzuglotzen, wie er sich ausgedrückt hatte.
Obgleich ich mich normalerweise durchaus rühmen kann, einen starken Charakter und einen festen Willen zu haben, bereitete ich mir in dieser Hinsicht diesmal eine bittere Enttäuschung. Lange hielt ich meine Enthaltsamkeit nicht durch. Ich kam gegen den unheimlichen Zwang, der sich in mir festgesetzt hatte, nicht mehr an, hörte auf zu essen und nahm meinen Tischnachbarn wieder fest ins optische Visier. Dass ich dabei nicht aufstand und ihm ganz dicht auf die Pelle rückte, musste ich mir bereits als Erfolg anrechnen.
Erwartungsgemäß merkte mein Opfer sehr schnell, dass ich wieder angefangen hatte, ihn zu fixieren wie die Schlange das Kaninchen. Ruckartig fuhr er abermals herum.
»Sagen Sie mal, Mister«, schnauzte er. »Sind Sie vielleicht … anders herum?«
»Ob ich …«
»… auf Männer stehe!«, sagte er drastisch. »Ja, genau das war meine Frage.«
»Ich … bin verlobt«, stammelte ich. »Mit einem überaus reizenden Mädchen«, fügte ich dann noch hinzu, ganz so, als müsste ich jedes Missverständnis ausschließen.
»Na, die Schnepfe möchte ich sehen«, knurrte er und wandte sich wieder ab.
Zorn wallte in mir hoch. Hatte ich es nötig, Priscylla auf diese Weise beleidigen zu lassen? Der Fremde war zwar kräftig und überragte mich noch um gut eine Hand breit, aber ich zweifelte nicht im Mindesten daran, dass ich es jederzeit mit ihm aufnehmen konnte. Nur die Erkenntnis, dass seine rüde Verhaltensweise wohl von mir provoziert worden war, ließ mich davon Abstand nehmen, handgreiflich zu werden.
In jedem Fall war dem Fremden der Appetit jetzt endgültig vergangen. Er stieß wütend seinen Teller zurück und rief lautstark nach dem Kellner. Er zahlte, ließ sich seinen Mantel bringen, bedachte mich noch mit einem wutsprühenden Blick und verließ dann das Gasthaus.
Ich stand vor einer schweren Bewährungsprobe. Alles in mir drängte mich, unverzüglich aufzuspringen und dem Mann zu folgen. Krampfhaft klammerte ich mich an der Tischplatte wie an einem Rettungsanker fest. Ich spürte, wie mir der Schweiß aus allen Poren brach, wie in meinem Kopf ein Schwindel erregendes Gefühl der Leere entstand, wie das Blut in meinen Adern raste und pochte. Entzugserscheinungen wie bei einem Opiumsüchtigen, schoss es mir durch den Kopf.
Diesmal jedoch hielt ich durch. Und langsam, wohl mit jedem Schritt, den sich der Fremde vom Restaurant entfernte, besserte sich mein Befinden wieder. Zumindest die rein körperlichen Symptome verflüchtigten sich. Was blieb, war die seelische Empfindung, einen ungeheuren Verlust erlitten zu haben, einen Verlust, den ich wahrscheinlich nicht ertragen konnte, ohne dabei dem hellen Wahnsinn anheimzufallen.
Meinem Kellner war nicht entgangen, dass mit mir irgendetwas nicht in Ordnung war. Er trat an den Tisch und blickte mich mit echter Besorgnis an.
»Kann ich etwas für Sie tun?«, fragte er.
Ich nickte. »Verraten Sie mir den Namen des Mannes, der hier am Nebentisch gesessen hat.«
Und so erfuhr ich, dass der Fremde der mich auf so mysteriöse Weise in seinen Bann geschlagen hatte, ein Sir Henry Baskerville aus Devonshire war.
Nachdem Frederic Murphy die Häupter seiner Lieben gezählt hatte, stieß er einen gotteslästerlichen Fluch aus.
»Bruce!«, brüllte er.
Er bekam keine Antwort, obwohl kaum ein Zweifel daran bestehen konnte, dass sein Sohn ihn gehört haben musste.
»Bruce!«
Diesmal hatte sein Rufen Erfolg. Der Junge trat aus dem Stall und kam zum Pferch herüber, mit zögernden, unsicheren Schritten. Sein sommersprossiges Gesicht war betont ausdruckslos, aber in seinen Augen flackerte das leibhaftige schlechte Gewissen. Nur zu gut wusste er, warum er gerufen worden war.
»Ja, Daddy?«
Frederic Murphy deutete auf die Schafskoppel. »Kannst du zählen, Bruce?«, fragte er mit falscher Freundlichkeit.
Sein Sohn wandte sich dem Gattergeviert zu, in dem sich blökend der ganze Besitz der Familie Murphy drängte, hob die rechte Hand und fing tatsächlich an, die Schafe abzuzählen.
»Eins, zwei, drei …«
»Hör auf!«, unterbrach ihn Frederic Murphy mit kaum gebändigtem Zorn. »Du weißt so gut wie ich, dass es nicht siebenundzwanzig, sondern nur sechsundzwanzig sind.«
»Nur sechsundzwanzig?« Bruce gab sich nach wie vor den Anschein der vollkommenen Unschuld. Erneut hob er seine Rechte und zählte weiter.
»Vier, fünf, sechs …«
Frederic Murphy setzte dem Spiel ein Ende, indem er dem Jungen eine schallende Ohrfeige versetzte, die diesen beinahe zu Boden torkeln ließ.
»Das soll dich lehren, deinen Vater für dumm zu verkaufen!«
Jetzt endlich gab sich Bruce geschlagen. Er fuhr sich über die schmerzende Wange, schniefte und verdrängte mühevoll die Tränen, die sich in seinen Augen zu sammeln begannen.
»Es … es war nicht meine Schuld«, sagte er weinerlich. »Ich habe aufgepasst wie immer, aber trotzdem –«
»– ist dir eins der Schafe weggelaufen!«
»Es ist nicht weggelaufen. Es war auf einmal ganz einfach … verschwunden.«
Frederic Murphy blickte zum Himmel empor, an dem die Sonne längst untergegangen war. Die Dämmerung hatte bereits ein Stadium erreicht, in dem sie jetzt sehr schnell der Nacht weichen würde. Und wenn es erst einmal völlig dunkel geworden war, ließ sich gar nichts mehr machen.
»Komm«, sagte er zu seinem Sohn. »Wir suchen das Tier.«
»Wir werden es nicht finden!«
»Wenn wir hier rumstehen, ganz bestimmt nicht. Also komm.« Frederic Murphy wandte sich zum Gehen.
Der Junge zögerte. »Jetzt ins Moor? In ein paar Minuten ist es stockfinster!«
Frederic Murphy wusste, wo er seinen Sohn packen konnte. »Du hast doch nicht etwa Angst?«, fragte er mit gespielter Geringschätzung.
»Ich habe nie Angst«, antwortete Bruce bestimmt.
»Worauf wartest du dann noch?«
Augenblicke später waren Vater und Sohn unterwegs. Ihre kleine Schaffarm lag am Rand des Grimpener Sumpfs, eines ausgedehnten Moorgebietes in der Grafschaft Devonshire. Die Landschaft war trostlos, öde und dünn besiedelt und ermöglichte ihren Bewohnern – Torfstechern, Moorbauern, Schafzüchtern – nur ein kärgliches Auskommen, das sie sich im Schweiße ihres Angesichts verdienen mussten. Frederic Murphy konnte ein trauriges Liedchen davon singen. Um den Schafen Weideplätze bieten zu können, die ihre gewiss nicht sonderlich anspruchsvollen Bedürfnisse zu befriedigen vermochten, war es erforderlich, mitunter tief ins Moor einzudringen. Dies brachte Gefahren mit sich, denn das Moor war tückisch und lag ständig auf der Lauer nach Ahnungslosen und Unvorsichtigen. Aber die Murphys kannten sich aus im Sumpf und wussten sehr wohl, welche Stellen sie meiden mussten, um ihr Leben nicht aufs Spiel zu setzen. Das galt für Vater und Sohn gleichermaßen, und Frederic Murphy war sich darum auch völlig im Klaren darüber, dass Bruce keine Angst vor dem Moor selbst hatte. Was sein Sohn fürchtete, war vielmehr das, was seit einigen Wochen wieder im Moor umgehen sollte – das unheimliche Etwas, das …
Frederic Murphy verdrängte ärgerlich die unsinnigen Gedanken. Er glaubte nicht an die Manifestation des leibhaftigen Bösen. Den größten Teil seines Lebens hatte er in dieser Gegend verbracht, und in all der Zeit hatte es sich niemals gezeigt. Dass es nun nach so vielen Jahren sein höllisches Haupt wieder in die Höhe recken sollte, war nicht mehr als eine der vielen Legenden, die in den Köpfen der Alten wurzelten. Gewiss, auch er hatte in den Nächten der jüngsten Vergangenheit die grauenhaften Laute gehört, die aus den Tiefen des Sumpfes zum Haus herübergedrungen waren. Aber das Moor gebar viele Geräusche, für die sich fast immer eine natürliche Erklärung fand.
Dennoch musste Murphy im Stillen zugeben, dass er sich nicht ganz wohl in seiner Haut fühlte. Während er mit seinem Sohn den Trampelpfad entlangschritt, der zur Südweide führte, waren seine Nerven gespannt wie selten. Man konnte nur noch wenige Meter weit sehen. Das Kieferngestrüpp rechts und links des Weges ragte wie die Gestalten von verkrüppelten Zwergen aus dem jetzt aufkommenden Bodennebel; unheimliche Gnome, die zahllose spinnengleiche Arme ausstreckten. Der Nebel quoll aus dem feuchten Erdreich hervor und legte einen grauen, löchrigen Teppich über das Land. Abgefallene Nadeln und Blätter machten den an sich noch festen Untergrund schlüpfrig und glitschig. Das Zirpen und Quaken ganzer Armeen von Moorgetier erweckte den Eindruck, als würden wahnsinnige Musiker eine misstönende Sinfonie intonieren. Aber all dies war alltäglich und normal. Was dagegen ganz und gar nicht alltäglich und normal war …
Abrupt blieb Frederic Murphy stehen, so abrupt, dass sein Sohn, der in wenigen Schritten Abstand folgte, gegen ihn prallte.
»Hörst du das, Bruce?«
Der Vierzehnjährige, von seinem Naturell her wirklich kein Angsthase, griff nach der Hand seines Vaters und umklammerte sie krampfhaft.
»Ja, ich höre es«, flüsterte er.
Jenseits der Kakophonie der Frösche und Grillen ertönten andere Laute; furchtbare Töne, die das Blut in den Adern der beiden einsamen Wanderer gefrieren ließen. Es war ein Heulen, lang gezogen und erschreckend laut, obwohl es aus weiter Ferne zu kommen schien, gleichzeitig qualvoll, wild und drohend.
»Der … der Höllenhund!«, hauchte Bruce und drückte die Hand seines Vaters noch fester. »Der Höllenhund von Baskerville!«
Die schrecklichen Töne verhallten, hingen nur noch als schauerliches Echo in der Luft. Minutenlang blieben die Murphys wie erstarrt stehen und warteten. Aber das markerschütternde Heulen klang nicht wieder auf. Die Nacht gehörte wieder dem Kleingetier der Moorlandschaft.
»Komm«, sagte Frederic Murphy schließlich und fuhr seinem Sohn beruhigend durchs Haar.
»Nach Hause?«, fragte der Junge hoffnungsvoll.
»Noch nicht. Was es auch war – es ist vorbei. Und außerdem kam es aus einer ganz anderen Richtung, nicht wahr?«
Widerstrebend nickte Bruce. Langsam wurde er seiner Angst Herr und ließ die Hand seines Vaters los. Die Murphys setzten ihren Weg zur Südweide fort und erreichten sie schließlich, ohne dass sie unterwegs noch irgendetwas Ungewöhnliches wahrgenommen hatten.
Die Weide war eine mit Riedgras bewachsene Wiese, etwa sechzig Meter lang und vierzig Meter breit, und lag unmittelbar am Rand einer tückischen Morastmulde. Zum Sumpf hin wurde sie leicht abschüssig, wie um auf die Gefahr hinzudeuten, die dort lauerte. Henry Murphy war sich dieser Gefahr bewusst und ging mit der gebotenen Achtsamkeit zu Werke. Vorsichtig näherte er sich dem Rand des Moorlochs, immer langsam einen Fuß vor den anderen setzend und sich vergewissernd dass er noch festen Stand besaß. Der Boden wurde nachgiebig und schlammig. Schwarzes, nach Moder riechendes Wasser umspielte schwappend seine Füße und ließ diese bei jedem Schritt bis zu den Knöcheln einsinken. Wenn Murphy sie wieder aus dem Schlamm hob, klang ein hässliches Geräusch auf, das ihn auf unangenehme Weise an das Schlachten eines Schafes erinnerte: als wenn rohes Fleisch in einen Steintrog fiele.
Das Riedgras, von der Feuchtigkeit begünstigt, wuchs hier viel höher als im weiter oben gelegenen Teil der Wiese und erreichte an manchen Stellen eine Höhe von mehr als einem Meter. Murphy hielt es durchaus für möglich, dass das verloren gegangene Schaf in diesem Grasdschungel steckte. Normalerweise mied die Herde diesen morastigen Grenzstreifen wie die Pest, aber es kam doch vor, dass sich ein einzelnes Tier von den anderen absonderte, in den modrigen Schlamm geriet und sich dann nicht mehr vor oder zurück traute. Schafe gehörten nun einmal nicht zu den intelligentesten Vertretern der Tierwelt.
Während er sich durch Morast und Ried kämpfte, gab Frederic Murphy leise Lockrufe von sich, in der Hoffnung, das verirrte Schaf auf sich aufmerksam zu machen. Erfolg hatte er damit allerdings nicht. Und da es inzwischen zu dunkel geworden war, um mehr als verschwommene Konturen zu erkennen, konnte er das Tier, wenn es denn überhaupt da war, natürlich auch nicht sehen.
Sein Verstand sagte ihm schon bald, dass er sich auf ein ziemlich sinnloses Unterfangen eingelassen hatte, aber da er ein sehr gewissenhafter Mensch war und wohl auch ein bisschen zur Sturheit neigte, setzte er die Suche fort. Dabei wurde ihm zunächst gar nicht so recht bewusst, dass er dem gefährlichen Sumpfloch mittlerweile bedrohlich nahe gekommen war. Als er merkte, dass seine Beine schon fast bis zu den Knien einsanken und es immer anstrengender wurde, sie wieder aus dem Morast zu befreien, erschrak er beinahe. Nun war es wirklich an der Zeit, die Suche abzubrechen.
»Bruce?«, rief er.
»Ja, Daddy?« Die Stimme seines Sohns, der oben auf der Weide wartete, klang unglücklich und besorgt.
»Ich komme zurück; in zwei, drei Minuten bin ich wieder bei dir.« Bruce stieß einen Laut der Erleichterung aus, dem man deutlich anmerken konnte, wie sehr er sich danach sehnte, endlich nach Hause gehen zu können.
Frederic Murphy wollte eben eine Kehrtwendung machen, als er plötzlich unmittelbar vor sich ein eigenartiges Geräusch wahrnahm. Es war ein Glucksen, ein Schmatzen, das sich anhörte, als ob sich etwas Großes, Schweres aus dem Sumpf lösen würde.
Frederic Murphy verhielt den Schritt, blieb bewegungslos stehen, um sich besser konzentrieren zu können. Er spürte, wie sich sein Pulsschlag beschleunigte, wie sein Herz unruhig zu hämmern begann. Sein Instinkt, durch sein Leben in der freien Natur besonders geschärft, sagte ihm, dass irgendetwas nicht so war, wie es sein sollte. Dass da irgendwo vor ihm etwas Lebendiges war.
Da war das Geräusch wieder, gurgelnd, blubbernd. Und dann war da auf einmal ein Geruch in der Luft – nein, kein Geruch, vielmehr ein Gestank, der so bestialisch war, dass Murphy krampfhaft gegen ein schier überwältigendes Gefühl des Ekels ankämpfen musste. Er keuchte, versuchte die Luft anzuhalten, konnte den entsetzlichen Gestank, der wie eine unsichtbare Wolke der Pestilenz auf ihn eindrang, jedoch nicht fernhalten. Übelkeit übermannte ihn, lähmte ihn förmlich.
»Daddy?«, hörte er die besorgte Stimme seines Sohnes. »Daddy, wo … wo bist du?«
Murphy wollte antworten, aber als er den Mund öffnete, kam nur ein heiseres, ersticktes Krächzen hervor. Jetzt hörte und roch er nicht nur etwas, nein, er sah auch etwas. Eine gigantische Masse hatte sich aus dem Sumpf erhoben, ein amorphes Etwas, so abgrundtief schwarz, dass er es nur wahrnehmen konnte, weil die Dunkelheit der Nacht, die es einhüllte, im Kontrast dazu geradezu hell wirkte. Die furchtbare Schwärze wuchs vor ihm auf wie eine bis zum Himmel reichende, fugenlose Mauer. Und eine Kälte, wie sie nur in den toten Schluchten zwischen den Sternen denkbar erschien, griff nach Frederic Murphy, lähmte seine Sinne vollends und ließ ihn in eine gnädige Bewusstlosigkeit sinken.
Das quälende, grauenvolle Heulen, das in diesem Augenblick wieder in der nebelverhangenen Ferne hörbar wurde, drang nicht einmal mehr in sein Bewusstsein,
Es war eine Art Verrücktheit, die Besitz von mir ergriffen hatte. Wo ich auch ging, was ich auch tat, fortwährend erschien ein großer, schlanker, sonnengebräunter Mann vor meinem geistigen Auge.
Sir Henry Baskerville!
Ich tat alles Mögliche, um sein Bild aus meinem Bewusstsein zu verbannen, vertiefte mich bis zur geistigen Erschöpfung in die geschäftlichen Unterlagen, die Aufschluss über meinen erstaunlich großen Aktienbesitz gaben, suchte sogar Kontakt zu dem mir eigentlich verhassten Londoner Gesellschaftsleben. Aber es half alles nichts: Henry Baskerville war immer dabei.
Tagelang hatte ich gegen die Versuchung angekämpft, nähere Informationen über meinen Plagegeist einzuholen – und sah mich letzten Endes doch veranlasst, der Versuchung nachzugeben. Und so wusste ich mittlerweile einiges über diesen Mann, der aus völlig unerfindlichen Gründen für mich der wichtigste Mensch der ganzen Welt geworden zu sein schien.
Henry Baskerville war erst vor wenigen Wochen nach England gekommen, nachdem er den größten Teil seines Lebens zunächst in Kanada und dann als privater Forschungsreisender vor allem in den Ländern des Orients zugebracht hatte. Der Grund für seine Rückkehr ins Vaterland lag darin, dass sein Onkel, Sir Charles Baskerville, verstorben war und ihm neben einem beträchtlichen Barvermögen auch den Familienbesitz in Devonshire vererbt hatte. Wie schon von mir geschätzt, betrug Henry Baskervilles Alter tatsächlich dreißig Jahre. Er war unverheiratet, erfreute sich eines ausgezeichneten Rufs und schien nichts, aber auch gar nichts an sich zu haben, was mein rätselhaftes Interesse an seiner werten Person erklären konnte. Und doch brannte dieser Wissensdurst so lodernd in mir, dass ich ernsthaft um meine geistige Gesundheit bangte.
Und so tat ich schließlich das, was ich tun musste, wenn ich mich auch nach wie vor verstandesmäßig dagegen sträubte: Ich kaufte mir eine Fahrkarte nach Devonshire.
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie mir ein wenig Gesellschaft leisten, Doktor!« Henry Baskerville blickte seinen Gast, der ihm in der Bibliothek von Baskerville Hall bei einem Glas ausgezeichneten schottischen Whiskys gegenübersaß, dankbar an. »Hier im Schloss ist es für einen Mann wie mich, dem eine gewisse Abenteuerlust im Blut liegt, allein doch ziemlich … nun ja, langweilig.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite«, erwiderte Dr. Mortimer, der residierende Landarzt. »Es bereitet mir außerordentliches Vergnügen, ihren Erzählungen von fremden Völkern und Ländern zu lauschen. Und außerdem …« Er stockte in seinem Redefluss und griff, beinahe etwas verlegen, nach seinem Whiskyglas.
»Und außerdem?«, wiederholte Henry Baskerville fragend. »Was wollten Sie sagen?«
»Ach, nichts«, wehrte der Doktor ab. »Vergessen Sie es bitte.«
»Kommen Sie, mein Freund«, blieb Baskerville beharrlich. »Sie wollten auf etwas ganz Bestimmtes hinaus. Also, rücken Sie schon raus damit!«
Dr. Mortimer zuckte die Achseln. »Wenn Sie unbedingt darauf bestehen … Nun, wie Sie wissen, war ich ein guter Freund Ihres Onkels und deshalb fühle ich mich in gewisser Weise auch für Sie … verantwortlich.«
»Verantwortlich?«
»Sie wissen schon, was ich meine, Sir Henry. Die Drohungen gegen Ihre Person, der rätselhafte Tod von Sir Charles, dieser unselige Familienfluch …«
Der Doktor wollte noch mehr sagen, kam aber nicht dazu. Draußen auf dem Schlosshof, der im matten Glanz der spätmorgendlichen Sonne lag, war es laut geworden. Eine Stimme, offenbar die eines jungen Burschen, machte sich mit schriller Eindringlichkeit auf höchst befremdliche Art und Weise bemerkbar.
»Mörder! Verbrecher! Mörder! Verbrecher!«
Henry Baskerville runzelte die Stirn und sah sein Gegenüber an. Dr. Mortimer konnte seinen fragenden Blick jedoch nur genauso fragend erwidern.
Die beiden Männer erhoben sich, traten an eines der Fenster der Bibliothek und blickten auf den Hof hinunter. Dort stand, wie die Stimme bereits zu erkennen gegeben hatte, ein ungefähr fünfzehnjähriger Junge in abgetragenen und ziemlich schmutzigen Kleidern. Er sah an der Fassade von Baskerville Hall hoch und stieß wieder und wieder seine schrillen Rufe aus.
»Mörder! Verbrecher!«
Henry Baskerville zog die Mundwinkel nach unten. »Sehr groß scheint sein Sprachschatz nicht zu sein. Kennen Sie ihn?«
Der Doktor nickte. »Ja. Sein Name lautet Bruce Murphy. Er ist der Sohn eines Schafzüchters hier ganz in der Nähe.«
Ein schwarzbärtiger Mann kam aus dem Portal des Schlosses gestürmt. Barrymore, der Butler, der schon Henry Baskervilles Onkel treue Dienste geleistet hatte. Er packte den Jungen unsanft am Arm und versuchte ihn zum Schweigen zu bringen. Was ihm zunächst allerdings nicht gelang. Obwohl Bruce Murphy fest von seinen starken Armen umklammert wurde, fuhr er mit seinen zeternden Beschimpfungen lautstark fort.
Henry Baskerville öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus. »Lassen Sie ihn los, Barrymore.«
Widerstrebend gab der Butler den Jungen frei.
Kaum, dass der Sohn des Schafzüchters den Schlossherrn erkannt hatte, als seine Stimme einen noch eindringlicheren, geradezu hasserfüllten Tonfall annahm.
»Mörder! Verbrecher …«
»Ja, das kennen wir ja nun schon zur Genüge«, fiel ihm Baskerville ins Wort. »Vielleicht verrätst du uns jetzt mal, warum du hier so wild herumschreist.«
Der Junge stutzte, geriet aus dem Konzept, fing sich aber schnell wieder.
»Sie sind schuld!«, brüllte er zum Bibliotheksfenster hinauf. »Sie und Ihr ganzes gottverdammtes Baskerville-Geschlecht! Sie und Ihr mörderischer Höllenhund!«
Henry Baskerville tauschte einen schnellen Blick mit Dr. Mortimer und wandte sich dann wieder dem Jungen zu.
»Woran soll ich schuld sein, Bruce?«
»Mein Vater ist … ist verschwunden! Ihr verfluchter Höllenhund hat … hat ihn geholt! Mörder! Verbrecher …«
Die Stimme des Jungen überschlug sich fast, ging dann in ein heftiges Schluchzen über. Augenblicke später weinte er haltlos. Sein magerer Körper zuckte und bot das Bild eines solchen Jammers, dass sich selbst im Inneren eines Uncle Scrooge aufrichtiges Mitleid geregt hätte.
»Warte, Junge, ich komme nach unten«, rief Henry Baskerville und eilte dann gemeinsam mit Dr. Mortimer auf den Schlosshof.
Es war nicht einfach, aus dem Sohn des Schafzüchters herauszuholen, was sich nun tatsächlich ereignet hatte. Sein ungezügelter Zorn hatte sich erschöpft und war kindlicher Verstörtheit und Hilflosigkeit gewichen. Schließlich ergab sich in etwa dieses Bild: Bruce Murphy war gestern Abend mit seinem Vater zu einer Moorweide gegangen, um ein verloren gegangenes Schaf zu suchen. Schon auf dem Weg hatten sie das Heulen des »Höllenhundes« gehört, der dann auf der Weide angeblich über den Vater hergefallen war und ihn verschleppt hatte.
Nachdem der Junge mit seinen gestammelten Erklärungen zum Ende gekommen war, gab Dr. Mortimer ein gequältes Ächzen von sich und zog ein überaus ernstes, sorgenvolles Gesicht, sehr zum Ärger des Schlossherrn.
»Sie glauben diesen ganzen Unsinn?«, fragte Henry Baskerville mit scharfer Stimme.
»Ich würde nicht von … Unsinn sprechen, Sir Henry«, antwortete der Arzt ausweichend.
Baskerville lachte kurz auf. »Höllenhund? Familienfluch? Lieber Freund, es tut mir leid, aber Sie können doch beim besten Willen nicht verlangen, dass ich all dies ernst nehme!«
»Ich habe das Heulen des Hundes selbst schon gehört«, sagte Dr. Mortimer. »Und es gibt durchaus glaubhafte Zeugen, die ihn auch gesehen haben. Sie sollten die Angelegenheit wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denken Sie nur an den Tod Ihres Onkels.«
»Onkel Charles war ein alter, herzkranker Mann. Ich bin der Ansicht, dass er eines ganz natürlichen Todes gestorben ist. Und wie Sie wissen, unterscheidet sich diese meine Ansicht nicht von der der Kriminalpolizei.«
»Polizisten glauben nur das, was sie mit den Händen anfassen können. Aber es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde …«
»Geschenkt!« Baskerville machte eine unwirsche, abwehrende Handbewegung und wandte sich dann wieder dem immer noch schluchzenden Jungen zu.
»Bruce, es tut mir leid, dass dein Vater verschwunden ist, aber ich habe nicht das Geringste damit zu tun.« Er dachte kurz nach und fuhr fort: »Ich mache dir einen Vorschlag: Wir gehen jetzt gemeinsam noch einmal zu dieser Weide und suchen nach ihm, einverstanden?«
»Wir werden ihn nicht finden«, erwiderte Bruce Murphy hoffnungslos.
»Das sehen wir ja dann. Also?«
Müde nickte der Junge. Von der zornerfüllten Energie, die er vorhin versprüht hatte, war nichts mehr übrig geblieben. Er war jetzt nur noch ein Kind, das seinen Vater verloren hatte und nicht wusste, wie es mit dieser Situation fertig werden sollte.
»Kommen Sie mit, Doktor?«, fragte Baskerville den Arzt.
Als dieser kurzentschlossen nickte, rief der Schlossherr nach seinem arabischen Diener Chalef, der mit ihm nach England gekommen war, und gab Anweisung, die Kutsche anspannen zu lassen.
Wenig später rollte das Gefährt vom Schlosshof, Chalef auf dem Kutschbock, Baskerville, Dr. Mortimer und Bruce Murphy im Fahrgastraum.
Die Fahrt bis zur Bauernkate der Murphys betrug etwa zwanzig Minuten. Von dort aus hieß es zu Fuß weiterzugehen, denn der Weg zu der Schafweide war mit der Kutsche nicht befahrbar. Als Henry Baskerville vor dem Haus ausstieg, bemerkte er eine Frau mittleren Alters, offenbar die Mutter des jungen Bruce.
Als sie ihn sah, machte sie ein Gesicht, als sei sie dem Teufel höchstpersönlich begegnet, bekreuzigte sich hastig und verschwand beinahe fluchtartig im Haus. Baskerville war sich nicht sicher, ob er über diese Reaktion ärgerlich oder betroffen sein sollte. Der Einfachheit halber beschloss er, den befremdlichen Vorfall schlicht zu ignorieren.
Der Pfad zur Weide führte geradewegs ins Moor hinein, und Henry Baskerville hatte wieder einmal Gelegenheit, dieses Land näher in Augenschein zu nehmen. Es erschien ihm karg, düster und in gewisser Weise trostlos, stieß ihn dennoch in keiner Weise ab. Dies war das Land seiner Väter, das Land, in dem auch er selbst das Licht der Welt erblickt hatte, seine Heimat. Und die Liebe zu dieser Heimat lag ihm wohl im Blut, auch wenn er ihr seit Jahrzehnten fern gewesen war.
Bruce Murphy hatte die Führung übernommen und geleitete sie zielsicher den vielfach gewundenen, von knorrigem Gehölz gesäumten Weg entlang, der nach einer ganzen Weile in eine Wiese mit Schräghanglage mündete.
»Hier war es«, sagte er fast tonlos und deutete zu dem abschüssigen Teil hinunter, der mit meterhohen Grasbüscheln und Schilfrohr bewachsen war.
»Komm, zeig uns genau die Stelle, an der du deinen Vater zuletzt gesehen hast«, forderte Baskerville ihn auf.
Der Junge schüttelte den Kopf. »Ich … ich gehe da nicht runter. Da, diesen Weg hat mein Vater genommen.« Wieder hob er die Hand und deutete ins Schilf hinab.
Achselzuckend setzte sich Henry Baskerville in Bewegung. Dr. Mortimer und Chalef schlossen sich ihm an, während Bruce Murphy am oberen Rand der Wiese stehen blieb. Unverhüllte Angst spiegelte sich in seinem schmalen, sommersprossigen Gesicht wider.
Bald schon wurde der bisher solide Untergrund schwammig und nachgiebig. Modriges, schwärzliches Wasser schwappte unter den Füßen. Henry Baskerville dachte an seine Wildlederstiefel, die für solche Bodenverhältnisse eigentlich nicht geschaffen waren, zögerte für einen Augenblick, stampfte dann aber entschlossen weiter, zumal er glaubte, tatsächlich eine Spur gefunden zu haben. Vor ihm war das hohe Riedgras stellenweise niedergedrückt, sodass sich fast so etwas wie eine Schneise gebildet hatte. Das Gras mochte vom Wind zerzaust worden sein, vielleicht aber auch von einem Menschen, der sich hindurchgewunden hatte. Erst als ihm das Moorwasser bereits bis zum Schienbein reichte und das Fortkommen immer mühevoller und anstrengender wurde, verhielt Baskerville seinen Schritt. In einer Entfernung von etwa zwölf oder fünfzehn Metern war kaum noch Vegetation zu erkennen, sondern nur noch schmutziges, Blasen werfendes Wasser, aus dem einzelne Halme emporragten.
»Das ist ein Sumpfloch, nicht wahr?«, fragte er Dr. Mortimer. »Wer da reingerät, kommt nie wieder raus, richtig?«
»Es sieht ganz danach aus«, stimmte ihm der Arzt zu.
Baskerville schnippte mit den Fingern. »Dann dürfte ja wohl alles klar sein. Der Schäfer hat sich zu weit vorgewagt und ist ganz einfach im Morast versunken!«
Dr. Mortimer wiegte zweifelnd den Kopf hin und her. »Frederic Murphy war ein vorsichtiger Mann und kannte diese Gegend wie seine Westentasche. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er einen solchen Fehler begangen haben soll.«
»Es war finstere Nacht.«
»Trotzdem. Und außerdem geht man im Sumpf nicht so schnell unter. Es ist ein langsames, qualvolles Versinken, bei dem einem noch Zeit genug bleibt …«
»… um nach Hilfe zu rufen?«
»Das wollte ich sagen, ja. Der Junge hat uns jedoch gesagt, dass sein Vater ganz plötzlich verschwunden war – von einem Augenblick zum anderen.«
»Hm.« Henry Baskerville kräuselte die Nase. »Eigenartiger Geruch. Ist das der Sumpf?«
Dr. Mortimer atmete ebenfalls ganz bewusst durch die Nase und zog überrascht die Stirn hoch. »Sie haben Recht, es riecht wirklich eigenartig. Ganz und gar nicht typisch für das Moor. Fast wie in einer Abdeckerei, würde ich sagen.«
»Sagte der Junge nicht, dass er einen entsetzlichen Gestank wahrgenommen hat? Ich hätte da allerdings mehr an Feuer und Schwefel gedacht!«
»Feuer und Schwefel?«, echote der Doktor, der nicht gleich verstand, was der Schlossherr meinte.
»Der Höllenhund!«, erklärte Baskerville und grinste.
Augenblicke später jedoch war ihm nicht mehr nach Grinsen zumute.
Ausgerechnet Chalef, der mit Moorlandschaften bisher überhaupt noch keine Erfahrungen gemacht hatte, war es, der das Grauenhafte als erster erblickte. Sein braunes Gesicht war grau wie Asche geworden, als er mit zitternder Hand auf einen verwachsenen Laubbaum deutete, der ein Stück weiter hügelaufwärts stand.
»Mein Gott«, flüsterte Dr. Mortimer.
Im Geäst des Baumes hing, etwa fünf oder sechs Meter über dem Erdboden, ein Mensch. Ein Mann, der ohne jeden Zweifel tot war.
Bruce Murphy, der dem Baum näher stand als die drei Männer, war jetzt ebenfalls aufmerksam geworden. Er drehte sich um, blickte zu den Ästen hinauf und stieß einen furchtbaren Schrei aus.
»Daddy!«
Es war zu viel für den Jungen. Er machte Anstalten, zu dem Baum hinüberzulaufen, hatte aber nicht die Kraft dazu. Seine Beine versagten ihm den Dienst. Er schrie laut auf und sank, von Weinkrämpfen geschüttelt, ins feuchte Gras.
Baskerville, Dr. Mortimer und Chalef drehten dem Sumpfloch den Rücken zu und wateten zur Wiese zurück. Als sie unter dem Baum ankamen, sagte zunächst keiner von ihnen ein Wort. Sie waren gestandene Männer, die in ihrem Leben schon so manches gesehen und erlebt hatten, aber dieser schreckliche Anblick raubte ihnen buchstäblich die Sprache.





























