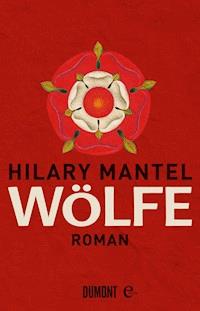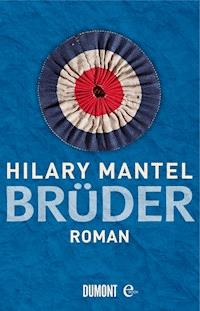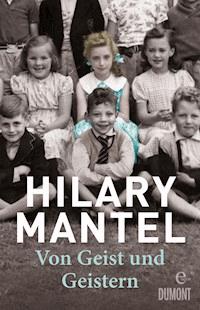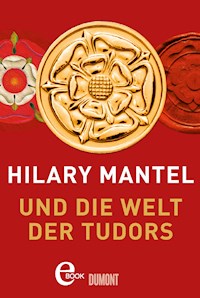8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Irgendwo im nördlichen England der Fünfzigerjahre: Fetherhoughton ist ein gottverlassenes Nest, eine Enklave der Ignoranz und des Aberglaubens. Father Angwin ist hier der Gemeindepriester, ein Zyniker, der längst seinen Glauben verloren hat und nur noch in Ruhe gelassen werden will; vor allem von dem neuen Bischof, der die Region in moderne Zeiten führen will. Die zweite Heimsuchung des Priesters ist Mutter Perpetua, die ihr Kloster mit eiserner Hand führt und jede Abweichung vom Pfad des Glaubens hart bestraft. Sie hat es vor allem auf die freiheitsliebende junge Nonne Philomena abgesehen. Eines Abends taucht ein Fremder an der Tür des Pfarrhauses auf und bietet Father Angwin seine Dienste an. Ist er ein Spion des Bischofs, wie Angwin glaubt? Ist er ein Engel, der den Priester wieder glauben lässt und Philomena die Liebe lehrt? Oder gar der Teufel selbst? Trockener Humor, hervorragende Charakterzeichnung und ein bissiges Porträt der Kirche im England der Fünfzigerjahre. »Der Roman ist leicht, geistreich, scharfsinnig und lustig; dabei behandelt er ernsthaft die Frage, was gut und was böse ist.« EVENING STANDARD
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Fetherhoughton ist ein eintöniges, gottverlassenes Nest, eine Enklave der Ignoranz und des Aberglaubens, von undurchdringlichen Moornebeln vor den Avancen der Aufklärung und der Vernunft beschützt. Vater Angwin ist der Gemeindepriester, ein Zyniker, der längst seinen Glauben verloren hat und nur noch in Ruhe gelassen werden will. Vor allem von dem neuen eifrigen Bischof, der die Region in moderne Zeiten führen will. Die zweite Heimsuchung des Priesters ist Mutter Perpetua, die ihr Kloster mit eiserner Hand führt und jede Abweichung vom Pfad des Glaubens hart bestraft. Sie hat es vor allem auf die freiheitsliebende junge Nonne Philomena abgesehen.
Eines Abends taucht ein Fremder an der Tür des Pfarrhauses auf und bietet Vater Angwin seine Dienste an. Ist er die Hilfe, die der Bischof angedroht hat? Doch wie ein Spion des Bischofs sieht der Mann namens Fludd nicht aus. Vielmehr umgibt ihn etwas Unwirkliches, das die einen voller Entzücken anzieht, so wie Philomena, und die anderen voller Entsetzen erstarren lässt, so wie Angwins Haushälterin, die sich zum Schutz aufs Singen verlegt. Ist er ein Engel, der die Bewohner aus ihrer Gleichförmigkeit befreit, dem Priester seinen Glauben wiederbringt und Philomena die Liebe lehrt? Oder ist er gar der Teufel, der alle in den Abgrund reißen wird?
»Der Roman ist leicht, geistreich, scharfsinnig und lustig; dabei behandelt er ernsthaft die Frage, was gut und was böse ist.«
Evening Standard
© Els Zweerink
Hilary Mantel, geboren 1952 in Glossop, England, war nach dem Jura-Studium in London als Sozialarbeiterin tätig. Sie lebte fünf Jahre lang in Botswana und vier Jahre in Saudi-Arabien. Für den Roman ›Wölfe‹ (DuMont 2010) wurde sie 2009 mit dem Booker-Preis, dem wichtigsten britischen Literaturpreis, ausgezeichnet. Mit ›Falken‹, dem zweiten Band der Tudor-Trilogie, gewann Hilary Mantel 2012 den Booker erneut. Bei DuMont erschienen zuletzt die Romane ›Jeder Tag ist Muttertag‹ und ›Im Vollbesitz des eigenen Wahns‹ (beide 2016).
Werner Löcher-Lawrence, geboren 1956, ist als literarischer Agent und Übersetzer tätig. Zu den von ihm übersetzten Autoren zählen u.
Hilary Mantel
DER HILFSPREDIGER
Roman
Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence
eBook 2017 Die englische Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel ›Fludd‹ bei Viking, London. © Hilary Mantel 1989
© 2017 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Übersetzung: Werner Löcher-Lawrence Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagmotiv: © plainpicture/Goto-Foto/Gay Early Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN eBook 978-3-8321-8967-9
Eine Bemerkung
Die Kirche in dieser Geschichte hat einige, aber keine große Ähnlichkeit mit der tatsächlich existierenden römisch-katholischen Kirche um das Jahr 1956. Das Dorf Fetherhoughton findet sich auf keiner Karte.
Der wirkliche Fludd (1574–
Sie kennen zweifellos Sebastiano del Piombos riesiges Gemälde Die Auferweckung des Lazarus, das in der Londoner Nationalgalerie hängt und im 19.
KAPITEL EINS
Am Mittwoch kam der Bischof persönlich. Er war ein moderner Prälat, forsch und füllig, mit randloser Brille, und nichts gefiel ihm besser, als mit seinem großen schwarzen Wagen durch die Diözese zu rasen.
Zur Sicherheit hatte er zwei Stunden vor seiner Ankunft angerufen, was unter den gegebenen Umständen ratsam war. Das Klingeln des Telefons in der Diele des Gemeindepfarrers hatte etwas gedämpft Geistliches. Miss Dempsey hörte es auf ihrem Weg aus der Küche. Einen Moment lang stand sie da, betrachtete den Apparat und ging dann behutsam auf den Fußballen darauf zu. Sie hob den Hörer ab, als könnte sie sich daran verbrennen. Den Kopf zur Seite geneigt, die Hörmuschel in einigem Abstand von ihrer Wange, lauschte sie der Nachricht des bischöflichen Sekretärs. »Ja, Mylord«, murmelte sie, wobei ihr im Nachhinein klar wurde, dass der Sekretär das nicht verdient hatte. »Der Bischof und seine Speichellecker«, sagte Vater Angwin immer. Miss Dempsey nahm an, sie waren so etwas wie Diakone. Sie hielt den Hörer mit den Fingerspitzen und legte ihn mit großer Sorgfalt zurück auf die Gabel, stand im düsteren Licht, dachte nach und senkte kurz den Kopf, als hätte sie den Heiligen Namen Jesu gehört. Dann ging sie zur Treppe und bellte nach oben: »Vater Angwin, Vater Angwin, stehen Sie auf und ziehen Sie sich an. Der Bischof wird uns noch vor elf heute heimsuchen.«
Miss Dempsey ging zurück in die Küche und schaltete die elektrische Deckenleuchte ein. Es war kein Morgen, an dem das Licht einen großen Unterschied machte: Wie eine dicke graue Decke hing der Sommer über dem Fenster. Miss Dempsey hörte das unablässige tropf, tropf, tropf von den Ästen und Blättern draußen und dazu ein dringlicheres metallisches Tropfen, pitt-patt, pitt-patt, von der Dachrinne. Ihre Gestalt bewegte sich, das elektrische Licht hinter sich, über die trist grüne Wand, riesige Hände trieben zum Wasserkessel, ihre Glieder wie durch ein dickflüssiges Meer zum Herd. Oben schlug der Pfarrer mit einem Schuh auf den Boden und tat so, als wäre er bereits auf dem Weg.
Zehn Minuten später stand er tatsächlich auf. Sie hörte das Knarzen der Dielen, das Gurgeln des aus dem Becken abfließenden Wassers, seine Schritte auf der Treppe. Er seufzte sein einsames Morgenseufzen, als er den Flur herunterkam, war plötzlich hinter ihr und fragte: »Agnes, haben Sie etwas für meinen Magen?«
»Ich denke schon«, sagte sie. Er wusste, wo das Salz stand, aber sie musste es ihm holen, als wäre sie seine Mutter. »Waren heute viele in der Sieben-Uhr-Messe?«
»Komisch, dass Sie fragen«, sagte Vater Angwin ganz so, als fragte sie das nicht jeden Morgen. »Ein paar alte Marienkinder waren da, dazu die gewohnten Hilflosen. Ist das ein besonderes Fest für sie? Die Walpurgisnacht?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen, Vater. Ich bin selbst ein Marienkind, wie Sie wissen, und ich habe nichts dergleichen gehört.« Sie wirkte gekränkt. »Trugen sie ihre Umhänge und alles?«
»Nein, sie waren in Zivil, einfach in ihren normalen Pferdedecken.«
Miss Dempsey stellte die Teekanne auf den Tisch. »Sie sollten sich nicht über die Schwesternschaft lustig machen, Vater.«
»Ich frage mich, ob was drüber durchgesickert ist, dass der Bischof kommt. Durch einen unterirdischen Nachrichtendienst? Bekomme ich keinen Speck, Agnes?«
»Nicht, solange Ihr Magen in so einem Zustand ist.«
Miss Dempsey schüttete ein, und das dicke braune Gurgeln des Tees gesellte sich zum Tropfen der Bäume und zum Wind im Kamin.
»Und noch etwas«, sagte er. »McEvoy war da.« Vater Angwin kauerte sich über den Tisch und wärmte die Hände an der Tasse. Als er den Namen McEvoy aussprach, huschte ein Schatten über sein Gesicht und blieb an seinem Kieferknochen hängen, sodass Miss Dempsey mit ihrer blühenden Fantasie einen Augenblick lang zu sehen glaubte, wie er als Achtzigjähriger aussehen würde.
»Ach ja«, sagte sie, »und wollte er etwas?«
»Nein.«
»Warum erwähnen Sie ihn dann?«
»Liebe Agnes, gönnen Sie mir etwas Frieden. Gehen Sie, ich muss mich auf Seine Korpulenz vorbereiten. Was, denken Sie, will er? Was führt er diesmal im Schilde?«
Agnes ging hinaus, einen Staubwedel in der Hand, das Gesicht voller Beschwerden. Was immer er mit dem unterirdischen Nachrichtendienst gemeint haben mochte, er wollte ihr doch wohl nichts vorwerfen? Der Bischof formte seine Absichten tief in seinem Herzen, und niemand außer ihm selbst hatte gewusst, dass er zu Besuch kommen wollte, höchstens vielleicht einer der Speichellecker. Und deshalb hatte sie es auch nicht wissen, ausplaudern oder verraten können, den Marienkindern nicht und auch sonst keinem in der Gemeinde. Hätte sie es gewusst, hätte sie es womöglich erwähnt. Womöglich – wenn sie gedacht hätte, jemand müsse es wissen. Denn Miss Dempsey hatte eine spezielle vermittelnde Position inne, zwischen der Kirche, dem Kloster und allen anderen. Informationen zu sammeln war eindeutig ihre Pflicht. Was sie damit machte, unterlag ihrem Urteil und ihrer Erfahrung. Miss Dempsey würde sogar im Beichtstuhl lauschen, wenn sie könnte. Oft schon hatte sie überlegt, wie das wohl möglich wäre.
Allein am Frühstückstisch zurückgeblieben, starrte Vater Angwin in seine Teetasse und bewegte sie hin und her. Miss Dempsey wusste nicht mit dem Teesieb umzugehen. In den Teeblättern war zwar nichts Besonderes zu erkennen, doch Vater Angwin hatte für einen Moment das Gefühl, dass jemand hinter ihm in die Küche gekommen war. Wie in einer Unterhaltung hob er den Blick, aber da war niemand. »Komm herein, wer immer du bist«, sagte er, »und trink etwas bitteren Tee.« Vater Angwin war ein listiger Mann, Augen und Haare hatten die Farbe toter Blätter. Er neigte den Kopf leicht zur Seite, atmete schnüffelnd ein und scheute vor dem zurück, was er da roch. Irgendwo im Haus schlug eine Tür.
Und Agnes Dempsey: wie sie mit dem Staubwedel in der Hand über den staublosen Schreibtisch fuhr. In den letzten Jahren war ihr Gesicht sanft nach unten gerutscht, einem leichten Baumwollstoff gleich, der sich in einer Schachtel bauscht, und ihr Hals fiel in mehligen, runden Falten hinter den Schutz ihrer Kleidung. Ihre Augen waren rund wie die eines Kindes, leuchtend blau, der Ausdruck überrascht, verstärkt noch durch die unsichtbaren Brauen und das verblichene, grau melierte Gold ihres Haares, das wie statisch aufgeladen in die Luft stand. Über den kurzen, flaschenförmigen Beinen trug Miss Dempsey Faltenröcke, dazu pastellfarbene Twinsets, die die zarten Hügel ihrer Brust bedeckten. Ihr Mund, klein, blass und kaum zu erkennen, war wie dafür gemacht, all die Dinge aufzunehmen, die sie so gern mochte: Eccles Cakes, Vanilleschnitten und Miniatur-Schokoröllchen, die in rot-silberne Folie gewickelt waren. Es war ihr zur Gewohnheit geworden, die Folie vorsichtig herunterzuziehen, dünn wie einen Stift zusammenzudrehen und Ringe daraus zu formen, die sie sich über den Ringfinger schob. Dann hielt sie beide Hände vor sich hin, die blutleeren Finger leicht krumm von der beginnenden Arthritis, und bewunderte sie, wobei sich an ihrer linken Braue oberhalb der Nase eine Konzentrationsfalte bildete. Schließlich legte sie sich die Hand mit dem Ring noch eine Weile aufs Knie, zog ihn herunter und warf ihn ins Feuer. Das war Miss Dempseys ganz persönliches kleines Ritual, bei dem sie noch niemand beobachtet hatte. Über der Oberlippe, rechts, hatte sie eine kleine, flache Warze, so farblos wie ihr Mund. Es fiel ihr schwer, sie nicht zu befühlen. Miss Dempsey hatte Angst vor Krebs.
Als der Bischof hereingeeilt kam, hatte Vater Angwin seinen Kater überwunden und saß mit gekonnt einschmeichelndem Lächeln in der guten Stube.
»Vater Angwin, Vater Angwin«, sagte der Bischof, durchquerte den Raum und ergriff ihn: Die eine Hand drückte seinen Oberarm, die andere pumpte seine Rechte auf und ab, fast außer sich vor Herzlichkeit, und doch schwamm Argwohn im Funkeln der bischöflichen Zweistärkenbrille und der Bischofskopf wanderte wie das bewegliche Ziel, das man auf einer Kirmes zu treffen versucht, mechanisch von einer Seite zur anderen.
»Tee«, sagte Vater Angwin.
»Ich habe keine Zeit für Tee«, sagte der Bischof und trat auf den Kaminvorleger. »Ich bin gekommen, um mit Ihnen über die Vereinigung aller unvoreingenommen denkenden Menschen in der Familie Gottes zu sprechen«, sagte er. »Nun ja, nun ja, Vater Angwin. Bei Ihnen rechne ich da mit Schwierigkeiten.«
»Wollen Sie sich nicht setzen?«, fragte Vater Angwin zurückhaltend.
Der Bischof verschränkte die rosafarbenen Hände vor dem Leib, sah den Priester streng an und wiegte sich ganz leicht vor und zurück. »Die nächste Dekade, Vater Angwin, ist die Dekade der Eintracht. Die Dekade des Zusammenkommens. Die Dekade der menschlichen Familie Christi. Die Dekade der christlichen Gemeinschaft im Austausch mit sich selbst.« Agnes Dempsey kam mit einem Tablett herein. »Oh, wenn Sie ihn schon bringen«, sagte der Bischof.
Als Miss Dempsey den Raum wieder verlassen hatte – ihre Knie waren ganz steif vom nassen Wetter, und sie brauchte daher ihre Zeit –, sagte Vater Angwin: »Meinen Sie eventuell: die Dekade, um das Kriegsbeil zu begraben?«
»Die Dekade der Versöhnung«, sagte der Bischof. »Die Dekade der Freundschaft, der Koexistenz und der Vielen-in-Einem.«
»Sie sprechen, wie ich noch nie jemanden habe sprechen hören«, sagte Vater Angwin.
»Der ökumenische Geist«, sagte der Bischof. »Spüren Sie ihn nicht in der Luft? Spüren Sie nicht, wie er mit den Gebeten einer Million christlicher Seelen in Ihre Richtung weht?«
»Im Nacken spüre ich ihn.«
»Bin ich meiner Zeit voraus?«, fragte der Bischof. »Oder hinken Sie ihr hinterher, Vater Angwin? Schließen Sie Augen und Ohren vor dem Wind des Wandels? Schenken Sie ruhig den Tee ein, ich kann es nicht ausstehen, wenn er zu lange gezogen hat.«
Vater Angwin tat, wie ihm geheißen, der Bischof ergriff seine Tasse, wackelte leicht damit und nahm einen heißen Schluck. Immer noch vor dem Kamin stehend, drehte er die Füße ein wenig weiter nach außen, legte den freien Arm hinter den Rücken und atmete hörbar ein und aus.
»Er ist erzürnt«, sagte Vater Angwin mit leiser Stimme, aber nicht zu sich selbst. »Ich erzürne ihn. Sagen Sie, ist der Tee heiß genug? Gut genug? Möchten Sie etwas Whisky hinein?« Er hob die Stimme. »Ich habe so gut wie keine Vorstellung, worauf Sie hinauswollen.«
»Nun«, sagte der Bischof. »Haben Sie von der Messe in Landessprache gehört? Haben Sie darüber nachgedacht? Ich denke darüber nach. Ich denke ständig darüber nach. In Rom gibt es Männer, die darüber nachdenken.«
Vater Angwin schüttelte den Kopf. »Da könnte ich nicht mitmachen.«
»Keine Wahl, mein guter Mann, da haben Sie keine Wahl. In fünf Jahren, lassen Sie sich das gesagt sein, vielleicht auch etwas mehr als fünf Jahren …«
Vater Angwin hob den Blick. »Meinen Sie«, sagte er, »die Leute werden verstehen, was wir sagen?«
»Genau darum geht es.«
»Schlimm«, murmelte Vater Angwin durchaus hörbar. »Reiner Unsinn.« Dann lauter: »Ich kann verstehen, wenn Sie denken, Latein sei zu gut für die Leute. Aber das Problem, das sich mir stellt, ist ihr mangelndes Verständnis des Englischen.«
»Das sehe ich durchaus«, sagte der Bischof. »Die Leute von Fetherhoughton sind nicht unbedingt gebildet. Das würde ich nicht behaupten.«
»Was soll ich also tun?«
»Wir tun alles, um die Menschen voranzubringen, Vater. Ich meine da nicht den sozialen Wohnungsbau, der, wie ich weiß, in der Gegend hier ein wunder Punkt ist …«
»Requiescant in pace«, murmelte Vater Angwin.
»… aber werden den Leuten nicht Brillen verschrieben? Werden ihre Zähne nicht versorgt? In diesen Zeiten, Vater Angwin, wird getan, was getan werden kann, um die materielle Situation der Menschen zu verbessern, und es ist Ihre Aufgabe zu überlegen, wie sie sich auch spirituell fördern lassen. Und ich habe da ein paar Hinweise und Tipps für Sie, die Sie freundlicherweise annehmen werden.«
»Ich sehe nicht, warum ich das sollte«, sagte Vater Angwin wieder durchaus laut genug, um gehört zu werden, »wo Sie doch so ein alter Narr sind. Ich verstehe nicht, warum ich in meiner Gemeinde nicht der Papst sein soll.« Er hob den Blick. »Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung.«
Der Bischof starrte ihn mit blanken Augen an. Er schürzte die Lippen, sagte aber erst wieder etwas, als er die zweite Tasse getrunken hatte: »Ich möchte mir die Kirche ansehen.«
An diesem frühen Punkt mag ein Blick auf die Topografie des Dorfes Fetherhoughton lohnen, wie auch auf die Sitten und Gebräuche seiner Einwohner und darauf, wie sie sich zu kleiden pflegten.
Das Dorf lag in einem Moorgebiet, von dem es auf drei Seiten umgeben war. Die dahinter liegenden Berge sahen von den Straßen des Dorfes wie der gesträubte, hingekauerte Rücken eines schlafenden Hundes aus, und die allgemeine Haltung der Leute war, keine schlafenden Hunde zu wecken, denn sie hassten die Natur. So wandten sie ihre Blicke denn der vierten Seite zu, der Straße und der Eisenbahn, die sie ins schwarze Herz des industriellen Nordens trugen: nach Manchester, Wigan, Liverpool. Dennoch waren sie keine Stadtmenschen und besaßen nicht deren Neugier. Landmenschen waren sie allerdings auch nicht. Ja, sie konnten eine Kuh von einem Schaf unterscheiden, doch davon lebten sie nicht. Die Baumwolle war ihr Geschäft, und das seit fast einem Jahrhundert. Es gab drei Webereien, aber keine Tracht, nichts Malerisches.
Im Sommer war das Moor schwarz. Winzige ferne Gestalten schwärmten über Hügel und Berge, Leute von der Wasserbehörde und der Forstverwaltung. In den Falten der Erhebungen, außer Sicht, gab es zinnfarbene Wasserspeicher. Das erste Ereignis des Herbstes war der Schnee, der den Pass durch die Moore hinüber nach Yorkshire blockierte, was allgemein als eine gute Sache galt. Den ganzen Winter über blieben die Berge schneebedeckt. Bis April schmolz der Schnee zu einzelnen Flecken zusammen, und erst im Mai, wenn es wirklich warm wurde, verschwand er ganz.
Mit einer einzigartigen Willensanstrengung hielten die Menschen von Fetherhoughton den Blick von den Mooren abgewandt und redeten auch nicht über sie. Sprach jemand von der wilden Würde und Größe der Landschaft, gab er sich damit als Fremder zu erkennen. Die Fetherhoughtoner ignorierten das alles, waren nicht Emily Brontë und wurden auch nicht dafür bezahlt, es zu sein, und schon die bloße Andeutung, dass es um etwas Brontëhaftes gehen mochte, reichte, dass sie sich verschlossen und die Augen mit dem Betrachten ihrer Schuhriemen beschäftigten. Die Moore waren der riesige Friedhof ihrer Fantasie. Später sollte es zu berüchtigten Morden in der Gegend kommen, deren Opfer dort ebenfalls begraben wurden.
Die Hauptstraße von Fetherhoughton hieß bei den Einheimischen »Upstreet«: »Ich geh die Straße rauf«, sagten sie, »in die Upstreet, zum Co-op-Textilladen.« Arm waren sie nicht. Hinter Schaufensterdekorationen mit Dosenlachs standen die Händler an ihren Aufschneidemaschinen mit durchwachsenem Speck bereit. Neben dem Co-op-Textilladen, der Co-op-Gemischtwarenhandlung, dem Co-op-Fleischer, dem Co-op-Schuhgeschäft und dem Co-op-Bäcker gab es noch Madame Hildas Moden und einen Friseur, der die jungen Frauen in Einzelkabinen setzte, mit Plastikvorhängen voneinander getrennt, und ihnen die Haare in Dauerwellen legte. Einen Buchladen gab es nicht oder sonst etwas in der Art. Aber es gab eine öffentliche Bibliothek und ein Kriegerdenkmal.
Um die Upstreet herum verliefen andere, sich windende Straßen mit Steigungen von fünfundzwanzig Prozent, gesäumt von Reihenhäusern aus dem örtlich vorkommenden Stein. Sie stammten vom Ende des letzten Jahrhunderts und waren von den Webereibesitzern für ihre Arbeiter gebaut worden. Die Haustüren gingen direkt auf den Bürgersteig hinaus. Unten gab es zwei Zimmer, von denen das Wohnzimmer das »Haus« genannt wurde, was im unwahrscheinlichen Fall, dass jemand aus Fetherhoughton seine Tagesaktivitäten erklären wollte, zu folgender Aussage hätte führen können: »Heute Morgen hab ich oben sauber gemacht, heute Nachmittag mach ich mich ans Haus.«
Die Sprache der Fetherhoughtoner ist nur schwer wiederzugeben, es zu versuchen ist so abwegig wie sinnlos. Ihr Ernst und ihre archaische Förmlichkeit lassen sich nicht auf eine Seite bannen. Es war ein Dialekt, der sich, wie Vater Angwin glaubte, von der Sprache ringsum gelöst hatte. Irgendeine Strömung hatte die Fetherhoughtoner überrascht und weit von den navigierbaren Läufen des einfachen Englischs entfernt; sie trieben und tanzten auf eigenen Gewässern, ohne Paddel den Bach rauf.
Aber das ist eine Abschweifung, und in den Häusern des Ortes war kein Platz für Abschweifungen. Im »Haus« stand ein Kohleofen, alle anderen Räume waren unbeheizt, wobei es vielleicht einen Heizstrahler gab, mit einem einzelnen Stab, der für einen kaum definierten Notfall gedacht war. Aus der Küche, mit einem tiefen Spülbecken und einem Kaltwasserhahn, führte eine steile Treppe in den ersten Stock. Zwei Schlafzimmer, eine Mansarde, draußen ein gepflasterter Hof, den sich zehn Häuser teilten. Eine Reihe Kohlenschuppen, eine Reihe Außenklos: Jedes Haus hatte seinen eigenen Kohlenschuppen, die Klos teilten sich jeweils zwei. Das waren die gewohnten häuslichen Umstände in Fetherhoughton und den umliegenden Bezirken.
Und die Frauen von Fetherhoughton, wie ein Fremder sie sehen mochte – hatte der doch die Gelegenheit, sie zu sehen: Während die Männer in der Weberei festsaßen, standen die Frauen gerne in den Haustüren. Das war es, was sie taten. Freizeitaktivitäten für Männer waren: Fußball, Billard, Hühnerzucht. Männer bekamen kleine Leckereien, als Belohnung für gutes Verhalten: Zigaretten, ein Bier im Arundel Arms. Religion und die öffentliche Bibliothek waren was für die Kinder. Frauen redeten nur. Sie analysierten Beweggründe, besprachen die ernsten Sachen und trugen das Leben voran. Nach der Schule und vor ihrem Status als Frau hatten sie in den Webschuppen gearbeitet: Vom Lärm der Maschinen halb taub, redeten sie heute zu laut, und ihre Stimmen schallten wie die Schreie verlorener Möwen durch die düsteren Straßen.
Baumlose Straßen, durch die der Wind blies.
Und ihre Straßenkleidung (nicht das, was sie in der Tür stehend trugen): Plastik-Regenmäntel von einem schweren, zähen Grün, luftundurchlässig wie die Haut von Außerirdischen. Regnete es zufällig einmal nicht, wickelten die Frauen die Mäntel zusammen und ließen sie im Haus, wo sie wie Reptilien vom Amazonas wirkten, die sich zum Schlafen eingerollt hatten.
Im Haus trugen die Frauen Pantoffeln, halbhoch und vorn mit einem großen Reißverschluss. Gingen sie hinaus, war es eine kräftigere Version aus robustem dunkelbraunem Wildleder. Die Beine wuchsen wie Röhren daraus empor, man sah aber nur ein paar Zentimeter davon unter den Säumen ihrer schweren Wintermäntel.
Die jüngeren Frauen trugen andere Pantoffeln, die sie von Verwandten zu Weihnachten geschenkt bekamen. Sie waren schalenförmig, mit einer dicken Krause aus rosafarbenem oder blauem Nylonfell. Zunächst waren die Sohlen dieser Pantoffeln hart und glänzten wie Glas. Es dauerte eine Woche, bis sie eingetragen waren und unter dem Fuß nachgaben, und während dieser Woche sah ihre Trägerin oft voller Stolz, doch auch mit einem Schuldgefühl wegen des Luxus auf sie hinab, während das Nylon an ihren Knöcheln kitzelte. Aber nach und nach verlor das Fell seine Fülle und Spannkraft, Krümel fielen hinein, und bis zum Februar verfilzte es mit Pommes-Fett.
Von ihren Türschwellen starrten die Frauen die Vorbeikommenden an und lachten. Wurde ihnen ein Witz als Witz erzählt, erkannten sie ihn als solchen, hauptsächlich jedoch fühlten sie sich durch die körperlichen Besonderheiten ihrer Mitmenschen unterhalten und lebten in der Hoffnung, einen Buckligen vorbeikommen zu sehen, jemanden mit X-Beinen oder einer Hasenscharte. Sie hielten es nicht für grausam, sich über die, die den Schaden hatten, lustig zu machen, sondern fanden es ganz natürlich. Sie waren sentimental, jedoch ohne Mitleid, sehr verletzend und gnadenlos, was Anomalien, Abweichungen, Verschrobenheiten, aber auch Originalität anging. Es herrschte ein Geist, der sich so grundsätzlich gegen alle Anmaßung wandte, dass er selbst noch Ehrgeiz und sogar Bildung ablehnte.
Von der Upstreet zweigte die Church Street ab, eine weitere steile Straße mit Hecken links und rechts, die mit einem ascheartigen Belag aus Rauch und Staub überzogen waren. Die Church Street weitete sich nach oben hin zu einem breiten matschigen, steinigen Pfad, der in Fetherhoughton als der »Kutschweg« bekannt war. Vielleicht war irgendwann im vorigen Jahrhundert einmal eine Kutsche dort hinaufgefahren und hatte eine fromme Person befördert. Der Pfad führte nirgendwohin, nur zur Dorfschule, zum Kloster und zur Kirche St Thomas Aquinas. Vom Kutschweg verliefen Fußpfade zum Fleckchen Netherhoughton und zu den Mooren.
Über einer der kleineren Dorfstraßen stand eine Methodistenkapelle, vierschrötig und rot, mit einem Friedhof rundherum, auf dem die Kapellengänger ihr frühes Grab fanden. Es gab nur wenige Protestanten, die sich auf die verschiedenen Häuserreihen verteilten. Wohnen konnten sie überall, ihre Häuser waren nicht gleich von den anderen zu unterscheiden, nur dass bei ihnen kein Farbbild des Pontifex mit einem Kalender darunter an der Tür des Wohnzimmerschranks klebte.
Und doch waren die Protestanten in den Augen ihrer Nachbarn ganz anders, waren des sträflichen Unwissens schuldig und weigerten sich, die Grundsätze des wahren Glaubens anzuerkennen. Sie wussten von St Thomas Aquinas, wollten aber nicht hinein, weigerten sich, Mutter Perpetua ihre Kinder für eine gute katholische Erziehung zu überlassen, und schickten sie stattdessen mit dem Bus in ein anderes Dorf.
Mutter Perpetua sagte den Kindern mit ihrem berühmten, gefährlich süßen Lächeln: »Wir haben nichts dagegen, dass die Protestanten Gott auf ihre eigene Weise anbeten. Aber wir Katholiken ziehen es vor, es auf Seine Weise zu tun.«
Natürlich waren die Protestanten aufgrund ihres sträflichen Unwissens verdammt. In der Hölle würden sie schmoren. Etwa siebzig Jahre hatten sie, um mit dem Fahrrad durch die steilen Straßen zu fahren, zu heiraten, Brot und Schmalz zu essen: Dann kam die Bronchitis, die Lungenentzündung, eine gebrochene Hüfte. Der Priester ruft an, und der Blumenhändler flicht einen Kranz. Und am Ende reißt ihnen der Teufel das Fleisch mit der Beißzange von den Knochen.
Das ist gut nachbarschaftliches Denken.
Die Kirche St Thomas Aquinas war ein mächtiges Gebäude, das Mauerwerk mit den Rückständen von Ruß und Fett überzogen, das ursprüngliche Grau längst schwarz. Sie stand auf einer Art Pickel, erhöhtem Grund, was kleine Steintreppen und gepflasterte Aufgänge notwendig machte; rutschig und vermoost drängten sie sich am Fuß des Turmes und sahen aus wie ein paar Terrier zu Füßen eines gefährlichen, verdreckten Landstreichers.
Tatsächlich war die Kirche keine hundert Jahre alt. Sie war gebaut worden, als die Iren nach Fetherhoughton kamen, um in den Webereien zu arbeiten, aber jemand hatte dem Architekten gesagt, sie solle aussehen, als stünde sie schon immer da. In jenen armen, sorgenvollen Tagen war das ein verständlicher Wunsch, und der Architekt hatte ein Gefühl für Geschichte, ein shakespearesches Gefühl für Geschichte, mit großer Verachtung für mögliche anachronistische Fallstricke. Der letzte Mittwoch und die Schlacht von Bosworth gehören zusammen, die Vergangenheit ist die Vergangenheit, und die am letzten Mittwoch begrabene MrsO’Toole liegt im Rennen in die Ewigkeit Kopf an Kopf mit König Richard. Das war, das muss die Sicht des Architekten gewesen sein. Von den Römern bis zu den Hannoveranern war für ihn alles gleich: Sie alle trugen, zweifellos, Lederwamse und eiserne Kronen, verbrannten Hexen, und ihre Gebäude waren aus Stein, malerisch, kalt und mit Fenstern, die nicht wie unsere waren. Und sie schlugen sich auf die Schenkel und sagten: »Wohl denn!« Nur solch ein Blick hatte die Tingeltangel-Mittelalterlichkeit von St Thomas Aquinas schaffen können.
Der Architekt hatte vage gotisch begonnen und mit etwas Sächsischem, Brutalem geendet. Am westlichen Ende gab es einen Turm ohne Spitze oder Fialen, aber mit einer Brustwehr. Unter dem Vorbau standen steinerne Bänke und ein einfaches Weihwasserbecken, drum herum lagen schlecht riechende Matten, von schlurfenden Schritten dünn gewetzt. Die Matten waren ständig triefnass und womöglich aus einem wasseranziehenden pflanzlichen Gewebe. Der Eingang verfügte über einen Bogen im normannischen Stil, aber ohne versetzte kleinere Bögen, kleine Säulen oder sonst einen Schmuck und war nicht mal mit einer Raute, einer Zickzacklinie oder einem Winkelstreifen verziert. Streng war die Laune an dem Tag gewesen, da der Eingang entworfen wurde, und die Tür war mit Angeln und Eisenbeschlägen versehen, die an eine Belagerung, an Hunger und Menschen denken ließen, die nur noch Ratten zu essen hatten.
Drinnen, in der grubenhaften Düsternis, stand ein tiefes, schmuckloses Taufbecken auf einem einzelnen, einfachen Fuß, das groß genug war, um eine Mehrlingstaufe zu bewältigen oder ein Schaf darin zu baden. Im Westen gab es eine Galerie für die Orgel, mit noch größerer Düsternis darunter, und die Galerie selbst sah man erst, wenn man in die Schwärze dort eintauchte. Hinauf ging es durch eine kleine Tür mit Miniatur-Belagerungsbeschlägen, hinter der eine tückische Wendeltreppe mit hohen, steilen Stufen nach oben führte. Es gab zwei Seitenkapellen, zwei Gänge, und in den seitlichen Säulengängen wurde die Verwirrtheit des Architekten am deutlichsten: Manche der Bögen waren rund, andere spitz, dem Anschein nach spontanen Entscheidungen folgend, und wer durchs Hauptschiff ging, dem vermittelte das stilistische Durcheinander fälschlicherweise einen heroischen Eindruck, als wäre die Kirche wie eine der großen europäischen Kathedralen in Jahrhunderte auseinanderliegenden Phasen errichtet worden. Die Schäfte der Säulen waren plumpe, massige Zylinder aus grauem, feinnarbigem Stein, und ihre unbearbeiteten Kapitelle glichen Transportkisten.
Die Spitzbogenfenster waren paarweise angeordnet und wurden von sparsamen Maßwerken beherrscht, hier einem Kreis, da einem Vierpass, dort einem gekreuzten Dreipass. In jedem der Fenster stand ein Heiliger mit seinem Namen in einer unlesbaren germanischen Frakturschrift auf einer sich öffnenden Schriftrolle. Die Gesichter der Glasheiligen waren identisch, ein Ausdruck wie der andere, und das Glas selbst war das einer Textilstadt, hatte einen lichtabweisenden, industriellen Charakter, und die Farben waren so grell wie abscheulich: Ampelgrün, Zuckertütenblau und dazu das fade, säuerliche Rot billiger Erdbeermarmelade.
Der Boden bestand aus Steinplatten, die langen Bänke waren in einem fleckigen Siruprot lackiert, die Türen zum einzigen Beichtstuhl niedrig und verriegelt wie ein Kohlenschuppen.
Vater Angwin und der Bischof kamen durch den zugigen Gewölbezugang aus der Sakristei bei der Marienkapelle im Nordgang in die Kirche und sahen sich um. Nicht, dass es ihnen etwas gebracht hätte. Alles in allem war St Thomas Aquinas so finster wie Notre-Dame und glich ihr darüber hinaus in einer weiteren alarmierenden Besonderheit: Ganz gleich, wo man sich befand, man verlor alles Gespür dafür, was in den anderen Teilen der Kirche geschehen mochte. Man konnte die Decke nicht sehen, obwohl einen doch, in St Thomas Aquinas, das unbehagliche, kriechende Gefühl begleitete, dass sie sich nicht hoch über dem Kopf befände und womöglich langsam absenkte, ganz langsam, um ihr Ziel zu verbergen, sich eines schönen Wintertages mit den Steinplatten des Bodens zu vereinen und zu einem festen Block Mauerwerk zu werden, die Kirchgänger in sich gefangen. Die Innenräume der Kirche waren Ansammlungen von Finsternis, mit Kanälen noch tieferer Finsternis zwischen sich, in denen Gipsheilige standen, die der Bischof nun, so gut es ging, in Augenschein nahm. Auf schweren eisernen Gestellen, die so massiv waren wie die Gitter eines Raubtierkäfigs, flackerten Andachtskerzen vor den meisten von ihnen. Es war ein lichtloses Flackern wie von Sumpfgas in einem kaum spürbaren, atemlosen Wind. Es zog in der Kirche, richtig, und die Luftzüge folgten den Andächtigen wie ein schlechter Ruf, der ihnen gegen die Fesseln schlug und an ihren Kleidern hochkletterte, so wie es Katzen bei Menschen tun, die sie nicht mögen. War die Kirche leer, ruhte die Luft und pfiff nur von Zeit zu Zeit über die Bodenplatten, und die Kerzenflammen reckten sich in die Höhe, gerade und dünn, den Nadeln eines Schneiders gleich.
»Diese Statuen«, sagte der Bischof. »Haben Sie eine Taschenlampe?« Vater Angwin antwortete nicht. »Dann führen Sie mich herum«, verlangte der Bischof. »Hier fangen wir an. Ich kann diesen Burschen nicht identifizieren. Ist es ein Neger?«
»Nicht wirklich. Er ist angemalt. Viele sind das. Es ist der heilige Dunstan. Sehen Sie seine Zange nicht?«
»Wozu hat er eine Zange?«, fragte der Bischof grob. Den Wanst vorgereckt, starrte er den Heiligen feindselig an.
»Er war gerade in seiner Schmiede, als der Teufel kam, um ihn zu versuchen, und der Heilige packte seine Nase mit der rot glühenden Zange.«
»Ich frage mich, welchen Versuchungen man sich in einer Schmiede gegenübersehen kann.« Der Bischof linste ins Dunkel. »Da stehen eine Menge Heilige, Vater. Sie müssen mehr Statuen haben als alle anderen Kirchen in der Diözese.« Er wanderte den Gang hinunter. »Wie haben Sie die alle bekommen? Woher sind sie?«
»Die standen hier schon lange vor meiner Zeit. Sie waren immer schon hier.«
»Sie wissen, dass das unmöglich ist. Jemand hat sich für sie entschieden. Wer ist die Frau mit der Kombizange? Das ist ja der reinste Eisenwarenladen.«
»Die heilige Apollonia. Die Römer haben ihr die Zähne herausgeschlagen. Sie ist die Schutzheilige der Zahnärzte.« Vater Angwin sah in das nach unten gewandte, ausdruckslose Gesicht der Märtyrerin. Er bückte sich, holte eine Kerze aus der Holzkiste zu Füßen der Statue und steckte sie an der einzelnen Kerze von Dunstan an. Vorsichtig trug er sie zurück und stellte sie in einen von Apollonias Kerzenhaltern. »Niemand kümmert sich um sie. Die Leute hier halten nicht viel von Zahnärzten. Ihnen fallen die Zähne schon ziemlich früh aus, und sie empfinden es als Erleichterung.«
»Weiter«, sagte der Bischof.
»Das hier sind meine vier Kirchenväter. Den heiligen Gregor werden Sie an seiner päpstlichen Tiara erkennen.«
»Ich sehe nichts.«
»Glauben Sie es mir einfach. Dort steht der heilige Augustinus, der ein Herz hält, von einem Pfeil durchbohrt. Und die anderen Väter. Der heilige Hieronymus mit seinem kleinen Löwen.«
»Der ist wirklich klein.« Der Bischof lehnte sich vor und war praktisch Nase an Nase mit ihm. »Ganz und gar nicht realistisch.«
Vater Angwin legte die Hand auf die gewölbte Mähne des Löwen und fuhr mit dem Finger über seinen Rücken. »Hieronymus ist mein Lieblingsheiliger. Ich stelle ihn mir in der Wüste vor, mit seinen wilden Augen und seinen nackten Einsiedlerknien.«
»Wer noch?«, sagte der Bischof. »Ambrosius. Ambrosius mit dem Bienenkorb.«
»Der heilige Bienenkorb, wie ihn die Kinder nennen. In ähnlicher Weise hieß es in der Gemeinde vor etwa zwei Generationen, dass Augustinus der Bischof von Hippo sei, der Bischof der Flusspferde, und seitdem, fürchte ich, gibt es da einiges an Verwirrung, die sorgsam, verstehen Sie, von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben wird.«
Der Bischof ließ ein leises Brummen hören, tief in der Kehle. Vater Angwin hatte das Gefühl, ihm irgendwie in die Hände gespielt zu haben. Dass er denken musste, dass ihm, dem Pfarrer, die Verwirrung wichtig sei.
»Aber was macht das?«, sagte er schnell. »Sehen Sie die heilige Agathe hier, die arme Christenseele, mit ihren Brüsten auf einem Tablett. Warum ist sie die Schutzheilige der Glockengießer? Weil ein kleiner Fehler mit der Form gemacht wurde, das kann man verstehen. Warum segnen wir am fünften Februar Brot auf einem Tablett? Weil sie nicht nur wie Glocken, sondern auch wie Brötchen aussehen. Es ist ein harmloser Fehler, schicklicher als die Wahrheit und weniger grausam.«
Mittlerweile waren sie fast ganz hinten in der Kirche angelangt, und gegenüber im Nordgang gab es weitere Heilige. Der heilige Bartholomäus hielt das Messer gefasst, mit dem er geschunden worden war, die heilige Cäcilia ihre tragbare Orgel. Mit einem dümmlichen Ausdruck, der von ihrem matten Lächeln und einer abgestoßenen Nase herrührte, streckte die Jungfrau ihre blauen Arme steif unter ihrem Gewand aus, und die heilige Therese, die »kleine Blume«, sah finster hinter einem Rosengebinde hervor.