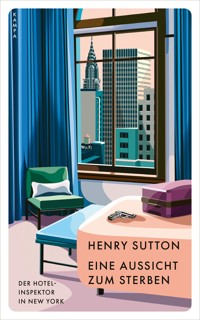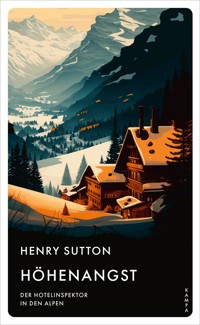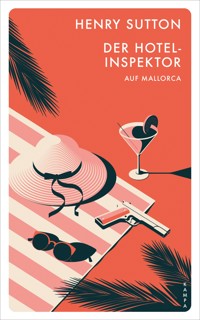
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
Er hat einen Traumjob: In Fünfsternehotels an den schönsten Orten der Welt übernachten, in Gourmetrestaurants schlemmen, sich im Spa verwöhnen lassen - und dabei noch Geld verdienen. Ben Martin ist Hotelinspektor der exklusiven Hideaway Hotels Group und reist inkognito um die Welt, immer mit dem Auftrag, Ausstattung und Service der Hotels auf Herz und Nieren zu prüfen. Ihm entgeht nichts: kein Staubkorn unter dem Bett, keine Falte im Hemd des Barchefs. Ist der Dry Martini perfekt gerührt, das Frühstücksei auf den Punkt gekocht? Wie oft klingelt es, bis der Concierge ans Telefon geht? Aber keine Nachlässigkeit im Service ist so schlimm wie ein Mord, der mit dem Hotel in Verbindung gebracht wird und dem Renommee der Gruppe schaden könnte. Im Hotel Pin d'Or auf Mallorca sind die Gäste so vornehm und nobel wie das Haus selbst, nur die zwei Russen in Begleitung eines Holländers, deren Jachten vor der Insel liegen, haben Martins Aufmerksamkeit erregt. Sich so unauffällig wie nur möglich zu verhalten, ist Martins täglich Brot, und so beginnt er, nicht nur das Personal, sondern auch die anderen Gäste im Blick zu behalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry Sutton
Der Hotelinspektor auf Mallorca
Roman
Aus dem Englischen von Johannes Sabinski
Kampa
Ein Vormittag Mitte Juni, die warme Luft duftete nach Meer und Mandeln, Pool und Sonnenmilch, und Ben Martin dachte, sollte er jetzt sofort sterben, hätte er wenigstens vom Paradies auf Erden gekostet. Besser konnte es eigentlich nicht mehr werden. Solche Augenblicke musste man festhalten. Er wusste nämlich auch, dass Ansichten sich ändern und Eindrücke täuschen konnten und dass er beidem oft vorschnell erlag.
Die Sonne drang durch den Baldachin aus Weinranken, der sich über die Terrasse erstreckte, und warf Muster auf den Saum des weißen Tischtuchs und die überraschend kühlen und glatten Terrakottafliesen. Ben hatte seine Budapester abgestreift und trank einen dünnen, kalten Cappuccino, der zu viel Milch und zu wenig Koffein enthielt. In Spanien war Kaffee so oft enttäuschend, und auf den Balearen erst recht. Dennoch hätte ein Hotel dieser Kategorie einen anständigen hinbekommen müssen. Er würde es in seinem Bericht erwähnen. Ben gähnte.
Die nächsten Augenblicke würde er weder an die Arbeit denken noch an sonst etwas Beunruhigendes wie jene haarsträubende Störung um zwei Uhr morgens. Er wollte die Aussicht, den Duft und die Abgeschiedenheit in vollen Zügen genießen.
Ben ließ den Blick über die Wipfel der Zirbelkiefern, Steineichen und Olivenbäume unter ihm schweifen. Eine lange, schnittige Motorjacht beherrschte die nächstgelegene Bucht. Das Wasser war völlig ruhig. Zu seinem Morgenkaffee hatte er sich noch einen Hierbas-Likör bestellt, um in Mittelmeerstimmung zu kommen und um zu sehen, ob er korrekt serviert würde, ohne Eis. Wurde er. Ben trank ihn in einem Zug.
Die dunstige grüne Landzunge hinter Cala Deià an der Nordwestküste der wunderschönen Insel Mallorca erhob sich aus dem Meer und ragte immer weiter empor, bis sie den höchsten Gipfel der Serra de Tramuntana bildete. Diese zerklüftete Gebirgswand trennte die schicken und exklusiven Enklaven im Norden der Insel vom überfüllten, unmäßig verstädterten Süden.
Wenige Kilometer außerhalb von Deià, in Richtung der berühmten Orangenhaine von Sóller, lag das Hotel Amagat, ein Fünf-Sterne-Haus und eines von zwei Hideaway-Hotels auf den Balearen. An eine Bergflanke geschmiegt, schien das Amagat in ständiger Gefahr zu schweben, durch den naturbelassenen mediterranen Wald ins Meer abzurutschen. Doch das Hauptgebäude, einst ein Landsitz, hatte seine Stellung seit dem siebzehnten Jahrhundert majestätisch gehalten.
Der riesige Infinitypool direkt hinter der Terrasse war letztes Jahr neu hinzugekommen. Sehr zu Bens Überraschung zog darin gerade eine Frau in einem weißen Bikini ihre Bahnen. Sie hatte schulterlanges Haar und brachte es fertig, mit einer überdimensionalen schwarzen Sonnenbrille von Gucci auf der Nase zu schwimmen – die verflochtenen goldenen Gs funkelten in der Sonne. Ganz offensichtlich wollte sie auf keinen Fall die Gläser nass spritzen, denn ihre Schwimmbewegungen waren überaus langsam. Ein Wunder, dass die Frau nicht unterging.
Und ein Wunder, dass sie nach letzter Nacht so gelassen wirkte.
Ben stellte das leere Likörglas zurück auf den Tisch und setzte sich mit einem Ruck auf. Ihm war plötzlich ein Gedanke gekommen. Wo war ihr Partner an diesem Morgen, der riesige Mann mit den riesigen Händen, der sich Wim Jansen nannte?
1
Ben war am Abend zuvor in zerknittertem Zustand eingetroffen, mit Falten im Anzug überall dort, wo sie nicht hingehörten. Er hatte sich nach einem kräftigen Schluck gesehnt und dennoch sofort das hoteleigene Restaurant mit Michelin-Stern angesteuert. Alles im Rahmen seiner Pflicht als Hotelinspektor für die Hideaway-Gruppe. Mit seinem Gehalt konnte er zu Hause schwerlich angeben – nicht dass sich seine Wohnung im Londoner Stadtteil Greenwich noch wie ein richtiges Zuhause anfühlte –, die beruflichen Annehmlichkeiten hingegen waren außerordentlich.
Konnte er denn in seiner Situation und in seinem Alter wirklich mehr erwarten? Ein zweiundfünfzigjähriger geschiedener Vater einer Heranwachsenden – nicht eben der Stoff, aus dem Träume gemacht sind, so viel war mal sicher. Immer noch malte er sich aus, eines Tages den großen internationalen Bestseller zu verfassen. Zumindest hatte er genug Zeit zum Schreiben – nicht nur von Hideaway-Berichten.
Irgendetwas mit irgendwem zu teilen war schwierig, denn sein Job erforderte größte Verschwiegenheit. Wenn er auf Reisen war, um ein Hotel zu inspizieren, konnte er niemandem erzählen, womit er sein Geld verdiente. Er reiste unter falschem Namen und mit falschem Firmenausweis. Seinen Pass hielt er unter Verschluss. In der Welt der Luxushotels sprach Geld eine viel deutlichere Sprache als Papiere. Sicher, gestern Abend hatte der tadellos gekleidete Oberkellner jeden Blick auf seinen zerknitterten Anzug geflissentlich vermieden und es verdächtigerweise bewerkstelligt, ihm sofort einen Tisch in bester Lage auf der gut besuchten Terrasse zu besorgen.
Ben hatte entschieden, darüber hinwegzusehen. Nach seinem Billigflug ohne jedweden Schnickschnack hatte er vorzügliches Essen aus regionalen Zutaten, unverschämt guten Wein und eine behagliche Umgebung dringend nötig gehabt. Er hatte schon häufiger darüber nachgedacht, dass es seine ehrliche Hingabe an die schönen Dinge des Lebens war, die ihn zu einem guten Hotelinspektor machte – vielleicht hatte er tatsächlich seine Berufung gefunden.
Als Journalist war er nicht mehr vorangekommen und dann entlassen worden, weil das Wirtschaftsmagazin, für das er arbeitete, dem Digitalzeitalter erlag, wie jede andere ihm bekannte Zeitschrift. Die Nachfrage nach abstrus luxuriösen Hotels, schicken Zimmern und guten Speisen wuchs zum Glück. Die Reichen und Erfolgreichen schienen immer reicher und erfolgreicher zu werden und mussten sich, Gott sei Dank, weiterhin gegenseitig verköstigen und beeindrucken.
Wim Jansen und seine in Zeitlupe schwimmende Partnerin Juliet de Vries, als welche Ben die beiden inzwischen kannte, hatten einen Tisch weiter gesessen, in aufdringlich romantischen Kerzenschein getaucht und lautstarkem Zikadengezirpe ausgesetzt. Das bisschen Seide, das sie trug, stand ihr sehr gut – ein hellblaues rückenfreies Kleid mit tiefem Ausschnitt. Er kam in der üblichen Aufmachung des korpulenten Superreichen mittleren Alters daher: weißes Leinenhemd über dunkler Leinenhose, mehrere klobige Halsketten, die zweifellos ihr Gewicht in Gold wert waren, Armreifen ähnlichen Kalibers – sah Ben da auch eine Rolex? – und dazu die denkbar schmalsten Slipper.
Was hatten groß gewachsene Männer nur immer mit diesen Schuhen? Ben trug nie etwas anderes als Budapester. Er hatte mehr als zehn Paar davon in unterschiedlich reparaturbedürftigem Zustand, weil sie, wie er seiner Ex-Gattin schon zu oft erzählt hatte, ewig hielten. Hatte sie darum genug von ihm gehabt? Sein Fimmel für Budapester. Wie wär’s zur Abwechslung mal mit trendigen Turnschuhen, hatte sie einmal gesagt. Sei das nicht ein Widerspruch in sich, hatte er entgegnet. Es war einer ihrer gemäßigteren Wortwechsel gewesen. Seine Budapester, allesamt in Brauntönen gehalten, waren ausnahmslos von Crockett and Jones in der Jermyn Street in London. Langlebigkeit, Bequemlichkeit und eine schlichte Eleganz seien seine Markenzeichen, hatte er zu ihr gemeint. Überdies hatte sie etwas an der Farbe seiner Kleidung auszusetzen, die bis auf zwei dunkelgraue Hemden und einen Pullover ausschließlich blau war. Es erleichterte das morgendliche Ankleiden ungemein.
Sein ältester Freund Olly, ehemaliger A&R-Musikmanager und Drogengeschädigter, der sich nach einem Entzug als Restaurantbetreiber neu erfunden hatte, trug selbstverständlich immer nur trendige Turnschuhe – und zwar neue, weil sie ständig kaputtgingen. Dazu Jeans und Kapuzensweater. War das angemessen für einen Mann Mitte fünfzig? Ben konnte über Ollys Aufmachung hinwegsehen, weil er großartige Gesellschaft war, immer optimistisch und ein sprudelnder Quell guten Essens und Musikwissens.
Zu seinen interessanten Nachbarn auf der Terrasse gesellten sich bald zwei weitere Leute – ein halb so schwerer und offenbar halb so protziger Mann wie Jansen und eine ältere, rundlichere Ausgabe von de Vries. Sie trug ein orangerotes Oberteil mit langen Ärmeln, eine enge weiße Hose und silberne Sandalen. Auf dem linken Fußknöchel hatte sie eine kleine Tätowierung, die wie ein Vogel aussah.
Die Sprache hatte sofort von Holländisch zu Englisch gewechselt. Zunächst hatte Ben den Halbproleten und das orangene Oberteil für Polen gehalten, dann merkte er, dass es Russen waren. Sie hießen Roman und Anna. Die Männer redeten mindestens eine halbe Stunde lang über Motorjachten, die Frauen schnippten Asche ab und rollten unauffällig die Augen.
»Wehe, das Boot ist wieder nicht schnell genug. Das letzte hat nur dreißig, höchstens fünfunddreißig Knoten gemacht«, sagte Roman. »Und es war zu groß. Ein richtiger Tanker. Nutzlos.«
»Mit Spielzeugen kann ich nichts anfangen«, lachte Wim. »Was zählt, ist Reichweite. Dreihundert, vierhundert Kilometer mindestens – so was brauchst du.«
»Ich sag dir schon, was ich brauche«, entgegnete der andere.
Wim schnaubte, was er, wie Ben beobachtete, häufig tat. Als versuchte er, durch Luftausstoß seine Masse etwas zu vermindern. »Die hier ist eine echte Schönheit – das verspreche ich. Ich zeig sie dir heute Nacht. Morgen ist sie vielleicht schon weg.«
»Sie ist hier?«
»Ja, jetzt. Morgen krieg ich noch eine andere rein. Die wird dir auch gefallen. Ich habe gerade viele Kunden, meine Dienste sind sehr gefragt. Aber dir mache ich den besten Preis, wie immer.« Er klatschte in die Hände, rieb sie dann aneinander und stieß das tiefe Lachen eines lebenslangen Zigarrenrauchers aus.
»Du wirst mir zu teuer und lieferst nicht das, was ich haben will.«
»Wenn dir nicht gefällt, was du siehst«, er warf einen Blick zur hinreißenden de Vries, »dann verschwende nicht wieder meine Zeit. Ich bin stolz auf mein Geschäft, meine Ware. Einen besseren Deal kriegst du nirgendwo im ganzen Mittelmeerraum. Und denk dran«, er senkte die Stimme, »mich hintergehen ist nicht. Niemals.«
»Wir werden ja sehen. Dieses Hotel im Übrigen, ich kann’s nicht leiden«, sagte der Russe. Er schien an Selbstbewusstsein zu gewinnen. »Die Leute, die hier arbeiten. Denen traue ich nicht.«
Am Nachbartisch sank Ben in seinem dicken marineblauen Anzug in sich zusammen. Er betrachtete das akkurat ausgerichtete Besteck, das weiße, mit großen verchromten Klammern befestigte Tischtuch, die einzelne Kerze auf seinem Tisch und ihr elektronisches Flackern in einer Rauchglasvase. Von Weitem mochte sie vielleicht echt wirken.
Mit jäh erhobener Stimme sagte de Vries dann auf Englisch: »Diese Männer, die trauen doch keinem. Das ist ihr Leben.«
»Und unseres«, antwortete die Frau namens Anna erheblich leiser. »Aber ich kenne die Wahrheit.«
Ihr Essen kam. Die Vorspeisen: kleine, sorgfältig angerichtete Teller mit erlesenen regionalen Köstlichkeiten. Eine Sommelière präsentierte daraufhin eine Flasche 2004er Chambolle-Musigny – Ben war beeindruckt.
Wim Jansen machte sich nicht die Mühe, den Wein zu probieren, bevor er sich das Glas vollschenken ließ und den Inhalt rasch hinunterkippte. Die Weinkellnerin schien solches Verhalten durchaus gewohnt, blieb freundlich und lächelte.
Seinerseits hatte Ben eine Flasche Torre des Canonge blanc bestellt, der auf der hiesigen weißen Rebsorte Giró blanc beruhte. Er war kräftig, komplex und modern und passte wunderbar zu seinem eigenen ersten Gang – einem erstaunlichen Carpaccio von fangfrischen Roten Garnelen aus Sóller mit Orangenscheiben und Lavendelvinaigrette. Aber die Unterhaltung am Nebentisch störte ihn weiterhin.
Ben beschlich der Verdacht, dass Juliet etwas mit dem Russen am Laufen hatte. Der versuchte nicht mal zu verbergen, dass er ihr direkt auf die Brüste starrte. Das einzige anscheinend halbwegs entspannte Mitglied der Runde war Anna. Während Juliet in einer Garnele herumstocherte, verzehrte Anna genüsslich ihre Calamari.
Eine sanfte Meeresbrise wehte über die Terrasse, brachte die Lichterketten in den Weinranken sachte zum Schaukeln und die sonderbare Gruppe kurzzeitig zum Schweigen. Hunderte Meter tiefer lag das Mittelmeer, schwarz und ruhig.
Die Sterne hoch droben wurden von zwei Flutlichtern ausgeblendet, die auf vier riesige Palmen gerichtet waren: Wächter am Eingang des alten Herrensitzes. Ben wusste, dass der Himmel selbst zu dieser späten Stunde von Flugzeugen wimmelte, die Menschen von und nach Palma de Mallorca beförderten, in ihren Urlaub mit Freunden und Familie. Er wusste auch, dass die meisten Gäste des Amagat nicht wie er mit einer Billigfluglinie angereist waren. Ein paar dürften sogar mit Privatjets gekommen sein.
Ungeachtet dessen wusste er die drei perfekt gebratenen Lammkoteletts auf dem Teller vor ihm zu würdigen, die mit einer Kruste aus Kräutern und Oliven überzogen waren und von püriertem Fenchel und Tupfern von Olivenölgelee begleitet wurden. Vielleicht ein wenig einfallslos – bis auf die kandierten Lavendelzweige. Dennoch wünschte sich ein Teil von ihm, er hätte den Steinbutt mit Foie gras und Sherryjus gewählt, den Wim Jansen gerade serviert bekam.
Allein zu essen war, trotz der Güte der Speisen, ihrer Darreichung und des reizvollen Ambientes, die vielleicht schwerste seiner Pflichten. Es gab nur begrenzt viele Arten, einen Tisch einzudecken und zu dekorieren, und begrenzt viele Arten, ein Lamm zu würzen. Seine Berichte mussten ausführlich sein. Verstohlen schrieb er Stichpunkte auf – er hatte immer ein kleines Notizbuch und einen Stift zur Hand –, ehe etwas anderes seine Aufmerksamkeit auf sich zog.
Juliet hatte ebenfalls den Steinbutt bestellt. Wobei sie ihn kaum anrührte, sondern nur auf dem Teller herumschob. Ben war immer wieder fassungslos, wie viel Essen die Leute in den besten Restaurants der Welt stehen ließen. Er war dazu erzogen worden, seinen Teller leer zu essen, und hatte sich auch in seiner Ehe mit Alex daran gehalten. Es war sicher nicht das Essen gewesen, was dieser Beziehung den Garaus gemacht hatte. Alex und er waren beide ambitionierte Köche.
Und ganz gewiss war es auch nicht die Geburt ihrer wunderschönen Tochter Natalie gewesen, das mit Abstand Beste, was ihm im Leben passiert war. Auch hatte es nicht an ihrem Karrierismus gelegen – Alex war Firmenanwältin. Die Beziehung war, so hatte sie verletzend gesagt, an seinem Übereifer gescheitert: Er hatte ihr zu viel Liebe und Zuneigung gezeigt. Auch in der Öffentlichkeit. Küssen im Park, Händchenhalten auf der Straße, Wangenstreicheln im Restaurant – war das nicht, was Ehepaare taten? Sie kam mit seiner Aufmerksamkeit, seiner Liebe nicht zurecht.
Dass Alex zudem ein leidenschaftliches Verhältnis mit einer Kollegin unterhielt, kam erst später ans Licht. Er hatte sich damit abgefunden, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht hatten. Um Natalies willen versuchten sie weiterhin, respektvoll miteinander umzugehen, obwohl er natürlich ahnte, dass Alex ihn nie wirklich geliebt hatte.
Dafür war sie nun sehr glücklich mit Gabby verheiratet, und von ihren biederen Kollegen wurde die Beziehung gänzlich akzeptiert. Ebenso von Natalie, seit Kurzem vierzehn Jahre alt.
Ben dachte häufiger darüber nach, wie gern er sich Vollzeit um Natalie kümmern würde. Doch er wusste auch, dass Alex eine tolle Mutter war und sein Job häufiges Reisen und ein spärliches Gehalt mit sich brachte. Außerdem hatte Ben kein richtiges Zuhause mehr. Es gab zwar seine kleine Wohnung in Greenwich, aber darin meistens einen Untermieter oder Airbnb-Gäste.
Außerdem hatte Natalie zusehends mehr an materiellen Dingen und jeder kleinsten Art von Verschwendung auszusetzen. Unlängst war sie engagiertes Mitglied der Extinction Rebellion geworden, was es ihm noch schwerer machte, seinen Job vor ihr zu rechtfertigen.
Ben wählte als Dessert den sautierten Pfirsich mit Mandeleis, da es ihn unvermittelt nach Süßem verlangte, um seine trüben Gedanken zu verscheuchen. Und weil sich damit ein Likörwein rechtfertigen ließ. Gewöhnlich verzichtete er auf Nachtisch, nicht zuletzt, weil er neulich erschrocken festgestellt hatte, dass sein Hosenbund ein wenig eng geworden war. Bis zum Alter von fünfzig Jahren hatte er immer nur Kleidergröße M getragen.
Seine Garderobe wurde überwiegend von einem unabhängigen Designer und Kleidungsfabrikanten im ländlichen England angefertigt. Das Label Old Town bot stilistisch zusammengewürfelte, aber unverwüstliche Hemden, Jacken und Hosen an – zweckmäßig, wie er gern dachte. Es hatte inzwischen einen gewissen Kultstatus und wurde zuweilen in den hipperen Läden von East London gesichtet. Olly hielt es für einen schlechten Witz. Natalie pflegte entsetzt den Kopf zu schütteln, wobei er das Gefühl hatte, sie könnte sich noch mit der Aussage und den Prinzipien der Marke anfreunden, wenn auch nicht mit ihren Schnitten.
Als Ben seine jüngste Bestellung bei Old Town aufgab – für ein weiteres blaues Hemd aus Chambray-Stoff und eine eng anliegende Jacke mit vier Knöpfen aus marineblauem Köper –, hatte er der Mitinhaberin verlegen mitgeteilt, dass er die Sachen diesmal wohl in Größe L brauche.
»Keine Sorge. Sie sind nicht der erste Kunde in Ihrem Alter, dem das passiert«, hatte sie ihm am Telefon geantwortet.
Von flüchtigen Inaugenscheinnahmen abgesehen, suchte er die Fitnessräume der Hideaway-Anlagen selten und in großen Abständen auf. Lieber verschaffte er sich draußen Bewegung, auf Wegen, Feldern und Stränden – in der Natur.
»Ich hoffe, alles war nach Ihren Wünschen, Sir«, sagte plötzlich ein Kellner, der sich vorbeugte, um den leeren Dessertteller abzuräumen.
»Ausgezeichnet.« Ben nahm an, der Kellner hatte keine Ahnung, dass sie beide letztlich für dasselbe Unternehmen arbeiteten, mit seinen weltweit zehntausend Mitarbeitern und der Firmenzentrale in Frankfurt.
»Wäre Ihnen ein Kaffee recht oder ein Digestif?«
Ben war seit Langem an die internationale Sprache der gehobenen Küche gewöhnt. Er sah zu, wie Wim Jansen, Juliet de Vries und die beiden anderen ihren Tisch verließen und sich nach drinnen begaben, wobei sein Blick wie magisch von Juliets spärlich bedecktem Hinterteil angezogen wurde. Ben hatte gelegentlich Techtelmechtel mit anderen Hotelgästen. Aber seine unregelmäßigen Arbeitszeiten und die Tatsache, dass er Natalie so oft wie möglich sehen wollte, machten dauerhafte Beziehungen nahezu unmöglich. Ohnehin war er sich nicht sicher, ob er überhaupt eine feste Beziehung wollte, schließlich war er noch immer auf der Hut, sich nicht wieder in die Falsche zu verlieben.
»Ich nehme einen Digestif in der Bar«, sagte er. Er hatte genug von der warmen Brise, dem Duft nach Pinien und teuren Parfüms und von den ewiglich flackernden Kerzen. Außerdem wollte er den anderen ins Innere folgen. Sie hatten seine Aufmerksamkeit erregt. Sie machten hier keinen Urlaub.
2
Nachdem er die Rechnung für sein Menü inklusive fünfzehn Prozent Trinkgeld mit einem unleserlichen Gekrakel abgezeichnet hatte, erhob Ben sich rasch, klopfte die Sitzfalten aus seiner Hose und schlängelte sich über die Terrasse zum Haupteingang des Hotels.
Die Bar befand sich in einem langen schmalen Raum mit hohem Deckengewölbe. Er glich ein wenig einer Kapelle, gleichzeitig einschüchternd und heimelig. Die Beleuchtung war warm und gedämpft, das Mobiliar eine Mischung aus schweren Stühlen und Truhen, mallorquinische Antiquitäten womöglich, und ultramodernen Designerstücken aus Glas und Stahl. Alles wirkte gediegen und war in cremefarbenen und hellbraunen Tönen gehalten, mit gelegentlichen Farbtupfern in knalligem Violett bis Magentarot. Das Thema »Alte Verse, neues Lied« machte sich gut.
Solche Gegensätze konnten einander ergänzen. Olly versuchte schon ewig, Ben dazu zu bringen, moderner zu sein, gab ihm dies oder das zu hören, während der die Vorzüge von Dingen pries, die Bestand hatten. »Bis auf die Ehe, mein Freund«, hatte Olly einmal gesagt. Die beiden gaben ein seltsames Bild ab, wenn sie gemeinsam eine Bar oder ein Restaurant betraten. Ben in seinen Budapestern und Olly mit den neuesten Turnschuhen. Ihnen gefiel der Kontrast und Witz daran. Keiner von beiden würde sich je ändern.
Nur zwei Gäste waren in der Bar, und sie hatten keinerlei Ähnlichkeit mit dem faszinierenden Vierergespann. Diese beiden waren blass und fleckig im Gesicht und unterhielten sich lautstark auf Englisch, mit schottischem Akzent.
»Whiskey würde ich immer vorziehen«, sagte der Mann und schaute leicht angewidert sein Glas Brandy an.
»Whisky trinkst du doch immer«, entgegnete seine Begleitung. Sie war unaufdringlich stilvoll gekleidet und lächelte warm, aber nüchtern. »Warum nicht mal was anderes probieren, hier aus der Region? Wir sind schließlich im Urlaub.«
»Was wissen die Spanier schon von Brandy?«, meinte er. »Und ich wette, dieser Drink kostet ’ne Stange Geld. Im Voraus sagen sie’s einem nie, ist doch wahr.« Auch der Mann war gut, wenn auch konservativ gekleidet und wirkte keinesfalls mittellos.
»Was erwartest du in so einer Art Hotel? Barzahlung am Tresen? All you can eat? Entspann dich.«
Nicht zum ersten Mal dachte Ben, wie viele Leute mit Geld es gar nicht verdienten, sich so ein Hotel leisten zu können. Hätte er hingegen genug Geld, würde er nicht unbedingt hier absteigen. Man konnte gut und gern vier Mal im Jahr in einem normalen Hotel Urlaub machen für den Preis von einem Mal in einem Hideaway.
Der Barkeeper polierte Gläser und schaute aus Höflichkeit zur Decke. Ben schlenderte hinüber.
»Guten Abend«, sagte er auf Englisch. Er sah keinen Grund, Kastilisch oder Katalanisch zu sprechen. Die Belegschaft eines Hideaway, zumindest wenn sie Kontakt zu Gästen hatte, sprach Englisch – außer in Frankreich. War er in Frankreich, gab Ben sich immer Mühe mit der Landessprache. Er konnte einigermaßen Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und ein wenig Katalanisch, was ein Grund dafür war, dass er den Job bekommen hatte.
Ein anderer war, vermutete er, dass zu seinen letzten journalistischen Arbeiten ein Profil der Geschäftsführerin von Hideaway gehört hatte. Er war nach Frankfurt geflogen, um Emily Muller über ihren blitzartigen Aufstieg in der Branche zu interviewen. Sie hatten sich sofort gut verstanden. So gut sogar, dass sie ihn hinterher zum Essen ausgeführt hatte. Den überraschend vergnüglichen Abend hatten sie damit verbracht, über ihre Scheidungen, Wohnungskredite, Karriereentscheidungen und ihre Kinder zu reden. Vielleicht wäre sie mitgekommen, hätte er einen Absacker in seinem Hotel vorgeschlagen. Doch weil er in einem preiswerten Motel am Stadtrand übernachtete, hatte er es nicht getan.
Sie hatte ihn ein wenig eingeschüchtert, war äußerst klug, attraktiv und elegant gekleidet. Eine Gegeneinladung war lange überfällig. Nur war sie jetzt seine Chefin.
»Was darf es sein?«, fragte der Barkeeper, nachdem er ein perfekt poliertes Glas behutsam auf ein Bord zurückgestellt hatte.
Ben kletterte auf einen Barhocker – es gab nur vier, sie waren übermäßig gepolstert. Es gehörte zu seinen Privilegien, zu seinem Job, zu bestellen, was immer er wollte, und dabei das gesamte Angebot zu prüfen. Ben ließ seinen Blick an der eindrucksvollen Flaschensammlung im Eichenregal hinter der Bar entlangwandern und entschied sich rasch für einen mallorquinischen Brandy, einen achtzehn Jahre alten Suaz Reserve. Er hatte bei einem früheren Aufenthalt auf der Insel mit Alex und Natalie, nicht in diesem Hotel, sondern in einer Einzimmerwohnung in Puerto Pollensa, davon gehört. Damals hätte er sich den Brandy nicht leisten können, aber es war ein herrlicher Urlaub gewesen und einer der wenigen, die sie gemeinsam verbracht hatten.
»Gute Wahl«, sagte der Barkeeper mit einem Nicken. »Der kommt hier aus der Nähe. Die Familie Suaz ist für ihre Weine und Brandys berühmt.«
»Sind Sie Franzose?«, fragte Ben.
Der Barkeeper schüttelte den Kopf. »Marokkaner.«
Nachdem er Ben den Brandy eingeschenkt hatte, machte er sich wieder ans Gläserpolieren, mied auf einmal den Blickkontakt. Ben sah sich über die Schulter um, spürte, dass noch jemand im Raum war. Am Eingang zur Bar stand ein Mann im Anzug. Er starrte geradewegs in Richtung Bar, als würde er jemanden kontrollieren. Und nicht einfach irgendwen. Er schaute unmittelbar zum Barkeeper. Als er sah, dass Ben seinen Blick bemerkt hatte, ging er. Ben konnte sich ziemlich gut vorstellen, wer dieser Mann war.
»Woher genau in Marokko?« Ben wandte sich wieder seinem Getränk und dem Barkeeper zu. Obwohl der so viel herumpolierte, fand Ben nicht, dass sein eigenes Glas so sauber glänzte, wie es eigentlich sollte. Er hätte diesen Minuspunkt im Notizbuch vermerkt, wenn der Barkeeper nicht so verängstigt und seltsam schutzlos gewirkt hätte.
»Nicht so wichtig. Eine Kleinstadt.« Er sah Ben immer noch nicht an.
»Ich hatte letztes Jahr eine tolle Zeit in Marrakesch. Wie lange sind Sie schon hier?«
»Ich bin jeden Tag hier.«
Ben wurde klar, dass er dem Mann wachsendes Unbehagen bereitete. »Ich bin David«, sagte Ben und streckte die Hand aus.
Darauf drehte sich der Mann ihm zu. »Ja, Sir«, sagte er, ohne Bens Hand zu schütteln.
Ja, Sir? Ben konnte den Ton des Barkeepers nicht richtig einordnen. Wie üblich hatte er nicht unter seinem richtigen Namen eingecheckt. Das Zimmer war für David Slavitt gebucht worden. Es war Bens Art, sich seine schöpferische Seite im Unternehmensdickicht zu erhalten. David Slavitt war das Pseudonym, das er für seinen bislang unveröffentlichten Kriminalroman benutzt hatte. Unwillkürlich schüttelte er den Kopf. Er hatte diesen Traum noch nicht ganz aufgegeben. Sein Leben konnte nicht nur daraus bestehen, Laken und Kissen zu inspizieren, Speisekarten zu studieren oder Grünanlagen und Wellnessanwendungen zu begutachten. Ohnehin ging seine Neugier, die ihm als Journalist so gute Dienste erwiesen hatte, stets weit über schlichte Tatsachen hinaus. Warum verhielten sich Menschen auf eine bestimmte Weise? Allem lag entweder eine Motivation zugrunde oder Verlangen.
Olly sagte immer, Ben hätte bei der Polizei anfangen oder so eine Art moderner Privatschnüffler werden sollen – wäre er bloß nicht so wählerisch und anspruchsvoll bei allem, was er aß und trank. »Du bist kein Typ für Bier und Curry, oder? Kann mir dich nicht mit Fast Food im Streifenwagen vorstellen«, wiederholte er sich gern.
»Und Sie sind?«, fragte Ben in freundlichem Ton, wie er hoffte, und hielt dabei seinen Brandy hoch.
»Engin«, sagte der Marokkaner leise.
»Ist ruhig hier heute Abend.« Jetzt, Anfang Juni und unter der Woche, war zwar keine Hauptsaison, aber ein Hotel wie dieses zielte auch nicht auf die Schulferien ab.
Der Barkeeper lächelte. »Es ist ein warmer Abend.« Er schaute weg. »Ich hab immer zu tun.«
Er schien zufrieden damit zu sein, ein Glas auf Hochglanz zu polieren, wenn er beschäftigt wirken musste. Ein ratloser Ben machte daraufhin den Fehler, sich abermals umzusehen, doch diesmal fiel sein Blick auf den Schotten, der sogleich zu winken anfing und ihm signalisierte hinüberzukommen.
Offenbar hatte das Paar einander als Gesellschaft satt und war erpicht darauf, irgendeinen Fremden in ein Gespräch zu verwickeln. Ben war schon öfter in dieser Lage gewesen. Gewöhnlich hatte er nichts dagegen einzuwenden, sondern freute sich auf etwas Plauderei, um ganz nebenbei so viel er konnte über jemandes Aufenthalt in einem Hideaway zu erfahren.
»Kommen Sie rüber zu uns«, rief der Mann und ließ Ben keine Wahl. Ben stieg von dem Hocker, griff nach seinem Brandy, nickte Engin verschwörerisch zu und ging hinüber.
»Ich habe Sie Englisch sprechen hören«, sagte der Mann. »Die meisten Leute hier sind entweder Deutsche, Holländer – die reisen echt viel, was? – oder Russen. Warum haben die Russen so viel Geld? Na, wir wissen, warum, stimmt’s?«
»Bringen Sie ihn ja nicht in Fahrt«, lachte die Frau.
Ben fand nicht, dass er das getan hätte.
»Ian«, sagte der Mann und streckte seine Hand aus.
Ben schüttelte sie zögerlich. »David«, seufzte er. »David Slavitt.«
»Und das ist Maggie.« Ian nickte seiner Begleitung zu.
»Hi«, sagte Ben und schüttelte weniger zögerlich auch ihre Hand. Sie war um die vierzig, hatte blondes schulterlanges Haar, blaue Augen und trug ein schickes rotes Neckholder-Kleid.
»Dann sind Sie auch geneppt worden?« Ian zeigte auf Bens Glas.
»Das?«, sagte Ben, hielt seinen großen Schwenker hoch und versuchte dabei, die Fettflecken darauf zu verbergen, »ist der edelste Brandy der Balearen. Wird weltweit verkauft, falls Sie also je einen ergattern können.«
»Na schön«, sagte der Mann. »Mir kommt er spanisch vor, wenn Sie mich fragen.«
Ben wusste nicht recht, was er damit meinte. Er war deutlich älter als seine Begleitung und sichtlich an eine luxuriöse Umgebung gewöhnt, wenn auch nicht daran, die Kosten selbst tragen zu müssen. Er war durch und durch Firmenmensch in Polohemd und gebügelter Freizeithose.
»Mir schmeckt mein Drink«, sagte Maggie und führte daraufhin aus, dass sie einen Mandellikör trinke und dieser ebenfalls aus der Gegend stamme.
Ian fiel Maggie rasch ins Wort, um Ben zu verraten, dass er Anwalt sei und eine eigene Kanzlei in Edinburgh habe, als wäre das nicht offensichtlich. Maggie habe früher für ihn gearbeitet und nun seien sie Mann und Frau. Darüber lachte er. Sie nicht. Sie feierten heute ihren dritten Hochzeitstag. Zusammen kamen sie auf eine beträchtliche Zahl Ehen und Kinder, wobei Maggie nicht so aussah, als hätte sie so viele vorzuweisen wie er. »Das Leben ist reichhaltig und kompliziert«, sagte Ian.
Ben hatte sofort das ungute Gefühl, dass die beiden nicht mehr viele gemeinsame Hochzeitstage feiern würden.
»Kann ich Ihnen noch einen holen?«, fragte Ian mit Blick auf Bens Glas.
Ben wollte Ian gerade ins Bild setzen, wie selten und kostspielig Suaz-Brandy sei, doch der war schon auf halbem Weg zur Bar.
»Wo ist denn jetzt der Barkeeper hin?«, wunderte er sich.
Ben konnte Engin nirgends sehen. Normalerweise wäre er davon wenig begeistert gewesen. Kellner hatten da zu sein, sobald man sie brauchte, und unsichtbar, tat man es nicht. Obwohl es ihn ziemlich beeindruckte, wie Elgin nun Ian aus dem Weg zu gehen suchte. Er konnte es ihm kein bisschen verübeln.
»Sind Sie allein hier?«, fragte Maggie. »Sie sind mir beim Abendessen aufgefallen. Ihre Jacke gefällt mir. Woher haben Sie die? Ich wünschte, Ian würde mehr auf seine Kleidung achten. Er trägt immer dasselbe langweilige alte Zeug.«
»Danke«, sagte Ben und sah an seiner Jacke hinunter, die offen stand, um sein blaues Hemd von Old Town zu zeigen. Er würde den Umstand verschweigen, dass auch er eigentlich immer das Gleiche trug und dass seine Familie das nicht guthieß. »Sie ist von einem kleinen Modelabel in Norfolk.« Er lächelte, stand auf, fühlte sich befangen. Er schaute hinüber zu Ian. »Sie brauchen mir nicht noch einen Drink holen, danke. Ich mach für heute Abend Schluss.«
Er trat den Rückzug an. Maggie sah ihn immer noch an, leicht verwirrt.
»Tja, ich bin allein hier«, sagte er, weil er mit ihr fühlte. »Nur so bekomme ich etwas erledigt. Ich bin Schriftsteller.« Er lächelte breiter, um die Notlüge zu verhehlen. Er hatte den Satz schon viele Male zuvor gesagt.
»Wie wunderbar«, sagte sie. »Ich lese furchtbar gern. Irgendwas, wovon ich gehört haben könnte?«
»Es sind Krimis. In Großbritannien bin ich nicht so bekannt. Haben Sie beide eine gute Nacht.« Er wandte sich schleunig ab und ging aus der Bar, wobei er bemerkte, dass von Engin noch immer jede Spur fehlte.
Beim Gang durch die Lobby war sich Ben sicher, den Rücken des Anzugträgers durch eine Tür hinter der verwaisten Rezeption verschwinden zu sehen. Er gehörte natürlich zur Belegschaft, war der Hoteldirektor. Ben hatte seine Hausaufgaben gemacht.
Die Luft draußen war herrlich warm, obwohl der Wind jetzt frischer blies und die Lichterketten in den Weinranken stärker schaukelten. Ein paar Leute, Paare zumeist, beendeten noch ihr Abendessen. Ben holte sein Telefon hervor und sah, dass es keine neuen Anrufe oder Nachrichten gab, gar nichts von Natalie, obwohl er ihr zuvor zwei SMS geschickt hatte, um mitzuteilen, dass er gut angekommen sei und dass sie ihm fehle. Außerdem hatte er versucht, ihr ein Foto des Hotels zu senden, schien aber stattdessen ein Bild von seinem Daumen übermittelt zu haben. Kein Wunder, dass sie nicht geantwortet hatte.
Er war nicht müde. Die Aussicht auf ein wunderbar weiches Bett mit frischen Laken in einer – hoffentlich – sorgsam lärmgedämmten und geschmackvoll eingerichteten Juniorsuite reizte ihn nicht. Er wusste, dass er nicht gut schlafen würde. Diese Gabe hatte ihn schon vor Jahren verlassen. Er ertappte sich dabei, wie er vom Hotel fort bummelte, in Richtung einer kleinen Menschengruppe in einiger Entfernung, die ihn irgendwie anzog. Es waren zwei oder drei Leute, vielleicht zwei Männer und eine Frau, die sich zügig bewegten. Er konnte nicht ausmachen, wohin sie gingen.
Bald war er über die Gartenanlage hinaus geschlendert und bei den Tennisplätzen, hatte die drei aber schon aus den Augen verloren, denn vor ihm lag tiefschwarze Nacht. Überdies lenkte ihn ein merkwürdiges Rascheln hinter den gedrungenen Johannisbrotbäumen ab, die den Fußweg säumten. Erst vermutete er einen Vogel, dann eine Ratte, die sich genüsslich den Bauch mit Abfällen aus dem Sterne-Restaurant vollschlug. Aber nein, eine Katze flitzte genau vor seinen Füßen über den Gehweg. Sie war mager und knochig, und beglückt fühlte er sich in diesem Moment keinesfalls.
Da er den Lageplan und die Hinweise für Gäste auf seinem Zimmer schon studiert hatte, wusste er, dass dies der Pfad sein musste, der bis hinunter ans Meer führte. Anscheinend war das ein viertelstündiger steiler Abstieg, und festes Schuhwerk wurde empfohlen. Er trug nie etwas anderes als festes Schuhwerk. Die Strecke war allerdings unbeleuchtet. Er entschied, dass es bis zum Morgen Zeit hatte, und kehrte angetan vom warmen Halogenschein, in den es getaucht war, zum Hotel zurück. Ebenfalls hübsch beleuchtet und mit zielstrebiger Anmut ging Juliet de Vries über die Terrasse. Sie hatte sich einen Schal um die Schultern geworfen.
Sie verließ die Terrasse am anderen Ende und ging um die Ecke des Hauptgebäudes. Es war fünf Minuten nach Mitternacht.
3
Als Ben das nächste Mal auf seine Armbanduhr sah, war es zwei Uhr vierzig. Er hatte seine Nachttischlampe anmachen müssen, weil die Ziffern der Jaeger-LeCoultre aus den fünfziger Jahren, die einmal seinem Großvater gehört hatte, ihre Fluoreszenz eingebüßt hatten und sein Telefon zum Aufladen auf dem Schreibtisch in der gegenüberliegenden Zimmerecke lag. Dort schien die nächstgelegene Steckdose zu sein, nicht eben praktisch. Er würde das in seinem Zimmerbericht erwähnen müssen. Der Gedanke daran entlockte ihm ein Gähnen.
Aber sein Telefon gab keinen Ton von sich. Davon war er also nicht aufgewacht. Was ihn hatte aufschrecken lassen, war lautes Geschrei.
Es klang nach einem Mann und einer Frau. Sie brüllten einander auf Holländisch an, und selbst wer es mit keinem Wort beherrschte, begriff unschwer, dass der Streit zügig eskalierte.
Ben wusste, dass es vollkommen sinnlos war, das Licht zu löschen und zu versuchen, wieder einzuschlafen, außerdem sorgte er sich um die Frau. Er kletterte aus dem Bett und fühlte sich seltsam erleichtert, die Decke los zu sein. Ihm war zu warm gewesen, merkte er, weil er die Klimaanlage abgestellt hatte, die lauter surrte, als sie es in einem Haus wie diesem sollte. Wann hatte ihn nachts je eine Klimaanlage nicht gestört? Dennoch gehörte auch das in den Bericht.
Auf einem Bord im Badezimmer fand er einen schweren Bademantel, der etwas zu fest zu einem dicken weißen Bündel geschnürt war. Er warf ihn sich über und trat auf den Balkon hinaus.
Das Gebrüll kam nicht aus einer der angrenzenden Suiten, sondern anscheinend aus einem Zimmer ganz am Ende des Gebäudes. Trotzdem war der Aufruhr draußen viel deutlicher zu hören. Die Frau schrie inzwischen regelrecht. Plötzlich hörte man einen lauten Knall, als wäre ein Gegenstand geworfen worden – oder eine Person. Dann zerschmetterte Glas. Das Ganze würde teuer werden.
Ben beugte sich vor und bekam sie in den Blick. Ja, es war Juliet de Vries, auf ihrem Balkon, und der abwegigste Unsinn schoss ihm in den Kopf. Wim Jansen war kein Romeo, das war klar. Wahrscheinlich war sie auch keine Julia im Shakespeare’schen Sinne.
Andere Gäste tauchten nun auf ihren Balkonen auf, während das Geschrei von Holländisch zu Englisch überging. Ben fragte sich für eine Millisekunde, ob sie absichtlich eine Show abzogen.
»Bleib mir vom Leib, du Hure«, dröhnte der Mann.
»Ich? Fick dich«, schrie sie zurück. »Scheißtyp. He, fass mich bloß nicht an mit deinen dreckigen Mörderhänden.«
»Ich soll dich nehmen wie die Hure, die du bist?«
»Fick dich.«
»Ach ja? Du sollst kriegen, was du willst. Ihr seid doch alle gleich.«
Das Krachen und Rumsen wurde lauter. Nur zu gut konnte sich Ben die Verwüstung in der Suite ausmalen – zertrümmerte Rahmen der Fotos ländlicher Szenen auf Mallorca, zerbrochene kunsthandwerkliche Töpferwaren, zerlegte Stilmöbel. Die eine oder andere moderne Gerätschaft, die schlagartig nicht mehr nach einundzwanzigstem Jahrhundert aussah. Blut auf den Laken, an Wänden und der Decke.
»Fass mich ja nicht an«, schrie sie erneut. »Sonst bist du tot. Ich bring dich um.«
Jetzt lachte der Mann. Dann schrie er, wenn nicht wie ein Schwein, dann wie ein wilder Eber. »Nein, du bringst mich nicht um, aber ich fick dich – klar? Wie all die anderen Kerle.« Etwas schlug krachend unter ihrem Balkon auf.
Ben knotete sich hastig den Bademantel zu und schlüpfte barfuß in seine Budapester. Dann öffnete er die Zimmertür und lief den Flur hinunter. Aus zwei anderen Zimmern spähten Leute, doch Ben war der Erste, der an der großen, eisenbeschlagenen Eichentür zur Suite ankam. Er hämmerte dagegen. Die Tür schien aus Massivholz zu sein. Dann bemerkte er eine Klingel und drückte darauf. Niemand kam. Er griff nach der Klinke. Sie ließ sich nicht bewegen, gab nicht nach.
»Aufmachen!«, rief er, ehe er wieder mit der Faust gegen die Tür hämmerte.
Grabesstille herrschte nun hinter der Tür. Noch einmal klopfte Ben vergeblich aufs Holz, dann sah er sich über die Schulter um. Niemand sonst hatte seine Suite verlassen, um ihm beizustehen. Das war das Problem mit den Überprivilegierten – sie leisteten nie Erste Hilfe.
»Aufmachen«, rief Ben abermals, rüttelte an der Klinke und schlug gegen die Tür.
»Verzeihung«, hörte er hinter sich.