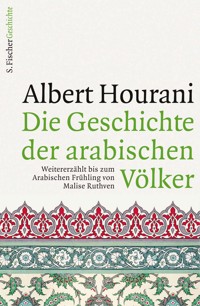14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Diese Essays des großen Orientalisten Albert Hourani, der mit seiner ›Geschichte der arabischen Völker‹ in Deutschland einen großen Erfolg feierte, dienen dem Verständnis zwischen Europa und den arabischen Ländern. Sie sind in der Zeit der Spannung zwischen dem Islam und dem Westen ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung beider Seiten. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Ähnliche
Albert Hourani
Der Islam im europäischen Denken
Essays
FISCHER Digital
Aus dem Englischen übertragen und herausgegeben von Gennaro Ghirardelli
Inhalt
André Raymond in Freundschaft und mit Verehrung gewidmet
Einleitung
Die vorliegenden Essays verraten ein anhaltendes Interesse an der Entstehungsweise geistiger Traditionen: an einem Vorgang, der Ideen auf Ideen häuft, sie weitertradiert, verändert und entwickelt, wobei sie an Gewicht gewinnen. Meine jahrelange Tätigkeit als Lehrer für Geschichte des Nahen Ostens hat bei mir ein besonderes Interesse an zwei Arten dieses Prozesses geweckt. Das eine gilt der Herausbildung einer besonderen europäischen Sicht auf den Islam und seine Kultur, eine Sicht, die von einer sich vertiefenden Kenntnis des muslimischen Glaubens und seiner Geschichte herrührt sowie von sich verändernden Anschauungen über Religion und Geschichte in Europa. Das zweite betrifft die Entstehung einer wissenschaftlichen Überlieferung – gemeinhin als »Orientalismus« bekannt –, nämlich die Ausbildung von Methoden, Texte zu erfassen, zu bearbeiten und zu interpretieren, sowie deren Weitergabe von einer Generation zur nächsten über eine Kette – eine silsila, um den arabischen Begriff anzuwenden – von Lehrern und Studenten.
Diese beiden Vorgänge waren eng miteinander verknüpft: Gelehrte arbeiten nicht abstrakt, ihre Ansichten sind geprägt von der Kultur ihrer Zeit und vorangegangener Zeiten; sie machen es sich zur Aufgabe, zu deuten, was sie ihren Quellen entnehmen; die Auswahlkriterien, die Betonung und Ausführung schreiben sich von ihrem Leben her.
Im ersten und längsten Essay dieses Buches unternehme ich den Versuch, die Verbindung zwischen diesen beiden Prozessen deutlich zu machen, indem ich die Wurzeln europäischer Tradition in islamwissenschaftlichen Studien über Gott, Menschen, Geschichte und Gesellschaft, die zentral für das europäische Denken sind, freilege. Insbesondere versuche ich zu zeigen, wie sehr die Richtung der Islamwissenschaft, die im 19. Jahrhundert als eine eigene Disziplin hervortrat, von einigen zu jener Zeit geläufigen Ideen bestimmt wurde: von kulturgeschichtlichen Ideen, Ideen über Natur und Bildung der Religionen, über die Art und Weise, wie heilige Bücher zu lesen waren, und über die Beziehungen zwischen den Sprachen. Ich wollte die wichtigsten Abstammungslinien der Islamwissenschaft nachzeichnen, die im 17. Jahrhundert in Paris und Leiden ihren Ausgang nahm. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte die Islamwissenschaft ihre Organisationsform entwickelt – ihre eigenen Methoden der Lehre, der Veröffentlichung und ihre eigene Wissenschaftssprache – und sie hatte eine tragfähige und beständige Autorität, die bis auf den heutigen Tag besteht, erworben.
Besondere Aufmerksamkeit widmete ich Ignaz Goldziher, der, wie mir scheinen will, eine zentrale Stellung in dieser Geschichte einnimmt: Er war Erbe beider großer silsilas und zugleich ein von den beherrschenden Ideen seiner Zeit und auch von seiner eigenen, jüdischen Tradition geprägter Geist. Vor allem zwei Schriften Goldzihers schufen eine Art Orthodoxie, die ihren Einfluß bis heute geltend macht: jene über die Ursprünge und Entstehung des hadith (der Überlieferungen des Propheten) sowie jene über die Herausbildung der islamischen Theologie und des islamischen Rechts.
Ich selbst gehöre keiner dieser großen silsilas an. Ich kam auf anderen Wegen zur Geschichte des Nahen Ostens und lehrte an einer Universität, deren Bedeutung für die Geschichte der Islamwissenschaft eher marginal war, obwohl in Oxford Arabisch seit dem 17. Jahrhundert gelehrt wird. Ich schätze mich jedoch glücklich, Kollegen zu haben, die in der eigentlichen Tradition ausgebildet waren – unter diesen die bereits verstorbenen H.A.R. Gibb, Richard Walzer, Samuel Stern, Joseph Schacht und Robin Zaehner –, und ich war in Oxford zu einer Zeit, da Anstrengungen unternommen wurden, der »Orientalistik« mit finanzieller Hilfe von seiten der Regierung neuen Schwung zu verleihen. Die wichtigste Persönlichkeit bei diesem Prozeß war H.A.R. Gibb in seiner Zeit als Laudian Professor in Oxford. Über ihn habe ich an anderer Stelle ausführlicher geschrieben.[1]
Wie alle »Orientalisten« seiner Zeit sah sich Gibb gezwungen, in allzu vielen Bereichen zu lehren: in Sprache, Literatur und Geschichte. Er hielt sich in erster Linie für einen Historiker, und eines seiner Hauptanliegen in Oxford bestand darin, Historiker davon zu überzeugen, der Geschichte außereuropäischer Gebiete mehr Aufmerksamkeit zu widmen und ihr im Lehrplan den ihr, wie er meinte, gebührenden Platz einzuräumen. Einer der Gründe, weshalb er schließlich Oxford verließ, um nach Harvard zu gehen, war der (begründete) Glaube, daß historische Fakultäten der Idee der Weltgeschichte aufgeschlossener gegenüberstünden und daß gute, als Historiker ausgebildete Studenten dazu gebracht werden könnten, sich dem Studium der islamischen Welt zu widmen.
Als Historiker war Gibb darum bemüht, sowohl die Quellen heranzuziehen, um zu entdecken, was sich in der islamischen Geschichte ereignet hatte (wie etwa in seinen Studien über das Leben von Saladin), als auch eine Interpretation der Gesellschaften vorzunehmen, in denen der Islam die vorherrschende Religion war; eine seiner grundlegenden Arbeiten ist der Essay »An interpretation of Islamic history«[2].
Marshall Hodgson war ein amerikanischer Historiker, der, obwohl nicht Schüler von ihm, dennoch unter dem Einfluß von Gibbs Ideen stand. Hodgsons Buch The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization[3] ist Gegenstand des zweiten Essays in diesem Band. Jedes einzelne Wort im Titel dieses Werks ist von Bedeutung, sorgfältig gewählt und bedenkenswert: venture (Wagnis), Islam, conscience (Bewußtsein), history (Geschichte) und world society (Weltgesellschaft). Ich schrieb diesen Essay als Rezension und begrüßte das Buch mit Begeisterung als einen äußerst wichtigen und originellen Versuch, Kategorien zu schaffen, mit deren Hilfe islamische Geschichte im Kontext der Geschichte der gesamten Ökumene, das heißt, der Welt der seßhaften Landwirtschaft, der Städte und der Hochkultur verstanden werden konnte. Ich halte es immer noch für ein bemerkenswertes und aufregendes Buch und möchte dabei noch ein weiteres hinzufügen, das eine umfassende Synthese bietet, nämlich das Buch eines Studenten von Gibb aus der Zeit in Harvard: Ira Lapidus’ History of Islamic Societies[4].
Hodgsons – und auch Lapidus’ – Buch liegt die Annahme zugrunde, daß es innerhalb der allgemeinen Geschichte der Ökumene so etwas wie eine »islamische Geschichte« gebe, das heißt, daß es in Gesellschaften, in denen der Islam die vorherrschende Religion war, gewisse gemeinsame Struktur- und Entwicklungsmerkmale gegeben habe. Gibb teilte diese Ansicht, dennoch ging keiner von ihnen davon aus, daß »Islam« der Schlüssel sei für alles, was in »islamischen« Gesellschaften geschah, noch, daß die Geschichte dieser Gesellschaften aus sich wiederholenden Zyklen ähnlicher Erscheinungen bestehe. Alle drei sind sich vollkommen darüber im klaren, daß die Geschichte jeder »islamischen« Gesellschaft einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort sich von der anderer unterscheidet. Mein eigenes Interesse als Historiker richtete sich hauptsächlich auf die Länder um das östliche Mittelmeer, im weitesten Sinne also um den Nahen oder Mittleren Osten, und dabei vor allem auf die letzten zwei Jahrhunderte. Mein Anliegen war, zu bestimmen, ob und bis zu welchem Grad die Tatsache, daß der Islam in Ägypten, Syrien oder der Türkei die dominierende Religion ist, dazu beitragen kann, seine Geschichte in der Moderne zu verstehen. Ich hatte Gelegenheit, diese Frage 1979 auf einer Konferenz an der University of California in Los Angeles zu diskutieren; der dritte Essay ist das Ergebnis davon. Darin stelle ich drei alternative (oder sich überschneidende) Erklärungsprinzipien zur Debatte und komme zu dem Schluß, daß der Begriff »islamische Geschichte« uns hilft, gewisse Aspekte der modernen nahöstlichen Geschichte zu erklären. Am Schluß des Essays weise ich darauf hin, daß ich die Vermutung hegte, dies wäre seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr länger der Fall. Genausowenig wie andere Beobachter sah ich voraus, daß die achtziger Jahre dereinst die Epoche des – etwas ungenau ausgedrückt – »Wiedererwachens des Islam« genannt werden sollte.
In diesem Essay – ebenso wie in den anderen – zeigt sich allerdings, daß ich um den Hintergrund wußte, auf dem dieses »Wiedererwachen des Islam« beruhte: auf dem sich verändernden Bewußtsein vom »anderen« dieser arabischsprechenden, vorwiegend muslimischen Welt, über die europäische Gelehrte und Historiker – unter ihnen ich selbst – geschrieben haben. Es gab eine Zeit, da konnte diese Welt wie ein zum Sezieren freigegebener Körper behandelt werden, aber Reisen, die Erfahrung imperialer Herrschaft und die Auflehnung dagegen sowie die Wiederbelebung des einheimischen überlieferten Gedankenguts und Schrifttums machten es unmöglich, weiterhin so über den »Orient« zu denken. Wissenschaft wird heute von der Zusammenarbeit derjenigen getragen, die in westlicher Tradition ausgebildet sind, und von denen, die über diese Ausbildung hinaus etwas von ihrer eigenen Tradition islamischen Denkens und Glaubens mitbringen. Niemand kann heute noch Bedeutendes über die Welt des Islam schreiben, ohne ein gewisses Gefühl einer lebendigen Beziehung zu jenen, über die er schreibt, mitzubringen.
Der vierte Essay beschäftigt sich mit zwei in mancher Beziehung äußerst unterschiedlichen und doch auch wieder sehr ähnlichen Männern, deren Lebenswege sich für einen kurzen Moment berührten und deren Schriften vom klaren Bewußtsein der Notwendigkeit geprägt sind, die Kluft zu überbrücken, die durch Gewalt, Feindseligkeit und Abgrenzung entstanden war. Die Vorstellung, am falschen Platz zu stehen, verfolgt T.E. Lawrence in Die sieben Säulen der Weisheit: Wenn er nach der Eroberung von Damaskus seinen Abschied einreicht, dann deshalb, weil »mich das Ereignis nur mit Kummer erfüllte und die Phrase bedeutungslos geworden ist«[5]. Auch Louis Massignon verwarf »unseren weltlichen Wahn, zu verstehen, zu erobern, zu besitzen«.
Leben und Persönlichkeit von Lawrence und Massignon haben mich jahrelang beschäftigt. Das Buch The Seven Pillars of Wisdom, das ich las, als es 1935 zum erstenmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, hat mich zutiefst bewegt und hat vielleicht – halb bewußt, halb unbewußt – die Richtung meines Werks als Historiker mitbestimmt. Später dann konnte ich während vierzehn Jahren vom Fenster meines Schlafzimmers aus auf den Bungalow im Garten seines Elternhauses in der Polstead Road sehen, wo er in seiner Jugend gelebt hatte. Massignon begegnete ich einige Male; sein Gesicht und die Gespräche sind mir in Erinnerung geblieben. Von Freunden und Kollegen habe ich viel über ihn erfahren, und auch hier war der genius loci von Bedeutung. Ich sah ihn deutlich vor mir, sooft ich die griechisch-katholische Kirche in Garden City in Kairo besuchte, die von seiner Freundin Mary Kahil sorgfältig renoviert worden war. Seine Überlegungen zum Islam und dessen Beziehung zum Christentum gaben Stoff zu mehr als nur einem dieser Essays.
Massignons Werk übte auf die französischen Gelehrten seiner und der nächsten Generation einen großen Einfluß aus. Dies zeigt sich an den Schriften von Jacques Berque, obwohl das Gedankengebäude, auf dem diese beruhen, sich davon erheblich unterscheidet. Mein Essay über Jacques Berque ist Ausdruck der Dankbarkeit sowohl für eine lange Freundschaft als auch für alles, was ich von ihm gelernt habe. Seine Bücher sind geprägt von der langen Erfahrung französischer Herrschaft und Anwesenheit in Nordafrika. Jacques Berque, der in Algerien aufwuchs und sich schon im frühen Alter zusammen mit seiner Muttersprache Französisch die arabische Sprache aneignete – und später während seines jahrelangen Aufenthaltes oder seiner Besuche als Beamter und Wissenschaftler –, lehrte uns, die verschiedenen Bewegungen der Geschichte auseinanderzuhalten: die Geschichte, welche ausländische Herrschaft arabisch-islamischen Ländern aufzuzwingen versuchte, und diejenige, welche diese Völker selbst hervorbrachten. Der Titel eines seiner Bücher, Intérieur du Maghreb, weist auf das beherrschende Anliegen seines Werks hin: Er schaut über die Zentren der Macht und über die Küstenstädte mit ihrer gemischten Bevölkerung hinaus auf die Städte und Dörfer in den Bergen und Tälern des Hinterlandes. Seine Schriften drücken auch ein Glaubensbekenntnis aus: daß, trotz allem, was war, eine Veränderung der Menschen stattgefunden habe; daß eine Synthese lateinischer und arabischer Kultur, der Traditionen beider Seiten des Mittelmeeres bestehe und weiterhin fortlebe.
Diesem Essay habe ich drei weitere hinzugefügt, die das Augenmerk auf die Veränderung im Bewußtsein vom »anderen«, auf die Versuche, eine neue Stimme in der Welt zu finden, lenken. Der erste untersucht das letzte Stadium, in dem es noch möglich war, von einer unabhängigen Welt islamischer Kultur zu sprechen. Obwohl die politischen und ökonomischen Voraussetzungen dieser Unabhängigkeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu bestehen aufhörten, konnte ein gebildeter Muslim immer noch mit Vertrauen auf die Macht und Überlebenskraft der kulturellen Überlieferung, die er von der silsila seiner Lehrer und Vorfahren empfangen hatte, in die Welt blicken.
Ein halbes Jahrhundert später war das schon nicht mehr der Fall. Die Ausdehnung des europäischen Handels sowie die Ausweitung der militärischen Macht und des politischen Einflusses Europas führte – zuerst durch die einheimischen Herrscher, danach durch fremde Mächte – dazu, daß neue Verwaltungsmethoden, neue Gesetzbücher und eine neue Art von Schulen eingeführt wurden. Kenntnisse des Französischen und anderer europäischer Sprachen sowie der Welt, die sie eröffneten, brachten neue Fragen und Ideen. Dieser geistige Aufbruch vollzog sich vor allem in den Hafenstädten und in anderen Städten, wo Männer und Frauen verschiedener Religionszugehörigkeit und Nationalitäten Seite an Seite zusammenlebten und wo der Austausch von Ideen wie von Gütern am leichtesten und auf einträglichste Art stattfinden konnte. Eine der wichtigsten Städte war Beirut. Die letzten beiden Essays befassen sich mit zwei Mitgliedern der Familie al-Bustani, libanesische Christen, die in Beirut ihre geistige Ausbildung erfahren hatten und die eine wichtige Rolle bei dem Versuch spielten, die neue Welt zu verstehen: Butrus, der die erste arabische Enzyklopädie herausgab und dazu beitrug, einen modernen Stil explikativer arabischer Prosa zu entwickeln, und Sulaiman, der mit seiner Übersetzung der Ilias von Homer die Grenzen arabischen Poesieverständnisses erweiterte. Beide Essays sind Freunden gewidmet: Der erste wurde für einen Essayband zu Ehren von Jacques Berque geschrieben und der zweite zum Andenken an Malcolm Kerr, der als Präsident der amerikanischen Universität 1984 in Beirut ermordet wurde. Er war ein alter Freund, und er war es, der mich zu jener Konferenz in Los Angeles eingeladen hatte, die Anlaß zu dem vierten Essay in diesem Band war.
I. Der Islam im europäischen Denken
1
Zeit seines Bestehens war der Islam ein Problem für das christliche Europa; seine Anhänger waren der Feind an der Grenze. Im 7. und 8. Jahrhundert drangen die im Namen des Chalifats, des ersten muslimischen Reiches, kämpfenden Heere in das Zentrum der christlichen Welt vor. Sie besetzten Provinzen des byzantinischen Reichs in Syrien, im Heiligen Land, in Ägypten und wandten sich nach Nordafrika, Spanien und Sizilien. Die Eroberung war nicht nur militärischer Art, sondern in der Folge auch von umfassenden Bekehrungen begleitet. Zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert kam es zu einem christlichen Gegenangriff, der im Heiligen Land, wo ein katholisches Königreich Jerusalem entstand, für eine Weile von Erfolg gekrönt war. Beständiger war dieser Erfolg allerdings in Spanien. Dort fand 1492 das letzte muslimische Königreich sein Ende, doch kam es zu dieser Zeit andernorts unter türkischen Dynastien zu einer muslimischen Expansion: Die Seldschuken drangen nach Anatolien vor, und später vernichteten die Osmanen, was vom byzantinischen Reich noch übriggeblieben war; sie eroberten dessen Hauptstadt Konstantinopel und rückten nach Ost- und Zentraleuropa vor. Noch im 17. Jahrhundert waren sie in der Lage, die Insel Kreta zu besetzen und Wien zu bedrohen.
Die Beziehung zwischen Muslimen und europäischen Christen war jedoch nicht nur vom Heiligen Krieg, von Kreuzzügen und vom dschihad bestimmt. Es gab auch einen Handel über das Mittelmeer, dessen Schwergewicht sich im Lauf der Zeit veränderte. Vom 11. und 12. Jahrhundert an verstärkten die italienischen Hafenstädte ihre Handelstätigkeit, und im 15. und 16. Jahrhundert tauchten Schiffe aus nordeuropäischen Häfen im Mittelmeer und im Indischen Ozean auf. Auch ein Gedankenaustausch fand statt, jedoch überwiegend aus den Ländern des Islam in christliche: Arabische Werke der Philosophie, Wissenschaft und Medizin wurden ins Lateinische übersetzt, und bis ins 16. Jahrhundert waren in den medizinischen Schulen Europas die Schriften des großen Arztes Ibn Sina in Gebrauch.
Durch Konflikte getrennt und gleichzeitig auf mancherlei Weise miteinander verbunden, stellten Christen und Muslime eine religiöse und geistige Herausforderung füreinander dar. Was konnte jede dieser Religionen gegenüber der anderen jeweils geltend machen? Für muslimische Denker war die Stellung des Christentums klar: Jesus gehörte für sie in die Reihe echter Propheten, die ihren Abschluß mit Muhammad, dem »Siegel der Propheten«, fand; seine verbürgte Botschaft war im wesentlichen die gleiche wie diejenige Muhammads. Aber die Christen hatten ihren Glauben falsch verstanden: Sie hielten ihren Propheten für einen Gott und glaubten, daß er am Kreuz hingerichtet worden war. Die gängige muslimische Erklärung lief darauf hinaus, daß die Christen ihre Schrift entweder durch Entstellung des Textes oder durch eine falsche Auslegung seiner Bedeutung »gefälscht« hätten. Die muslimischen Denker verfochten den Standpunkt, in der christlichen Schrift – würde sie richtig verstanden – ließe sich kein Hinweis für die Behauptung finden, daß Jesus Gott ist, und eine Passage im Koran machte klar, daß er nicht gekreuzigt worden, sondern auf irgendeine andere Weise in den Himmel gekommen war. Die Christen dagegen leugneten die Echtheit der Offenbarung, die Muhammad empfangen hatte, doch eine korrekte Auslegung der Bibel zeigte, daß das Kommen des Propheten Muhammad vorhergesagt worden war.
Für Christen war die Sache schwieriger. Sie wußten, daß die Muslimen an einen Gott glaubten, der gemäß seinem Wesen und seinen Handlungen für den Gott gehalten werden konnte, den auch die Christen anbeteten; für sie kaum annehmbar war jedoch Muhammad als ein echter Prophet. Das Ereignis, auf das die alttestamentarischen Propheten hingewiesen hatten, das Kommen Christi, hatte schon stattgefunden. Was bedurfte es also noch weiterer Propheten? Außerdem leugnete Muhammads Lehre eine zentrale Doktrin des Christentums: Die Menschwerdung und die Kreuzigung Christi – und somit auch die Dreifaltigkeit und die Vergebung. Konnte der Koran irgendwie als das Wort Gottes angesehen werden? Auf die wenigen Christen, die überhaupt etwas davon kannten, wirkte der Koran nur wie ein entferntes Echo von biblischen Geschichten und Themen.
Bis auf wenige Ausnahmen standen die meisten Christen dem Islam während der ungefähr ersten tausend Jahre der Konfrontation unwissend gegenüber, obwohl der Koran seit dem 12. Jahrhundert in einer lateinischen Übersetzung zugänglich war. Die erste Übersetzung entstand unter der Leitung Peters des Ehrwürdigen, des Abtes von Cluny. Einige Werke der arabischen Philosophie, welche die Tradition griechischen Denkens weiterführten, waren in Übersetzungen wohlbekannt. So gut wie unbekannt waren hingegen die theologischen, juristischen und religiösen Werke, in denen der Inhalt des Korans als Denk- und Handlungssystem hervortrat. Im 13. Jahrhundert entwickelten sich einige Dominikanerklöster in Spanien zu Zentren des Islamstudiums, doch verfielen auch sie in den folgenden Jahrhunderten wieder. Auf muslimischer Seite waren die Kenntnisse eher größer – und mußten es wohl auch sein, da weiterhin viele arabischsprachige Christen in muslimischen Ländern – insbesondere in Spanien, Ägypten und Syrien – lebten. Kenntnisse über deren Glauben und Glaubenspraktiken waren daher für Verwaltung und Politik unabdingbar. Sie sollten allerdings nicht zu hoch veranschlagt werden; die Grenzen werden in al-Ghazalis Schrift Wider die Gottheit Jesu deutlich.[6]
Die Christen schauten mit einer Mischung aus Furcht und Verwirrung und mit dem unbehaglichen Gefühl des Wiedererkennens einer gewissen geistigen Verwandtschaft auf den Islam, der sich ihnen in unterschiedlichem Licht darstellte. Gelegentlich wurde die geistige Verwandtschaft zugegeben. So gibt es zum Beispiel einen von Papst Gregor VII. im Jahre 1076 an al-Nasir, einen muslimischen Prinzen in Algerien, gerichteten Brief. Darin heißt es:
»Es ist eine Bruderliebe, die wir uns gegenseitig und mehr als anderen Völkern schulden, weil wir denselben Gott anerkennen und uns, wenn auch auf verschiedene Weise, zu ihm bekennen; und wir loben und preisen ihn täglich als unseren Schöpfer.«[7]
Unter den Gelehrten kam es zu Diskussionen über diesen Brief; es scheint indes, daß seine Bedeutung nicht überschätzt werden sollte. Es wurde darauf hingewiesen, daß gute Gründe für den herzlichen und freundlichen Ton verantwortlich waren, in dem Gregor den Brief abfaßte, ging es doch um den Schutz der im Schwinden begriffenen christlichen Gemeinden Nordafrikas, um die gemeinsame Gegnerschaft des Papstes und al-Nasirs zu einem anderen muslimischen Herrscher in Nordafrika und vielleicht auch um den Wunsch einiger Kaufleute in Rom, einen Anteil am wachsenden Handel im Hafen von Bougie (Bidschaya) zu haben. In anderen Briefen an Christen hatte Gregor härtere Worte für Muslime und den Islam. Nichtsdestoweniger zeugt der Brief von der Einsicht, daß die Muslime keine Heiden waren, was insofern überraschend ist, als er kurz vor der Eröffnung einer Epoche der Feindseligkeiten – der Kreuzzüge – geschrieben wurde.[8]
Verbreiteter war die Meinung, daß der Islam ein Ableger oder eine Häresie des Christentums sei. Dieser Ansicht war der erste ernstzunehmende christliche Theologe, Johannes von Damaskus (675–749). Er selbst war Beamter des umaiyadischen Chalifats in Damaskus und konnte Arabisch. In einem Abschnitt seines Werks über christliche Häresien rechnet er auch den Islam dazu: Dieser glaubt an Gott, leugnet aber bestimmte Grundwahrheiten des Christentums; und weil er diese leugnet, sind auch die Wahrheiten, die er gelten läßt, bedeutungslos. Die verbreitetste Ansicht war jedoch am anderen Ende des Meinungsspektrums angesiedelt, nämlich, daß der Islam eine falsche Religion, Allah nicht Gott und Muhammad kein Prophet sei. Der Islam sei eine Erfindung von Menschen mit beklagenswerten Motiven und einem jämmerlichen Charakter und er werde mit Feuer und Schwert verbreitet.[9]
2
Was auch immer europäische Christen über den Islam dachten, so konnten sie doch nicht leugnen, daß er ein wichtiger Faktor in der menschlichen Geschichte war, mit dem man sich auseinandersetzen mußte. In der frühen Moderne zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert nahm das Wissen über den Islam zu und veränderte sich in einem gewissen Sinn. Weil das militärische Gleichgewicht sich verlagert hatte, gab es im 18. Jahrhundert auch keine militärische Herausforderung durch das Osmanische Reich mehr. Ein verbessertes Navigationssystem ermöglichte europäischen Schiffen die Entdeckung der Welt sowie die Ausdehnung des Handels im Mittelmeer und im Indischen Ozean, und man begann europäische Niederlassungen einzurichten. Zu den Gemeinden italienischer Kaufleute in den Häfen des östlichen Mittelmeeres kamen neue hinzu. Aleppo zum Beispiel, eines der wichtigsten Zentren nahöstlichen Handels, beherbergte mehrere ausländische Gemeinden, inklusive eine Anzahl englischer Kaufleute (die Stadt ist bei Shakespeare zweimal erwähnt: im Othello und im Macbeth)[10]; portugiesische, holländische, französische und englische Händler ließen sich auch in einigen indischen Häfen nieder. Eine neue Form politischer Beziehungen bildete sich heraus: Europäische Staaten hatten Botschafter und Konsuln in den osmanischen Gebieten, obwohl der osmanische Sultan bis zu den napoleonischen Kriegen keine ständigen Botschaften in Europa unterhielt. Verträge und Bündnisse waren in Diskussion: Die Franzosen und Osmanen schlossen ein Abkommen gegen die Habsburger, die Engländer und andere versuchten Beziehungen zu den safawidischen Schahs in Iran herzustellen.
Mit den enger werdenden Beziehungen kam es zu einer Erweiterung des geistigen Horizonts und einer Entfaltung des Wissens. Für die Gelehrten und Denker hatte der Islam keine unmittelbare Bedeutung mehr: Die religiösen Auseinandersetzungen in Europa zur Zeit der Reformation und Gegenreformation drehten sich um andere Probleme, und die Fortschritte der europäischen Wissenschaft und Medizin minderten die Bedeutung arabischer Schriften. Dennoch war der Islam für die religiösen Fragen jener Zeit immer noch wichtig. Obwohl die vergleichende Sprachwissenschaft damals noch keine Wissenschaftsdisziplin war, war doch allgemein bekannt, daß das Arabische mit den Sprachen der Bibel, dem Hebräischen und dem Aramäischen, eng verwandt war, und das Studium des Arabischen konnte einige Klarheit über sie verschaffen. Auch konnten Kenntnisse über den Nahen Osten zur Erklärung beitragen, in welcher Umgebung die biblischen Ereignisse stattgefunden hatten. Reisen, Handel und Literatur sorgten in gebildeten Kreisen für vermehrte Aufmerksamkeit gegenüber der gewaltigen und rätselhaften Erscheinung der islamischen Zivilisation, die sich dank des Arabischen als lingua franca – der bis dahin am weitesten verbreiteten Sprache – vom Atlantik bis zum Pazifischen Ozean erstreckte. Eine solche Vergegenwärtigung spricht aus den Worten von Dr. Johnson:
»Zwei Dinge verdienen unser Interesse: die christliche und die mahomedanische Welt. Alles übrige mag man für barbarisch halten.«[11]
Welche Auswirkung hatten diese Veränderungen auf die Einstellung gegenüber dem Islam? Noch immer gab es ein weites Spektrum von möglichen Haltungen. Da war auf der einen Seite die gänzliche Ablehnung des Islam als Religion. Pascal etwa überschrieb die 17. seiner Pensées mit dem Titel »Gegen Muhammad«. Christus sei alles, was Muhammad nicht sei, behauptete er. Muhammad sei ohne Autorität, sein Kommen nicht vorhergesagt, er habe keine Zeichen und Wunder getan: »Jeder Mensch kann tun, was Mohammed getan hat […] Kein Mensch kann tun, was Christus getan hat.« Muhammad habe den Weg des menschlichen Erfolgs eingeschlagen, während Jesus Christus für die Menschheit gestorben sei.[12] Diese Ansicht wurde weiterhin aufrechterhalten, doch kam es mit der Zeit zu einer bezeichnenden Akzentverschiebung: Der Mensch Muhammad wurde weniger verunglimpft und seine menschlichen Qualitäten sowie seine außerordentlichen Leistungen eher anerkannt. So hatten 1784 die »Bampton Lectures« von Joseph White, einem Professor für Arabisch in Oxford, den »Vergleich von Islam und Christentum im Lichte ihres Ursprungs, ihrer Erscheinungsform und ihrer Wirkungen« zum Gegenstand.[13] Dabei schließt er aus, daß das Erscheinen des Islam in irgendeiner Weise ein wunderbares Ereignis gewesen war oder daß er irgendeine Rolle in der göttlichen Vorsehung gespielt habe. Es handle sich vielmehr um eine Naturreligion, die sich auf Anleihen bei den christlichen und jüdischen Schriften stütze. Sein Erfolg könne mit einfachen Worten erklärt werden: mit der Verderbtheit der zeitgenössischen Kirche einerseits und mit der Persönlichkeit des Propheten andererseits. Weit davon entfernt, »ein Monstrum an Unwissenheit und Lasterhaftigkeit« zu sein, wie bei anderen christlichen Verfassern, war Muhammad nach Whites Worten:
»ein außerordentlicher Charakter mit glänzender Begabung und großem Geschick […] ausgestattet mit einer Geistesgröße, die den Stürmen der Feindschaft durch […] die bloße Kraft eines starken und fruchtbaren Genius zu trotzen vermochte«.[14]
Um diesen Wechsel des Tons und des Urteils zu erklären, muß man sein Augenmerk auf die besseren Kenntnisse über den Islam wie auch auf eine veränderte Haltung gegenüber der Religion überhaupt richten. Joseph White und seine Zeitgenossen konnten sich auf zweihundert Jahre europäischer Geistesgeschichte stützen. Die erste systematische Untersuchung in Westeuropa über den Islam und seine Geschichte geht auf das späte 16. Jahrhundert zurück. Im Jahre 1587 begann der reguläre Arabischunterricht am Collège de France in Paris; die ersten beiden Professoren waren Doktoren der Medizin, ein Hinweis darauf, in welchen Disziplinen Arabischkenntnisse zu jener Zeit wichtig waren. Der dritte Professor war ein maronitischer Priester aus dem Libanon, und auch dies ist bedeutsam, weil damit die erste Zusammenarbeit zwischen Europäern und einheimischen Gelehrten belegt wird.[15] Bald darauf, im Jahr 1613, wurde an der Universität Leiden in den Niederlanden ein Lehrstuhl für Arabisch eingerichtet, dessen erster Inhaber der berühmte Gelehrte Thomas Erpenius war. In England wurde 1632 ein Lehrstuhl in Cambridge und 1634 einer in Oxford eingerichtet. Zu dieser Zeit begann das ernsthafte und anhaltende Studium arabischer Quellen, aus denen die menschliche Gestalt Muhammads deutlicher hervorging.
Verfolgt man die Entwicklung allein in England, so kommt man nicht umhin, mit Edward Pococke (1604–91), dem ersten Inhaber des Lehrstuhls in Oxford, zu beginnen. Er war zweimal für längere Zeit im Nahen Osten, einmal als Kaplan der englischen Kaufleute in Aleppo und danach in Istanbul. An beiden Orten sammelte er Manuskripte oder schrieb sie ab. Eines seiner Werke, das aus dem Studium dieser Schriften hervorging, war sein Specimen Historiae Arabum, dessen Einleitung einen Überblick über den Umfang der wissenschaftlichen Kenntnisse seiner Zeit gibt. Es enthält arabische Genealogien, Erklärungen zur Religion Arabiens in vorislamischer Zeit, eine Beschreibung der grundlegenden Lehren des Islam und eine Übersetzung von al-Ghazalis Glaubensbekenntnis.[16] Um die Jahrhundertwende unternahm George Sale (ca. 1697–1736) die erste zuverlässige Koranübersetzung, die sich ihrerseits weitgehend auf die letzte lateinische Version von Lodovico Maracci stützte. Auch hier ist die Einleitung wichtig; sie stellt die Frage nach den Absichten Gottes, die sich im Kommen Muhammads manifestieren. Dieser war nicht, wie Sale meint, unmittelbar von Gott erleuchtet, sondern Gott nutzte dessen menschliche Neigungen und Interessen für seine eigenen Absichten: »Eine Geißel für die christliche Kirche zu sein, weil diese nicht gemäß der heiligen Religion, die sie empfangen hatte, lebte.«[17] Dies war nur dank Muhammads bemerkenswerter Eigenschaften möglich, dank seiner Überzeugung nämlich, zur Wiederherstellung der wahren Religion gesandt zu sein, seines Enthusiasmus (im Sinne des 18. Jahrhunderts als eines starken, nicht von der Vernunft gezügelten Gefühls), dank seines Scharfsinns und guten Urteilsvermögens, seines gutartigen Charakters und nicht zuletzt dank seiner angenehmen und höflichen Manieren.
In derselben Generation veröffentlichte Simon Ockley (1678 bis 1720) eine History of the Saracens mit einem ähnlichen Bild von Muhammad. Danach war dieser kein erleuchteter Prophet, wohl aber ein Mann von bemerkenswerter Begabung, der nicht nur das Wissen und die Gelehrsamkeit früherer Zeiten in sich vereinigte, sondern auch als Moralreformer wirkte. Die Araber brachten Europa
»allgemein gebotene Dinge, die Gottesfurcht, die Zügelung der Leidenschaften, kluge Wirtschaft, schickliches und besonnenes Benehmen«[18]
wieder zurück.
Mit zunehmendem Wissen veränderte sich auch die Sicht auf Religion in der eigentlichen Bedeutung des Wortes. Wie Wilfred Cantwell Smith in seinem Buch The Meaning and End of Religion zeigt, taucht der moderne Gebrauch des Begriffs im 16. und 17. Jahrhundert auf. Davor bezeichnete er nur Formen des Kultes, von da an jedoch jedes von Menschen geschaffene Glaubenssystem und alle Glaubenspraktiken. Wird der Begriff so gebraucht, sind verschiedene Religionen möglich, alle wert, daß man sich mit ihnen auf rationale Weise beschäftigt und auseinandersetzt.[19]
Dieses erwachende Interesse an der Vielgestaltigkeit religiöser Vorstellungen ist zum Beispiel im Leben von Robert Boyle (1627–91), dem bekannten »Naturphilosophen« und einer der Gründer der Royal Society, deutlich zu erkennen. In seiner Autobiographie beschreibt er eine geistige Krise in seinem früheren Leben. Auf einer Bildungsreise besuchte er ein Karthäuserkloster in der Nähe von Grenoble und wurde dort von »so seltsamen und schrecklichen Gedanken heimgesucht und von so verwirrenden Zweifeln über manche Grundfesten des Christentums«, daß er versucht war, sich umzubringen, bis es »zuletzt Gott gefiel […] ihm das entzogene Gefühl Seiner Gnade wiederzuschenken«.[20] Aus dieser Krise zog er die heilsame Lehre, »ernsthaft die fundamentalsten Wahrheiten des Christentums erforschen zu wollen und zu hören, was sowohl Türken und Juden als auch die wichtigsten Sekten der Christen zur Begründung ihrer unterschiedlichen Ansichten vorbringen konnten«.[21] Er meinte, daß allein durch eine solche Erforschung sein eigener Glaube fest begründet werden konnte. In seinem Testament verfügte er, daß jährlich eine Anzahl von Vorlesungen gehalten werden sollte, die für die christliche Religion und gegen die »Atheisten, Theisten, Heiden, Juden und Mahomedaner«[22] Zeugnis ablegten.
Wurde das Christentum im Licht seiner Beziehungen zu anderen Religionen betrachtet und wurden alle Religionen als ein von Menschen geschaffenes Glaubens- und Handlungssystem angesehen, so konnten daraus mehrere Schlüsse abgeleitet werden: Das Christentum konnte als besonderer Glauben mit besonderem Ursprung gelten, oder aber alle Religionen als Werke menschlichen Denkens und Fühlens; das Christentum war dann nicht notwendigerweise einzigartig und die beste aller Religionen.
Einige Autoren des 18. Jahrhunderts neigten tatsächlich dazu, sich Leben und Wirken Muhammads zu einer versteckten Kritik am Christentum – zumindest in der Form, wie die Kirchen es lehrten – zunutze zu machen. Muhammad konnte als Beispiel übertriebener Schwärmerei und ehrgeizigen Strebens vorgeführt werden und seine Anhänger auch als Beispiele menschlicher Leichtgläubigkeit; umgekehrt konnte er als Verkünder einer Religion, die rationaler war oder näher am reinen, natürlichen Glauben als das Christentum, angesehen werden.
Dies war die Sicht einiger französischer Denker des 18. Jahrhunderts, und wir hören in Napoleons Äußerungen über den Islam noch ein Echo davon. In der auf arabisch verkündeten Proklamation nach der Landung in Ägypten im Jahre 1798 versicherte er den Ägyptern, daß die Franzosen »Gott weit mehr fürchten als dies die Mamelucken taten und den Propheten und den herrlichen Koran verehren […] Die Franzosen sind wahre Muslime.«[23] Ohne Zweifel war darin viel Propaganda, aber auch Bewunderung für die Leistungen Muhammads (ein Thema, auf das Napoleon später in seinem Leben wieder zurückkam) und eine bestimmte Ansicht von der Religion: Es gibt einen Gott oder ein höheres Wesen, dessen Existenz vernunftmäßig begriffen werden kann, dessen Wesen und Wirken jedoch von gewissen Religionen entstellt wurde. Die Religionen können daran gemessen werden, inwieweit ihre Lehre sich einer rational einsichtigen Wahrheit annähert.
Eine solche Vorstellung von der Religion kann auf verschiedene Weisen geäußert werden, die von einer echten vernunftbestimmten Überzeugung bis hin zu einem fast gänzlichen Skeptizismus oder Agnostizismus reichen. Edward Gibbon stand auf der Schwelle zum Skeptizismus, dennoch erschien ihm Muhammad im besten Licht, in dem man einen religiösen Führer sehen konnte. Das 50. Kapitel von Geschichte des Verfalls und Untergangs des Römischen Reiches ist Muhammad und dem Aufstieg des Islam gewidmet. Es ist ein Werk von außerordentlicher Gelehrsamkeit, das sich auf eine breite Lektüre von Werken europäischer Gelehrter und Reisender wie Chardin, Volney und Niebuhr stützt. Gibbon hat eine klar gefaßte und bis zu einem gewissen Grad günstige Meinung über Muhammad. Dieser, so glaubt er, sei Träger »eines wahren höheren Geistes«, der, wie es sich gehört, in der Einsamkeit geformt worden war; denn »Umgang bereichert den Verstand; aber Einsamkeit ist die Schule des Geistes«. Das Ergebnis dieser Einsamkeit war der Koran, »ein herrliches Zeugnis der Einheit Gottes«. Er bringt Gott als
»[…] ein unendliches und ewiges Wesen, ohne Gestalt und Ort, ohne Anfang und Seinesgleichen, gegenwärtig in unseren geheimsten Gedanken, das sein Dasein aus der Notwendigkeit seiner eigenen Natur und alle moralische und geistige Vollkommenheit aus sich selbst schöpft«
zum Ausdruck. Dies ist, fügt Gibbon hinzu, »ein für unsere gegenwärtigen Kräfte vielleicht allzu erhabenes Glaubensbekenntnis«, und deshalb lauern Gefahren dahinter, gegen die Muhammad nicht immer immun war:
»Gottes Einheit ist eine mit der Natur und Vernunft übereinstimmende Vorstellung; und ein flüchtiger Umgang mit Juden und Christen lehrte ihn Verachtung und Abscheu gegen den Götzendienst in Mekka […] die Geisteskraft, unaufhörlich auf einen Gegenstand gerichtet, wandelte eine allgemeine Verpflichtung in eine besondere Berufung; die Eingebung des erhitzten Verstandes wurde als Eingebung des Himmels gefühlt […] wie das Bewußtsein in einem ungeschiedenen Zustand zwischen Selbstillusion und vorsätzlichem Betrug schlummern mag.«
Mit zunehmendem Erfolg, so meint Gibbon, hätten sich auch die Motive Muhammads geändert:
»Menschenliebe mag glauben, daß Muhammads ursprüngliche Beweggründe reine Wohltätigkeit waren; doch […] Mekkas Ungerechtigkeit und Medinas Wahl machten den Bürger zum Prinzen, den demütigen Prediger zum Heerführer […] und ein Staatsmann mag argwöhnen, er habe über die Begeisterung seiner Jugend und die Leichtgläubigkeit der Bekehrten heimlich gelächelt.«[24]
(Wir finden hier schon vor, was später ein gängiges Thema in der europäischen Wissenschaft werden sollte: den Unterschied zwischen Muhammad in Mekka und in Medina.)
3
Europäer, die sich mit dem Islam beschäftigten, konnten diesem gegenüber zu Beginn des 19. Jahrhunderts zwei Haltungen (selbstverständlich in je verschiedenen Variationen) einnehmen. Sie konnten den Islam entweder als Feind und Gegenspieler des Christentums ansehen, der einige christliche Grundwahrheiten für seine eigenen Zwecke in Anspruch nahm, oder aber als eine Form, mit deren Hilfe menschliche Vernunft und menschliches Empfinden, Gottes Natur und das Universum zu verstehen und zu erklären versuchen. Beiden Haltungen gemeinsam war die Anerkennung der Tatsache, daß Muhammad und seine Anhänger eine bedeutende Rolle in der Weltgeschichte gespielt hatten. Überdies war es zu dieser Zeit schwieriger, dem Islam wie auch anderen Religionen in der Welt gegenüber keine Stellung zu beziehen, da die Beziehungen zwischen Europa und den Völkern Asiens und Afrikas mit anderen Religionen als dem Christentum im Wandel begriffen waren. Zusammen mit der Erfindung und Anwendung neuer Herstellungsmethoden weitete sich der Handel aus, und neue Verkehrsmittel wurden entwickelt: Dampfschiff, Eisenbahn, Telegraphie. Die Expansion Europas brachte neue Kenntnisse von der Außenwelt und schuf neue Zuständigkeiten: Britische, französische und holländische Herrschaft wurde über die Hafenstädte und deren Hinterland in den Ländern um das Mittelmeer und am Indischen Ozean ausgeweitet, während sich nach Süden, zum Schwarzen Meer hin, und nach Osten, nach Asien hinein, die russische ausbreitete.
Folglich fand in diesem Jahrhundert auch eine Erneuerung des Denkens über den Islam statt. Diese nahm, je nach den Erfahrungen der verschiedenen europäischen Nationen, unterschiedliche Formen an. In Großbritannien und unter den Briten des Empires erhielt die Vorstellung vom Gegensatz zwischen Christentum und Islam durch den religiösen Eifer der Evangelikalen neuen Auftrieb, wonach die Rettung nur in der Vergegenwärtigung der Sünde und in der Hinnahme der Heilsbotschaft Christi liege, und daß, wer um seine Rettung weiß, die Pflicht habe, anderen die Wahrheit entgegenzuhalten. Eine solche Konfrontation war nun dank vermehrter organisierter missionarischer Tätigkeit auf breiterer Ebene als früher möglich, aber auch, weil das expandierende Empire, insbesondere das indische, ein weites Feld von Möglichkeiten und Verpflichtungen bot.
Im allgemeinen nahmen die vom evangelikalen Geist erfüllten Missionare dem Islam gegenüber eine ablehnende Haltung ein und waren vom Pflichtbewußtsein durchdrungen, die Muslime bekehren zu müssen. Als ein Musterbeispiel kann Thomas Valpy French (1825–91), Prinzipal des St. John’s College in Agra und später Bischof von Lahore, gelten. Schon früh in seiner Missionstätigkeit kam er zu dem Schluß, daß »Christentum und Muhammedanismus so verschieden wie Himmel und Erde und wohl nicht miteinander in Einklang zu bringen« waren.[25] Später gab er den Posten als Bischof auf, weil er es für seine Pflicht ansah, das Evangelium in Arabien, im Herzen der muslimischen Welt, zu verkünden. Er starb auf dem Weg dorthin in Muskat.
Bisweilen kam es zu direkten Konfrontationen; mindestens zwei davon sind überliefert. Die erste war eine schriftliche Kontroverse zwischen Henry Martyn (1781–1812), einem berühmten Missionar in Indien, während seines Aufenthaltes in Schiraz im Jahre 1811 und zwei iranischen schiitischen Theologen. In der Hauptsache ging es um Fragen, die bei allen Polemiken zwischen Muslimen und Christen schon immer im Mittelpunkt gestanden hatten. Ist der Koran ein Wunder? Martyn verneinte es, die mullas dagegen äußerten die orthodoxe Meinung, daß der Koran einzig und unwiederholbar und dies der Beweis für seinen göttlichen Ursprung sei. War das Kommen Muhammads in der Bibel vorhergesagt? Auch hier brachten die mullas die orthodoxe Sicht zum Ausdruck: Sein Kommen war vorhergesagt, doch der Text der Bibel war von der Kirche verfälscht oder falsch gedeutet worden. Waren die moralischen Eigenschaften Muhammads und seiner Anhänger so beschaffen, daß sie den Glauben an eine göttliche Herkunft des Islam zuließen? Hier drehte sich die Diskussion um vertraute Themen: die Vielzahl der Frauen des Propheten und die Verbreitung des Islam mit Waffengewalt.[26]
Eine direktere öffentliche Kontroverse fand 1854 in Agra zwischen Karl Pfander, einem deutschen Missionar im Dienst der Church Missionary Society, und einem muslimischen Geistlichen, Schaich Rahmatullah al-Kairanawi, statt. Pfander stammte aus deutschem pietistischen Milieu, das dem der Evangelikalen nicht unähnlich war. Von einigen evangelikalen Beamten der Ostindiengesellschaft ermutigt, betrieb er eine aktive Prediger- und Schrifttätigkeit, veröffentlichte ein dickes Buch über Sünde und Erlösung und wurde von Schaich Rahmatullah zu einer öffentlichen Debatte herausgefordert. Hauptsächlich ging es um die Frage, ob die christlichen Schriften dahingehend geändert wurden, die Hinweise auf das Kommen des Propheten Muhammad zu verschleiern. Die Debatte blieb ohne Ergebnis, weil Pfander sich nach der zweiten Sitzung zurückzog, doch wird aus den Berichten klar, daß er das Treffen nicht für sich entscheiden konnte. Rahmatullah verfügte über einige Kenntnisse in der neuen deutschen Wissenschaft der Bibelkritik, die er von einem muslimischen indischen Arzt mit guten Englischkenntnissen bezogen hatte; er nutzte sein Wissen, um die Frage nach der Echtheit und Zuständigkeit der Bibel in einem neuen Licht zu betrachten.[27]
Nicht nur die Missionare waren vom evangelikalen Geist erfüllt; viele britische Beamte in Indien waren ebenfalls davon erfaßt. Einer von ihnen, William Muir (1819–1905), war bei der Debatte von Agra dabei. Einige Jahre davor hatte er einen Artikel, »The Muhammadan controversy«, geschrieben, der die für die Evangelikalen charakteristische ablehnende Haltung gegenüber dem Islam dokumentierte. Der Islam sei, so sagte er,
»der einzige unverhohlene und ernstzunehmende Widersacher des Christentums […] ein tatkräftiger und mächtiger Feind […] Gerade weil der Muhammedanismus sich nicht zum göttlichen Ursprung bekennt und sich so viele Waffen vom Christentum angeeignet hat, ist er ein so gefährlicher Gegner.«[28]
Später, nach seiner Karriere in Indien, wurde Muir Rektor der Universität von Edinburgh und schrieb sein berühmtes Buch Life of Muhammad, das für viele Jahre das Standardwerk zu diesem Thema bleiben sollte. Es enthält weitgehend dieselbe Botschaft wie der frühere Artikel. Muhammad erscheint als eine Mischung aus guten und schlechten Eigenschaften, wobei die schlechten in seinem späteren Leben überwogen. Es sei ein Irrglauben anzunehmen, daß der Islam eine Art Christentum wäre oder eine evangelikale Vorbereitung darauf sein könnte:
»Darin ist gerade so viel Wahrheit, die aus früheren Offenbarungen entlehnt, aber in eine andere Form gebracht ist, wie es braucht, um die Aufmerksamkeit von der Notwendigkeit nach mehr abzulenken.«[29]
Außerhalb der Kreise evangelikaler Christen fanden andere Haltungen möglicherweise weitere Verbreitung: Etwa jene, die von der Vorstellung ausgingen, der Islam sei innerhalb seiner Grenzen ein unverfälschter Ausdruck des Bedürfnisses, an einen Gott zu glauben, und zwar an einen Gott mit eigenen Werten. Eine solche Sicht wurde in eher verworrener Form in einem Werk vertreten, das einen großen und nachhaltigen Einfluß auf die englischsprachige Welt haben sollte: Thomas Carlyles 1841 erschienene Vorlesung »The hero as prophet« in On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History. Carlyle erkennt darin, entsprechend seiner Definition von der Prophetie, Muhammad als Propheten an: »eine schweigsame große Seele: einer von denen, der nicht anders als ernst sein kann«. Er war sich »des großen Mysteriums der Existenz bewußt […] der unbeschreiblichen Tatsache des ›Hier bin ich‹«. In einem gewissen Sinne war er inspiriert:
»Solch Licht war erschienen, daß es die Finsternis dieser wilden arabischen Seelen zu erleuchten vermochte. Wie verwirrt von der blendenden Pracht des Lebens und des Himmels […] nannte er es Offenbarung und Engel Gabriel; wer von uns vermöchte denn zu wissen, wie es nennen?«[30]
Einer von denen, die Carlyles Vorlesungen hörten, war F.D. Maurice, ein führender Theologe der Kirche von England, einer, der zu seiner Zeit – und danach noch – selbst Auseinandersetzungen auslöste und einige Verwirrung stiftete. John Stuart Mill, der nicht mit seinen Ideen sympathisierte, sagte über ihn: »in Maurice war mehr intellektuelle Energie verschwendet als in irgendeinem anderen meiner Zeitgenossen«.[31] In einem Brief lobte Maurice den nachsichtigen Blick Carlyles auf Muhammad, war jedoch mit dessen Vorstellung von Religion nicht einverstanden. Carlyle, sagte er,
»betrachtet die Welt, als ob sie ohne Zentrum wäre und [die christliche Lehre] nur als eine mythische Veranstaltung unter vielen, in denen bestimmte Handlungen […] Gestalt annehmen«.[32]
Maurices eigene Anschauungen über andere Religionen kamen einige Jahre später in seinem Buch The Religions of the World and Their Relations with Christianity zum Ausdruck. Es handelt sich dabei um Vorlesungen in der von Robert Boyle gegründeten Vorlesungsreihe. Herausgegeben wurden sie 1845–46, als Maurice Professor für Literatur und Geschichte am King’s College in London war, wo er bald darauf Professor für Theologie werden sollte. Dies war einige Jahre vor der Kontroverse, welche zu seiner Abberufung vom Lehrstuhl führte. In den Vorlesungen wandte sich Maurice Fragen zu, die sich, wie er glaubte, aus den Verhältnissen seiner Zeit und seines Landes ergaben. England war im Begriff, eine Kolonialmacht zu werden. Es bestand also eine Verpflichtung, Nichtchristen das Evangelium zu predigen, was Kenntnisse von deren Religionen voraussetzte und davon, in welchem Verhältnis das Christentum zu ihnen stand. Dabei erhob sich wiederum eine andere Frage: Was ist Christentum? Ist es nur eine unter anderen Weltreligionen oder nimmt es diesen gegenüber eine besondere Stellung ein, die ihm eine Wahrheit verleiht, welche die anderen nicht haben? Maurice erklärt, daß er sich der »enormen Veränderung der Einstellung der Menschen gegenüber religiösen Systemen« bewußt sei. Beunruhigende Fragen müßten gestellt werden:
»Sollte nicht jede Religion ihren eigenen Boden haben? […] Wird nicht vielleicht eine bessere Zeit kommen, da alle Religionen ihr Werk mehr schlecht als recht erfüllt haben und von etwas Verständlicherem und Befriedigerendem abgelöst werden?«
Die große politische Revolution des ausgehenden 18. Jahrhunderts hat die Beschuldigung erhoben, die Religionen würden im Interesse der Politiker und Priester verteidigt. Solche Anschuldigungen wurden sowohl gegen das Christentum als auch – und vielleicht noch vehementer – gegen andere Religionen gerichtet. Es war daher notwendig, die Frage zu stellen, was Religion wirklich sei.[33]
Für Maurice war das Wesen der Religion »der Glaube in den Herzen der Menschen«. Damit meinte er etwas Besonderes: Glaube war für ihn nicht nur eine menschliche Eigenschaft, ein wesentlicher Bestandteil der conditio humana