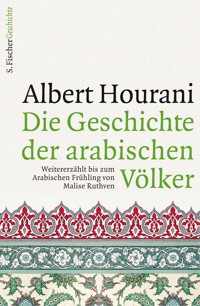
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
DAS GRANDIOSE MEISTERWERK, DER KLASSIKER ZUR GESCHICHTE DER ARABISCHEN WELT, von den Anfängen des Islam bis heute. Jetzt in einer repräsentativen Neuausgabe mit einem aktuellen Nachwort, das die Geschichte bis zum Arabischen Frühling weitererzählt. Der große Orientalist Albert Hourani, ein Wanderer zwischen den Welten, präsentiert in seinem elegant erzählten Klassiker die gesamte Geschichte und Kultur der arabischen Völker seit dem 7. Jahrhundert. Brillant beschreibt er die rasante Verbreitung des Islam und erzählt von den Gelehrten, Völkern und Ereignissen, die die arabische Welt prägten. Er schildert Aufstieg und Ende des Osmanischen Reichs, die Folgen der europäischen Expansion und die Konflikte in der Region, bis hin zur Intifada und den Golfkriegen. Wie es danach bis zum Arabischen Frühling weiterging, erzählt der bekannte Publizist und Islamwissenschaftler Malise Ruthven in seinem aktuellen Nachwort. Fulminante historische Erzählung und kluge Analyse zugleich, ist das Buch ein unentbehrlicher Beitrag zum Verständnis der heutigen arabischen Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1147
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Albert Hourani
Die Geschichte der arabischen Völker
Weitererzählt bis zum Arabischen Frühling von Malise Ruthven
Biografie
Albert Hourani, 1915 als Sohn libanesischer Eltern in Manchester geboren, studierte in Oxford. Er lehrte zunächst an der Amerikanischen Universität in Beirut und nach dem Zweiten Weltkrieg dann in Oxford am St Anthony's College. Er war Direktor des Middle East Center und nach 1979 Gastprofessor in Chicago und Harvard. Albert Hourani starb 1993.
Malise Ruthven, geboren 1942, ist ein bekannter englischer Publizist und Experte für die arabische Welt. Er schreibt u.a. für die ›New York Review of Books‹ sowie für den ›Guardian‹ und den ›Observer‹. Auf Deutsch erschien von ihm ›Der Islam‹, auf Englisch zuletzt ›A Historical Atlas of the Islamic World‹ (mit Azim Nanji 2004), das mit dem Middle East Outreach Council Book Award ausgezeichnet wurde.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei S. FISCHER
Aktualisierte Neuausgabe 2014
Die englische Originalausgabe erschien 1991 unter dem Titel ›A History of the Arab People‹ bei Faber and Faber Ltd., London, die aktualisierte Neuausgabe 2013.
© Albert Hourani, 1991
© Vor- und Nachwort: Malise Ruthven, 2002/2013
Für die deutsche Ausgabe:
© 2014 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die Begriffe aus der Arabistik wurden von Susanne Enderwitz überprüft.
Karten: Graphik Harald und Ruth Bukor
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403359-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Vorwort von Malise Ruthven
Vorwort von Albert Hourani
Hinweis des Autors
Geographische Begriffe
Zur Umschrift
Daten
Prolog
Teil I: Die Erschaffung einer Welt (Siebtes bis zehntes Jahrhundert)
Kapitel 1 Eine neue Macht in einer alten Welt
Die Welt, in die die Araber kamen
Die Sprache der Dichtung
Muhammad und das Erscheinen des Islam
Kapitel 2 Ein Reich wird geschaffen
Muhammads Nachfolger: die Eroberung eines Reiches
Das Kalifat von Damaskus
Das Kalifat von Bagdad
Kapitel 3 Die Bildung einer Gesellschaft
Das Ende der politischen Einheit
Eine geeinte Gesellschaft: die ökonomischen Grundlagen
Die Einheit von Glaube und Sprache
Die islamische Welt
Kapitel 4 Die Ausformung des Islam
Die Autoritätsfrage
Die Macht und die Gerechtigkeit Gottes
Die schari’a
Die Traditionen des Propheten
Der Pfad der Mystik
Der Pfad der Vernunft
Teil II: Arabisch-Muslimische Gesellschaften (Elftes bis fünfzehntes Jahrhundert)
Kapitel 5 Die arabisch-muslimische Welt
Staaten und Dynastien
Araber, Perser und Türken
Geographische Unterteilungen
Muslimische Araber und andere Glaubensgemeinschaften
Kapitel 6 Die ländlichen Gebiete
Das Land und seine Nutzung
Stammesgesellschaften
Kapitel 7 Das städtische Leben
Märkte und Städte
Die städtische Bevölkerung
Das Gesetz und die ulama
Sklaven
Muslime und Nichtmuslime in der Stadt
Frauen in der Stadt
Das Gesicht der Stadt
Häuser in der Stadt
Die Kette der Städte
Kapitel 8 Städte und ihre Herrscher
Die Entstehung von Dynastien
Das Interessenbündnis
Die Kontrolle über die ländlichen Regionen
Vorstellungen politischer Autorität
Kapitel 9 Die Wege des Islam
Die Säulen des Islam
Die Freunde Gottes
Kapitel 10 Die Kultur der ulama
Die ulama und die schari’a
Die Überlieferung des Wissens
kalam
al-Ghazali
Kapitel 11 Divergierende geistige Strömungen
Der Islam der Philosophen
Ibn Arabi und die Theosophie
Ibn Taimiya und die hanbalitische Tradition
Die Entwicklung der Schia
Jüdische und christliche Gelehrsamkeit
Kapitel 12 Höfische Kultur und Volkskultur
Herrscher und Bauten
Dichtung und Erzählung
Musik
Das Verständnis der Welt
Teil III: Das Osmanische Zeitalter (Sechzehntes bis achtzehntes Jahrhundert)
Kapitel 13 Das Osmanische Reich
Die Grenzen politischer Macht
Die osmanische Regierung
Die Osmanen und die islamische Tradition
Das Regierungssystem in den arabischen Provinzen
Kapitel 14 Osmanische Gesellschaften
Bevölkerung und Reichtum im Osmanischen Reich
Die arabischen Provinzen
Die Kultur der arabischen Provinzen
Jenseits der Reichsgrenzen: Arabien, der Sudan und Marokko
Kapitel 15 Die Veränderung des Kräftegleichgewichts im achtzehnten Jahrhundert
Zentrale und lokale Autorität
Die arabisch-osmanische Gesellschaft und Kultur
Die Welt des Islam
Veränderte Beziehungen zu Europa
Teil IV: Das Zeitalter der europäischen Imperien (1800–1939)
Kapitel 16 Europäische Macht und Reformregierungen (1800–1860)
Die Expansion Europas
Die Anfänge des europäischen Imperiums
Die Reformregierungen
Kapitel 17 Die europäischen Imperien und die herrschenden Eliten (1860–1914)
Die Grenzen der Unabhängigkeit
Die Teilung Afrikas: Ägypten und der Maghreb
Die Allianz der vorherrschenden Interessen
Die Kontrolle des Bodens
Die Lage der Menschen
Die duale Gesellschaft
Kapitel 18 Die Kultur des Imperialismus und der Reform
Die Kultur des Imperialismus
Der Aufstieg der Intellektuellen
Die Kultur der Reform
Das Aufkommen des Nationalismus
Die Kontinuität der islamischen Tradition
Kapitel 19 Der Höhepunkt europäischer Macht (1914–1939)
Die Vorherrschaft Großbritanniens und Frankreichs
Das Primat der britischen und französischen Interessen
Die Immigranten und das Land
Eine einheimische Elite entsteht
Bemühungen um politische Einigung
Kapitel 20 Änderungen in Lebensweise und Denken (1914–1939)
Bevölkerung und ländliche Gebiete
Das Leben in den neuen Städten
Die Kultur des Nationalismus
Der Islam der Elite und der Massen
Teil V: Das Zeitalter der Nationalstaaten (seit 1939)
Kapitel 21 Das Ende der Imperien (1939–1962)
Der Zweite Weltkrieg
Nationale Unabhängigkeit (1945–1956)
Die Suezkrise
Der Algerienkrieg
Kapitel 22 Gesellschaftliche Veränderungen (Die 1940er und 1950er Jahre)
Bevölkerung und Wirtschaftswachstum
Die Profite des Wachstums: Kaufleute und Grundbesitzer
Die Staatsmacht
Reich und Arm in der Stadt
Kapitel 23 Nationale Kultur (Die 1940er und 1950er Jahre)
Das Bildungswesen und seine Probleme
Sprache und Ausdruck
Islamische Bewegungen
Kapitel 24 Der Höhepunkt des Arabismus (Die 1950er und 1960er Jahre)
Populärer Nationalismus
Der Aufstieg des »Nasirismus«
Die Krise von 1967
Kapitel 25 Arabische Einigkeit und Uneinigkeit (seit 1967)
Die Krise von 1973
Der beherrschende Einfluß der USA
Die gegenseitige Abhängigkeit der arabischen Länder
Arabische Uneinigkeit
Kapitel 26 Aufruhr der Gemüter
Ethnische und religiöse Spaltungen
Reich und Arm
Die Frauen in der Gesellschaft
Ein Erbe und seine Erneuerung
Die Stabilität der Regime
Die Labilität der Regime
Nachwort von Malise Ruthven
Die Krise in Syrien
Zwei Golfkriege
Die amerikanische Besetzung und deren Folgen
Die religiöse Dimension
Rebellion im Jemen
Der Palästinakonflikt
Kontinuität der Dynastien
Die Herausforderung des Islamismus
Die islamistische Herausforderung in Algerien
Islamisierung und der Konflikt im Sudan
Entwicklungskrisen
Satelliten und soziale Medien als Katalysatoren
Schluß
Anhang
Karten
Die Familie des Propheten
Die Haschimiten
Die Schiitischen Imame
Die Kalifen
Die wichtigen Dynastien
Herrscherfamilien im 19. und 20. Jahrhundert
Glossar arabischer Begriff
Bibliographie
Danksagung
Register
Für meine Kollegen und Studenten
am St Antony’s College, Oxford
Vorwort von Malise Ruthven
Als Albert Hourani 1993 starb, hinterließ er ein umfangreiches Werk mit mehr als einhundert Essays und mehreren bahnbrechenden Büchern, das seinen Höhepunkt in der Geschichte der arabischen Völker fand[1]. Als Wissenschaftler von unermüdlicher Produktivität lehrte und inspirierte er eine ganze Generation von Studenten durch seine wissenschaftlichen Schriften und durch die selbstlose Hingabe, mit der er ihre Forschungen anleitete. Der freundliche und bescheidene Mann schien in beispielhafter Weise alle Eigenschaften zu verkörpern, die man bei einem Hochschullehrer sucht, aber durchaus nicht immer findet: einen ruhelos forschenden Geist, stets offen für neue Ideen, Eleganz in der Argumentation und Höflichkeit in der Debatte.
Ich hatte nie das Privileg, zu seinen Doktoranden zu gehören, von denen viele eine herausragende Karriere auf beiden Seiten des Atlantiks gemacht haben. Aber ich hatte das Vergnügen, ihn gegen Ende seiner Lehrtätigkeit in Oxford und dann während seiner Zeit als Emeritus in London zu kennen. Mein Verleger hatte ihm das Manuskript zu Seid Wächter der Erde: Die Gedankenwelt des Islam zugeschickt – ein Buch, das ich in meiner Zeit als Journalist bei der BBC in London geschrieben hatte. Er wich damals von der Konvention des anonymen Rezensenten ab und rief mich persönlich an. Ich weiß heute noch, wie sehr ich mich freute, als ich seinen Anruf erhielt: »Ihr Buch gefällt mir. Möchten Sie nach Oxford kommen und es mit mir zusammen durchgehen?« In mehreren Sitzungen erfuhr mein Manuskript die Expertenprüfung, die sonst nur den Dissertationen seiner Doktoranden vorbehalten war. Albert prüfte den Text nicht nur auf Fehler. Er wollte, daß es aus sich heraus Erfolg hatte, und füllte behutsam die Lücken meiner eigenen Lektüre. Einer seiner weniger freundlichen Kritiker nannte ihn einmal den Pascha der Nah- und Mitteloststudien, der einem ganzen Netzwerk aus Beziehungen zwischen Schirmherr und Klienten vorstehe, wie er es in seinen Schriften über die osmanisch-arabische Gesellschaft beschrieben hatte. Angemessener wäre wohl der Vergleich mit dem Sufi-Scheich oder Meister, der seine jungen murids (Anhänger) zu größerer Wahrheit und besserem Verständnis zu führen versucht.
Albert Hourani wurde 1915 in Manchester geboren, als fünftes von sechs Kindern einer Familie von Baumwollhändlern aus Marjayoun im heutigen Libanon. Sein Großvater war von der griechisch-orthodoxen Kirche zum Protestantismus übergetreten. Sein Vater Fadlo hatte seine Ausbildung am Syrian Protestant College erhalten, bevor er 1881 nach Manchester ging, um im Baumwollexport zu arbeiten. Baumwoll- und Wollerzeugnisse aus Manchester fanden sich im gesamten Osmanischen Reich und in Nordafrika, während in der Stadt selbst Gemeinschaften levantinischer Einwanderer – Muslime, Christen und Juden – lebten, die dort ihren Geschäften nachgingen. Alberts Bruder Cecil erinnert sich in seinen Memoiren:
Meine frühesten Erinnerungen an Manchester haben zwei Gesichter: ein nahöstlich-libanesisches, voller Poesie, Politik und Geschäft, das andere teils schottisch-presbyterianisch, geprägt von sonntäglichen Kirchbesuchen und der Sonntagsschule, teils englisch aufgrund eines englischen Kindermädchens und einer ganzen Folge englischer und irischer Köchinnen und Hausmädchen.
Nichts veranschaulicht diese Zweiteilung besser als die Nahrung, mit der wir aufwuchsen. An Samstagen, wenn mein Vater zu Hause mit seinen libanesischen und syrischen Geschäftspartnern und Kunden zu Mittag aß, gab es Speisen aus den libanesischen Dörfern – kibbe und das traditionelle Samstagsgericht mujaddara, Esaus Linsengericht; sonntags gab es dann englisches Roastbeef, gefolgt von Apple-Pie oder Milchpudding.[2]
Fadlo Hourani war ein eifriges Mitglied der Liberalen Partei und der gesellschaftlichen Clubs in Manchester. 1946 – schon über achtzig Jahre alt – wurde er Honorarkonsul des Libanon in Nordengland, ein Amt, das ihm einen offiziellen Status in der Stadt verlieh, in der er den größten Teil seines Lebens verbracht hatte. Früher in seiner Laufbahn hatte er unter ethnischer Diskriminierung leiden müssen. Als er versuchte, Albert und dessen älteren Bruder George in der besten Privatschule Manchesters anzumelden, sagte man ihm, dort nehme man nur »englische Jungen« auf. Er reagierte darauf mit der Gründung einer eigenen Schule, der Didsbury Preparatory School, die zwar recht klein war, aber über eine gemischte Schülerschaft aus Levantinern, Engländern und sephardischen Juden verfügte. Mit vierzehn schickte er Albert auf die Mill Hill School bei London, das erste »öffentliche« (gebührenpflichtige) Internat, das nicht von der Church of England gegründet worden war. Die 1807 von Nonkonformisten ins Leben gerufene Mill Hill School förderte bei ihren Schülern eine Kultur der Toleranz und der individuellen Freiheit. Hourani war ein glücklicher und fleißiger Schüler. Mill Hill sollte einen bleibenden Eindruck in seinem Denken und Fühlen hinterlassen.
1933 ging Hourani ans Magdalen College in Oxford, wo er das klassische PPE-Studium (Philosophie, Politik und Ökonomie) absolvierte. Das Studium vermittelte ihm eine solide Grundlage im liberalen englischen und europäischen Denken, von Locke und Mill bis Descartes und Kant. Es stimulierte außerdem sein Interesse an der Geistesgeschichte. In seinem letzten Studienjahr vertiefte er sich jedoch in die Geschichte und dort vor allem in die Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens. Die Anregung dazu verdankte er Besuchen in Marjayoun und der Freundschaft seines Vaters mit Philip Hitti, dem Doyen der im Westen arbeitenden arabischen Historiker. Er begann ein Doktorandenstudium auf dem Gebiet der Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens in Oxford (wo allerdings nur wenig zu diesem Thema gelehrt wurde), gab dieses Projekt aber bald wieder auf. Statt dessen verwendete er sein Stipendium zu Reisen nach Beirut, wo er eine Dozentenstelle am einstigen College seines Vaters erhielt, das heute den Namen American University of Beirut (AUB) trägt.
Viele Jahre später beschrieb er, welchen entscheidenden Einfluß seine Jahre in Beirut auf sein Denken ausübten:
Nach dem Zwielicht Nordenglands erlebte ich zum ersten Mal das mediterrane Licht. Es war wichtig für mich, daß ich meine erweiterte Familie kennenlernte, oder vielmehr meine beiden Familien, die meines Vaters und die meiner Mutter. Ich erfuhr etwas über mich selbst und auch über das Wesen der Familienbande in der Mittelmeerwelt: die Art, wie Blutsbande oder Verbindungen allen zwischenmenschlichen Beziehungen Tiefe und Festigkeit verleihen können, wie auch über die Werte der Ehre und der Schande, über die Anthropologen später so viel schreiben sollten.[3]
Zwei bedeutsame Gestalten, die ihn an der AUB beeindruckten, waren Charles Malik (später Außenminister des Libanon und eine der führenden Stimmen bei der Gründung der Vereinten Nationen, an deren Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte er mitwirkte) und Qustantin Zurayk, Dozent für die Geschichte des Islam und Ideengeber der jüngeren arabischen Nationalisten. Inzwischen hatte Hourani genügend Arabisch gelernt, um Zurayks »eloquenter und gut durchdachter Vorlesung über islamische Geschichte« zu folgen, von der er bescheiden behauptete, sie sei die Lehrveranstaltung gewesen, in der er »einer formalen Ausbildung auf diesem Gebiet noch am nächsten gekommen« sei. Houranis Interesse am arabischen Nationalismus wurde durch die Lektüre zweier Bücher geweckt: Die sieben Säulen der Weisheit von T.E. Lawrence und Das arabische Erwachen von George Antonius. Er nahm viele der in diesen epochemachenden und einflußreichen Werken enthaltenen Gedanken in sich auf. Lawrenc’ Sicht der arabischen Bewegung erschien ihm jedoch als »allzu schlicht heroisch«, und die Thesen von Antonius zum ureigenen Charakter der arabischen Identität bezweifelte er. Seines Erachtens vernachlässigten oder unterschätzten beide Autoren in ihren Vorstellungen von der arabischen Nation die Jahrhunderte der osmanischen Herrschaft.
Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Hourani als Analytiker in der von dem Historiker Arnold Toynbee geleiteten Forschungsabteilung des britischen Außenministeriums. Er teilte viele von Toynbees Ansichten über den Nahen und Mittleren Osten und über den Bruch der Versprechungen, die den Arabern während des Ersten Weltkriegs von den Briten gemacht worden waren. Sein Vorgesetzter in der für den Nahen und Mittleren Osten zuständigen Unterabteilung war Hamilton Gibb, dem Hourani später in dem von Gibb gegründeten neuen Centre for Middle Eastern Studies am St Antony’s College in Oxford folgen sollte. Als besonders anziehend empfand er Gibbs distanziert-wissenschaftlichen Schreibstil. Durch seine Arbeit während der Kriegs- und Nachkriegszeit erwarb Hourani unmittelbare Erfahrungen mit der Diplomatie in spannungsreichen und schwierigen Zeiten. 1942 schickte man ihn auf eine Forschungsmission in den Nahen Osten, und aufgrund seines Berichts erhielt er eine Stellung im Amt des Britischen Ministers in Kairo, wo er bis 1945 blieb. Dort traf er einige der führenden Persönlichkeiten der Zeit, darunter Glubb Pascha, den britischen Offizier, der die aus Beduinen bestehende Arabische Legion in Transjordanien aufbaute und befehligte, und David Ben Gurion, den Zionistenführer, der später der erste Premierminister Israels wurde und mit dem er ein »langes und angenehmes« Gespräch führte. Wenig später wurden aus den für das Außenministerium verfaßten Berichten die ersten Fassungen publizierter Bücher: Syria and Libanon (1946), Great Britain and the Arab World (1946) und Minorities in the Arab World (1947).
Gegen Ende des Krieges befaßten sich Hourani und seine Kollegen zunehmend mit der Lage in Palästina und den Problemen, die sich aus dem gegensätzlichen Druck der jüdischen Einwanderung und des arabischen Widerstands für die Mandatsmacht Großbritannien ergaben. Natürlich galten seine Sympathien den palästinensischen Arabern, die Enteignung und den Verlust ihres Landes befürchteten, als die zionistische Bewegung angesichts der aus Osteuropa kommenden Enthüllungen über die Greueltaten der Nazis an Schwung gewann. 1945 traf er mit Musa Alami zusammen, dem »intelligentesten und interessantesten unter den palästinensisch-arabischen Führern«, der ihn überredete, sich dem Arab Office in Jerusalem anzuschließen, einer Organisation, die das Ziel verfolgte, der zionistischen Propaganda entgegenzutreten, indem sie die arabische Sache erklärte. Zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben arbeitete er als Propagandist. Obwohl die zionistischen Lobbyisten ihn für ihren gefährlichsten Gegner hielten, fühlte er sich in dieser Rolle nicht wohl. Im Rückblick auf diese Phase seines Lebens schrieb er später:
Ich mochte diese Arbeit jedoch nicht und glaube auch nicht, daß ich gut darin war. Die Gesellschaft von Politikern und ihre Art zu denken gefielen mir nicht; auch fiel es mir schwer, die endlosen Wiederholungen des politischen Diskurses und die Notwendigkeit zu ertragen, um der Wirksamkeit eines Argumentes willen so viele Bedeutungsnuancen zu unterdrücken. Ich schloß dieses Kapitel meines Lebens mit Erleichterung ab und habe es niemals wieder geöffnet.[4]
In den Wirren des Arabisch-Israelischen Krieges von 1948 und der Gründung des Staates Israel (die man in der arabischen Welt al-naqba – die Katastrophe – nennt), wurde das Arab Office geschlossen, und Hourani kehrte nach Oxford zurück, wo er bis zu seiner Emeritierung 1984 blieb. Obwohl er noch einige Jahre weiterhin über Palästina schrieb, gab er dieses politisch orientierte Schreiben Ende der 1950er Jahre zugunsten einer distanziert-analytischen wissenschaftlichen Arbeit auf, die er an Sir Hamilton Gibb so bewunderte. Er war offensichtlich der Ansicht, daß eine auf Politik zielende Wissenschaft intellektuell und moralisch leicht kompromittiert wird. Es ist jedoch auch klar, daß al-naqba ihn persönlich sehr berührte. »Baudelaire hat gesagt, das Herz habe nur einen Jahrgang«, schrieb er 1957. »Wenn das so ist, wird meines immer von dem geprägt sein, was in Palästina geschehen ist.« Zu dieser Zeit trat Hourani der römisch-katholischen Kirche bei.
Ich nehme an, das Palästina-Trauma hatte einigen Einfluß auf seine Fähigkeit, auch eher negative Aspekte der arabischen Geschichte unbeirrt in den Blick zu nehmen: die Gewalt und Leidenschaft in den arabisch-islamischen Gesellschaften, Aspekte der Grausamkeit wie die Sklavenmärkte im 19. Jahrhundert, den Einfluß der patriarchalischen Sitten auf die Frauen und die zuweilen mörderische Behandlung von Menschen, die Mächte in Frage stellten, welche sich – wie die des mittelalterlichen Europa – als Träger einer göttlichen Autorität verstanden. Bei aller Eleganz seiner Analysen liegt doch eine gewisse Milde in der olympischen Distanziertheit, mit der er das Kommen und Gehen der historischen Ereignisse betrachtete.
Die arabische Niederlage in Palästina verstärkte auch seine natürliche Skepsis. Die Unfähigkeit der arabischen Staaten, die Palästinenser wirksam zu verteidigen, war in seinen Augen symptomatisch für die darunterliegenden strukturellen Probleme – den Wettstreit zwischen rivalisierenden, von verfeindeten Anführern beherrschten Netzwerken, der im Gegensatz zu ihrer öffentlichen Rhetorik stand. Hourani glaubte nie, daß die Aufrufe Abd an-Nasirs zu arabischer Einheit, die im Verlauf der 1950er und 1960er Jahre von anderen arabischen Führern aufgegriffen wurden, eines Tages Wirklichkeit würden.
Bevor Hourani sich den strukturellen Fragen zuwandte, die er in seiner Geschichte der arabischen Völker so klar und überzeugend darlegt, unternahm er einen Ausflug in das Reich der Ideen. Seine berühmte Studie über Arabic Thought in the Liberal Age 1798–1939 (1962) war eine elegant geschriebene Untersuchung zu den Reaktionen christlicher und muslimischer Intellektueller auf die Herausforderungen des Kolonialismus im 19. und 20. Jahrhundert und den Einfluß des europäischen Denkens. Obwohl er sein eigenes Buch später kritisierte, weil er darin der Ablehnung europäischer Ideen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt habe, hatte es doch beträchtlichen Einfluß. Der verstorbene Hisham Sharabi, ein führender palästinensisch-amerikanischer Wissenschaftler, sah darin eine unverzichtbare Quelle jeder Erforschung der modernen arabischen Geistesgeschichte. Sharabi gehörte zu den wichtigsten Beiträgern der von 2002 bis 2005 erschienenen Arab Human Development Reports (AHDR) der Vereinten Nationen, einer bislang einzigartigen Bemühung arabischer Intellektueller um eine kritische Selbstanalyse in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts. Houranis Vermächtnis und Geist sind deutlich spürbar in dieser bemerkenswerten Gemeinschaftsarbeit, auf die ich im Nachwort zu diesem Buch noch genauer eingehen werde.
Arabic Thought war indessen nur der Anfang einer intellektuellen Reise und nicht einmal deren Mittelpunkt. Am St Anthony’s College in Oxford (an dem ausschließlich Doktoranden studieren) konnte Hourani sich für ein Werk, das er jedoch niemals abschloß, in die arabisch-osmanische Geschichte vertiefen. Eine beträchtliche Zeit lang, während der er Doktoranden betreute und Aufgaben in der Universitätsverwaltung wahrnahm, waren Aufsätze das Genre seiner Wahl. In einem davon, »Ottoman Reform and the Politics of Notables«, ging er dem Phänomen der Unordnung in den osmanischen Städten des 19. Jahrhunderts nach, deren Wurzeln er in der wachsenden Spannung zwischen einer zentralisierten Bürokratie und älteren Methoden der sozialen Kontrolle erblickte. Die Idee einer »speziellen Politik von Würdenträgern« regte zahlreiche Dissertationen an und ist in der Wissenschaft weitgehend akzeptiert. Seine Arbeit zur osmanischen Zeit war indessen nicht vergebens, bildet sie doch einen wesentlichen Strang in der Geschichte der arabischen Völker.
Ein wichtiger neuer Einfluß ergab sich 1962 aus seinem Besuch an der University of Chicago und seiner Bekanntschaft mit der Arbeit von Sozialwissenschaftlern und Anthropologen sowie der französischen Historikerschule der Annales, der er in Gestalt seines einstigen Schülers André Raymond begegnete. Am wichtigsten für die Entstehung dieses Buches war unterdessen Houranis Begegnung mit dem Quäker-Historiker Marshall Hodgson, dem wohl größten Islamwissenschaftler, den Amerika jemals hervorgebracht hat und dessen dreibändige Venture of Islam (1974) erst nach Hodgsons frühem tragischen Tod im Alter von 46 Jahren veröffentlicht wurde. Durch die Lektüre dieses Buches gewann Hourani ein tieferes Verständnis Ibn Chalduns (1332–1406), des großen arabischen Gelehrten und Geschichtsphilosophen, dessen Muqaddima – Betrachtungen zur Weltgeschichte – eine bemerkenswert scharfsinnige, bei entsprechender Anpassung auch heute noch erstaunlich gute Analyse der arabischen Gesellschaften im Hochmittelalter enthält.
Im Prolog zur Geschichte der arabischen Völker und in mehreren Abschnitten des Textes zollt Hourani Ibn Chaldun und vor allem dessen Konzept der asabiya Tribut, einem »Gemeinschaftsgeist, der sich darauf richtet, Macht zu erlangen und zu bewahren«. »Asabiya« oder »Clandenken« prägt die patriarchalische Familienordnung, die heute noch der Machtstruktur in vielen arabischen Ländern zugrunde liegt. In ihren auch im 20. Jahrhundert virulenten Formen, in denen das »Clandenken« eine Festigung durch moderne Überwachungs- und Foltersystem erfährt, wird asabiya fast überall von den Erhebungen in Frage gestellt, die man im Westen als »Arabischen Frühling« bezeichnet. Trotz des Sturzes der Regime in Tunesien, Ägypten, Libyen und im Jemen ist keineswegs ausgemacht, daß das »Clandenken« tatsächlich auf dem Rückzug ist oder daß es nicht in neuen Formen wiedererstehen könnte. Soziale Identitäten, die sich auf die Familie oder den Clan stützen, sind in aller Regel dauerhafter als solche, die auf den formalen Aspekten eines öffentlichen Amtes basieren. Trotz der Überlagerung durch moderne Regierungs- und Verwaltungssysteme hat asabiya sich als ein erstaunlich hartnäckiges Phänomen erwiesen.
In der Vergangenheit hatte ein mit asabiya ausgestatteter Herrscher gute Chancen, eine Dynastie zu errichten, während städtische Gebilde diese Eigenschaft meist nicht besaßen. Wenn eine dynastische Herrschaft stabil war und florierte, blühte auch das städtische Leben. Aber zu Ibn Chalduns Zeiten trug jede Dynastie den Keim ihres Untergangs bereits in sich, wenn die Herrscher zu Tyrannen degenerierten oder sich durch das Luxusleben korrumpieren ließen. Nach kurzer Zeit ging die Macht dann an eine neue, zähe, von den Rändern kommende Gruppe über. Hourani hat gezeigt, daß sich am allgemeinen Charakter der meisten arabischen Regime oder der Ausrichtung ihrer Politik seit den frühen 1960er Jahren bemerkenswert wenig verändert hat. Die Gruppen, die seit der Entkolonialisierung und bis ins 21. Jahrhundert hinein die Macht innehatten, waren in der Regel schon in den 1970er Jahren an der Macht. Diese Phase politischer Stabilität – die nun in der gesamten arabischen Welt in Frage gestellt wird – erscheint erstaunlich, wenn man die außerordentlich raschen Veränderungen und das Ausmaß der sozialen Wirren bedenkt, die unter der Oberfläche brodeln: die explodierenden Bevölkerungszahlen, die rasche Urbanisierung, die Veränderungen in ländlichen Gebieten und die immer wieder ausbrechenden bewaffneten Konflikte, von der Westsahara bis nach Palästina, im sogenannten »Morgenland« der Levante und in der Golfregion. Hourani erklärte dieses Paradoxon mit einer tiefen Verbeugung vor Ibn Chaldun:
Man könnte Ibn Chaldun frei zitieren und sagen, die Stabilität eines politischen Regimes beruht auf drei Voraussetzungen: Es muß einer Herrschaftsgruppe gelingen, ihre Interessen mit denen der einflußreichen Kräfte der Gesellschaft zu verbinden, und das Interessenbündnis muß in einer politischen Idee zum Ausdruck kommen, die wiederum in den Augen der Gesellschaft, beziehungsweise eines großen Teils der Gesellschaft, die Macht der Regierenden legitimiert. [S. 548]
Hourani erkannte, daß der Zusammenhalt eines Regimes im 20. Jahrhundert von Faktoren abhängt, die es in der Vergangenheit noch nicht gegeben hatte – man denke etwa an den Einsatz moderner bürokratischer Methoden oder die Manipulation und den Zwang seitens der Geheimdienste und Sicherheitskräfte. Außerdem reicht die Macht des modernen Staates heute oft in Regionen hinein, auf die er in der Vergangenheit keinen Zugriff hatte, zum Beispiel in Gebirgsregionen, Wüsten oder Steppen (die marokkanische Herrscher einst als »unbotmäßige Gebiete« bezeichneten). Doch in der modernen arabischen Politik blieb die asabiya der herrschenden Gruppen ein wichtiger Faktor. In manchen Ländern wie Ägypten und Tunesien wurde dies durch die Mechanismen des Einparteiensystems nach osteuropäischem Vorbild verdeckt, das dem Führer zur Legitimation und als Transmissionsriemen oder Übertragungskanal für seine Autorität diente, in Wirklichkeit aber den Interessen des Herrschers, seiner Familie und seines Gefolges aus Freunden und Klienten nützte. In anderen Ländern wie Syrien oder dem Irak vor der amerikanischen Invasion wurde die Partei von einer inneren Gruppe kontrolliert, deren Zusammenhalt weitgehend auf bereits bestehenden, durch Sektensolidarität unterfütterten Verwandtschaftsbeziehungen basierte. In anderen wiederum wie etwa Saudi-Arabien und den Monarchien am Golf bestimmt die durch Blutsbande und gemeinsame Interessen zusammengehaltene Herrscherfamilie den Staat: L’état c’est nous.
Hourani war nicht der erste moderne Autor, der in Ibn Chaldun einen eindrucksvollen Lotsen durch die arabisch-islamische Geschichte mit ihren zahlreichen Verwirrungen und ihrer entmutigenden Komplexität fand. Neben Hodgson stützte sich auch Ernest Gellner, Autor von Pflug, Schwert und Buch, in seinen Schriften über die muslimische Gesellschaft Nordafrikas ausgiebig auf den arabischen Gelehrten. Doch weder Hodgson noch Gellner reichten an Hourani heran in der Kenntnis der Originalquellen, der Breite der Lektüre und vor allem in der Leichtigkeit, mit der er komplexe Ideen in ein verständliches und lesbares Englisch übersetzte.
Natürlich konnte Hourani nicht voraussehen, daß eine Generation von Aktivisten, die noch gar nicht geboren war, als er seine Geschichte der arabischen Völker schrieb, die politische Trägheit von Jahrzehnten aufbrechen und in manchen Fällen sogar überwinden würde, um die soziale und politische Landschaft der arabischen Welt zu erneuern – ausgestattet mit einem sehr präzisen Bewußtsein für die Funktionsweise der Medien und mit großem physischen und moralischen Mut. Doch seine Analyse wird zweifellos ihren Kampf erhellen, nicht zuletzt indem sie die gewaltigen Hindernisse aufzeigt, die ihnen das uralte Phänomen der asabiya in ihren vielfältigen modernen Formen in den Weg legt. Fachleute werden dieses Buch weiterhin wegen der Tiefe seiner Gelehrsamkeit bewundern, gewöhnliche Leser, weil es ihnen einen so lebendigen Zugang zur Geschichte der Araber eröffnet.
Malise Ruthven
Februar 2012
Vorwort von Albert Hourani
Thema dieses Buches ist die Geschichte der arabischsprechenden Teile der islamischen Welt vom Aufstieg des Islam bis in unsere Zeit. In manchen Perioden mußte ich jedoch über das Thema hinausgehen, zum Beispiel bei der Betrachtung der Frühzeit des Kalifats, des Osmanischen Reiches und der Expansion des europäischen Handels und Herrschaftsgebietes. Man könnte einwenden, das Thema sei zu weit oder zu eng gefaßt, denn die Geschichte des Maghreb unterscheide sich von der Geschichte des Nahen Ostens, oder die Geschichte der Länder mit Arabisch als wichtigster Sprache lasse sich nicht getrennt von der Geschichte anderer muslimischer Länder betrachten. Irgendwo muß man jedoch eine Grenze ziehen, und ich habe sie hier gezogen – unter anderem auch wegen der Begrenztheit meines Wissens. Ich hoffe, das Buch wird zeigen, daß ein genügendes Maß an Einheit historischer Erfahrung zwischen den einzelnen Regionen besteht, um sie in einen Zusammenhang zu stellen und um so darüber zu schreiben.
Dieses Buch ist für eine allgemeine Leserschaft bestimmt, die etwas über die arabische Welt erfahren möchte, und es ist für Studienanfänger gedacht. Spezialisten wird klar sein, daß in einem Werk dieser Themenbreite vieles, was ich sage, auf der Forschungsarbeit anderer basiert. Ich habe versucht, die wesentlichen Tatsachen darzustellen und sie im Licht dessen zu interpretieren, was andere geschrieben haben. Die Bibliographie enthält die Werke der Autoren, denen ich zu Dank verpflichtet bin.
Hinweis des Autors
Geographische Begriffe
Bei einem Buch, das einen so langen Zeitraum umfaßt, mußte ich eine Entscheidung über die Schreibweisen von Namen treffen. Ich habe die Namen moderner Staaten benutzt, um geographische Regionen zu kennzeichnen, selbst wenn diese Namen in der Vergangenheit nicht in Gebrauch waren. Es erschien mir einfacher, das ganze Buch hindurch denselben Namen zu benutzen, als ihn entsprechend der geschichtlichen Periode zu ändern. Daher bezeichnet »Algerien« eine bestimmte Region in Nordafrika, obwohl dieser Name erst in der Neuzeit in Gebrauch kam. Im allgemeinen benutze ich Namen, die dem westlichen Leser vertraut sind. Das Wort »Maghreb« ist vermutlich so bekannt, daß es anstelle von »Nordwestafrika« verwendet werden kann. Bei »Maschreq« ist das nicht der Fall, und deshalb benutze ich statt dessen »Naher Osten«. Ich habe die muslimischen Teile der Iberischen Halbinsel als »Andalus« bezeichnet, denn ein Wort ist einfacher als eine Wortverbindung. Wenn ich den Namen eines heutigen souveränen Staates benutze, während ich über eine vor der Existenz dieses Staates liegende Periode schreibe, bezeichnet er eine grob definierte geographische Region; nur wenn ich über die Neuzeit schreibe, bezieht sich der Name auf das heutige Staatsgebiet. Zum Beispiel bezeichnet »Syrien« im größten Teil des Buches eine bestimmte Region mit gewissen natürlichen und sozialen Gegebenheiten und einer insgesamt einheitlichen Vergangenheit. Ab der Entstehung des Staates Syrien nach dem Ersten Weltkrieg verwende ich den Namen nur noch dafür. Ich muß wohl kaum darauf hinweisen, daß diese Handhabung kein politisches Urteil darüber beinhaltet, welche Staaten bestehen und wie ihre Grenzen verlaufen sollten.
Karte 1 enthält die wichtigsten verwendeten geographischen Begriffe.
Zur Umschrift
Für eine bessere Lesbarkeit des Textes wurde auf die wissenschaftliche Transkription verzichtet. Die englische Umschrift arabischer Namen, Wörter und Termini wurde nach den Vorschlägen der Dudenredaktion eingedeutscht. Im Deutschen nicht oder anders gebräuchliche Laute sind:
’
Stimmabsatz
th
stimmloses englisches th (thing)
dsch
stimmhaftes italienisches g (giorno)
ch
stimmloses deutsches ch (Bach)
dh
stimmhaftes englisches th (there)
r
gerolltes r
z
stimmhaftes deutsches s (Rose)
gh
Gaumen-r (norddt. Wagen)
q
tiefes k
w
englisches w (water)
Wörter, die im Deutschen vertraut sind, wurden in ihrer üblichen Form belassen (z.B. Koran statt Qur’an). Dasselbe gilt für eine Anzahl von Länder- und Städtenamen (z.B. Khartum statt Chartum). Der stimmlose Kehllaut des Arabischen wurde außer bei kursiv gesetzten Termini am Wortanfang weggelassen und in der Wortmitte bzw. am Wortende nur durch ein Apostroph als Stimmabsatzzeichen markiert (z.B. Ali, schari’a). Auch die Vokallängungen und emphatischen Laute wurden nicht berücksichtigt.
Daten
Seit frühislamischer Zeit legen Muslime der Datierung von Ereignissen den Tag von Muhammads Übersiedlung von Mekka nach Medina im Jahre 622n.Chr. zugrunde. Arabisch wird diese Auswanderung als die Hidschra bezeichnet. In den europäischen Sprachen fügt man deshalb islamischen Jahresangaben die Initialen n.H. hinzu.
Das Jahr des muslimischen Kalenders hat nicht die gleiche Länge wie das christliche Jahr. Grundlage für die Berechnung des christlichen Jahres ist ein vollständiger Umlauf der Erde um die Sonne, der ungefähr dreihundertfünfundsechzig Tage dauert. Das muslimische Jahr hat zwölf Monate, die jeweils einem Mondumlauf um die Erde entsprechen. Das unter diesen Voraussetzungen gemessene Jahr ist etwa elf Tage kürzer als das Sonnenjahr.
Informationen über die Umrechnung muslimischer Daten in christliche Daten und umgekehrt finden sich in den Wüstenfeld-Mahlerschen Vergleichstabellen zur muslimischen und iranischen Zeitrechnung (Wiesbaden 1961).
Die Datumsangaben in diesem Buch sind alle Daten der christlichen Zeitrechnung, es sei denn, es ist im Kontext wichtig, das muslimische Datum oder Jahrhundert anzugeben.
Im Falle von Herrschern sind die Daten der Thronbesteigung und des Todes (oder der Absetzung) angegeben, bei anderen Personen Geburts- und Sterbedatum. Ist das Datum der Geburt unbekannt, findet sich nur das Todesdatum (z.B. gest. 1456), bei noch lebenden Personen nenne ich nur das Geburtsdatum (z.B. geb. 1905). Sind nur ungefähre Lebensdaten bekannt, wird dies durch ca. deutlich gemacht (z.B. ca. 1307–1358).
Prolog
Im Jahre 1382 bat ein arabischer Gelehrter im Dienste des Herrschers von Tunis seinen Herrn um die Erlaubnis für eine Pilgerfahrt nach Mekka. Nachdem sie ihm erteilt worden war, bestieg er ein Schiff nach Alexandria in Ägypten. In seinem fünfzigsten Lebensjahr verließ er, wie sich herausstellte, für immer die Länder des Maghreb, in denen er und seine Vorfahren auf unterschiedlichen Gebieten eine bedeutende Rolle gespielt hatten.
Abd ar-Rahman ibn Chaldun (1332–1406) gehörte einer Familie an, die nach der arabischen Eroberung Spaniens aus dem südlichen Teil Arabiens dorthin gekommen war und sich in Sevilla niedergelassen hatte. Als die christlichen Reiche im Norden Spaniens sich ausdehnten, siedelte die Familie nach Tunis über, wie viele Familien, die traditionell im Staatsdienst oder im Bereich der Kultur gearbeitet hatten. Sie bildeten in den Städten des Maghreb (des westlichen Teils der islamischen Welt) ein Patriziat, dessen Dienste die dortigen Herrscher gerne in Anspruch nahmen. Ibn Chalduns Urgroßvater spielte eine Rolle am Hof von Tunis, fiel aber in Ungnade und fand den Tod; sein Großvater diente dem Thron ebenfalls, sein Vater jedoch gab die Politik und den Staatsdienst auf und führte das zurückgezogene Leben eines Gelehrten. Ibn Chaldun selbst erhielt nach der Sitte der Zeit durch seinen Vater und durch Gelehrte, die in den Moscheen oder Schulen von Tunis unterrichteten oder die Stadt besuchten, eine gründliche Ausbildung. Und während er als junger Mann an anderen Orten lebte, setzte er seine Studien fort, denn es entsprach der Tradition, in der er stand, daß ein Mann Wissen bei allen suchen sollte, die es weitergeben konnten. In seiner Autobiographie erwähnt er die Namen der Lehrer, deren Vorlesungen er hörte, sowie die Fachgebiete, die sie unterrichteten: der Koran, für die Muslime das Wort Gottes, der es durch den Propheten Muhammad in arabischer Sprache offenbarte; der hadith oder die Überlieferung dessen, was der Prophet sagte und tat; Jurisprudenz, die Wissenschaft vom Gesetz und den sozialen Normen, die formal auf Koran und Hadith ruhte; die arabische Sprache, ohne welche sich die Religionswissenschaften nicht verstehen ließen; außerdem die rationalen Wissenschaften Mathematik, Logik und Philosophie. Er berichtet Einzelheiten über die Persönlichkeit und das Leben seiner Lehrer, und er schreibt, daß die meisten von ihnen, wie seine Eltern, dem Schwarzen Tod, der großen Pestepidemie zum Opfer fielen, der um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts die Welt heimsuchte.
Schon in jungen Jahren brachten Ibn Chalduns Sprachbeherrschung und seine Kenntnis der Rechtswissenschaft ihn in die Dienste des Herrschers von Tunis – zunächst als Sekretär, später in verantwortungsvollere und daher gefährdetere Ämter. Es folgten zwanzig Jahre wechselhaften Glücks. Er verließ Tunis und diente anderen Herrschern im Maghreb; er ging nach Granada, der Hauptstadt des letzten noch überlebenden muslimischen Reiches in Spanien. Dort wurde er gunstvoll aufgenommen und mit einer Mission zu dem christlichen Herrscher Sevillas, der Stadt seiner Vorfahren entsandt. Dort aber zog er Mißtrauen auf sich und reiste überstürzt nach Algerien ab. Hier trat er neue Ämter an: Vormittags erledigte er Regierungsgeschäfte und lehrte anschließend in der Moschee. Unter seiner Mitwirkung schlossen Führer der Araber- und Berberstämme aus der Wüste und den Bergen politische Treuebündnisse mit den Herrschern, denen er diente. Der Einfluß, den er dadurch gewann, erwies sich als nützlich, wenn er, was wieder und wieder in seinem Leben geschah, bei seinem Herrn in Ungnade fiel. Einmal verbrachte er vier Jahre (1375–79) unter dem Schutz eines arabischen Stammesführers in einer Festung im algerischen Hinterland. In diesen Jahren, während er frei war von den Geschäften der Welt, verfaßte er eine große, breit angelegte Geschichte der Dynastien des Maghreb.
Der erste Teil dieser Geschichte, die Muqaddima (Vorrede) zieht bis auf den heutigen Tag das Interesse auf sich. Ibn Chaldun versucht darin, den Aufstieg und Fall von Dynastien auf eine Weise zu erklären, die in seiner Sicht fortan als Kriterium für die Glaubwürdigkeit historischer Aufzeichnungen dienen sollte. Die früheste und einfachste Form der menschlichen Gesellschaft, glaubte er, war die der Steppen- und Bergvölker, die Ackerbau oder Viehzucht betrieben und in lockerer Gefolgschaft zu Führern standen, die Gehorsam nicht erzwingen konnten. Solche Völker besaßen eine gewisse natürliche Tugend und Stärke, waren jedoch unfähig, aus eigener Kraft eine stabile Regierung, Städte oder Hochkulturen hervorzubringen. Dazu bedurfte es eines Herrschers mit absoluter Autorität. Und ein solcher Herrscher konnte sich nur durchsetzen, wenn es ihm gelang, eine Gruppe von Anhängern zu bilden und zu beherrschen, die asabiya besaßen, das heißt, Gemeinschaftsgeist, der sich darauf richtete, Macht zu erlangen und zu bewahren. Diese Gruppe ließ sich am besten aus den tatkräftigen Männern der Steppengebiete und Berge rekrutieren; eine Gruppe konnte zusammengehalten werden durch Abhängigkeiten oder das Gefühl einer tatsächlichen oder fiktiven gemeinsamen Herkunft. Gefestigt wurde sie durch eine Religion, zu der sich alle bekannten. Eine starke Gefolgschaft mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit ermöglichte einem Herrscher die Gründung einer Dynastie; war ihre Macht stabil, entstanden große Städte mit spezialisiertem Handwerkertum, mit Luxus und hoher Kultur.
Jede Dynastie trug jedoch den Keim ihres Niedergangs in sich. Tyrannei, Zügellosigkeit und ein Verlust der Führungsqualitäten konnten sie schwächen. Die Macht mochte vom Herrscher auf Mitglieder der eigenen Gruppe übergehen, doch früher oder später konnte die Dynastie durch eine andere, auf ähnliche Weise entstandene ersetzt werden. Wenn das geschah, verschwand oft nicht nur der Herrscher, sondern das ganze Volk, auf das sich seine Macht gegründet hatte, fiel zusammen mit der von ihm geschaffenen Lebensweise auseinander; wie Ibn Chaldun in einem anderen Zusammenhang sagt: »Bei einer allgemeinen Veränderung der Umstände ist es, als habe die gesamte Schöpfung sich verändert und die ganze Welt sich gewandelt.«[1]
Die Griechen und die Perser, »zu ihrer Zeit die größten Mächte der Welt«[2], waren von den Arabern verdrängt worden, die dank ihrer Stärke und ihres Zusammenhalts eine Dynastie hervorgebracht hatten, deren Macht sich von Zentralasien bis Spanien erstreckte. Aber die Araber ihrerseits waren in Spanien und im Maghreb von den Berbern und weiter im Osten von den Türken verdrängt worden.
Das wechselnde Geschick der Herrscher bestimmte das ihrer Diener. Als Ibn Chaldun nach Alexandrien reiste, stand er am Anfang einer neuen Laufbahn. Er unternahm die Pilgerfahrt nach Mekka noch nicht – das sollte er später tun –, sondern begab sich nach Kairo, das ihm als eine Stadt von besonderem Rang erschien, anders als alle Städte, die er kannte: »Metropole der Welt, Garten des Universums, Treffpunkt von Nationen, Ameisenhügel von Völkern, heilige Stätte des Islam, Sitz der Macht.«[3] Kairo war die Hauptstadt des Mamluken-Sultanats, einer der größten Staaten der damaligen Zeit, der neben Ägypten auch Syrien umfaßte. Ibn Chaldun wurde dem Herrscher vorgestellt, gewann seine Gunst und erhielt zunächst eine Leibrente und dann Anstellungen erst an einer, dann an einer zweiten königlichen Hochschule. Er sandte einen Boten an seine Familie in Tunis, um sie nachkommen zu lassen, aber sie ertranken alle auf der Schiffsreise.
Ibn Chaldun lebte bis zu seinem Tod in Kairo. Er verbrachte einen Großteil seiner Zeit mit Lesen und Schreiben, aber das Muster seines früheren Lebens wiederholte sich im Wechsel von Einfluß und Ungnade. Wenn er die Gunst des Herrschers verlor, machte er seine Feinde dafür verantwortlich, aber möglicherweise lagen die Gründe auch in seiner Persönlichkeit. Mehrmals ernannte ihn der Herrscher zum Richter an einem der obersten Gerichtshöfe, aber jedesmal gab Ibn Chaldun diese Position wieder auf oder verlor sie. Er begleitete den Sultan nach Syrien und besuchte die heiligen Stätten in Jerusalem und Hebron. Er reiste ein zweites Mal nach Syrien, als Damaskus von Timur Lenk (Tamerlan) belagert wurde, einem der großen asiatischen Eroberer, der ein Reich geschaffen hatte, das sich von Nordindien bis Syrien und Anatolien erstreckte. Ibn Chaldun führte Gespräche mit Timur Lenk; er sah in ihm ein Beispiel jener Befehlsgewalt, die sicher auf der Stärke seiner Armee und seines Volkes ruhte und auf die Timur Lenk eine neue Dynastie gründen konnte. Es gelang Ibn Chaldun nicht, Damaskus vor der Plünderung zu bewahren, aber er erreichte für sich die freie Rückreise nach Ägypten. Unterwegs indessen wurde er in den Hügeln von Palästina überfallen und ausgeraubt.
Ibn Chalduns Leben, wie er es schildert, verrät uns etwas über die Welt, der er angehörte. Es war eine Welt, welche die Menschen in ihr ständig an die Zerbrechlichkeit all ihres Strebens gemahnte. Seine eigene Laufbahn zeigt deutlich, wie unsicher die Zweckbündnisse waren, auf die Dynastien sich zur Erhaltung ihrer Macht stützten. Das Zusammentreffen mit Timur Lenk vor Damaskus machte deutlich, wie sehr der Aufstieg einer neuen Macht das Leben von Städten und Völkern beeinflußte. Außerhalb der Stadt war die Ordnung gefährdet. Der Gesandte eines Herrschers konnte ausgeraubt werden, aber ein in Ungnade gefallener Höfling konnte außerhalb des Bereichs städtischer Kontrolle Zuflucht finden. Der Tod der Eltern durch die Pest und der Tod von Frau und Kindern durch Schiffbruch war ihm eine tiefe Lehre über die Machtlosigkeit des Menschen in der Hand des Schicksals.
Eines war jedoch beständig oder schien es zu sein. Denn eine Welt, in der eine Familie aus dem südlichen Arabien nach Spanien übersiedeln, sechs Jahrhunderte später wieder etwas näher an den Ort ihrer Herkunft zurückkehren konnte und sich immer noch in vertrauter Umgebung befand, besaß eine Einheit, welche die Trennungen von Zeit und Raum überwand. Die arabische Sprache öffnete überall in dieser Welt die Türen zu Ämtern und Einfluß; ein Wissenskanon, der über Jahrhunderte hinweg durch eine bekannte Kette von Lehrern weitergegeben worden war, schützte eine sittliche Gemeinschaft vor dem Verfall, selbst wenn die Herrscher wechselten. Pilgerstätten wie Mekka und Jerusalem waren unverrückbare Pole der menschlichen Welt, auch wenn die Macht sich von einer Stadt in eine andere verlagerte. Und der Glaube an einen Gott, der die Welt erschaffen hatte und sie erhielt, gab den Schicksalsschlägen einen Sinn.
Das Gebiet, auf das sich das Buch bezieht, mit den wichtigsten geographischen Gegebenheiten und häufig verwendeten Namen.
Teil IDie Erschaffung einer Welt
(Siebtes bis zehntes Jahrhundert)
Zu Beginn des siebten Jahrhunderts entstand in den Randgebieten der großen Reiche der Byzantiner und der Sasaniden, die die westliche Hälfte der Welt beherrschten, eine religiöse Bewegung. In Mekka, einer Stadt im westlichen Arabien, rief Muhammad Männer und Frauen zu sittlicher Reform und zur Unterwerfung unter den Willen Gottes auf. Dieser Wille Gottes drückt sich in dem aus, was Muhammad und seine Anhänger als ihnen offenbarte göttliche Botschaften anerkannten, die später in einem Buch, dem Koran, zusammengefaßt wurden. Im Namen dieser neuen Religion, des Islam, eroberten arabische Armeen die umliegenden Länder und gründeten ein neues Reich, das Kalifat. Es umfaßte große Teile des byzantinischen Reiches, das ganze Reich der Sasaniden und erstreckte sich von Zentralasien bis Spanien. Das Machtzentrum des Reiches verlagerte sich unter den Umaiyaden-Kalifen von Arabien nach Damaskus und später unter den Abbasiden nach Bagdad im Irak.
Im zehnten Jahrhundert zerbrach das Kalifat. In Spanien und Ägypten kam es zur Bildung von rivalisierenden Kalifaten, aber die soziale und kulturelle Einheit, die sich im Inneren des Reiches entwickelt hatte, erwies sich als dauerhaft. Ein Großteil der Bevölkerung war muslimisch geworden (das heißt, zu Anhängern der Religion des Islam), doch daneben gab es auch jüdische, christliche und andere Glaubensgemeinschaften. Die arabische Sprache hatte sich ausgebreitet und wurde zum Medium einer Kultur, die Elemente der Traditionen aller in der muslimischen Welt aufgegangenen Völker in sich vereinte und die ihren Ausdruck in der Literatur, in einer Rechtsordnung, einem theologischen System und der Geisteshaltung fand. Muslimische Gesellschaften entwickelten in unterschiedlichen äußeren Umgebungen spezifische Institutionen und Formen. Die Verbindungen zwischen Ländern des Mittelmeerbeckens und denen des Indi- schen Ozeans ließen ein einheitliches Handelsgefüge entstehen und führten zu Veränderungen in Landwirtschaft und Handwerk, die Grundlage für das Wachstum großer Städte mit einer urbanen Zivilisation wurden. Ausdruck dieser Zivilisation waren Gebäude in einem spezifisch islamischen Stil.
Kapitel 1Eine neue Macht in einer alten Welt
Die Welt, in die die Araber kamen
Die Welt des Ibn Chaldun muß den meisten Menschen, die darin lebten, ewig erschienen sein. Doch Ibn Chaldun wußte, daß sie eine frühere verdrängt hatte. Siebenhundert Jahre vor seiner Zeit hatten die Länder; die er kannte, unter der Herrschaft »der zwei größten Mächte ihrer Zeit« ein anderes Gesicht gehabt.
Viele Jahrhunderte lang waren die Länder des Mittelmeerbeckens Teil des Römischen Reiches gewesen. Die ländlichen Gebiete brachten Getreide, Früchte, Wein und Öl hervor, und der Handel verlief auf friedlichen Seerouten. In den großen Städten hatte eine reiche Klasse vielfältigen Ursprungs Anteil an der griechischen und lateinischen Kultur des Reiches. Ab dem vierten Jahrhundert nach Christus verlagerte sich das Zentrum imperialer Macht nach Osten. Konstantinopel trat als Hauptstadt an die Stelle Roms; der Kaiser war Mittelpunkt der Loyalität und das Symbol des Zusammenhalts. Später kam es zu dem, was man eine »horizontale Teilung« genannt hat und die in anderen Erscheinungsformen bis in unsere Zeit weiterbestehen sollte. In Deutschland, England, Frankreich, Spanien und Norditalien herrschten Barbarenkönige, obwohl das Gefühl, zum Römischen Reich zu gehören, noch immer bestand. Das südliche Italien, Sizilien, die nordafrikanische Küste, Ägypten, Syrien, Anatolien und Griechenland blieben unter der direkten kaiserlichen Herrschaft Konstantinopels. In dieser geschrumpften Form war das Reich eher griechisch als römisch. (In seiner späteren Zeit wird es im allgemeinen häufiger nach Byzanz, dem früheren Namen von Konstantinopel, »byzantinisch« als »römisch« genannt.) Der Kaiser regierte durch griechischsprechende Beamte; die großen Städte im östlichen Mittelmeerraum, Antiochia in Syrien und Alexandria in Ägypten, waren Zentren griechischer Kultur und entsandten Angehörige der örtlichen Eliten in den kaiserlichen Dienst.
Eine weitere und tiefgreifendere Veränderung hatte stattgefunden. Das Reich war christlich geworden, nicht nur durch ein offizielles Dekret des Herrschers, sondern infolge von Bekehrungen auf unterschiedlichen Ebenen. Die Mehrheit der Bevölkerung war christlich, obwohl an der Schule von Athen bis ins sechste Jahrhundert heidnische Philosophen lehrten, obwohl in den Städten jüdische Gemeinden existierten und die Erinnerungen an heidnische Götter immer noch in den zu Kirchen umgewandelten Tempeln spukten. Das Christentum verlieh der Loyalität zum Kaiser eine neue Dimension und den örtlichen Kulturen seiner Untertanen einen neuen Rahmen. Christliche Vorstellungen und Symbole fanden ihren Ausdruck nicht nur im Griechischen, das in den Städten gesprochen wurde, sondern auch in den Literatursprachen der verschiedenen Regionen des Reiches: Armenisch in Ostanatolien, Syrisch in Syrien, Koptisch in Ägypten. Die Gräber von Heiligen und andere Pilgerstätten bewahrten und pflegten manchmal in einer christlichen Form die uralten Glaubensvorstellungen und religiösen Praktiken einer Region.
Die Institutionen der Selbstverwaltung griechischer Städte waren mit dem Erstarken der kaiserlichen Bürokratie verschwunden, aber Bischöfe übernahmen oft in ihrem Einflußbereich die Führung der Menschen. Als der Kaiser Rom verließ, hatte der Bischof der Stadt, der Papst, eine Möglichkeit der Machtentfaltung, wie sie den Patriarchen und Bischöfen der oströmischen Städte versagt blieb. Sie standen in enger Verbindung zur Reichsregierung, doch sie konnten immerhin die Interessen ihrer Stadt verteidigen und die Stimmung der Bewohner zum Ausdruck bringen. Auch Einsiedler oder wundertätige Heilige, die in Anatolien und Syrien an den Rändern der Städte oder des besiedelten Landes lebten, mochten als Schiedsrichter bei Streitigkeiten oder als Sprecher der ländlichen Gemeinde auftreten, und der Mönch in der ägyptischen Wüste lieferte ein Beispiel für eine Gesellschaft, die sich von der säkularen, der städtischen Welt unterschied. Neben der offiziellen orthodoxen Kirche entstanden andere, in Doktrin und Praxis von ihr abweichende Religionsgemeinschaften; sie waren entweder Ausdruck von Loyalität oder Opposition aller jener gegenüber der Zentralgewalt, die eine andere Sprache als Griechisch sprachen.
Bei den wichtigsten doktrinären Unterschieden ging es um die Natur Christi. Das Konzil von Chalkedon hatte im Jahre 451 Christus zwei Naturen zugeschrieben: eine göttliche und eine menschliche. Die Mehrheit innerhalb der Kirche in Ost und West akzeptierte diese Formulierung, und die Reichsregierung unterstützte sie. Erst später kam es allmählich und in erster Linie als Folge der Autoritätsfrage zu einer Spaltung zwischen der Kirche in den byzantinischen Gebieten, der griechisch-orthodoxen Kirche mit ihren Patriarchen an der Spitze des Priestertums, und der Kirche in Westeuropa, die den Papst in Rom als höchste Autorität anerkannte. Es gab jedoch Glaubensgemeinschaften, die daran festhielten, daß Christus nur ein einziges Wesen besitze, das sich aus zwei Wesen zusammensetzte. Diese monophysitische Doktrin wurde von der armenischen Kirche in Anatolien vertreten, von den meisten ägyptischen Christen (nach dem alten Namen für Ägypten »Kopten« genannt) und von vielen syrischsprachigen Christen in Syrien (als syrisch-orthodox oder nach dem Namen ihres bekanntesten Theologen als »Jakobiten« bezeichnet). Wieder andere unterschieden deutlicher zwischen den beiden Wesen Christi, um seine volle Menschlichkeit zu Lebzeiten zu behaupten. Für sie lebte das Wort Gottes seit seiner Empfängnis in dem Menschen Jesus. Diese Doktrin galt für die Nestorianer; sie wurden nach einem Denker genannt, der diese Auffassung vertrat. Ihre Kirche hatte die meisten Anhänger unter den Gläubigen im Irak, jenseits der Ostgrenze des byzantinischen Reiches. Im siebten Jahrhundert bildete sich nach dem Versuch, einen Kompromiß zwischen dem orthodoxen und dem monophysitischen Standpunkt zu finden, eine weitere Gruppierung: die Monotheleten. Sie schrieben Christus zwei Wesen, aber nur einen Willen zu.
Im Osten des byzantinischen Reiches, auf der anderen Seite des Euphrat, lag ein anderes großes Reich: das Reich der Sasaniden. Ihre Herrschaft erstreckte sich über den heutigen Iran und Irak bis nach Zentralasien. Das heute als Iran oder Persien bezeichnete Land umfaßte eine Reihe von Regionen mit hoher Kultur und alten Städten, die von unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen bevölkert wurden. Sie waren durch Steppen oder Wüsten voneinander getrennt, und es gab keine großen Flüsse, die eine leichte Verbindung zwischen ihnen ermöglicht hätten. Von Zeit zu Zeit wurden sie von starken, langlebigen Dynastien geeint; die letzte war die Dynastie der Sasaniden, deren Macht sich ursprünglich auf die persischsprachigen Völker des südlichen Iran stützte. Die Sasaniden errichteten einen Familienstaat, der durch eine hierarchisch gegliederte Beamtenschaft regiert wurde. Sie versuchten, eine feste Grundlage für Loyalität und Einheit zu schaffen, indem sie die altiranische Religion wieder zum Leben erweckten, die traditionell mit dem Religionsstifter Zoroaster in Verbindung gebracht wurde. Nach dieser Glaubenslehre war das Universum ein Schlachtfeld, wo gute und böse Geister unter dem höchsten Gott gegeneinander kämpften. Die guten Geister würden schließlich aus eigener Kraft gewinnen, aber tugendhafte Männer und Frauen von ritueller Reinheit konnten den Sieg beschleunigen.
Nachdem Alexander der Große 334–33 vor Christus den Iran erobert hatte und ihn enger mit der Welt des östlichen Mittelmeerraumes verband, drangen Ideen der griechischen Welt nach Osten vor. Gleichzeitig verbreitete sich die Lehre Manis, eines Religionslehrers aus dem Irak, im Westen. Mani versuchte, alle Propheten und Lehrer in einem einzigen religiösen System zu vereinigen (dem Manichäismus). Unter den Sasaniden wurde die Lehre des Zoroaster in philosophischer Ausprägung, mit größerem Nachdruck auf dem Dualismus von Gut und Böse, mit einer Priesterschaft und festen Formen der Verehrung wiederbelebt und ist als Mazdaismus oder Zoroastrismus bekannt. Als Staatsreligion stützte der Mazdaismus die Macht des Herrschers. Er galt als gerechter König, der die Harmonie zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Klassen wahrte.
Die Hauptstadt der Sasaniden, Ktesiphon, lag nicht auf den Hochebenen des Iran, sondern im fruchtbaren und bevölkerten, von Euphrat und Tigris bewässerten Gebiet des mittleren Irak. Außer Zoroastrianern und Manichäern gab es im Irak Anhänger der nestorianischen Kirche, die im Staatsdienst eine wesentliche Rolle spielten. Dieses Gebiet war auch das wichtigste Zentrum jüdisch-religiöser Gelehrsamkeit, und es bot heidnischen Philosophen und gelehrten Medizinern aus den griechischen Städten des Mittelmeerraums Zuflucht. Die persische Sprache war in verschiedenen Formen weit verbreitet; die damalige Schriftform ist als Pahlevi bekannt. Ebenfalls verbreitet war Aramäisch, eine semitische, dem Hebräischen und Arabischen verwandte Sprache. Sie wurde zu dieser Zeit im ganzen Nahen Osten gesprochen, und eine ihrer Ausformungen ist die syrische Sprache.
Die beiden Reiche umfaßten die wichtigsten, dauerhaft besiedelten Kulturregionen der westlichen Halbkugel. Weiter südlich, zu beiden Seiten des Roten Meeres, gab es jedoch zwei andere Gesellschaften mit traditionellen Machtstrukturen, die von der Landwirtschaft und dem Handel zwischen dem Indischen Ozean und dem Mittelmeerraum lebten. Die eine war Äthiopien, ein altes Königreich mit dem koptischen Christentum als Staatsreligion. Die andere war der Jemen im Südwesten der Arabischen Halbinsel, ein Land fruchtbarer Täler und Umschlagplatz für den Fernhandel. An einem Punkt ihrer Geschichte waren diese kleinen Stadtstaaten in einem größeren Reich aufgegangen, das geschwächt wurde, als in frühchristlicher Zeit der Handel zurückging, der später jedoch wieder an Stärke gewinnen sollte. Der Jemen hatte eine eigene Sprache, die sich vom Arabischen unterschied, wie es sonst überall in Arabien gesprochen wurde, und er hatte eine eigene Religion: Priester dienten einer Vielzahl von Göttern in den Tempeln, die Pilgerstätten waren, aber auch Verwaltungszentren großer Ländereien. Die Gläubigen verrichteten dort ihre Gebete, obwohl gemeinschaftliche Formen der Verehrung unbekannt waren. In späteren Jahrhunderten drangen von Syrien auf den Handelswegen und von Äthiopien jenseits des Roten Meeres christliche und jüdische Einflüsse in den Jemen vor. Im sechsten Jahrhundert zerstörte ein dem Judaismus zugeneigter König ein christliches Zentrum, aber der christliche Einfluß nahm durch Invasionen aus Äthiopien wieder zu; an diesen Auseinandersetzungen waren auch Byzantiner und Sasaniden beteiligt.
Zwischen den großen Imperien des Nordens und den Königreichen am Roten Meer lag ein Gebiet, das sich von ihnen unterschied. Der größere Teil der Arabischen Halbinsel bestand aus Steppengebieten oder Wüste mit Oasen, in denen es genug Wasser gab, um Nahrungsmittel anzubauen. Die Bewohner sprachen arabische Dialekte und unterschieden sich auch in ihrer Lebensweise voneinander. Ein Teil lebte als Nomaden und weidete Herden von Kamelen, Schafen oder Ziegen im Umkreis der spärlichen Wasserstellen in der Wüste. Diese Völker bezeichnet man traditionell als »Beduinen«. Daneben gab es seßhafte Bauern, die in den Oasen Getreide anbauten und Palmen pflanzten, und Händler oder Handwerker, die in kleinen Marktflecken lebten. Manche verbanden auch mehrere dieser Lebensweisen miteinander. Das Gleichgewicht zwischen den Nomaden und den seßhaften Gruppen war immer gefährdet. Die beweglichen, bewaffneten Kamelnomaden stellten zwar eine Minderheit der Bevölkerung dar, doch sie erhoben sich ebenso wie die städtischen Kaufleute über die Ackerbauern und Handwerker. Auch ihr Ethos von Mut, Gastfreundschaft, Familienloyalität und Stolz auf die Abstammung dominierte. Die Nomaden standen nicht unter einer stabilen Herrschaft, sondern schlossen sich jeweils Führern aus Familien an, um die sich eine mehr oder weniger beständige Anhängerschaft scharte. Der charakteristische Dialekt der gemeinsamen Herkunft galt als ein Ausdruck für Zusammenhalt und Loyalität. Solche Gruppierungen bezeichnet man üblicherweise als Stämme.
Die Macht der Stammesführer ging oft von Oasen aus, wo sie enge Bindungen zu den Kaufleuten unterhielten, die den Handel im Stammesgebiet organisierten. In diesen Oasen ermöglichte es jedoch die Macht der Religion auch anderen Familien, eine andere Form von Einfluß zu gewinnen. Die Religion der Viehzüchter und Pflanzer scheint keine klaren Formen gehabt zu haben. Man sah in Steinen, Bäumen und anderen natürlichen Gegenständen die Verkörperungen örtlicher Gottheiten, die mit Gestirnen identifiziert wurden. Gute und böse Geister durchzogen die Welt in Gestalt von Tieren; Wahrsager behaupteten, übernatürliche Weisheiten zu verkünden. Aus heutigen religiösen Praktiken in Südarabien schließt man, daß die Götter nach damaliger Vorstellung in einem Heiligtum wohnten, einem haram, einem Bezirk oder einer Siedlung, die von Stammeskonflikten ausgeklammert blieb. Der haram war Ziel von Pilgerreisen und Opferplatz; er war ein Treffpunkt, und dort wurden Streitigkeiten geschlichtet. Diese heilige Stätte wurde von einer Familie behütet, die unter dem Schutz eines benachbarten Stammes stand.[1] Eine solche Familie konnte zu Macht oder Einfluß gelangen, indem sie geschickt ihr religiöses Prestige, ihre Rolle als Schlichterin von Stammesstreitigkeiten und die Gelegenheiten zum Handel nutzte.
Diese Welt des Nahen Ostens sah im sechsten und zu Beginn des siebten Jahrhunderts viele Veränderungen. Byzanz und das Sasanidenreich führten lange Kriege gegeneinander, die mit Unterbrechungen von 540 bis 629 dauerten. Die hauptsächlichen Kampfgebiete lagen in Syrien und im Irak. Für kurze Zeit drangen die Sasanidenheere bis zum Mittelmeer vor und besetzten neben den großen Städten Antiochia und Alexandrien auch das heilige Jerusalem. Aber Kaiser Heraklios drängte sie nach 620 wieder zurück. Die Sasanidenherrschaft erstreckte sich vorübergehend auch bis in das südwestliche Arabien. Dort hatte das jemenitische Reich als Folge der äthiopischen Invasionen und des Niedergangs der Landwirtschaft einen großen Teil seiner früheren Macht eingebüßt.
Die Macht und der Einfluß der Großreiche reichten bis auf die Arabische Halbinsel, und seit Jahrhunderten waren Nomaden vom nördlichen und zentralen Arabien in die ländlichen Teile einer Region gezogen, die man heute oft als den »Fruchtbaren Halbmond« bezeichnet: Die Bevölkerung im Inneren von Syrien, im Gebiet westlich des Euphrat im unteren Irak und in der Gegend zwischen Euphrat und Tigris im oberen Irak (Dschezira) bestand weitgehend aus Arabern. Sie brachten ihr Ethos und ihre gesellschaftlichen Organisationsformen mit sich. Manche der Stammesführer übten ihre Macht von Oasenstädten aus; sie hielten im Auftrag der Reichsregierungen andere Nomaden von den besiedelten Gebieten fern und zogen Steuern ein. Deshalb konnten sie stabilere politische Gemeinschaften schaffen, etwa die der Lachmiden mit der Hauptstadt Hira in einer Region, die nicht unter direkter Kontrolle der Sasaniden stand, und die der Ghassaniden in einem vergleichbaren Gebiet von der Größe des byzantinischen Reiches. Die Bewohner dieser Staaten erwarben politische und militärische Kenntnisse und öffneten sich Ideen und Glaubensvorstellungen, die aus den imperialen Ländern kamen; Hira war ein Zentrum des Christentums. Aus diesen Staaten, aus dem Jemen und auch durch Kaufleute, die auf den Handelswegen durch die Länder zogen, drang Kunde von der Außenwelt und ihrer Kultur nach Arabien, und es kamen auch Siedler von dort. In den Oasen des Hedschaz in Westarabien lebten jüdische Handwerker, Händler und Bauern, und in Zentralarabien gab es christliche Mönche und Konvertiten.
Die Sprache der Dichtung
Unter den Hirtenstämmen verbreitete sich offenbar das Gefühl einer kulturellen Identität; erkennbar wird das am Entstehen einer gemeinsamen, aus den arabischen Dialekten entstandenen dichterischen Sprache. Es handelte sich um eine Hochsprache mit Verfeinerungen in Grammatik und Vokabular. Sie entwickelte sich allmählich, vielleicht durch Überarbeitung eines Dialekts oder durch das Verschmelzen mehrerer Dialekte. Benutzt wurde sie von Dichtern verschiedener Stammesgruppen und in den Oasenstädten. Ihre Dichtung hat sich vielleicht aus der rhythmischen, erhabenen und gereimten Hochsprache der Anrufungen oder Zaubersprüche entwickelt, aber was uns überliefert ist, läßt sich in keiner Hinsicht als primitiv bezeichnen. Es ist das Ergebnis einer langen Tradition, zu deren Entstehung und Bereicherung nicht nur Stammestreffen und das Leben in Marktflecken beigetragen haben, sondern auch die Höfe arabischer Dynastien an den Rändern der Großreiche – ganz besonders der Hof von Hira am Euphrat, der offen war für christliche und mazdaistische Einflüsse.
Die aus dieser Tradition hervorgegangenen Regeln der Dichtkunst sind kompliziert. Die am höchsten geschätzte dichterische Form war die Ode oder qasida, ein Gedicht mit bis zu hundert Zeilen in einem von mehreren gültigen Metren und einem einzigen durchgehaltenen Reim. Die einzelnen Verse sind stets in Halbverse geteilt. Im ersten Vers reimen sich beide Halbzeilen, in den übrigen Versen nur die jeweils zweiten. In der Regel war jeder Vers in seiner Bedeutung abgeschlossen, und Zeilensprünge waren selten, doch das verhinderte nicht die Weiterführung von Gedanken oder Gefühlen im nächsten Vers und durch das ganze Gedicht.
Gedichte wurden nicht niedergeschrieben, obwohl das möglich gewesen wäre, denn die Schrift war auf der Arabischen Halbinsel bekannt. Inschriften in den Sprachen Südarabiens reichen Jahrhunderte zurück. Die frühesten arabischen Inschriften in aramäischer Schrift hat man auf das vierte Jahrhundert datiert. Später entwickelte sich eine eigene arabische Schrift, die möglicherweise nicht nur für Inschriften, sondern auch im Fernhandel Verwendung fand. Doch Gedichte wurden verfaßt, um öffentlich vorgetragen zu werden, entweder vom Dichter oder von einem rawi, einem Rezitator. Das hatte gewisse Folgen. Der Sinn oder Inhalt mußte in einer Zeile vermittelt werden, einer Einheit aus Worten, deren Bedeutung die Zuhörer sofort erfassen konnten; jeder Vortrag war einzigartig und unterschied sich vom nächsten. Dem Dichter oder dem rawi





























