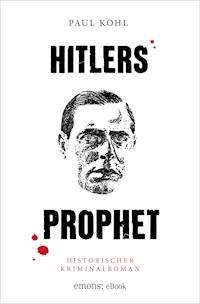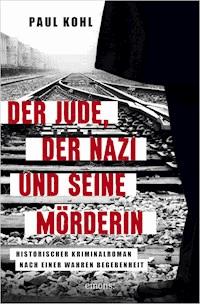
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein eindrucksvoller Roman über die NS-Ein eindrucksvoller Roman über die NS-Zeit. Vier Menschen, vier Lebensläufe, vier Schicksale: Der radikale Berliner Antisemit Wilhelm Kube wird als Generalkommissar in das okkupierte Minsk abgeschoben. Die weißrussische Partisanin Jelena soll dort seine Geliebte werden, ihn ausspionieren und töten. Kubes Frau Anita, blind für die Taten ihres Mannes, schließt Freundschaft mit dem Feind. Der Berliner Jude Gustav wird in das Minsker Ghetto deportiert, wo ihn der Tod erwartet. Die Leben der vier kreuzen sich verhängnisvoll und enden 1943 in einer Katastrophe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Kohl, geboren 1937 in Köln, studierte Germanistik und Theaterwissenschaft, war Buchhändler und Mitarbeiter bei Fernsehproduktionen. Heute ist er Hörfunk- und Buchautor und schreibt über geschichtliche und sozialkritische Themen, insbesondere über die NS-Zeit. 2014 erhielt er den Axel-Eggebrecht-Preis.
Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch sind die meisten Personen (mit Ausnahme von Gustav Heimann und seiner Familie) nicht frei erfunden, sondern existierten wirklich. Ihre Handlungen beruhen auf einem historischen Hintergrund.
©2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/Trigger Image/Sharon Wish Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-352-3 Historischer Roman Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Dieses Buch widme ich Hejo Emons, dem ich viel verdanke.
1
1897: Berlin, nördliche Vorstadt, Prenzlauer Berg, Eberswalder Straße. Hier wohnt der zehnjährige Willi im Vorderhaus. Sein Vater hat als städtischer Steuereinnehmer beim Magistrat und als preußischer Beamter das Privileg, mit seiner Familie eine große, sonnige Wohnung im Vorderhaus mit Balkon zur Straßenseite zu bewohnen. Im Hinterhaus sind vom Dachgeschoss bis in das Souterrain die Armen einquartiert. Willis Mutter ist eine sorgfältige und sparsame Hausfrau, die viel Zeit darauf verwendet, die Hemden und Hosen ihres Mannes und des kleinen Willi zu waschen und zu bügeln und ihre Schuhe zu putzen.
Berlin wächst und wächst und dehnt sich aus, in die Breite und in die Höhe. Neue Chausseen werden strahlenförmig vom Zentrum aus durch die Dörfer im Umland geschlagen, neue Strecken für Untergrundbahnen durch das Erdreich gebuddelt, gigantische Hallen aus Stahl und Glas für neue Bahnhöfe in der Stadt und im Umkreis errichtet. Häuserblocks werden abgerissen, monströse Mietskasernen hochgezogen, die ersten Hochhäuser stehen bereits. Die Stadt ist erfüllt von Lärm und verdreckter Luft.
In dieser Zeit besucht Willi, ein fröhliches Kerlchen, die Gemeindeschule gleich um die Ecke seiner Wohnung, lernt fleißig, bringt stets beste Noten nach Hause und legt sie stolz seinen Eltern auf den Tisch.
Die Eltern erziehen Willi streng im Sinn des evangelischen Christentums. So beschäftigt sich der Zehnjährige mit den biblischen Gestalten des Neuen Testaments, besonders mit Jesus. Eifrig besucht er den Religionsunterricht und in der nahe gelegenen Gethsemane-Kirche den Kindergottesdienst. Der Pastor lobt den kleinen Willi: »Aus dir wird noch ein tapferer Kämpfer für unseren Herrn. Das sehe ich ganz deutlich.« Dem Knaben hüpft das Herz im Leib.
Willi ist auch ein sangesfreudiges Kerlchen. Singen macht ihm großes Vergnügen, gern hört er seine schöne Stimme. Bei einem Gesangswettbewerb erkennt der Direktor des Königlichen Domchors sein Talent, erteilt ihm Gesangsunterricht, nimmt ihn als Chorknaben auf, und schon bald jubelt Willi mit seiner hellen Glockenstimme im Berliner Dom bei Hochämtern sein »Halleluja«.
Er kann nicht ahnen, dass in diesem Dom Jahrzehnte später die Reste seines von Minen zerfetzten Körpers in einem prunkvollen Sarg vor dem Altar liegen werden, bedeckt mit einer Hakenkreuzfahne und überhäuft von prachtvollen Kränzen.
1918: Im Berliner Westend beendet Gustav Heimann erfolgreich seine Realschule. Er ist achtzehn. Was nun? Klar, eine Lehre. Aber was für eine? Fast alle seine Schulkameraden wissen, was sie machen werden. Die meisten wollen eine Banklehre beginnen, um viel Geld zu verdienen und Bankdirektor zu werden. Einige wollen Kraftfahrzeugmechaniker werden, weil sie von Automobilen besessen sind und weil Automechaniker jetzt im Krieg dringend gesucht werden und erst recht nach dem Sieg. Gustav weiß gar nicht, was er werden will. Gern würde er an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität studieren. Aber dafür müsste er erst sein Abitur machen. Und dann? Was sollte er studieren? Keine Ahnung. Vielleicht etwas mit Kunst. Da sagt bei der Abschlussfeier sein Klassenlehrer zu ihm: »Für dich kommt nur eine Buchhändlerlehre in Frage. Für dich Bücher und sonst gar nichts.«
Nun gut, das wär doch was. Warum nicht?
Gustavs Vater ist Verkäufer im Schuhgeschäft Leiser in Charlottenburg. Er ist entsetzt, als ihm der Sohn seinen Berufswunsch mitteilt. »Buchhändler willst du werden? Einer, der Bücher verkauft? Wie kommst du denn darauf? Den ganzen Tag nur Bücher!«
»Und du?«, hält Gustav dagegen. »Den ganzen Tag nur Schuhe!«
Der Vater will ihn für diesen Vorwurf zurechtweisen, beißt sich aber auf die Lippen und sagt: »Ich hab dich schon bei Leiser als Lehrling angemeldet. Für dich Schuhe und sonst gar nichts.«
Das gefällt Gustav gar nicht. Doch der Vater besteht darauf. »Schuhe brauchen die Menschen immer. Auch im Krieg. Aber Bücher braucht keiner.«
Seine Mutter wendet ein: »Lass doch den Jung selbst entscheiden. Er ist volljährig und kann machen, was er machen will.«
Zerknirscht zieht sich der Vater zurück. Gustavs Mutter ist stolz auf ihren selbstbewussten Sohn und freut sich über seine Entscheidung. Doch wie soll er in einer Buchhandlung eine Lehrstelle finden in diesem katastrophalen Krieg, in dem alle Brot, Kartoffeln und Schuhe brauchen, aber keine Bücher?
Gustav will es trotzdem versuchen. Er kann nicht wissen, dass er über zwei Jahrzehnte später in einem Massengrab bei Minsk verscharrt werden wird.
1921: Jelena wächst in dem kleinen, verkommenen Bauerndorf Masjukowtschina bei Minsk auf. In einer schiefen Hütte am Waldrand. Aus den Wandbalken quillt Harz hervor, an dem die Kleider kleben bleiben, wenn man sich daranlehnt. Und zwischen den Balken klaffen fingerdicke Spalten, die mit Lumpen zugestopft sind. Dazwischen hausen Grillen, sie zirpen die ganze Nacht hindurch und zerren an den Nerven der Familie. Auf den Bodenbrettern liegen die Strohsäcke, auf denen die Sechsjährige mit ihren Eltern schläft. In einer Ecke der Hütte befindet sich ein großer gemauerter Lehmofen, davor wackelt eine Holzbank. Im Stall haben sie drei Kühe, zwei Schweine, einige Hühner und ein Pferd, das den Panjewagen zieht. Im Frühjahr versinken die Felder und Wege im Schlamm, im Sommer verdorren die Weiden in der glühenden Hitze zu staubigen Wüsten, und im Winter liegt dicker Schnee über allem und knackt das Eis. Da hockt die Familie auf der Bank am Ofen, wärmt ihre Rücken und weiß oft nicht, wie sie sich ernähren und mit was sie ihr Vieh füttern soll.
Jelena weiß nicht, dass man sie über zwanzig Jahre später in Minsk zwingen wird, am Tod Tausender Menschen schuldig zu werden.
1918: Hamburg, Stadtteil Eppendorf, Nissenstraße nahe der Alster. In diesem vornehmen Viertel wurde Anita Katharina Dorothea Lindenkohl geboren, die ihre Eltern zärtlich Nitalein nennen. Anitas Vater Heinrich ist ein ehrlicher, aufrichtiger Mensch und als gewissenhafter Amtmann Leiter des Hamburger Stadtarchivs. Auch zu den Wochenenden bringt er in seiner schwarzen Aktentasche Dokumente mit nach Hause, um sie in seinem Herren- und Raucherzimmer zu bearbeiten. Er ist Sozialdemokrat durch und durch, sogar SPD-Mitglied und gehört der Gewerkschaft an. Ein echter roter Sozi, wie er sich selbst gern nennt. Ihre Mutter Elisabeth hört gern Musik und liest vor allem Gedichte. Lenau und Löns. Liebevoll umhegen und umsorgen sie ihr Nitalein, das zu einem hübschen blonden Mädchen herangewachsen ist.
Anita hat eine Menge Flausen im Kopf. Sie will Pianistin werden. Immer und immer wieder übt die Neunjährige vor und nach ihren privaten Klavierstunden im Wohnzimmer auf den weißen und schwarzen Tasten. Vor sich die Czerny-Etüden »Die Kunst der Fingerfertigkeit« und rechts und links am Klavier die beiden Ständer mit den gelben Kerzen. Doch sosehr sie sich abmüht und wiederholt und repetiert, immer drückt sie die falschen Tasten. Sie ist deprimiert und schmeißt oft mit lautem Knall den Klavierdeckel zu, dass ihre Mutter in ihrem Stuhl hochschreckt.
Jahrzehnte später wird sie, um ihr Leben zu retten, aus der Ruinenstadt Minsk zu ihren Eltern nach Bayern fliehen müssen.
Die Gemeindeschule schließt Willi als besonders guter Schüler mit einem glänzenden Zeugnis ab. Was nun?
»Du wirst Steuereinnehmer und Beamter«, bestimmt sein Vater. »Wie ich.«
Willi ist da anderer Meinung. Er will etwas Besseres, etwas Höheres werden als sein Vater. Aber was?
»Ich will zur Universität, studieren, Akademiker werden«, begehrt das Söhnchen auf.
»Dazu brauchst du Abitur«, wendet sein Vater ein. »Das hast du nicht.«
»Dann hole ich es nach.«
»Also in ein Gymnasium«, lenkt der Vater zögernd ein und seufzt. Die Mutter sagt nichts und lächelt in sich hinein.
»Nicht in irgendein Gymnasium. Ich will ins ›Graue Kloster‹.« Darauf besteht Willi.
Das humanistische Gymnasium »Zum Grauen Kloster« in der Klosterstraße ist das beste in der Stadt. Hier hatten schon Bismarck und andere große Geister ihr Abitur abgelegt und später ihre große Karriere begonnen.
»Das geht nicht«, wehrt Willis Vater ab. »Dafür haben wir nicht das Schulgeld.«
Seine Mutter schlägt vor: »Als Mitglied des Magistrats könntest du für Willi eine finanzielle Unterstützung beantragen.«
Der Vater windet sich, reicht schließlich widerwillig beim Magistrat den Antrag ein, und prompt wird für den zukunftsvollen Sohn eine Zuwendung zum Besuch des »Grauen Klosters« bewilligt. Nun fährt er täglich mit der neuen Elektrischen in die Klosterstraße und erhält eine breit gefächerte humanistische Ausbildung mit Latein, Altgriechisch und musischer Erziehung. Er liest und liest und liest. Mit Vorliebe die deutschen Klassiker, auch die antiken römischen und griechischen Klassiker. Leidenschaftlich verschlingt er Dahns »Kampf um Rom« und ist ganz benommen davon. Auch sein Vater steigt eine Stufe höher. Er wird Kirchenvorsteher und Synodaler der Gethsemane-Gemeinde. Die Familie wohnt nun im Gemeindehaus, direkt neben der evangelischen Kirche.
Um Geld zu verdienen, gibt Willi Nachhilfeunterricht für zurückgebliebene Schüler und bezahlt damit sein Abonnement der deutschnationalen und antisemitischen »Staatsbürgerzeitung«. Darin liest er: »Es gibt keine Ruhe für die Völker der Erde, wenn nicht das Judentum ausgeschieden wird«, und: »Die Juden sind unser Unglück.« Obwohl er nie einen Juden persönlich kennengelernt hat, setzt er sich als engagierter Klassensprecher dafür ein, dass Juden nicht mehr am Turnunterricht teilnehmen dürfen, und beschließt, nie einen jüdischen Laden zu betreten. Zugleich dichtet er ein Jahr vor seinem Abitur als guter Christ das fromme Weihnachtsspiel »Dr.Martin Luthers Weihnachtsabend«. Ein Stück, in dem der Reformator von einem Bösewicht ermordet werden soll, von einem ergebenen Bibelschüler jedoch gewarnt und damit das schlimme Attentat verhindert wird.
Im »Grauen Kloster« wird Willis Erguss mit großem Erfolg aufgeführt. Alle applaudieren. Willi sonnt sich in seiner Anerkennung. Für seinen Abituraufsatz wählt er das Thema »Kann Fremden unser Deutschland zum Vaterland werden?« und schreibt: »Den Juden kann unser Deutschland nie zum Vaterland werden. Sie werden immer Fremde bleiben. Ihnen ist zu raten, dorthin zurückzukehren, woher sie kamen.«
Die Eltern sind über seinen Antisemitismus entsetzt und ratlos. Sie fragen sich: »Wie kommt er darauf? Woher hat er das? Von uns nicht. Was soll aus ihm nur werden?«
Sein Deutschlehrer dagegen lobt seine Einstellung und gibt ihm dafür dick unterstrichen die Note »sehr gut«. Das bestätigt ihm die Richtigkeit seiner Aussage. Die Königliche Prüfungskommission urteilt in Willis Abschlusszeugnis: »Seine Reife ist unzweifelhaft.« Mit diesem Papier in der Hand besteht er darauf, nicht mehr Willi genannt zu werden, sondern Wilhelm.
Seine Lehrstelle in einer Buchhandlung will Gustav allein finden. Doch seine Mutter besteht darauf, sie mit ihm zusammen zu suchen. Das passt ihm gar nicht. Dazu kauft sie ihm bei Brenninkmeyer einen steifen Anzug mit dem üblichen Pfeffer-und-Salz-Muster, in dem er sich sehr unwohl fühlt, dazu eine graue Krawatte. Bisher hat der Achtzehnjährige noch nie eine Krawatte getragen. Jetzt muss er. Sie findet, dass er für die Vorstellungsgespräche sehr ordentlich aussehen muss; er kommt sich vor wie ein dressiertes Äffchen. Dann zieht sie mit ihm los, von Buchhandlung zu Buchhandlung. In diesem Frühjahr, es ist 1918, begegnen ihnen immer wieder Männer in abgerissenen Reichswehrmänteln, die auf einem Bein auf Krücken dahinhumpeln, sich auf Holzwägelchen mit Stumpen bis zu den Knien vorwärtsschubsen oder in einer Ecke hocken und betteln.
Seine Mutter führt ihn zu Kiepert und Hugendubel, zu Droemer, zu Schoeller und Schropp. Ihm ist es sehr peinlich, dass sie bei allen Vorstellungsgesprächen das Wort führt. Sie lobt seinen Anstand, dass er sehr sauber hält, kein Kommunist ist und sehr tüchtig arbeiten kann. Bald ist er es leid, überall vorgeführt zu werden, und geht allein auf Stellensuche. In der großen Buchhandlung Amelang in der Kantstraße hätte man ihn beinahe genommen, doch da wurden kurz vor ihm drei Lehrlinge eingestellt. Pech. Als er die Heine-Buchhandlung in der Reichsstraße betritt, kommt ihm ein blondes Mädchen entgegen, er schätzt sie auf sechzehn. Vielleicht ein Lehrmädchen, denkt er. Dann wäre es wieder nichts.
»Bitte schön, Sie wünschen?«, fragt sie. Ihre weiche Stimme klingt sympathisch.
Um ihn herum Regale mit dicht vollgestellten Büchern, auch überall auf den Tischen Stapel von Büchern. Und an einer Wand hängt ein großes eingerahmtes Porträt eines jungen Mannes mit einem schmalen Gesicht. Seine langen Haare hängen ihm bis auf die Schultern. Er weiß nicht, wer dieser Jüngling im offenen Hemd ist.
»Was kann ich für Sie tun?«, ermuntert sie ihn und lächelt dabei.
Verlegen druckst er herum. Nur zögernd bringt er hervor: »Kann ich Ihren Chef sprechen?«
»Na klar«, sagt sie und ruft in einen hinteren Raum, dessen Tür offen steht: »Papa, da ist jemand für dich!«
Ein älterer Herr kommt heran, am Kragenknopf seines weißen Hemdes trägt er eine schwarze Fliege. Der Herr begrüßt ihn freundlich, stellt sich mit »Demski« vor und fragt: »Worum geht’s?«
Er führt ihn nach hinten in sein kleines Büro.
»Haben Sie Abitur?«
Gustav bedauert. »Nur Realschule.«
»Na ja, das ist ja auch was wert. Haben Sie schon mal was mit Büchern zu tun gehabt?«
Wieder muss Gustav bedauern.
»Was lesen Sie denn gern?«, will Demski wissen. »Was lesen Sie gerade?«
Gustav wird knallrot im Gesicht. Wie ein Blödian kommt er sich vor. Schnell nennt er Bücher, von denen sein Vater schwärmte, die Gustav aber nie gelesen hat.
»Das Leben von Richard Wagner und von Napoleon. Weiß nicht mehr, von wem.«
Demski lächelt. »Na ja, für den Anfang. Und was haben Sie sonst noch gelesen?«
Er will seinen Karl May nicht nennen. Das scheint ihm zu blamabel.
»Sicher haben Sie von Karl May ›Winnetou‹ gelesen.«
Gustav fühlt sich ertappt und nickt.
»Na also. Das andere werden Sie noch kennenlernen.« Dann will er wissen: »Was ist denn Ihr Herr Vater von Beruf?«
Oh Gott, das auch noch. Er geniert sich zu sagen, dass sein Vater einfacher Schuhverkäufer bei Leiser ist, und befördert ihn schnell zum Filialleiter.
»Schön, schön«, sagt Demski. »Leiser. Das ist doch was.«
Fünf Minuten darauf unterschreibt Gustav seinen Lehrvertrag für drei Jahre und kann sofort anfangen. Jubel steigt in ihm hoch. Viel verdient er nicht, aber es reicht zum Leben. Dazu kann er in eine Dachkammer des Hauses ziehen.
»Dann haben Sie keine lange Anfahrt. Ich mag es nämlich nicht, wenn mein Lehrling zu spät kommt.«
Als Demski Gustav aus dem Laden begleitet und die Tochter des Buchhändlers ihn anlächelt, muss er immer auf das Porträtfoto zwischen den Bücherregalen schauen. Unüberlegt fragt er, wer das auf dem Foto ist.
»Das wissen Sie nicht? Und dann wollen Sie bei mir Buchhändler werden?«
Gustav stottert etwas herum.
»Das ist der Heinrich Heine.«
Wieder wird Gustav purpurrot im Gesicht. Er hätte sich denken können, wer das ist, wenn er in der Heine-Buchhandlung steht. Er ärgert sich über seine Dummheit und hätte sich in den Hintern beißen können.
»Na ja«, sagt Demski väterlich, »den werden Sie bei mir auch noch kennenlernen.«
Zu Pfingsten besucht die kleine Jelena ihre Tante im Nachbardorf. Sie schenkt ihr einen Hefekuchen. Ihre Mutter hat ihr verboten, bei der Tante etwas zu essen. Es sei eine Schande, bei anderen Menschen etwas zu essen. Aber bei ihr zu Hause gibt es nie Hefekuchen. Mit schlechtem Gewissen stopft sie ihn in den Mund, da kommt ein Bauer herein und sagt: »Kind, dein Vater ist gestorben. Gott segne ihn im Himmel.«
Schnell wickelt die Tante den restlichen Kuchen für den Heimweg ein und eilt mit der Sechsjährigen über die Felder zur Hütte des Verstorbenen. Immer wieder stolpert Jelena beim Laufen, fällt hin. Als sie ankommen, sind schon alle Nachbarn versammelt und klagen. Auf der Holzbank am Ofen liegt ihr toter Vater. Die Mutter kauert zusammengesunken und wie versteinert neben ihm.
Mit ihren großen dunklen Augen, die schwarzen Haare verdecken halb das Gesicht, starrt Jelena auf ihren leblosen Vater. Sie kann nicht begreifen, was geschehen ist, und hält den eingewickelten Hefekuchen fest in der Hand. Eine alte Nachbarin steckt ihrem Vater eine brennende Kerze zwischen seine auf der Brust gefalteten Hände. Dabei tropft heißes Wachs auf seine Haut. Auf einmal zucken seine gelben Finger. Alle erschrecken. Besonders die kleine Jelena. Ist ihr Vater doch nicht tot? Die Nachbarn betasten seine Hände. Sie sind eiskalt. Hat er noch im Tod das heiße Wachs gespürt?
Ein Jahr nach dem Tod von Jelenas Vaters legt sich ihr einziges Pferd in einer der kältesten Winternächte im Stall nieder und steht am Morgen nicht mehr auf. Die Tschornaja, die Schwarze, ist steif gefroren. Nun muss die Mutter die Lederriemen über ihre Brust und ihre Schultern spannen und selbst den Wagen ziehen. Die Mutter kränkelt immer mehr. Sie kann den Hof nicht allein führen. Das geht über ihre Kräfte. Sie magert ab und hustet schrecklich. Oft kann sie am Morgen nicht aufstehen und muss tagelang im Bett liegen bleiben. Die kleine Jelena steht hilflos daneben und weint.
Nachbarn versorgen die drei Kühe und zwei Schweine im Stall und machen Jelena etwas zu essen. Ein Arzt stellt fest: Die Mutter hat eine schwere Lungenentzündung. Eine Woche später stirbt sie dahin. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Vaters. Nun ist die achtjährige Jelena eine Waise.
Anita muss ihren Traum als Pianistin aufgeben. Ihre Finger sind zu kurz. Jetzt will sie Balletttänzerin werden, im Scheinwerferlicht vom Publikum bejubelt werden. Immer wieder legt sie im Wohnzimmer die Schellackplatte mit Tschaikowskys »Schwanensee« auf ihr Grammophon und tanzt mit schwingenden Gebärden vor dem großen Spiegel. Ihre Eltern sehen ihr vergnügt zu und freuen sich über ihre Tänze. Sie erlauben ihr, Ballettunterricht zu nehmen, und schon während ihrer Ausbildung schafft sie es, in einer Tanzgruppe in Operettenaufführungen mitzutanzen. Doch bald stellt sich heraus, dass sie mit ihren fünfzehn Jahren zu alt für eine Ballettschülerin ist. Damit hätte sie als Fünfjährige anfangen müssen.
Ihr acht Jahre älterer Bruder Friedrich, der Friedel, hat es schon weit gebracht. Nach seiner hervorragend bestandenen Schauspielprüfung ist er jugendlicher Darsteller im Thalia-Theater. Anita bewundert und liebt ihren großen Bruder Friedel. Oft darf sie zu den Proben für seine neuen Aufführungen und sitzt bei den Premieren staunend und mit heißen Wangen in der ersten Reihe im Parkett. Nachdem auch ihr Traum von einer Karriere als Balletttänzerin geplatzt ist, will sie nun Schauspielerin werden. Eine berühmte Schauspielerin. Voll Zuversicht gewähren die Eltern ihr Schauspielunterricht am Thalia-Theater. Begeistert absolviert sie die ersten Stunden, Wochen und Monate. Ihre Lehrerin ist Mirjam Horwitz, die Ehefrau des Intendanten. Da ist sie in guten Händen.
In ihrem Schauspielunterricht übt Anita mit ihrer Lehrerin das Gretchen aus Goethes »Faust«: »Ich gäb was drum, wenn ich nur wüsst, wer heut der Herr gewesen ist! Er sah gewiss recht wacker aus und ist aus einem edlen Haus. Das konnte ich ihm an der Stirne lesen– er wär auch sonst nicht so keck gewesen.« Und: »Du lieber Gott! Was so ein Mann nicht alles, alles denken kann! Beschämt nur steh ich vor ihm da und sag zu allen Sachen ja. Bin doch ein arm unwissend Kind, begreife nicht, was er an mir find’t.«
Sie übt die Ophelia aus »Hamlet«: »Oh welch edler Geist ist hier zerstört. Das Auge des Klugen, die Zunge des Gelehrten, der Arm des Kriegers, die Blüte und Hoffnung des Staates, der Spiegel der Sitte, das Muster der Bildung– alles hin, alles hin! Und ich, der Frau’n elendeste und ärmste, die Honig sog von seinen Worten, wollte vormals nichts wissen von den Mahnungen der anderen und hörte sie in meiner Schwärmerei nur wie verstimmte Glocken. Wehe mir, wehe! Dass ich nicht voraussah, wie es kommen musste!«
Immer wieder muss sie diese und andere Rollen vortragen, und immer wieder korrigiert ihre Lehrerin: »Du betonst falsch. Du musst Pausen machen zwischen den Sätzen. Du musst so sprechen, als würdest du noch danach suchen müssen, was du sagen willst. Als würdest du erst während des Sprechens die richtigen Worte finden. Bedenke bei jedem Satz, was du sagst. Bedenke den Sinn deiner Worte.«
An der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität belegt Wilhelm die Fächer Philosophie, Alte und Neue Geschichte, Altphilologie, Kirchengeschichte und Theologie. Er ist nun einundzwanzig Jahre alt und plant seine berufliche Karriere. »Aufstieg« heißt seine Parole. Er will raus aus dem Kleinbürgertum seines Elternhauses, nicht mehr der Sohn eines einfachen Steuereinnehmers sein. Wilhelm Kube will zu den akademischen Kreisen aufsteigen, zur Oberschicht gehören, in den obersten Spitzen der Gesellschaft seinen Platz einnehmen.
Er gründet den »Deutschvölkischen Studentenverband«, den ersten antisemitischen Korporationsverband in Deutschland, der das Nationalbewusstsein der Studenten fördern soll. Mitglieder werden nur aufgenommen, wenn sie nachweisen können, dass kein jüdisches Blut in ihren Adern fließt. Bald ist Kube Vorsitzender dieses Studentenverbandes, veranstaltet mit Propagandisten der deutschvölkischen Ideologie und des Antisemitismus Versammlungen und Vorträge, stürmt mit seinen Studenten gegnerische Veranstaltungen und sprengt sie.
An der Universität unterstützt die jüdische Moses-Mendelssohn-Stiftung bedürftige, würdige und tüchtige Studenten, ohne Unterschied ihres religiösen Bekenntnisses. Der antisemitische Kube beantragt bei der Stiftung ein Jahres-Stipendium und erhält tatsächlich eine Unterstützung von sechshundertfünfzig Mark. Auch für das folgende Jahr wird ihm eine zweite Förderung mit der gleichen Summe gewährt. Mit diesen Geldern finanziert er seine antisemitische Verbandszeitschrift. Seine »Hochschulblätter« machen Front gegen Polen, gegen Sozialdemokraten, wenden sich gegen Ausländer an deutschen Hochschulen, hetzen gegen die angeblich zu große und zersetzende Rolle der Juden im öffentlichen und politischen Leben Deutschlands und fordern die Zurückdrängung der schädlichen Wirkung der Juden.
Schon bald erkennt Kube, dass er im akademischen Bereich keine Karriere machen kann, nicht nach seinen Vorstellungen. Sein Ziel ist ein Beruf, der ihn aus der Masse heraushebt. Er beschließt, politischer Journalist zu werden, und bricht sein Studium ab. Die Moses-Mendelssohn-Stiftung fordert ihn auf, das gewährte Stipendium für das folgende Jahr zurückzuzahlen. Kube denkt nicht daran und verlässt Berlin mit dem jüdischen Stipendium in der Tasche.
Im ersten Lehrjahr muss Gustav einmal pro Monat im Hof hinter dem Laden alle Bücher ausklopfen, die Fächer auswischen und in den Regalen das Autorenalphabet überprüfen. Er liest die Namen Goethe und Schiller. Gut, die kennt er, hat aber von ihnen nie etwas gelesen. Er sieht auch Namen, von denen er noch nie etwas gehört hat. Dostojewski, Feuchtwanger, Fontane, Jean Paul, Kleist, Ringelnatz, Stifter, Storm, Tolstoi. Er ist beschämt, so unwissend zu sein.
Im Keller muss er die Pakete für die Kundenbestellungen packen und sie zur Post bringen. Dabei verwaltet er schon die Portokasse. Immer öfter kommt die Tochter seines Chefs zu ihm herunter und plaudert mit ihm. Er unterhält sich gern mit ihr, obwohl er darauf achten muss, mit seiner Arbeit nicht zu sehr zu trödeln. Demski kommt es verdächtig vor, dass seine Gertrud so oft zu seinem Lehrling in den Keller verschwindet. Manchmal, wenn zu viele Kunden im Laden sind, muss er sie nach oben rufen. Einmal erzählt Gertrud Gustav, dass ihre Mutter vor vier Jahren gestorben ist. Sie war Krankenschwester und meldete sich 1914 freiwillig an die Front. Dabei wurde sie in Frankreich von einer Granate tödlich getroffen. Gertrud war damals zwölf. Die Mutter fehlt ihr sehr. Ihr Vater, zehn Jahre älter als ihre Mutter, war zu alt, um eingezogen zu werden. So hat er den Krieg überlebt.
Demski beobachtet genau, wie sich seine Tochter und Gustav verlieben. Sollen sie nur, denkt er. Gertrud ist sechzehn und ein freier Mensch. Wenn sie schon keine Mutter hat, soll sie wenigstens einen Freund haben.
Im zweiten Lehrjahr darf Gustav schon bei Treffen mit Verlagsvertretern dabei sein, wenn Demski Neuerscheinungen bestellt, und er darf Kunden bedienen; und im dritten Jahr darf er an die Kasse.
Einmal, als Demski einen Jugendlichen verdächtigt, ein Buch eingesteckt zu haben, muss Gustav ihm auf der Straße nachrennen und ihn auffordern, die Tasche zu öffnen. Dabei sieht ihm sein Chef von der Ladentür aus zu. Der Junge hat tatsächlich Rilkes »Cornet« in der Tasche und zittert am ganzen Leib. Gustav bringt es nicht fertig, ihn Demski vorzuführen.
»Schon gut«, sagt er. »Klau das nächste Mal woanders.«
Der Ladendieb sieht ihn völlig verwundert an und verschwindet schnell.
»Und?«, fragt Demski. »Was ist?«
»Er hat nichts mitgehen lassen.«
»Versteh ich nicht. Dabei hätte ich schwören können, dass er was eingesteckt hat.«
»Er hatte wirklich nichts.«
»Passen Sie nächstes Mal besser auf, wenn sich wieder jemand verdächtig verhält.«
Nach dem verlorenen Krieg läuft in der Buchhandlung ein besonderes Geschäft. Die Generäle und Feldmarschälle Hindenburg, Ludendorff, Seeckt, Blomberg, Mackensen, alle mit dem Adelstitel »von«, bieten ihre heldenhaften Kriegserinnerungen zum Verkauf an. Und sie werden wie verrückt gekauft.
»Passt mir zwar nicht«, sagt Demski, »brauche aber den Umsatz. Sonst kann ich meinen Laden nicht halten.«
Im Hinterhaus wohnt der Taxifahrer Bluhmke, von allen Blümchen genannt, trotz seiner wuchtigen Erscheinung mit seinem mächtigen rostroten Schnäuzer, seiner Lederjacke und ledernen Schirmmütze. Gustav begegnet ihm oft im Hof, wenn er altes Packpapier zu den Abfalltonnen bringt und Blümchen seinen Wagen aus der Garage holt. Seinen Taxistand hat er ganz in der Nähe. Am Reichskanzlerplatz, Ecke Ahornstraße. Bücher hat er im Laden noch nie gekauft. Sie sind nicht sein Ding. Wenn er an seinem Stand auf Kunden wartet, liest er die Zeitungen, die Fahrgäste in seinem Wagen liegen ließen. Die »Morgenpost«, die »BZ« und manchmal auch die »Vossische«.
Dass sich Gustav und Gertrud gut verstehen, hat er schon längst mitbekommen.
»Hübschet Mädchen, die Jetrud«, brummelt er anerkennend und rückt dabei seine Schirmmütze zurecht. »Die möcht ick ooch mal jern in meener Kraftdroschke kutschiern.«
Nach dem Tod von Jelenas Eltern nimmt ein benachbarter Bauer die Achtjährige bei sich auf. Sie bekommt ein Strohbett und zu Weihnachten abgetragene Kleider und ausgetretene Schuhe geschenkt. Im Sommer geht sie ohnehin barfuß. Auch den weiten Weg ins Nachbardorf, um die Volksschule zu besuchen. Von der Bäuerin bekommt sie dafür ein Schreibheft und einen Bleistift. Sie läuft bei jedem Wetter. Ab und zu nimmt sie ein Bauer auf seinem Panjewagen mit. Die Volksschule im Dorfrat besteht aus einem einzigen Raum, in dem ein Lehrer mehrere Klassen zugleich unterrichtet. So versteht sie nichts, wenn der Lehrer den älteren Schülern Dinge erklärt, von denen sie noch nie etwas gehört hat, und langweilt sich, wenn sie mit ansehen muss, wie sich die neu eingeschulten Kinder mühsam mit dem Alphabet abquälen.
Eine warme Jacke für den Winter besitzt sie nicht. Damit sie nicht friert, wickelt die Bäuerin sie für den Schulweg in eine Decke und knotet die Ecken auf dem Rücken zusammen. Vor dem Unterricht löst ihr Lehrer die Knoten, damit sie sich bewegen kann, und nach dem Unterricht bindet er ihre Decke wieder auf dem Rücken zusammen. Einmal passiert es, dass während ihres Heimwegs ältere Jungen sie in einen Schneehaufen stoßen und weitergehen. In der zusammengeknoteten Decke kann sie ihre Arme nicht bewegen. Wie ein Klotz muss sie in dem Schneehaufen liegen bleiben. Sie ruft um Hilfe, aber die verschneite Landschaft ist menschenleer, keiner hört sie. Ihr Körper wird kälter und erstarrt. Dann spürt sie ihn nicht mehr. Nach langer Zeit kommt zufällig ihr Lehrer vorbei. Er befreit sie aus dem Schnee und hebt sie wie ein Stück gefrorenes Holz hoch. Er nimmt sie mit zu sich nach Hause, gibt ihr heißen Tee zu trinken und schenkt ihr eine seiner beiden Jacken, die ihr viel zu groß ist. Nun hat sie etwas Warmes anzuziehen.
»Die kannst du behalten«, sagt er. »Da wächst du noch rein.«
Anita erlebt eine fröhliche Hochzeit. Ihr großer Bruder Friedel heiratet die schöne Lore, eine bejubelte Tänzerin. Lore ist Jüdin, eine geborene Loewenstein. Dass die Familie nun eine jüdische Schwiegertochter hat, ist für sie ohne Bedeutung. Alle lieben die frohe und erfolgreiche Lore. Na wennschon, eine Jüdin im Haus, was soll’s? Für die Mutter ist das kein Problem, obwohl die Nationalsozialisten immer mehr gegen die Juden hetzen. Sie nimmt das nicht ernst. »Das geht vorüber«, sagt sie.
Anitas Vater, Friedel und Lore sind anderer Meinung. Sie hassen die Nazis. Wenn die mal an die Macht kommen, wird es schlimm, warnen sie. Dann stehen entsetzliche Zeiten bevor.
Lore hat Angst. Was wird dann aus ihr? Alle nehmen sie in den Arm. Als Sozi fürchtet der Vater nun auch um seine Stellung. Wenn die Nazis Ernst machen mit ihrer Drohung, die Sozialdemokraten zu beseitigen, was wird dann aus ihm? Trotzdem will er seiner SPD treu bleiben. Unbeirrt. Komme da, was da wolle.
Wenn Anita Lore mit ihrem modernen, ungewöhnlichen Ausdruckstanz auf der Bühne sieht, bedauert sie im Stillen immer noch, dass sie damals schon zu alt war für eine Ballettausbildung. Doch jetzt hat sie mit ihrer Schauspielausbildung einen befriedigenden Ersatz gefunden.
2
Wilhelm Kube lässt sich in Wismar, später in Breslau nieder, wo er in verschiedenen antisemitischen, deutsch-nationalistischen und rechtsradikalen Zeitungen als politischer Redakteur und Publizist arbeitet. In seinen Artikeln agitiert er für einen Krieg gegen die Nachbarländer, fordert, das Reich durch Okkupationen zu vergrößern und die Bodenschätze der besetzten Länder auszubeuten. Zugleich gibt er weiter seine »Hochschulblätter« heraus, in denen er schreibt: »Die Erhaltung der arischen Rasse, ihre Werte und die Reinhaltung des germanischen Blutes sind unsere höchste Pflicht. Jede Vermischung mit niedriger stehenden, nichtarischen Rassen bedeutet Rassenverschlechterung. Gegen die Gefahr der Rassenmischung mit Slawen und Juden sind besondere Maßnahmen zu ergreifen. Die Ausmerzung von Minderwertigen ist anzustreben.«
Feuer fängt Kube, als Kaiser Wilhelm Ende Juli 1914 zum Krieg aufruft. Da darf er nicht fehlen. Um mit seinem persönlichen Einsatz für seine proklamierten Kriegsziele zu kämpfen, meldet er sich freiwillig an die Front. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Walter, der bald darauf als zweiundzwanzigjähriger Fliegerleutnant an der Westfront abgeschossen wird. Auch Kubes Schwager fällt in Frankreich im Kugelhagel. Zwei Kriegstote im engsten Familienkreis, da gefällt Kube der Kampf im Schützengraben gar nicht mehr. Er will zurück in seine Breslauer Zeitung und wird prompt von der Redaktion als politischer Redakteur für »unabkömmlich« reklamiert. Da kann er nun in der warmen Schreibstube Durchhalteparolen verbreiten und fordern: »Den Osten müssen wir für deutsches Siedlungsland erweitern, das Kurland und Litauen erobern und Polen durch deutsches Blut befreien.«
Dazu kommt es nicht. Kube muss seine Pläne für das Reich vorerst aufgeben. Die Niederlage des deutschen Heeres, die Kapitulation und die Abdankung des Kaisers kann er nicht ertragen. Was für eine Schande! Diese Demütigung Deutschlands, diese Erniedrigung ist für ihn auch persönlich eine Schmach. Er sinnt auf Revanche und gründet in Breslau seinen völkischen »Bismarck-Bund«. Damit will er die heranwachsende Jugend für völkische, nationale Ideale begeistern, sie zur Wiederherstellung der Ehre Deutschlands und zum Kampf gegen den Marxismus und das Judentum aufrufen. Sie macht er für den verlorenen Krieg schuldig.
Nach drei Jahren Lehrzeit ist Gustav Buchhändlergehilfe und berechtigt, gemeinsam mit Demski und Gertrud den Laden zu leiten. Demski kränkelt immer mehr und sagt zu den beiden: »Kinder, wenn ihr mal heiratet, überlass ich euch den Laden.« Vier Jahre später, 1925, ist es so weit. Obwohl Gustav und Gertrud Juden sind, kommt für sie eine jüdische Heirat nicht in Frage. Warum auch? Sie fühlen sich nicht als Juden. Also was soll’s? Es gibt auch keine kirchliche Trauung, nur die Prozedur am Standesamt. Nun ist die dreiundzwanzigjährige Gertrud Demski eine Gertrud Heimann und der zwei Jahre ältere Gustav zusammen mit ihr der Inhaber der Heine-Buchhandlung. Er zieht von seiner Dachstube hinab in den ersten Stock zu Gertrud, Demski wechselt in die Wohnung gegenüber. Blümchen gratuliert dem Hochzeitspaar mit fünf freien Taxifahrten und wünscht ihnen, neben all ihren Büchern das Leben nicht zu vergessen.
Am Tag ihrer Heirat kommt Hitlers »Mein Kampf« heraus. Kein Exemplar davon wird im Fenster gezeigt, keines in die Regale gestellt oder auf den Tischen ausgelegt. Das wär ja noch schöner. Strikte Ablehnung dieses Pestgestanks.
Der schwächelnde Demski kann es sich nicht verkneifen, immer noch im Laden herumzukrauchen, doch Gustav und Getrud schmeißen das Geschäft allein und schicken ihn wieder weg. Nach der Inflation und trotz der zunehmenden Wirtschaftskrise läuft ihre Buchhandlung einigermaßen zufriedenstellend. Vor allem, weil sie sich auf billige Taschenbücher konzentrieren und eine Abteilung für vergriffene Bücher mit stark herabgesenkten Preisen einrichten, ihr Modernes Antiquariat. Sie müssen bescheiden haushalten und können sich keine großen Sprünge leisten. Aber es reicht gerade so zum Leben.
Zwei Jahre später schreit in der Wiege ihr Töchterchen Erika, das die blonden Haare ihrer Mutter hat und die blauen Augen ihres Vaters.
Mittlerweile hat sich Kube wieder in Berlin angesiedelt, ist mit der Tochter eines Staatsanwaltssekretärs verheiratet und stolzer Vater zweier Söhne. Der Dreiunddreißigjährige fühlt sich als Dichter berufen und schreibt eine bombastische, schwülstige Historienschnulze: »Totila– Der letzte Gotenkönig«. Sie spielt um 550 nach Christus und zeigt den heroischen Kampf des Gotenvolkes und seines Anführers König Totila gegen das byzantinische Heer, das übermächtig aus vielen Völkern besteht. Alle gegen einen. Totila fordert seine Mannen auf, ihr Leben zu opfern, um ihre Ehre zu retten. Das tapfere Gotenheer wird von den Feinden besiegt. Auch Totila, getroffen von tödlichen Pfeilen, sinkt nieder. Gemeinsam mit seiner geliebten Swanhilde. Seine letzten Worte: »Am Leben liegt uns nichts, an Ehre alles!« Für Kube ein Sinnbild des ruhmreichen Kampfes des germanischen Volkes gegen alle seine Feinde. Eine Verherrlichung seines Heldengeistes.
Für die Uraufführung seines »Totila« sammelt ein Freundeskreis Geld und organisiert in einem Berliner Theater die Uraufführung. Von der Presse werden das Stück und die Aufführung völlig verrissen. In den Gazetten muss Kube lesen: »Ein grauenhafter, pompöser Kitsch! Schwulst über Schwulst.« Kein Theater will mehr etwas von seinem »Totila« wissen, nirgends wird er nachgespielt. Für Kube eine entsetzliche Pleite. Eine Katastrophe. Ihm ist klar: Die Juden sind an allem schuld. Nach seiner Meinung sind alle deutschen Theater völlig verjudet. Da hat er keine Chance.
Der Bauer findet, dass Jelena nun kräftig genug ist, um mit anzupacken. Sie muss die Kühe auf die Weide und zurück in die Ställe treiben, die Schweine auf dem Acker bewachen und die Ställe ausmisten, frisches Stroh aufschütten und schwere Milchkannen schleppen. Sie muss bei der Ernte helfen. Im Sommer brennt die Sonne heiß auf das Feld. Beim Dreschen und Heueinfahren dringen Wolken von Strohstaub in ihre Kleider. Sie kleben auf der verschwitzten Haut, der ganze Körper juckt. Und beim Ährenlesen stechen die harten Stoppeln in ihre nackten Füße. Beißender Schweiß rinnt in ihre Augen, ihr Gaumen trocknet aus. Kein Wasser zum Trinken. Und bei der Kartoffelernte im Herbst regnet es oft den ganzen Tag. Ihre Kleider sind klatschnass. Niedergebückt muss sie in der Kälte mit ihren klammen Fingern die Kartoffeln aus der Erde kratzen. Wenn sie sich aufrichtet, schmerzt ihr gekrümmter Rücken.
Etwas entfernt von den Äckern und Feldern führt eine Bahnlinie vorbei. Sehnsüchtig sieht sie den vorbeirauschenden Zügen nach. Sie fahren über Minsk nach Moskau. Was sind das für glückliche Menschen, die in einem solchen Zug fahren dürfen!, phantasiert sie. So möchte sie auch einmal dahingleiten. Wie schön wäre das! Einfach einsteigen und losfahren. Bis nach Moskau. Einmal im Leben nach Moskau! Das wünscht sie sich so sehr. Lange schaut sie diesen Zügen nach. Bis man sie anschreit, weiterzuarbeiten.
Einmal, im Sommer beim Roggenschneiden mit ihrer Sichel, schaut sie wieder den vorbeifahrenden Zügen nach und merkt nicht, dass die Erwachsenen mit ihrer Arbeit schon weit nach vorne gerückt sind. Sie beeilt sich, den Anschluss zu finden, und schlägt schnell mit ihrer Sichel durch die Halme. Da wird ihr plötzlich schwarz vor den Augen, und sie sieht drehende Kreise. Sie fühlt, dass etwas in ihren Finger gestochen hat. Ihre Hand ist dunkelrot verschmiert von Blut, auf der Sichel liegt die Spitze eines ihrer Finger. Eine Frau rennt herbei, steckt die Fingerspitze in ihre Schürzentasche, zerschneidet mit der Sichel ihr Kopftuch und verbindet damit die Wunde, damit sie weniger blutet.
Nach der Pleite mit seinem »Totila« entschließt sich Kube, Politiker zu werden. Er muss sich einer Partei anschließen und darin aktiv werden. Zur Auswahl hat er in Berlin neun Parteien, die ihre Namen wie bei einem Würfelspiel aus den Begriffen »deutsch«, »konservativ«, »national«, »nationalistisch«, »Volk«, »völkisch«, »sozialistisch«, »Freiheit« und »Bewegung« zusammensetzen. Fast alle antidemokratisch und antisemitisch. Nur wenige sind demokratisch und liberal. Die interessieren ihn nicht. Er sucht etwas Radikales. Viele lösen sich auf oder werden verboten, bilden sich unter einem anderen Namen neu.
In seiner ersten Partei steigt der Karrieregierige schnell vom einfachen Mitglied zum Geschäftsführer auf. Doch bald kommt es zu Zerwürfnissen. Seine groben Praktiken zerreißen die Partei. Er tritt in die nächste Partei ein, schafft es bis zum Generalsekretär und wird nach kurzer Zeit wegen Betrügereien hinausgeworfen. Er geht zur dritten Partei. Auch hier bleibt er nicht lang. Sie ist ihm nicht radikal genug. Aus seiner vierten Partei schmeißt man ihn als Vorsitzenden wegen seiner Intrigen raus. So hastet der Herrschsüchtige jahrelang weiter von Partei zu Partei, bis er alle neun durchhat.
Da lernt der mittlerweile Vierzigjährige bei einer Versammlung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei deren Anführer kennen, einen gewissen Adolf Hitler. Das Programm der NSDAP gefällt ihm sehr. Besonders gefällt ihm dieser Hitler. Von ihm ist er spontan begeistert. Er ist so recht nach seinem Geschmack.
Kube tritt in die NSDAP ein, lässt sich auf der Oberlippe ein kleines Bärtchen wachsen und zieht mit Hitler, Goebbels und Göring für Wahlkämpfe durch das Land. Sie hetzen gegen die Sozialdemokraten und Kommunisten. Sie rufen zum Judenhass auf und provozieren Saalschlachten. Besonders wenn Kube spricht, rasen die Säle. Er reißt derbe Witze über die politischen Gegner. Alle lachen. Schnell hat er die Tausende von Zuhörern auf seiner Seite.
Als Krakeeler bringt er die Versammlungen so richtig in Schwung. Hitler findet Gefallen an diesem Rabauken. Von jetzt an steigt Kubes Karriere steil nach oben. Von jetzt an beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt.
Die Nationalsozialisten haben Deutschland in Gaue aufgeteilt, um in diesen Territorien NS-Propaganda zu betreiben, neue Mitglieder zu gewinnen, die Partei aufzubauen, sie mit ihrer Verwaltung in den Griff zu bekommen. Goebbels beherrscht schon seit zwei Jahren den Gau Berlin. Kube bekommt 1928 von Hitler zum Dank für seinen bisherigen Parteieinsatz den Gau Ostmark zugeteilt. Ein riesiger Bezirk östlich von Berlin bis zur polnischen Grenze. Das ist nun sein Hoheitsgebiet. Hier hat er alle Vollmachten, kann schalten und walten, wie es ihm gefällt. Hier kann er in seiner braun-goldenen Gauleiteruniform und mit den goldenen Eichenblättern, dem Reichsadler und Hakenkreuz König sein. Nun ist er ein »Goldfasan«, wie man diese Kategorie nennt.
Er gründet sein offizielles Partei-Propagandablatt »Der Märkische Adler«. Als Hauptschriftleiter verkündet er gleich in der ersten Ausgabe: »Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist. Ein Jude kann daher kein Volksgenosse sein. Das Judentum ist eine Pest. Die Pestträger müssen ausgerottet werden. Das Ziel unseres nationalsozialistischen Programms ist die Bekämpfung des Judentums und seine totale Vernichtung.«
Seinen Sohn Horst setzt er als Redakteur ein und ernennt ihn zugleich zu seinem Adjutanten.
Er schmeißt Bürgermeister, Stadt- und Landräte, sogar Richter raus, wenn sie nicht nach seiner Pfeife tanzen, und ersetzt sie durch befreundete treue Parteigenossen, auch wenn sie vorbestraft sind. Man wirft ihm Vetternwirtschaft vor. Das stört ihn nicht. Er ist beliebt und sitzt fest im Sattel. Im Berliner Reichstag und im Preußischen Landtag diffamiert er den Innenminister und beschimpft ihn als »Schweinehund«. Dafür muss er eine hohe Geldstrafe zahlen. Damit gilt er als vorbestraft. Doch das kratzt ihn nicht. Lächelnd blättert er die Scheine hin und wiederholt seine Verleumdung. Kube, inzwischen bekannt als Frauenjäger, poussiert mit dem gesamten weiblichen Personal der Gauleitung und nimmt sich, obwohl mit seiner Margarete verheiratet, seine Sekretärin als Geliebte. In seiner Buchhaltung tauchen massive Fehlbeträge auf. Intern weiß man von seinen Unterschlagungen, doch keiner wagt, dagegen etwas zu unternehmen, aus Angst, die Stellung zu verlieren. Kubes Gauleitung wird als »Saustall« bezeichnet. Das ist ihm egal. Andere Gauleiter treiben es ebenso.
Außer der Laufkundschaft kommen auch besondere Buchliebhaber in Gustavs und Gertruds Heine-Buchhandlung. Darunter ein ulkiger Kauz mit einem Kopf wie ein aus Holz geschnitzter Kasperle: der Ringelnatz vom nahen Sachsenplatz oder von seiner eigentlichen Wohnung, der »Westendklause«. Er freut sich immer, wenn er seine Gedichte, Novellen, Romane und Kinderbücher im Regal stehen sieht.
»Verkauft ihr auch was davon?«, fragt er schelmisch.
»Natürlich«, bestätigen die beiden. »Wir müssen immer nachbestellen.«
Nur sein erschienener Berlin-Roman »…liner Roma…« stockt. Ein wildes Großstadtepos, gänzlich unkonventionell, ohne die üblichen Sätze, oft nur Substantive und Verben aneinandergereiht, dazwischengemengt wie Hackfleisch Collagen aus Reklamesprüchen und Tagesmeldungen. Dass sein modernes Werk kaum läuft, verschweigen sie ihm. Doch das weiß er selbst und lässt seine grotesken Gedichte los, dass sich Gustav und Gertrud kugeln vor Lachen.
»Ich bin eben etwas schief ins Leben gebaut«, sagt Ringelnatz und geht wieder.
Auch ein Herr mittleren Alters und mit sehr gepflegtem Äußeren kommt öfter zu ihnen und bestellt Musikbücher. Hindemith heißt er. Auch er wohnt in der Nähe, am Sachsenplatz. Fast neben Ringelnatz.
»Der mit seinen schrägen Tönen«, lässt Gertrud abseits leise fallen.
»Psst«, mahnt Gustav. »Das ist moderne Musik.«
Freundlich bietet Hindemith ihnen Freikarten für seine Aufführungen in der Krolloper an. Gertrud ist verhindert, sie muss die kleine Erika versorgen. Doch Gustav nimmt sie gern an, besucht Hindemiths Premieren und lauscht mit großen Ohren.
Dann ist da noch ein Stammkunde vom nahe gelegenen Kaiserdamm, ein Herr mit einer dicken Brille, der eigentlich ein Arzt ist und dazu wuchtige Romane und merkwürdige Erzählungen schreibt. Döblin. Eben ist mit einem sensationellen Erfolg sein »Berlin Alexanderplatz« erschienen, von dem im Laden ein ganzer Stapel auf dem Tisch liegt. Gustav muss daran denken, dass fünf Jahre zuvor der Großstadtroman von Ringelnatz im gleichen Stil kaum gekauft wurde.
Und noch ein eleganter Kunde kommt regelmäßig, ebenfalls ganz nah vom Kaiserdamm. Er ist groß, sieht sehr attraktiv und reich aus, schlenkert mit einem edlen Stock und trägt zum korrekten Anzug mit Weste manchmal sogar ein Monokel. Eine dandyhafte Erscheinung, dieser Remarque. Auch von seinem neu erschienenen »Im Westen nichts Neues« liegt ein riesiger Stapel auf dem Tisch, die Käufer reißen sich um diesen Antikriegsroman. Gustav und Gertrud müssen immer wieder nachbestellen.
Und dann betritt einmal ein Herr mit Halbglatze die Buchhandlung. Emil Nolde, der Maler von der nahen Bayernallee. Gustav kennt ihn. Obwohl er schöne Bilder malt, will er mit diesem Antisemiten nichts zu tun haben. Nur zögernd erhebt er sich und bedient ihn kühl und abweisend. Nolde spürt die Ablehnung und verlässt den Laden.
Als er draußen ist, sagt Gustav: »Dieser Judenhasser braucht hier nicht mehr zu erscheinen.«
Nolde kommt auch nie wieder.
3
Jelena hält die Plackerei auf dem Hof nicht mehr aus. Sie ist mittlerweile zu einer Jugendlichen herangewachsen und muss schuften wie zwei Erwachsene. Sie will weg von diesem Bauern. Sie muss abhauen. Sie will nach Minsk. Mit sechzehn fühlt sie sich erwachsen genug, um dort selbstständig zu leben. Sie war noch nie in dieser nahen Hauptstadt. In einer großen Stadt muss es doch möglich sein, eine Arbeit mit einem gerechten Lohn zu finden. Normal zu leben wie andere Menschen auch. Doch der Bauer lässt sie nicht gehen. Für ihn und die Bäuerin ist sie eine billige Arbeitskraft. Jelena aber drängt weiter. Schließlich willigen die beiden ein und geben ihr einen Zettel mit der Adresse ihrer Verwandten Olga und Wanja Tomskaja in Minsk. Sie haben eine Gerberei und können Jelena sicher gegen Lohn gebrauchen. Also auf nach Minsk!
Jelena packt ihre wenigen Sachen in ein Köfferchen und besucht vor ihrer Abreise noch einmal ihr Elternhaus. Das baufällige Häuschen, der Stall und die Scheune mit ihren schiefen Wänden sind zusammengestürzt. Lange bleibt sie zum Abschied davor stehen. Sie denkt an den Harz, der aus den Balken quoll und an dem ihre Kleider kleben blieben, wenn sie sich daranlehnte. Wieder hört sie in den Ritzen, die mit Lumpen zugestopft waren, die Grillen zirpen. Sie denkt daran, wie sie sich am Lehmofen den Rücken wärmte, wie sie auf den Knien ihres Vaters saß und er mit seinen rauen Händen ihre kleine Hand hielt, wie ihre Mutter die dampfende Kartoffelsuppe auf den Tisch stellte und ihre Eltern immer wieder ein liebes Wort zu ihr sprachen. Nach all dem, was sie bisher bei den fremden Menschen erleben musste, scheint ihr die heimatliche Hütte wie ein kleines Paradies. Sie denkt auch daran, wie ihr toter Vater damals auf der Holzbank lag und alle zu sehen glaubten, dass seine gelben Finger zuckten, als das heiße Wachs auf seine kalte Hand tropfte. Und sie denkt daran, wie ihre Mutter tot und kalkweiß im Bett lag. Jelena, dürr wie eine Latte, dreht sich um und geht weg. Sie muss nach Minsk.
Ein Lastauto, vollgeladen mit Torf, nimmt Jelena mit in die Stadt. Sie sitzt neben dem Fahrer und hält ihr Köfferchen auf dem Boden mit den Füßen fest. Der alte, knochige Mann hat seine zerbeulte Schirmmütze so tief ins Gesicht gezogen, dass sie seine Augen verdeckt. Sie fragt sich, wie er so etwas sehen kann. Wahrscheinlich muss er gar nichts sehen, denn die Straße führt stundenlang nur schnurgeradeaus, links und rechts nichts als Wälder, Wälder. Hinter ihnen stößt der Laster dicke schwarze Wolken aus. Allmählich tut ihr der Hintern weh. Aus dem zerschlissenen Sitz ragen die Spiralen der Eisenfedern heraus und drücken sich in ihren Po. Immer wieder muss sie sich anders setzen, um den Schmerz zu mildern. Die Landstraße ist voller tiefer Schlaglöcher, in die der Laster voll hineinkracht. Dabei schlagen die Stahlfedern hart in ihre Haut, und der Wagen schaukelt so sehr, dass sie sich am Türgriff festhalten muss, um nicht vom durchgesessenen Sitz zu rutschen.
Die Reise kommt ihr endlos lang vor. Während der ganzen Zeit spricht der Fahrer kein einziges Wort mit ihr, und sie hat keine Lust, mit ihm ein Gespräch zu beginnen. Die Zustände im Dorf kennt er, und was sie in Minsk vorhat, geht ihn nichts an. Das ist ihre Privatsache. Zweimal hält er am Straßenrand an, um neben seinem Laster zu pissen und eine Papirossa zu rauchen. Am Ende wirft er das glühende Ding ins Gebüsch.
Als sie sich der Stadt nähern, verschwindet der Wald zu beiden Seiten, nun reihen sich entlang der Piste alte Holzhäuschen aneinander, wie in ihrem Dorf. Dann wird die Straße breiter und glatter, und die ersten gemauerten hohen Häuser tauchen auf. So hohe Häuser hat sie noch nie gesehen. Sie sieht auch zum ersten Mal in ihrem Leben eine elektrische Straßenbahn und staunt.
Grußlos setzt der Fahrer sie im Stadtzentrum ab, an einer Brücke, die über einen kleinen Fluss führt. Bräunlich wälzt sich das Wasser dahin. Da steht Jelena also mit ihrem Köfferchen mitten in der Stadt, umbraust von lärmenden Autos und Omnibussen, die stinkende Wolken ausstoßen. Sie muss husten. Diesen Gestank ist sie nicht gewohnt. In ihrem Dorf gab es Pferde, die die Karren zogen, und nur ein paar Traktoren, die nicht diesen Gestank hinterließen, der sie jetzt im Hals würgt. Und so viele Menschen hasten um sie herum. Sie wird angerempelt, geschubst, gestoßen. Rücksichtslos, brutal. Auch das ist sie nicht gewohnt.
Die Gesichter der Menschen sehen alle irgendwie gleich aus. Wie aus Beton und leblos. Die meisten Minsker tragen seltsame Uniformen. Dazwischen sieht sie Männer in feinen Anzügen und Frauen in kostbaren Kostümen. Sie sieht aber auch sehr viele Menschen in ärmlicher, zerfetzter Kleidung. Überall ragen hohe Baugerüste empor, lärmen mächtige Bagger und Transporter, zwischen Bergen von Ziegeln wirbeln Kalk und Staub auf. Eine Stadt im Aufbau. Wohin sie auch schaut, überall rasender Autoverkehr, Absperrungen, Umleitungen. Gestank, wohin sie sich auch wendet. Und an den Fassaden hängen riesige Transparente mit Parteipropaganda.
Das also ist Minsk.
Wieder schaut sie auf ihren Zettel mit der Anschrift der Gerberei. Es ist schwierig für sie, sich in dieser großen Stadt zu orientieren. Sie hat keinen Stadtplan und muss sich durchfragen. Schließlich geht sie los mit ihrem Köfferchen. Sie muss an Ampeln stehen bleiben, die im immer gleichen Takt die Farbe wechseln. Auch das ist für sie neu. Sie muss die Autos vorbeisausen lassen, ehe sie die Straße überqueren darf. Dabei brausen sie durch große, schmutzige Regenpfützen und spritzen ihr frisch gewaschenes Kleid voll Dreck. Sie kommt über einen Marktplatz mit Buden. In ihrem Dorf holten sie die Kartoffeln, Rüben und Karotten vom Acker, und die Äpfel pflückten sie von den Bäumen. Hier müssen die Menschen alles in diesen Buden kaufen.
Nach drei Jahren Unterricht kommt für Anita der aufregende Tag der Eignungsprüfung. Sie schlottert am ganzen Körper. Sie nimmt ihr Herz in beide Hände und tritt in ihrem violetten Kleid, das die Mutter für sie ausgesucht hat, auf die riesige Bühne des Thalia-Theaters, angestrahlt von einem grellen Scheinwerfer. Hinter ihr die Kulissen der gestrigen Vorstellung, vor ihr der finstere Zuschauerraum. Die Männer der Prüfungskommission im Parkett kann sie nur als dunkle Schatten erahnen. Sie schluckt, atmet tief durch, bis ihr Zwerchfell schmerzt, und trägt tapfer die Rollen vor, die sie mit ihrer Lehrerin eingeübt hat. Das Clärchen aus Goethes »Egmont«, die Titania aus Shakespeares »Sommernachtstraum« und die Adelheid aus Hauptmanns »Biberpelz«.
Nach ihren Vorträgen langes Schweigen der Kommission. Anita ist schockiert. Sie hat das Gefühl, leichenblass zu werden. Sie fürchtet, zwischen den Brettern der Bühne, die für sie eine Welt bedeuten, zu versinken. Die Kommission schweigt noch immer. Aus, vorbei, Ende. Zerstoben ihr Traum vom Theater. Das steht für die zitternde Anita fest. Zuerst ihre zerplatzten Wünsche, Pianistin oder Balletttänzerin zu werden, und nun das frühe Ende ihrer Theaterkarriere, noch ehe sie begonnen hat.
Dann sagt einer der Männer: »Treten Sie ab. Warten Sie auf dem Flur, bis wir Sie rufen.«
Sie hat kaum noch die Kraft, von der Bühne zu schlurfen und sich auf den Flur zu schleppen.
Neben ihr auf den Bänken zappeln nervöse Prüflinge, denen dieses Fegefeuer noch bevorsteht. Jünglinge und Backfische, alle in ihrem Alter.
»Na, wie war’s?«, fragen sie. »Hast du’s geschafft?«
Stumm winkt Anita ab. Sie wartet. Die Zeit scheint unendlich lang. Sie hat keine Hoffnung mehr.
Dann endlich wird sie hereingerufen. Sie glaubt, vor dem Jüngsten Gericht zu stehen.
Lächelnd teilen ihr die Männer mit: »Frau Anita Lindenkohl, wir haben die Freude, Ihnen zu bestätigen, dass Sie Ihre Eignungsprüfung mit Auszeichnung bestanden haben. Herzliche Gratulation.«
Irgendwie sind ihre Ohren taub. Sie zweifelt, ob sie richtig gehört hat. Doch als man ihr feierlich die verzierte Urkunde überreicht und ihre Lehrerin Horwitz auftaucht, sie herzlich umarmt und ihr gratuliert, da weiß sie: Sie hat es geschafft. Jetzt ist sie eine echte Schauspielerin! Jetzt strahlt für sie wieder die Sonne.
Anita überlegt, unter welchem Künstlernamen sie auftreten soll. Anita behalten oder ihre anderen Namen Katharina oder Dorothea in die Programmhefte und auf die Plakate setzen? Sie bleibt bei Anita. Aber Lindenkohl ist kein Name für eine Künstlerin. Das klingt nicht gut. So lässt sie »kohl« weg und nennt sich Anita Linden. Anita Linden. Das klingt viel besser. Mit diesem Künstlernamen besetzt man sie im Thalia als junge Heldin und jugendliche Liebhaberin zuerst in kleinen Rollen, dann in größeren. Ihre Eltern, ihr Bruder Friedel und Lore bewundern sie.
Endlich findet Jelena die Gerberei, direkt an dem Flüsschen Swisslotsch. »Ledergerberei Tomskaja« ist auf eine alte Hausfassade gemalt, von der ein Teil des Verputzes abgefallen ist. Sie geht um das Haus herum zum Fluss und weicht zurück. Fäulnisgestank schlägt ihr entgegen. Am Ufer stehen große Holzgestelle, bespannt mit Tierhäuten. In das Wasser hinein sind Stege gebaut, die wie große Waschbretter aussehen. Darauf knien Arbeiter und schrubben mit Handbürsten nasse Felle. Eine Weile steht sie da und schaut sich das alles an.
Hier also soll sie nun arbeiten.
»Was willst du hier?«
Drohend steht ein Mann in verdreckten Klamotten neben ihr.
»Verschwinde!«
Seine barsche Stimme hat sie so erschreckt, dass sie im Moment nicht antworten kann.
»Hast du nicht gehört? Verschwinde!«
»Ich soll hier arbeiten«, bringt Jelena eingeschüchtert hervor.
»Wir brauchen niemanden.«
»Ich bin Jelena Grigorewna Masanik aus Masjukowtschina.«
Der Mann überlegt kurz.
»Geh da ins Haus.«
Ohne Begrüßung zeigt Tante Olga ihr eine kleine Kammer unter dem Dach mit einer schrägen Luke, durch die Jelena nur den Himmel sehen kann, aber immerhin den Himmel. In der Kammer befinden sich ein Bettgestell mit einer Matratze und einer Decke und ein kleines Waschbecken, jedoch ohne Wasserhahn. Das Wasser muss sie in einem Krug von einer Pumpe im Hof holen. Das ist ihr neues Heim. Als Lohn bekommt sie zwölf Rubel im Monat. Davon wird ihr für die Kammer und das Essen ein Teil abgezogen. Für sie selbst bleiben nur ein paar Kopeken für den notwendigsten Bedarf.
Um fünf Uhr früh muss sie die Holzbottiche, die Schurbretter und die Kessel schrubben. Anschließend Holz hacken, den Herd befeuern, im Haus putzen, für acht Personen kochen, im Gemüsegarten die Beete in Ordnung halten und dazu ein kleines krankes Kind hüten. Die Wäsche der Familie muss sie im Swisslotsch waschen. Aber nur dann, wenn die Arbeiter nicht die Felle und Häute spülen. Als Essen bekommt sie am Morgen eine Tasse Tee und eine Scheibe Brot und eine Gurke. Am Mittag gibt es eine Suppe, in der etwas schwimmt. Und am Abend wieder eine Tasse Tee und ein Stück Brot. Das ist alles.
Onkel Wanja ist der einzige freundliche Mensch in diesem finsteren Haus. Er hört ihr zu, wenn sie ihm ihr Leid klagt, und nickt, sagt aber nichts. Im Winter schlägt er für sie ein Loch in den vereisten Swisslotsch, damit sie darin die Wäsche waschen kann. Wenn sie die Kleidungsstücke aus dem Wasser zieht und sie auswringt, erstarren sie zu Eis.
Auch ihre eigenen, nass gewordenen Kleider sind vereist und hart wie Blech. Onkel Wanja hilft ihr, die vollen, schweren Körbe ins Haus zu schleppen und die Wäsche zum Trocknen auf dem Holzboden auszubreiten. Im Haus gibt es keinen wärmenden Lehmofen wie in ihrer Bauernkate, an dem sie sich den Rücken wärmen kann. Nur einen eisernen Herd. Kaum ist sie aufgetaut, überfällt sie der Hunger. Aus dem Speiseschrank kann sie nichts nehmen. Die Tante hat ihn abgeschlossen und bewahrt den Schlüssel in ihrer Schürze. Oft hat Jelena so einen Hunger, dass ihr schwindelig wird. Zu Hause und bei den Bauern gab es wenigstens genug Borschtschsuppe und Brot. Es gibt keinen Ruhetag. Die Plackerei wird für Jelena immer unerträglicher. Sie muss weg, weg von dieser Familie. Immer wieder nimmt sie sich vor, einfach abzuhauen.
Als die Heimanns eines Abends im September’31 die Kasse abrechnen, stürmt Blümchen herein. Völlig aufgebracht und außer Atem japst er: »Komm grad vom Ku’damm. Junge, Junge, da war wat los! Eene riesje Rotte von SA-Bengels vaprügeltn Passantn, die se für Judn hieltn. Mit Schlagringen und Knüppeln. Ooch uff die Jäste draußen vorn Cafés schlugn se ein und brülltn ›Jude, verrecke!‹ und ›Schlagt de Juden tot!‹. Nee, so wat, nee. Dit Pack wird imma frecher.«
»Einzelfälle, Einzelfälle«, wollen ihn die Heimanns beruhigen.
»Nee, nee. Dit is schon öfters passiert. Dit sind keene Kinkerlitzchen.«
»Die Regierung wird die Lümmel bestrafen.«
»Eua Wort in Jottes Ohr. Und in de Rejierung. Ick muss weita.«
Ein Jahr darauf wird durch ein Gesetz verboten, jüdische Familiennamen zu ändern. Es soll verhindern, dass Juden ihre Abstammung verschleiern.
»Bei uns gibt es nichts zu verschleiern«, beruhigt Gustav Gertrud. »Unser Name ist nicht jüdisch. Es ist ein ganz normaler deutscher Name. Auch ›Demski‹ ist nicht jüdisch.«
Kube feiert seinen fünfundvierzigsten Geburtstag. »Kommt und singet alle mit, wünscht Gesundheit und viel Glück. Kube hat Geburtstag«, wird gejubelt. Und alle kommen, singen und wünschen ihm viel Glück. Schon seit dem frühen Morgen sind die Straßen um seine Gauleitung an der Apostelkirche in Berlin-Schöneberg von dichten Menschenmassen erfüllt und rufen ihm »Er lebe hoch!« und »Heil!« zu. Vier Kapellen aus der Ostmark spielen vor dem Gauhaus schneidige Weisen. Darunter auch zwei SS-Standartenkapellen. Kreisleiter, Landräte, Ortsgruppenleiter und Bürgermeister stürmen in seine Büros, überhäufen ihn mit Gratulationen und überreichen ihm riesige Blumensträuße. Fotografen der gesamten NS-Presse, vor allem vom »Völkischen Beobachter«, »Angriff« und »Stürmer«, drängen sich nach vorn und knipsen Bilder für ihre Zeitungen. Besonders Kubes Sohn Horst, sein Adjutant und Redakteur, macht Fotos, Fotos, Fotos von seinem strahlenden Vater.
Und immer wieder treffen auf dem Fernschreiber Glückwunschtelegramme ein. Auch Postboten eilen herbei und überreichen ihm Telegramme. Darunter Glückwünsche vom Führer Adolf Hitler, von Göring und Goebbels. Für Kube huldigende Bestätigungen für seine Politik. Er ist überglücklich an diesem Tag.
Nach zwei Jahren packt Jelena wieder mal ihre wenigen Habseligkeiten in ihr Köfferchen und haut ab von dieser Gerberei. Heimlich verlässt sie in aller Frühe das Haus, ohne sich abzumelden. Auf den ausstehenden Lohn von ein paar Kopeken verzichtet sie gern, Hauptsache, sie ist weg.
Irgendeine Arbeit wird sie in dieser großen Stadt schon finden. Überall wachsen große Häuser, sogar Hochhäuser empor, moderne Bauten, mächtige Fabriken. Da muss es doch möglich sein, eine normale Arbeit zu finden mit einem gerechten Lohn und zu leben wie andere Menschen auch.
Tagelang läuft Jelena in der Stadt herum und sucht Arbeit. Irgendeine Arbeit in Fabriken, Lagerhallen, auf den Märkten. Ohne Erfolg. Sie hat keine einzige Kopeke mehr in der Tasche. Um etwas zu essen, klaut sie hin und wieder Kleinigkeiten von den Marktständen. Sie muss doch essen, um nicht umzufallen. Die Nächte verbringt sie im Wartesaal des Minsker Bahnhofs. Er ist überfüllt mit Menschen, die ebenfalls keine Unterkunft haben. Auf dem Bahnsteig sieht sie die langen Züge mit den Schildern »Moskau– Belorussischer Bahnhof«. Die Fenster der Schlafwagen sind mit spitzenverzierten Gardinen verhangen. Auf jeder der Gardinen leuchtet ein großes blaues Segelschiff mit aufgeblähten Segeln. Sonderbar, denkt Jelena, ein Schiff an einem Zug. Vielleicht gleiten diese Züge wie Segelschiffe durch die Nacht bis nach Moskau.
Auch sie will einmal nach Moskau. Sie denkt daran, wie sie bei ihrer Arbeit auf den Äckern und Feldern sehnsüchtig den vorbeifahrenden Zügen nach Moskau nachgesehen hat. Nun steht sie auf dem Minsker Bahnsteig ganz dicht vor diesen Waggons und kann sie sogar berühren. Durch die Berührung hat sie das Gefühl, Moskau schon ein Stückchen näher gekommen zu sein.
Sie wird von einem berauschenden Gedanken erfasst: Einfach in einen Schlafwagen einsteigen, sich in einem leeren Abteil verstecken oder sich in die Toilette einschließen, bis die Fahrkartenkontrolle vorübergegangen ist– einfach einsteigen und nach Moskau fahren. Der Gedanke macht sie ganz schwindelig. Da ertönt ein Pfiff, und der Zug dicht vor ihr fährt langsam los. Ohne sie. Sie hat Mühe, sich von dem leeren Gleis abzuwenden und zurück in den Wartesaal zu schlurfen, der überfüllt ist mit schlafenden Menschen und in dem es stinkt von ihren Ausdünstungen. Gerne würde sie draußen in der freien Nachtluft schlafen, aber dazu ist es viel zu kalt.
Immer wieder verbieten Kirchenleitungen SA-Männern, mit ihren Fahnen an Gottesdiensten teilzunehmen, und schicken sie hinaus. Das bringt Kube in Rage. Außerdem haben nach seiner Meinung die Kirchen viel zu viel Macht über die christliche Erziehung und das christliche Leben. Die Kirche soll nicht mehr über das Christentum entscheiden. Kube fordert, sie zu entmachten.
Im »Völkischen Beobachter« und in seinem »Märkischen Adler« fordert er, die Trennung von Kirche und Staat aufzuheben und die Kirche mit einem nationalistischen Staat zu vereinen. Über das Christentum soll allein der Staat bestimmen. Dafür gründet er eine neue Kirchenpartei und nennt sie »Deutsche Christen«. Für Kube sind sie dieSA Jesu Christi.
Er versammelt nationalsozialistische Pfarrer um sich, die seine neuen »Deutschen Christen« organisieren sollen. Ihnen predigt er: »Wir sehen in Rasse, Volkstum und Nation die von Gott geschenkte und anvertraute Lebensordnung. In den Juden sehen wir eine schwere Gefahr für unser Volkstum. Ihr fremdes Blut ist das Eingangstor in unseren Volkskörper.«
Kubes Programm: Ablehnung der jüdisch-marxistischen Ideologie. Rassenreinheit als Bedingung für eine Kirchenmitgliedschaft. Loslösung der Kirche von jüdischen Wurzeln. Entjudung der kirchlichen Botschaft durch Abkehr vom Alten Testament und Umdeutung des Neuen Testaments. Verbot von Mischehen mit Juden, die zur Bastardierung führen. Verkündung eines heldisch-germanischen Jesus.
Kube hat Erfolg. Bei Kirchengemeindewahlen erhalten die »Deutschen Christen« ein Drittel der Stimmen. Stolz verkündet er: »Gott hat mich als Deutschen geschaffen. Deutschtum ist ein Geschenk Gottes. Gott will, dass ich für mein Deutschland kämpfe. Kriegsdienst ist Gottesdienst. Der neue Christ hat das Recht, die Mächte der Finsternis zu bekämpfen. Er hat das Recht, die alte Kirche zu bekämpfen, die den Nationalsozialismus nicht anerkennt.«
4
Wieder mal stürmt Blümchen in den Laden, seine Lederjacke trotz der Kälte weit aufgerissen.
»Habta schon jehört? So ’ne Schweinerei!«
Gustav und Gertrud, auch Demski haben es schon im Radio gehört: Reichspräsident Hindenburg hat Hitler zum neuen Reichskanzler ernannt.
»Diese Kanalratte!«, poltert Blümchen. »Dem möcht ick mal de Fresse poliern. Dieser herjelaufene Österreicher! Bis vor eenem Jahr noch Staatenloser und jetzt deutscher Kanzler! Da wird der Hund inna Pfanne verrückt!«
Blümchen ist außer Atem. »Musste den janzen Mittag immer wieder Leute zum Wilhelmplatz chauffieren«, keucht er. »Alle wolln den Adolf sehn, unsern neuen Führer. Hab ooch jehört, dass der Remarque in de Schweiz abjehaun is.«
Und schon stürmt er wieder hinaus. Vorsichtshalber nimmt Gustav die Gedichte und Stücke von Brecht und »Im Westen nichts Neues« von Remarque aus dem Fenster.
Bald darauf muss er Hitlers »Mein Kampf« in die Auslage stellen, dazu Rosenbergs »Der Mythus des 20.