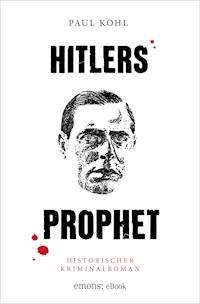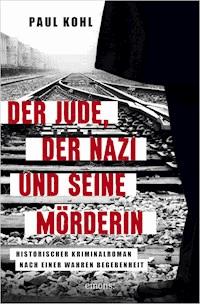Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Brillant recherchiert, lakonisch, gesellschaftskritisch. Deutschland, 1951: Die Republik ist im Aufbruch. Menschen kehren heim aus Krieg und Emigration. Und auch die Nazis kommen wieder. Denn sie waren nie weg. Nach außen bieder, bürgerlich, scheinbar harmlos, doch mit den alten Zielen schleichen sie sich ein in Presse, Parteien und Parlamente. Und mittendrin der jugendliche Ludwig, benebelt von "Schwarzwaldmädel" und Wirtschaftswunder. Als er erkennt, was um ihn herum geschieht und was sein eigener Vater getan hat, weiß er, dass er handeln muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Kohl, geboren 1937 in Köln, studierte Germanistik und Theaterwissenschaft, war Buchhändler und Mitarbeiter bei Fernsehproduktionen. Heute ist er Hörfunk- und Buchautor und schreibt über geschichtliche und sozialkritische Themen, insbesondere über die NS-Zeit. 2014 erhielt er den Axel-Eggebrecht-Preis für sein Lebenswerk als Autor für Hörfunkfeatures.
Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch sind einige Personen nicht frei erfunden, sondern existierten wirklich. Ihre Handlungen beruhen auf einem historischen Hintergrund. Im Anhang befindet sich ein Quellenverzeichnis.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Mint Images Ltd., Pietschmann2
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-799-6
Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Donnerstag, 3. Mai 1951. Christi Himmelfahrt. Früher Morgen. Wolkenloser blauer Himmel über Opladen. Die Sonne beginnt den Tag zu wärmen. Der Nordwestdeutsche Rundfunk meldet in seinen Nachrichten: In Korea bauen die nordkoreanischen und chinesischen Truppen ihre Stellungen aus. Sie rüsten auf für ihre große Frühjahrsoffensive. Amerikanische Flugzeuge bombardieren in ihrer bisher größten Aktion des Koreakrieges Flugplätze an der Grenze zu China. Zum damenhaften Schick der deutschen modebewussten Frau empfehlen die aufblühenden Modeagenturen farblich sorgfältig abgestimmte Accessoires wie Schmuck, Hüte und Handtaschen. Besondere Hüftmieder betonen den Knick der Wespentaille.
Sebastian Nettelbeck radelt über die eiserne Wupperbrücke, strampelt die Düsseldorfer Straße hinauf zum Frankenberg, zu seinem Stadtarchiv. Schön liegt zwischen hohen alten Bäumen das prächtige Landratsamt vor ihm, mit dem großen Säulenportal, dem breiten Balkon darüber, den beiden herrschaftlichen Etagen und dem mächtigen gewölbten Dach. Unter dieser Haube ist sein Stadtarchiv verstaut. Von der St.-Ulrich-Kirche weht der Klang der Glocken herüber, ruft zum Morgengebet. Christi Himmelfahrt. Mag er hinauffahren in den Himmel, Nettelbeck hat zu tun, Feiertag hin oder her, noch so viel zu tun.
Er schießt sich seinen rechten Zeigefinger weg. Mit seiner Pistole bei Schießübungen während des Drills, aus ihm einen Soldaten zu machen. Es bleibt nur ein Stummel. Mit so einem Stumpf kann er nicht den Abzugshahn einer Pistole, eines Karabiners, eines Maschinengewehrs drücken. In den Krieg will er auf keinen Fall. Diesen Irrsinn macht er nicht mit. Nein, er nicht. Er hat erreicht, was er will, ist wehrunfähig, wird freigestellt. Besser ein Finger weniger als tot im Krieg. In mehreren Ämtern schlägt er sich mit Büroarbeiten durch. In Papieren blättern und mit neun Fingern auf einer Schreibmaschine tippen, das kann er.
Während des Krieges bleibt im Opladener Stadtarchiv alles liegen. Niemand registriert die Ankäufe, die Erbschaften, die Hinterlassenschaften der Toten, stopft die Konvolute, die Dossiers, Urkunden, Korrespondenzen in Regale, stapelt die Dokumente, Chroniken, Aktenbündel auf dem Boden. Auch nach dem Krieg lässt man alles verrotten und verschimmeln. Dringend braucht man jemanden, der Ordnung schafft in diesem Chaos. Da taucht Nettelbeck auf und fragt nach Arbeit. Er wird angestellt als Archivar, was er nie gelernt hat. Macht nichts, Hauptsache, man hat jemanden, der sich über diesen Wust hermacht. Sein fehlender rechter Zeigefinger ist kein Hindernis. Er ist dreißig, nicht verheiratet, keine Familie und ist froh, in den alten Papieren wühlen zu dürfen.
Bei seiner Einstellung sagt man ihm, das Stadtarchiv sei das Gewissen und Gedächtnis von Opladen, und stellt ihm als Hilfe die Kriegerwitwe Elfriede Martens zur Seite. Ihr Mann liegt irgendwo in Russland. Das hätte auch ihm passieren können, wenn er sich nicht den Finger weggeschossen hätte. Mit ihr macht er sich voller Schwung und Elan an die Arbeit. Sie ordnen, registrieren das verrottete, verschimmelte Gewissen und Gedächtnis der Stadt, legen Bestandslisten an mit Signaturen und Standorten. Sie stellen große Lücken fest. Es fehlen wesentliche Teile der Stadtgeschichte. Vor allem aus der Nazizeit.
Nettelbeck geht in die Birkenbergstraße zum alten Anselm und kauft in seinem Antiquariat ein, was er kriegen kann. Alte Bildbände, historische Stadtansichten, Chroniken von längst verschwundenen Firmen, Erinnerungen von Opladenern, die jetzt auf dem Friedhof liegen oder irgendwo in den überfallenen Ländern. Er forscht über die niedergebrannte Synagoge, forscht, wie viele und welche jüdischen Geschäfte hier enteignet und arisiert wurden, wie viele und welche Juden geflüchtet sind, wohin andere Juden deportiert wurden, wie viele Selbstmorde es gab. Und wie viele und welche alten Nazis wieder in Amt und Würden sind, wieder in Wohlstand leben.
Die Chöre der Heimatvereine singen das Bergische Heimatlied:
Wo die Schwerter man schmiedet dem Lande zur Wehr,
wo es singet und klinget dem Höchsten zur Ehr,
wo das Echo der Lieder am Felsen sich bricht,
der Finke laut schmettert im sonnigen Licht,
wo das Wort noch gilt als heiligstes Pfand,
da ist meine Heimat, mein Bergisches Land.
***
Donnerstag, 3. Mai 1951. Christi Himmelfahrt. Vormittag. Die Sonne strahlt, die Luft ist warm. Der Nordwestdeutsche Rundfunk meldet in seinen Nachrichten: Die erste Internationale Automobilausstellung in Frankfurt am Main wird mit großem Erfolg beendet. Großes Interesse fanden neben den Luxuslimousinen auch Klein- und Mittelklassewagen. Als vollberechtigtes Mitglied wird die Bundesrepublik Deutschland in den Straßburger Europarat aufgenommen. Der Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen Jakob Kaiser eröffnet in München die Ausstellung »Deutsche Heimat im Osten«. Der NATO-Oberbefehlshaber General Dwight D. Eisenhower verkündet eine Ehrenerklärung für den deutschen Soldaten.
Am selben Tag, als Sebastian Nettelbeck in seinem Stadtarchiv weggestopfte Dokumente sichtet, steigt Karl Koberling in Opladen aus dem Zug. Er kehrt zurück aus dem Krieg. Er kehrt zurück in sein Heimatstädtchen.
Ein Glück, ein Riesenglück hat der Karl Koberling gehabt. Er hat den Krieg überlebt, er lebt noch. Zwar etwas abgemagert und knochig, aber er lebt noch. Sein buschiger dunkler Schnäuzer ist etwas lichter und heller geworden, aber er hat ihn noch. Er hat auch noch seine dunklen Augen, auch wenn sie jetzt etwas eingesunken sind, tiefer in den Höhlen liegen. Ein bisschen klein war er immer schon, nun hat er das Gefühl, noch ein paar Zentimeter geschrumpft zu sein. Doch sein Körper ist noch sehnig und elastisch, ein Körper für Krieg und Frieden. Nun ist er wieder da. Er hört die Glocken der Remigius-Kirche läuten. Christi Himmelfahrt. Der Christus hat seinen Dienst auf Erden getan und fährt in den Himmel. Er hat seinen Dienst im Krieg getan und kehrt nach Hause zurück.
Mitten im Gedränge steht Koberling vor dem Bahnhof. Menschen kommen von den Zügen, Menschen hasten zu den Bahnsteigen. Diolenanzüge, Trenchcoats und Lodenmäntel zwängen sich von vorne, von hinten an ihm vorbei, stoßen ihn an, schubsen ihn beiseite. So viel Betrieb am Feiertag. Und alle gut und sauber gekleidet, nicht wie er in seinen alten Klamotten. Ihre Leiber und Gesichter wohlgenährt und rund, nicht wie er so dürr. Alle wollen irgendwohin. Er will zu Irma, seiner Frau.
Den Bahnhof haben sie wieder aufgebaut. Schön sieht er nun aus und so neu.
Koberling steht zwischen den Trümmern des Bahnhofs, zerbombt durch einen Luftangriff. Ein paar Tage Heimaturlaub in seiner OT-Uniform. Der Schalterraum ist weg. An einer Holzbude die Liste der Züge, die nicht verkehren. Überall Schutt. Und auf der anderen Seite der Gleise die Stahlskelette des Reichsbahn-Ausbesserungswerks, des RAW. Bombardiert. Völlig zerstört. Da taucht in Koberlings Kopf wieder dieser Splitter auf, dieses böse Lied, das er so oft singen musste: »Und liegt vom Kampfe in Trümmern die Welt zuhauf, das soll uns den Teufel kümmern, wir bauen sie wieder auf.«
Vor dem Krieg zieht er als Maurer und sogar Polier eine der Hallen hoch und verputzt sie sauber. Ist zufrieden mit seiner Arbeit. Jetzt haben sie das RAW zum Teil wieder aufgebaut, arbeitet schon wieder. Er fragt sich, ob sein Haus noch steht. Ob seine Irma noch lebt.
Vor dem Bahnhof noch das alte Telefonhäuschen. Es hat den Krieg überstanden und glänzt gelb. Auf die Glastür ein Herz geschmiert mit einem durchbohrenden Pfeil. Daneben ein Heil Hitler! gekleckst, durchgestrichen und danebengeschrieben: Hitler kaputt! Er fragt sich, ob er seine Irma anrufen soll, ihr sagen soll, dass er zurückgekehrt ist, am Bahnhof steht und in einer Viertelstunde bei ihr ist. Vielleicht läuft sie ihm sogar entgegen. Etwas Geld in der neuen Währung hat er in der Tasche. Hat man ihm in Friedland gegeben. Da fällt ihm ein, dass er gar nicht weiß, wie viel man jetzt für ein Ortsgespräch einwerfen muss, ob sie noch die alte Telefonnummer hat oder eine neue, ob sie überhaupt noch ein Telefon hat, ob sie jetzt zu Hause ist oder trotz Feiertag bei irgendeiner Arbeit. Er will sie trotzdem anrufen, zieht die verschmierte Glastür auf. Vom Apparat hängt das abgeschnittene Kabel herab, ohne Hörer. Er liegt nicht auf dem Boden, wurde geklaut. So ein Ding braucht jeder. Hitler schneidet das Kabel ab, klaut den Hörer, ruft aus seinem Bunker das Volk auf zum allerletzten Widerstand. Und wenn es dazu zu feige ist, ist es nicht wert weiterzuleben, soll mit ihm zugrunde gehen.
Doch ein Teil des deutschen Volkes lebt noch. Auch er, der Koberling. Er kann seiner Irma nicht sagen, dass er wieder da ist. Nun gut, dann überrascht er sie.
Die Veteranenchöre der Bergischen Gesangsvereine singen das Bergische Heimatlied:
Keine Rebe wohl ranket am felsigen Hang,
kein mächtiger Strom fließt die Täler entlang.
Doch die Wälder, sie rauschen so heimlich und traut,
über grünenden Bergen der Himmel sich blaut.
War ich auch weit am fernsten Strand,
schlägt mein Herz der Heimat, dem Bergischen Land.
***
In seinem Stadtarchiv zieht Nettelbeck aus einem Schrank ein verstecktes Dossier hervor, öffnet es. Dokumente über die Gründung der Bundesrepublik mit einem großen Foto, Datum: 20. September 1949. Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer stellt sein erstes Kabinett vor. Alle Minister im schwarzen Cut, Smoking oder Frack, Adenauer in der Mitte im Stresemann. Alle Minister gut genährt, alle lächeln.
Über drei Köpfen ist mit Bleistift ein Kreuzchen gezeichnet. Das erste über Ludwig Erhard. Dem Foto ist ein Blatt angeheftet, darauf ein Text getippt. Kein Hinweis, wer das getippt hat. Nettelbeck liest über Ludwig Erhard:
Verfasst ab 1938 für das Nürnberger Institut für Wirtschaftsbeobachtung hoch bezahlte Gutachten über die wirtschaftliche Ausbeutung des annektierten Österreich, Sudetenlands und Protektorats Böhmen/Mähren. Enge Zusammenarbeit mit SS-Obergruppenführer Josef Bürckel, Gauleiter in Wien und Lothringen, Bürckel deportiert die Juden aus diesen Gebieten. Erhard erstellt für den SS-Obergruppenführer und Gauleiter Expertisen über die Verwertung ihrer Hinterlassenschaften.
Verfasst 1940 für die Haupttreuhandstelle Ost im besetzten Polen ein wirtschaftspolitisches Gesamtkonzept, wie der neue deutsche Ostraum entwickelt werden muss. Nennt die Deportation und Ermordung von Polen Evakuierung. Die Überlebenden sollen eingedeutscht und für das Reich möglichst produktiv eingesetzt werden. Die konfiszierten polnischen Betriebe sollen an Deutsche übertragen werden. Bekommt für seine Pläne viel Lob von Göring. Erhält von Himmler einen neuen Auftrag für einen hoch dotierten Bericht über die weitere Ausmerzung der Polen.
Gründet 1942 sein eigenes Institut für Industrieforschung, bestehend nur aus ihm und einer Sekretärin, höchst üppig finanziert von der Reichsgruppe Industrie, entwirft einen Plan zur Kriegsfinanzierung. Wird dafür vom Führer mit dem Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ausgezeichnet. Verfasst 1944 eine Studie für die Zeit nach dem verlorenen Krieg: Annullierung aller Schulden, Einführung einer neuen Währung und Neuaufbau der Wirtschaft. Viel Lob dafür von SS-Gruppenführer Otto Ohlendorf. Ohlendorf, Chef des Sicherheitsdienstes Inland, Leiter der SS-Einsatzgruppe Südukraine und Kaukasus, befielt die Ermordung von 90.000 Menschen. Wird nach den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gehängt. Erhard überlebt. Ist nun Wirtschaftsminister unter Adenauer.
Das zweite Kreuzchen über Hans-Christoph Seebohm. Nettelbeck liest auf dem angehängten Papier:
Seebohm, 1941 Aufsichtsratsvorsitzender der arisierten Egerländer Bergbau AG. Seit 1947 stellvertretender Vorsitzender der rechtsradikalen Deutschen Partei. Beauftragter der amerikanischen Organisation Gehlen in Pullach, Abteilung Ostforschung. Fordert 1949 Ehrfurcht vor Fahnen des Nationalsozialismus. Lehnt das Grundgesetz als von den Alliierten aufgezwungen ab. Unterstellt den Sozialdemokraten asiatische Wurzeln, die nicht zum Deutschtum führen. Ist nun Verkehrsminister unter Adenauer.
Das dritte Kreuzchen über Eberhard Wildermuth. Da steht:
Beim Einmarsch in Frankreich Bataillonskommandeur. 1941/42 Aufstieg zum Regimentskommandeur in Serbien. 1942 Einsatz in Heeresgruppe Mitte/Sowjetunion. Befördert zum Oberst. 1943 Einsatz in Italien. 1944 Festungskommandant von Le Havre/Frankreich. Ist nun Minister für Wohnungsbau unter Adenauer.
Die haben überlebt, sagt Elfriede Martens. Mein Mann nicht. Der liegt irgendwo in Russland. Und die sitzen jetzt in der Regierung.
Nettelbeck findet auch Papiere über eine Erica Pappritz. Tochter eines Rittmeisters, Mitglied der NSDAP, Ausbilderin des diplomatischen Nachwuchses im Auswärtigen Amt, Leiterin des Referats Zeremonial- und Rangfragen während der Nürnberger Reichsparteitage, Betreuerin des Diplomatischen Corps, heute stellvertretende Protokollchefin in Adenauers Bundeskanzleramt. Sie legt höchsten Wert auf korrektes Benehmen in der Bundesrepublik und beginnt, Empfehlungen zu schreiben. Zum Beispiel über das formvollendete Grüßen in der Öffentlichkeit:
»Grundsätzlich gilt: Lieber zehnmal zu viel als einmal zu wenig grüßen! Wann immer wir einem Gesicht begegnen, das uns vertraut oder irgendwie bekannt vorkommt, grüßen wir. Insbesondere, wenn wir männlichen Geschlechts sind. Denn in Deutschland grüßt der Herr zuerst. Es grüßen also der Herr die Dame, der Jüngere den Älteren, der Einzelne die Gruppe, die Unverheiratete die Verheiratete zuerst. Die Dame erweist ihre Grußbezeigung durch leichtes Senken des Kopfes, während der Herr mit angedeuteter Verbeugung seinen Hut lüftet, etwa bis in Schulterhöhe. Natürlich nimmt man als Herr zum Gruß die zweite Hand aus der Tasche und die Zigarette, Zigarre oder Pfeife aus dem Mund. Der Gruß beginnt wenige Schritte vor dem zu Grüßenden. Man darf den Gruß keinesfalls beenden, den Hut wieder aufsetzen, ehe man an dem anderen vorüber ist.«
***
Donnerstag, 3. Mai 1951. Christi Himmelfahrt. Mittag. Noch immer Sonnenschein über Opladen. Der Nordwestdeutsche Rundfunk meldet in seinen Nachrichten: Wie in Berlin und Köln finden in vielen Städten der Bundesrepublik Demonstrationen gegen die beginnende Wiederaufrüstung statt. Durch ein von der Bundesregierung verabschiedetes, in Kraft getretenes Gesetz werden ehemalige Wehrmachtsangehörige wieder in den Dienst gestellt und erhalten Pensionen. Verkehrsminister Hans-Christoph Seebohm, stellvertretender Vorsitzender der rechtsradikalen Deutschen Partei, nimmt einen ehemaligen Träger des NSDAP-Blutordens in sein Ministerium auf.
Am selben Tag, als Karl Koberling vor dem Bahnhof steht, kehren auch Leonhard Birnbaum und seine achtzehnjährige Tochter Luise aus Brüssel in ihr Heimatstädtchen zurück. Ohne seine Frau Marianne, ohne Luises Mutter. Die Straßenbahn der Linie O bringt sie von Köln hierher zur Endhaltestelle. Sie sind durch Flittard gefahren, vorbei am Bayerwerk, zum Teil noch in Ruinen, zum Teil wieder aufgebaut, arbeitet jetzt wieder, sind durch Leverkusen gefahren, durch Wiesdorf, Küppersteg. Die Strecke kennt er. Fuhr mit seinem kleinen Auto immer wieder nach Köln, kaufte für sein Foto- und Radiogeschäft neue Fotoapparate ein, Filme, Material für Entwicklungen, neue Radios.
Da stehen sie nun. Eilige drängen aus den Wagen, schubsen sie beiseite, andere hasten hinein, stoßen sie weg, erstürmen die Sitzplätze. Leonhard und Luise treten zurück, stellen sich vor das Schaufenster des Juwelier- und Uhrengeschäfts Beller. In der Auslage Perlencolliers, filigrane Silberkettchen, Korallenketten mit Bernsteinen, goldene Armreife, goldene Ohrringe. Man schmückt sich wieder. Medaillons mit Frauenporträts. Ein Porträt sieht Marianne ähnlich. Auch goldene Eheringe. Man heiratet wieder. Leonhard hat seinen silbernen Ehering nicht mehr am Finger. Den riss man ihm im KZ vom Finger. Goldene Armbanduhren, große prunkvolle Wanduhren, die Pendel schwingen hin und her. Alle Zeiger zeigen auf dreizehn Uhr fünfunddreißig. Die Hälfte des Tages ist vorbei, die zweite Hälfte steht Leonhard und Luise noch bevor. Neben dem Beller-Schmuck eine Ruine, davor ein Bauzaun. Man baut wieder auf. Auf den Bauzaun blau gesprüht: In den funkelnden Scherben unserer Vergangenheit beginnen wir neu zu träumen.
Wovon sollen Leonhard und Luise träumen?
Die Glocken der nahen Remigius-Kirche verkünden Christi Himmelfahrt. Christus fährt in den Himmel, sie kehren zurück in ihr Geburtsstädtchen. Luise sieht ihren Vater an. Sein Gesicht hat sich in den vergangenen zwölf Jahren sehr verändert. Seine fein geschnittene Nase ist breit geworden, seine hellen, prüfend blickenden Augen haben sich getrübt und flackern, als würde er etwas suchen. Seine dunklen Haare, lange nicht mehr geschnitten, ragen an den Schläfen und im Nacken unter seinem schwarzen Filzhut hervor, sind grau geworden. Gebückt nun seine früher immer aufrechte Haltung. Sie kehren heim nach ihrer Flucht aus Opladen Anfang ’39. Allein. Seine Frau Marianne, ihre Mutter wird aus Belgien nach Auschwitz deportiert. Leonhard und Luise überleben irgendwie in den KZs Breendonk und Mechelen.
Wohin jetzt? Zu Leonhards bestem Freund Edmund auf keinen Fall. Vielleicht lebt er nicht mehr, ist nicht mehr in Opladen. Und wenn doch, will er ihn nicht mehr sehen, diesen SS-Mann, das Schwein. Nie wiedersehen. Und so was war mal sein Freund. Macht Karriere. Leonhard sah in der Zeitung ein Foto von ihm, als neuer Richter im Amtsgericht Opladen. Erkannte ihn sofort wieder an seinem runden Robbengesicht. Erkannte Ende ’38, Anfang ’39 seine Unterschrift auf zwei Amtsschreiben. Enteignung seines Foto- und Radioladens und ihrer Wohnung. Höchst amtlich, höchst richterlich. Von seinem ehemaligen Freund hat er die Schnauze voll. Gestrichen voll.
Aber zu den Küppers muss er, zu Hartmut und Amalie. Hoffentlich gibt es ihren Konsum noch in der Steinstraße. Wo er und Marianne immer einkauften. Bis Anfang 1939. Hinter Heringsfässern und aufgestapelten Bierkästen. Er, Marianne und die kleine Luise. Eng zusammengekauert in einer Ecke auf der Ladepritsche von Hartmuts Lieferwagen. Zugedeckt mit alten Kartoffelsäcken. Den Atem angehalten, kein Husten, kein Geräusch. Bis alles vorüber ist.
Zu den Küppers kann er jetzt nicht. Ist noch zu erschöpft von der Reise. Muss erst ankommen in diesem alten neuen Opladen. Aber morgen unbedingt. Trotzdem jetzt in die Altstadtstraße zu seinem ehemaligen Foto- und Radiogeschäft, zu ihrer Wohnung. Da muss er hin. Muss sehen, ob das Haus noch steht, in dem er und Luise geboren wurden, oder weggebombt wurde.
Die Bergischen Gesangsvereine singen das Bergische Heimatlied:
Wo die Wälder rauschen, die Nachtigall singt,
die Berge ragen, der Amboss erklingt,
wo die Quelle rinnet aus moosigem Stein,
die Bächlein murmeln im blumigen Hain,
wo im Schatten der Eiche die Wiege mir stand,
da ist meine Heimat, mein Bergisches Land.
***
Nettelbeck sucht weiter und entdeckt hinter Akten über die Anfänge der Bundesrepublik, zwischen einem Bündel Altpapier versteckt, zwei neue Fotos. Eine Aufnahme zeigt einen Wald. Uniformierte, die Gesichter mit Farbe beschmiert, hocken in einem Schützengraben, überspannt mit einem Tarnnetz, zielen mit ihren Gewehren auf einen unsichtbaren Feind. Das andere Motiv: ein improvisierter Schießplatz, Uniformierte zielen auf Menschenattrappen aus Pappe. Auf der Rückseite der Fotos mit Bleistift notiert: Die Schnez-Truppe.
Was ist denn das für ein Haufen?, fragen sich Nettelbeck und die Martens. Nie gehört.
Angehängt an die Fotos ein Text über die Schnez-Truppe. Sie lesen:
Die Geheimorganisation Schnez umfasst zweitausend ehemalige Offiziere der Waffen-SS und der Wehrmacht, angeführt von General Albert Schnez. Zu ihr gehören auch die Wehrmachtsgenerale Adolf Heusinger und Hans Speidel. Die Truppe will ihre Schlagkraft bis zu vierzigtausend Mann ausbauen. Ihr Ziel: bei einem Angriff der Sowjets Deutschland verteidigen, gegen die Kommunisten kämpfen. Sie bespitzelt linksorientierte Bürger, legt Listen an von zurückgekehrten Juden, um sie im Falle eines Krieges festzunehmen. Finanziert wird die Truppe durch Spenden von Unternehmern. Adenauer will davon lange nichts wissen, um die Spender nicht zu verärgern, benötigt die Firmen für seinen Wiederaufbau. Lässt die Truppe jedoch später durch die Organisation Gehlen beobachten, unternimmt sonst nichts gegen sie.
Das muss in die Presse, sagt Nettelbeck. Das muss bekannt werden. Das bringe ich hier den Zeitungen.
Das machen Sie nicht, befiehlt die Martens.
Das muss die Presse veröffentlichen.
Wenn das rauskommt, enden Sie wie der heilige Sebastian.
Er kennt die Statue in der Remigius-Kirche. Da steht der fast nackte Sebastian, durchbohrt von Pfeilen. Hingerichtet von Bogenschützen.
Nettelbeck geht trotzdem zu den Lokalredaktionen der Düsseldorfer Nachrichten, des Neuen Vorwärts, der Rheinischen Post, sagt: Ich hab da was für Sie, und legt ihnen die Dokumente über Erhard, Seebohm, Wildermuth und über die Schnez-Truppe auf den Tisch. Das sollen sie bringen. Sie nicken.
Als er draußen ist, sind sie sich einig: zu heiße Ware, damit kommen wir in Teufels Küche, und stopfen seine Papiere in die Schublade.
***
Donnerstag, 3. Mai 1951. Christi Himmelfahrt. Früher Nachmittag. Die ersten Wolken ziehen auf, aber noch schön warm in Opladen. Der alte Anselm hat heute sein Antiquariat erst spät geöffnet und seine Krabbelkiste wieder vor den Laden gestellt.
Eigentlich darf er an diesem Feiertag gar nicht öffnen. Pfeif drauf, sagt er sich, er ist kein Christ, und wenn dieser Christus heute in den Himmel fährt, ist das seine Sache. Er hat damit nichts zu tun. Die Dünnedahls gegenüber halten ihren Fahrradladen geschlossen. Für sie ist Feiertag. Na bitte, sollen sie. Sie machen die Woche über genug Umsatz. Alles neue, teure Fahrräder. Sogar mit Dreigangschaltung. Mit ihnen hinaus ins Bergische Land. Seine Reiseführer für Radtouren verstauben in der Krabbelkiste und im Fenster.
Ein Bollerwagen rumpelt vorbei, gezogen von einem Pferd, die jungen Männer im Unterhemd saufen Bier aus Flaschen, grölen »O du schöner Westerwald« oder so was. Vatertag. Er ist kein Vater, hat keine Kinder, nicht mal mehr eine Frau. Sie starb ihm weg. Kein Christ, kein Vater, keine Frau. Was ist er denn, der Anselm? Ein alter Antiquar, der nichts verkauft. Wenn ein Schupo vom Revier vorbeikommen sollte und meckert, weil er geöffnet hat, holt er seine Krabbelkiste herein, und wenn er weg ist, stellt er sie wieder raus. Seit einem Jahr gibt es hier einen neuen Schupo mit einem glänzenden schwarzen Tschako. Der war heute noch nicht hier.
Anselm brüht eine große Tasse schwarzen Tee auf, sehr schwarz, sehr stark. Seine tägliche Belebung. Wenn er heiß durch die Kehle rinnt, sich im Körper ausbreitet, hat Anselm das Gefühl, er bewässert seine langsam austrocknenden Organe, erwärmt sie wieder, wenigstens ein bisschen.
Er sieht sich in seiner dämmrigen Höhle um. Mit ihm sind auch seine Bücher gealtert. Sie verstauben, vergilben, vertrocknen. Wie er.
Wenn er zurückdenkt, kommt ihm die Vergangenheit wie ein Traum vor. Aufgewachsen ist er in diesem Antiquariat. Es ist sein Zuhause. Als Kind hockt er in einer Ecke und sieht sich stundenlang die Bilder in den großen Büchern an, die faszinierenden farbigen Bilder aus fremden Ländern. Urwälder, wilde Tiere, Wüsten, Segelschiffe auf tosenden Meeren.
Später, sehr viel später, hilft er seinem Vater beim Sortieren der alten Bücher, beim Einstellen in die Regale, beim Stapeln auf den Tischen und auf dem Boden. Und noch später, ausgebildet als Antiquar, führt er mit ihm das Geschäft. Anselm heiratet seine Erna. Sein kränkelnder Vater stirbt, Anselm und Erna erben den vollgestopften Laden. Das Geschäft läuft schlecht. Noch schlechter während der Inflation und der Wirtschaftskrise. Die Menschen kaufen keine Bücher, sie brauchen Kartoffeln, Brot, Schuhe, Kleider, Brennholz, Kohlen. Wer kauft da antiquarische Bücher, die durch so viele Hände gegangen sind? Alle noch gut erhalten, aber eben gebraucht. Altware. Totale Flaute. Auch aus seiner Krabbelkiste vor dem Laden kauft keiner etwas. Nur wenn er sie abends hereinholt, sind da einige Lücken. Storm, Ganghofer, Löns geklaut.
Die Menschen brauchen Geld, um ihre Familien zu ernähren. Keine Arbeit, aber steigende Mieten. Sie räumen ihre Bibliotheken aus und bieten sie ihm zum Kauf an. Sie schleppen wertvolle Erstausgaben heran, einmalig erschienene Editionen, längst nicht mehr erhältlich. Kostbare Bände, gebunden in Leder, in Schweinsleder, sogar in Pergament. Erbstücke aus mehreren Generationen. Obwohl er und Erna kaum Geld haben, kaufen sie diese Schätze an zum möglichst billigen Preis. So wächst ihr Antiquariat noch weiter, und die Kunden verlassen den Laden mit wertlosen Scheinen, pfundweise in den Händen.
Er stellt mit Erna die angekauften Bücher in die Regale in der Hoffnung, sie später einmal teuer zu verkaufen, wenn die Zeiten besser werden. Sie ahnen, dass ihre Hoffnung trügt. Die Zeiten werden nicht besser, werden noch schlechter, sie halten dennoch an ihrer Zuversicht fest. Ratlos sitzen sie auf ihrem Erwerb, den sie nicht loswerden. Manchmal werden ihnen auch ein Storm, Ganghofer, Löns angeboten. Sie erkennen die geklauten Exemplare aus ihrer Krabbelkiste wieder, kaufen sie zurück von ihrem restlichen Geld.
Bald darauf stirbt Anselms Frau. Aus Verzweiflung. Nun hockt er allein in seinem Chaos, versinkt in seinen Büchern. Insgeheim ist er froh, nichts zu verkaufen. Es sind seine Bücher, seine Kinder, von denen er sich nicht trennen will. Er will sie alle für sich behalten. Von seiner kleinen Erbschaft kann er knapp überleben.
Er fragt sich, was aus seinem Antiquariat mal wird nach seinem Tod. Wie es weitergehen soll mit seinem Bücherschatz. Keine Erben, kein Nachfolger in Sicht. Ein Richter vom Amtsgericht, zuständig für Geschäftsauflösung, wird beschließen, dass irgendjemand den ganzen Plunder übernehmen soll.
***
Donnerstag, 3. Mai 1951. Christi Himmelfahrt. Später Nachmittag. Wolken überziehen die Sonne. Es wird kühl in Opladen. Der Nordwestdeutsche Rundfunk meldet: Nordkoreanische und chinesische Truppen beginnen ihre erwartete Frühjahrsoffensive. Es gelingt ihnen, die amerikanischen Stellungen nördlich des achtunddreißigsten Breitengrades zu durchbrechen und nach Süden vorzustoßen. Der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Korea, General Ridgway, fordert seine Soldaten auf, so viele Feinde wie möglich zu neutralisieren und nicht eher zu weichen, bevor nicht jeder Kommunist ausgelöscht ist. Die Bundesregierung verbietet allen Verbänden, eine Volksbefragung gegen die Wiederbewaffnung durchzuführen.
Am selben Tag, als Leonhard und Luise aus der Straßenbahn steigen, kommt auch Luggi mit seiner Mutter Kathi in Opladen an. An diesem Himmelfahrtstag fährt Luggi nicht in den Himmel, er wird als Beifahrer in einem Möbelwagen mit dem Umzugsgut aus dem bayrischen Gauting hierherverfrachtet. Nach einem langen Tag Rumpeln und Hoppeln auf der Autobahn, auf den harten Sitzen durchgerüttelt, steht er nun vor der neuen Wohnung, vor dem grauen Polizeigebäude in der Düsseldorfer Straße. Er kann es nicht fassen, dass er nun hier leben soll. Von irgendwoher weht Glockengeläut.
Ein Jahr davor wird sein Vater, Polizeimeister Hannes Stadler, hierher versetzt und wohnt bis zur Ankunft seiner Familie in Untermiete. Der vierzehnjährige Luggi will in seinem Gauting auf dem Land bleiben, bei seinen Freunden, bei seinem Großvater Jakob, bei seiner Großmutter Walburga und seinem Schäferhund Arko, mit dem er durch den Wald streunt. Es hilft kein Widerstreben, kein Auflehnen, kein Bocken, er muss mit seiner Mutter dem Vater folgen, wird aus seiner Dorferde herausgerissen und in dieses Kaff verpflanzt, umgetopft.
Hier soll er nun Wurzeln schlagen, aufwachsen, erwachsen werden, Früchte tragen. In dieser neuen Erde. Soll hier ein neues Leben beginnen, an diesem fremden Ort, wo er niemanden kennt, wo er nicht weiß, mit wem er sich anfreunden wird, in welche Schule er gehen soll. Er ist immer noch zu dick. Etwas weniger als in Gauting, aber noch zu viel. Das gibt sich, sagt der Doktor Hepp. Wenn er sich auswächst in ein paar Jahren, dann ist er wieder normal. Luggi will aber jetzt schlank sein, gut aussehen wie die anderen Jungen in seinem Alter. So wie er jetzt dasteht, findet er hier keine Freundin. Und in ein paar Jahren, mein Gott, das ist noch lange hin. So lang will er nicht warten.
Ratlos schaut er auf das grau verputzte Polizeigebäude. Im Parterre das Revier der Schupos und in der ersten Etage die Kriminalpolizei. Dort sind drei Büroräume für die neue Familie Stadler in eine kleine Wohnung umgebaut worden. Da sollen sie nun einziehen.
Noch immer reitet Luggi wie in Gauting auf seinem wilden Mustang über die Prärie auf der Spur des bösen Santers, der mit seinem Doppellaufstutzen die Indianer abknallt, treibt er auf einem Floß mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn auf dem Mississippi, hockt vor Onkel Toms Hütte am Lagerfeuer, sucht auf der Schatzinsel nach dem verborgenen Schatz der Piraten. Vielleicht ist er im Keller dieses Polizeigebäudes versteckt. Da muss er ihn suchen. Vielleicht aber findet er in diesem Keller eingemauerte Leichen, einen Stapel Leichen, nicht aufgeklärte Verbrechen.
Aus dem Hinterhof des Polizeigebäudes rast ein Verkehrsunfallkommando heraus, mit gellendem Martinshorn und blitzendem Blaulicht.
Die Möbelpacker stehen herum und warten auf ihren Einsatz, die Ladung in den ersten Stock zu schleppen. Luggi fürchtet, dass sein schönes rotes Fahrrad Pegasus bei der Rumpelfahrt durch die Schlaglöcher beschädigt wurde. Seine Mutter hat Angst, dass die Spiegel und die Scheiben ihres Wohnzimmerbuffets zu Bruch gegangen sind. Die Möbelpacker trösten sie. Alles gut gehüllt in dicke Decken. Ein Polizist in dunkelblauer Uniform kommt auf sie zu.
Hab Sie schon durchs Fenster gesehen, sagt er freundlich und reicht ihnen die Hand. Heger. Bin hier der Revierleiter. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Ihr Mann musste gerade weg zu einem Einsatz. Verkehrsunfall auf der Wupperbrücke.
Na, dann wollen wir mal, brabbeln die Möbelpacker und beginnen ihre Arbeit.
Die Wohnung liegt Wand an Wand neben den Büros der Kripo. Vom Gang geht es direkt in die kleine Küche, von dort weiter zu den anderen Räumen. Die Toilette, zugleich das Klo für die Kripo und für die zu den Vernehmungen Vorgeladenen, befindet sich am anderen Ende eines langen Korridors.
Luggi hat ein eigenes Zimmer, zwar klein, aber es reicht. Von seinem Fenster aus kann er im Hinterhof auf dem schwarzen Granulat die Polizeiautos sehen. In Gauting schaut Luggi durch sein Fenster auf die Wiese mit Apfel- und Birnbäumen, auf die Hühner und den großen bunten Hahn, hört ihn krähen. Sieht die Kaninchenställe, die grauen Pelzknäuel hinter dem Maschendraht, ein Ohr heruntergeklappt. Manchmal gibt es sonntags Kaninchenbraten, der ihm gar nicht schmeckt, wenn er daran denkt, wie er das Karnickel davor noch gestreichelt hat. Und für Arko gibt es die Knöchelchen. Er sieht den Gemüsegarten und den kleinen Kartoffelacker. Sieht seinen Arko vor der Hütte liegen. Wenn er ihn ruft, steht er auf, wedelt mit dem Schwanz. Es geht wieder los in den Wald. Sein Gauting ist so weit weg.
In einer Beilage der Düsseldorfer Nachrichten findet Luggi eine Strophe, die ein Leser als Ergänzung zum Bergischen Heimatlied eingesendet hat:
Wo die Menschen eilen zur Arbeit geschwind,
die Mutter beruhiget das weinende Kind.
Wo der Vater lobet den lernenden Sohn,
empfängt von ihm rühmend Worte als Lohn.
Wo der Knabe im Dickicht findet den Pfad,
der Bauer wirft aus seine trächtige Saat,
wo jeder geschützt ist in sorgender Hand,
das sei meine Heimat, mein Bergisches Land.
***
Ein Radfahrer wird totgefahren. Am selben Tag im Mai, als Luggi mit seiner Mutter in Opladen eintrifft. Auf der Wupperbrücke totgefahren. Ganz in der Nähe. Fast vor der Statue des heiligen Nepomuk, des Schutzpatrons der Brücke und des Beichtgeheimnisses. Sofort versammeln sich Passanten um den Toten auf dem Asphalt. Dunkelrot, fast schwarz fließt das Blut aus seinem Kopf. In der Lache liegt seine zerbrochene Brille, daneben sein zerbeultes altes Fahrrad, seine Aktentasche und verstreute Papiere. Ein paar Fußgänger sehen, wie von hinten sehr schnell ein Auto kommt, dann ein Krachen, der Radfahrer und sein Fahrrad liegen auf der Straße, der Pkw rast davon. Andere sehen, dass der Wagen kein Kennzeichen hat. An den Typ und seine Farbe können sie sich nicht erinnern. Alles geht so schnell. Der einzige wirkliche Augenzeuge des Unfalls ist St. Nepomuk auf seinem Podest, der Mucki, wie ihn die Opladener nennen. Doch der Patron des Beichtgeheimnisses drückt nur sein Kreuz an die Brust und schweigt. Er hat nicht vergessen, dass man ihn vor langer Zeit in Prag von der Karlsbrücke in die Moldau stürzte.
Langsam fährt die Straßenbahn vorbei, aus den Fenstern schauen die Fahrgäste auf den Toten hinab, auf seinen blutverschmierten Kopf. Ein paar Passanten sammeln seine zerbrochene Brille, seine Aktentasche, die herumliegenden Papiere ein und schleifen den Toten von der Straße auf den Bürgersteig, legen das verbogene Fahrrad neben ihn. Eine Frau rennt zum nahen Pförtnerhäuschen der Textilfärberfabrik Schusterinsel am Ufer der Wupper. Der Mann soll die Polizei rufen. Die Fabrikarbeiterinnen haben Feierabend, kommen heran. Was ist passiert? Der Auflauf um die Leiche wird immer größer. Bald hört man das Martinshorn des Verkehrsunfallkommandos, sieht die blau blitzenden Lichter, und schon trifft der Wagen ein. Zwei Polizisten steigen aus, sehen sich um und fluchen, weil die Leute den Toten vom Unfallort auf den Bürgersteig gezerrt haben.
Polizeimeister Hannes Stadler ist verärgert, dass er gerade jetzt zu diesem Unfall muss. Er erwartet seine Frau Kathi und seinen Sohn Luggi mit den Möbeln aus Gauting, will sie begrüßen. Nun muss er auf dem Asphalt mit Kreide die Umrisse zeichnen, wo der Verunglückte gelegen haben könnte. Muss mit seinem Kollegen und Freund Gustav Freese den Unfall aufnehmen, die ganze Prozedur erledigen, den ganzen Papierkram, Augenzeugen befragen.
Dachte, ist ’n Besoffener, sagt man ihm. Hab den Suffkopp liegen lassen. Soll seinen Rausch ausschlafen.
Ein anderer: Ist halt gestürzt. Wird sich schon wieder berappeln.
Keiner kann Genaues sagen. Nur: schnelles Auto, ohne Kennzeichen, weitergefahren. Fahrerflucht. Auch das noch.
Passanten übergeben Hannes Stadler die eingesammelten Papiere und die Aktentasche. Er sucht darin und findet den Personalausweis des Toten: Sebastian Nettelbeck, Stadtarchivar. Geboren 1920. Nicht verheiratet. Keine Ehefrau, die er über diesen Todesfall informieren muss. Er atmet auf. Gott sei Dank. Das bleibt ihm erspart. Das macht er gar nicht gern, einer Familie den Tod eines Angehörigen mitteilen. Das überlässt er einem Kollegen. Und wenn er wirklich dran ist, druckst er herum und weiß nicht, wie er es sagen soll. Morgen soll Freese mit dem Stadtarchiv reden. Heute geht das nicht. Feiertag. Da ist keiner da. Während Freese das Fahrrad in den Einsatzwagen wirft, ruft er das Bestattungsunternehmen Breidschuh an. Es soll die Leiche bis zur weiteren Klärung abholen.
Nach und nach zerstreut sich die Menge. Nur wenige bleiben noch und starren auf das graue Tuch, das den toten Nettelbeck bedeckt.
Der ist über die Wupper gegangen, sagt einer.
Bald rollt der angestaute Verkehr wieder ungestört über die Brücke.
Im Radio und auf Schallplatten singt die kleine Conny Froboess:
Pack die Badehose ein,
nimm dein kleines Schwesterlein
und dann nischt wie raus nach Wannsee.
Ja, wir radeln wie der Wind
durch den Grunewald geschwind,
und dann sind wir bald am Wannsee.
***
Karl Koberling sieht nahe beim Bahnhof den schwarzen, mit einem Palmzweig geschmückten Wagen des Beerdigungsunternehmens Breidschuh vorbeifahren. Die Firma kennt er. Die gab es schon vor dem Krieg. Stabile Existenz. Breidschuh hat immer viel zu tun, so ein Geschäft hat ewigen Bestand. Die Toten sterben nicht aus. Koberling aber lebt noch. Hat den Krieg überlebt. Dass er eingezogen wird, stört ihn nicht. Ist für ihn kein Problem. Er ist Maurer, sogar Polier und Betongießer. Im Krieg arbeitet er weiter in seinem Beruf. Egal ob im Frieden in der Heimat bei Brenner oder an der Front bei der OT. Beruf bleibt Beruf.
Bei der Organisation Todt, diesem Baukonzern, setzt er die Brücken wieder instand, die die Partisanen gesprengt haben, um den Nachschub zu blockieren. Baut die Kasernen und Lazarette für die Wehrmacht wieder auf, die diese zuvor bombardiert hat. Mit seiner OT zieht er durch Polen. Bei Rastenburg hilft er mit beim Bau von Hitlers Wolfsschanze. Er zieht durch Weißrussland. In Minsk betoniert er die Bunker für die SS. Zieht durch Russland. In Smolensk baut er die Flakstellungen und die Rollbahn. Und überall sind Zwangsarbeiter eingesetzt. Besonders Kriegsgefangene und Juden aus den umliegenden Ghettos. Unbehaglich wird es ihm nur, als die Bomben der Russen neben ihm einschlagen und die Minen der Partisanen dicht vor ihm hochgehen, seine Kameraden zerfetzen. Ihm aber passiert nichts.
Dann schnappen ihn die Russen, er muss in Workuta am nördlichen Polarkreis in einem Bergwerk malochen. Nach fünf Jahren lassen sie ihn frei, ab nach Westen. Er gerät in das Durchgangslager Friedland. Heißt wohl so, weil das Land jetzt Frieden hat.
Man kleidet ihn neu ein für ein neues Leben. Nach zwölf Jahren hat er nun wieder Zivilklamotten am Leib. Sein zerfledderter OT-Mantel und seine schief getretenen Stiefel landen in riesigen Körben, zusammen mit Uniformen der Wehrmacht und der SS. Keine benagelten Stiefel mehr. In denen hat er sich lange genug die Zehen wund gestoßen und die Fersen aufgescheuert. Er bekommt ausgelatschte, aber bequeme Lederschuhe, eine ausgebeulte Hose, Hemd, Jacke und einen alten Trenchcoat. Ist ihm egal, Hauptsache, keine Uniform und keine Stiefel mehr. Er kann seinen wuchernden Stoppelbart abrasieren, sich wieder ordentlich waschen und auch wieder satt essen.
Da hat er zum ersten Mal wieder deutsche Zeitungen in der Hand. Großdeutschland heißt jetzt Bundesrepublik, und es gibt eine neue Regierung. Mit einem Kanzler Adenauer. Der war mal Oberbürgermeister in Köln. Bevor die Nazis kamen. Mehr weiß er nicht über ihn. Jetzt ist er der erste Kanzler nach dem Krieg. Keine Ahnung, was er vorhat. Auf Fotos ist er schon sehr alt. Weit über siebzig. So ein alter Sack. In dem Alter noch Kanzler? Das kann nicht gut gehen. Der ist bald weg. Und dann? Haben die keinen Jüngeren gefunden, der anpackt und das zerstörte Land wieder aufbaut? Wer weiß, wie das enden wird mit ihm.
Auf anderen Fotos der neue Bundespräsident. Er heißt Theodor Heuss. Sieht freundlich aus, gutmütig. Wie ein lieber Großvater mit weißem Haar. Und diese neuen Minister. Alle so gut genährt. So kurz nach dem Krieg. Wo hatten die ihre Depots? Da sind auch neue Parteien. CDU, CSU, FDP. Keine Ahnung, was sie treiben werden. Die SPD kennt er noch von früher. Bis die Nazis kamen und sie verboten. Bis ’33 gab es eine Menge Regierungen. Schnell eine nach der anderen. Mal sehen, ob das diesmal klappt. Mal sehen, wie lange die jetzt hält.
Vor dem Bahnhof steht wieder ein Kiosk, das Büdchen, vollgehängt mit Zeitungen an Wäscheklammern wie ein Lebkuchenhäuschen. Amerikaner setzen ihre Atombombenversuche fort. Lassen in der Wüste von Nevada ihre dritte Bombe explodieren. Auch die Russen testen erfolgreich neue Atombomben.
In Koberlings Kopf rumort es. Kommt bald der Dritte Weltkrieg? Noch ist nicht der Schutt vom letzten weggeräumt, nun wieder ein neuer? Diesmal mit diesen neuen Bomben. Er glaubt, schon ihr Rauschen zu hören. Na Prost.
Am Kiosk hängt auch die Deutsche Soldaten-Zeitung. Bei einer Zusammenkunft ehemaliger Frontsoldaten in Frankfurt am Main gründen sie den Bund Stahlhelm. Sie sind wieder da. Waren nie weg. Wieder bereit. Es geht wieder los. Immer noch nicht die Schnauze voll vom Krieg. Dazu die Schlagzeilen: Täglich über tausend Flüchtlinge aus der Sowjetischen Besatzungszone in die Bundesrepublik. Anderthalb Millionen Arbeitslose. Das stört ihn nicht. Er ist Maurer, sogar Polier und Betongießer. Da findet er überall Arbeit. Ist doch Wiederaufbau.
Neben der Zeitungsbude hockt auf einem Brett mit kleinen Rädchen ein Krüppel. Beide Beine bis zu den Hüften amputiert. Er kann sich nur fortbewegen, wenn er sich mit den Händen auf dem Boden abstößt. Hätte auch ihm passieren können. Er ist noch mal davongekommen. Schwein gehabt, Karlchen, sagt er sich. Nun muss er weiter. Zu seiner Irma. Er will sie überraschen, will ihr frohes Gesicht sehen, wenn er plötzlich vor ihr steht nach so vielen Jahren des Alleinseins. Will sehen, wie sie sich freut.
***
Rudi Heger freut sich gar nicht, als ihm Polizeimeister Stadler Nettelbecks Aktentasche auf den Schreibtisch legt. Na gut, na schön, als Revierleiter sind Verkehrsunfälle seine Sache. Aber ein tödlicher Unfall, Fahrerflucht, dazu noch ein Wagen ohne Kennzeichen, damit hat er nichts zu tun. Das ist eine Angelegenheit der Kripo. Er hat genug anderes um die Ohren und übergibt die Aktentasche Wipperfürth einen Stock höher.
Nun liegt der Kladderadatsch auf dem Schreibtisch des Kripoleiters Oberkommissar Erwin Wipperfürth. Er öffnet die Tasche und nimmt die Papiere daraus hervor. Auf dem ersten Blatt steht: Dr. Friedrich Bossmann, Rechtsanwalt. Eigene Kanzlei am Frankenberg, nahe Landratsamt. Wohnhaft in Opladen.
Wipperfürth stutzt. Den Bossmann, den Friedrich, kennt er. Gut sogar. Oft sitzen sie abends im Stippchen zusammen, trinken ihr Bier, plaudern über dies und das. Auch über ihre Zeit im Dritten Reich. Bossmann lässt manches anklingen, doch nicht viel. Wipperfürth fragt nicht weiter nach. Interessiert ihn nicht. Manchmal spielt er mit Bossmann am Birkenberg eine Partie Tennis. Im Opladener Tennisclub sind sie beliebte Mitglieder. Hin und wieder fahren sie auch nach München, nach Pullach. Aber immer getrennt, zu verschiedenen Zeiten. Wäre sonst zu verdächtig.
Weiter steht da über Bossmann:
1906 geboren in Opladen. Abitur im Aloysius-Gymnasium Opladen, Studium Jura und Staatsrecht in Köln, Promotion zum Dr. jur., 1933 mit siebenundzwanzig Jahren Eintritt in SA und NSDAP. 1937 Eintritt in SS. Mitglied des NS-Rechtswahrerbundes. Tätig beim Sicherheitsdienst in Aachen. 1940 Gerichtsoffizier und Untersuchungsführer bei der Sicherheitspolizei Wiesbaden. 1941 SS-Hauptsturmführer. Gestapo Wiesbaden und Kassel, Referat Judenangelegenheiten. 1942 Reichssicherheitshauptamt in Berlin im Referat Eichmann, Abteilung IV B4. Sachbearbeiter für die Vorbereitung der »Endlösung der europäischen Judenfrage«. 1943 SS-Sturmbannführer. 1944 von Eichmann zum Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes nach Verona abgeordnet. Dort im Judenreferat Durchführung der Endlösung der »Judenfrage« in Italien. Auf seinen Befehl bis September 1944 über 6.000 italienische Juden in Vernichtungslager deportiert. Zuständig für das KZ Fossoli. Verleihung Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern durch Himmler. In Padua Leiter der Sicherheitspolizei. Auf seine Anordnung Deportation der dort noch lebenden Juden.
Bis Kriegsende Gesamtzahl der durch Bossmann deportierten italienischen Juden: 7.750. Setzt sich Ende April 1945 mit falschen Papieren unter dem Namen Fritz Müller nach Österreich ab. Gerät in amerikanische Gefangenschaft, wird im August 1945 entlassen. Verschweigt 1948 bei seiner Entnazifizierung seine NS-Tätigkeit. Wird als Mitläufer Kategorie IV eingestuft. Lebt seit 1948 in seiner Geburtsstadt Opladen. Führt dort als Rechtsanwalt eine eigene Anwaltskanzlei.
Nun ja, sagt sich Oberkommissar Erwin Wipperfürth, solche gibt es viele. Alle haben mehr oder weniger mitgemacht. Warum nicht auch er? Es war eine schwierige Zeit. Nun gut, manches war nicht sehr schön. Zugegeben, es gab Auswüchse. Gibt es in jedem Krieg. Ist nun mal so. Nicht zu vermeiden.
Er legt das Papier beiseite, nimmt sich das nächste Blatt vor, liest:
Dr. Edmund Rauschenberg, Richter am Amtsgericht. Wohnhaft in Opladen.
Wieder stutzt er. Auch den Rauschenberg kennt er. Kennt ihn gut. Sitzt mit ihm und Bossmann oft im Stippchen beim Bier zusammen, plaudern auch über ihre Nazizeit. Edmund spricht manchmal davon, welche Schwierigkeiten er hatte. Ging allen so. War eben eine schwere Zeit. Dieses Jahr stand er sogar mit ihm beim Karnevalszug auf dem Prinzenwagen. Und am Wochenende spielt er mit ihm wieder Tennis. Und dann muss er wieder nach Pullach. Der Rauschenberg zwei Tage später.
Über Edmund Rauschenberg steht da:
1905 geboren in Opladen. Mit Friedrich Bossmann Abitur im Aloysius-Gymnasium Opladen, Gemeinsames Studium Jura und Staatsrecht in Köln. Zum Dr. jur. promoviert. Erstes und zweites Staatsexamen. Dozent für Strafrecht in der Akademie für Deutsches Recht in Berlin. 1933 Eintritt in NSDAP und SA. 1936 in SS. Mitglied des NS-Rechtswahrerbundes. Trifft dort wieder Bossmann. Rauschenberg wird Richter am Reichsgericht in Leipzig. Versetzt wegen einer unschönen Sache zum Landesgericht Köln. Versetzt wegen einer unschönen Sache zum Amtsgericht Opladen. Dort maßgeblich beteiligt an der Arisierung. Enteignet jüdische Geschäfte und Unternehmen und übergibt sie Ariern. Verschweigt bei Entnazifizierung seine Tätigkeit als Richter. Wird eingestuft als Mitläufer Kategorie IV. Lebt seit 1949 in seiner Geburtsstadt Opladen. Enge Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Friedrich Bossmann.
Nun ja, sagt sich Oberkommissar Erwin Wipperfürth. Solche gab es viele. War eben damals so. Wir mussten alle irgendwie mitmachen. Jeder auf seine Weise. Vorbei ist vorbei. Man hat überlebt, ist wieder gut im Geschäft. Verdient wieder ordentlich. Auch der Rauschenberg. Auch durch Pullach. Großzügig bezahlt. Wie der Bossmann. Es geht weiter. Das Vergangene wird eingeebnet. Die Späne von gestern sind zusammengekehrt, die Stricke von den Hälsen abgenommen.
Wipperfürth besieht sich noch mal die beiden Blätter. Schade, dass sie nur Kopien sind. Er hat immer gern das Original von Dokumenten in der Hand. Aus Prinzip. Wo befinden sie sich? Sicher hat der Bursche die Originale in seinem Stadtarchiv herausgekramt. Er muss sie da verschwinden lassen. Die Kopien stopft er in seine Schreibtischschublade und verschließt sie.
Trotzdem lassen ihn die Papiere nicht los. Wipperfürth versteht nicht, dass Nettelbeck so was getippt hat. Was hatte er damit vor? Wollte er es veröffentlichen? Sehr unklug von ihm, das bekannt zu machen. Sehr unklug. Das macht man nicht. Grundsätzlich nicht. Er hätte sich denken können, dass so was Ärger gibt. Nun ist der Nettelbeck über die Wupper gegangen. Das hat er nun davon.
Und jetzt soll er diesen Fahrer ermitteln. Ein Wagen ohne Kennzeichen. Dazu ein tödlicher Unfall mit Fahrerflucht. Wer saß am Steuer? Wer weiß, was da alles rauskommt. Die Sache ist ihm zu heikel. Besser, er lässt die Finger davon.
Plötzlich wird ihm heiß. Im Stadtarchiv könnte auch etwas über ihn liegen. Über seine Gestapo-Zeit in Brüssel. Nun gut, der Nettelbeck kann nichts mehr hervorzerren. Der nicht mehr. Aber da arbeiten auch andere, die schnüffeln. Wenn da einiges über ihn bekannt wird, was dann? Wird nicht. Mein Gott, das ist über sechs Jahre her. Gestapo in Brüssel. Seitdem ist nichts passiert. Schwamm drüber. War nicht der Einzige. Auch bei seinen Kripokollegen Schönlein und Gutbrot ist nichts ans Licht gekommen. Waren in den Einsatzgruppen in Polen, Lettland, Russland. Da ging es auch nicht korrekt zu.
Und wenn die im Stadtarchiv doch was über ihn finden, dann helfen ihm seine Freunde in Pullach. Auf die ist Verlass. Die Amis und der Gehlen haben schon so manchen von damals rausgehauen und in ihren Dienst eingestellt. Brauchen ihre Fachkenntnisse, sind auf sie angewiesen. Das hat sogar der olle Adenauer für seine Regierung öffentlich zugegeben. Man kann nicht auf Beamte verzichten, die beste Erfahrung im politischen Dienst haben, hat der Alte gesagt, als er seinen Globke ins Bundeskanzleramt holte. Seine Regierung, ganz Bonn ist voll von diesen damaligen Professionellen. Was soll er sich da Sorgen machen? Wipperfürth ist beruhigt. Er lehnt sich zurück.
Im Radio und auf Schallplatten singt Willy Schneider:
Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein.
Deinen Kummer tu auch mit hinein.
Und mit Köpfchen hoch und Mut genug
leer das volle Glas in einem Zug! Das ist klug!
Schließ die Augen einen Augenblick,
denk an gar nichts mehr als nur an Glück.
Und auf eins, zwei, drei wirst du gleich seh’n
wird das Leben wieder wunderschön!
***
Die braune Dusche beginnt. In Opladen hängen immer mehr Fahnen aus den Gebäuden. Rote Fahnen mit schwarzen Hakenkreuzen. Auch drapiert man sie immer häufiger dekorativ in Schaufenstern. Anselm legt so einen Lappen nicht in seine Auslage. Bei mir nicht, sagt er sich. Nicht zwischen meinen Büchern. Kommt nicht in Frage.
SA-Lümmel dringen in sein Antiquariat, beschimpfen ihn, weil er keine Hakenkreuzfahne im Schaufenster hat, und drücken ihm ein schön gefaltetes Tuch in die Hände. Bekenntnis zum Führer, befehlen die Bengel. Sie stöbern in den Regalen, auf den Tischen, in den Stapeln auf dem Boden, werfen, was ihnen nicht passt, in ihre Kartons und schleppen sie fort. Als sie weg sind, schmeißt er den roten Fetzen, das Kreuz mit den Haken in eine Mülltonne im Hof. Er denkt an seinen Freund in Köln. Sicher dringen sie auch bei ihm ein, reißen alle missliebigen Bücher aus den Regalen, raffen sie auf den Tischen und auf dem Boden zusammen, werfen sie in ihre Kartons und schleppen sie fort.
Bei den Dünnedahls gegenüber hängt so ein Lappen über den ausgestellten Fahrrädern. Sie sehen, wie die SA Bücher aus seinem Laden herausholt, sagen ihm, dass seine und andere Bücher von jüdischen Autoren und Regimegegnern im Mai in Köln verbrannt werden.
Anselm fährt nach Köln. Das muss er sehen, sonst glaubt er es nicht. Vor der Alten Universität am Rhein im Römerpark lodert ein Scheiterhaufen. Studenten mit ihren blöden Mützen schleudern Bücher wie Wurfscheiben in die Flammen. Andere schleppen Dutzende Körbe voller Bücher aus der Universität heraus, wieder andere zerren prall gefüllte Kartons von Lastwagen.
Anselm schaudert es. Da könnten auch die Kartons mit seinen Büchern sein. Die ganze Literatur in die Flammen! Auf einer Tribüne sitzen der Rektor, die gesamte Professorenschaft, der Senat der Universität und handverlesene Ehrengäste. Alle klatschen Beifall. Eine SA-Kapelle spielt einen flotten Marsch. Laut und schräg. Massen von Neugierigen scharen sich um den Scheiterhaufen, glotzen. Bratwürste brotzeln, Kölsch wird ausgeschenkt. Ein gutes Geschäft.
Abseits erkennt er im flackernden Schein des Scheiterhaufens seinen Kölner Freund und Antiquariatskollegen Luzenis. Er geht zu ihm, sie begrüßen sich stumm. Auch er will sehen, wie man seine Bücher verbrennt, sonst glaubt er es nicht. Fassungslos stehen sie da. Sie können sich nicht von ihren Büchern trennen. Die Bücher brennen schlecht. Sie liegen eng aufeinander, leisten dem Feuer Widerstand, lassen es nicht eindringen. Andere ergeben sich, Abwehr sinnlos, öffnen ihre Einbände, lassen sich verschlingen. Den Feuerwehrmännern geht der Brand zu langsam, sie werfen Brandbeschleuniger in die Flammen, kippen Benzin dazu. Nun lodert alles wieder hoch.
Jahre später Anfang November brennt etwas anderes. Die Opladener Synagoge. Dicker Qualm quillt aus den zerborstenen Fenstern, Feuerfontänen schlagen heraus, die restlichen Scheiben zersplittern, Scherben fliegen umher, Balken stürzen herab. Jemand will schützend etwas retten. Schnell wird es ihm von der Polizei abgenommen. Die Feuerwehr steht daneben, lässt das Bethaus niederbrennen, achtet nur auf den Funkenflug, damit die Flammen nicht auf die Nachbarhäuser übergreifen, muss immer wieder die Gaffer zurückdrängen.
Auch sonst brennt in Opladen an diesem Abend noch so einiges. In Anselms Antiquariat wirft die SA keine Fackeln. Er ist kein Jude. Er muss an Birnbaum denken und eilt zu ihm in die Altstadtstraße. Er sieht, wie die SA seinen Foto- und Radioladen plündert, verwüstet und ihn in Flammen aufgehen lässt. Versteinert stehen Birnbaum, Marianne und die kleine Luise da. Er kann ihnen nicht helfen.
Schon seit dem Boykott ihres Ladens und auch der anderen jüdischen Geschäfte in Opladen im April ’33 redet er auf sie ein, Deutschland zu verlassen. Anselm weiß, wie es weitergehen wird in den nächsten Jahren. Sie können sich nicht zu einer Flucht entschließen. Auch die Küppers, Hartmut und Amalie, wissen, wie es weitergeht.
An den Ortseingängen die ersten Schilder, an Geschäften und Restaurants die ersten Schilder: Juden unerwünscht. 1935 die Nürnberger Gesetze. Juden sind keine Reichsbürger mehr, keine deutschen Staatsbürger mehr. Was sind die Birnbaums dann? Sind rechtlos. Anfang November 1937 gibt Hitler seine Kriegspläne bekannt. Birnbaum muss im Jahr darauf sein Vermögen über fünftausend Reichsmark anmelden, darf keine Behörde mehr betreten.
Auch die Küppers reden auf die Birnbaums ein, Deutschland zu verlassen. Sie können sich noch immer nicht zu einer Flucht entschließen. Sie zögern.
***
Ihr Zögern ist ein Fehler. Das sehen Leonhard und Marianne ein. Sie hätten auf Anselm und die Küppers hören sollen, schon viel früher fliehen müssen. Auch sie selbst ahnen seit ’33, wie es enden wird, und bleiben trotzdem. Es ist ihr Heimatstädtchen, sie sind hier aufgewachsen, haben hier ihre Freunde und ihren Laden Bild und Ton.
Jeden Monat, jede Woche, jeden Tag neue Schikanen. Es geht Schlag auf Schlag. Immer wieder überlegen sie, ob es doch besser wäre zu emigrieren. Sollen sie ihren Laden aufgeben? Und da ist die kleine Luise. Mit dem Kind emigrieren? Wohin? Wie im Ausland ihr Brot verdienen? Sie können sich nicht entscheiden und hoffen gegen alle Vernunft, dass es doch nicht ganz so schlimm kommt.
Bis es dann ganz schlimm kommt, an diesem Abend im November 1938. Ihr Geschäft wird geplündert, verwüstet, sie müssen es wieder instand setzen. Dann die Enteignung ihres Ladens und ihrer Wohnung durch seinen früheren Freund Rauschenberg. Auch die anderen jüdischen Geschäfte und Wohnungen in Opladen werden enteignet. Dass sie nicht mehr in die Stadthalle gehen dürfen für eine Theateraufführung, für ein Konzert, kein Kino mehr besuchen dürfen, darauf können die Birnbaums verzichten in ihrer Situation. Auch dass Leonhard sein Auto und seinen Führerschein abliefern muss, auch darauf kann er verzichten nach dem Verlust seines Ladens.
Was Leonhard und Marianne jedoch schockiert: Ab dem 1. Januar 1939 ist in ihre neue Kennkarte ein großer Stempel geprägt, ein großes rotes J. Jude! Und am 30. Januar verkündet Hitler zum sechsten Jahrestag seiner Herrschaft, dass im Fall eines Krieges die europäischen Juden vernichtet werden.
Jetzt müssen sie mit ihrem Töchterchen fliehen, um ihr Leben zu retten. Raus aus Deutschland, raus aus diesem Land. Wohin? Was müssen sie einpacken? Was ist nötig? Was brauchen sie am dringendsten? Die nächstgelegene Stadt im Ausland ist Brüssel.
Hartmut Küpper schiebt Leonhard, Marianne und die kleine Luise auf die Ladepritsche seines Lieferwagens, schiebt sie ganz hinten in eine Ecke hinter Heringsfässer und aufgestapelte Bierkästen, wirft alte Kartoffelsäcke über sie und fährt los, fährt vorbei an Aachen bis zur belgischen Grenze. Da muss er halten. Ausreise aus dem Reich. Die Birnbaums hören Stimmen. Deutsche Soldaten, Zoll. Sie hören Hartmut sagen: Einkaufstour für meinen Laden. Die Hecktür wird geöffnet. Die Birnbaums unter ihren Kartoffelsäcken wagen nicht zu atmen, unterdrücken Husten, keine Bewegung, kein Geräusch. Ihre Herzen schlagen bis zum Hals, bis in den Gaumen. Ihre Körper drohen zu platzen. Dann wird die Hecktür zugeschlagen. Es geht ein kleines Stück weiter. Wieder Halt. Einreise in Belgien. Wieder Stimmen. Diesmal französische Stimmen. Die Fahrt geht weiter. Sie können wieder atmen. Sie atmen auf, bleiben noch immer versteckt.
Nach längerer Zeit wieder Halt. Hartmut öffnet die Hecktür, sagt: Wir sind in Lüttich.
Sie klettern hinaus. Stehen unter einer Brücke. Neben ihnen die Maas. Hartmut drückt Leonhard ein Bündel belgische Francs in die Hand.
Die hab ich noch von meiner letzten Einkaufstour. Geld für euren Zug nach Brüssel. Da drüben ist der Bahnhof. Viel Glück. Überlebt gut. Wenn ihr wieder in Opladen seid nach diesem ganzen Scheiß, sehen wir uns wieder.
Umarmungen, Tränen. Hartmut fährt zurück.
In Brüssel finden die Birnbaums Unterkunft in der Hutmanufaktur Cohen.
Wir müssen zusammenhalten, sagt der Jude Paul Cohen und versorgt Leonhard und Marianne mit gut bezahlter Arbeit. Sie spannen nassen Filz über hölzerne Hutformen, drücken ihn fest an und lassen vorsichtig die warme Presse darüber hinab, warten, bis es nicht mehr dampft, dann immer wieder die Presse, bis der Hut steif genug ist. So viele verschiedene Hutformen, so viele Modelle. Sie arbeiten sich gut ein, schaffen Tag für Tag eine Menge Filzhüte. Das Annähen der Bänder mit Schlaufen machen andere.
Der sechsjährigen Luise verschafft Cohen einen Platz in der Deutschen Schule in Brüssel. Dort sitzt sie zusammen mit anderen Erstklässlern, mit Jungen und Mädchen der Familien, die in deutschen Behörden und Firmen arbeiten, und der Familien, die aus Nazideutschland geflohen sind. Sie lernt Kinder aus Kassel und Hamburg kennen, aus Nürnberg und Köln. Mit einem Kölner Jungen freundet sie sich schnell an. Er kennt Opladen gut. Seine Großeltern wohnen in der Kanalstraße.
Paul Cohen schenkt Luise das deutsche Kinderbuch »Die Häschenschule« mit bunten Bildern. Schon bald kann sie die fröhlichen gereimten Verse lesen und einige auswendig hersagen. Angst hat sie vor dem gefährlichen Fuchs, der im Gebüsch auf die Häschen lauert, sie fressen will. Er hat so böse Augen. Angst hat sie auch vor dem Jäger mit dem großen Schießgewehr. Er will die Häschen totschießen. Auch Leonhard erhält von Paul Cohen ein Geschenk. Er schenkt ihm einen großen schwarzen Filzhut mit breiter Krempe und einem Lederbändchen, den Leonhard selbst gepresst hat. Den trägt er jetzt immer.
Kurz nach dem Überfall der Wehrmacht auf Belgien im Mai 1940 wird die Deutsche Schule geschlossen, Cohens Hutmanufaktur beschlagnahmt und Paul Cohen verhaftet. Leonhard und seine Familie kommen durch einen Zufall davon. Paul Cohen sehen sie nie wieder. Den schwarzen Filzhut trägt Leonhard als Erinnerung an ihn.
Sie finden Arbeit in Henrik DeDonders Fotolabor und können bei ihm in seiner Dachkammer hausen. Als Fotograf hilft Leonhard mit beim Entwickeln von Filmen, beim Vergrößern und Kolorieren von Porträtaufnahmen. Seine Frau Marianne versorgt die Küche, putzt DeDonders Wohnung und sein Fotolabor, und die siebenjährige Luise sortiert die Fotos und Filme. Die Familie kann sich knapp über Wasser halten. Beim Hin- und Herschwenken eines Bildes im Entwicklungsbad tauchen vor Leonhard zwei markante Gesichter auf, die ihn interessieren.
Zwei Juden, die nach Brüssel geflohen sind und hier versteckt leben, sagt DeDonder. Der mit dem Buch in der Hand ist der Wiener Schriftsteller Hans Mayer. Und der mit der Mütze ist der Maler Felix Nussbaum aus Osnabrück. Der malt hier weiter seine Bilder. Sehr seltsame Bilder. Alle sehr düster. Sein Versteck ist voll davon.
Die beiden will Leonhard unbedingt besuchen, sie kennenlernen, so bald wie möglich.
DeDonder verschafft der Familie Birnbaum gefälschte Ausweise mit dem Namen Vangruiten. Den müssen sie sich einprägen, ihn sich genau merken für Razzien. Wie er diese Fälschungen herstellt, wissen sie lange nicht. Bis er sie einmal in seinem Keller versteckt, kurz bevor die Sicherheitspolizei bei einer Großrazzia Anfang September 1942 das ganze Haus durchsucht. Da sehen sie eine Menge Blankoausweise, viele Stempel, eine kleine Presse, einen Kopierer und einen Stoß Flugblätter. Auf denen steht:
Kampf den Nazibestien! Die Verhaftungen nennen sie Arbeitseinsatz. Die KZs Breendonk und Mechelen sind nur der Anfang. Wir wissen: Von dort gehen die Deportationen nach Auschwitz. Sie enden mit der Vernichtung! Mit dem Tod! Widerstand und Kampf gegen die Okkupanten! Jeder von uns muss gegen sie kämpfen! Mit der Waffe in der Hand, anstatt bei einer Razzia ergriffen und vernichtet zu werden!
Jetzt ist ihnen auch klar, warum DeDonder oft halbe Nächte unterwegs ist. Als sie wieder nach oben dürfen, verschweigen sie ihm, was sie gesehen haben, obwohl er es weiß. Lange sprechen sie nicht darüber. Bei DeDonder hausen sie bis 1943, bis eine Nachbarin sie an die Gestapo verrät. Leonhard, Marianne, die zehnjährige Luise und auch DeDonder werden in die KZs Breendonk und Mechelen verschleppt, Marianne und DeDonder von dort nach Auschwitz transportiert.
Im Herbst 1944 befreien die Amerikaner Breendonk, Mechelen und Brüssel. Leonhard kehrt mit Luise zurück nach Brüssel, findet als Fotograf Arbeit bei der Zeitung La Liberté, und Luise kann ein Jahr darauf die wiedereröffnete Deutsche Schule besuchen. Die Zeitung beauftragt ihn, für einen Bericht über die beiden KZs Fotos zu machen. Als ehemaliger Häftling kann er diese Stätten des Terrors am besten dokumentieren. In Mechelen fotografiert er auch einen Güterzug, einen Waggon, in den Marianne getrieben wurde. Das muss er festhalten. Das muss in seinem Gedächtnis bleiben.
Lange zögert, grübelt er, ob er mit Luise nach Opladen zurückkehren soll. Dann entschließt er sich zur Rückkehr. Seine Kollegen der Liberté bereiten ihnen ein großes Paket Reiseproviant, darunter für ihn zwei Flaschen Wein, für seine Tochter zwei Flaschen belgischer Apfelsaft, verabschieden die beiden herzlich und wünschen ihnen viel Glück.
Da stehen sie nun mit ihren Koffern, am 3. Mai 1951. Luise kratzt wieder an ihrer linken Wange, an ihrer Narbe, die so oft juckt und manchmal brennt.
Nicht kratzen, sonst reißt die Wunde wieder auf, sagt Leonhard. Er hat andere Wunden, doch die sieht man nicht. Er schiebt ihre Hand weg und rückt seinen schwarzen Filzhut mit der breiten Krempe und dem braunen Lederbändchen gerade, seinen schwarzen Filzhut von Paul Cohen. Jetzt schnell los zu ihrem Laden und zu ihrer Wohnung.
Leonhard weiß, dass es völlig sinnlos ist, in die Altstadtstraße zu gehen. Ihr Laden und ihre Wohnung gehören jetzt einem anderen. Völliger Unsinn, sich das anzusehen. Was will er dort? Mit dem neuen Inhaber reden? Sich anschauen, was nun in seiner Auslage liegt, wie er sich in ihrer Wohnung eingerichtet hat? Totaler Unsinn. Er will davon nichts wissen. Und trotzdem will er dahin. Wenigstens sehen, ob das Haus noch existiert, ob da vielleicht ein Neubau steht. Und dann? Was hat er davon?
Er kann nicht anders, er muss zu seinem früheren Leben zurück. Es treibt ihn dorthin. Sie greifen ihre schweren Koffer und ziehen los.
Erica Pappritz, stellvertretende Protokollchefin in Adenauers Auswärtigem Amt, notiert in ihren Empfehlungen für ihre Protokollabteilung und für die Öffentlichkeit zur Reisegarderobe:
»Natürlich kann man in seine Reisekoffer immer ein paar Kleider und Anzüge mehr einpacken als nötig. Wir wollen schließlich am selben Ort nicht zweimal im selben Anzug gesehen werden und wie Landstreicher auftreten. Besonders unsere Damenwelt hat ein Interesse daran, sich so oft wie möglich so nett wie möglich umzuziehen. Meistens aber genügen außer der sportlichen Reisekombination zwei elegante Straßenanzüge, ein grauer und ein dunkler. Wer große Theater- oder Opernpremieren vorhat, wird auch einen Smoking einpacken. Madame nimmt dann ein entsprechendes kleines Abendkleid mit. Ebenso wichtig ist die kleine Garderobe, die man am Strand trägt, beim Wandern, auf dem Tennisplatz, beim Segeln. Hemden und hübsche Krawatten für die Männer, nette Tageskleider für die Damen.«
***
Luggi hat gehört, dass es hier ganz nah einen kleinen Fluss gibt, die Wupper. Die wird er sich morgen ansehen. Vielleicht kann er darin Kaulquappen und kleine Fische fangen, wie in seinem Flüsschen Würm, das durch Gauting fließt. Er hat auch gehört, dass sie manchmal gelblich schäumt, wenn die Chemiefabriken in Wuppertal ihre Abwässer in den Fluss leiten. Seine Würm schäumt nicht. Die ist immer sauber. In der Nähe keine Chemiefabriken. Und er hat gehört, dass es in Leverkusen diese große Fabrik Bayer gibt. Je nach Wind soll ihr Schwefelgestank auch hier zu riechen sein. Bei Gauting gibt es keine solche Fabrik. Da stinkt es nie.
In seinem Dorf steigt der kleine Luggi aus dem Kinderwagen um auf sein Dreirad, von dem Dreirad auf seinen Roller, von dem Roller auf sein Kinderfahrrad, von dem Kinderfahrrad auf sein großes Rad, seinen schönen roten Pegasus. Er stößt sich barfuß auf Kieswegen die großen Zehen auf, dass sie unter den Nägeln heraus bluten. Tritt barfuß auf den Weiden in Kuhfladen, der braune Brei quillt zwischen seine Zehen und bleibt hängen. Das Klo ist ein Plumpsklo mit einer Jauchegrube hinterm Haus, überdeckt mit morschen Brettern. Sein Großvater mahnt: Nicht darüberlaufen. Sonst plumpst du hinein in deine eigene Scheiße. Regelmäßig kommt ein großer Kesselwagen und saugt mit einem dicken Schlauch jeden Monat die Scheiße der Familie heraus.