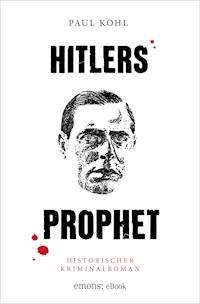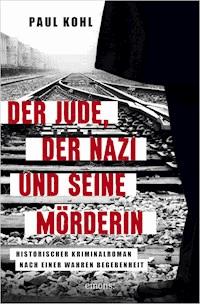14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Der Journalist Paul Kohl beschäftigt sich mit einem zentralen Thema der kritischen Militärgeschichte: den Verbrechen der deutschen Wehrmacht und der Polizei während des Angriffskrieges gegen die Sowjetunion. 1985 bereiste der Autor das Gebiet der damaligen Sowjetunion und befragte erstmals Überlebende des Vernichtungsfeldzugs der deutschen Wehrmacht und der Polizei. Seine Reise führte ihn zu den ehemaligen Konzentrationslagern von Minsk, Borisov, Orscha, Mogilov und Vitebsk. Ergänzt von einem ausführlichen Dokumententeil. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Ähnliche
Paul Kohl
Der Krieg der deutschen Wehrmacht und der Polizei 1941–1944
Sowjetische Überlebende berichten
FISCHER Digital
Mit einem Essay von Wolfram Wette
Inhalt
Die Zeit des Nationalsozialismus
Eine Buchreihe
Herausgegeben von Walter H. Pehle
»Es ist und bleibt unser Anliegen, die soldatische Haltung und Leistung der Soldaten und Truppenteile der ehemaligen Wehrmacht, die ehrenhaft und tapfer gekämpft haben, zu würdigen und ihnen die Achtung und den Respekt der Bundeswehr zu bekunden.«
General Klaus Naumann, Generalinspekteur der Bundeswehr, in seiner Festansprache am 7. Juni 1992 in Mittenwald.
Einleitung
Warum ich diese Reise unternahm
Oradour und Lidice sind bekannte Namen. Selbstverständlich. Doch Kortelisi, Bajki, Borki, Dalwa? Vielleicht mit Ausnahme von Chatyn kennen wir keines der 628 Dörfer, die allein in Belorußland mitsamt der Bevölkerung von deutschen Truppen niedergebrannt wurden. Warum nicht? Über die KZs in Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen usw. wurde sehr viel veröffentlicht. Warum wurde noch nichts veröffentlicht über die Lager in und um Minsk, Baranowici, Smolensk, Vjasma usw.?
Das Getto von Warschau ist ein Begriff. Warum wissen wir nichts über die Gettos von Minsk, von Vitebsk, von Orscha, von Mogilov, von Sluzk oder Riga? Warum?
Über Auschwitz wissen wir sehr gut Bescheid. Warum wissen wir nichts über Trostenez bei Minsk, den zentralen Vernichtungsort von Belorußland, wo 206500 Menschen erschossen, vergast und verbrannt wurden? Warum ist Trostenez so unbekannt? Über die Verbrechen der deutschen Wehrmacht, der deutschen Polizei und der SS in Polen wissen wir viel. Warum wissen wir so wenig über die Massaker der deutschen Truppen in den besetzten Gebieten der Sowjetunion? Was wissen wir über den Einsatz der Gaswagen in den besetzten Gebieten der Sowjetunion durch die Einsatzgruppen? Was wissen wir überhaupt über diese Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes (SD)?
Über 28 Millionen Tote hatte die Sowjetunion durch den deutschen Überfall von 1941 und die Besetzung bis 1944 zu beklagen. Das sind 14 Prozent der Bevölkerung der UdSSR. Das sind aber auch 44 Prozent der weltweiten Gesamtzahl der Opfer des Zweiten Weltkrieges. Ausgehend von der früheren Angabe von über 20 Millionen sowjetischen Opfern mußten 13,6 Millionen Rotarmisten ihr Leben lassen und 7 Millionen Zivilisten. Nach Angaben des Minsker Historikers Iwan Bejdin wurden von den deutschen Truppen sogar 11 Millionen Zivilisten ermordet. Wie viele Millionen Kriegsgefangene und Zivilisten wurden nach Deutschland deportiert, um sich hier in den Rüstungsbetrieben zu Tode rackern zu müssen? Und wer von uns kennt die Massengräber, wo diese Menschen bei uns im bundesdeutschen Boden verscharrt liegen? Wir haben die Feuerstürme von Hamburg und Dresden selbst erlebt, oder zumindest darüber erzählen gehört. Und man spricht noch heute davon. Doch wer erwähnt auch nur mit einem Wort eine der 1700 zerbombten Städte oder eines der 70000 vernichteten Dörfer in der Sowjetunion?
50 Jahre nach Ende dieses Vernichtungskrieges wissen wir – von wenigen großen Städten abgesehen – immer noch beschämend wenig darüber, was damals dort geschah. Eine andere Art von Eisernem Vorhang haben wir hier in unserem Wahrnehmungsvermögen heruntergehen lassen. Und wenn man darüber zu sprechen beginnt, dann hört man oft, es solle »endlich Schluß sein« mit alldem. Wie kann Schluß sein mit Informationen, die noch gar nicht verbreitet wurden? Und wer sagt dies? Und in welcher Absicht?
Wenn bei uns vom Krieg und vom »Russen« die Rede ist, hört man als erstes die leidvollen Geschichten der Flüchtlinge und Vertriebenen. Daß aber davor die deutschen Truppen russische Bevölkerung vertrieben und deportiert haben und diese vor den Deutschen fliehen mußte – wer denkt schon daran? Und man rechnet auf, was die russischen Truppen beim Einmarsch in das zusammenbrechende Reich alles begingen. Natürlich sind auch hier Verbrechen geschehen. Ich sage »natürlich«, denn ich stelle mir vor, mit welcher Wut, mit welchem Haß und Rachegefühl Rotarmisten den Boden des damaligen Reiches betraten, nachdem sie erleben mußten, wie ihre Familien von den Deutschen massakriert wurden, wie ihre Städte und Dörfer zerstört und ihre Kameraden in den Lagern von der Wehrmacht wie Ungeziefer vernichtet wurden. Sollte man von solchen Menschen erwarten, daß sie nicht in Zorn und Rache diesen Boden betraten, von dem dieser Krieg ausging? Auch hier verwechselt man gerne Ursache und Wirkung.
Und dennoch und trotz allem hat die einmarschierende Rote Armee nicht Gleiches mit Gleichem vergolten. Das ist leicht nachzurechnen. Denn hätten die Sowjets auch ihrerseits über 28 Millionen Deutsche umgebracht – was wäre da noch vom Rest-Reich geblieben? Von der damals sowjetisch besetzten Zone wäre auf jeden Fall nichts mehr geblieben. Und viele von uns würden heute nicht mehr leben.
Leicht kommt uns von den Lippen, daß die Alliierten Hitler besiegt hätten. Sie landeten in der Normandie aber erst am 6. Juni 1944, eineinhalb Jahre nachdem die Rote Armee die deutsche Wehrmacht in Stalingrad endgültig geschlagen hatte. Sie griffen erst ein, als längst feststand, daß die Rote Armee Hitler in die Knie zwang. Die Rote Armee hat uns vom deutschen Faschismus befreit, und nicht die Alliierten. Und das schaffte die Rote Armee nicht wegen, sondern trotz Stalin. Dennoch feiern wir immer noch die Alliierten als unsere »Befreier«.
Ich habe meinen Vater oft gefragt: Was hast du gemacht im Krieg, und nichts erfahren. Er war Polizist und mit einem Polizeibataillon in Polen, in Serbien, in Griechenland und Holland eingesetzt. Ich wußte, daß er beteiligt war am »Bandenkampf«, bei Unternehmungen gegen Partisanen, bei »Befriedungsaktionen«, bei »Säuberungsaktionen« in Dörfern und Gettos. Ich habe ihn oft gefragt, was sie denn mit diesen Menschen gemacht haben. Achselzucken oder ausführliche Erzählungen mit belanglosen Daten, Uhrzeiten, Kompaniezusammenstellungen, gespickt mit Dienstgradbezeichnungen. Meine Ahnung wuchs. Und damit ein unbehagliches Gefühl. Besonders wenn er von seinen »Kameraden« sprach. Mein Vater war kein Nazi. Aber er hat auch nichts gegen sie getan. Er war kein Faschist. Aber auch kein Antifaschist. Daß meine Eltern die NSDAP wählten, war ihnen selbstverständlich. Es ging ihnen doch gut, bis ’39. Sie haben auch nicht »Mein Kampf« gelesen, obwohl das Buch in der Vitrine stand.
Vier meiner Onkel waren an der Ostfront. Drei kehrten zurück. Oft hatte ich sie gefragt: Was habt ihr da eigentlich gemacht? Konkret. Die Antworten: Es war eben Krieg. Wir haben nur unsere Befehle ausgeführt. Das war eben so. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Auch Menschen. Der vierte Onkel ist bei Charkov begraben. Er hatte sich freiwillig gemeldet. Oder sie erzählten penibel genau, wann sie mit welcher Einheit und mit wieviel Mann um wieviel Uhr wohin transportiert wurden, wo sie dann mit welcher Einheit zusammengelegt wurden und wann wo das russische Feuer begann und mit wieviel Geschützen mit wieviel Millimeter sie das Feuer erwiderten. So ein Gedächtnis! Aber keiner kann sich erinnern, jemals einen Russen oder eine russische Familie erschossen zu haben. Zahlen, hinter denen sie verstecken, was sie wirklich trieben.
Einer dieser Onkel war bei der OT, der Organisation Todt. Bei Stalino. Er hat »nur Straßen gebaut«, sagt er. Die Organisation Todt hat in den besetzten Gebieten der Sowjetunion aber auch Konzentrationslager gebaut und die Zivilbevölkerung zu Schanzarbeiten angetrieben und sie niedergeschossen, wenn sie vor Erschöpfung umfielen. Und sie hat Juden in Gettos erschossen. Davon wußte er nichts.
Der andere Onkel war Fallschirmspringer. Für welche Einsätze? Das hatte er vergessen. Und der dritte war bei den Stukas, den Sturzkampffliegern. Er wurde abgeschossen. Und wenn er mal erzählte, schimpfte er über die russischen Partisanen, weil sie sich verteidigt haben. Sie alle und meine Eltern sprechen heute noch vom 8. Mai 1945 als Tag der Niederlage, des Zusammenbruchs, der Kapitulation, und nicht als Tag der Befreiung. Nein, wirkliche Nazis waren sie alle nicht … Warum wurde in der Bundesrepublik der 8. Mai nicht als Nationalfeiertag festgelegt?
Mit meiner Fragerei hatte ich mich in meinem Verwandtenkreis allmählich unbeliebt gemacht. Zumal ich ein Rundfunkfeature für den Sender Freies Berlin über dieses Thema schreiben wollte. Aussagen von Familienangehörigen auch noch veröffentlichen? Da sprach man mit mir erst recht nicht mehr über dieses Thema.
Mehr Ehrlichkeit erhoffte ich mir darauf von Fremden. So gab ich in mehreren Tageszeitungen eine Anzeige auf: »Rußlandfeldzug! Suche ehemalige Wehrmachtssoldaten …« Zwei Wochen lang klingelte das Telefon. 35 ehemalige Wehrmachtssoldaten wollten mir berichten, wie es wirklich war. Ich habe alle besucht, habe ihre Erzählungen auf Kassette aufgenommen.
Sie jammerten über die kalten Winter. Haben die sowjetischen Soldaten nicht gefroren? Sie klagten über den Schlamm, über die schrecklichen Strapazen, über den Hunger. Hatten sich nicht viele von ihnen freiwillig an die Front gemeldet? Und die Sowjets, die ihr Land verteidigten, haben die nicht auch gelitten? Sie schimpften über die Unfähigkeit ihrer Befehlshaber, ihrer Generäle, über deren strategische und taktische Fehlentscheidungen. Sonst hätte man den Bolschewismus natürlich schnell besiegt. Man hätte alles ganz anders machen müssen. Aber auf sie als einfache Soldaten hörte ja keiner. Sie erzählten mir, wie sie es gemacht hätten und wie dann der Russe leicht vernichtet worden wäre.
Und dann schwärmten sie, wie freundlich sie von den russischen Familien aufgenommen wurden, wie diese alles für sie hergegeben haben, wie herzlich ihr Zusammenleben war, als wären die Deutschen dort alle auf Urlaub gewesen. Sie schwadronierten, daß den Russen das Sterben nicht viel ausmachte, daß die eben eine andere Einstellung zum Tod hätten, eine asiatische.
Ich fragte, ob sie auch beteiligt waren am Niederbrennen der Dörfer. Nein, das waren immer andere. Man habe wohl ab und zu von weitem ein Bauernhaus brennen sehen. Und außerdem hätten die Russen ihre Häuser immer selbst angesteckt.
Ich fragte, ob sie an Massenerschießungen beteiligt waren. Nein, um Gottes willen, das war die SS. Wohl habe man so hin und wieder gehört, daß bei einer anderen Einheit »so etwas« vorgekommen sei.
Ich fragte, ob sie mitgeholfen hätten, Gettos zu errichten und zu bewachen. Auch da waren alle gerade Essen holen oder im Lazarett. Auch geplündert haben sie nicht. »Requiriert« ja, aber nicht geplündert. Und jedes Huhn, jedes Schwein und jede Kuh, die sie aus den Ställen der Bauern holten, haben sie bezahlt. Natürlich. Die Russen hätten dabei sogar noch ein gutes Geschäft gemacht.
Doch als ich meinen Recorder eingepackt hatte und in der Tür stand und mich verabschiedete, da rutschte manchem noch ein Satz heraus, den er lächelnd zu beschönigen versuchte. Naja, ganz so brav waren wir natürlich nicht. Aber was willste machen.
Von den 35 ehemaligen Wehrmachtssoldaten haben sich drei zu ihren Verbrechen bekannt. Haben ihre Schuld eingesehen, es tat ihnen leid. Sie würden gerne wieder in die Sowjetunion fahren, als Touristen das Land wiedersehen und jene Sowjetbürger, denen sie damals als Feinde gegenüberstanden. So sprachen drei von 35 ehemaligen Soldaten.
Darauf gab ich eine Anzeige in Tageszeitungen auf mit dem Text: »Überfall auf die Sowjetunion! Welcher ehemalige Soldat erzählt mir über die Verbrechen der deutschen Wehrmacht und der Polizei …« Kein einziger Anruf. Doch, ein Anruf kam: Eine wütende Stimme beschimpfte mich als Schmutzfink, als Kommunistensau, ob ich denn überhaupt Deutscher sei und ich solle mich vorsehen, sonst würde man mit mir noch abrechnen. Das Ganze natürlich, ohne seinen Namen zu nennen.
Ich besorge mir Literatur über dieses Thema. Ich gehe in Bibliotheken. Da steht in mehreren Exemplaren Paul Carell, »Unternehmen Barbarossa«, und daneben mit Farbfotos Carells »Unternehmen Barbarossa im Bild«. Ich blättere in den Bänden und sehe die Bilder mit den Soldaten an den Geschützen und lese die Bildunterschrift: »Die Werferbatterien jagten ihre mächtigen Geschosse in schneller Folge aus den Rohren. Mit glühendem Feuerschweif heulten die Raketen über die Front.« Natürlich hatten die Deutschen damals keine Raketen. Und: »Das deutsche 8,8-cm-Flakgeschütz war der Panzerschreck der Russen.« Ich sehe die Panzerkolonnen und lese: »Die Schlacht rollt. Deutsche Panzer preschen in Feuerstellung.« Ich sehe die brennenden Dörfer und lese: »Und weiter stürmen die Panzer nach Osten.« Und dann immer diese lachenden Soldaten mit ihren hochgekrempelten Hemdsärmeln und die MP in der Faust. Unrasierte, verschwitzte, aber immer heldenhafte Gesichter. Und ihre Panzer stürmen voran, daß die Steppe nur so staubt. Fröhliche Umarmungen mit Russen, die ihnen Fleisch und Eier anbieten. Ein deutscher Soldat, der vor einem Russenkind kniet und ihm Bonbons anbietet. Bilder für die deutschen Wochenschauen. Und dann die frierenden Landser im Schneefeld mit der Unterschrift: »Der russische Winter hat der deutschen Offensive gegen Moskau das Rückgrat gebrochen!« War es nur der Winter? Und nicht die Rote Armee, die Partisanen, die zivilen Widerstandskämpfer in den Städten?
Aber in diesem »Standard-Informationswerk« von Carell kein einziges Bild von Zivilisten, die am Galgen hängen, von Massenerschießungen und Massengräbern, von Gettos, von Kriegsgefangenenlagern, von Gaswagen … So etwas hat es nach Paul Carell nicht gegeben. Das ist auch kein Wunder, wenn man weiß, daß Paul Carell in Wirklichkeit Paul Karl Schmidt hieß und der Pressechef des Nazi-Außenministers Ribbentrop war.
In einem dieser Bände sehe ich immerhin die Fotografie eines russischen Kriegsgefangenen: das Gesicht ausgemergelt von Hunger und Zwangsarbeit, ein knöchriger, geschorener Schädel mit Augen im Tran, schon halb zum Tod hinüber – Bilder, wie wir sie von Auschwitz-Häftlingen kennen. Das einzige Bild von einem Opfer dieses »Rußlandfeldzuges«. Und darunter steht von einem Leser mit blauem Kugelschreiber gekrakelt: »Langhaariger Penner.«
Ich sehe von Konsalik »Die Rollbahn«, lese ein paar Zeilen und stelle es wieder ins Regal. Ich finde das 1982 von Erich Mende veröffentlichte Buch »Das verdammte Gewissen«, ein Buch von Alfred Dregger und die Erinnerungen von Adolf Heusinger, dem Chef der Operationsabteilung im Generalstab des Heeres in der UdSSR. Heusinger war nach 1945 Mitbegründer und Generalinspekteur der Bundeswehr sowie Vorsitzender des Ständigen Militärausschusses der NATO in Washington. In allen finde ich viel Selbstlob und »schicksalhafte Verstrickung«, aber kein Wort der Anerkennung und Übernahme von Schuld. Aus den Tätern war also nichts herauszubekommen, von den Vätern nichts zu erfahren.
Ich sehe im Regal »Sonderakte Barbarossa – Dokumente« aus sowjetischer Sicht von Lew Besymenski, dem Moskauer Historiker, schlage auf und lese innen auf dem Titelblatt mit Kugelschreiber geschmiert: »Übles bolschewistisches Machwerk! Hier wird gelogen, verschwiegen, entstellt und verschönt. Fazit: Nicht lesbar!« Und ich finde von demselben Autor »Die Schlacht um Moskau 1941«, ein Buch, das sich ebenfalls auf sowjetische Dokumente stützt. Froh darüber, endlich einmal eine Schilderung aus der Sicht der Opfer in der Hand zu haben, leihe ich die beiden Bücher aus. Der Bibliothekar, ein junger Mann, blättert darin herum und sagt dann: »Und Sie glauben, das stimmt?«
Schon lange vorher, aber nun erst recht, war mir klar, daß es nur einen Weg gab, um zu erfahren, was von 1941 bis 1944 zum Beispiel nur im »Operationsraum« der Heeresgruppe Mitte von Brest am Bug bis kurz vor Moskau geschah: nämlich diese Strecke selbst nachzufahren und dort die Überlebenden aus dieser Zeit erzählen zu lassen. Wenn die Täter schweigen, so werden die Opfer berichten.
Es gab die Heeresgruppe Nord mit ihrer Stoßrichtung auf Leningrad, die Heeresgruppe Süd, die auf die südlichen Sowjetrepubliken angesetzt war, und die Heeresgruppe Mitte, die mir wegen ihrer zentralen Lage und Stoßrichtung auf Moskau beispielhaft für diesen Vernichtungskrieg war, der unter dem Code »Unternehmen Barbarossa« lange vorbereitet wurde. Von Brest bis Moskau also sollte die Reise gehen. Vom Sender Freies Berlin erhielt ich den Auftrag für ein Rundfunkfeature über dieses Thema und damit von ihm auch die Reisekosten. »Steh auf! Es ist Krieg!« hieß dann später das Feature, das fast alle Rundfunkanstalten gesendet haben.
Wie diese Reise verlief
Nachdem ich mich in Fachliteratur (siehe im Anhang das Literaturverzeichnis) – darunter die Kriegstagebücher des Oberkommandos der Wehrmacht und die Ereignismeldungen UdSSR der Einsatzgruppen – eingelesen hatte, stellte ich eine Route von Städten, Dörfern und Orten zwischen Brest und Moskau zusammen, die ich besuchen wollte, und ging damit zum Westberliner Büro der sowjetischen Presseagentur APN/Nowosti. Dort übermittelte man meine Wünsche und Pläne der Moskauer Zentrale. Man war mit meiner Wunschroute einverstanden und schlug noch zusätzlich andere Orte vor, die ich noch nicht kannte. APN/Nowosti in Moskau telefonierte in den einzelnen Städten mit den Redakteuren der Kreiszeitungen und mit den Bürgermeistern, die mich dann ortskundig betreuen, mich mit Informationen versorgen, mich zu den einzelnen Stätten führen und überlebende Gesprächspartner für mich ausfindig machen sollten. Fahrer wurden bereitgestellt, Hotelzimmer reserviert. Und es wurde für mich ein Dolmetscher in Moskau ausgewählt, der nicht nur einfach übersetzte, sondern selbst Journalist ist und sich für dieses Thema interessierte. So entstand ein Programm für sechs Wochen, auf die Stunde genau ausgetüftelt, mit Ankunfts- und Abfahrzeiten in jeder Stadt, in jedem Dorf.
Belorußland hat neben den baltischen Republiken in diesem Krieg am meisten leiden müssen. Belorußland hatte 2,2 Millionen Tote zu beklagen. In dieser Republik kam jeder vierte Bewohner ums Leben. In Weißrußland, das die Nazis »Weißruthenien« nannten, wurden 209 Städte und 9200 Dörfer (davon 628 Dörfer mitsamt den Bewohnern) vernichtet. Es gab dort 70 Gettos und 60 große Lager, in denen Kriegsgefangene und Zivilisten systematisch durch Erfrieren, Verhungern, Erschießungen, durch bewußt herbeigeführte Epidemien dem Tode ausgeliefert wurden. 1,4 Millionen Menschen sind allein in Weißrußland in diesen Lagern umgekommen. Die Industriekapazität dieser Republik wurde zu 96 % zerstört.
Als ich über 40 Jahre nach Ende dieses Krieges im September 1985 losfuhr, fragte ich mich auch: Wie würde ich in einem solchen Land empfangen werden? Meine Gesprächspartner traf ich in den Räumen der Kulturhäuser. Jede Siedlung hat ein solches Kulturhaus. Hier finden Versammlungen statt, Konzerte, Vorträge, Theateraufführungen, Filmvorführungen, hier ist auch oft die Bibliothek untergebracht. Ich traf sie in Sitzungsräumen von Rathäusern, von Gemeindeverwaltungen oder in Redaktionsräumen von Kreiszeitungen, in Büros von Kolchosen und Sowchosen oder in Heimatmuseen mit Räumen, in denen Erinnerungsstücke aus dem Krieg ausgestellt werden. Jedes kleine Dorf hat ein solches »Kriegsmuseum«. Hier sind die Gegenstände versammelt, die man in der jeweiligen Umgebung fand: Granatenhülsen, ein Stück eines abgeschossenen Bombers, Geschützteile, durchschossene Stahlhelme, Uniformteile, zerfetzte Armeebücher, Briefe, Karten. Dazu Schaubilder und Galerien von eingerahmten Porträts von Generälen, Partisanen, Zivilisten – Verteidiger des jeweiligen Ortes.
Bei jedem Treffen waren 10 oder 20 alte Menschen versammelt, die der jeweilige Bürgermeister oder Zeitungsredakteur aus dem Ort selbst oder aus der Umgebung gebeten hatte zu kommen: ehemalige Partisanen, Widerstandskämpferinnen, Rotarmisten, Menschen, die von Massenerschießungen fliehen konnten oder zusammen mit anderen in brennenden Scheunen eingeschlossen waren und ausbrechen konnten, die aus KZs und Kriegsgefangenenlagern flüchten konnten oder dort irgendwie überlebten. Fast alle hatten ihre ganze Familie verloren und sind nun die letzten Zeugen von Vernichtungsaktionen.
Ich saß Invaliden gegenüber, denen man ein Bein oder einen Arm amputiert hatte, die blind waren oder gelähmt durch eine deutsche Kugel. Am Anfang betrachteten sie mich skeptisch, stellten kritische Fragen an mich. Immerhin war ich – ausgenommen die großen Städte – in Dreiviertel des Gebietes nach Kriegsende der erste Westdeutsche (oder gar Deutsche überhaupt), der diese Menschen besuchte und sie nach ihren Erlebnissen damals fragte. Doch bald verlor sich ihre Scheu, sie gewannen Vertrauen.
Viele sprechen zu Beginn nur stockend. Sie haben Angst vor der Erinnerung. Doch dann bricht ihr Schmerz mit einem Mal wieder hervor. Ihre Sätze ersticken in Tränen, sie können nicht mehr weitersprechen, entschuldigen sich. Andere beginnen gleich bei den ersten Sätzen zu weinen, stoßen ihre erlebten Leiden hervor, als sei es gestern gewesen. Das Entsetzen tritt ihnen wieder aus den Augen. Sie gehen aus dem Raum, beruhigen sich und kommen wieder. Sie dachten, es sei alles vergessen. Doch wenn sie nun berichten, steht wieder alles vor ihnen. Sie werden von ihren Erinnerungen überwältigt. Alte Männer wischen sich heimlich Tränen aus den Augen. Ich habe niemanden erlebt, der beim Erzählen seiner Geschichte ruhig bleiben konnte.
Viele geben mir einen Brief, in dem sie am Tag zuvor alles aufgeschrieben hatten, weil sie Angst hatten vor dieser Begegnung. Sie holen Fotos aus ihren Handtaschen, zeigen mir ihre Familienangehörigen, die von den Deutschen umgebracht wurden. Oder in den Museen zeigen sie auf die Porträts: »Das war mein Mann. – Das war meine Schwester. – Das war mein Sohn. – Meine Mutter. Mein Vater. Meine Tochter …«
Während all dieser Zeit höre ich kein böses Wort mir gegenüber, keinen Vorwurf. Immer wieder unterscheiden sie zwischen den Faschisten und den Deutschen. Sie betonen, daß es auch gute Deutsche hier gab, vereinzelt. Die ihnen eine Zigarette zugesteckt hatten, die von ihrer Familie zu Hause erzählten, die ihnen in einigen Fällen sogar das Leben gerettet hatten, sie vor den Faschisten retteten.
Und sie unterscheiden immer wieder zwischen der Generation damals und der bundesrepublikanischen Jugend heute. Daß diese Menschen nach all ihren Erlebnissen noch so differenzieren – das hat mich oft beschämt. Kein Wort der Rache. Wohl aber Trauer und Schmerz. Und kopfschüttelndes Unverständnis darüber, daß bei uns in der Bundesrepublik noch heute so viele Massenmörder nicht zur Rechenschaft gezogen wurden und frei herumlaufen. Von den immer noch unterlassenen Wiedergutmachungszahlungen an die deportierten Zwangsarbeiter reden sie erst gar nicht, winken mit der Hand resigniert ab, aussichtslos.
Und ein anderer Punkt taucht immer wieder in unseren Gesprächen auf: die Stationierung der Pershing II auf bundesdeutschem Boden. 1985 ist die Stationierung dieser Mittelstreckenraketen in vollem Gang. Die Sowjets haben wieder Angst vor uns. Sie können nicht verstehen, daß nach zwei Angriffen auf ihr Land nun die Westdeutschen dem US-Militär erlauben, auf ihrem Boden jene Pershing II aufzustellen und damit für einen dritten Angriff rüsten.
Wenn ich mich verabschiede, schenken sie mir Bücher über die neuerrichtete Stadt, über das notdürftig wiederaufgebaute Dorf. Man schenkt mir Holzschnitzereien, Fotos, Souvenirs, Anstecknadeln. Und immer wieder packt man mir das in der Schale liegengebliebene Obst und Gebäck ein als Proviant für unterwegs. Sie verabschieden mich, als würde ich zur Familie gehören, und laden mich ein, doch bald wiederzukommen. Und immer wieder dieser Satz: »Grüßen Sie das deutsche Volk und sagen Sie, wir möchten in Frieden miteinander leben.«
Alte Frauen, alte Männer, deren gesamte Familie erschossen, vergast, verbrannt wurde und die als letzte Zeugen dieser Vernichtungsaktionen überlebt haben, führen mich zu diesen Massengräbern: »Hier war es.« Gruben, die man an der nachgesackten Erde erkennt. Davor ein kleiner Obelisk als Gedenkstein mitten in der Landschaft. Auch bei dieser direkten Konfrontation an den Vernichtungsstätten kein Vorwurf mir gegenüber. Nur ihr Bedauern: »Warum kommen Sie erst jetzt?« Ja, das frage ich mich auch. Warum komme ich erst jetzt? Warum habe ich nicht schon vor 20 Jahren diese Erkundung unternommen? Ich wußte doch auch damals schon in Umrissen, was hier geschehen war. Ich rechne zurück: Das wäre 1965 gewesen. Die Bundesrepublik hatte damals gerade die Adenauer-Ära hinter sich. Ludwig Erhard war Bundeskanzler. Dann kam Kiesinger. Animierte diese Zeit mit ihrem Antikommunismus zu einer Reise in die Sowjetunion, die immer noch als Feindbild herhalten mußte?
Meine Gastgeber meinen aber mit ihrer Frage, daß ich früher noch mehr lebende Augenzeugen hätte antreffen und befragen können. So viele sind inzwischen gestorben. Und es ist abzusehen, wann der letzte Augenzeuge aus jener Zeit nicht mehr leben wird. »Nun gut«, sagen sie, »es ist besser, Sie kommen so spät als gar nicht.«
Bei meiner Reise durch das westliche Belorußland (das frühere östliche Polen) von Brest bis kurz vor Minsk muß ich mir immer wieder vor Augen halten, daß über diese Menschen, die hier nun vor mir sitzen, zweimal die Mordlawine hinweggegangen ist. Am 17. September 1939 vom Osten her Stalins Rote Armee und am 22. Juni 1941 vom Westen her die deutschen Truppen. Damals, 1985, erstarrten meine Gesprächspartner, wenn ich sie bat, auch etwas über den Überfall Stalins auf dieses Gebiet zu berichten, und mein Dolmetscher Slawa wurde nervös. Sie schwiegen verlegen. Heute würden sie sicher freier darüber sprechen.
Am 23. August 1939 unterzeichneten die Außenminister Ribbentrop und Molotov einen »Nichtangriffsvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion« und ein »Geheimes Zusatzprotokoll«, in dem sich Hitler und Stalin Polen je ungefähr zur Hälfte in »Interessenssphären« aufteilten[1]. Eine Woche darauf, am 1. September 1939, überfielen die deutschen Truppen Polen (Stalin schickte Hitler ein Glückwunschtelegramm zur erfolgreichen Einnahme von Warschau), und am 17. September 1939 rückte die Rote Armee in das östliche Polen ein. Wie verabredet trafen sich die beiden Armeen an der »Interessensgrenze« in der Mitte Polens. Deutsche und russische Generäle schüttelten sich freundschaftlich die Hände, feierten zusammen bei Sekt ihren Einmarsch, prosteten sich auf die Zukunft zu und hielten am 22. September 1939 in Brest-Litowsk sogar eine gemeinsame Truppenparade ab.
Elf Tage nach dem Einmarsch der Roten Armee in Ostpolen schlossen Hitler und Stalin am 28. September 1939 neue Abkommen: einen »Deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag« nebst zwei »Geheimen Zusatzprotokollen« und einem »Vertraulichen Protokoll« und eine »Erklärung der Deutschen Reichsregierung und der Regierung der UdSSR« – alle unterzeichnet von Ribbentrop und Molotov.
In diesem »Grenz- und Freundschaftsvertrag« und in einem der beiden »Geheimen Zusatzprotokolle« vom 28. September 1939 wurde die gemeinsame Grenzlinie »rektifiziert«: In der nördlichen Hälfte Polens gab Hitler den Sowjets besetztes Land ab, dafür ließen die Sowjets die deutsche Wehrmacht im Süden weiter vorrücken. In der Mitte Polens wurde als gemeinsame Grenze der Bug bei Brest-Litowsk festgelegt[2].
Auch Stalin hatte mit Polen einen sowjetisch-polnischen Nichtangriffspakt geschlossen. Das war 1932. Nun war er in Ostpolen unter dem Vorwand einmarschiert, die dort lebende weißrussische und ukrainische Bevölkerung zu schützen. Tatsächlich lebten in dem von der UdSSR besetzten Gebiet Ostpolens etwa acht Millionen Weißrussen und Ukrainer und nur ca. fünf Millionen Polen. Rote Armee, der Geheimdienst NKWD und die Geheimpolizei GPU liquidierten, wie Hitler es zuvor in Westpolen und später in der Sowjetunion tat, die Verwaltung und die Intelligenz. 300000 Polen gerieten in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Davon überlebten nur 82000. Chatyn bei Smolensk, wo die deutschen Besatzer später 4500 der insgesamt 15000 ermordeten polnischen Offiziere in einem Massengrab fanden, ist bekannt. Doch unbekannt sind die Lager Starobielsk und Ostaschkov, in denen fast alle 10000 Gefangenen ermordet wurden. Während der 21 Monate dauernden Besatzung, vom 17. September 1939 bis zum 22. Juni 1941, bis die Sowjets selbst von der deutschen Wehrmacht überfallen wurden, ließ Stalin von den insgesamt 13 Millionen Bewohnern Ostpolens etwa 1250000 Menschen nach Sibirien und Kasachstan deportieren. Das sind knapp 10 Prozent der gesamten örtlichen Bevölkerung. Von diesen Deportierten kamen ca. 40 Prozent in den Gulags ums Leben[3]. Doch nicht die Verbrechen Stalins, sondern die Verbrechen der deutschen Wehrmacht, der deutschen Polizei und der Einsatzgruppen sind der Inhalt meines Buches.
Nach dieser Reise im September 1985 fuhr ich noch mehrmals in die Sowjetunion, um gezielt an bestimmten Orten über Verbrechen nachzufragen. Bei alldem ging es mir nicht – wie in den meisten anderen Darstellungen – um Schlachtbeschreibungen, welche Division wann aus welcher Richtung kam. In diesen üblichen strategisch-taktischen Schilderungen wie zum Beispiel bei allen Büchern von Werner Haupt, den ich bewußt nicht in mein Literaturverzeichnis aufnahm, fällt auf, daß darin außer den deutschen »Helden« nie Menschen vorkommen. Man könnte meinen, es handele sich hier um menschenlose Regimenter und Bataillone, um menschenleere Landschaften und Städte. Und natürlich kommen in diesen »realistischen« Darstellungen erst recht keine abgeschlachteten Opfer vor. Will man damit der Schuld entgehen?
Ich will umgekehrt nur von Menschen erzählen. Kriegsleiden von unten gesehen. Aus der Sicht der Opfer. Und diese überlebenden Opfer erzählen natürlich nicht »wissenschaftlich«. Wenn sie »Soldaten« sagen, dann meinen sie nicht unbedingt damit die Wehrmacht. Sie meinen einfach Uniformierte. Das können SD-Beamte sein oder Schutzpolizisten, russische Hilfswillige oder Rumänen. Als diese Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen geholt, auf dem Marktplatz zusammengetrieben und auf Lkws geladen wurden, da fragten sie nicht, welche Einheit sie zum Tode karrte. Sicherheitspolizei, Waffen-SS, allgemeine SS, Wehrmacht, Organisation Todt, Schutzpolizei, Gendarmerie – für die Opfer waren dies alles »Soldaten«. Sie sprechen von »deutschen Truppen«, von »Faschisten«, von »Hitler-Leuten«. Man kann hier keine genaue militärische Bezeichnung erwarten, keine exakten Termini. Diese Menschen kämpften um ihr Überleben und waren froh, wenn sie wieder mal für einen Tag davongekommen sind. Erst später, im nachhinein und erst recht nach Kriegsende, als Berichte erschienen, haben einzelne diese Truppenteile unterschieden.
So verhält es sich auch mit den Zahlenangaben. Als deutsche Truppen ein Dorf niederbrannten, wußten die Bewohner natürlich nicht, wie viele Menschen jetzt in dieser Scheune zusammengepfercht waren, wie groß das Ausmaß der Vernichtung war. Kriegsgefangene wußten natürlich nicht, wie viele Gefangene in diesem Moment in diesem Lager hausten, wie viele jeden Tag erschossen wurden. Erst später erfuhren sie diese Zahlen, lasen sie nach Kriegsende in den Zeitungen. Wobei sich die Sowjetische Außerordentliche Staatliche Untersuchungskommission auch selbst meistens nur auf Schätzungen stützen konnte, die allerdings im großen und ganzen zutrafen.
Wenn die Augenzeugen in diesem Buch an vieles noch eine so genaue Erinnerung haben, so können sie natürlich nach über 40 Jahren nicht mehr unterscheiden, ob sie sich nun an selbst Erlebtes erinnern oder darüber gelesen oder gehört haben. Nach so vielen Jahrzehnten vermischt sich zwangsläufig persönlich Erlebtes mit Berichten von anderen. Das bedeutet jedoch keineswegs, daß ihre Aussagen im geringsten in Frage zu stellen sind. Sie dürfen nur nicht als wissenschaftliches Material angesehen werden, sondern als Erfahrung, die in diesen Menschen bis heute lebendig geblieben ist.
Oft erlebe ich, daß bei Nennung der deutschen Verbrechen bei uns sofort mit den Verbrechen Stalins gekontert wird. Als wäre die Schuld des einen durch die Schuld des anderen aufgehoben. Nie würde man auf den Gedanken kommen, einen Mörder freizusprechen, nur weil ein anderer auch gemordet hat. Dieses Zeigen auf den anderen macht deutlich, wie sehr man bemüht ist, von der eigenen Schuld abzulenken oder sie zu verharmlosen. Unerträglich ist dabei, wenn man aufrechnet, daß Stalin ca. 50 Millionen Sowjetbürger umbringen ließ und Hitler »nur« 28 Millionen. Solange bei uns immer noch nicht die »Ereignismeldungen UdSSR« jener Killerkommandos, genannt Einsatzgruppen, veröffentlicht sind, haben wir kein Recht, auf andere zu zeigen. Diese »Ereignismeldungen UdSSR« belegen nämlich, daß die Mehrheit der »anständigen« und »ehrenhaften« Soldaten und der deutschen Polizei genauso aktiv an Massenmorden beteiligt waren wie die SS und die Waffen-SS. Solange bei uns immer noch Gerichtsverfahren gegen nachgewiesene Kriegsverbrecher »mangels hinreichenden Tatverdachts« eingestellt werden, haben wir kein Recht, mit dem Finger auf die sowjetischen Kollaborateure zu zeigen, auf die lettischen, weißrussischen und ukrainischen Hilfswilligen. Dieses Thema ist ein innersowjetisches Problem. Es ist nicht das Thema meines Buches.
In einer Zeit, in der ein Arzt gerichtlich verfolgt, demagogisch diffamiert und sogar mit dem Tode bedroht wird, nur weil er die Selbstverständlichkeit ausspricht, daß Soldaten »potentielle Mörder« sind, in dieser Zeit darf anstandslos das Buch des ehemaligen Kommandeurs der 6. Infanterie-Division, Horst Großmann, vertrieben werden, in dem er schreibt: »Lob und Dank verdienen alle Waffengattungen …« Seine Division hat auch mit dazu beigetragen, daß in Rschew von den 60000 Einwohnern nach der deutschen Okkupation nur noch 362 Menschen lebten. Weiter Großmann in seinem Buch: »So verlassen die Rschew-Kämpfer unbesiegt einen Frontabschnitt, dessen Name allein für sie Inbegriff soldatischer Bewährung bleibt und auch in Zukunft Ansporn zu voller Einsatzbereitschaft sein wird.« Das schrieb Großmann 1963. Was meint er denn mit »in Zukunft … volle Einsatzbereitschaft?« Über diese Verherrlichung des Krieges und über diesen Aufruf zum Massenmord regten sich keine Bundeswehrsoldaten auf, da fühlten sie sich nicht »in ihrer Ehre beleidigt«, und kein Verteidigungsminister sah darin einen Grund zur Klage wegen Volksverhetzung. Und dann schreibt Großmann in seinem Buch: »Unmenschliches leistete der deutsche Soldat.« Da hat er recht. Das ist wahr. Treffender hätte er es gar nicht formulieren können.
Ich dagegen danke meinen russischen Freunden Sergej Guk, Valerij Golubzov und Borislaw Petschnikow. Sergej Guk hat als damaliger Leiter des Westberliner APN/Nowosti-Büros meine Reise schwungvoll in die Wege geleitet. Valerij Golubzov organisierte von Moskau aus in unzähligen Telefongesprächen den konkreten Verlauf der Reise, und Borislaw Petschnikow machte als Dolmetscher vieles Unmögliche möglich. Diese Troika warf sich für mich ins Geschirr und tat alles, damit ich dieses Buch schreiben konnte. Diesen dreien meinen freundschaftlichen Dank!
Die Reise
»22. Juni 1941 (Sonntag)
… Neue Fanfaren ausprobiert … Aber die Lißtfanfare bleibt doch die beste … schwülere Atmosphäre. Nun wartet aber die ganze Welt auf das reinigende Gewitter … Um 330h beginnt der Angriff. 160 komplette Divisionen. 3000 km lange Angriffslinie. Alles steht gut. Größter Aufmarsch der Weltgeschichte. Der Führer ist von einem Albdruck befreit, je näher die Entscheidung kommt … Er taut direkt auf. (Alle) Müdigkeit scheint von ihm gewichen … Dieses Krebsgeschwür muß ausgebrannt werden. Stalin wird fallen … 330h. Nun donnern die Geschütze. Gott segne unsere Waffen! Draußen auf dem Wilhelmplatz ist alles still und leer. Berlin schläft, das Reich schläft … Ich gehe ruhelos im Zimmer auf und ab. Der Atem der Geschichte ist hörbar. Große, wunderbare Zeit, in der ein neues Reich geboren wird. Unter Schmerzen zwar, aber es steigt empor zum Licht. Die neue Fanfare ertönt. Machtvoll, brausend und majestätisch. Ich verlese über alle Sender die Proklamation des Führers an das deutsche Volk. Auch für mich ein feierlicher Augenblick … Ich fühle mich ganz frei … Dann fahre ich nach Schwanenwerder. Die Sonne steht schon groß und schön am Himmel. Im Garten draußen zwitschern die Vögel. Ich falle ins Bett. Und schlafe 2 Stunden einen tiefen, gesunden Schlaf.«
Joseph Goebbels, Tagebücher[4]
An einem 24. Juni hatte Napoleon 1812 die Memel überschritten und damit seinen Überfall auf Rußland begonnen. Die Tage vom 22. bis 24. Juni sind die längsten im Jahr. Da ist es am längsten hell. Das heißt, an diesen Tagen können Soldaten am weitesten marschieren, die Panzer am weitesten fahren und die Flugzeuge am längsten bombardieren.
Brest
Brest (polnisch: Brześć nad Bugiem) (BB360°).
Geb. Brest.
54200 Einw. (1937).
(4615 Wohngebäude, 1931).
Gebietshauptstadt und Festung am rechten Ufer des Bug, an der Mündung des Muchawez (Muchawiec). Wichtiger Eisenbahnknotenpunkt der Bahnen von Warschau, Moskau, Belostok, Baranowitschi, Kowel und Chelm. Straßenknotenpunkt der Straßen von Warschau (195 km), Chelm (152 km), Luzk (206 km) und Ssluzk. – Die Stadt ist bekannt durch die Friedensverhandlungen zwischen Rußland und den Mittelmächten im Nov./Dez. 1917. – Wehrwichtige und militärische Anlagen: 3 Krankenhäuser, ehemaliges polnisches Lazarett, 38 Schulen, El.-W. (928 kW), El.-W. der Eisenbahn (244 kW), Wasserturm, Wasserleitung, Kanalisation, Post-, Fernsprech- und Telegraphenamt, Großgarage, Hauptbahnhof (1,5 km lang, bis zu 7 Ausweichgleisen breit) mit Wasserturm, Bahnhof Brest II mit großen Lagerhäusern und Wasserturm, Bahnhof Brest IV (2 km lang, bis zu 12 Ausweichgleisen breit) mit Wasserturm, Lagerhäusern und Rampen, Bahnhof Brest-Podleskij mit Wasserturm; 2 Bahnbrücken über den Muchawez, Straßenbrücke über den Bug, großes Lagerhaus mit Gleisanschluß, Öl- und Benzinniederlage, Feuerwehrdepot, Schlachthof; ehemalige polnische Artillerie- und Pionierkaserne, Panzerwagenkaserne, 2 Infanteriekasernen; erweiterter Fortgürtel, große alte Kernfestung, 2 Munitionsdepots, Flugplatz (Schuppen, Kaserne, Gleisanschluß, FT- und meteorologische Station, unterirdisches Munitionsdepot), Truppenübungsplatz. – Industrie: Metallwarenfabriken, Lederverarbeitung, Ölfabrik, Holzindustrie, Musikinstrumentenfabrik, 4 Dampfsägewerke, Sägewerke, viele Ziegeleien, Kerzen-, Tabak-, Grütze- u.Likörfabrik, Brauereien, Mühlen, darunter 3 Motormühlen[5].
Montag, 9. September, 16 Uhr: Ankunft in Brest am Bug. Hier beginne ich meine Reise auf der Spur der Heeresgruppee Mitte von Brest bis Moskau. Ich werde abgeholt von meinem Dolmetscher Borislaw Petschnikow und von einem Redakteur der Brester Kreiszeitung. Der Zug fährt in den Bahnhof ein. Ich trete hinaus auf den Flur, will ihnen ein Zeichen geben. Die Schaffnerin, die uns eben noch so liebenswürdig Gläser mit heißem Tee servierte, machte uns resolut klar, daß wir alle in unserem Abteil warten müssen, bis Zoll und Paßkontrolle den Waggon passiert haben.
Wir sitzen also in unseren Abteilen und warten. Grenzbahnhof Brest. Draußen laufen Dutzende auf dem Bahnsteig hin und her. Suchen ihre Leute in den Waggons. Paßkontrolle. Mein Gegenüber, ein Student aus Ost-Berlin, der in Moskau Ökonomie studiert, streckt seinen DDR-Paß hin. Der sowjetische Grenzbeamte blättert. In Ordnung. Ich gebe ihm meinen Westberliner »Behelfsmäßigen Personalausweis« und mein Visum. Er blättert. In Ordnung. Etwas zu verzollen? Nein. Keine Gepäckkontrolle. Ich kann aussteigen. Draußen stehen schon Borislaw und der Redakteur. Wir stellen uns vor. Er heißt Sascha, schüttelt mir die Hand. »Herzlich willkommen in der Sowjetunion!« Es beginnt zu regnen. Die beiden schnappen meine zwei Koffer und laufen zum bereitstehenden Pkw der Zeitung. Wir fahren zum Hotel »Intourist«. Brest – meine erste Station.
Das also ist Brest. Breite Straßen, an den Seiten junge Bäume gepflanzt. Neubauten. Der Verputz schon ein bißchen abgeblättert. Daneben werden neue Wohnblöcke hochgezogen. Sehr wenige Autos auf den Straßen. »Schon viel zu viele!« sagt Sascha. Große rote, gelbe, blaue Transparente an den Hauswänden. Gigantische Leninköpfe. In riesigen Buchstaben drei Worte: »Frieden«, »Partei«, »Ruhm«. Menschen strömen in Geschäfte, stehen an Bushaltestellen; eine Schulklasse wird über den Fahrdamm geleitet. Eine Menschengruppe vor einem Kwas-Wagen, Krüge in der Hand. Verkehrspolizisten von der »Gaj« stehen gelangweilt neben ihrem Fahrzeug. Am Straßenrand werden Blumen und Äpfel verkauft.
Im Hotel »Intourist«. Borislaw erledigt meine Anmeldung an der Rezeption. Sascha telefoniert mit der Redaktion für unser erstes Treffen in der Festung. Ich will mit dem Aufzug nach oben in mein Zimmer, da hilft mir ein älterer Mann die Koffer tragen. Wir stehen im Aufzug. Er spricht Deutsch. Ich frage ihn, wo er so gut Deutsch gelernt hat. »In einem deutschen KZ«, sagt er. Ohne Vorwurf.
Am nächsten Tag: Borislaw und ich stehen vor dem Eingangstor der Festung: ein monumentales Betongewölbe. Das Tor in Form eines riesigen fünfzackigen Sowjetsterns. Die Wände, die Zacken verkantet, verzahnt. Über uns in den Betonnischen durch Lautsprecher das Ticken eines Metronoms. Das Pausenzeichen von Radio Moskau. Ein Signal dafür, daß im Augenblick keine Luftangriffe drohen. Dann Stille. Drei, vier Sekunden. Darauf das drohende Brummen von Bombengeschwadern. Wieder kurze Stille. Dann hallend die Stimme des Nachrichtensprechers: »Achtung! Hier spricht Moskau! Wir senden eine wichtige Botschaft. Heute morgen um 4 Uhr haben ohne jede Kriegserklärung deutsche bewaffnete Kräfte die Grenzen der Sowjetunion überschritten. – Wir sind im Recht. Der Feind wird geschlagen werden. Der Sieg wird auf unserer Seite sein.«[6] Anschließend der Marsch »Steh auf, steh auf, du Riesenland …«
Als wir ankommen, stehen schon Gruppen von Menschen unter dem Gewölbe. Schweigend. Rosen und Nelken in der Hand. Ältere, viele Jugendliche, Kinder. Sie hören auf den Text der Nachricht, auf die Musik. Hin und wieder flüstert jemand. Neue Gruppen kommen hinzu. Auch westliche Touristen. Einzelne, Familien mit ihren Kindern, sowjetische Touristen. Es beginnt zu regnen. Der Wind weht den Regen schräg in den Durchgang hinein. Wir rücken eng zusammen auf die trockene Stelle. Schauen hinaus auf den großen Platz vor dem Tor, wo die Busse parken, hören das Ticken des Metronoms. Auf der anderen Seite das weite Gelände der früheren Festung, die Kasematten, die Ruinen, die Gedenkstätten. Ebenso plötzlich, wie es begann, hört es auf zu regnen. Die Wolkendecke reißt auf, es wird hell, sogar etwas Sonne. Wir gehen weiter. Viele bleiben stehen, schweigend. Hören den Marsch, den Chor: »Und nicht zertrete mehr der Feind uns Feld und Flur und Strand …«
In einem Raum im Museum der Festung werden wir bereits erwartet: Eine ehemalige Krankenschwester des Festungshospitals, ein Musiklehrer, zwei Ehefrauen von damals hier stationierten Kommandeuren. Prochorenkow, Daja Dmitrowna, ist die Älteste. 74 Jahre. Schon beim ersten Satz bricht sie in Tränen aus: »Die Deutschen haben meine ganze Familie umgebracht. Zuerst hier gleich zu Beginn des Krieges 1941 meinen Mann. Er war Artillerist. Dann meine drei Kinder. Mein ältester Sohn war 6, der andere 4 und mein Kleinstes 11 Monate alt. 1943 sind meine Eltern an einer Eisenbahnstation bei Brest erschossen worden, als sie fliehen wollten. Eine Woche lang war ich auf dem Festungsgelände. Ich war damals 30 Jahre alt. Wir haben uns in den Kellern der Kasernen versteckt. Wir hatten kein Wasser. Nichts zu essen. Eine Woche lang. Als die Faschisten die Festung stürmten, warfen sie Rauchgranaten in die Keller. Ich habe gesehen, wie meine Kinder erstickten. Und ich konnte nichts dagegen tun. Wie ich das selbst überlebt habe, weiß ich nicht. Durch einen Zufall. Ich wundere mich, daß ich noch lebe.«
Ich sehe draußen die Sonne auf dem Festungsgelände, die Menschen, die über das Pflaster gehen. Blumen in der Hand. Ich sehe die Bäume. Es ist ein schöner Herbsttag. Mir gegenüber Frau Arschinowa, Anastasia Antonowna. Sie holt aus ihrer Handtasche ein Foto von ihrer Familie. Fragt mich, ob ich mich dafür interessiere. Aber natürlich. Liebevoll legt sie das Foto auf das Wachstuch des Tisches. »Meine Familie. Ich bin als einzige übriggeblieben.«
Auf dem Foto: ein Ausflug vor dem Krieg. An einem See. Sie noch jung, ein kleines Kind auf dem Arm, das nur wenig ältere an der Hand. Daneben ihr Mann. Im Sonntagsanzug. »Mein Mann und Kind tot«, sagt sie auf deutsch. Und dann weiter in Russisch: »Ich war die Frau eines Kommandeurs der Festung. Ich hatte drei kleine Kinder. Der Ältere war 5, meine Tochter 3 Jahre. Wir lebten zusammen mit anderen Familien in der Festung. Im Ost-Fort. Als die Faschisten uns überfielen, beschossen sie die Festung derart, daß wir völlig verwirrt waren. Alle rannten hin und her, die Männer, die Frauen, die Kinder. Alle rannten umher. Wir wußten nicht, was wir als erstes tun sollten. Die Faschisten haben mich als Frau eines Kommandeurs und meine Kinder aus der Festung herausgezerrt und uns unter die Geschütze gelegt, die die Festung beschossen. Das waren große Kanonen. Die Faschisten haben uns als Geiseln unter die Geschütze gelegt, damit mein Mann und die anderen Verteidiger kapitulieren sollten. Was sollte ich da tun? Es war entsetzlich. Bei jedem Schuß war mir, als würde mein Gehirn aus dem Kopf herausquellen. Den Kindern kam das Blut aus den Ohren und aus dem Mund. Meine Tochter starb. Mein Sohn ist seitdem taub. Er war damals 5 Jahre alt. Wenn ich heute durch die Straßen von Brest gehe, sehe ich in meiner Erinnerung immer noch das zerstörte Brest und empfinde Schmerz dabei. Und dann sehe ich zugleich die heutige blühende Stadt, die wiederaufgebauten Häuser, die lachenden Menschen.«
Ich schaue wieder das Foto an. Die Familie sonntags am See. Auch der Tag des Überfalls war ein Sonntag. Sie nimmt das Bild zu sich, weint still. – »Können Sie das verstehen?« fragt sie und wischt sich mit dem Handrücken über die Wange.
Frau Arschinowa und die 74jährige Frau wollen nicht mit hinaus auf das Festungsgelände. Sie haben genug davon. Sie wollen das nicht wiedersehen. Es reißt zu viele Erinnerungen auf. Ich verabschiede mich von ihnen. Sie wünschen mir viel Glück, danken mir dafür, daß ich gekommen bin, um mir das alles anzuhören. Die 74jährige drückt mir die Hand und sagt: »Grüßen Sie das deutsche Volk. Und sagen Sie, daß wir gut nebeneinander leben möchten. Und daß es keinen Krieg mehr gibt.«
Wir gehen über das Gelände, wo früher die Festung stand. Um uns herum die Reste, die von der Festung übriggeblieben sind: Mauern, Fundamente, offene Keller, die Grundmauern des Weißen Palastes. Hier ist am 3. März 1918 der Diktatfrieden von Brest-Litowsk unterzeichnet worden, und ringsumher die Trümmer des Zweiten Weltkrieges. Wir gehen an Tafeln mit Namen vorbei. Davor liegen Chrysanthemen. Eine wiederhergestellte Häuserzeile, das zerschossene Cholmer Tor aus roten Ziegelsteinen, die Ruinen der Kasernen, die Reste der Wohnungen für die Zivilangehörigen der Brester Garnison, die Ruine der ehemaligen Kirche – die Sowjets hatten sie bei ihrer Besetzung Polens 1939 zum Klub der Garnison umgebaut. Daneben das kolossale Mahnmal: der gigantische Kopf eines Sowjetsoldaten. Turmhoch. Über sein Gesicht wächst Moos entlang den Wasserläufen des Regens. Sein Hinterkopf mit den wehenden Haaren geht über in eine flatternde Fahne. Das Ganze gegossen aus Beton. Und als Kontrast dazu gleich daneben ein schlanker, hoch aufschießender Obelisk. Und unter unseren Füßen, unter den Steinplatten liegen 850 Verteidiger der Festung begraben. Eine lange Mauer mit ihren Namen. Davor niedergelegt Rosen, Nelken. An die Buchstaben der Namen rote Pioniertücher geklemmt. Aus den Lautsprechern um uns ertönt, halb vom Winde verweht, leise Chorgesang: die »Träumerei« von Robert Schumann.
Die ehemalige Krankenschwester Katschowa, Braskowa Lesnewna, Karbuk, Georgij Michailowitsch und Borislaw gehen mit mir über das Festungsgelände. Karbuk, G.M., heute 62 Jahre alt, erzählt: »Ich war damals 18. Am Samstag, dem 21. Juni 1941, am Vorabend des Krieges, bin ich zusammen mit meinen Freunden in den Park gegangen. Ich weiß es noch genau: Es war ein warmer Abend. Da spielte ein Orchester. Es gab Musik, die Leute haben getanzt. Wir trafen unsere Mädchen, waren lustig. Dann, in der Nacht, es begann gerade zu dämmern, weckte mich mein Vater: ›Steh auf!‹ schrie er. ›Es ist Krieg!‹ Es waren nicht einzelne Schüsse zu hören. Es war eine ganze Kanonade. Die Artillerie, die die Festung beschoß. Da sahen wir auch schon die Bomber über Brest fliegen und wie sie die Bomben abwarfen[7]. Wir sind nach draußen auf die Straße. Da rannten unsere Soldaten. Wir fragten: ›Was ist los?‹ Und sie: ›Seht ihr nicht, es ist Krieg!‹ Wir Jugendliche wollten nicht an Krieg glauben. Für uns war das etwas Fernes. Wir ahnten wohl, daß bald ein Krieg ausbrechen werde. Wir haben doch die Deutschen hinter dem Bug gesehen. Trotzdem, wir wollten nicht daran glauben. Doch als wir auf der Straße die ersten Verwundeten und Toten auf dem Pflaster liegen sahen und all das Blut – da haben wir daran glauben müssen, daß nun Krieg war. Nach ein paar Stunden fuhren schon die ersten Panzer, danach die Motorradfahrer durch die Stadt, und dann die Infanterie. Mein Vater war Vorsitzender der Genossenschaft. Er rannte gleich zum Genossenschaftsbüro. Ein deutscher Soldat packte ihn am Arm und schrie: ›Du Kommunist! Du Kommissar!‹ Er wollte ihn sofort auf der Straße erschießen. Mein Vater hat noch Glück gehabt. Er konnte sich losreißen und in dem Gewühl untertauchen. In der Stadt sind überall Menschen erschossen worden. Schon in den ersten zwei Wochen wurden in Brest 8000 bis 9000 Menschen erschossen[8]. Und auch in den Monaten danach ging das ständig weiter[9]. Von 36 Mitschülern meiner Klasse sind im Lauf des ganzen Krieges vier am Leben geblieben. Die Deutschen haben überhaupt alle erschossen, die ihnen nicht paßten. Weil sie Kommunisten waren, weil sie Juden waren, weil sie Widerstand leisteten oder auch nur im Verdacht standen, Widerstand zu leisten. Besonders die Einsatzgruppen. Das waren die Killerkommandos. Hier war die Einsatzgruppe B, und zum Teil auch die Einsatzgruppe A. Die haben zusammen mit der Wehrmacht und den Polizeieinheiten gemordet.«[10]
Wir gehen über eine Brücke. Georgij Karbuk erzählt mir über die Festung:
Angriff auf die Zitadelle von Brest-Litowsk, 22. Juni 1941
»Die Festung liegt am Zusammenfluß von Muchawiec und Westlichem Bug und besteht aus vier Inseln. Vier Anlagen zusammengebaut zu einem gewaltigen Bollwerk. Eine Fläche von insgesamt vier Quadratkilometern. Umgeben von einem sechs Kilometer langen und 10 Meter hohen Erdwall. Im Außenring die Verteidigungsanlagen. Innerhalb der Mauern die Kasernen, Kasematten, Magazine, Krankenhäuser, Schulen, Wohngebäude für die Familienangehörigen. 8000 Soldaten waren üblicherweise als Garnison stationiert. Zur Zeit des Angriffs aber, an einem Sonntagmorgen, befand sich nur ein Teil davon in der Festung. Etwa 3500 Soldaten. Der andere Teil hatte Urlaub oder war woanders eingesetzt. Der Überfall begann am 22. Juni 1941 um 3 Uhr 15.[11] Es begann gerade zu dämmern. 500 Geschütze waren auf die Festung Brest gerichtet. In den ersten Stunden sorgten Geschütze, Bomber und Maschinengewehre für 5000 Einschläge pro Minute. Bis 12 Uhr mittags sollte die Festung – laut Plan – eingenommen sein. Die deutsche Wehrmacht war davon überzeugt, die Grenzwachen innerhalb von einer halben Stunde zu liquidieren. Sie versuchte von drei Seiten, in die Festung einzudringen: vom Westen auf die Westinsel; vom Norden, wo die Wohnhäuser der Angehörigen der stationierten Soldaten standen; und vom Süden, auf die Südinsel, wo sich die Hospitäler befanden. In 8 Stunden sollte die Festung erobert sein. Womit die Deutschen aber nicht rechneten: Es dauerte 28 Tage, bis die Festung fiel. Fast einen Monat lang. Am 30. Juni standen sie immer noch vor den massiven Mauern. Vorangegangen war ein permanenter Artilleriebeschuß. Besonders am 29. und 30. Juni 1941. Dabei fielen die meisten Verteidiger. Nach dem 30. Juni konnten die deutschen Truppen vereinzelt in das Gelände eindringen, wurden aber immer wieder hinausgeschossen. Während die Wehrmacht bereits weit in das Land eingedrungen, schon bis hinter Smolensk vorgestoßen war, dauerten die Kämpfe um die Brester Festung immer noch an. Bis zum 20. Juli. Dann mußte sich der kleine noch lebende Rest der sowjetischen Garnison ergeben. Er hatte keine Munition mehr.«
Georgij Michailowitsch Karbuk bleibt vor einer Plastik stehen. Überlebensgroß ein Rotarmist, auf dem Boden kriechend, ganz flach auf der Erde, schwer verletzt, halb verdurstet, schiebt sich zu einer Wasserquelle hin. »Durst« heißt die Plastik. »Das Schlimmste war der Wassermangel. Die Maschinengewehre mußten ständig mit Wasser übergossen werden, um sie zu kühlen, damit sie sich nicht heißschießen, die Metalläufe sich nicht verbiegen, sie nicht klemmen. War ein Maschinengewehr defekt, war man verloren. Daneben lagen die Verwundeten, die starben, wenn sie kein Wasser bekamen. Was war nun wichtiger? Ein intaktes Maschinengewehr zur Verteidigung oder diesen Menschen retten? War ein Maschinengewehr kaputt, so war auch eine ganze Gruppe von Menschen verloren. Und überall lagen die Verwundeten und Sterbenden. Die lechzten nach Wasser! Die Familien, die Kinder! Wie viele sind nur verdurstet! Und ganz nah, nur ein paar Schritte, die beiden Flüsse. Doch die Deutschen hatten drüben an ihrem Ufer große Flakscheinwerfer aufgestellt und strahlten unsere Seite in der Nacht taghell an. Jeden Busch haben sie damit angeleuchtet. Und wagte sich jemand von uns an den Fluß heran, um nur eine Blechbüchse voll Wasser zu holen, sofort wurde er abgeknallt. Da sind viele von uns liegengeblieben.«
Wir stehen an diesem Ufer. Das hohe Gras der Wiesen, die Bäume, die Büsche. Die Sonne scheint. Das langsam fließende Wasser. Grün. Ein idyllischer Ort. Unvorstellbar, was hier damals geschah. Etwas weiter entfernt befand sich jene Brücke, auf die Hitler nach der Einnahme der Festung Mussolini geführt hatte, um ihm den Erfolg seiner schlagkräftigen Wehrmacht vorzuführen. »Zuvor hatte Hitler noch ein paar der schwersten russischen Kanonen an die Festungsmauer heranschaffen lassen, um Mussolini zu zeigen, welch gewaltigen Feind die Deutschen besiegt hätten. Eine Aufforderung an den Duce, sich doch endlich mehr in diesem Krieg zu engagieren.«
Wie das konkret war, als die Deutschen in die Festung eindrangen, will ich wissen. Katschowa Braskowa Lesnewna, Krankenschwester in der chirurgischen Abteilung des Hospitals auf der Südinsel: »In der Festung lebten etwa 300 Familien der hier stationierten Soldaten, Frauen, Kinder. Dazu die Krankenschwestern, Ärzte und Ärztinnen der Hospitäler. Gleich beim ersten Bombardement und dem Beschuß durch die Kanonen gingen die Gebäude der Chirurgischen Klinik in Flammen auf. Auch die anderen Gebäude brannten. Das gesamte Hospital bestand aus 36 Bauten. Wir dachten, die Faschisten würden die Krankenhäuser verschonen. Auf den Dächern waren doch groß die roten Kreuze gemalt. Gleich beim ersten Beschuß gab es viele Verwundete und Tote. Ich erinnere mich noch genau. Wir hatten den Befehl, sofort alle Überlebenden in die Kasematten des Erdwalls zu transportieren. Während der Beschießung. Überall lagen die Toten und Verwundeten auf der Erde. In den Kasematten haben wir dann notdürftig die Verwundeten gepflegt. Die verletzten Kinder, die Soldaten, die Frauen. Doch dann hatten wir kein Verbandszeug mehr. Keine Medikamente mehr, kein Wasser. Die Hauptgebäude brannten. Wir waren in den Kasematten. Es fehlte an allem. Vor allem Wasser. Wir konnten kein Wasser vom Fluß holen. Aber wir brauchten doch Wasser für die Verwundeten!
Ich habe es selbst erlebt, wie eine Krankenschwester aus unserer Abteilung am Wiesenufer erschossen wurde, weil sie Wasser holen wollte. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wir konnten nicht einmal den Leichnam wegholen. Acht Tage lag sie da im Gras. Und dann, nach einer Woche Belagerung, sind die ersten Faschisten in die Festung eingedrungen. Vor unseren Augen haben sie alle Verwundeten, die Kinder, die Frauen, die Soldaten – alle erschossen. Wir Krankenschwestern wollten ihnen entgegeneilen, wir hatten unsere weißen Kittel an mit dem roten Kreuz darauf, und unser Schwesternhäubchen. Wir dachten, darauf würden sie Rücksicht nehmen. 28 Verwundete haben die Faschisten allein in meiner Abteilung erschossen. Und wenn welche nicht sofort tot waren, warfen sie Handgranaten auf sie.
Als die Deutschen die ersten Länder besetzt hatten, haben wir in den Zeitungen von ihren Brutalitäten gelesen. Wir konnten es trotzdem nicht so recht glauben, daß Menschen so grausam gegen andere Menschen sein können. Wir wollten es einfach nicht glauben. Und nun haben wir es selbst erlebt.
Später dann, während des Krieges, habe ich an meine Familie nach Kobrin geschrieben. Ich wollte wissen, wie es ihnen geht. Ob noch alles in Ordnung ist. Lange erhielt ich keine Antwort. Dann erfuhr ich durch andere, daß die Deutschen meine Schwester und ihren Mann erschossen hatten. Die ganze Familie meiner Schwester wurde erschossen. Sie waren Kolchosbauern. Die ganze Familie: Fünf Menschen einfach erschossen.
Und heute – über 40 Jahre nach Kriegsende – hier in Brest ist in der neuen Fußgängerzone eine große Buchhandlung. In diesem Haus wohnte meine Freundin. In diesem Haus ist meine Freundin mit ihrer ganzen Familie erschossen worden. Ich kann heute nach über 40 Jahren immer noch nicht in dieses Haus gehen. Ich kann es nicht einmal ansehen. Ich kann heute noch nicht ruhig daran vorbeigehen.«
Weiter über die Fundamente der Festung. Georgij Karbuk zeigt mir geschmolzene Mauerreste. Geschmolzene Ziegelsteine. Wie eine Lavamasse erstarrt: »Die Deutschen haben Flammenwerfer eingesetzt. Sie haben die Flammenwerfer einfach in die Kellerfenster hineingehalten. Sie wagten nicht, selbst in den Kellerraum einzudringen. So haben sie einfach die Flammenwerfer hineingehalten. Da verbrannte alles. Sogar die Ziegelsteine schmolzen. Andere warfen Granaten in die Kellerräume, wo sich die Familien versteckt hielten.«
Geschmolzene Ziegelsteine. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Wie eine erstarrte Paste. Dunkelrot, schwarz: »Von den 3500 Mann in der Festung haben 17 überlebt.«
Wir gehen in einen der Keller. An der Wand Inschriften. Mit dem Bajonett in die Betonwand eingeritzt. Mein Dolmetscher übersetzt: »Wir sterben. Aber wir haben uns verteidigt. 20.7.41.«
Wir gehen zurück zum Museum. In Vitrinen Briefe, Tagebücher, Uniformfetzen, eine durchschossene Uhr, durchschossene Fotos. Die Wände voller eingerahmter Porträts der Verteidiger. Diese jungen, ernsten Gesichter. Die Frauen, die Kinder. Darunter ihre Schulzeugnisse, bis zum Beginn der großen Ferien 1941. Bombensplitter, Granathülsen, die Ziehharmonika eines Soldaten, sein Komsomolzenbuch, halb verbrannt. Ein Stück Blech vom Dach des Krankenhauses; Baumstümpfe, in denen noch die Kugeln der MG-Salven stecken. Ein anderer Baumstumpf, zerfetzt von einer Granate, ein Teil eines Krankenbettes, durchsiebt von Kugeldurchschüssen. In einer Vitrine ein Brief. Ein Brief unter Hunderten in diesen Räumen: »An meine Eltern, an meinen Bruder Lale. Lieber Lale, schicke mir Deine Fotografie. Ich lebe hier wie woanders auch. Ich sehne mich nach Euch. Und ich sehne mich nach meinem Grusinien. Hier ist alles ruhig. Bald geht mein Dienst zu Ende. Ich umarme Euch, Kako. Brest, 13. Juni 1941.«
Kako ist Akaki Ambrosewitsch Schewardnadse, der ältere Bruder des ehemaligen sowjetischen Außenministers Eduard Schewardnadse. Er wurde hier erschossen, gleich am ersten Tag des Überfalls. Am Ausgang ein großer Kasten aus Glas. Bis zum Rand gefüllt mit Asche. Ein Sarg voller Asche. Asche der Festung von Brest. Ich trete hinaus ins Freie. Helle Sonne. Ich spüre die Wärme auf der Haut. Abschied von Braskowa Katschowa. Sie drückt mir die Hand. »Bitte sagen Sie den Deutschen, daß wir wohl unterscheiden zwischen den Faschisten damals und den Deutschen heute. Auch damals haben wir immer unterschieden zwischen faschistischen Verbrechern und den einfachen deutschen Soldaten. Wir haben das damals trotz allem sehr genau auseinandergehalten. Und wir haben keinen Zorn, kein Rachegefühl gegen die Deutschen heute. Aber wir können nicht verstehen, daß so viele bei Ihnen immer noch nicht begreifen wollen, was die Faschisten damals uns angetan haben. Bei Ihnen sind so viele Informationen erschienen und bekanntgeworden über die 6 Millionen ermordeten Juden. Wird denn über unsere Opfer, über unsere 28 Millionen ermordeten Sowjetmenschen auch soviel berichtet?«