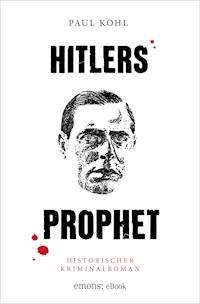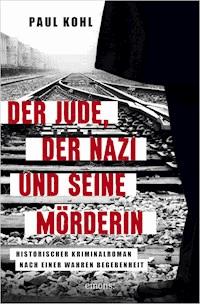Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Weimar 1783: Eine Kindsmörderin wird enthauptet, ein Schmied und ein Bauer ermordet und junge Burschen als Rekruten nach Preußen verkauft. Auf der Suche nach einer wertvollen Handschrift irrt Archivar Kestner im Labyrinth dieser Verbrechen umher - und erhofft sich Hilfe von Geheimrat Goethe. Doch dieser weist ihn ab. Da erscheint ihm Mephistopheles persönlich und lockt ihn in einen Keller des abgebrannten Schlosses. Jetzt wird es für Kestner höllisch heiß.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Kohl, geboren 1937 in Köln, studierte Germanistik und Theaterwissenschaft. Er war Buchhändler und Mitarbeiter bei Fernsehproduktionen. Heute ist er Hörfunk- und Buchautor und schreibt vorwiegend über geschichtliche und sozialkritische Themen. Seit 1970 lebt und arbeitet er in Berlin. 2014 erhielt er den Axel-Eggebrecht-Preis für sein Lebenswerk als Autor für Hörfunkfeatures.
Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch sind die meisten Personen nicht frei erfunden, sondern existierten wirklich. Ihre Handlungen beruhen auf einem historischen Hintergrund.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotive: fotolia.com/artefacti, shutterstock.com/STILLFX, shutterstock.com/Andrii Muzyka, shutterstock.com/mart Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-889-2 Historischer Kriminalroman Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Unsere moralische und politische Welt ist
mit unterirdischen Gängen, Kellern und Cloaken miniret,
an deren Zusammenhang wohl niemand denkt und sinnt.
Johann Wolfgang Goethe, Weimar 1781
EINS
Seinen Arbeitstag an diesem Donnerstag, dem 20.November 1783, begann der Archivar Hofrat Christian Kestner ruhig wie immer. Er war frisch rasiert, auf seinen Wangen duftete noch das aufgetragene Eau de Cologne, und sein weißes, von Lotte gestärktes und gebügeltes Hemd knisterte unter seinem Jackett. Bedächtig sortierte er die vor ihm liegende Arbeit. Neue Archivgesetze mussten in die bestehende Gesetzessammlung eingegliedert werden, Anträge für Restaurierungen alter, brüchiger Bücher aus dem 15.Jahrhundert geprüft, neue Dokumente in den Bestand aufgenommen und mit Signaturen versehen werden. Gemeinsam mit seinen Kollegen war Kestner mit Engagement, mit Gewissenhaftigkeit und auch mit Liebe zu seinem Beruf bemüht, in seinem Archiv des Kurfürstentums Hannover Ordnung zu halten. Sorgfalt war sein oberstes Gebot.
Bevor er jedoch mit der Erledigung der Aufgaben begann, zog er wie üblich die schwarzen Ärmelschoner über seine Manschetten, brühte in seiner Kanne einen duftenden Minzetee auf und genoss den ersten Schluck aus seiner Tasse.
Mit der Ruhe war es schlagartig vorbei, als der Archivleiter Hubertsen seinen Raum betrat. Seit zehn Jahren war Hubertsen Kestners direkter Chef, seit er von Wetzlar nach Hannover übergesiedelt war. Sie verstanden sich gut.
Wie immer, wenn Hubertsen für Kestner einen besonderen Auftrag hatte, strich er mit dem Zeigefinger über sein dünnes Menjoubärtchen. »Sie sind der richtige Mann für Weimar«, sagte er. »Durch Ihre Frau Gemahlin haben Sie eine besondere Beziehung zu Goethe.«
Nun kam schon wieder diese Geschichte, die Kestner seit elf Jahren anhing wie eine Schleppe, die er nicht loswurde.
»Sie können die Handschrift am Montag in der Fürstlichen Bibliothek abholen. Man erwartet Sie.« Mit diesen Worten legte er Kestner die Vollmacht des Archivs und eine in grüne Seide gebundene Mappe auf den Tisch.
Kestner kannte den Inhalt der Mappe. Er schlug sie trotzdem auf. Vor ihm lag die umfangreiche, seit Jahren andauernde Korrespondenz seines Archivs mit der Fürstlichen Bibliothek in Weimar. Obenauf der kunstvolle kolorierte Kupferstich, den ein unbekannter Künstler vor vielen Jahren angefertigt hatte. Eine Kopie des kostbaren Originals von 1575 aus der Handschriftensammlung seines Kurfürsten GeorgIII., das dieser vor langer Zeit an die Fürstliche Bibliothek ausgeliehen hatte. Der Welfe, der durch Geburt auch König von Großbritannien war, hatte eine Leidenschaft für Botanik und sammelte alle möglichen Darstellungen von Blumen. Besonders von exotischen Blüten.
Kestner nahm den Kupferstich in die Hand, der bis ins letzte Detail die Kostbarkeit des Originals wiedergab. Die Abbildungen der verschiedenfarbigen Rosen, der Orchideen, Malven, Lilien, Gladiolen wirkten so echt, dass man glaubte, ihren Duft riechen zu können. Ornamente verzierten die Initialen und Versalien der erklärenden Schriften seitlich der Blumen und Blüten. Der gesamte Kupferstich wurde von schmückenden Blättergirlanden umrahmt. Er war wunderschön. Wie herrlich musste da erst das farbige Original aussehen, das er nun abholen sollte. Kestner freute sich darauf, diese Kostbarkeit in den Händen zu halten.
Schon vor langer Zeit hatte bewiesen werden können, dass GeorgIII. und damit der hannoversche Hof der rechtmäßige Eigentümer dieser Preziose war. Doch Weimar hatte den Anspruch Hannovers immer wieder abgestritten. Depeschen waren hin- und hergegangen. Nach langem Gezerre hatte die Fürstliche Bibliothek endlich die Eigentumsrechte bestätigt und der Rückgabe zugestimmt. Nur der Übergabetermin hatte noch bestimmt werden müssen. Auch das war schwierig gewesen. Als Gründe für die Verzögerung hatte Weimar Umbauarbeiten in der Bibliothek angegeben, eine Umgruppierung der Bestände und so manches andere. Nun hatte man also als endgültiges Datum Montag, den 24.November, genannt.
Er freute sich auch darauf, endlich einmal Weimar zu besuchen. Er war noch nie in diesem berühmten Ort gewesen und neugierig, Goethes Wahlheimat kennenzulernen. So hatte er auch Gelegenheit, die großartige Fürstliche Bibliothek zu besichtigen, über die er schon so viel gehört und gelesen hatte. Für ihn als heimlichen Literaten war der Besuch einer jeden historischen Bibliothek ein aufregendes Erlebnis. Und nun sollte er gerade diesen Weimarer Prunkbau persönlich erleben.
Ein bitterer Tropfen fiel in seinen süßen Wein, als der Archivleiter bestimmte, er solle mit seinem Assistenten Lorenz Petersen reisen.
»Warum gerade mit Lorenz?«
»Er muss das lernen. Er hat Potenzial, läuft aber noch in die falsche Richtung. Liest zu viel wirres Zeug. Bringen Sie ihn auf Kurs. Nehmen Sie ihn in Zucht. Geben Sie seinem Schiffchen die nötige Richtung.«
Dass er mit Lorenz verreisen sollte, passte Kestner gar nicht. Nicht mit diesem jungen Spund. Er war zwar ein netter Kerl, aber mit seinen dreiundzwanzig Jahren noch ein Luftikus. In den wenigen Wochen, seit er im Hofarchiv tätig war, hatte er zwar insgesamt nur ein paar Tage bei Kestner gearbeitet. Die übrige Zeit war er den Kollegen in den anderen Abteilungen zugeteilt. Doch mit ungezügeltem Interesse am Gegenstand seiner Ausbildung tat sich Lorenz in keiner Weise hervor. Er war aus Celle gekommen und sollte nach dem Wunsch seiner Eltern etwas Anständiges lernen. Ausgerechnet Archivwesen. Dafür war er nach Kestners Meinung überhaupt nicht geeignet. Lorenz war froh, endlich aus den Zwängen seines strengen Elternhauses ausgebrochen zu sein, und trieb im hannoverschen Hofarchiv nur närrischen Unfug. Anstatt Archivgesetze, Katalogisierung, Provenienzforschung und Restaurierungspraktiken zu lernen, verschlang der schwarzhaarige Wuschelkopf mit den dunklen, lebhaften Augen begeistert revolutionäre Pamphlete. Dazu die neuesten aufwieglerischen Agitationen aus Frankreich, die in deutscher Übersetzung auch im Kurfürstentum Hannover zirkulierten. Ein Heftchen nach dem anderen saugte er auf. Revolution, das war seine Parole. Mit diesem Wirrkopf sollte er nun nach Weimar.
Eine Ablehnung war zwecklos. Der Archivleiter hatte schon für beide Kutschplätze und die Zimmer im Hotel »Zum Weißen Schwan« reservieren lassen.
»Sicher werden Sie auch Goethe besuchen«, sagte Hubertsen lächelnd. Kestner sah ihm an, dass er ihn um diese Begegnung beneidete. Auch er hätte dem berühmten Dichter gern einmal die Hand gedrückt. »Sie sind doch mit ihm eng befreundet. Und auch familiär verbunden. Machen Sie sich reisefertig. Morgen geht es los. Ich freue mich schon darauf, dieses Original endlich in Händen zu halten und in unseren Bestand einzufügen.«
Kestner informierte Lorenz Petersen und verbot seinem Assistenten, irgendeinen Aufruf zur Revolution oder Verherrlichung der Demokratie mit auf die Reise zu nehmen und in der Kutsche zu lesen.
»Aber meinen Schubart nehme ich mit.«
»Kommt nicht in Frage«, entschied Kestner. Auf das Lesen von Schubarts »Teutscher Chronik 1777« stand Zuchthaus. Für seine politische Schrift saß Daniel Schubart seit Jahren eingekerkert auf dem Asperg.
»Ich verstecke ihn in meiner Reisetasche.«
»Da schon gar nicht. Bei einer Kontrolle werden sie ihn finden.«
»Wo dann?«
Kestner war nachsichtig und riet Lorenz, dieses Pulver in seiner Unterhose zu verstecken.
»Hoffentlich machen sie in Weimar keine Leibesvisitation.«
»Wirst du Wolfgang treffen?«, fragte Lotte, als sie Kestners Reisetasche packte.
»Natürlich werde ich ihn sehen«, versicherte er ihr. Schließlich waren sie Freunde. Auch wenn sie vor elf Jahren persönliche Rivalen gewesen waren und sich seit neun Jahren nicht mehr gesehen hatten. Er freute sich auf ein Wiedersehen mit ihm. Es würde so vieles zu erzählen geben.
Sogleich machte sich sein neunjähriger Sohn daran, seinem Patenonkel in Weimar mit Buntstiften ein Briefchen zu schreiben: »Lieber Onkel Wolfgang, wie geht es Dir? Mir geht es gut. Ich finde Dein Gedicht ›Heidenröslein‹ sehr schön und habe es auswendig gelernt und in der Klasse vor allen Schülern aufgesagt. Lieben Gruß. Dein Patenkind Wolfgang.«
Goethe hatte ihnen 1773 für ihre Heirat die Eheringe geschenkt und später für ihren Erstgeborenen Georg, der ein Jahr danach zur Welt kam, die Patenschaft übernommen. Es verstand sich, dass er Goethe zuliebe auch auf den Namen Wolfgang getauft wurde. Dazu hatte Goethe seinem Patenkind einen goldenen Taufdukaten mit der Prägung »1749« geschenkt. Es war jene Goldmünze, die Goethe zu seinem eigenen Geburtstag erhalten hatte. Er hatte sie nur weitergereicht.
Beim Gedanken an ein Wiedersehen mit Goethe stand Kestner wieder vor Augen, wie das damals gewesen war, vor elf Jahren in Wetzlar. Lottes Liebschaft mit Goethe im Sommer 1772.
Kestner hatte als Gesandter des Reichskammergerichts in Wetzlar eine gute Stellung gehabt und musste für Gerichtsvisitationen oft verreisen. Als Revisor prüfte er unangemeldet bei Gerichten sich hinschleppende Prozesse auf ihre korrekte Führung und überwachte die hygienischen und strafrechtlichen Zustände in Zuchthäusern. Oft hatte er zu spüren bekommen, dass er bei den Kontrollierten äußerst unbeliebt war.
Eines Tages war dieser junge Goethe aus Frankfurt zum Reichskammergericht gekommen, um juristische Praxis zu lernen, geschickt von seinem reichen Vater. Ein verwöhntes dreiundzwanzigjähriges Kerlchen, den Kopf voller dichterischer Spinnereien. Die Jurisprudenz kümmerte ihn einen Dreck. Mit seinen Kumpanen zog er durch die Wirtshäuser, schäkerte mit den Mädchen, legte sich in die Wiesen und deklamierte Homer und Ovid. Dieser junge Goethe hatte sich in seine Lotte verliebt. In seine blonde, hübsche neunzehnjährige Charlotte Buff. Sie waren seit Langem verlobt. Einander fest versprochen. Das wusste Goethe, hatte sich aber nicht darum geschert und sich trotzdem in sie verliebt.
Goethe hatte anfangs Lotte mehr geliebt als sie ihn. Sie musste sich als Verlobte und Mütterchen ihrer zehn kleinen Geschwister zurückhalten. Lottes Mutter war kurz zuvor gestorben, so war sie gezwungen, ihre Geschwister zu versorgen und den Haushalt zu bewältigen. Doch die Liebe hatte auch sie erfasst. Sie war hin- und hergerissen zwischen zwei Männern. Da war einerseits der stürmische, in den Wolken schwebende Goethe, zu dem sie sich auch wegen ihrer musischen Veranlagung leidenschaftlich hingezogen fühlte– und andererseits Kestner, der um zwölf Jahre Ältere, Vernünftige mit seiner sicheren beruflichen Stellung, der ihr eine stabile Zukunft bot und immerhin ihr Verlobter war, den sie bald heiraten würde.
Während Kestner sich verbissen durch Akten wühlen musste, hatte Goethe genügend Gelegenheit gehabt, sich mit Lotte zu treffen, mit ihr im Garten Bohnen und Himbeeren zu pflücken und ihr so manches zärtliche Wort zuzuflüstern. Kestner hatte gelitten, hatte Lotte zu verstehen gegeben, dass sie zu ihm gehörte, und Goethe klargemacht, dass er sich betreffs ihrer keine Flausen in den Kopf setzen sollte.
Drei Monate hatte die Liebe der beiden gedauert. Für Kestner eine endlos lange Zeit, in der er ihre Affäre zähneknirschend erduldet hatte.
Dann, im September 1772, war Goethe aus Wetzlar geflohen. Nach drei Monaten Liebesrausch war er plötzlich weg gewesen und hatte Lotte und Kestner nichts als einen Zettel hinterlassen: »Leben Sie beide wohl. Adieu!«
Goethe hatte nur hin und wieder ihre Hand geküsst, einmal auch ihren Mund. Das hatte Lotte ihrem Kestner artig gebeichtet. Außer ihrer Leidenschaft– mehr war nicht gewesen. Trotzdem war Kestner über Goethes Abreise froh gewesen und erleichtert. Lotte aber hatte noch oft von ihm gesprochen.
Bei seiner überstürzten Abreise aus Wetzlar hatte Goethe seine Perücke liegen lassen. Kestner hatte sie wegwerfen wollen. Nichts mehr sollte an diesen Wirbelwind erinnern. Aber Lotte wollte sie bewahren. Wozu? Das ging Kestner nicht in den Kopf. Lotte legte die Perücke auf den Stuhl, auf dem ihr Liebhaber gesessen hatte. Wiederholt warf Kestner die Perücke in eine Ecke und nahm demonstrativ auf diesem Stuhl Platz. Eines Morgens entdeckten sie, dass ihre Katze in der Perücke gejungt hatte. Vier winzige Kätzchen mit noch verklebten Augen kauerten in der wollenen Schale. Die Katze, halb über sie gestreckt, leckte sie ab.
Später hatte Kestner in Lottes Büchern gepresste, getrocknete Blumen entdeckt. Blumen, die ihr Geliebter ihr einst schenkte. Er hatte die Gebilde herausgenommen und weggeworfen.
»Nimmst du auch deine Reisepistolen mit?«, fragte Lotte und hielt die beiden Waffen mit dem eisernen Lauf und dem Nussholzgriff hoch.
Diese Pistolen! Sofort sah Kestner wieder Jerusalem in seinem Blut liegen.
»Nimmst du sie mit?«, fragte sie nochmals.
Kestner zögerte. Seit jenem Oktober vor elf Jahren hatte er seine beiden Pistolen nicht mehr angefasst und sie in ihrem Holzkasten weit hinten im Wäscheschrank versteckt. Er konnte sie nicht mehr berühren. Er hatte das Gefühl, es mit giftigen Schlangen zu tun zu haben, die sofort zubeißen würden, wenn er es versuchte. Während seiner Inspektionsreisen hätte er sie des Öfteren gut gebrauchen können, etwa als er einmal in der Kutsche von Räubern überfallen wurde oder als in einem Gasthaus Diebe in seine Kammer eindringen wollten.
»Ja oder nein?«, wollte Lotte wissen.
Kestner blickte auf die Pistolen in ihren Händen und sah wieder eine davon im Blut neben Jerusalems zerschossenem Kopf liegen. Das Bild verfolgte ihn seit Jahren. Bei ihrem Umzug von Wetzlar nach Hannover hatte Lotte die Dinger mitgenommen, jetzt wieder hervorgeholt und hielt sie abwartend in die Luft.
»Was ist nun?« Lotte war ungeduldig, sie wollte mit dem Packen fertig werden.
Kestner zögerte immer noch.
»Du wirst sie brauchen während der Reise«, sagte Lotte. »Auch in Weimar gibt es böse Menschen.«
Böse Menschen in Weimar, das konnte er sich gar nicht vorstellen. Außerdem würde er gegen sie auf keinen Fall die Waffe einsetzen. Das widersprach seinem Grundsatz der Gewaltlosigkeit.
Lotte sah ihm an, was er dachte. »Du würdest dich wohl lieber erschießen lassen, als dich zu wehren. Sei nicht so fromm!«
Er mochte ihre realistische Einschätzung und überwand sich.
»Steck sie in die Manteltaschen«, entschied er. »Und dazu die Munition.«
Streng genommen hätte er seine Reisepistolen damals in Wetzlar Jerusalem gar nicht leihen dürfen. Das war gegen die Vorschrift. Aber er war überzeugt gewesen, dass Jerusalem wirklich verreisen musste und sich dafür die Waffen auslieh. Einmal unkorrekt gehandelt, und schon brach die Katastrophe herein. Natürlich hatte er nicht wissen können, dass Jerusalem sich damit erschießen wollte. Trotzdem fühlte er sich schuldig an seinem Tod.
Der dreiundzwanzigjährige Karl Wilhelm Jerusalem war 1772 kurz vor dem gleichaltrigen Goethe als Praktikant zum Reichskammergericht gekommen und wie dieser überhaupt nicht an seiner juristischen Ausbildung interessiert gewesen. Prozessführung zu studieren war ihm völlig schnuppe. Er fühlte sich sehr fremd in Wetzlar, hatte keine Freunde und lief immer nur allein herum. Auch mit Goethe und Kestner hatte er keinen Kontakt. Im Kontrast zur Melancholie, in der er versank, kleidete sich der blonde Jüngling extravagant wie sonst keiner. Stets trug er einen blauen Rock mit blinkenden Messingknöpfen, eine gelbe Weste und gelbe lederne Kniehosen, dazu halbhohe braune Stulpenstiefel.
Zur gleichen Zeit, da sich Goethe in die verlobte Charlotte verliebte, verliebte sich Jerusalem in die verheiratete Elisabeth, die Ehefrau des kurpfälzischen Legationssekretärs Herdt. Wie bei Goethe eine aussichtslose Liebe. Elisabeth Herdt verbot ihm schließlich sogar das Haus. Das stürzte Jerusalem in schwarze Verzweiflung.
Einen Monat nach Goethes Flucht aus Wetzlar bat er Kestner, ihm seine Reisepistolen zu leihen, unter dem Vorwand, verreisen zu müssen. Obwohl Kestner diesen Praktikanten kaum kannte, händigte er ihm seine beiden Pistolen aus.
Am nächsten Morgen wurde Kestner in die Wohnung Jerusalems gerufen. Was er dort gesehen hatte, verfolgte ihn bis heute. Jerusalem lag vollständig angekleidet und in seinen braunen Stulpenstiefeln auf dem Bett. Sein blauer Rock, seine gelbe Weste und die lederne Kniehose waren über und über mit Blut beschmiert und sein Kopf durch den Schuss völlig entstellt. Auf dem Boden seines Zimmers breitete sich von seinem Schreibtisch bis zum Fenster eine große Lache getrockneten Blutes aus.
Dort, auf dem Boden neben dem Schreibtisch, hatte der Hausmeister Jerusalem am Morgen entdeckt. Er röchelte noch. Der Hausmeister rief einen Arzt. Der konnte Jerusalem jedoch nicht mehr retten und stellte fest: Er hatte sich in der Nacht mit der Pistole durch das rechte Auge in den Kopf geschossen, war auf den Boden gestürzt, hatte sich zum Fenster und wieder zurück zum Schreibtisch gewälzt. Der Arzt und der Hausmeister legten ihn samt der Pistole auf sein Bett, dann starb er.
Kurz nach diesem schrecklichen Erlebnis schrieb Kestner einen ausführlichen, bewegten Bericht über Jerusalems Selbstmord an Goethe nach Frankfurt, und Goethe dankte ihm für die genaue Schilderung.
Eine Obduktion bestätigte, dass sich der Selbstmörder mit Kestners Pistole erschossen hatte. Kestner wurde stark gerügt, weil er seine Dienstwaffen einem Fremden ausgeliehen hatte, und er musste eine hohe Strafe zahlen. Nur unter einer strengen Auflage erhielt er seine Reisepistolen zurück. Noch immer quälte ihn der Gedanke, dass Jerusalem durch seine Waffe aus dem Leben schied.
Am Palmsonntag des darauffolgenden Jahres heirateten Kestner und Lotte mit Goethes Eheringen. Er war zweiunddreißig und sie zwanzig. Im selben Jahr 1773 eröffnete sich für Kestner ein gewaltiger Karrieresprung. Er wurde zum Archivsekretär und Hofrat am kurfürstlichen Hof Hannover berufen. Also Umzug von Wetzlar nach Hannover.
Im Mai 1774 brachte Lotte ihren ersten Sohn zur Welt, für den Goethe die Patenschaft übernahm und den sie ihm zuliebe auch Wolfgang tauften.
Im Herbst desselben Jahres gab es auf der Leipziger Buchmesse eine Sensation. Anonym war ein Briefroman erschienen: »Die Leiden des jungen Werthers«. Natürlich wurde schnell bekannt, wer der Autor war: ein fünfundzwanzig Jahre junger Mann aus Frankfurt. Ein gewisser Johann Wolfgang Goethe, bereits berühmt durch sein Schauspiel »Götz von Berlichingen«, das ein Jahr zuvor erschienen war.
Bald erhielten Kestner und Lotte in Hannover ein vom Dichter signiertes Exemplar. Aus der kurzen Liebesepisode mit Lotte hatte Goethe in seinem »Werther« eine Riesengeschichte gemacht. Alles völlig übertrieben und das meiste falsch dargestellt. Er hatte es in seiner Phantasie so beschrieben, wie er es sich in seiner Leidenschaft gewünscht hatte. War eben ein Dichter.
Werthers Lotte war ganz anders als Kestners wirkliche Lotte. Bei Goethe glänzten ihre Augen tiefschwarz. Seine Lotte hatte blaue Augen. Im »Werther« spielte Lotte auf dem Spinett. Dazu hätte seine Lotte gar keine Zeit gehabt. Sie hatte sich um die zehn Geschwister kümmern müssen. Außerdem besaß sie gar kein Spinett. Sie war auch nicht so temperamentvoll wie die Lotte im »Werther«. Sie war ruhiger, ein Hausmütterchen. Aber das hätte natürlich nicht in einen heißblütigen Liebesroman gepasst. Da musste das Erlebte ein bisschen angepasst und hin und her geschoben werden. Dichtung statt Wahrheit.
Und das Wichtigste: Im Briefroman erschoss sich Lottes Liebhaber Werther. In Wirklichkeit aber hatte sich ein anderer erschossen. Nämlich der Jurapraktikant Karl Wilhelm Jerusalem. Allerdings auch wegen einer Liebesaffäre. Den Bericht, den Kestner über den Selbstmord an Goethe geschickt hatte, hatte dieser Wort für Wort für seine Beschreibung verwendet. So war der Suizid Jerusalems zum Suizid des jungen Werthers geworden. Auch Jerusalems Kleider legte der Dichter seinem Werther an.
Der Briefroman wurde für Goethe zu einem sensationellen Erfolg. Viel verdiente er damit nicht, aber er wurde dadurch noch berühmter, als er durch seinen »Götz« ohnehin schon war. Ein wahres »Werther-Fieber« griff um sich. Junge Männer kleideten sich in blauem Frack mit blinkenden Messingknöpfen, mit gelber Weste, lederner gelber Kniehose und halbhohen braunen Stulpenstiefeln. Es gab ein Parfüm Eau-de-Werther, Werther-Fächer, Werther-Ziertüchlein, Werther-Medaillons, Werther-Tassen, Werther-Krüge, Werther-Schnitzel.
Auch Lotte war durch das Buch berühmt geworden. Ihre Bekanntheit aber geriet ihr zum Fluch. Alle wollten plötzlich diese Lotte sehen. Fremde Menschen drangen ins Haus ein, um einen neugierigen Blick auf Werthers Lotte zu werfen. Immer wieder musste sie die Gaffer hinausdrängen. Auch heute noch, neun Jahre nach Erscheinen.
Kestner war von diesem Ansturm verschont geblieben. Im »Werther« hieß Lottes Verlobter nicht Kestner, sondern Albert. Er kam also in diesem Bestseller gar nicht vor.
Was er nicht begreifen konnte: So viele junge Menschen, Männer und Mädchen, hatten sich nach der Lektüre des »Werther« erschossen, ertränkt, erhängt. Eine Selbstmordseuche war ausgebrochen. Das ging ihm nicht in den Kopf. Nach dem Lesen dieses Romans brachte man sich doch nicht um.
Lange hatte Kestner es Goethe verübelt, dass dieser ihn in der Figur des Albert so unvorteilhaft dargestellt hatte. So fad und langweilig, so blass und tranig. So war Kestner gar nicht gewesen. Er hatte sich verfälscht gefühlt und sich bei ihm beschwert. Geantwortet hatte Goethe ihm in vielen Briefen, dass er Albert aus dramaturgischen Gründen so kontrastreich zu Lotte gestalten musste. Er habe einen Kontrapunkt zu Lotte schaffen wollen. Das hatte Kestner eingesehen und ihm vergeben.
Bald darauf hatte Goethe ihnen geschrieben, dass er an einem neuen Stück mit dem Titel »Faust« arbeitete. Darin ließ er einen ganz besonderen Teufel auftreten, den er Mephistopheles nannte. Es werde aber noch eine Weile dauern, bis sein »Faust« fertig sei und gedruckt werden könne. Vorerst sei sein Werk nur ein Fragment. Doch seinen Mephisto mit seinen hinterhältigen Teufeleien sehe er bereits ganz deutlich vor sich.
Aus Goethes weiteren Briefen, die er Lotte und Kestner aus Weimar sehr ausführlich nach Hannover geschrieben hatte, wussten sie, was für eine Karriere er inzwischen gemacht hatte. Da Goethe mit dem Erscheinen des »Werther« ein berühmter Mann geworden war, hatte der achtzehnjährige Herzog Carl August ihn, den acht Jahre älteren Dichter, 1775 zu sich nach Weimar geholt. Das Schloss des Herzogs war ein Jahr zuvor abgebrannt, sein Herzogtum völlig bankrott, der ihn umgebende Adel korrupt. Carl August benötigte Glanz für seinen Hof, eine Berühmtheit, die seinen Hofstaat schmückte. Um Goethe in Weimar zu halten, überfütterte der jugendliche Herrscher ihn mit Privilegien und Staatsämtern. Goethe wurde sein intimster Freund. Er machte ihn zum Mitglied des Geheimen Rats im Geheimen Consilium, dem engsten Beratergremium der Regierung, das in letzter Instanz über alle Geschäfte des Herzogtums entschied, ernannte ihn zum Kriegsminister und Finanzminister und adelte ihn. Johann Wolfgang Goethe war nun ein »von Goethe« und ließ sich mit »Exzellenz« anreden. Dazu organisierte er am Hof als Maître de Plaisir Maskenbälle, Redouten, Theatervorstellungen.
Was für eine Karriere! Im Gegensatz zu Kestner, dem Hofarchivar, aber immerhin Hofrat. Dabei hatten sie am selben Tag Geburtstag.
ZWEI
Kestner hasste Reisen mit der Kutsche. Sie rissen ihn jedes Mal völlig aus seinem gewohnten Alltag heraus. Kutschreisen bedeuteten ein Einzwängen zwischen unangenehmen Fremden in engen, rumpelnden Kästen auf harten Holzbänken, schlechtes, teures Essen in den Gasthöfen, schmutzige, kalte Betten. Er musste froh sein, wenn er sich unterwegs keine Flöhe, Wanzen oder Läuse einfing. Und nach jeder Rückkehr benötigte er ein paar Tage, um wieder in seine geordneten Zustände zurückzufinden. Am liebsten wollte er ganz darauf verzichten. Als Gesandter des Reichskammergerichts musste er früher oft zu Inspektionsvisiten verreisen. Nun hatte er keine Lust mehr, sich solchen Strapazen auszusetzen.
Jetzt aber musste er nach Weimar. Es half nichts. Auftrag war Auftrag, und Dienst war Dienst.
Während Lotte weiter seine Reisetasche packte, seine Wäsche faltete und sie sorgfältig verstaute, studierte Kestner in einem kleinen Hausatlas die bevorstehende Strecke. Wie immer wollte er sich ordentlich vorbereiten und alles genau wissen. Sie führte über Seesen und Osterode westlich am Harz entlang, dann an der Südseite des Harzes über Nordhausen bis Sangerhausen und schließlich nach Süden über Sömmerda und Erfurt nach Weimar. Mit Grausen sah er der Kutschfahrt entgegen. Drei Tage hin, drei Tage zurück. Sechs Tage lang nur Mühsal und Unannehmlichkeiten. Er sehnte jetzt schon die Stunde herbei, in der er nach dieser Tour wieder bei Lotte und in seinem Archiv ankommen würde.
Als Kind hatte Kestner oft voller Reisefieber den bepackten Kutschen nachgesehen. Einmal in so einem Wagen durchs Land fahren! Durch das ganze Kurfürstentum hindurch, von einer Grenze zur anderen. Davon träumte er als Kind. Stundenlang trieb er sich damals mit seinen Freunden an der Poststation herum und bestaunte die großen, schnaubenden Pferde und die merkwürdigen Reisenden mit ihren Hüten und sonderbaren Gepäckstücken. Allzeit bereit, für ein paar Kreuzer die kleinen Gepäckstücke flink in das Hotel zu tragen, was sie gerade schnappen konnten. Doch immer wieder hatten die Lakaien des Hotels sie weggestoßen. Sie hatten sich das Kleingeld selbst verdienen wollen.
Lorenz freute sich auf die Reise. Er nahm sie als Abenteuer. Für ihn war es das erste Mal, eine so lange und weite Reise zu unternehmen. Von seinem Elternhaus in Celle war er noch nie weiter in die Welt gekommen als bis Hannover. Weimar bedeutete ihm nichts. Er wusste gar nicht, wo es lag. Auch von Goethe hielt Lorenz wenig. Eigentlich nichts. Er kannte nichts von ihm. Aus Gerüchten, die in Celle und Hannover herumschwirrten, wusste er nur, dass der junge Dichter wohl einmal eine Liebschaft mit der damaligen Verlobten seines Chefs gehabt hatte. Aber Schiller kannte Lorenz, besonders seine »Räuber«.
Der erste Tag bis Osterode verlief ohne besondere Zwischenfälle. Zwar rumpelte und holperte die Kutsche über die gepflasterten, oft löchrigen Chausseen, dass Kestner die Stöße schmerzhaft bis in seine Hüften spürte und sich an der Sitzkante festhalten musste. Aber das war normal.
Am Anfang machte sich Lorenz ein Vergnügen daraus, sich neben den Kutscher auf den Bock zu setzen und für kurze Zeit selbst die Zügel in der Hand zu halten. Bald aber kam er völlig verfroren zurück in den Wagen und erzählte, dass er den Kutscher ein paarmal habe wecken müssen, weil dieser eingeschlafen war.
Unterwegs stiegen immer wieder Reisende aus, neue kamen hinzu. Der Erträglichste war der Mann, der den lieben langen Tag lang allen erzählte, wo er schon überall gewesen war. In Hamburg, in Heidelberg, in Ulm, sogar auf der Wartburg. Und einmal sei er über die Alpen nach Venedig gefahren. Da wäre die Kutsche, als die Pferde scheuten, beinahe in eine tiefe Schlucht gestürzt. Die Zuhörer schauderte es. Zuletzt sei er in Leipzig auf der Buchmesse gewesen. »Nichts mehr los«, kritisierte er. »Früher war dort viel mehr los und alles viel besser.«
In Osterode wurden sie im Gasthof »Zum Goldenen Horn« einquartiert. Als Kestner und Lorenz die Gaststube betraten, hätte es sie beinahe umgehauen. Aus dem völlig überfüllten Raum schlugen ihnen Rufe, Schreie, Lachen, Trompetenstöße und Gebrüll entgegen, das Gesang sein sollte. Es war ein Getöse, als wollte man die Gaststätte einstürzen lassen. Die Menschen, die den Lärm verursachten, konnten sie kaum erkennen. Die enge Stube war eingetaucht in dichten Tabakrauch und den düsteren gelblichen Schein der Laternen, die von der niedrigen Decke herabhingen.
Nachdem sie sich mit den anderen Reisenden zum Tresen durchgekämpft und nach ihren Schlafkammern erkundigt hatten, schrie ihnen die Wirtin entgegen: »Schützenfest! Alles belegt! Mal sehen, wo wir noch Platz schaffen! Schützenfest! Taubenschießen!« Dabei füllte sie einen Bierkrug nach dem anderen. Notfalls sollten sie auf den Dielen im Flur schlafen oder, wenn sie Glück hatten, zusammen mit mehreren Fremden in einem Doppelbett.
Bis die Verteilung der Schlafplätze geklärt war, mussten sich Kestner und Lorenz auf die letzte Kante einer langen Holzbank hocken, auf der sich breite Leiber drängten. Dicke Frauen schleppten bis zum Rand gefüllte Bierkrüge zu den Tischen und knallten sie auf die Holzplatten. Immer wieder wurden mit Essen vollgepackte Teller dazwischengestellt. Kestner und Lorenz konnten gebratene Tauben, Klöße und Kraut erkennen.
Schnell leerten sich die Krüge und die Teller und füllten sich die Leiber. Der Hunger stach in Kestners und Lorenz’ Mägen, so bestellten auch sie Taubenbraten. Er war zäh, und in der undefinierbaren Soße schwammen Flaumfederchen. Sie ließen die Hälfte stehen und hatten nur noch den Wunsch, irgendwo schlafen zu können. Der infernalische Lärm aus Gegröle und Blechmusik um sie herum steigerte sich ins Monströse, und manchmal hatten sie den Eindruck, als würden Teller und Krüge durch die Luft fliegen.
Schließlich führte sie der Wirt in eine Kammer im ersten Stock. In einem Doppelbett schnarchten bereits drei halb ausgezogene Männer. Sie mussten sich dazwischenlegen.
Im Schlaf küsste der Mann neben Kestner dessen Hände und murmelte »Mariechen, Mariechen«, und der Mann neben Lorenz umarmte ihn mehrmals sehr eng. Sie waren froh, als die Nacht endlich vorüber war und sie weiterreisen konnten.
Ab Osterode sprang der Teufel aus dem Weihwasserbecken. Da stieg eine feine Dame in einem weißen Pelzmantel zu. Ihr wulstiges Unterkinn hing tief herab. Kaum war die Kutsche abgefahren, knöpfte sie ihren Pelzmantel auf. Zum Vorschein kam ein hoch aufgestapelter Busen unter einem Brusttuch, an dessen Saum sich Häkeleien reihten, die an Türmchen erinnerten. Und unter dem Brusttuch kam ein dicker Mops zum Vorschein, der sich an ihren Busen schmiegte. Das Mitnehmen von Hunden in die Kutsche war verboten. Die Dame interessierte das nicht, sie holte ihn hervor und quetschte ihn auf die Holzbank zwischen sich und Lorenz. Es dauerte nicht lange, da kotzte der Mops auf die Bank, direkt neben Lorenz. Noch rechtzeitig genug konnte er in der letzten Sekunde aufspringen.
»Er kann das Schaukeln nicht vertragen«, erklärte die Dame.
»Wir auch nicht!«, rief Lorenz erbost. »Deshalb kotzen wir noch lange nicht die Sitze voll.«
Mit angezogenen Knien musste er sich zwischen die Füße der Reisenden auf den Boden hocken. Um sich den Anblick der verdreckten Schuhe zu ersparen, schloss Lorenz die Augen.
Der säuerliche, ekelerregende Gestank in der Kutsche war unerträglich. Da kramte eine andere, sehr magere Dame ihren Flakon mit Riechwasser hervor. Ihr Gesicht schien nur aus einem Mund zwischen den beiden Ohren zu bestehen und in der Mitte aus einem gewaltigen Nasenkolben. Mit zitternden Händen schraubte sie ihr Riechfläschchen auf und verschüttete durch das Ruckeln des Wagens den gesamten Inhalt. Sofort überfielen alle heftige Hustenanfälle.
»Immerhin besser als der Kotzegestank«, bemerkte sie spitz.
Um die Parfümstinkerei zu verdrängen, zündete sich der Mann neben ihr eine dicke Zigarre an, obwohl das Rauchen in der Kutsche streng verboten war. Von erneuten Hustenanfällen geschüttelt, empörten sich die Reisenden über den Qualm. Der Zigarrenraucher versuchte sie zu beruhigen: »Das Aroma meines Tabaks duftet unvergleichlich besser als diese Parfümverpestung.«
Die Dame mit dem leeren Flakon geriet außer sich, verlor ihre Contenance und schlug mit ihrem Handtäschchen auf den Raucher ein. Dabei fiel seine Zigarrenasche auf ihr Seidenkleid.
Sie explodierte vor Wut.
Hundekotze, Parfümgestank, Zigarrenrauch. In der Kutsche konnte man kaum noch atmen. Ein Öffnen der Fenster war nicht möglich. Dafür war es draußen zu kalt. Erst bei der Mittagsrast in Nordhausen wischte man den vollgekotzten Sitz notdürftig ab, streute Sägemehl darüber und durchlüftete den Wagen. Dass die Dame mit dem Mops wieder zusteigen durfte, war nur durch eine saftige Bestechung des Kutschers möglich. Lorenz konnte sich in das Sägemehl auf seiner Bank setzen, holte ein kleines Büchlein hervor, las darin und kicherte. Als er wieder mal laut auflachte, stellte Kestner beiläufig fest: »Du scheinst dich ja mächtig zu amüsieren.«
Lorenz nickte, las weiter und gluckste vor Vergnügen.
»Was liest du denn da?«, wollte Kestner wissen.
Er zeigte ihm die Titelseite. »›Freuden des jungen Werthers‹. Ist sehr lustig.«
Kestner kannte diese Satire von Nicolai. Seine Erlebnisse damals mit Goethe waren nicht sehr lustig. Lorenz gibbelte weiter vor sich hin.
Spät am Abend kamen sie in Sangerhausen an. Das war ihre zweite Übernachtungsstation. Im »Adler« herrschten nicht so höllische Zustände wie im »Goldenen Horn«. Das Gasthaus war längst nicht so überfüllt. Trotzdem, die gebratene Leber, die Kartoffeln und der Rotkohl waren fast kalt. Immerhin erhielten sie in einer kleinen Kammer zwei getrennte Betten. Die waren viel zu schmal und zu kurz und die Kammer nicht geheizt.
Bei entsprechender Zuzahlung hätte Kestner besseres Essen, bequemere Betten und geheizte Zimmer haben können. Immerhin war es Ende November. Doch dafür hatte er nicht genügend Geld. Sein Reisebudget war sehr streng kalkuliert.
Am nächsten Morgen mussten sie in aller Frühe weiter. Sie hatten keine Zeit, sich aus der Blechschüssel zu waschen. Zum hastigen Frühstück gab es nur einen Kanten Brot und einen Schluck Bier. In der Dunkelheit und Morgenkälte stiegen nach ihnen auch wieder die Dame mit dem Mops, die Frau mit dem Parfümflakon und der Zigarrenraucher zu.
Nur noch ein Tag bis Weimar. So lange mussten Kestner und Lorenz durchhalten.
Es kam zwar zu keinem neuen Streit zwischen Mopsdame, Flakonfrau und Raucher, aber Kestner hatte von der ganzen Reise jetzt schon genug. Dreimal am Tag Pferdewechsel. Dabei jeweils eine Stunde Aufenthalt. Der Halt konnte genutzt werden, um die Toiletten aufzusuchen. Falls diese Aborte überhaupt zu betreten waren. Oft kamen Kestner, Lorenz und die anderen Reisenden mit zusammengekniffenen Gesichtern zur Kutsche zurück. Schon beim Öffnen der Klotüren hatte es ihnen das Bedürfnis verschlagen, sich zu entleeren. Sie waren gezwungen, es bis zum nächsten Halt auszuhalten. Wenn es gar nicht mehr anders ging, mussten sich die Männer unterwegs an einen Baum stellen und die Damen sich hinter entfernten Büschen verstecken.
Während der gesamten Fahrt wurden immer wieder neue Beträge verlangt: Chausseegeld, Brückengeld, Futtergeld für die Pferde, Ausspanngeld, Einspanngeld. Bei jedem Halt, ob zur Mittagsrast oder zur Übernachtung, drängten Händler sie dazu, aus ihren Bauchläden bunte Bänder, Souvenirs, Schuhcreme, Bürsten oder Abführpulver zu kaufen. Sie verfolgten die Reisenden bis in die Gasthäuser, klammerten sich an sie bis zu ihren Eintragungen in die Fremdenbücher. Manchmal sogar bis in ihre Kammern.
In der letzten Station in Erfurt wollte ein feiner Herr zusteigen. Seiner Uniform nach war er ein preußischer Offizier. Doch die Kutsche war voll besetzt. Um für ihn Platz zu machen, musste der Mann aussteigen, der allen von seinen Reisen erzählt hatte. Seine Proteste waren vergebens. Er musste zurückbleiben.
Als Einziger der Reisenden durfte dieser würdige Offizier seine große Reisetasche mit in die Kutsche nehmen. Schon bald gab es im Wagen zwischen dem Zigarrenraucher und dem Preußen eine Schlägerei. Die Mitreisenden schrien aus den Fenstern: »Halt! Halt!«
Der Kutscher hörte nicht. Wahrscheinlich war er wieder im Suff auf dem Bock eingeschlafen.
Da nahm Kestner seine beiden Reisepistolen, lud sie und schoss damit aus dem Fenster in die Luft. Das hörte der Kutscher. Der Wagen hielt an. Mit schwerer Zunge drohte der Kutscher dem Zigarrenraucher, ihn auf die Chaussee zu werfen, sollte er sich nochmals mit dem feinen Herrn prügeln. Lallend wies er ihn zurecht: »Man schlägt sich nicht mit einem Adeligen. Schon gar nicht mit einem von Wolfsburg!«
Lorenz wunderte sich gar nicht, dass dieser Mensch ein Adeliger war. Er kannte diese Sorte aus der »Teutschen Chronik« seines Schubart. Darin wurden sie oft in ihrer Selbstherrlichkeit beschrieben.
DREI
Beim Erfurter Tor musste die Kutsche anhalten. Endlich war Kestner am Ziel. Noch nicht ganz. Aber knapp davor.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!