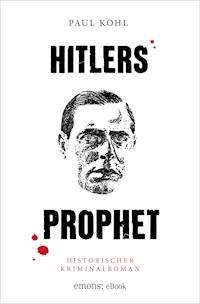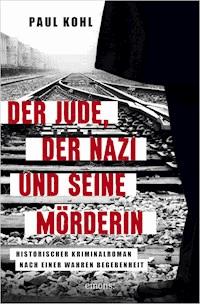Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Köln Krimi Classic
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Köln 1955: Die Leiche eines prominenten Bauunternehmers wird in der Baugrube des neuen Opernhauses entdeckt. Selbstmord entscheidet die Kripo und beschließt, nicht zu ermitteln. Da taucht ein Kriegsheimkehrer im Kommissariat auf und macht eine verhängnisvolle Aussage. Der ehemalige Gauleiter von Köln, der im Hintergrund noch immer die Fäden spinnt, ordnet an: Der Mann muss 'fottjemaat' werden. Doch da sind der junge Journalist vom Stadt-Anzeiger und den Kriminalassistent, die den Deckel vom Topf der braunen Suppe nehmen. Nun wird es auch für sie gefährlich – lebensgefährlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Kohl, geboren 1937 in Köln, war dort Mitte der fünfziger Jahre als Buchhändler tätig. Heute ist er Hörfunk- und Buchautor und schreibt vorwiegend über sozialkritische und zeitgeschichtliche Themen. Sein Schwerpunkt: der Überfall auf die Sowjetunion. Paul Kohl lebt und arbeitet seit 1970 in Berlin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Heribert Stragholz Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch, Berlin eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-660-7 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
1
Donnerstag, 5.Mai 1955
Durch die Pariser Verträge endet um zwölf Uhr mittags das Besatzungsregime in der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik ist nun ein souveräner Staat.
Aufruhr herrschte an diesem Donnerstagvormittag am Neumarkt. Menschenmassen drängten sich zwischen Schildergasse und St.Aposteln. Dazwischen Polizisten mit ihren schwarz glänzenden Tschakos, in den Händen Gummiknüppel, und berittene Polizei hoch zu Ross. Auf der gegenüberliegenden Seite des Neumarkts eilten Mannschaftswagen mit Blaulicht und Martinshorn hin und her. Der Kreisverkehr der Straßenbahnen war stillgelegt. Sie stauten sich bis weit in die Cäcilienstraße hinein.
Der Demonstrationszug kam aus der Schildergasse, zog am Trümmergrundstück vorbei, auf dem der Neubau von Hertie vorbereitet wurde, vorbei an der Radiohandlung Graf, der Commerzbank, der WKV Waren-Kredit und dem hell und sauber leuchtenden Neubaukoloss der Kreissparkasse. Bei St.Aposteln bog er in die Mittelstraße ein Richtung Rudolfplatz. Dort sollte die Abschlusskundgebung mit einer Ansprache des Bonner SPD-Parlamentariers der Opposition Heinz Kühn stattfinden.
Besonderes Aufsehen erregte unter den Zuschauern am Straßenrand das Transparent »Nazi-Generäle in der neuen Bundeswehr – Heusinger, Speidel, de Maizière– Trettner, Kielmansegg– Alle weg!«.
Einige der Zuschauer auf dem Bürgersteig applaudierten, andere schüttelten voller Unverständnis und Missbilligung den Kopf, die meisten aber beschimpften die Demonstranten, drohten mit den Fäusten und brüllten: »Arbeitsscheues Gesindel!« und »Geht doch rüber!« Die Fahrgäste, die auf ihre Straßenbahn warteten, waren wütend, weil man wegen dieses »Kommunisten-Packs« ihre Elektrische stillgelegt hatte.
Stefan Pütz stand vor der Kreissparkasse und schaute den Demonstranten zu. Absichtlich hatte er seinen Apparat nicht mitgenommen. Er wollte sie nicht fotografieren, um nicht in den Verdacht zu geraten, ein Polizeispitzel zu sein. Sein Freund Andi dagegen machte Aufnahmen. Am Oberarm trug er die weiße Binde mit der Aufschrift »Presse«. Er brauchte die Fotos für seinen Artikel, der morgen im Kölner Stadt-Anzeiger erscheinen sollte.
Vor einer Woche hatte Pütz fast an der gleichen Stelle am Neumarkt gestanden, als Caterina Valente in der Radiohandlung Graf anlässlich des Erscheinens ihrer neuesten Single eine Autogrammstunde gegeben hatte. Jubelnde Menschenmassen waren versammelt gewesen, ein riesiges Polizeiaufgebot hatte eine Fahrbahn gesperrt und sich schützend vor den Schaufensterscheiben des Schallplattenladens postiert, damit diese nicht von den drängenden Menschen eingedrückt wurden. Wie Trauben hatten die Menschen aus den Fenstern der Bürogebäude gehangen, und als die Valente mit ihrem Wagen vorfuhr, war ein Freudenschrei durch die Menge gebraust, alle hatten die Arme hochgerissen, gewunken und gerufen: »Ca-te-ri-na! Ca-te-ri-na!«
Jetzt riefen die Demonstranten: »Kei-ne NA-TO! Kei-ne NA-TO!«
Etwas entfernt von Pütz standen seine Kripo-Kollegen Herkenrath, Bohnsack und Braubach in einer Gruppe beisammen und knipsten eifrig die Protestierenden.
Die Pferde der berittenen Polizei schnaubten erschreckt und stoben wild hin und her. Demonstranten und Zuschauer wichen ängstlich zurück, wenn die Gäule mit Schaum im Maul scheuten und sich aufrichteten. Es war gefährlich, in die Nähe ihrer tretenden Hufe zu geraten. Hoch zu Ross verschafften sich die Polizisten Respekt. Einige junge Leute beeindruckte das jedoch überhaupt nicht. Sie warfen Knallkörper zwischen die Beine der Pferde, um die Reiter und damit die Staatsmacht zu Fall zu bringen. Da wurde es besonders gefährlich. Die Pferde gerieten in Panik, und die Reiter hatten Mühe, ihre Pferde im Zaun zu halten. Manch einer wäre tatsächlich beinahe gestürzt.
Pütz sah, wie Polizisten nach solchen Attacken einzelne junge Demonstranten herausgriffen und die sich heftig Wehrenden abführten. In seiner Nähe wurde eine junge, etwa zwanzigjährige blonde Frau aus dem Zug herausgeholt. Sie schlug um sich und schrie. Andere Demonstrationsteilnehmer wollten ihr beistehen, wollten sie aus dem Griff der Polizei befreien. Sie wurden ebenfalls abgeführt. Als Andi diesen Vorfall fotografierte, stieß ihn ein Polizist rüde beiseite. Beinahe hätte er ihm die Kamera aus den Händen geschlagen. Die junge Frau verschwand Augenblicke später hinter einer Polizeikette.
»Hoffentlich hab ich sie gut im Kasten«, sagte Andi zu Pütz.
2
Samstag, 7.Mai
Nach seiner Rückkehr aus Argentinien unternimmt der ehemalige Inspekteur der NS-Jagdluftwaffe, General a.D. Adolf Galland, über dem Flughafen Düsseldorf Probeflüge mit Übungsflugzeugen für die neue deutsche Luftwaffe. Galland soll im Amt Blank bei der künftigen deutschen Luftwaffe eingesetzt werden.
Es war ein warmer Nachmittag. Die Sonne versprach ein schönes Wochenende. Pütz und Andi saßen auf dem kleinen Platz vor dem »UKB-Stüffge«. Auf dem wackeligen Gartentisch vor ihnen stand frisch gezapftes Kölsch. Wenn sie mit ihren Füßen versehentlich an die Tischbeine stießen, drohten die Gläser jedes Mal umzukippen. Immer neue Bierdeckel klemmten sie unter die Metallbeine, es half nichts.
An der Hauswand lehnten zusammengeklappte Stühle mit Sitzen aus Holzlatten. Daneben hing ein Zigarettenautomat, aus dem man auch verklebte Liebesperlen ziehen konnte.
Zu dieser Zeit war im »Stüffge« noch nicht viel los. Der Wirt mit seiner schmuddeligen Schürze um den Bauch stand dösend in der Tür und sah den Kindern zu, wie sie auf einem Bein in den Kästchen hin und her hüpften, die sie mit Kreide auf die Straße gemalt hatten. In der leeren Kneipe bereitete Uschi Portionen von »Halve Hahn« vor und packte die frischen Frikadellen aus, die Matthes' Metzgerei von nebenan gerade geliefert hatte. Am großen runden Familienstammtisch saß wie so oft Uschis achtjährige Tochter tief über ihr Heft gebeugt und machte Schulaufgaben.
Das Lebensmittelgeschäft Wingert gegenüber hatte noch geöffnet. An der Hauswand blätterte die weiße Schrift »Milch Eier Butter Käse« langsam ab, und vor dem Schaufenster saßen auf den leeren Obstkisten Nachbarn, erzählten und lachten. Im Haus daneben lehnte wie immer Mama Lisbeth aus ihrem Parterrefenster, die Ellbogen auf ein Kissen gestützt, und beobachtete alles, was auf der Straße geschah. Was sie sah und hörte, wusste bald ganz Unter Krahnenbäumen. Noch ein Haus weiter zur Ecke An den Linden waren beim Haushaltswarenladen Hürtgen schon die Gitter heruntergelassen. Hier hatte Pütz seine Töpfe und Pfannen gekauft, als er vor einigen Jahren über der Kneipe eingezogen war.
Er gab dem Wirt ein Zeichen für zwei neue Kölsch.
»Nochens!«, rief der Wirt, fast ohne sich zu bewegen, zum Tresen hinein.
Hingefläzt und halb hinter Andis Rücken versteckt, machte Pütz heimlich Fotos von den Nachbarn gegenüber. Vor einigen Tagen hatte er sich von seinem Gehalt als Kriminalassistent bei Schmitt & Schmitt in der Hohe Straße eine Voigtländer gekauft: den neuesten Apparat zum Aufklappen. Eigentlich zu teuer für seine Verhältnisse, aber er wollte sie haben. Fotografieren war seine Leidenschaft. Nun probierte er seine Neuanschaffung aus.
Am schräg gegenüberliegenden Hauseingang mühten sich zwei Frauen ab, einen riesigen Korb mit Kartoffeln durch die schmale Tür zu bugsieren. Fluchend und lachend versuchten sie immer wieder, ihre Fracht durch den Eingang zu zwängen. Daneben stand an die Wand gelehnt ein Bursche, sah ihnen grienend zu, drückte seine Schiebermütze noch tiefer ins Gesicht und spuckte lässig auf das Pflaster. Schnell und verstohlen fotografierte Pütz aus seiner Deckung die Szene, da schaute der Bursche plötzlich zu ihm herüber.
Uschi brachte zwei Gaffel, neigte sich mit ihrem braunen Lockenkopf und ihrem duftenden Busen tief zu Pütz herab und zog mit ihrem Stift je einen neuen Strich auf die Bierdeckel. Wieder mal genoss er es, wie angenehm sie roch.
»Prösterchen«, sagte sie lächelnd.
»Warum spielt deine Kleine nicht mit den Kindern auf der Straße?«, fragte er.
»Die sitzt lieber drinnen und malt. Soll ich euch was zu essen bringen?«
Pütz und Andi nickten. »Wie immer.«
Uschi richtete sich auf und ging langsam, ihr Tablett schwenkend, zurück in die Kneipe. Pütz sah ihr nach. Sie trug einen kurzen, straff über den Po gespannten Rock.
»Ich glaube, du setzt dich nur wegen ihr so oft hierher«, frotzelte Andi. Grinsend prosteten sie sich zu, tranken und wischten sich den Bierschaum vom Mund.
Ein Pferd zog einen Karren von Merlins Kohlenhandlung vorbei und hielt ein paar Häuser weiter an. Der Klüttenmann wuchtete eine Hucke mit Briketts auf seinen Rücken, wobei einige auf das Pflaster fielen und zerbrachen, und verschwand durch eine Kellertür. Kaum war er verschwunden, eilten zwei Kinder herbei, sammelten die Brikettstücke auf und liefen damit davon.
Uschi brachte für jeden von ihnen eine faustgroße Frikadelle, dazu das Senfpöttchen und zwei Röggelchen. Sie klecksten mit dem Löffel Senf auf die Teller, tippten ihre Frikadellen hinein und bissen ab. Uschi verschränkte ihre nackten Arme vor ihrer Brust, blieb einen Moment neben Pütz stehen und schaute ihnen zu, wie es ihnen schmeckte. Als sie langsam in die Kneipe zurückging, sah er ihr kauend nach.
»Macht man nicht.« Andi stieß ihn mit dem Ellbogen an.
»Dass ich ihr nachsehe oder dabei kaue?«
»Beides.«
Kennengelernt hatten sie sich vor fünf Jahren. 1950 besuchte Stefan Pütz die Polizeischule, Felix Andernach war Lehrling in der Ringbuchhandlung Nethe am Hohenzollernring. Pütz benötigte damals Bücher für seine Ausbildung, und Andi bestellte sie für ihn. Als Pütz dann eine Anstellung bei der Schutzpolizei erhielt, stieg Andi bei Nethe zum Gehilfen auf. Bei seinen Besuchen in der Buchhandlung empfahl er Pütz so manches Buch und warnte ihn vor der Flut der erscheinenden Autobiografien der ehemaligen Wehrmachtsgeneräle und SS-Führer. »Alles Weißwäscherei«, hatte er ihm zugeflüstert. »Aber es wird wie verrückt gekauft.«
Als Pütz dann zwei Jahre später zur Kriminalpolizei überwechselte und seine Anwärterzeit und seine Lehrgänge absolvierte, entschloss sich Andi, Journalist zu werden, wurde Volontär beim Stadt-Anzeiger und besuchte die Journalistenschule. Auch während dieser Zeit trafen sie sich oft in Kneipen und Milchbars, sahen sich in der Brücke des British Center in der Cäcilienstraße die neuen amerikanischen und englischen Filme an, gingen ins Theater: in die provisorisch hergerichtete Aula der neuen Universität, wo sie den Ausdruckstänzer Harald Kreutzberg sahen und den Pantomimen Marcel Marceau. Sie besuchten auch die Kammerspiele der Städtischen Bühnen am Ubierring, in der ersten Etage über dem Völkerkundemuseum. Beide Bühnen waren bis zum Neubau eines eigenen Schauspielhauses ein Provisorium.
An eine Aufführung in den Kammerspielen konnte sich Pütz noch gut erinnern: Man spielte Brechts »Galilei«. Um zum Gebäudeeingang zu gelangen, mussten sie durch ein Spalier von wütenden Protestierenden. Die beschimpften sie und brüllten: »Kommunisten raus aus Kölner Bühnen!« Dazu hielten sie ein Transparent hoch: »Besucht kein Stück des Kommunisten Brecht!« Vor einem halben Jahr war Pütz Kriminalassistent im 1.Kommissariat und Andi zur gleichen Zeit Journalist beim Stadt-Anzeiger geworden. Manchmal machten sie sich lustig über ihren parallel verlaufenden Berufsweg und nannten sich scherzhaft »Brüder im Aufstieg«.
Andi hatte Pütz zwei Artikel mitgebracht, die im Stadt-Anzeiger erschienen waren: seine Reportage über die Anti-NATO-Demonstration am Donnerstag mit seinem Foto, das zeigte, wie die junge blonde Frau von Polizisten aus der Mitte der Teilnehmer herausgezerrt wurde, und seinen Bericht über einen Heimkehrer, der ihn gestern in der Redaktion besucht hatte.
Pütz las die Überschrift des Artikels: »Heimkehrer-Schicksal: Das Haus eine Ruine, die Frau unauffindbar, als Kommunist verleumdet.« Darunter stand: »Nach zehn Jahren russischer Kriegsgefangenschaft wollte der beinamputierte Kölner Heimkehrer Erwin Palm voller Freude zu seiner Frau eilen, doch sein Haus gab es nicht mehr. Er stand vor einer Ruine. Die Hausnachbarn waren fremde Menschen, die keine Ahnung hatten, wo seine Frau heute wohnen könnte. Palm fand bald Arbeit als Nachtportier beim Paketpostamt am Hauptbahnhof. Doch schon nach vier Tagen wurde ihm gekündigt. Als Begründung gab die Post an, er habe sich an der KPD-Kundgebung vom vergangenen Donnerstag beteiligt. Erwin Palm bestreitet dies. Er habe nur in der Schildergasse dem Vorbeimarsch der Anti-NATO-Demonstration zugeschaut. Nach zehnjähriger Russland-Gefangenschaft würde er auf seinen Krücken nie hinter einer roten Fahne herhumpeln. Die Verbitterung ist Erwin Palm ins Gesicht geschrieben. Seine Heimkehr hatte er sich anders vorgestellt. Er weiß nicht, wie es mit ihm nun weitergehen soll. Vorerst kann er noch im Kolpinghaus wohnen, wenn auch zurzeit ohne Arbeit und Geld.«
Unter beiden Artikeln stand das Kürzel »felan« für »Felix Andernach«. Neben dem Bericht war ein Foto von Palm zu sehen: ein mageres, verbittertes Gesicht mit einer zerknautschten Wehrmachtsmütze auf dem Kopf.
Andi deutete auf das Foto. »Er hat mir von dem Riesenempfang im Hauptbahnhof erzählt, von den Musikkapellen und den Transparenten mit der Aufschrift ›Willkommen in der Heimat‹, wie alle von ihren Frauen mit Blumen empfangen und umarmt wurden und wie sich alle freuten. Nur seine Frau war nicht gekommen. Traurige Sache.«
Uschis kleine Tochter kam mit einem Blatt Papier heraus und legte es auf den Tisch. Es war eine wilde Zeichnung.
»Hast du das gemalt?«, fragte Pütz. Die Kleine nickte stolz. Zu sehen war ein zweigeteilter Himmel: auf der einen Seite blau mit strahlender Sonne, auf der anderen Seite dunkel mit schwarzen Wolken. Darunter eine Frau und ein Kind. Pütz deutete auf das Kind. »Das bist sicher du.«
Sie nickte und zeigte auf die Frau. »Und das ist meine Mami.«
»Und wo ist dein Papi?«, fragte Pütz.
»Der ist nicht da«, sagte die Kleine ernst.
In diesem Moment erschien Uschi in der Kneipentür. »Nun lass die Männer in Ruh«, rief sie.
Die Kleine nahm ihre Zeichnung und ging zurück in die Kneipe.
Uschi fragte: »Noch 'n Schlückche?«
Andi hielt die flache Hand über sein Glas und schüttelte den Kopf.
»Und du, Stefan?« Sie lächelte ihn an.
Doch auch Pütz lehnte dankend ab. Mit einem Augenzwinkern und einem gekonnten Hüftschwung verschwand Uschi wieder.
»Jetzt weiß ich auch, weshalb Marlene nie mit runterkommt. Sie will euch zwei nicht stören«, stichelte Andi.
Pütz ging nicht darauf ein. Dass Marlene nie mit Pütz im »Stüffge« saß, hatte einen anderen Grund. Dieses Herumsitzen, ein Kölsch trinken, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, miteinander ziellos und absichtslos plaudern und dabei den Leuten auf der Straße zuschauen– das alles war für Marlene vergeudete Zeit. Ihre Treffen mit anderen hatten immer einen Zweck, ein Ziel.
»Dieses Veedel ist nichts für sie«, sagte Pütz. »Zu viel Volk.«
»Sie ist wohl was Besseres gewohnt.«
»Gar nicht. Sie stammt aus Deutz und will unbedingt in Marienburg wohnen.«
»So wie ich sie kenne, schafft sie das auch.«
»Davon bin ich überzeugt«, bestätigte Pütz.
In einem der gegenüberliegenden Fenster im obersten Stockwerk erschien eine Frau, nahm eine Zinkwanne vom Haken an der Hauswand und die getrocknete Unterwäsche vom Eisengestell unter dem Fensterbrett und rief eines der Kinder auf der Straße. Es machte eine abwehrende Bewegung und spielte mit den anderen Kindern weiter. Nach einer Weile kam die Mutter wieder ans Fenster und schimpfte heftig. Langsam trödelte das Kind ins Haus.
Andi erzählte von einem Artikel, an dem er gerade arbeitete. Es ging um das »Soho« von Bickendorf. Sechshundert Obdachlose waren dort in Notbehausungen untergebracht: in Baracken, Wohnwagen, abgewrackten Bussen. Mehrere Personen eingezwängt in winzigen Räumen, die Kinder strolchten zwischen den Müllhaufen und Schutthalden herum, streunende Hunde fraßen die weggeworfenen Abfälle. Und natürlich gab es überall Ratten.
»Und das Sonderbare«, sagte Andi, »mitten in dem Elend steht neben einem aufgebockten Bus ein Borgward. Ein gebrauchter Leukoplastbomber. Schon ein paar Jahre alt. Trotzdem: Wie kommt ein Obdachloser an so ein Auto? Woher hat er das Geld?«
***
Marlene riss die Tür zur Dunkelkammer auf: »Stefan! Hörst du denn nicht?«
»Tür zu!«, befahl er. Sie schloss die Tür hinter sich.
»Telefon für dich.«
»Verdammter Mist. Gerade jetzt.«
Pütz sah auf die Uhr: kurz vor elf. So spät noch ein Anruf. Er ging zum Apparat in der Diele. Der Dauerdienst war dran: Er wurde zu einem Einsatz gerufen.
»Was ist los?«, fragte Marlene.
»In der Baugrube des neuen Opernhauses hat man jemanden gefunden. Braubach ist schon unterwegs.«
»Reicht doch, wenn der Braubach da ist.«
»Reicht nicht. Bin schließlich sein Assistent.«
Marlene kehrte zu ihrem Zeichentisch zurück, an dem sie für den Neckermann-Katalog Damenkleider skizzierte, und Pütz ging verärgert wieder in seine Dunkelkammer, nahm seine Aufnahmen aus dem Fixierbad, schwenkte sie eilig in der Wässerung und hängte sie mit Wäscheklammern zum Abtropfen an eine Schnur. Es waren heimliche Aufnahmen von heute Nachmittag, als er mit Andi unten im »Stüffge« gesessen hatte. So gern hätte er auch die restlichen Fotos entwickelt. Doch nun musste er weg.
»Mist, verdammter!«, fluchte er.
Unter die abtropfenden Fotos legte er die Seite des »Kölner Stadt-Anzeigers«, die er von Andi erhalten hatte. Die Tropfen fielen auf den Artikel über den Heimkehrer Erwin Palm und auf das Foto, das Andi von ihm gemacht hatte. Das nasse Zeitungspapier wellte sich, und Palms verbittertes Gesicht mit der zerknautschten Wehrmachtsmütze zerfranste.
Pütz griff noch schnell einen Apfel, warf sich seinen Trenchcoat über, ging zu Marlene und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Dabei sah er auf ihre Zeichnungen: Blusen und Kostüme bis oben geschlossen, die Taille sehr, sehr eng und die Röcke glockenartig und weit. Die Modelle hießen Bellana, Mira, Tilly, Aline, Lydia und so weiter. Und die Damen, die diese Kleider trugen, sahen alle gleich aus: jung, blond, Puppengesichter. Ihre Arme hielten sie kapriziös gespreizt. Das sollte Vornehmheit ausdrücken.
»Hübsch«, kommentierte er flüchtig, obwohl er die Gestalten samt ihrer Gewänder abscheulich fand. Marlene wurde für ihre Zeichnungen gut bezahlt, im Gegensatz zu ihm, der für sein kleines Assistentengehalt auch noch nachts rausmusste.
»Wann kommst du denn wieder?«
»Keine Ahnung. Tschö.« Und weg war er.
Pütz parkte seinen alten Brezel-VW direkt bei der Großbaustelle neben einem Imbissstand. »Beim Jupp– Schnellimbiss« stand groß unter dem Flachdach, rechts und links davon hing Reklame von »Funke Kölsch«, »Coca-Cola« und »afri cola«. Pütz erinnerte sich, dass hier früher ein Wurst-Maxe mit seinem silbernen Bauchladen gestanden und dampfende Würste an die Bauarbeiter verkauft hatte. Etwas später hatte der Mann einen Campingwagen aufgestellt und sein Angebot um Frikadellen und Bier erweitert. Und bald darauf betrieb er diese Imbissbude mit Fleisch vom Grill, Koteletts, Pommes frites und Dosenbier. Zur Mittagszeit drängten sich so viele hungrige Bauarbeiter um den Stand, dass er zwei Frauen als Hilfskräfte einstellen musste.
Bis zur riesigen Baugrube, wo das neue Opernhaus aus dem Boden gestampft wurde, hatte Pütz nur wenige Schritte zu gehen. In Köln wurde wie verrückt gebaut. Die ganze Stadt war eine einzige Baustelle. Straßen wurden neu verlegt, Ruinen abgerissen, Schutt abtransportiert, Baugruben ausgehoben, Wohnblocks, Geschäftshäuser, Versicherungs- und Bankpaläste neu errichtet. Es staubte nur so vor lauter Emsigkeit.
Aber diese Baustelle hier war eine besondere. Große Schautafeln zeigten, wie das neue Opernhaus in zwei Jahren aussehen sollte: ein gigantisches, halbiertes Trapez, bis zu vierzig Meter hoch, dazwischen die Bühne und der Zuschauerraum. Und die Ruine des schönen alten Opernhauses am Rudolfplatz ließ die Stadt verrotten. Schon wuchsen dort Sträucher und kleine Bäume aus den Fensteröffnungen. Pütz verstand nicht, warum man diesen zum Teil noch erhaltenen Prachtbau nicht wieder herrichtete. Dafür klotzte man für viel Geld diesen protzigen Kasten mit seinen schrägen Wänden mitten in die Stadt.
Pütz ging an den großen Firmentafeln der Bauunternehmen vorbei. »Wir bauen Köln wieder auf– Richard Prenner Hoch- und Tiefbau«, »Wir bauen Köln wieder auf– Hannelore Kelsterbach Baustoffe en Gros«. Auch »Hubert Stomp Hoch- und Tiefbau« baute Köln wieder auf.
Als er an der Zufahrtsrampe eintraf, die in die Grube hinabführte, hatte sich um den Streifenwagen »Arnold7« mit seinem Blaulicht schon eine Menge Schaulustiger versammelt.
»Wat es loss?«, wollten sie von den Polizisten wissen.
»Wat es passeet?«
»Ene Besoffene«, klärte eine kleine alte Frau mit schmalem Gesicht die Umstehenden auf und hielt dabei ihren weißen Spitz an der Leine.
»Kei Wunder«, bemerkten die Kneipengäste lachend. »Us däm ›Schlückche‹ stänevoll direktemang en de Grub!«– »Ene äsch kölsche Heldenduud!«
Immer wieder verkündete die Alte aufgeregt: »Mein Knubbel hat den Betrunkenen da unten gefunden. Mein Knubbel!«
»Dann krit hä sescher Finderluhn«, kam es aus der Menge.
Gleichzeitig mit Pütz traf auch der etwas dickliche Kommissar Braubach ein. Unter seinem zerknitterten Tuchmantel trug er eine Hausjacke.
»Mensch, ich war kurz davor, in die Badewanne zu steigen«, begrüßte er Pütz mürrisch. »Habe überhaupt keine Lust, mich so spät noch mit irgendetwas abzugeben.« An die Polizisten am Streifenwagen gewandt fragte er: »Wo liegt der Mann?«
Im Schein ihrer Taschenlampen führten zwei Polizisten Pütz und Braubach durch den Matsch tief hinab in die Grube. Lastwagen, Bagger und Betonmischer hatten die Erde der Rampe durchpflügt, sodass sie mit ihren Schuhen fast bis zu den Knöcheln in den Morast einsackten. Unten angekommen, mussten sie darauf achten, in der Dunkelheit nicht über Bretter und Eisenrohre zu stolpern. Entfernt sahen sie die Umrisse eines Baggers und eines Förderbandes. Schließlich waren sie am gegenüberliegenden Ende der Baugrube angelangt, wo die Erdwand senkrecht nach unten abfiel.
Erkennungsdienstler waren schon zur Stelle und hatten das Terrain mit rot-weißem Flatterband abgesperrt und Lampen aufgestellt. Ein Polizeifotograf machte Blitzlichtaufnahmen. Ein Arzt mit einer DRK-Armbinde kam ihnen entgegen und sagte: »Der Mann ist tot.«
Gönnerhaft legte Braubach Pütz seine Hand auf die Schulter. »Da kannste gleich in deinen ersten Toten einsteigen. Jetzt zeig mal, was du in der Ausbildung gelernt hast.«
Dies war nicht Pütz' erster Todesfall. In dem halben Jahr, das er im 1.Kommissariat arbeitete, hatte er es schon mit mehreren Toten zu tun gehabt. Zuletzt mit dem zerstückelten Jugendlichen, der im Rhein in die Schraube eines Schleppers geraten war. Dennoch zeigten sich seine Kollegen ihm gegenüber immer gern als »alte Hasen«.
Und nun lag vor Pütz im Schein der Lampen die neue Leiche: ein Mann von etwa fünfzig Jahren. Er war gut gekleidet, trug einen teuren Anzug aus dunkelblauem Tuch, ein weißes Hemd und eine fein gemusterte Krawatte. Auf der Vorderseite seiner Kleidung klebte gelblicher Schmutz, dem Anschein nach Erbrochenes. In seinem vollen, leicht angegrauten Haar hing nasse Erde, seine Augen waren weit geöffnet, als würden sie geradeaus starren, sein Mund zu einer Grimasse verzerrt und sein Gesicht rosig, vereinzelt mit leuchtend roten Flecken bedeckt. Von der Stirn zog sich bis zur Schläfe eine mehrere Zentimeter lange Verletzung hin, von Blut beschmiert. Er lag direkt neben der steilen Erdwand, im Dreck zwischen Zementsäcken, Eisengeflecht und Teerfässern.
»Sieh an, der Prenner«, stellte Braubach fest. Er schien überhaupt nicht überrascht zu sein.
»Welcher Prenner?«, fragte Pütz.
»Na, der Bauunternehmer.«
»Kennen Sie ihn?«
»Den kennt doch jeder.«
Vorsichtig drehte der Arzt den Körper hin und her. Beim Bewegen der Arme und Beine gaben die Gelenke nach. Noch war keine Leichenstarre eingetreten. Das Thermometer zeigte normale Lebenstemperatur.
»Ich schätze, der Tod ist erst vor etwa einer Stunde eingetreten«, sagte der Arzt. »Für die Todesursache müssen wir die Obduktion abwarten.« Dabei zeigte er auf die blutverschmierte Verletzung am Kopf.
»Wie kam diese Wunde zustande?«, wollte Pütz wissen.
»Wahrscheinlich durch den Sturz.« Mit seiner Taschenlampe leuchtete der Arzt auf ein großes Winkeleisen, das neben Prenners Kopf lag. Es war voller Blut.
Ein Erkennungsdienstler trat hinzu, streifte sich Gummihandschuhe über und steckte das Eisen in einen Zellophansack. »Das nehmen wir mal mit«, sagte er. Dann nahm er Abstriche von dem Erbrochenen.
»Warum hat er sich erbrochen?«, fragte Pütz.
»Sicher hatte er zu viel getrunken und ist dann besoffen in die Grube gestürzt«, behauptete Braubach.
»So klar ist das noch nicht«, wehrte der Arzt ab.
Mit durchsichtigen Plastikklebebändern tastete der Mann von der Spurensicherung den Anzug des Toten ab, um im Labor festzustellen, ob sich darauf Textilfasern einer fremden Kleidung oder Haare befanden. Anschließend durchsuchte er die Jacken- und Hosentaschen des Toten. Ein Raubüberfall war es nicht. Dann wären die Taschen nach außen gekrempelt gewesen. Im Jackett fand er eine Brieftasche mit Führerschein, Zulassung und Personalausweis mit Lichtbild, ausgestellt auf den Namen Richard Prenner. Und eine größere Menge Bargeld: zweitausenddreihundertvierzig Mark.
In der Zwischenzeit hatten andere Kollegen vom Erkennungsdienst das Gelände im weiten Umkreis nach Hinweisen abgesucht und kamen zurück. »Nichts gefunden.«
Braubach fragte: »Wo ist denn sein Auto? Prenner ist doch nicht zu Fuß unterwegs gewesen.«
Per Funk wurden die Streifenwagen »Arnold2« und »Arnold5« herbeigerufen, die bald darauf mit Martinshorn und Blaulicht eintrafen. Die Polizisten notierten aus Prenners Papieren das Kennzeichen des Fahrzeugs und schwärmten aus. Schnell hatten sie den Wagen gefunden: ein Mercedes350Cabrio mit verchromten Stoßstangen und Zierleisten. Er stand ganz in der Nähe, in der Streitzeuggasse. Man inspizierte den Wagen, konnte aber bei der ersten Durchsicht nichts Auffälliges entdecken. Ein Abschleppdienst schaffte ihn zur Kripo in der Merlostraße zur genaueren Untersuchung.
Braubach bat Pütz: »Geh schon mal rauf und versuche, Zeugen aufzutreiben, ob jemand etwas gesehen oder gehört hat.«
Während Pütz über die Rampe nach oben stapfte, sah er, wie Braubach auf den Arzt einredete und dieser immer wieder abwehrte.
Obwohl es schon bald Mitternacht war, versammelten sich oben am Grubenrand immer mehr Schaulustige um die Einsatzwagen. Sie umringten Pütz: »Wä es dä Mann?«– »Es hä duud?«– »Zick wann lit hä do en dä Jrub?«– »Met däm neuen Opernhuus fängk et jo och jot an.«– »Et fählt nur noch dä Jesang dozu.«
Er befragte die Umstehenden: »Haben Sie jemanden gesehen, der aus der Grube herauskam? – Haben Sie jemanden gesehen, der oben auf der Straße wegrannte?– Haben Sie Schreie gehört? Hilferufe?«
Keiner hatte etwas Auffälliges bemerkt. Nur die alte Frau mit ihrem weißen Spitz drängte sich immer wieder vor. Ihre Augen funkelten, und über ihr schmales Gesicht flackerte die Aufregung. »Mein Knubbel hat den Mann entdeckt. Krieg ich da keinen Finderlohn?«
Durch die Menge zwängte sich der Reporter der BILD-Zeitung. Immer wenn irgendwo etwas los war, tauchte er auf. Er trat auf Pütz zu. »Ein paar Fragen, Herr–«
»Nein, nicht jetzt«, wies ihn Pütz ab.
»Liegt da unten tatsächlich der Bauunternehmer Prenner?«
»Woher wissen Sie das?«
»In der Kneipe sagen das alle. War es ein Unfall? Ein Mord? Oder nur Selbstmord?« Der BILD-Reporter wurde immer aufdringlicher.
»Keine Fragen.«
»Ist die Witwe schon informiert? Was sagt sie dazu?«
»Schluss jetzt«, fuhr ihn Pütz wütend an.
»Dann mache ich wenigstens ein Foto von Ihnen.«
Schon zückte er seine Kamera mit dem großen Blitzlicht, doch Pütz fuhr ihn heftig an: »Kein Foto!«
»Nur eines.«
»Kein Foto!«, schrie Pütz. »Verstanden?«
Der Reporter zog sich zurück und blitzte aus einiger Entfernung.
Pütz wunderte sich, dass Andi nicht auftauchte und für den Stadt-Anzeiger berichtete.
Nun drängte sich wieder die Alte vor. Aufgewühlt berichtete sie Pütz: »Ich geh mit meinem Knubbel jeden Tag zweimal um die Baustelle Gassi. Morgens und abends. Auch heute, als das passiert ist.«
»Haben Sie da etwas bemerkt?«
»Nichts. Ich geh jeden Abend mit Knubbel um dieselbe Zeit Gassi. Immer von halb zehn bis zehn.«
Sicherheitshalber ließ er sich ihre Adresse geben und notierte in seinen Kalender: »Hedwig Klemens, Glockengasse, gegenüber Baustelle«.
Inzwischen war Braubach mit dem Arzt nach oben gekommen, und sogleich stürzte sich die Alte auch auf ihn. »Herr Inspektor, mein Knubbel hat den Toten gefunden. Da krieg ich doch Finderlohn.«
»Na klar«, feixte Braubach. »Er soll da in die Kneipe gehen und eine Wurst verlangen. Ich zahl sie.«
Sie stutzte, wusste im Augenblick nicht, ob Braubach das wirklich ernst meinte.
»Wie schaut's aus mit Zeugen?«, wandte der sich an Pütz, ohne die Frau weiter zu beachten.
»Nichts.«
»Ist auch verzichtbar. Die Sache ist ziemlich eindeutig.«
Der Arzt reichte Braubach den Totenschein in doppelter Ausführung: einen für die Akten und den anderen für die Ehefrau.
»Nun haben Sie ja doch ›Todesursache ungeklärt‹ eingetragen«, nörgelte Braubach.
»Ich muss Sie wohl nicht über die Vorschriften belehren, Herr Kommissar.«
Braubach schwieg und steckte die Scheine missmutig ein.
Der Arzt übergab ihm Prenners Papiere. »Im Ausweis steht seine Adresse. Bringen Sie seine Ehefrau hierher, damit sie ihn identifiziert. So lange bleibt er hier liegen.«
»Kommen Sie«, sagte Braubach zu Pütz. »Wir fahren nach Marienburg. Aber davor sehen wir uns etwas an.«
Er verabschiedete sich mit einem Kopfnicken von dem Arzt und ging mit Pütz zum Bauzaun in der Streitzeuggasse, und zwar an die Stelle, wo Prenner tief unten neben der Grubenwand lag.
Die leichten hölzernen Absperrwände, vollgeklebt mit Plakaten, waren ein Stück zur Seite geschoben. Sie zwängten sich durch die Lücke und standen vor einem niedergedrückten Maschendrahtzaun. Dahinter ging es senkrecht nach unten. Sie schauten hinab und sahen unten im Lampenschein der Erkennungsdienstler das weiße Tuch, unter dem Prenner lag.
»Er wollte wahrscheinlich nachsehen, ob die Absperrung in Ordnung ist«, stellte Braubach fest, »und ist dabei abgestürzt– betrunken wie er war.«
»Und unten mit dem Kopf auf das Eisen aufgeschlagen«, ergänzte Pütz.
»Genau. Dann ist die Sache wohl geklärt«, bekräftigte Braubach.
***
In Marienburg ließ es sich gut leben– wenn man nicht tot war. Hier im Süden von Köln war durch die Bombenangriffe fast nichts zerstört worden. Die alten Villen standen noch unbeschädigt. In den gepflegten Vorgärten blühten die Sträucher, der Goldregen und der Weißdorn, und hinter den Villen taten sich Gartenparadiese auf: mit Weihern, Teehäuschen, kleinen Magnolienbäumen und üppigen Fliederbüschen. Hier lebten Vorstandsmitglieder des Gerling-Konzerns, des Bankvereins und der Rhein-Ruhr-Bank, Direktoren von Allianz und Nordstern, Aufsichtsratsmitglieder von Ford und Felten & Guillaume. Hier lebte auch der Bauunternehmer Richard Prenner– bis vor zwei Stunden.
Braubach musste nicht auf Prenners Personalausweis nachsehen, wo dieser wohnte. Obwohl die kleinen Straßen, die Privatstraßen glichen, in der Dunkelheit schlecht zu erkennen waren, steuerte er den Wagen gezielt zur Leyboldstraße 16. Er schien die Adresse zu kennen.
Vor der Scheibe, direkt vor Braubachs Gesicht, baumelte an einem silbernen Schnürchen eine kleine Christophorus-Figur. Der Schutzpatron der Autofahrer hüpfte in der Dunkelheit hin und her. Ein Wunder, dass sich das kleine Jesuskind auf seinen Schultern festhalten konnte und nicht herunterfiel. Pütz hätte in seinem Auto ein solches Gebaumel vor seinen Augen nicht ertragen können. Es hätte ihn verrückt gemacht und vom Verkehr abgelenkt. Aber Braubach schien das nichts auszumachen. Vielleicht stellte er sich vor, sein Auto sei der heilige Christophorus und er als Fahrer das Jesulein, das durch alle Verkehrsflüsse getragen wird. So ganz sicher schien ihn sein Patron aber doch nicht immer geschützt zu haben, denn Pütz wusste von mindestens zwei Karambolagen, die Brauchbachs Auto zerbeult hatten.
Dann standen sie vor der schönen alten Villa. Obwohl es schon nach Mitternacht war, brannte am Hausportal eine gusseiserne Laterne im rustikalen Stil. Das schmiedeeiserne Gartentor stand offen. Sie gingen an Buchsbaumhecken vorbei über einen weißen Kiesweg zur Eichenpforte. Zu beiden Seiten standen Imitationen von gewundenen Barocksäulen. Die Fenster zur Straßenfront waren mit eisernem Blattwerk vergittert. Alles roch nach viel Geld. Pütz las die beiden golden blinkenden Namensschilder.
»Wer ist denn Kelsterbach?«, fragte er.
»Ist sie«, sagte Braubach.
»Heißt sie nicht auch Prenner?«
»Ist eine geborene Kelsterbach. Sie führt noch immer ihren Mädchennamen, weil sie die ›Baustoffe en Gros‹ von ihrem Vater geerbt hat.«
Braubach drückte die beiden Klingelknöpfe. Innen ertönte ein Gong, dunkel und breit. Sonst blieb es still.
»Vielleicht holen wir sie aus dem Bett«, meinte Pütz.
»Glaub ich nicht. Die Hannelore ist noch auf.«
Da hörten sie innen Schritte wie auf Fliesen. Energische Schritte. Mit einem Ruck wurde die Eichentür aufgerissen, und vor ihnen stand Hannelore Prenner: eine Frau mittleren Alters, rötlich gefärbte Haare, harte Gesichtszüge. Um ihren faltigen Hals lag ein breites, goldenes Collier mit einem großen, violett funkelnden Stein in der Mitte.
Ihre Lippen waren dunkelrot geschminkt, fast schwarz. An einer Seite ihrer Oberlippe war sie wohl mit dem Lippenstift ausgerutscht. Wie ein kleiner Klecks Brombeermarmelade glänzte der Ausrutscher über ihrer Lippenlinie. Sie trug ein wallendes rosafarbenes Abendkleid.
Sie stutzte. »Braubach?«
»Entschuldigen Sie, gnädige Frau«, begann Braubach zögernd, »dass wir zu so später Stunde noch zu Ihnen kommen.«
»Ist was mit meinem Mann?«
»Ja.«
»Was?«
»Ihr Mann ist verunglückt.«
»Verunglückt?«
»Ja.«
»Ich habe mich schon gewundert, wo er bleibt. Wie geht es ihm?«
»Sehr schlecht.« Braubach atmete schwer. Schließlich brachte er es über die Lippen: »Ihr Mann ist tot.«
Sie schwieg.
»Mein aufrichtiges Beileid.«
Auch Pütz sprach ihr sein Beileid aus. Hektisch fuhr sie sich mit der Hand übers Gesicht, dann sah sie Braubach direkt in die Augen: »Wo ist es passiert?«
»In der Baugrube für das Opernhaus.«
»Um wie viel Uhr?«
»Man hat seine Leiche etwa um Viertel nach zehn entdeckt.«
Fahrig bat Hannelore Prenner Braubach und Pütz einzutreten. Sie ging voraus durch die weiträumige Diele und geleitete sie in ein riesiges Wohnzimmer. Ihr weites Chiffonkleid umwehte ihren Körper.
Das könnte eine schöne Skizze für Marlenes Modelle sein, dachte Pütz. Er sah sich um. An den Wänden hingen drei mächtige dunkle Ölschinken in protzigen vergoldeten Barockrahmen. Pütz gefielen die Gemälde überhaupt nicht. Wahrscheinlich waren die Rahmen mehr wert als die Bilder.
An beiden Seiten der Gemälde waren Wandlämpchen mit gelben Schirmchen aus Plüschstoff angebracht. Die kleinen Lampen verstreuten ein schwaches, diffuses Licht. Unter einem der mächtigen dunkelbraunen Ölbilder, die Pütz an angebrannte Mehlschwitze erinnerten, stand eine weiße Schleiflack-Musiktruhe. Wie zur Dekoration lag darauf ein aufgeschlagenes Album mit Langspielplatten. Klassische Musik. Unter dem anderen Gemälde prunkte ein Fernsehgerät mit silbernen Plastikzierleisten. Hinter Glastüren beleuchtete eine große Laterne die Terrasse. Dahinter konnte man in der Dunkelheit den Garten erahnen.
Hannelore Prenner deutete auf zwei breite Ledersessel. Als Pütz sich setzte, versank er in der weichen Polsterung und musste sich mit beiden Händen an den klobigen Armlehnen festhalten. Sie ließ sich in dem Sessel ihnen gegenüber nieder, stützte ihre Ellbogen auf die Lehnen und presste die Finger so sehr ineinander, dass ihre Knöchel fast weiß wurden. Pütz bestaunte die mächtigen Steine ihrer Fingerringe und die mehrfach übereinandergelegten übergroßen Armreife aus Gold, Silber und Platin.
Auf einem Glastischchen neben ihrem Sessel stand ein weißes Telefon, das mit einem goldbestickten Brokatstoff überzogen war. Nur der Kreis für die Wählscheibe war ausgespart. Der tutende Hörer lag neben dem Apparat. Sie hatte wohl gerade telefoniert. Schnell legte sie den Hörer auf die Gabel.
»Wie ist es passiert?«, fragte sie.
Braubach erklärte: »Sicher wollte er am Abend noch mal die Absperrung der Baustelle kontrollieren und ist dabei an einer gefährlichen Stelle in die Tiefe gestürzt.«
»Ja, ich erinnere mich«, bestätigte Hannelore Prenner. »Er wollte nachsehen, ob die Absicherungen in Ordnung sind. Das hat er gesagt, als er losging. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«, fragte sie und streifte nervös über ihr Haar, wobei ihre Armreife klimperten.
Braubach und Pütz lehnten dankend ab.
»Aber ich muss jetzt einen Cognac trinken.« Hastig griff sie nach dem Schwenker auf dem kniehohen Tisch vor ihr, trank ihn gierig leer und goss sich aus der Asbach-Flasche kräftig nach, wobei sie etwas Cognac auf die Glasplatte verschüttete. Sie leerte auch dieses Glas mit einem Schluck, stellte es klirrend auf die Glasplatte und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Dabei verschmierte sie die Schminke ihrer Lippen nun völlig.
Mit halb geöffnetem Mund starrte sie in die Luft, griff abwesend zur Zigarettenschachtel, fingerte eine der letzten Lux heraus und versuchte, sie anzuzünden. Doch ihre Hand, mit der sie das Feuerzeug hielt, zitterte so sehr, dass es ihr nur mit Mühe gelang, die Flamme an das Zigarettenende heranzuführen. Der Anblick ihres verschmierten Mundes ekelte Pütz.
Braubach übergab ihr die Kopie des Totenscheins. Sie nahm das Blatt und las. Dabei konnte Pütz ihre schrumpeligen Finger sehen und ihre dunkelrot lackierten Fingernägel. Sie waren spitz wie scharfe Krallen. Verärgert sah sie Braubach an. »Wieso ist die Todesursache ungeklärt?«
»Wir müssen noch die Obduktion abwarten.«
»Ich will keine Obduktion. Die Todesursache ist doch klar. Unfall! Unfall!« Wütend warf sie das Blatt auf die Glasplatte, direkt auf den verschütteten Cognac. Sofort saugte der Totenschein den Alkohol auf und bildete dunkle Flecken.
Nach einer Weile sagte Braubach mit heiserer Stimme: »Wir müssen Sie leider bitten mitzukommen, um Ihren Mann zu identifizieren.«
»Ist der Arzt noch da? Ich muss mit ihm reden.« Torkelnd erhob sie sich, stakste in die Diele und zog unbeholfen einen Pelzmantel über. Braubach wollte ihr dabei helfen, doch sie wehrte ab.
Während der Fahrt zum Unfallort sprach keiner ein einziges Wort.
Braubach hielt auf dem Brachland zwischen den Streifenwagen, dem Fahrzeug des Erkennungsdienstes und einem Krankenwagen, der inzwischen angekommen war.
Kaum aus dem Auto gestiegen, fragte Hannelore Prenner die Polizisten: »Ist der Arzt noch da?«
Sie wiesen nach unten in die Baugrube. Hannelore Prenner zeigte auf die vielen Wagen und Polizisten um sie herum: »Muss das sein, dieser ganze Aufwand hier?«
Braubach bot ihr den Arm an, um sie über die Rampe in die Grube hinabzuführen, doch sie lehnte ab. Zu dritt wateten sie durch den Sand und Dreck, vorbei an den Förderbändern, Moniereisen und Verschalungsbrettern. Dann standen sie vor dem weißen Tuch, unter dem Hannelores Mann lag. Der Arzt trat heran, stellte sich ihr vor und sprach sein Beileid aus. Sie schnitt ihm das Wort ab.
»Damit das klar ist, ich will keine Obduktion!«
Der Arzt erschrak über ihre Barschheit, erwiderte aber höflich: »Gnädige Frau, ob wir sezieren oder nicht, entscheiden der Staatsanwalt und der Richter.«
»Ich will keine Obduktion!«
»Dann wenden Sie sich an die genannten Herren«, wies sie der Arzt immer noch höflich zurecht und hob das weiße Laken leicht an, sodass Prenners Kopf zu sehen war. »Wenn Sie bitte bestätigen wollen: Ist das Ihr Ehemann Richard Prenner?«
Sie stand neben der Leiche, immer noch mit verschmiertem Mund und trotzigem Gesicht, und nickte kaum erkennbar. In diesem Moment tauchte der BILD-Reporter neben ihnen auf. »Sind Sie die Witwe?«, fragte er und hob den Fotoapparat.
Erschrocken schaute sie auf. In dieser Sekunde blitzte er in ihr Gesicht und dann schnell auf den freiliegenden Kopf des Toten. Braubach, der Arzt und Pütz drängten ihn weg, beschimpften ihn und hätten ihm beinahe die Kamera aus der Hand geschlagen. Der Arzt bedeckte Prenners Kopf wieder, und sie wandten sich zum Gehen.
Oben angekommen, bot Braubach Hannelore Prenner an, sie nach Hause zu fahren, doch sie lehnte ab.
»Warum haben Sie bei diesem Arzt nicht durchgesetzt, dass es keine Obduktion geben soll?«, warf sie ihm zornig vor. »Sie sind doch Kommissar.«
Durch eine Funkstreife wurde ein Taxi bestellt, das kurz darauf eintraf und mit ihr abfuhr. Braubach und Pütz sahen ihm schweigend nach.
»Als wir in das Wohnzimmer kamen, lag der Telefonhörer neben der Gabel«, sinnierte Pütz.
»Sie war betrunken. Hatte wohl vergessen, den Hörer aufzulegen.«
»Warum hat sie schon vor unserem Eintreffen Cognac getrunken? Die Flasche war halb leer.«
»Vielleicht hat sie mit ihm Krach gehabt.«
»Do bringe se em«, raunte es aus der Menge der Schaulustigen.
Braubach und Pütz wandten sich um und sahen, wie Prenners zugedeckte Leiche auf einer Trage aus der Grube herausgetragen und in den Krankenwagen geschoben wurde.
Die Polizisten hatten Mühe, die vielen Neugierigen um das Auto zurückzudrängen. Der Arzt verabschiedete sich und stieg in den Krankenwagen. Unten in der Grube waren im hellen Lampenschein die Spurensicherer noch bei der Arbeit.
»Wir gehen jetzt auch«, sagte Braubach müde und sah auf die Uhr. Es war Viertel nach eins.
***
Marlene schlief bereits. Obwohl Stefan sich im Bad ganz leise wusch und sachte neben ihr ins Bett schlüpfte, wachte sie auf.
Sie drehte sich um und murmelte: »So geht das nicht mehr weiter.«
Er war zu müde, um sie zu fragen, was sie damit meinte. So spät in der Nacht und nach all diesen Erlebnissen wollte er jetzt nicht auch noch eine Grundsatzdiskussion führen müssen. Jetzt brauchte er vor allem Schlaf, Schlaf, Schlaf.
3
Sonntag, 8.Mai
Die 2. Deutsche Camping-Ausstellung auf dem Messegelände mit über sechzigtausend Besuchern ist beendet. Großes Interesse fanden besonders die Zelte und Wohnwagen. Die Aussteller der Campingartikel-Industrie sind sehr zufrieden.
Über dem Sonntagsfrühstück hing eine dunkle, schwere Gewitterwolke. Pütz schmeckte das Marmeladenbrötchen überhaupt nicht. Auch Marlene kaute übel gelaunt. Sie schwieg die meiste Zeit und antwortete auf seine Fragen nur mit einem knappen »Ja« oder »Nein«.
Er legte sein Brötchen weg. »Was ist denn los?«
Sie sah ihn wütend an. »Da fragst du noch?«
»Was ist denn?«
»Leben wir nun zusammen oder nicht?«
»Natürlich leben wir zusammen.«
»Den Eindruck hab ich nicht.«
Räuspernd brachte er hervor: »Ich muss am Nachmittag zum Rhein.«
Er fürchtete, gleich würde wieder ihr Blitz einschlagen und ihr Donner über ihn herfallen. Aber nichts. Es gab keinen Krach. Sie sah ihn nicht einmal an, sondern sagte nur: »Dann geh.«
»Ich muss mir die Stromschwimmer ansehen.«
»Mach das.«
»Wegen des Unfalls von vergangener Woche.«
»Also wieder weg.«
»Es tut mir leid.«
»Muss dir nicht leidtun.« Pütz wäre es lieber gewesen, Marlene hätte ordentlich Zoff gemacht, ihm alles Mögliche vorgeworfen. Aber nein, sie sagte nur mit angespannter Stimme: »Du kannst dir Zeit lassen. Ich bin heute Abend zum Essen eingeladen. Das kann spät werden.«
»Von wem bist du eingeladen?«
»Beruflich.«
»Wo geht ihr denn essen?«
»Weiß ich noch nicht.«
Plötzlich wurde Pütz eifersüchtig. Über ein Jahr lebten sie nun schon zusammen. In dieser Zeit hatte sie ihm nie einen Grund für Misstrauen gegeben. Gewiss, Marlene kannte viele Männer, aus ihrem Beruf und auch aus ihrem Bekanntenkreis. Manche dieser Männer hatte sie ihm bei Gelegenheit vorgestellt. Natürlich hatte Pütz dabei jedes Mal gedacht, ob dieser oder jener ihr besser gefallen könnte als er. Aber eifersüchtig, so wie jetzt, war er nie.
»Seid ihr mehrere, oder bist du mit einem allein?«
»Das stellt sich noch heraus.«
»Also gehst du mit einem Mann essen.«
Wieder traf ihn ihr giftiger Blick. »Na und?«
»Du bist vorher nie mit einem Mann allein essen gegangen.«
»Na dann mach ich es eben jetzt.«
»Wir könnten auch zusammen essen gehen.«
»Du hast ja nie Zeit.«
»Dann nehme ich mir jetzt Zeit.«
»Ach, auf einmal?«
Pütz stand auf, räumte sein Geschirr weg und ging in seine Dunkelkammer. Er machte sich daran, seine restlichen Bilder zu entwickeln: Fotos von Kölner Neubauten. Doch Marlenes Übellaunigkeit hatte ihm den Spaß an seinem Hobby verdorben. Lustlos beobachtete er, wie seine Aufnahmen im Entwicklungsbad sichtbar wurden: das wiederhergestellte Zeughaus, das neu errichtete Wallraf-Richartz-Museum mit seinen spitzen Giebeln, das neue helle Gebäude des NWDR am Wallrafplatz.
So viele Gebäude hatte er mit seinem neuen Apparat fotografiert, und kein einziges Mal Marlene. Andere hatten von ihren Freundinnen Dutzende von Fotos. Auch mit seinem alten Apparat hatte er sie nie aufgenommen. Er konnte sich das nicht erklären. Muss ich nachholen, nahm er sich vor. Muss ich schnellstens nachholen.
Schon seit einiger Zeit kriselte es zwischen ihnen. Immer weniger sprachen sie miteinander. Über den Stand seiner Ermittlungen durfte er ihr nichts erzählen. Und so fragte sie auch nicht danach. Dazu wollte er nichts über ihre Modezeichnungen für Neckermann wissen. Er mochte diese leblosen Puppen nicht, die sie mit flottem Stift skizzierte. Dieser Schnickschnack, dachte er, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Aber sie verdiente viel Geld damit. Viel mehr als er. Sie konnte sich ein schickes rotes Lloyd-Cabrio leisten. Er dagegen war froh, dass es sein VW mit dem ovalen Brezel-Heckfenster noch tat. Solange seine alte Mühle ihn noch dorthin brachte, wohin er fahren musste, war er zufrieden mit seinem Käfer.
Ihm wurde bewusst, dass sie schon lange nicht mehr gemeinsam im Kino gewesen waren. Marlene liebte alle Filme mit O.W. Fischer, den er nicht ausstehen konnte, und Musikfilme wie »Fanfaren der Liebe« mit Grethe Weiser und Dieter Borsche, die er einfach blöd fand. Sie dagegen mochte seine Filme nicht wie »Orphée« von Cocteau oder Fellinis »La Strada«. Und wenn sie mal am Abend einen Film sehen wollten, der sie beide interessierte, musste er plötzlich wieder zu einem Ortstermin. Ach, es war eine verflixte Sache.
***