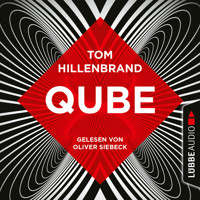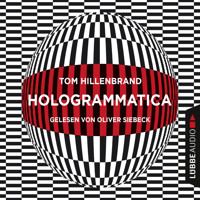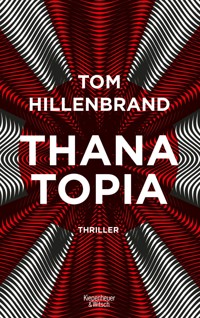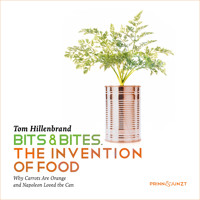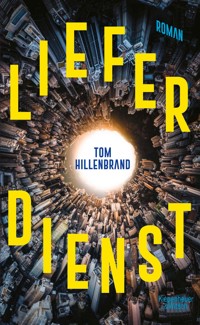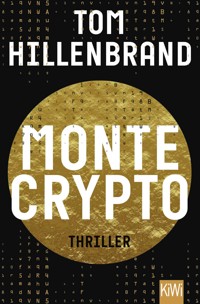Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein historisches Abenteuer voller Spannung, Intrigen und der Jagd nach dem schwarzen Gold des Orients – Kaffee! Wir schreiben das Jahr 1683. Europa befindet sich im Griff einer neuen Droge: Kahve. Das begehrte Getränk ist teuer, denn die Osmanen haben das Monopol darauf und wachen streng über ihren Schatz. Doch der junge Engländer Obediah Chalon, Spekulant, Händler und Filou, hat einen waghalsigen Plan: Er will den Türken die wertvollen Kaffeebohnen abluchsen, koste es, was es wolle. Mit finanzieller Unterstützung der Vereinigten Ostindischen Compagnie stellt Chalon ein Team internationaler Spezialisten zusammen, um das scheinbar Unmögliche zu schaffen. Die spektakuläre Reise in den Orient scheint zunächst zu gelingen, doch schon bald sind immer mehr Mächte hinter ihnen her. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem nicht nur Chalons Zukunft, sondern auch die des Kaffees in Europa auf dem Spiel steht. »Der Kaffeedieb« von Tom Hillenbrand ist ein farbenfroher Abenteuerroman voller Spannung, exotischer Schauplätze und faszinierender Figuren.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tom Hillenbrand
Der Kaffeedieb
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tom Hillenbrand
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tom Hillenbrand
Tom Hillenbrand, geb. 1972, studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Ressortleiter bei SPIEGEL ONLINE. Seine Romane wurden vielfach ausgezeichnet (u.a. mit dem Friedrich-Glauser-Preis) und in zahlreiche Sprachen übersetzt.
www.tomhillenbrand.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Lange haben die Europäer das Heidengebräu verschmäht, aber am Ende des 17. Jahrhunderts verfällt Europa dem Kaffee. Philosophen in London, Gewürzhändler in Amsterdam und Dichter in Paris treffen sich in Kaffeehäusern und konsumieren das Getränk der Aufklärung. Aber Kaffee ist teuer. Und wer ihn aus dem jemenitischen Mokka herausschmuggeln will, wird mit dem Tod bestraft. Der Mann, der es trotzdem wagen will, ist der junge Obediah Chalon, Spekulant, Händler und Filou. Er hätte allen Grund sich umzubringen, nachdem er an der Londoner Börse Schiffbruch erlitten hat. Nur ein ganz großes Geschäft könnte ihn vor dem Ruin bewahren. Und so geht er aufs Ganze und stellt eine Truppe internationaler Spezialisten zusammen, um den Türken den Kaffee zu klauen. Die spektakuläre Reise scheint zunächst zu gelingen, doch dann sind immer mehr Mächte hinter ihnen her …
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Karte: Europa
Karte: Osmanisches Reich
Teil I
Teil II
Teil III
Teil IV
Teil V
Teil VI
CODA
Anhang
Dramatis Personæ
Die Diebe:
Die Franzosen:
Die Türken:
Weitere Personen:
Glossar
Für meine Kaffeemuse
Teil I
So liebst Du allen Geist und Witz Und gierst nach neuster Kund
Von Dänen, Türken, Judenvolk, dem ganzen Erdenrund
Ich schiffe Dich zu einem Ort, wo Neuigkeiten wogen
Erfahre es im Kaffeehaus – niemals wird dort gelogen
Denn nichts passiert in dieser Welt, vom Fürsten bis zur Maus
Das nicht sofort geschleudert wird in unser Kaffeehaus.
Thomas Jordan »Nachrichten aus dem Kaffeehaus«
Die silberne Zwei-Pence-Münze tanzte über die Theke, mit sirrendem Klang, bis Obediah Chalon der Sache mit seinem Zeigefinger ein Ende bereitete. Er nahm das Geldstück an sich und musterte die Bedienung. »Guten Morgen, Miss Jennings.«
»Guten Morgen, Mister Chalon«, erwiderte die Frau hinter der Theke. »Mächtig kalt für einen Septembermorgen, findet Ihr nicht?«
»Nun, Miss Jennings, nicht kälter als vergangene Woche, würde ich meinen.«
Die Verkäuferin zuckte mit den Achseln. »Was darf ich Euch geben?«
Obediah hielt ihr die Münze hin. »Eine Schale Kaffee, bitte.«
Miss Jennings nahm das Geldstück und runzelte die Stirn, weil es sich um einen der alten, gehämmerten Tuppence handelte. Nachdem sie die Silbermünze mehrfach hin- und hergewendet hatte, gelangte sie offenbar zu dem Schluss, dass der Rand nicht allzu sehr abgefeilt worden war, und legte sie in die Kasse. Als Wechselgeld gab sie Obediah eine bronzene Kaffeehausmarke.
»Keine Pennys?«, fragte er, obwohl er die Antwort bereits kannte. Kleingeld war rar, seit die Leute es einschmolzen, um das darin enthaltene Silber zu verkaufen. Deshalb bekam man als Wechselgeld neuerdings nur noch diese vermaledeiten Marken.
Miss Jennings setzte einen Ausdruck routinierten Bedauerns auf.
»Habe seit Wochen keine Pennys mehr zu Gesicht bekommen«, sagte sie. »Die werden in diesem Königreich langsam seltener als schönes Wetter.«
Die Melodie des Gassenhauers »The Blacksmith« pfeifend, ging die Kaffeehausdame zum Kamin und griff sich eine der hohen schwarzen Eisenkannen, die dort vor dem Feuer standen. Kurz darauf kam sie mit einer flachen Schale zurück und reichte sie Obediah.
»Danke. Und sagt, ist Post für mich gekommen?«
»Moment, ich muss nachschauen«, sagte Jennings und ging zu einem Regal aus dunklem Holz, in dem sich zahlreiche Brieffächer befanden. Obediah trank den ersten Schluck Kaffee, während die Kellnerin nach seiner Korrespondenz suchte. Kurz darauf kam sie zurück und händigte ihm drei Briefe sowie ein Päckchen aus. Letzteres ließ er nach einem kurzen Blick auf den Absender rasch in einer Rocktasche verschwinden. Dann stellte er seine Schale auf der Theke ab und nahm sich die Briefe vor. Der erste stammte von Pierre Bayle aus Rotterdam und enthielt, dem Umfang nach zu urteilen, entweder einen sehr langen Brief oder die neueste Ausgabe der »Nouvelles de la République des Lettres«, vielleicht auch beides. Der zweite kam von einem Genfer Mathematiker, der dritte aus Paris. Er würde sie später in Ruhe lesen.
»Habt Dank, Miss Jennings. Und wisst Ihr, ob die neue Ausgabe der ›London Gazette‹ bereits eingetroffen ist?«
»Sie liegt dort hinten, auf dem letzten Tisch vor dem Bücherregal, Mister Chalon.«
Obediah durchquerte den Raum. Es war erst kurz nach neun Uhr morgens und »Mansfield’s Coffee House« war noch recht leer. An einem Tisch nahe dem Kamin saßen zwei schwarz gekleidete Männer ohne Perücken. Aus ihren säuerlichen Gesichtsausdrücken und gedämpften Stimmen schloss Obediah, dass es sich um protestantische Dissenter handelte. Am anderen Ende, unter einem Gemälde, das die Seeschlacht von Kentish Knock darstellte, saß ein junger Beau. Er trug einen isabellfarbenen Samtrock und hatte an seinen Ärmeln und Strümpfen mehr Schleifchen befestigt als eine Versailler Hofdame. Ansonsten war »Mansfield’s« verlassen.
Obediah legte Hut und Gehstock beiseite, setzte sich auf eine Bank und nippte an seinem Kaffee, während er die »Gazette« durchblätterte. In Southwark hatte es offenbar einen größeren Brand gegeben; ferner gab es Aufruhr wegen eines Buches, das die Abenteuer einer Kurtisane am Hofe des Königs schilderte und das Charles II. verbieten lassen wollte. Obediah gähnte. Nichts von alledem interessierte ihn auch nur ansatzweise. Er zog eine gestopfte Tonpfeife aus der Tasche seines Rocks, erhob sich und ging zum Kamin. Dort entnahm er einem kleinen Eimer einen Kienspan und hielt diesen in die Flammen. Kurz darauf kehrte er schmauchend zu seinem Platz zurück. Gerade wollte er ein auf dem Tisch ausliegendes Pamphlet zur Hand nehmen, das dazu aufrief, alle Dissenter und Papisten aufzuknüpfen, mindestens aber dauerhaft einzukerkern, als sich die Tür öffnete. Hindurch trat ein Mann, wohl an die fünfzig Jahre, mit einem Gesicht, dem Pocken und Seewind arg zugesetzt hatten. Er trug eine Klappmütze nach holländischer Art, ferner einen schneeweißen Backenbart, der farblich nicht sehr gut zu seiner tiefbraunen Perücke passte.
Obediah nickte ihm freundlich zu. »Guten Morgen, Mister Phelps. Habt Ihr Neuigkeiten?«
Jonathan Phelps war Stoffhändler mit guten Verbindungen nach Leiden und sogar nach Frankreich. Außerdem besaß er einen Bruder, der für den Sekretär der Admiralität arbeitete. Folglich war Phelps stets bestens darüber informiert, was gerade vor sich ging, sowohl in England als auch auf dem Kontinent. Der Händler nickte und erklärte, dass er sich zunächst einen Kaffee besorgen müsse, bevor er Neuigkeiten erörtern könne. Kurz darauf kam er mit einer Schale und einem Teller voller Ingwerkekse zurück und setzte sich Obediah gegenüber.
»Was wollt Ihr zuerst hören, den Kaffeehausklatsch oder die Neuigkeiten vom Kontinent?«
»Zunächst den Klatsch, wenn es Euch gefällig ist. Es ist noch recht früh für Politik.«
»Und verdammt kalt, bei Cromwells Schädel. Das muss der kälteste September seit Menschengedenken sein.«
»Nun, es ist heute Morgen nicht kälter als vergangene Woche, Mister Phelps.«
»Woher wollt Ihr das so genau wissen?«
»Ich nehme Messungen vor.«
»Messungen welcher Art?«
»Kennt Ihr Thomas Tompion, den Uhrmacher? Er fertigt neuerdings auch Thermometer. Damit lässt sich die Temperatur exakt bestimmen. Heute Morgen zum Beispiel, Schlag sieben Uhr, stand die Quecksilbersäule beim neunten Strich.«
Obediah holte ein kleines Notizbuch hervor und blätterte darin. »Damit ist es nach meiner Messung heute nicht kälter als vor einer Woche, am 14. September, als ich zur gleichen Zeit am gleichen Ort die Temperatur nahm.«
»Ihr mit Euren verrückten Experimenten. Warum tut Ihr das?«, fragte Phelps zwischen zwei Ingwerkeksen.
»Eine gute Frage. Aus einem allgemeinen naturphilosophischen Interesse, vermutlich. Letztlich aber, um Eure Frage zu beantworten.«
»Habe ich eine gestellt?«
»Zumindest indirekt, Mister Phelps. Ihr habt Euch gefragt, ob dieser 21. September des Jahres 1683 ein besonders kalter sei. Und um das objektiv beantworten zu können, müsste man über Vergleichswerte aus den Vorjahren verfügen.«
Phelps legte den Kopf schief. »Wollt Ihr jetzt den Rest Eures Lebens jeden Tag niederschreiben, wie warm oder kalt es morgens ist?«
»Und abends. Ferner notiere ich mir die Wetterverhältnisse – Regen, Wind, Nebel. Und ich bin nicht der Einzige. Kennt Ihr Mister Hooke, den Sekretär der Royal Society?«
»Ich habe von ihm gehört. Ist das nicht der Gentleman, der für so viel Aufsehen gesorgt hat, weil er im ›Grecian‹ am helllichten Tag auf einem der Kaffeehaustische einen Delfin seziert hat?«
»Ihr verwechselt ihn mit Mister Halley, werter Freund. Hooke interessiert sich eher für kleinere Tiere – und für das miserable englische Wetter. Deshalb hat er angeregt, dass Menschen im ganzen Königreich täglich die Temperatur nehmen und ihm die Ergebnisse zusenden. Auf Grundlage dieser Werte möchte er eine Art Wetterkarte erstellen. Nach einigen Jahren ließe sich damit sogar die Frage beantworten, ob es kälter oder wärmer geworden ist. Faszinierend, findet Ihr nicht?«
»Für einen Virtuoso wie Euch vielleicht, Mister Chalon. Mir hingegen graut vor der Vorstellung. Wenn Londoner sich nicht einmal mehr über das Wetter streiten können, was bleibt uns dann noch?«
Obediah lächelte und trank noch einen Schluck Kaffee.
»Ihr wolltet mir eigentlich erzählen, was Ihr auf Eurer morgendlichen Runde so aufgeschnappt habt, Mister Phelps.«
Ähnlich wie Obediah absolvierte der Tuchhändler eine tägliche Kaffeehausroutine. Soweit er wusste, besuchte Phelps in der Früh zunächst »Lloyd’s«, um sich über die dort angeschlagenen Schiffsmeldungen zu informieren und mit einigen Kapitänen zu sprechen. Sein zweiter Anlaufpunkt war »Garraway’s«, wo gegen acht Uhr die Morgenauktion für Tuch aus Spitalfields und Leiden stattfand. Hier versorgte er sich zudem mit den neuesten Notierungen für Textilien und andere Güter. Danach kam Phelps in die Shoe Lane, zu »Mansfield’s«, wohl vor allem wegen der Ingwerkekse.
»Die Preise für Holz steigen rasant. Wegen der Holländer.«
»Weil sie so viele Schiffe bauen?«
»Auch. Aber vor allem, weil es die Befürchtung gibt, dass Holz bald knapp wird. Das meiste kommt aus Frankreich und den Generalstaaten. Falls es zwischen den beiden Krieg gibt …«
»Haltet Ihr das für wahrscheinlich?«
»Ich habe heute Morgen einen Hugenotten getroffen, Monsieur du Croÿ. Er ist Leinenweber drüben in Spitalfields und besitzt noch immer gute Kontakte in seine alte Heimat. Offenbar stellt der Allerchristlichste König«, Phelps sah Obediah in die Augen, während er dies sagte, um ganz sicherzugehen, dass seinem Gesprächspartner der Sarkasmus nicht entging, »den Spanischen Niederlanden irgendwelche unerfüllbaren Forderungen. Louis XIV. verlangt Kontributionen zum Unterhalt eines großen Heeres, etwas in der Art. Viele glauben, dass dies nur das Präludium zu einem Überfall Frankreichs auf die Holländische Republik ist.«
Phelps sah ihn nachdenklich an. »Darf ich mir die indiskrete Frage erlauben, ob Ihr in Holz investiert seid, Mister Chalon?«
Ja, das bin ich, dachte Obediah. Und außerdem in Salz, Zucker, kanadische Biberfelle, chinesisches Porzellan und persische Teppiche. Doch das war nichts, was er Phelps oder irgendjemand anders auf die Nase binden würde. Deshalb sagte er lediglich: »Geringfügig. Es dürfte allerdings etwas zu spät sein, um nachzukaufen. Wenn diese Geschichte bereits bei ›Lloyd’s‹ kursiert, kennt sie in zwei Stunden jeder Kaffeehaussitzer in London.«
Phelps beugte sich leicht vor und raunte: »Ich habe noch etwas anderes gehört, das ganz ungeheuerlich ist. Ihr werdet es kaum glauben.«
Obediah schaute amüsiert. »Und zwar? Hat man den König mit einer katholischen Mätresse gesehen?«
Phelps schüttelte den Kopf. »Nein, das war letzte Woche. Nachdem es publik wurde, soll er sich von ihr getrennt und sich eine protestantische Hure gesucht haben. Ich meine etwas anderes. Ihr wisst, wo mein Bruder arbeitet?«
»Immer noch im Büro von Staatssekretär Pepys, nehme ich an.«
»Ja. Und aus dem Marineamt hört man, dass die Venezianer Anstrengungen unternehmen, eine Flotte auszurüsten.«
Phelps schaute bedeutungsschwer. »Eine große Flotte.«
»Ihr meint doch nicht etwa …«
»Oh doch. Vieles deutet darauf hin, dass sie Candia zurückerobern wollen.«
»Das erscheint mir unglaubwürdig«, erwiderte Obediah.
Als er Phelps’ beleidigte Miene sah, fügte er rasch hinzu: »Nicht die Nachricht per se, an deren Wahrheitsgehalt zweifle ich nicht. Aber die Erfolgsaussichten erscheinen mir gering.«
»In der Tat wäre es der größte Coup der Venezianer, seit sie den Apostel gestohlen haben. Zumindest wäre jetzt der perfekte Moment, meint Ihr nicht? Nun, da der Türke anderweitig gebunden ist …«
Während Phelps die Bemühungen der Venezianer, eine Kriegsflotte zur Rückeroberung Kretas aufzustellen, en détail referierte, holte Obediah die Kaffeehausmünze hervor, welche die Bedienung ihm gegeben hatte. Er drehte sie zwischen den Fingern hin und her. Auf der einen Seite waren ein Türkenkopf und eine Inschrift abgebildet. Sie lautete: »Murat der Große nannt’ man mich.« Und auf der anderen Seite: »Wohin ich kam, da siegte ich.«
»… stimme ich Euch zu, dass man über die Erfolgsaussichten des venezianischen Feldzugs geteilter Meinung sein kann. Aber bedenkt, was ein gewiefter Spekulant verdienen kann, wenn er darauf setzt, dass viele levantinische Güter demnächst vielleicht wieder über Iraklio nach London und Amsterdam kommen.«
»Ihr habt ja recht, Mister Phelps. Aber die Zeit der Venezianer ist vorbei. Sie sitzen in ihrer Wasserstadt und träumen von einstiger Größe, während die Türken ihnen Jahr für Jahr weitere Besitzungen wegnehmen. Die einzigen Dinge, in denen Venedig noch führend ist, sind Bordelle und Bälle.«
Phelps lächelte spöttisch. »Wenn man hört, was so alles im Palast von Whitehall passiert, dann haben die Venezianer inzwischen allerdings starke Konkurrenz.«
Obediah quittierte die Bemerkung des Händlers mit einem kaum wahrnehmbaren Nicken. Phelps mochte recht haben, aber den König und seinen Hof mit einem venezianischen Boudoir zu vergleichen, konnte einem schnell einen Aufenthalt im Tower oder in Newgate einbringen. Phelps würde einer Strafe aufgrund seiner Beziehungen vielleicht irgendwie entgehen können, aber Obediah Chalon war Katholik und damit aus Sicht englischer Richter so ziemlich jeder Gemeinheit verdächtig, zu der Menschen fähig waren. Er machte sich diesbezüglich keine Illusionen. Sein eigener Vater war adlig, wohlhabend und in der ganzen Grafschaft beliebt gewesen. Doch als Cromwells Schergen damals mit Fackeln und Piken vor ihrem Anwesen aufgetaucht waren, hatte all dies nichts mehr gezählt. Sondern nur, dass Ichabod Chalon Katholik war.
Deshalb war Obediah stets vorsichtig. Ein Fehler und man würde ihn schnurstracks in Tyburn aufknüpfen. Deshalb hütete er sich, über derlei Dinge zu sprechen, selbst in einem fast leeren Kaffeehaus.
Stattdessen zeigte er auf die Münze mit dem Türkenkopf. »Wie dem auch sei. Sultan Mehmed IV. ist vielleicht nicht Murat der Grausame. Aber er hat das beste und größte Heer der Welt. Diese Wette auf die Rückeroberung Candias erscheint mir zu heikel.«
Er steckte die Münze weg. Und außerdem habe ich bereits eine andere Wette laufen, dachte er. Eine, deren Ausgang so sicher ist wie das Amen in der Kirche. Obediah erhob sich. »Wenn Ihr mich nun entschuldigen würdet, Mister Phelps. Ich werde bei ›Jonathan’s‹ erwartet. Es war wie immer eine Freude, mit Euch zu plaudern.«
Sie verabschiedeten sich voneinander. Obediah trat hinaus, auf die Shoe Lane. Es war in der Tat kalt, ganz egal was Tompions Thermometer sagte. Die fahle Sonne hatte es noch nicht geschafft, den von der Themse herüberziehenden Morgennebel zu vertreiben, obwohl es bereits auf zehn Uhr ging. Er lief die Gasse hinauf bis zur Fleet Street und wandte sich dort nach links. Sein Ziel war jedoch nicht, wie er gegenüber Mister Phelps behauptet hatte, »Jonathan’s Coffee House« in der Exchange Alley. Dort erwartete man ihn erst am Nachmittag. Stattdessen nahm er Kurs auf Little Britain. Kurz überlegte er, einen Hackney zu mieten, entschied sich aber dagegen. Zu Fuß würde er schneller an sein Ziel gelangen, denn in London schien an diesem Dienstagmorgen äußerst reger Betrieb zu herrschen. Die Season hatte begonnen, Heerscharen von Landadligen und wohlhabenden Bürgern reisten dieser Tage aus den Grafschaften in die Hauptstadt, um dort für einige Wochen Quartier zu beziehen, Theaterstücke zu besuchen, sich auf Bällen und Empfängen zu zeigen und ihre Garderobe vor Weihnachten auf den Stand der aktuellen Mode zu bringen.
Vor einem Schaufenster hielt Obediah an und betrachtete seine Reflexion in der Scheibe. Auch er selbst hätte eine neue Garderobe gebrauchen können. Sein Justaucorps war nicht sehr abgetragen, wohl aber zu eng. Obediah, der gerade seinen zweiunddreißigsten Geburtstag gefeiert hatte, war zuletzt etwas auseinandergegangen. Folglich sah er in dem zu schmalen Gehrock mehr und mehr aus wie ein Haggis auf Beinen. Seine samtenen Kniebundhosen waren abgeschabt, das Gleiche galt für seine Schuhe. Er schaute in das beinahe faltenlose Jungengesicht mit den wasserblauen Augen und legte eine widerspenstige Perückenlocke zurecht. Zum Glück würde er nicht mehr lange mit diesen Kleidern auskommen müssen.
Obediah wandte sich ab, schlug seinen Kragen hoch und lief die Ludgate hinauf, vorbei an der riesigen Baustelle für die neue Kathedrale. Er ging weiter in Richtung des St. Bart’s Hospitals. Obwohl er sich von der Themse wegbewegte, kroch ihm die feuchte Kälte in die Knochen. Die meisten Menschen, die ihm entgegenkamen, blickten missmutig drein, hatten die Schultern hochgezogen und die Arme vor dem Körper verschränkt. Obediah hingegen lief federnden Schrittes, so als sei es ein strahlender Frühlingsmorgen. Heute war ein guter Tag. Es war der Tag, an dem er zu Reichtum gelangen würde.
Schon bevor er das jenseits der Stadtmauern liegende Little Britain betrat, konnte er es riechen. In dem Viertel befanden sich zahllose Buchhändler und Buchbinder. Londons olfaktorisches Grundmotiv, jenes unvergleichliche Parfüm aus verfaulenden Abfällen, kaltem Rauch und Pisse wurde hier um weitere Noten ergänzt: um Leimdämpfe und den beißenden Gestank frisch gegerbten Leders. Ohne die zahllosen, vor den Läden ausgelegten Bücher eines Blickes zu würdigen, lief Obediah bis zu einem Haus in der Mitte der Gasse. Über der Tür schaukelte eine Tafel im Wind. Sie zeigte die griechischen Lettern Alpha und Omega sowie ein Tintenfass. Darunter stand: »Benjamin Allport, Druckermeister.«
Er ging hinein. Der Leimgeruch wurde stärker und begann ihn augenblicklich in der Nase zu kitzeln. Immerhin roch es hier drin nicht nach Gosse. Allports Druckerei bestand im Wesentlichen aus einem großen Raum. In dessen hinterem Teil befanden sich zwei Druckpressen. Sie waren einer der Gründe, warum Obediah gerade diese Druckerei ausgewählt hatte. Allport verwendete holländische Maschinen – den Goldstandard unter den Pressen. Auf solchen Geräten druckten auch die großen Bankhäuser des Kontinents. Der vordere Teil des Ladens beherbergte neben einem derzeit verlassenen Schreibpult zwei große, niedrige Tische, auf denen sich Ries um Ries gelblichen Papiers türmte. Es handelte sich um frisch gedruckte Traktate. Obediah ging zu dem Pult und griff nach der kleinen Glocke, die dort stand. Er läutete zweimal.
»Einen Moment, bitte!«, ertönte eine Stimme von der Galerie. Während Obediah darauf wartete, dass Benjamin Allport erschien, sah er sich die frischen Druckerzeugnisse an. Da war ein Traktat namens »Der fürchterliche und erstaunliche Sturm, der herniederging in Markfield, Leicestershire, und bei dem höchst wundersame Hagelsteine zur Erde fielen, welche die Form von Schwertern, Dolchen und Hellebarden besaßen«. Ferner gab es ein Heft mit dem Titel »Der Londoner Laufpass oder die Politische Hure, in welchem all die Kunstgriffe und Stratageme gezeigt werden, welche jene Damen der Lust itzo gegen den Manne einsetzen, verwoben mit vergnüglichen Geschichten über die Darbietungen jener Damen«. Dies musste das Pamphlet sein, von dem er in der »Gazette« gelesen hatte und das am Hofe für Aufregung sorgte. Normalerweise lag ihm nichts ferner als derlei lüsternes Geschreibsel, aber nun griff er sich eine Kopie und blätterte darin. Obediah war gerade in eine Stelle vertieft, die eine eindringliche Schilderung der im Titel versprochenen Darbietungen enthielt, als er jemanden die Treppe herunterkommen hörte. Mit heißen Ohren legte er das Traktat zurück und schaute auf.
»Guten Morgen, Meister Allport.«
»Guten Morgen, Mister Chalon. Was haltet Ihr von der ›Politischen Hure‹?«
Allport war ein großer Mann, was man jedoch nicht gleich sah, auch wenn man ihm gegenüberstand. Sein Rücken war von der jahrelangen Arbeit an der Presse gebeugt, der Kopf befand sich auf der Höhe der Schultern. Allports Hände waren so schwarz wie die eines Mohren, sein perückenloses Haupt nahezu kahl.
Obediah spürte, wie sich seine Wangen röteten. »Die auf dem Titel angepriesenen Stratageme habe ich nicht finden können, nur die … Darbietungen.«
Allport kicherte. »Die dürften der Grund dafür sein, dass es sich besser verkauft als Gesangsfibeln vor Weihnachten. Ihr könnt gerne ein Exemplar mitnehmen, wenn Ihr wollt.«
»Sehr freundlich, Meister Allport, aber …«
»Ihr interessiert Euch lediglich für Naturphilosophie und Börsengeschäfte, ich weiß.«
»Sind meine Drucke fertig?«
»Selbstverständlich. Wenn Ihr mir folgen wollt.«
Allport führte ihn zu einer Holzkiste, die im hinteren Teil seiner Werkstatt stand. Er öffnete den Deckel. Die Kiste war voller Pamphlete. Der Drucker nahm eines heraus und reichte es Obediah. Es war auf dünnem, fast transparentem Papier gedruckt und umfasste etwa zwanzig Seiten. Stolz betrachtete Obediah den Titel: »Ein Vorschlag zur Verwendung von Wechselpapieren im Königreich England, ähnlich jenen, die von Amsterdamer Geschäftsleuten anstelle von Edelmetallen verwendet werden, als Heilmittel für die Misere der Knappheit unseres Geldes und zur Förderung des Handels, demütigst unterbreitet von Obediah Chalon, Esq.«
»Ich hoffe, Ihr seid mit der Qualität zufrieden.«
Obediah blätterte das Pamphlet auf. Der Druck war tadellos, aber das war es nicht, was ihn interessierte. Sein Augenmerk galt einem losen Blatt, das im Innenteil lag. Anders als der Rest des Traktats war es aus cremefarbenem Büttenpapier. Es besaß ein Wasserzeichen und eine aufwendige Prägung. Obediah tat einige Schritte auf einen Stützbalken zu, an dem eine Öllampe hing, um Allports Arbeit besser begutachten zu können.
»Ganz ausgezeichnet. Ich bin beeindruckt.«
Allport verneigte sich, soweit das bei seinem immensen Buckel möglich war. »Benötigt Ihr einen Burschen, der Euch die Pamphlete nach Hause liefert?«
»Nein, vielen Dank, das mache ich selbst. Aber sagt, bis wann könntet Ihr mir weitere hundert Stück drucken?«
Die Augen des Druckers weiteten sich.
»Von den Traktaten, meine ich, nicht von den Urkunden.«
»Ah, ich verstehe. Bis Anfang Oktober, wenn es Euch beliebt.«
»Ausgezeichnet. Ich zahle sie im Voraus und wäre Euch dankbar, wenn Euer Bursche sie dann liefert.«
»An Eure Anschrift?«
»Nein, je zwanzig an ›Jonathan’s‹, ›Nando’s‹, das ›Grecian‹, ›Swan’s‹ und ›Will’s‹«, sagte Obediah. Er wollte schließlich, dass sein Vorschlag Gehör fand. Und nirgendwo verbreiteten sich neue Ideen schneller als in den Kaffeehäusern.
»Ich werde dafür sorgen, dass sie dort ausgelegt werden«, antwortete Allport.
»Wie viel schulde ich Euch?«
»Die Pamphlete kosten jeweils einen Groat, inklusive der noch zu druckenden, hundertfünfzig mal vier Pence, also fünfzig Schillinge, wenn es beliebt, Sir. Die beiliegenden Sonderdrucke … insgesamt acht Pfund. Macht zusammen also zehn Guineas.«
Angesichts der enormen Summe musste Obediah kurz schlucken. Beim letzten Kassensturz hatte sich seine gesamte Barschaft auf nicht einmal fünfzehn Guineas belaufen. Aber das war nun nebensächlich, bereits in wenigen Tagen würde diese Investition mehr als das Hundertfache abwerfen. Er holte seine Börse hervor und legte zehn schwere Goldmünzen auf das Pult. Allport prüfte sie kurz und schob sie dann mit seiner rußschwarzen Pranke in die Kasse. Obediah schulterte die Kiste mit den Drucken, verabschiedete sich und machte sich auf den Weg zu seiner Wohnung.
Das Quartier in der Winford Street war bereits sein drittes innerhalb von zwei Jahren. Zuvor hatte er in der Fetter Lane gewohnt, dann nahe Leadenhall. Seine Umzüge verliefen, dessen war er sich schmerzlich bewusst, nach einem unerfreulichen Muster. Jede neue Behausung war weniger repräsentativ als die vorherigen. In dem Maße, in dem in den vergangenen Jahren sein Vermögen zusammengeschmolzen war, waren auch seine Wohnungen immer kärglicher geworden. Er stieg die schmale Treppe in den dritten Stock hinauf. Als er oben angekommen war, keuchte er. Schweiß rann ihm aus allen Poren. Ächzend stellte Obediah die schwere Kiste ab und schloss auf.
Das einzig Gute, das man über sein Mansardenzimmer sagen konnte, war, dass es viel Platz bot. Man hätte es sogar luftig nennen können, im doppelten Wortsinne. Nicht nur bot es reichlich Raum für Obediahs umfängliche Kuriositätensammlung, es zog darin auch wie auf der London Bridge. Das war schlecht für seine Gesundheit, aber ermöglichte es ihm andererseits, naturphilosophische Experimente durchzuführen, ohne an den giftigen Dämpfen zu ersticken, die damit bisweilen einhergingen.
Neben dem ungemachten Bett stand ein kleiner Sekretär voller Korrespondenz, die sich in unordentlichen Stapeln zwischen Tintenfässern, Federn und Siegelwachsbrocken türmte. Rechts davon befand sich ein mit Intarsien verziertes Schränkchen, das nur aus Schubladen zu bestehen schien. Ursprünglich hatte es sich dabei um eine Besteckkommode gehandelt, nun quollen aus den halb geöffneten Fächern Briefe über Briefe, Schriftwechsel mit Naturphilosophen und Virtuosi in Cambridge, Amsterdam, Bologna oder Leipzig. Und dies war nur sein Handapparat – in mehreren Kisten, die hinter dem Bett gestapelt waren, lagerte noch einmal die zehnfache Menge an Schriftstücken. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes stand ein wuchtiger Tisch, auf dem sich allerlei Gerätschaften befanden. Da gab es verschiedene Glaskolben voller Pulver und Tinkturen, ein Sezierbesteck, das nach der letzten Vivisektion nicht ausreichend gesäubert worden war, außerdem einen kleinen Schmelzofen nebst diversen Prägeformen für Münzen aller Art – spanische Pistolen, niederländische Stuiver, englische Kronen. Hinter dem Tisch, an der einzigen Wand, die keine Schrägen besaß, stand ein hohes Kabinett, in dem Obediah seine Schätze aufbewahrte: eine prächtige Originalausgabe des »Atlas Maior« von Willem Blaeu; ein Teleskop, mit dem sogar die Berge des Mars auszumachen waren; verschiedene in Alkohol eingelegte Ratten mit bizarren Missbildungen; eine erstaunlich präzise Schweizer Kaminuhr, vor deren Zifferblatt kleine Figuren zu jeder vollen Stunde eine Art Schäfflertanz aufführten, und natürlich sein Prunkstück: eine metallene Ente mit echten Federn, die man aufziehen und herumlaufen lassen konnte, ein Werk des großen französischen Automatenbauers de Gennes. Der mechanische Vogel konnte, wenn man den richtigen Hebel umlegte, sogar Gerstenkörner aus einem Schälchen aufpicken. Zwischen all dem lagen Zeichnungen, Dutzende jener mit Reißblei oder Kohle angefertigten Skizzen, die Obediah bei jeder Gelegenheit produzierte. Sie zeigten Kirchtürme, Schiffe oder Straßenszenen, aber auch Versuchsanordnungen, Stillleben oder Gesichter.
Er schleppte Allports Kiste in sein Zimmer und schloss hinter sich ab. Zunächst räumte er einen Teil seines Labortisches frei und säuberte die Fläche mit einem Lappen. Dann wandte er sich den Pamphleten zu. Er blätterte sie auf und nahm die eingelegten Büttenpapiere heraus. Insgesamt waren es zehn. Nachdem er sie auf den Tisch gelegt hatte, begutachtete er sie mit der Lupe. Allport hatte gute Arbeit geleistet.
Seiner Briefkommode entnahm Obediah ein Dokument, das den zehn aus der Druckerei täuschend ähnlich sah. Der einzige Unterschied bestand darin, dass auf dieser Urkunde ein Stempel aufgebracht war und das leere Feld in der Mitte eine Zahl enthielt. Außerdem befand sich in der linken unteren Ecke eine Unterschrift, in einer schwungvollen Hand ausgeführt, die Obediah, das hatte er am Vorabend bereits ausprobiert, mühelos würde nachahmen können. Zwei kleine Ausstanzungen in der oberen linken Ecke verrieten, dass die Urkunde bereits entwertet worden war. Für Obediah war sie dennoch pures Gold.
Aus seiner Rocktasche holte er nun jenes kleine Paket hervor, das er bei »Mansfield’s« mitgenommen hatte. Er brach das Siegel und riss das Papier entzwei. Eine kleine Holzkiste kam zum Vorschein. Sie war vernagelt. Mit einem Messer löste Obediah die Nägel und öffnete das Kistchen vorsichtig. Darin lag, auf einem Bett aus Sägespänen, ein Stempel. Der Fuß war aus Metall und zeigte einen doppelten Kreis, in dem ein großes verschnörkeltes »W« zu sehen war, mit drei kleinen Kreuzen darunter. Obediah begutachtete die Stempelfarbe auf dem Originaldokument und durchwühlte seinen Sekretär, bis er die passende Tinte gefunden hatte. Aus einer Schublade holte er weitere Prägestempel sowie eine Schreibfeder. Dann machte er sich an die Arbeit.
Saint Mary Woolnoth hatte gerade zur zweiten Nachmittagsstunde geschlagen, als Obediah, eine Mappe mit den druckfrischen Urkunden fest an seine Brust gepresst, in die Exchange Alley einbog. Die Exchange war eigentlich keine Allee, nicht einmal eine Straße – sie konnte kaum als gewöhnliche Gasse durchgehen. Stattdessen handelte es sich um ein Gewirr aus sechs oder sieben Durchgängen, vermittels derer man rasch von der Royal Exchange an der Cornhill auf die etwas weiter südlich verlaufende Lombard Street gelangen konnte. In diesem wenig anheimelnden Labyrinth aus Häusern mit windschiefen Dächern hatten sich zunächst lombardische Goldschmiede niedergelassen, später dann Börsenhändler. Obediah kannte hier jeden Winkel, und während er durch die Exchange Alley hastete, grüßten ihn mehrere Männer. Als ihm einer der Laufburschen entgegenkam, die zwischen der Börse und den Kaffeehäusern hin- und herpendelten, hob er den Arm und rief den Jungen.
»Du, komm mal her.«
Der Bursche, vielleicht dreizehn Jahre alt, rückte seine schmutzige und vermutlich verlauste Perücke zurecht und blickte Obediah erwartungsvoll an.
»Geh zur Börse und besorg’ mir die letzten Notierungen für Nelken. Ich warte bei ›Jonathan’s‹.«
Obediah hielt ihm einen Farthing hin. Der Bursche nahm ihn und steckte ihn rasch in seine Hosentasche.
»Wird gemacht, Sir«, antwortete er und verschwand in der Menge.
Obediah ging weiter, bis er »Jonathan’s Coffee House« erreichte. Als er den bis zum Bersten gefüllten Raum betrat, schlugen ihm die Aromen von Tabak, Kaffee und Aufregung entgegen. Während manche Gäste an den Tischen saßen und den »Mercure Galant« oder andere Handelsjournale studierten, war das Gros der Besucher auf den Beinen. In kleinen Grüppchen standen sie um die Stockjobber mit ihren Schreibblöcken und Wachstäfelchen herum und riefen durcheinander. Obediah bahnte sich einen Weg zur Theke.
»Eine Schale Kaffee, bitte.«
»Selbstverständlich, Mister Chalon«, antwortete der Wirt. »Ich bringe ihn Euch gleich, muss nur erst ein neues Fass öffnen.«
Obediah beobachtete den Wirt dabei, wie dieser ein kleines Holzfass auf die Theke wuchtete, anstach und kalten Kaffee in mehrere Kannen füllte. Er kramte die Kaffeehausmünze mit dem Konterfei Sultan Murats aus seiner Rocktasche und hielt sie dem Wirt hin. Der blinzelte kurz und schüttelte dann den Kopf. »Bedaure, Sir. Die nehmen wir hier nicht.«
Er gab dem Wirt stattdessen ein Zweipennystück. Im Gegenzug erhielt er eine weitere Bronzemünze, wieder mit dem Konterfei eines Türken. Dieser blickte allerdings weniger grimmig drein als Murat der Grausame. Die Inschrift verriet ihm, dass es sich um Süleyman den Prächtigen handelte. Während er darauf wartete, dass sein Kaffee heiß gemacht wurde, begann sich »Jonathan’s« zu leeren. Obediah konnte nun erkennen, dass sein Geschäftspartner noch nicht eingetroffen war. Er ging zu einem der Tische, setzte sich gegenüber zweier Herren auf die Bank und sah einige Briefe durch, die sich seit Tagen ungeöffnet in seiner Rocktasche befanden. Danach musterte er die beiden Männer. Ihre teuren, aber etwas aus der Mode gekommenen Röcke und ihre für einen Besuch im Kaffeehaus viel zu pompösen Ausgehperücken wiesen sie als Landadlige aus, die zur Season nach London gekommen waren. Vor den beiden lagen verschiedene Wechsel und Zertifikate. Vermutlich versuchten sie sich als Spekulanten. Obediah blätterte in einer »Gazette«, überflog einen Artikel über Brotaufstände in Paris und wartete, dass sein Laufbursche zurückkam. Währenddessen lauschte er der Unterhaltung seiner beiden Tischnachbarn.
»… soll das Wetter im Süden noch schlechter sein als hier. Der Türke wird die Belagerung abbrechen müssen, bevor die Pässe zuschneien.«
»Glaubt Ihr wirklich, dass Kara Mustafa einfach abziehen und dem Grand-Seigneur in Konstantinopel mit leeren Händen gegenübertreten wird? Nein, ich sage Euch: Die Stadt ist am Ende. Dort soll bereits die Cholera ausgebrochen sein.«
»Ihr überseht, Sir, dass ein Entsatzheer den Kaiser noch immer retten könnte.« Der Mann senkte die Stimme. »Ich habe gute Kontakte nach Versailles. Und von dort höre ich, dass König Louis eine Armee aufstellt.«
»Aber warum sollten gerade die Franzosen den Habsburgern helfen?«, fragte der andere.
»Weil es um nichts weniger geht als um den Fortbestand der Christenheit. Man kann sich nicht Rex Christianissimus nennen und zusehen, wie alles von diesen teuflischen Ketzern überrannt wird.«
Es kostete Obediah alle Mühe, nicht laut loszuprusten. Eher würde die Hölle einfrieren, als dass Louis XIV. dem Kaiser zu Hilfe eilte. Wie er aus seinem Netzwerk von Briefeschreibern wusste, hatte kürzlich sogar ein Legat des Papstes in Versailles antichambriert, um den katholischen Louis zu überreden, seinem österreichischen Glaubensbruder gegen die Türken zu Hilfe zu eilen. Der Sonnenkönig hatte den Legaten nicht einmal empfangen.
Viel wahrscheinlicher war, dass die Franzosen den Krieg der Osmanen gegen die Habsburger nutzen würden, um ungestört die Spanischen Niederlande oder die Holländische Republik zu überfallen. Obediah hatte zuletzt seine Briefwechsel mit einigen Naturphilosophen in Deutschland, Polen und Italien intensiviert. Viele dieser Männer besaßen exzellente Kontakte zum jeweiligen Hof ihres Landes. Und von überall war dasselbe zu hören: Niemand hatte Lust, kurz vor Wintereinbruch ein Entsatzheer an die Donau zu schicken. Die protestantischen deutschen Fürsten ohnehin nicht, und der polnische König verdankte seine Krone, wie jeder wusste, schließlich Louis XIV., der bei Sobieskis Wahl das polnische Parlament bestochen hatte. Kurzum, alles, was er aus der République des Lettres hörte, deutete darauf hin, dass es keine Hilfe für Kaiser Leopold I. geben würde.
Trotzdem glaubten die meisten Engländer, der Kontinent werde doch noch irgendwie in letzter Minute vor den Türken gerettet werden. Nicht, weil es dafür gute Argumente gegeben hätte – sondern einfach, weil nicht sein durfte, was nicht sein konnte. Obediah hingegen war Realist. Einer seiner Konstantinopler Korrespondenten hatte den osmanischen Heerwurm sogar gesehen – der türkische Großwesir Kara Mustafa hatte ihn Ausländern und Diplomaten vor dem Abmarsch stolz vorgeführt. Angeblich umfasste er mehr als hundertfünzigtausend Mann. Nichts und niemand würde dieser gewaltigen Kriegsmaschinerie standhalten können, nicht einmal der Römische Kaiser Deutscher Nation. Das Reich würde untergehen. Und Obediah würde daran sehr viel Geld verdienen.
Der Laufbursche betrat das Kaffeehaus. Obediah hob die Hand. »Der Preis für ein Pfund Nelken liegt derzeit bei acht Pfund, drei Schilling und Sixpence, Sir.«
»Wann erfolgte die letzte Notierung?«
»Vor einer Stunde, Sir.«
Obediah gab dem Jungen einen weiteren Farthing. Kurz nachdem ihm der Wirt endlich den Kaffee gebracht hatte, steuerte jemand auf seinen Tisch zu. Es war seine Verabredung: Bryant, ein auf Gewürze spezialisierter Börsenhändler.
»Guten Tag, Mister Chalon. Was kann ich heute für Euch tun? Wollt Ihr wieder in Rohrzucker investieren?«
Bryant, ein tonnenförmiger Mann mit einer schief sitzenden, rabenschwarzen Allongeperücke, versuchte unbeteiligt dreinzublicken, während er sprach. Aber Obediah konnte den hämischen Unterton in seiner Stimme hören. Der Plan, die in den Sommermonaten traditionell anziehenden Preise für Zucker aus Brasilien für ein recht waghalsiges Optionsgeschäft zu nutzen, war eine seiner weniger guten Ideen gewesen und mit dafür verantwortlich, dass er in eine Kemenate jenseits der Stadtmauern hatte umsiedeln müssen. In Kürze, dachte er bei sich, wird dir dein überhebliches Grinsen im Gesicht festfrieren, James Bryant.
»Nein danke, Mister Bryant. Ich wollte wegen eines anderen Geschäfts mit Euch reden. Es geht um Nelken.«
»Ah? Stellt Ihr welche zum Verkauf? Dann wäre ich interessiert. Das Angebot ist derzeit sehr mickrig.«
»Ich weiß. Schenkt mir zehn Minuten Eurer Zeit.« Er blickte dem Börsenhändler in die Augen. »Aber wir sollten uns dazu ein ruhigeres Plätzchen suchen.«
Bryant hob seine buschigen Brauen. »Oh? Nun gut. Lasst uns dort hinten an den leeren Ecktisch gehen.«
»Einverstanden. Möchtet Ihr etwas trinken? Eine Schale Kaffee?«
»Lieber eine Schokolade. Mit zwei Eigelb und einem Schuss Port, bitte. Der Arzt sagt, das sei gut gegen meine Gicht.«
Während ihnen Bryant den Tisch freihielt, holte Obediah noch einen Kaffee für sich und eine Schokolade für den Stockjobber. Dann setzte er sich ihm gegenüber.
»Nelken sind also immer noch knapp.«
Bryant nickte. »Die Amsterdamer Lager sind ziemlich leer. Und die Schiffe der Vereinigten Ostindischen Compagnie bringen erst im Sommer neue Ware, vielleicht noch später.«
»Daraus, Mister Bryant, kann ich wohl schließen, dass Optionen auf den Kauf von Nelken teurer werden, richtig?«
»So ist es. Vorgestern habe ich ein paar verkauft, das Pfund für dreizehn und sieben. Vor drei Monaten hättet Ihr die noch für die Hälfte bekommen.«
»Ich würde dennoch gerne einige dieser Optionen erwerben. Kennt Ihr jemanden, der welche loswerden will?«
»Ich kenne immer jemanden. Aber …«
»Aber was?«
»Aber wieso wollt Ihr das tun? Ihr könntet Euch mächtig die Finger verbrennen. Denkt an das Debakel mit dem Rohrzucker.«
Obediah lehnte sich zurück. »Ich wusste gar nicht, dass Ihr so um das Wohl Eurer Kundschaft besorgt seid. Eure Kommission ist Euch doch sicher, ganz egal, ob ich mit meinen Optionen im Geld bin oder nicht.«
»Ich wollte Euch einfach darauf hingewiesen haben, dass manche der Meinung sind, dass der Kurs von Nelkenoptionen nicht viel weiter steigen wird. Schließlich hat er sich bereits mehr als verdoppelt.«
»Nun, ich glaube, dass er noch viel höher klettern wird. Deshalb möchte ich eine beachtliche Menge erwerben.«
»Von welcher Summe reden wir?«
»Fünftausend Gulden.«
»Allmächtiger! Wisst Ihr etwas, dass ich nicht weiß?«
»Würde ich sonst bereits überteuerte Papiere in so großer Zahl kaufen wollen?«, fragte Obediah.
»Vermutlich nicht, dafür seid selbst Ihr zu ver … ich meine, Ihr seid zu beschlagen in diesen Dingen. Wollt Ihr mich nicht an Eurem Wissen teilhaben lassen?«
»Mister Bryant, nun beleidigt Ihr meine Intelligenz.«
»Verzeiht. Einen Versuch war es wert.«
»Selbstverständlich werde ich Euch verraten, warum der Preis für Nelken bald weiter in die Höhe schießt. Aber natürlich erst, wenn Ihr eine Gegenpartei für mich aufgetrieben habt und das Geschäft unter Dach und Fach ist.«
»Damit ich Euer Gerücht rumerzähle, den Preis treibe und kurz darauf die halbe Exchange Alley ins Nelkenfieber verfällt?«
Obediah lächelte. »Wenn das passierte, wäre es sicher ein gutes Geschäft. Für mich natürlich. Aber auch für den Stockjobber, der an fast jeder Nelkentransaktion mit einer Kommission beteiligt ist.«
»Ich denke, wir sind uns fast einig, Mister Chalon. Ich glaube auch schon zu wissen, wer als Gegenpartei infrage kommt. Da wäre nur noch eines: Wie gedenkt Ihr zu zahlen? In barer Münze? Ich sehe keine Truhe voller Silber, und angesichts der genannten Summe werdet Ihr eine brauchen – und keine kleine.«
»Ich besitze Wechsel über die nötige Summe.«
Bryant runzelte die Stirn. »Aus Siena oder Genf?«
Statt zu antworten, holte Obediah eine seiner gestempelten und signierten Urkunden hervor und hielt sie dem Stockjobber unter die Nase.
»Eine Verbriefung der Amsterdamer Wisselbank! Wie seid Ihr an die gekommen?«
»Über einen Geschäftspartner in Delft. Wie Ihr sehen könnt, lautet sie auf fünfhundert Gulden. Ich besitze zehn davon. Sie sind so gut wie Goldkronen. Besser sogar, denn man kann ihre Ränder nicht abfeilen.«
Einige Stunden später saßen James Bryant und Obediah Chalon bei Mister Fips, einem Notar in einer Nebengasse der Temple Street, und warteten auf den Verkäufer der Optionen.
»Ihr könntet mir nun allmählich sagen, um wen es sich handelt, Mister Bryant.«
»Sein Name ist Sebastian Doyle. Er ist Fechtlehrer.«
»Und wieso besitzt ein gemeiner Fechtlehrer Nelkenoptionen im Wert von fünftausend Gulden?«, fragte Obediah.
»Er ist nicht irgendein Schwertschwinger, sondern der persönliche Lehrer des Herzogs von Monmouth. Gehört zu dessen Entourage. Ich habe die Ehre, ihn in finanziellen Angelegenheiten zu beraten.«
Während sie in dem etwas muffigen Büro saßen und sich unterhielten, bemerkte Obediah, dass seine Stimme leicht zitterte. Er versuchte, gleichmäßig zu atmen und seine Hände ruhig zu halten. Grund für seine Nervosität war, neben dem Umstand, dass er gerade das Geschäft seines Lebens machte, der Notar auf der anderen Seite des wuchtigen Schreibtischs. Mit einer riesigen Lupe begutachtete Mister Fips die gefälschten Papiere der Wisselbank. Obediah konnte das grotesk vergrößerte, rot geäderte Auge des Mannes sehen, das zwischen den verschiedenen Papieren hin- und herhüpfte. Der Advokat hatte ein dickes Buch aufgeschlagen, das Faksimiles der gängigen Wechsel enthielt – in Livres lautende Anweisungen der französischen Caisse des Emprunts, nota di banco von Montei dei Paschi aus Siena, verbriefte Piaster des Sultanats, Wechsel von Oppenheimer aus Wien und auch die Papiere der Wisselbank. Obediah hatte dieses Buch noch nie zuvor gesehen und beschloss, sich demnächst ein Exemplar zu besorgen. Das Werk würde seine Arbeit erheblich erleichtern.
Bryant erzählte ihm irgendwelchen Tratsch über den Herzog von Monmouth, einen unehelichen Sohn König Charles II. Obediah hörte kaum hin. Stattdessen beobachtete er verstohlen, wie der Notar feinsäuberlich einen Wechsel nach dem anderen umdrehte, um sicherzugehen, dass keiner von ihnen durch ein Indossament ungültig gemacht worden war. Dann zählte er die Papiere noch einmal durch und legte sie gestapelt vor sich. Kaum war er damit fertig, öffnete sich die schwere Tür und ein Gehilfe trat ein. In der Hand hielt er eine Visitenkarte. Er verneigte sich, überreichte sie dem Notar und sagte: »Ein Mister Doyle wartet unten, Sir.«
»Herauf mit ihm, herauf mit ihm«, rief Fips.
Während der Diener verschwand, rieb sich Mister Fips die Hände. Vermutlich rechnete er gerade aus, wie hoch seine Kommission bei einem Geschäft über fünftausend Gulden sein würde. Dann erhob er sich und ging zur Tür, um den Klienten in Empfang zu nehmen.
Obediah konnte Sebastian Doyle riechen, bevor er ihn sah – eine Wolke von Lavendelduft wehte ihm voraus. Sein Geschäftspartner war jene Art von Mann, dem das Volk auf der Straße gerne »Französischer Hund!« hinterherrief. Er trug einen überlangen Gehrock aus blauem Samt, verziert mit einem Dutzend Goldknöpfen, die keine Funktion hatten, denn natürlich schloss Doyle seinen Mantel nie. Das hätte den Blick auf sein ebenfalls blaues, mit Jagdszenen besticktes Wams versperrt. Aus seinen Ärmeln quollen doppelrüschige Engageants mit mehr Spitze, als die durchschnittliche Engländerin in ihrer Aussteuer hatte. Vervollständigt wurde Doyles Garderobe durch seidene Kniestrümpfe, hochhackige Schuhe und einen Muff aus kanadischem Biberfell, der an einem Gürtel unterhalb seiner Hüfte baumelte. Seinen Hut hatte er abgenommen – nicht aus Höflichkeit, wie Obediah vermutete, sondern um die kunstvoll arrangierte Lockenpracht seiner Perücke nicht zu zerdrücken. Wahrscheinlich trug der Geck ihn in der Hand, seit er heute Morgen das Haus verlassen hatte.
»Mister Doyle, willkommen in meinem bescheidenen Büro. Mein Name ist Jeremiah Fips, von Seiner Majestät zugelassener Notar. Mister Bryant kennt Ihr bereits. Und dies ist Mister Chalon, ein Virtuoso und Naturphilosoph.«
Obediah verneigte sich leicht und sagte: »Es ist mir eine Freude, Eure Bekanntschaft zu machen, Sir.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Mister Chalon.«
Doyle nahm auf dem verbleibenden freien Stuhl Platz und sagte, an Bryant gewandt: »Ich hoffe, diese Transaktion dauert nicht allzu lange. Ich werde gegen sechs Uhr bei ›Man’s‹ erwartet.«
Wo sonst, dachte Obediah. »Man’s« nahe Charing Cross war das Kaffeehaus der Stutzer und Gecken. Doyles Tonfall und Gesichtsausdruck sollten den anderen Anwesenden vermitteln, es gehe bei seinem dortigen Termin um wichtige Staatsgeschäfte. Obediah war sich ziemlich sicher, dass es eher um Würfelspiel und Schnupftabak ging.
»Wir haben alles vorbereitet, sodass wir nur sehr wenig Eurer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen müssen«, sagte Mister Fips lächelnd.
»Ich werde – mit Eurer Erlaubnis, Gentlemen – das Geschäft noch einmal zusammenfassen. Danach bitte ich Sie beide um Ihre mündliche Zustimmung sowie Ihre Unterschrift. Die Rechnung für die anfallenden Gebühren lassen Mister Bryant und ich Ihnen später übersenden. Seid Ihr einverstanden, Messieurs?«
Doyle hielt zwei Finger seiner Rechten, die in mit Silberfäden durchwirkten Handschuhen aus Chamoisleder steckten, unter sein gepudertes Kinn. Mit der anderen Hand bedeutete er dem Notar fortzufahren.
Mister Fips nahm hinter seinem Schreibtisch Platz, setzte einen Zwicker auf und begann, einen mit einem Siegel versehenen Schrieb vorzulesen.
»Die hier anwesenden Gentlemen, Obediah Chalon Esq. – im Weiteren der Käufer – sowie Sebastian Doyle Esq. – im Weiteren der Verkäufer – kommen überein, folgende Transaktion vorzunehmen: Der Verkäufer überträgt dem Käufer Optionen zum Kauf von 54 Pfund Ambon-Nelken, mit Fälligkeit zum …«
Während Fips den Vertragstext vortrug, überlegte Obediah, wie viel seine Optionen in einigen Tagen wohl wert sein mochten. Er tippte auf mindestens das Fünf-, vielleicht sogar das Sechsfache. Möglicherweise würde ihr Preis sogar noch weiter steigen. Man konnte nie wissen, was die Börse tat, wenn sie einmal in Rage oder Panik geriet. Mit diesem Geschäft würde er mehrere Hundert Prozent Rendite erwirtschaften. Nein, das war nicht ganz richtig. Schließlich hatte er die fünftausend Gulden aus dem Nichts erschaffen, sein Gewinn würde also noch viel höher sein. Er musste sich zusammenreißen, um nicht selig zu grinsen, als Fips erklärte: »… zahlt der Käufer sofort den derzeitigen Optionswert in Wechseln der Amsterdamer Wisselbank.«
Doyle hob seine gezupften Augenbrauen. »In Wechseln sagt Ihr? Ist das denn sicher?«
»Sicherer geht es kaum. Mister Bryant?«
»Erlaubt mir, Euch das kurz zu erläutern. Die Papiere, die Mister Chalon besitzt, sind auf die Wisselbank ausgestellt, die reichste und sicherste Bank der Welt. Sie lauten auf das Konto von Jan Jakobzoon Huis, einem Bewindhebber der VOC, der Vereinigten Ostindischen Compagnie.«
»Was ist ein Bewindhebber?«
»Einer der Entscheidungsträger und Händler der VOC, Sir. Außerdem ein Aktionär.«
Das Misstrauen schien aus Doyles Gesicht zu weichen, wenn auch nicht vollständig. »Wie ist dieser Wechsel besichert und wo kann man ihn einlösen?«, fragte er.
»In Gold. Ihr könntet die Wechsel jederzeit in Amsterdam, Delft, Rotterdam oder Hamburg in bare Münze umtauschen, was aber kaum nötig sein wird. Jeder Londoner Geschäftsmann wird sie Euch begierig abnehmen – denn sicherer als bei der Wisselbank kann man sein Geld nirgendwo deponieren.«
»Gut. Wo muss ich unterschreiben?«
Mister Fips stand auf, ging um den Tisch herum und stellte dem Fechtlehrer ein Tintenfass nebst Feder hin. Dieser brauchte einige Sekunden, um sich seiner enganliegenden, parfümierten Handschuhe zu entledigen, erst dann unterschrieb er. Auch Obediah setzte seine schwungvolle Signatur unter die notarielle Urkunde. Fips zählte die Wechsel nochmals durch und überreichte sie Doyle, der sie umgehend an Bryant weitergab. »Bringt die für mich nach Whitehall. Ich habe dort während der Season Quartier genommen. Übergebt sie meinem Burschen, aber versiegelt.«
»Es ist mir eine Ehre, das für Euch erledigen zu dürfen, Sir.«
»Gut. Händigt diesem Gentleman bitte die Optionen aus. Meine Herren, wenn Ihr mich nun entschuldigen würdet. Die Pflicht ruft.«
Während Doyle dies sagte, machte er ein Gesicht, als ob er gleich losreiten und im Alleingang die Iren unterwerfen werde. Dann verschwand er die Treppe hinunter. Obediah ließ sich von Bryant die Optionspapiere geben. Sie verabschiedeten sich von Fips und verließen gemeinsam das Haus. Als sie draußen auf der Straße standen, sagte Bryant: »Darf ich Euch noch auf ein Getränk einladen? Mir scheint, wir haben noch etwas zu besprechen.«
»Gerne, Mister Bryant, aber das geht auf mich. Sollen wir zu ›Nando’s‹ gehen? Es scheint mir das nächstgelegene Kaffeehaus zu sein.«
Bryant war einverstanden, und so liefen sie die Middle Temple Lane bis zur Fleet Street hinauf und bogen dort nach rechts ab. »Nando’s« war, wie meist um die frühe Abendstunde, voller Templer, die nach ihren Terminen an den Gerichten hierherkamen, um mit Kollegen zu plaudern und die neuesten Verdikte und Urteile zu studieren, die an den Wänden des Kaffeehauses angeschlagen waren. Obediah und Bryant holten sich zwei Schalen Kaffee und setzten sich dann auf eine der wenigen noch freien Bänke.
»Nun? Wie fühlt sich das Optionspaket in Eurer Tasche an?«
»Leicht wie eine Feder, Mister Bryant.«
»Jetzt rückt schon damit raus. Was ist Euer Plan?«
»Lasst mich vorne beginnen. Warum, glaubt Ihr, ist der Preis für Nelken so stark gestiegen?«
Bryant zuckte mit den Schultern. »Weil die Nachfrage das Angebot übersteigt, nehme ich an. Der Grund interessiert mich ehrlich gesagt nicht, sondern nur seine Auswirkungen. Und die kann ich täglich auf den Kreidetafeln der Exchange Alley sehen – ferner in der wöchentlichen Depesche aus Holland, in der die Kursbewegungen am Dam gelistet sind.«
»Mich interessierten die Hintergründe des Preisanstiegs. Ich gehe dieser Sache bereits seit Monaten nach. Wie Ihr vielleicht wisst, besitze ich viele Brieffreunde.«
»Ja, Ihr scheint mit der ganzen Welt in Korrespondenz zu stehen.«
»Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber in der République des Lettres schnappt man so einiges auf, das einem zunächst nebensächlich erscheint. Neben naturphilosophischen Erörterungen enthalten die Briefe meiner Korrespondenten erstaunlich viel Tratsch, müsst Ihr wissen. Und von einem Bekannten in Den Haag erfuhr ich, warum in diesem Jahr so wenig Nelken auf dem Markt sind.«
»Nun?«
»Weil ein Teil der VOC-Flotte auf dem Rückweg von Batavia vor Mauritius untergegangen ist.«
»Nun, das passiert immer mal wieder, oder?«
»Natürlich, und die Holländer mit ihren vielen Tausend Schiffen können das verschmerzen. Im Indischen Ozean gibt es während der Monsunzeit nun einmal heftige Stürme. Es heißt, die Compagnie denke darüber nach, die Schiffe auf einer anderen Route fahren zu lassen, um die Verluste in Zukunft zu minimieren.«
Bryant nippte an seiner Schale. »Dieser Schiffbruch liegt aber in der Vergangenheit. Glaubt Ihr, dass die nächste Retourvloot auch absäuft?«
»Möglich ist es.«
Der Börsenhändler schüttelte den Kopf. »Ihr wollt darauf wetten, dass der Blitz zweimal in dieselbe Kirche einschlägt, ist das Euer Ernst? Ihr wettet aufs Wetter?«
»Verehrter Mister Bryant, Ihr missversteht mich. Natürlich könnte auch die nächste Nelkenlieferung aufgrund von Stürmen bei Davy Jones landen. Meine Nelkenoptionen würden dann weiter steigen. Aber das ist, wenn Ihr so wollt, nur die Hintergrundmusik. Ich will Euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe herausgefunden, dass nur zwei Handelshäuser noch nennenswerte Nelkenreserven besitzen. Das eine ist »Frans« in Amsterdam. Auf deren Lagerbestände lauten Doyles Optionen, die jetzt meine sind.«
»Und die anderen?«
»Die anderen Nelken kamen nicht über Holland, sondern über einen venezianischen Zwischenhändler, der Italien und das Kaiserreich beliefert. Dieser Händler hat sich, ich vermute aus spekulativen Gründen, ein sehr großes Depot angelegt. Ich schätze, dass sich mehr als zwei Drittel der derzeit verfügbaren Nelken in seiner Hand befinden, wohl an die sechstausendfünfhundert Pfund.«
»Und das soll ich in der Exchange Alley herumerzählen? Ich würde vermuten, dass es die Preise eher fallen als steigen lässt.«
»Ihr habt mich nicht gefragt, wo dieser Händler sein Lagerhaus hat.«
»London? Lissabon? Marseille?«
»Nein, Wien.«
Bryant lachte. Er lachte so laut, dass sich Dutzende Juristenköpfe in ihre Richtung drehten, die Stirnen gerunzelt angesichts dieses für ein Kaffeehaus sehr unziemlichen Gelärmes. Aber der Aktienhändler japste und prustete weiter, und auch Obediah musste grinsen.
»Die Nelkenreserven des Kontinents liegen in einer Stadt, die in wenigen Tagen von den Türken dem Erdboden gleichgemacht wird? Das ist ja großartig.«
Bryant versuchte, ernst dreinzuschauen. »Rein finanziell betrachtet, natürlich. Seid Ihr denn sicher, dass Wien fällt?«
»Zweifelt Ihr daran?«, fragte Obediah.
Der Stockjobber schüttelte den Kopf. »Nein. Niemand wird den Habsburgern helfen. Der Winter steht vor der Tür.«
»Es ist noch relativ früh«, sagte Obediah, »aber vielleicht wäre es angemessen, wenn wir einen Sherry tränken? Auf gute Geschäfte.«
Bryant war einverstanden. Chalon ging zur Theke und bestellte zwei Gläser. Aus seinem letzten Shilling wurde dadurch eine kleine Armee Süleymans, aber das war nun egal. Eine Welle der Euphorie durchströmte ihn. Bald schon würde er umziehen, sich auf Londons Prachtstraße, der Cheapside, völlig neu einkleiden und weitere Kuriositäten für seine Sammlung erwerben, die alle anderen Virtuosi Londons vor Neid erblassen ließen.
Als er mit den Gläsern gerade zum Tisch zurückgehen wollte, kam ein junger Mann durch die Vordertür gestürmt. Er war schweißgebadet, die Locken seiner Perücke klebten ihm an den Schläfen. Alle anwesenden Gäste verstummten und hefteten ihren Blick auf den Neuankömmling. Einen Moment lang war es so still, dass man nur das Knarzen hölzerner Bänke hörte, auf denen Männer sehr still zu sitzen versuchten. Dann erhob sich ein älterer Anwalt, nickte dem Mann zu und rief: »Sir, Euer ergebener Diener. Welche Nachricht bringt Ihr?«
Der junge Mann wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn und blickte in Richtung der erwartungsvollen Menge: »Ein Wunder ist geschehen! Der 11. September ist ein Tag, den man noch in Hunderten Jahren feiern wird.«
Der Anwalt neigte den Kopf leicht zur Seite. »Falls es hierbei um eine weitere angebliche Schwangerschaft von Königin Catherine geht, dann …«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Keineswegs, Sir. Ich komme soeben von ›Garraway’s‹, wo ein portugiesischer Händler diese Nachricht verkündete: Vor neun Tagen, am Abend des 11. September, ist der polnische König Jan Sobieski mit einem Heer von über hunderttausend Mann vor Wien aufgetaucht und hat den Türken vernichtend geschlagen. Die Stadt ist gerettet!«
Jubelgeschrei erhob sich, alle sprangen auf. Richter und Anwälte umarmten einander. Um den Boten bildete sich ein Menschenknäuel, jeder wollte dem jungen Mann auf die Schulter klopfen und ihm für die gute Nachricht danken. Nur Obediah blieb wie gelähmt an der Theke stehen, den Blick auf die vor ihm liegenden Kaffeehausmünzen mit den Türkenköpfen gerichtet.
Amsterdam, zwei Jahre später
Er wachte auf, als sich jemand an der Zellentür zu schaffen machte. Das Erste, was er spürte, war der Schmerz. Ächzend stemmte sich Obediah auf die Ellenbogen hoch. Sein Oberkörper, der nur von einem zerschlissenen Hemd bedeckt wurde, wies überall rote Striemen auf, die sich über Nacht zu voller Pracht entfaltet hatten. Nie hätte er geglaubt, dass Birkenzweige solche Pein verursachen konnten. Eine Ewigkeit hatten sie ihn gestern damit bearbeitet, zumindest war es ihm so vorgekommen. Festgebunden an einem Heringsfass, nicht in der Lage, sich zu bewegen, waren die Zweige immer wieder über seinen Rücken und seine Beine gepeitscht. Dennoch hatte er sich erneut geweigert, nach den Regeln des Tuchthuis zu spielen. Seit Tagen ging das so, und die Schläge waren nur die letzten in einer langen Reihe von Züchtigungen.
Er blickte auf die schwere eisenbeschlagene Eichentür. Als sie aufschwang, sah er in das Gesicht von Ruud, dem Wärter, der für diesen Trakt der Besserungsanstalt zuständig war. Der rappeldürre Mann war völlig kahl, dabei war er höchstens fünfundzwanzig. Obediah tippte auf die französische Krankheit. Die hätte auch erklärt, warum Ruud so dumm war. Der Wärter grinste hämisch. »Ah, mein englisches Püppchen. Endlich bereit zu arbeiten?«
Obediah musste husten. Das Tuchthuis nahe der Koningsplein war zugig und feucht, selbst für einen Londoner war das Klima eine schwere Prüfung. Vermutlich würde ihn eine Lungenentzündung dahinraffen, lange bevor ihm die Auspeitschungen den Garaus machten.
»Eine meinen Fähigkeiten angemessene Arbeit lehne ich nicht ab. Aber ich werde kein Brasilholz schneiden.«
Das Tuchthuis hatte sich auf die Fahnen geschrieben, vom Weg abgekommene Verbrecher und Vagabunden auf den Pfad der Tugend zurückzuführen, durch Gottes Wort und harte körperliche Arbeit. In Wahrheit scherte sich hier jedoch niemand um irgendjemandes Seelenheil. Stattdessen ging es darum, möglichst viel steinhartes Brasilholz in jenes kostbare rote Pulver zu verwandeln, das die Färber in Leiden und anderswo so schätzten. Im Amsterdamer Volksmund hieß das Tuchthuis deshalb auch Rasphuis, Sägehaus. Es war eine enorm anstrengende und auslaugende Arbeit. Sie bescherte den Insassen keine Tugendhaftigkeit, sondern einen raschen Tod. Er würde hier sterben, das war relativ wahrscheinlich. Und als jemand, der in seinem Leben noch keine Stunde harte körperliche Arbeit verrichtet hatte, wusste Obediah Chalon, dass ihn das Holzzerkleinern schneller zugrunde richten würde als so ziemlich alles andere, was sie ihm antun konnten.
Kaum hatte er ausgesprochen, schlug ihn der Wärter mit der Hand ins Gesicht, nicht mit der Fläche, sondern mit dem Rücken, sodass seine Knöchel Obediahs Wange trafen. »Fauler Abschaum! Ihr Papisten seid alle gleich!«
Dann zerrte Ruud ihn hoch und schubste ihn durch die Tür. Sie gingen einen langen, steinernen Gang entlang. Nach kurzer Zeit gelangten sie in den Hof. Das Tuchthuis war ein großes rechteckiges Gebäude, das aus vier Flügeln bestand, die einen Innenhof umschlossen. Dort harrten etwa hundert Männer in der morgendlichen Kälte aus, elende Gestalten in Sackleinen und abgetragener Wolle. Sie standen frierend und noch nicht ganz wach in vier Reihen, die von zwei Wärtern mit Ochsenziemern abgeschritten wurden. Während die Insassen bibberten und von einem Fuß auf den anderen traten, bleute ihnen Piet Wagenaar den Katechismus ein: »Da seufzten die Israeliten unter der schweren Arbeit und schrien laut auf, so dass ihr Ruf um Befreiung von der schweren Arbeit zu Gott drang.«
Wagenaar war der Ziekentrooster, der Pfarrer des Zuchthauses. Es ging das Gerücht, dass er die jüngeren und ansehnlicheren unter den Insassen nicht nur mit Bibelstellen und Psalmen traktierte. Obediah war bisher glücklicherweise von diesen Avancen verschont geblieben. Er wollte zu den anderen hinübergehen und sich in die Gruppe einreihen, doch der Wärter schlug ihm mit seinem Ziemer auf den Rücken.
»Du nicht, Püppchen. Da lang.«
Furcht wallte in Obediah auf, denn der Wärter scheuchte ihn in Richtung jenes Traktes, in dem die Bestrafungen durchgeführt wurden. Dann jedoch bogen sie nach rechts ab, in den Gebäudeteil, in dem Olfert van Domselaer seine Räume hatte, der Vorsteher des Tuchthuis. Schweiß trat Obediah auf die Stirn. Was konnte Domselaer von ihm wollen? Er riskierte es, dem Wärter eine Frage zu stellen.
»Bringt Ihr mich zum Vorsteher?«
Sofort bekam er wieder den Ochsenziemer zu spüren. »Halt’s Maul.«
Ruud liebte es, anderen zu widersprechen und ihnen vor Augen zu führen, dass sie falschlagen. Wahrscheinlich fühlte er sich ihnen dadurch überlegen. Obediah vermutete deshalb, dass der Wärter mit »Nein« geantwortet hätte, wäre es nicht zum Vorsteher gegangen. Insofern war es die Tracht Prügel wert gewesen. Jetzt wusste er, dass ihr Ziel wohl tatsächlich Domselaers Büro war. Obediah spielte im Geiste alle Möglichkeiten durch. Würde man ihm den Prozess machen? Oder ihn den Agenten der englischen Krone überstellen? War dies vielleicht die lange erhoffte Gelegenheit, dem Vorsteher zu beweisen, dass er über Talente verfügte, die dem Tuchthuis nützlich sein konnten?
Sie liefen einen weiß gekalkten Gang entlang, mit hohen Bleiglasfenstern und groben Teppichen. Vor einer Tür aus dunklem Holz blieben sie stehen, und Ruud klopfte.
»Herein!«, ertönte eine tiefe Stimme.
Der Wärter öffnete die Tür, schob Obediah hindurch und verneigte sich in Richtung eines älteren Mannes, der in einem Sessel vor einem fröhlich prasselnden Kaminfeuer saß. Dann verließ er das Zimmer. Von dem Feuer und dem bequemen Sessel abgesehen bot das Zimmer nicht viele Annehmlichkeiten. Es war ein Arbeitszimmer, nicht dazu gedacht, sich auszuruhen, wohl aber dazu, Gäste zu beeindrucken. Über dem Kaminalkoven war eine prächtige Marmorarbeit eingelassen. Sie zeigte eine Frau, die wohl Amsterdam symbolisieren sollte. In der Hand hielt sie einen furchterregenden, mit Nieten besetzten Knüppel, links und rechts von ihr wanden sich Männer in Ketten. Darunter stand: »Virtutis est domare quae cuncti pavent.«
Der Mann im Sessel sah, dass Obediah die Inschrift betrachtete und sagte: »Es ist eine Tugend, jene zu unterwerfen …«
»… vor denen alle in Furcht leben«, vervollständigte Obediah den Spruch.
Der Vorsteher mochte Ende vierzig sein. Er trug schwarze Kniebundhosen und einen schwarzen Justaucorps, dazu ein weißes Spitzenhemd und eine Mütze mit Zobelbesatz. In der Rechten hielt er ein in Leder gebundenes Buch. Er musterte seinen Gast.
»Ich vergaß, dass Ihr des Lateinischen mächtig seid.«
»Des Lateinischen, Seigneur, sowie mehrerer anderer Sprachen.«
Domselaer ignorierte die Bemerkung und bedeutete Obediah, sich auf einen Schemel in der Mitte des Raumes zu setzen.
»Ihr kennt also unser Motto. Aber es hat den Eindruck, dass Ihr es nicht versteht. Wie lange seid Ihr bereits hier, Obediah Chalon?«
»Achteinhalb Wochen.«
»Ihr folgt den Andachten des Ziekentroosters recht eifrig, höre ich, trotz Eures papistischen Irrglaubens. Die Nüchternheit unserer Andachten stößt Euch nicht ab?«
Obediah hatte keine Ahnung, worauf der Vorsteher hinauswollte. Vorsichtig sagte er: »Als Engländer bin ich es gewohnt, unter Protestanten zu leben, Seigneur. Außerdem ist gegen die Lesungen nichts zu sagen, auch wenn man Katholik ist. Die Bibel bleibt schließlich die Bibel.«
»Welch geradezu calvinistische Auffassung. Sicher wisst Ihr, dass nur ein paar Hundert Meilen westlich von hier Menschen für derlei dem gesunden Menschenverstand entsprechende Einlassungen aufgeknüpft werden.«
Obediah beschloss, dass es das Klügste war, mit einem demütigen Nicken zu antworten.
»Während Ihr also die Euch dargebotene spirituelle Nahrung zumindest nicht ablehnt, verweigert Ihr die Arbeit. Ist das richtig?«
»Ich bin sehr wohl bereit zu arbeiten, Seigneur. Ich besitze viele Fähigkeiten, die dem Tuchthuis nützlich sein könnten, wenn ich so kühn sein darf, dies anzumerken. Neben meinen Sprachkenntnissen verstehe ich mich auf Metallurgie sowie andere Künste und könnte …«
Domselaer schnitt ihm das Wort ab. »Ich weiß, wer Ihr seid und was Ihr könnt, Obediah Chalon. Ihr seid einer jener Männer, die man als Virtuosi bezeichnet. Ihr sammelt Traktate und wunderliche Spielzeuge, Ihr vertändelt Eure Tage in Kaffeehäusern und weilt im Schatten großer Naturphilosophen.« Er sprach das Wort aus, als reime es sich auf Pest und Cholera. »Aber Ihr gehört nicht zu ihnen. Habe ich nicht recht?«
Ohne Obediahs Antwort abzuwarten, fuhr er fort. Seine tiefe Stimme wurde lauter, fuhr wie Donner hernieder. »Ihr sucht nicht nach Weisheit, Ihr wollt lediglich renommieren. Eure angelesene Gelehrsamkeit steckt Ihr Euch an den Hut wie der Beau die Feder. Worüber Ihr vor allem anderen reichlich verfügt, das ist Eitelkeit! Der Herr hat Euch offenbar mit Verstand gesegnet, aber Ihr gebraucht ihn nicht.«
»Seigneur, ich …«
»Und wenn Ihr ihn benutzt, dann nur, um Schwindlereien zu erdenken und ehrbare Bürger zu betrügen. Nein, Obediah Chalon, Eure Talente mögen beachtlich sein, aber ich werde mich ihrer nicht bedienen!«
»Lasst mich Euer ergebenster Diener sein, Seigneur. Ich verspreche, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang für Euch zu arbeiten.«
Domselaer sah ihn an, wie man ein uneinsichtiges Kind ansieht. »Es geht nicht darum, was Ihr wollt. Es geht auch nicht darum, was ich will. Sondern darum, wie Ihr wieder zum Licht finden könnt. Und der Weg des Verstandes, der Weg, den Ihr bisher gegangen seid, hat Euch nicht zum Heil geführt. Er hat Euch hierhergebracht. Die Ratio hat Euch ins Verderben gestürzt, Obediah Chalon, und sie wird es wieder tun. Nur harte Arbeit kann Eure Seele bessern.«
Eine unglaubliche Wut stieg in Obediah auf, und er musste sich zurückhalten. Ansonsten hätte er diesen selbstgefälligen calvinistischen Menschenschinder auf der Stelle angefallen, ganz gleich, was danach mit ihm geschehen würde. Mit gepresster Stimme sagte er: »Brasilholz sägen? Das ist Sklavenarbeit. Ich bin ein Edelmann.«
Domselaer musterte ihn ungehalten. »Hier seid Ihr nur eine verlorene Seele. Und wenn das Euer letztes Wort ist, dann lasst Ihr mir keine andere Wahl.«
»Lieber sterbe ich!«
»Das werdet Ihr sicher irgendwann. Aber vorher werdet Ihr lernen, wie man seine Hände gebraucht.«
»Dazu könnt Ihr mich kaum zwingen. Um meinen Willen zu brechen, müsstet Ihr auch meinen Körper brechen. Und was nutze ich Euch dann noch?«