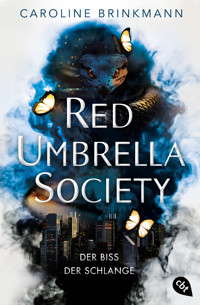Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leaf
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Tokito
- Sprache: Deutsch
ARCANE meets GAME OF THRONES: Der Kampf um Toktio - Die Fortsetzung von "Die Clans von Tokito" Verborgene Mächte haben es auf die führenden Mitglieder der Clans abgesehen und bedrohen den erblühten Frieden von Tokito. Durch einer Mordserie rücken Erin und ihr Dämon erneut in den Fokus der Ermittlungen. Einmal mehr muss die junge Rebellin sich auf den Distelkönig verlassen - wohlwissend, dass am Ende nur einer von beiden überleben kann. Während sie miteinander um die Kontrolle ihres Körpers kämpfen, ist der wahre Feind näher als gedacht… Zeitgleich ist die ehrgeizige Ryanne fest entschlossen, sich an die Spitze ihres Clans zu kämpfen. Doch der Plan geht nicht auf. Stattdessen wird sie ausgerechnet an den gefürchtetsten der Fürsten verschenkt: den Affenkönig. Wenn Ryanne an seinem Hof überleben will, muss sie all die angelernten Fähigkeiten als verführerischer Schmetterling aufwenden. Dabei kommt sie einem großen Geheimnis auf die Spur… Der Kampf um Tokito - Aufstieg des Schmetterlings ist die langersehnte Fortsetzung von Die Clans von Tokito. #LoveisLove #EnemiestoLovers #StarkeHeldin #MorallyGreyCharacters #UndercoverunterFeinden #Clan-Intrigen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Caroline Brinkmann
Der Kampf um Tokito
Aufstieg des Schmetterlings
Ausführliche Informationen über unsere
Autorinnen und Autoren und ihre Bücher
www.leaf-verlag.de
1. Auflage 2024
Originalausgabe:
Copyright © 2024 by LEAF Verlag, Bücherbüchse OHG,
Siebenbürger Straße 15a, 82538 Geretsried, Deutschland
Copyright © 2024 by Caroline Brinkmann
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Peter Molden
Textredaktion: Janina Roesberg, Yvonne Lübben
Covergestaltung: Isabelle Hirtz, Hamburg, instagram/isabelle_hirtz
Innengestaltung: LEAF Verlag unter Verwendung von Illustrationen von
Katharina Netolitzky instagram.com/kathi.netoGesetzt aus der Adobe Caslon
Satz: LEAF Verlag
ISBN 978-3-911244-19-0
Für den Wal im Ueno Park.
Mit dir hat alles angefangen.
Am Ende des Buches befindet sich eine Zusammenfassung
vom ersten Band und eine Auflistung der Clans.
1 Erin Rider
Ich bin die Dunkelheit,
aber mein Herz schlägt im Licht.
Schon seit einer Stunde kauerte ich auf dem Dach des Hochhauses. Ein kühler Wind wehte mir um die Nase und trug den Geruch der langsam erwachenden Stadt mit sich.
Ich lehnte mich vor.
Auf dem Marktplatz hatten die ersten Händler ihre Stände aufgebaut und bereiteten Essen vor. Süße Reiskuchen, Dampfnudeln und Kaffee für vorbeieilende Kundschaft. Von hier oben wirkten sie so klein und unbedeutend. Vielleicht trieb ich mich deswegen so gerne auf den Dächern herum. Für einen kurzen Moment konnte ich mir einbilden, alle Probleme in den Gassen tief unter mir zu lassen.
»Was machen wir hier noch gleich?«, flüsterten die Schatten um mich herum.
»Wir werden einen Wal berühren.«
»Und warum sollte man das wollen?«
»Es ist eine Art Tradition …« Meine Lippen verzogen sich zu einem Grinsen, während mein Blick wieder in den Himmel wanderte. Die ersten Strahlen der Sonne vertrieben bereits die Schwärze der Nacht und Wolken schoben sich zwischen die Unendlichkeit des Weltalls und unsere Stadt. Wie träge gigantische Luftschiffe schwebten sie dahin. Groß genug, um den ein oder anderen Gaswal zu verbergen.
»Normale Menschen machen Frühsport«, brummten die Schatten.
»Ich bin nicht normal.« Schließlich war ich von einem Dämon besessen. Dem Distelkönig, selbst ernannten Herren der Dunkelheit. Jemand hatte ihn in eine Tonscheibe gebannt, um die Welt vor ihm zu schützen, aber ich hatte ihn befreit.
Um diesbezüglich fair zu sein: Wenn man auf dem Tisch von Organhändlern liegt, die einen aufschlitzen wollen, kann man nicht unbedingt klar denken und klammert sich an jeden Strohhalm … oder eben Dämon.
Und nun hatte ich ihn an der Backe. Genau wie seine Schatten, die dunkler waren als alles Schwarz, was ich zuvor gekannt hatte. So verzehrend wie die Leere und unnahbar wie das All. Sie waren immer um mich herum, bewegten sich, folgten mir, flüsterten mir zu. Manchmal waren sie ein Teil von ihm. Manchmal bloß seine Diener.
Und manchmal schien es so, als wären sie auch bereits ein Teil von mir.
»Sie werden nie ein Teil von dir sein, denn ich bin ihr Herr und Meister«, korrigierte der Distelkönig. Natürlich konnte er meine Gedanken lesen, während seine vor mir verborgen waren.
Fairness sah anders aus, aber wenn ich eine Lektion bereits im Leben hatte lernen müssen, dann dass es keine Gerechtigkeit gab, wenn man nicht selbst für sie sorgte.
»Glaube mir, es ist eine Strafe, deine Gedanken zu lesen. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wie wenig eigentlich in deinem Kopf vor sich geht …«
Während der Distelkönig zu einem seiner Monologe ansetzte, entdeckte ich es. Eine Wolke wölbte sich auf uns zu. Im ersten Moment sah es aus wie eine riesige Hand, die sich uns entgegenstreckte. Dann quoll ein graublauer Kopf daraus hervor. Eine durchscheinende Membran umspannte den aufgedunsenen Köper. Wenn man nah genug dran war, konnte man im Inneren das Blitzen des Nervengeflechtes erkennen.
Ein Methanwal.
»Ich kannte mal jemanden, der auf so einem Viech geritten ist«, verriet mir der Distelkönig.
»Ach wirklich?«
»Ja. Jetzt ist er tot.«
»Runtergefallen?«
»Nein, dreißig Jahre später hatte er einen Herzinfarkt.«
»Also ist es machbar.« Ich musterte den Wal, der sich langsam zu uns herabsenkte. Man sagte, ihre Körper bestünden größtenteils aus Gas, weswegen man nicht auf ihnen reiten könnte. Mikko war davon überzeugt, weil er zahlreiche Bücher studiert hatte.
Dagegen war ich eher der praktische Typ.
»Wie hat er es angestellt, Distel? Wie ist dein Freund auf dem Wal geritten?«
»Er war nicht mein Freund. Ich habe glücklicherweise keine. Freunde sind unglaublich lästig. Man muss sich mit ihnen unterhalten, sich mit ihnen treffen und so tun, als würde man ihre Gesellschaft genießen. Man darf ihre Geburtstage nicht vergessen und das Schlimmste von allem: Man darf sie nicht töten.«
»Distel. Der Wal. Wie hat er es gemacht?«
»Siehst du diesen dunklen Fleck am Nacken? Dort ist eine Verhärtung der Membran. Beinahe wie ein Sattel. Wenn du es schaffst, auf dem zu landen, kannst du auf ihm reiten.«
Mein Herzschlag beschleunigte sich. Schwer, aber nicht unmöglich.
»O nein … Jetzt sag nicht, du willst es versuchen.«
»Natürlich.«
»Du wirst draufgehen.«
»Ich hab doch dich.«
»Dein Vertrauen in mich ist rührend, aber –«
»Wir werden es tun, Distel!« Mit diesen Worten sprang ich auf meine Füße und wartete auf den Gasriesen.
Wale waren neugierig und dieser hier wollte offenbar zu gerne wissen, was das seltsame Mädchen auf dem Dach machte. Geräuschlos glitt er durch die Schlucht an Hochhäusern in unsere Richtung. Alles, was ich hörte, war das Rauschen des Windes.
Als er beinahe bei mir angekommen war, rannte ich los – parallel zu dem Weg, den der Wal nahm. Gleich würde er mich einholen. Ich spürte, wie die Schatten mich packten. Mit ihrer Hilfe wurde mein Körper leichter, schneller.
Dann war es so weit. Der Gasriese glitt vorüber. Jetzt musste ich mich beeilen. Ein weiterer Schlag mit seiner Flosse und er wäre fort. Ich streckte den Arm aus und streifte seinen Kopf, der sich wie eine warme Dampfnudel anfühlte.
Fest und doch weich …
Ohne zu zögern, sprang ich ab. Die Schatten hoben mich gut drei Meter in die Höhe am Wal vorbei.
Dann fiel ich hinunter und landete. Genau auf dem dunklen Fleck in der Membran.
Ich habe es geschafft!
Jubelnd riss ich meine Arme nach oben, nur um im gleichen Moment zu versinken. Meine Beine flutschten einfach durch die Verhärtung hindurch, gefolgt vom Rest meines Körpers. Es fühlte sich an, als würde ich in einer Schale mit warmem Fischgelee versinken.
»Distel!«, rief ich, aber der Dämon antwortete nicht.
Er lachte bloß.
»Warum klappt es ni…« Der Rest meiner Worte wurde abgewürgt, als mein Kopf im Wal versank.
Um mich herum sah ich nur grauen Nebel und so hell blinkende Lichter, dass ich die Augen schließen musste. Panisch ruderte ich mit den Armen, bekam aber nichts zu fassen, an dem ich mich hätte festhalten können.
»Natürlich klappt es nicht, du hohle Nuss!«, rief der Distelkönig schallend lachend. »So ein Wal besteht aus Gas und Nerven. Nur Narren versuchen, auf ihm zu reiten.«
Verflixte Scheiße!
Ein unangenehmes Kribbeln befiehl meinen Körper. Es wurde mit jeder Sekunde stärker. Ich hatte das Gefühl, von Stromschlägen getroffen zu werden. Einer nach dem anderen jagte durch mich hindurch, sodass ich mich vor Schmerzen abwechselnd krümmte und überstreckte.
Ungehindert fiel ich durch den Wal – als ob man einen Stein in ein Schaumbad werfen würde. Plötzlich bemerkte ich einen kurzen Widerstand, bevor ich eine weitere gelartige Membran passierte. Sie glitt auseinander, während ich hindurchflutschte und in die Tiefe stürzte. Ich versuchte, mich zu drehen, damit ich meinen Sturz irgendwie abfangen konnte, aber mein Körper gehorchte mir nicht. Er kribbelte bloß. Ungehindert schlug ich auf einem der vielen Hochhäuser auf, die wie Speere in den Himmel wuchsen. Ein gewaltiger Schmerz zuckte durch meinen Rücken, als meine Knochen brachen und ich das Bewusstsein verlor.
∼
Ich blinzelte. Steif wie ein gefrorenes Fischstäbchen lag ich in einer Pfütze aus Blut und guckte in den Himmel. Über mir wurden die Buchstaben unserer Megastadt in den Himmel projiziert.
Um mich herum hatte sich eine Pfütze aus Blut gebildet, aber die Schatten kauerten wie treue Hündchen an meiner Seite. Sie heilten meine Wunden und fügten Sehnen und Knochen wieder zusammen.
Wenn der Dämon nicht gewesen wäre, wäre dieser Sturz ziemlich sicher tödlich ausgegangen. Allerdings war es auch dieser besagte Dämon, der mich erst zu dieser bekloppten Idee angestiftet hatte.
»Ich sehe dir einfach so gerne beim Sterben zu.«
»Reizend …«
»Außerdem habe ich dir doch gesagt, du wirst draufgehen. Aber du hörst ja nie auf mich und machst immer das Gegenteil von dem, was ich dir rate. Das ist so … berechenbar.«
»Ich hasse dich …«
»Das war der beste Morgen seit Langem«, gurrte der Dämon und ich spürte innerlich das breite Grinsen auf seinem Gesicht.
2 Ryanne Cimon
Schönheit ist vergänglich,
Wissen ist unendlich.
Im Freudentempel Seligkeiten war es voll. Jeder Tisch war belegt, die Gäste genossen Speisen und Getränke, während sie sich von Musik und Tanz unterhalten ließen.
Die Künstlerinnen vorne auf der Bühne trugen die azurblauen Kimonos der Anwärterinnen. Zwar waren sie noch keine echten Schmetterlinge, hofften es aber eines Tages zu werden.
Weitere Anwärterinnen in der gleichen Aufmachung huschten von Tisch zu Tisch und verteilten Getränke. Jedoch sollten wir unsere Gäste nicht einfach nur zufriedenstellen. Unsere Aufgabe bestand zudem darin, Informationen zu bekommen, die unserem Clan Vorteile verschaffen könnten. Da die Freudentempel von allen genutzt wurden, waren sie der perfekte Ort, um den Gästen mit Wein die Zungen zu lockern und in einem harmlos erscheinenden Gespräch auszuhorchen.
Auch ich trug die traditionelle Kleidung einer Anwärterin, nur mit einem Unterschied: mein Make-up. Bei den anderen unterteilte eine blaue Linie die Lippen. Auf den Wangen befand sich jeweils ein Punkt. Auf meiner Stirn war zusätzlich ein offenes blaues Dreieck gemalt, welches verriet, dass ich hier das Sagen hatte.
Meine Haare waren hochgesteckt und eine goldene Schmetterlingshaarspange thronte wie eine Krone auf meinem Kopf. Ein weiteres Zeichen für meine erhöhte Stellung. Aber all das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass mein Nacken leer war. Denn wäre ich ein echter Schmetterling, würde ein Tattoo mit zwei Flügeln meinen Nacken zieren.
Ich wusste noch, wie ich zum ersten Mal einen Schmetterling gesehen hatte. Ich hatte in meinem schmutzigen Baumwollkleid auf dem Boden gekniet und die Holzdielen geschrubbt, während er an mir vorüberglitt.
Unantastbar und wunderschön.
Genau so wollte ich auch sein, aber nur wenigen wurde diese Ehre zuteil.
Natürlich wusste ich, dass ich zufrieden sein sollte mit dem, was ich erreicht hatte. Immerhin leitete ich einen Freudentempel und verdiente viel Geld. Trotzdem war da dieser zehrende Hunger nach mehr in mir.
Ich wollte es schaffen. Ich wollte die Ehre der Flügel bekommen und an die Seite der Geisha aufsteigen, so wie es nur den schönsten und talentiertesten gestattet war.
Mit einem Tablett in der Hand ging ich auf einen Tisch am Rand zu, wo mich ein Gast erwartete. Er trug einen breiten Strohhut und abgenutzte, schmutzige Kleidung. Damit wirkte er wie ein Fremdkörper an einem bunten, schillernden Ort wie diesem. Wie ein Bettler, der sich einen Abend in diesem Haus nicht leisten konnte.
Trotzdem war er hier.
Als mein ausdrücklicher Gast.
»Hallo, Tunichtgut«, begrüßte ich ihn. Vor einiger Zeit hatte ich ihn gerettet, weshalb er mir eine Kette geschenkt hatte, an der einst sieben Krallen gehangen hatten. Sieben Krallen für sieben Gefallen, die er mir gewährt hatte. Nun waren es nur noch sechs.
»Hallo, Niemand.« Seine dunklen Augen blitzten auf.
Ich setzte mich zu ihm, nachdem ich uns grünen Tee und Gebäck serviert hatte. Über den Rand meiner zarten Porzellantasse nahm ich den Streuner ins Visier.
Tunichtgut mochte kein Geld besitzen, aber er hatte etwas viel Wertvolleres für mich.
Informationen.
»Was gibt es Neues?«
»Das Übliche.« Er warf sich einen Keks in den Mund. »Der Affenkönig testet seine Grenzen aus, indem er die anderen Fürsten provoziert. Letzte Nacht hat er ein weiteres Krankenhaus überfallen und geplündert. Ich denke, er weiß, dass sich ihm keiner entgegenstellen wird.«
Sein Blick zuckte zu einer größeren Gruppe Männer, die am anderen Ende des Raumes Tische zusammengeschoben hatten. Sie hatten die Statur von Kriegern, trugen gepanzerte Kleidung aus Leder und Fellen. Neben sich hatten sie ihre grobschlächtigen Waffen abgelegt. Mittlerweile hatten sie zu viel getrunken und wurden immer lauter.
Eindeutig Affen.
»Seitdem die Handfürstin tot ist, ist das Gleichgewicht der Clans zerstört. Und genau diese Schwäche nutzt ihr König.«
»Hey, wo bleibt unser Sake, Mädchen?«, brüllte einer der Affen und hielt eine Anwärterin am Arm fest.
Der Schmetterling riss seine braunen Augen auf. »Verzeihung, mein Herr, ich kümmere mich sofort darum.« Sie wollte davonhuschen, aber er zog sie sich auf den Schoß. Für einen Moment entgleiste ihr der professionelle Gesichtsausdruck und zeigte Entsetzen. Der Kerl schlang seine Arme um sie und vergrub sein Gesicht in ihrer Schulter.
Hilfesuchend zuckte ihr Blick durch den Raum. Kurz blieb er an mir hängen, aber offenbar ahnte das Mädchen, dass es bei mir nicht finden würde, wonach es suchte.
Also versuchte es, sich selbst zu retten. Mit den Lektionen, die uns Großmutter Yubaba beigebracht hatte. Besänftigend lächeln, Komplimente machen und die Aufmerksamkeit des Gegenübers in eine Richtung deiner Wahl lenken.
Ich wandte mich wieder meinem Gast zu. »Was ist mit dem Handclan? Haben sie immer noch keine Nachfolge für ihren Thron gefunden?«
Der Tunichtgut schüttelte den Kopf. »Es gibt drei, die diesen Posten für sich beanspruchen, und sie können sie nicht einigen. Die Phari vermitteln bereits und im Moment liegt eine junge Frau vorne, welche wohl auch Yubabas Favoritin wäre, aber die Entscheidung zieht sich in die Länge.«
»Und die anderen Clans? Wollen sie nichts unternehmen?«
Er zuckte mit den Schultern. »Sie hassen den Affenkönig und würden ihn am liebsten loswerden. Trotzdem biedern sie sich aus Furcht vor ihm mit Geschenken an. So läuft es doch immer. Sie mögen Angst vor ihm haben, aber noch mehr Angst haben sie, auf der Verliererseite zu stehen.«
»Beim Tigerclan waren sie sich recht einig …«
»Ja, aber im Moment will niemand einen weiteren Krieg. Krieg ist nicht gut fürs Geschäft. Wenn jemand dem Affenkönig einen vergifteten Kuchen schenken sollte, würde jeder großzügig wegsehen, aber selbst tätig zu werden, das wagen sie nicht.«
Ich nahm einen Schluck von meinem Tee. Das waren in der Tat keine beruhigenden Nachrichten.
»Warum tanzt du nicht für uns?«, brüllte einer der Affen, griff der Anwärterin unter die Arme und hob sie zu ihrem Entsetzen auf den mit Flaschen und Gläsern gefüllten Tisch. »Los! Zeig, was du kannst.«
Unter den johlenden Rufen drehte sie sich zaghaft um die eigene Achse.
Ein Räuspern lenkte meine Aufmerksamkeit von dem erschrockenen Mädchen ab.
»Sollen wir eingreifen, Frau Cimon?«, fragte eine der Wachen. Seine Hand ruhte auf dem Schwert, seine Miene war finster. Trotzdem sah ich auch Sorge in seinen Augen. Ebenso wie ich wusste er, dass sich die Affen nicht so einfach des Hauses verweisen lassen würden. Zumindest nicht, ohne hier alles kurz und klein zu schlagen. Und wegen der Waffen, die sie bei sich trugen, wäre mit erheblichen Verlusten zu rechnen.
»Nein … Haltet euch im Hintergrund.«
»Jawohl.« Er verbeugte sich und ging.
Wenn Tunichtgut recht hatte, konnten wir es uns im Moment nicht leisten, den Affenclan gegen uns aufzubringen.
»Es wirkt nicht so, als wäre sie noch Herrin der Lage«, bemerkte der Streuner.
»Ich weiß.«
Tunichtgut schenkte sich etwas Alkohol in seinen Tee. »Aber du magst die Kleine nicht?«, fragte er, ohne aufzuschauen.
»War meine erste große Liebe.«
Und sie hat mich verraten …
Jedes Mal, wenn ich Mirella ansah, spürte ich in mir eine Bitterkeit, die mich wie das Gift des Amphibienclans zerfraß.
»Verstehe.«
Einer der Affen hatte ihre Haarspange geklaut und das goldblonde Haar fiel ihr auf die Schultern. Trotzdem versuchte sie, ihre Aufgabe so würdevoll wie möglich zu erfüllen.
»Was hast du nun vor?«
»Ich muss ihr wohl helfen. Es zu ignorieren, wäre nicht gut fürs Geschäft.«
Angesichts der lauten Affen waren die anderen Gäste bereits verdächtig still geworden. Einige tuschelten, andere waren im Begriff zu gehen, um Ärger zu vermeiden. Also nahm ich einen letzten Schluck von meinem Tee und seufzte.
»Ich weiß, warum Yubaba dich mag«, sagte Tunichtgut. »Ihr seid aus demselben Holz geschnitzt.«
Verblüfft stellte ich meinen leeren Teebecher auf das Tablett. »Ich bin überhaupt nicht wie sie und wenn sie mich mögen würde, hätte sie mich nicht ohne ein weiteres Wort hier zurückgelassen.« Die Enttäuschung konnte ich nicht aus meiner Stimme verbannen, denn der Schmerz darüber saß immer noch tief. Sie hatte mich abgegeben und sich seitdem nicht mehr blicken lassen. Genau wie meine Mutter mich einst abgegeben hatte.
»Wenn du mich fragst, hat sie Großes mit dir vor. Sie hat das Seligkeiten in deine Hände gelegt. Das heißt, sie vertraut dir und will sehen, wie du dich schlägst.«
»Ich bin ihre Tests leid …« Frustriert knirschte ich mit den Zähnen.
Hatte ich nicht oft genug gezeigt, dass ich es verdient hatte, ein echter Schmetterling zu sein? Immerhin hatte ich mir ein Messer ins Herz gejagt, um zu beweisen, dass mich niemand besitzen konnte. Außer die Geisha befahl es. Was könnte das noch toppen?
Mirella schrie entsetzt auf, als sie vom Tisch gezerrt wurde. Ein besonders betrunkener Affe zog sie erneut auf seinen Schoß und versuchte, sie zu küssen, während die anderen ihm zujubelten.
Schon immer waren die Affen respektlos gewesen, doch seit der Handclan führerlos war, glaubten sie, sich alles erlauben zu können.
»Würdest du mich entschuldigen?«, fragte ich an Tunichtgut gewandt. Niemand demütigte einen Schmetterling oder eine Anwärterin ungestraft. Egal ob Mirella oder jemand anderen, ich würde sie daran erinnern, wo sie sich befanden.
Also marschierte ich auf die Bar zu, wo ich mir ein Tablett und zwei Flaschen Reiswein schnappte. Damit bewaffnet ging ich auf die Gruppe Affen zu. »Guten Abend, die Herren.«
»Hey, da kommt noch ein kleiner Falter.«
Ich stellte das Tablett auf den Tisch. »Mein Name ist Ryanne Cimon. Darf ich euch unseren besten Wein anbieten?« Es war ein billiger Fusel für die Gäste, die ich nicht ausstehen konnte. »Der geht selbstverständlich aufs Haus.«
»Oho! Womit haben wir das denn verdient?«
»Die Affen sind doch in ganz Tokito gern gesehene Gäste«, schmeichelte ich dem Sprecher.
»Das wüssten wir aber, Kleine. Die meisten nehmen Reißaus.«
»Nun. Wir mögen starke, wilde Kämpfer.« Anerkennend strich ich über die Keule, die er neben sich an den Tisch gestellt hatte. Eigentlich war es verboten, Waffen in einen Freudentempel zu bringen, aber auch diese Hausregel war ihnen offensichtlich egal. Ebenso wie die Devise, dass niemand die Herrin des Hauses – also mich – berühren durfte. Trotzdem versuchte der Keulen-Kerl, mich zu packen und an seine Brust zu ziehen. Geschickt wich ich ihm aus und umrundete den Tisch, um jedem einzuschenken. Dabei ließ ich keinen der Männer aus. »Lasst uns anstoßen!«
Mirella bekam ebenfalls ein Glas in die Hand gedrückt. Sie sah mich an und für den Bruchteil einer Sekunde verstanden wir uns so wortlos wie früher.
Scheinbar unauffällig berührte ich meine Schläfe und sie wusste Bescheid.
»Im Namen des Seligkeiten fühlen wir uns geehrt anlässlich euren Besuchs. Auf einen unterhaltsamen Abend«, sagte ich an die Affen gewandt und schenkte auch mir ein.
»Auf das Seligkeiten und seine Weiber!« Grölend stießen sie an. Bei Alkohol kannten sie keine Zurückhaltung. In einem Zug leerten sie ihre Gläser, während Mirella und ich die bittersüße Flüssigkeit nicht einmal an unsere Lippen ließen.
»Und nun tanz für uns, Puppe.« Ein Affe, der ein Tigerfell wie einen Umhang trug, wankte auf mich zu.
Ich widerstand dem Drang, nach der Klinge zu greifen, die ich unter einem Armband versteckt hatte. Ich hätte gut Lust, sie ihm zwischen die Beine zu stoßen. Stattdessen drückte ich ihn mit einem Lächeln voller Versprechen auf seinen Platz zurück und lehnte mich vor, so nahe, dass meine Lippen fast sein Ohr berührten. »Ich bin keine Puppe.«
»Was bist du dann?«
»Dein schlimmster Albtraum, denn niemand, ich wiederhole, niemand missachtet die Regeln meines Freudentempels.«
»Was soll das? Ich versteh nicht …« In dem Moment verdrehte er die Augen und sein Kopf krachte auf den Tisch. Sekunden später fiel der Nächste vom Stuhl. Und der Nächste, bis alle fünfzehn Affen selig schnarchten.
Im Raum war es nun totenstill geworden. Alle Gäste sahen mich mit einer Mischung aus Überraschung und Schock an.
Ich winkte die Wachen herbei. »Unsere Gäste wollen ausnüchtern. Bringt sie auf ihre Zimmer, bis es ihnen besser geht.«
Morgen würden sie mit klarem Kopf erwachen und sich ziemlich sicher an nichts erinnern.
»Meine lieben, verehrten Gäste. Bitte verzeiht die Unannehmlichkeiten und genießt weiter unseren Abend voller Musik und Kunst. Für den Rest des Abends gibt es Sake aufs Haus.«
3 Erin Rider
Ich bin die Dunkelheit,
aber mein Herz schlägt im Licht.
Es dauerte eine halbe Stunde, bis ich meine Beine wieder bewegen konnte, und eine weitere, bis ich unter viel Fluchen und Stöhnen aufstehen konnte.
Der Distelkönig lachte die ganze Zeit.
Als ich fit genug war, um mich am Gebäude hinunterzuhangeln, ging bereits die Sonne auf. Ich zog mir die Kapuze meines Mantels tief ins Gesicht, vergrub die Hände in den Taschen und ging die Straße entlang. Der Trick war es, gestresst, aber nicht ängstlich auszusehen, so, als ob man dringend irgendwo hinmusste. Am besten zur Arbeit, wie es normale Menschen mit einem Tattoo taten.
Allerdings waren es keine normalen Tattoos, die unsere Handgelenke zierten, sondern eine Existenzberechtigung in dieser Stadt. Sie bedeuteten, dass man zu einem der sechs Clans gehörte. Nur wenn das der Fall war, war man geschützt. In Tokito war der Clan alles: Arbeitgeber, Polizei und Rechtssystem in einem.
Seitdem ich ein klitzekleines Blutbad im Folterkeller des Raben angerichtet hatte, waren Mikko und ich clanlos. Bedauerlicherweise sprach sich so etwas herum, was es unmöglich machte, neue Arbeit zu finden. Das und die Tatsache, dass der Federclan ein üppiges Sümmchen auf meinen Kopf ausgesetzt hatte.
Auf der Straße kamen mir drei gut angezogene Männer entgegen. Sie trugen Turbane, extravaganten Schmuck und waren in bestickte Stoffe gehüllt, wie sie der Amphibienclan bevorzugte.
Meine Aufmerksamkeit galt vor allem den Geldbeuteln, die an ihren breiten Gürteln baumelten. »Distel«, flüsterte ich. »Wir sollten diese schwer beladenen Herren etwas erleichtern, meinst du nicht?«
»Nein, nicht wirklich.«
»Ich dachte, du liebst es, böse zu sein.«
»Ich liebe Heimtücke und Mord, Taschendiebstahl ist unter meiner Würde. Ich bin der Herr der Schatten. Und nicht der Herr der Diebe.«
»Wir brauchen Geld, wenn wir uns etwas zu essen kaufen wollen.«
»Nicht mein Problem. Ich habe nämlich keinen Hunger … Ich habe nicht mal einen Magen.«
»Und was passiert, wenn ich verhungere?«
»Dann bist du tot.«
Ich gab es auf.
Schön, musste ich es eben allein probieren. Ich begann, ein bisschen zu wanken, als wäre ich betrunken. Leider war das die einzige Masche, die ich kannte, und im Prinzip recht simpel. Ich würde den Ersten der drei Herren anrempeln. In der allgemeinen Verwirrung würde ich dann seine Geldtasche abreißen und ehe er das Fehlen bemerkt hätte, wäre ich bereits weg.
»So die Theorie«, kicherte Distel.»Hast du das denn schon einmal versucht?«
Das nicht, aber ich hatte Taschendiebe schon oft bei ihrer Arbeit beobachtet und es sah gar nicht schwer aus.
Optimistisch stolperte ich auf die Gruppe zu.
»Hey, pass doch auf, wo du hinläufst«, schalt mich der Mann, in den ich rannte.
»Entschuldigung, ich …« Eilig fummelte ich an dem verdammten Geldbeutel herum, der fester saß als gedacht. Verflixt! Bei den Taschendieben hatte dieser Teil deutlich leichter ausgesehen.
Der Mann starrte mich empört an, während ich an seinem Gürtel riss. »Willst du mich etwa beklauen?«
»Es ist so peinlich, dass es einem schon fast leidtun könnte.«
»Ich …«
»So eine Dreistigkeit habe ich ja noch nie erlebt.« Er drehte an einem Siegelring, aus dem eine Nadel fuhr. Amphibien waren nicht nur durch ihre Stoffe und extravagante Mode bekannt, sondern vor allem für … Gift!
Ich riss den verfluchten Geldbeutel ab und sprang zurück. Doch einer der anderen Männer hielt mich fest, während der mit dem Siegelring auf mich zukam. Mit einem Ellbogenschlag in die Magengrube befreite ich mich und sprang zur Seite. Gerade rechtzeitig. Die Nadel im Siegelring traf den Mann, der mich kurz zuvor noch festgehalten hatte.
Er verdrehte die Augen und fiel zu Boden. Gleichzeitig holte ich aus und verpasste dem Mann mit dem Giftring einen ordentlichen Kinnhaken. Dann wandte ich mich an den dritten, der entsetzt um Hilfe schrie.
»Ich will dir deine glorreiche Stunde nicht verderben, aber ich glaube, Verstärkung kommt.«
Ein Problem war, dass es verdammt viele Amphibien gab. Von allen Clans hatten sie am meisten Mitglieder, wodurch ihre Krieger, Männer und Frauen mit Blasrohren und Giftpfeilen, überall waren.
Also sprintete ich davon. In die dunkelste Gasse, die ich auf die Schnelle finden konnte. Hier warteten die Schatten bereits darauf, mich in ihre Arme zu schließen und zu verschlucken. Als wenige Augenblicke später die Giftkrieger der Amphibien um die Ecke guckten, sahen sie nur Dunkelheit.
∼
Mit einem Portemonnaie voller Münzen blieb ich einige Blöcke weiter bei einem Stand stehen und kaufte Reiskuchen und Mangosaft fürs Frühstück. Zum Glück interessierten sich die meisten Straßenverkäufer nicht für Clanzugehörigkeiten, solange man zahlte. Im Gegensatz zu den größeren Supermärkten. Dort wurden oft bereits am Eingang die Tattoos kontrolliert, weil sie keine Clanlosen hineinlassen wollten.
Gut gelaunt zog ich mit meiner Ausbeute weiter. Mikko würde Augen machen. Er liebte Reiskuchen, vor allem die mit Zuckerguss.
Gerade bog ich um eine Ecke, da wisperten die Schatten »Vorsicht!«. Zu spät. Ich stieß mit einer lebenden Wand zusammen. Mein Blick wanderte nach oben und ich blickte in ein wildes Gesicht, das zu einem Mann mit krummer Nase gehörte, der zu mir herabsah. Er trug keine bunte Seide, sondern ein Wams aus Leder. Am Gürtel baumelte eine Axt.
Ein Affe! Dem Geruch nach verbrachte er seine Freizeit lieber in Schenken als in Badehäusern.
Eine Pranke langte nach vorne, packte mich am Kragen und hob mich hoch. »Ich wurde von einem Floh umgerannt«, knurrte der Hüne seinem Kumpel zu.
»Ein Floh, der uns freundlicherweise Frühstück gebracht hat«, brummte einer und riss mir den Beutel mit Reiskuchen weg.
Ich wollte protestieren, doch er drehte mich auf den Kopf und schüttelte mich so heftig, dass der gestohlene Geldbeutel aus meiner Tasche rutschte. »Hey! Das ist mein Geld!«
»Wie gewonnen, so zerronnen …«, seufzte der Distelkönig.
»Betrachte es als Wegezoll.«
»Das ist nicht einmal euer Territorium.«
Der Affe ließ mich los. »Heute ist es das.«
Gerade noch rechtzeitig schaffte ich es, meinen Fall mit den Händen abzufangen und mich abzurollen.
Das war das Problem mit den Affen. Sie waren immer schon streitsüchtig gewesen, aber in letzter Zeit war es schlimmer geworden. Es kümmerte sie nicht mehr, in welchem der Viertel sie Unruhe stifteten.
»Wir könnten sie einfach töten«, schlug der Distelkönig vor. Ich spürte, wie er hinter mir aus dem Schatten wuchs. Beinahe meinte ich, eine Gestalt mit geschwungenen Hörnern zu erkennen, vor der die Dunkelheit selbst erstarrte.
»Nein.« Ich zog mich zurück. »Wir töten niemanden.«
»Aber sie haben unser Frühstück. Für mich reicht das als Grund.«
»Wir können neues Geld klauen.«
»Oder einfach ihre Nacken brechen. Geht schneller.«
NEIN!
Ich hatte Mikko versprochen, meine Seele möglichst rein zu halten, um nicht von der Dunkelheit verschlungen zu werden. Klauen, um zu überleben, war eine Sache. Morden, weil einem ein Reiskuchen geklaut wurde, eine andere.
»Das sehe ich anders. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.«
Ich ignorierte den Dämon und drehte mich um. Gerade wollte ich verschwinden, als die Pranke des Affen erneut auf meiner Schulter landete.
»Moment, Kleine.« Er drehte mich um und hielt mich fest. Prüfend musterte er mein Gesicht. »Du kommst mir bekannt vor.«
»Ich hab ein Allerweltsgesicht«, winkte ich ab.
Er wandte sich an seinen Kumpel. »Was meinst du, Bart?«
Der beugte sich vor, zupfte an meinen kurzen roten Haaren, hob meinen Arm an. »Hast recht … Bist du nicht …« Anscheinend fiel der Groschen, denn er schnappte nach Luft. »One-Strike?«
»Jo! Das ist One-Strike!«, bestätigte der zweite Affe aufgeregt.
Mein ach so glorreicher Kämpfername. Er war mir bei den illegalen Arenakämpfen in der Grube gegeben worden, weil ich bei meinem ersten Kampf nach einem Schlag k. o. gegangen war. Allerdings hatte ich bei meinem zweiten Kampf den Spieß umgedreht und meinen Gegner mit nur einem Schlag getötet. Das hatte ziemlich viele Zuschauer um ihren Wetteinsatz gebracht.
»Du solltest sie wirklich töten, bevor sie …«
»Wir sind Fans«, rief der Affe.
»Ach ja?«
»Große Fans.«
»Zeigst du uns deinen legendären Move? Bitte. Bitte.«
»Ja, zeig ihnen deine Faust. Am besten wie sie in ihr Gesicht schmettert und ihnen das Hirn platzen lässt.«
Distel, dachte ich warnend. Wir können uns im Moment keinen Stress erlauben. Lass uns einfach hochspringen und ein bisschen beeindruckend aussehen.
»Für was hältst du mich? Einen Zirkusaffen? Spring allein in die Luft.«
Und genau das tat ich. Ich mimte den Schlag, der mich legendär gemacht hatte, was den Affen ein freudiges »Ohhh« entlockte, auch wenn er ohne die Schatten nicht so imposant aussah wie sonst.
Begeistert klopften sie mir auf die Schulter. Ja, sie wollten sogar, dass ich ihnen ein Autogramm gab – genau auf den Kehlkopf. Die Stelle, an der ich meinen letzten Gegner getroffen hatte.
Am Ende gaben sie mir mein Frühstück und den Geldbeutel wieder und bestanden darauf, dass ich, sollte ich je in Schwierigkeiten sein, nach Bart und Matts fragen sollte. Sie würden sich dann um meine Probleme kümmern.
»Die waren überraschend nett«, sagte ich zum Distelkönig, nachdem wir uns verabschiedet hatten. »Gut, dass wir sie nicht getötet haben.«
»Du hast wirklich mehr Glück als Verstand. Weißt du das, Waisenkind?«
∼
Unser Zelt stand hoch oben auf dem Dach eines Hospitals im Schatten zweier Schornsteine. Hier hatten wir uns eingerichtet, nachdem wir nicht mehr in unsere alte Wohnung zurückgekonnt hatten. Die geldgierige Vermieterin, Madame Pie, hätte keine Sekunde gezögert, uns an den Federclan auszuliefern und die Belohnung zu kassieren.
Der Handclan hatte nach dem Tod seiner Fürstin glücklicherweise genug Probleme. Darum interessierten sie sich herzlich wenig für zwei Clanlose, die auf dem Dach ihres Krankenhauses campierten, wodurch wir bisher hier oben unsere Ruhe hatten.
Als ich die Plane des Zeltes zur Seite schob, schlug mir Wärme entgegen, vermengt mit dem Geruch der Reis-Algen-Plätzchen, die wir zum Abend gegessen hatten.
Ich streifte mir die Schuhe ab und ließ sie vor dem Eingang stehen. Dann tauchte ich in die Vertrautheit unseres Zuhauses und schloss die Klettverschlüsse der Plane hinter mir. Die Tüte mit den zerdrückten Reiskuchen legte ich auf den kleinen Klapptisch, ebenso wie das gestohlene Geld. Dann schlich ich auf unser Matratzenlager am hinteren Ende zu, hob die Decke an und schlüpfte zu Mikko, der immer noch selig schlief.
Seine Ruhe hätte ich gerne. Während mich nachts Hunderte an Ängsten umtrieben, vermochte ihn nichts zu wecken.
Mikko streckte sich, als ich mich an ihn kuschelte, um etwas von seiner Wärme zu klauen. »Du riechst seltsam … Wo warst du?«, nuschelte er verschlafen.
»In einem Wal«, antwortete ich.
»Ach so …« Er legte seinen Arm um mich und zog mich in Löffelchenstellung ganz nahe an sich heran. Für einen Moment lauschte ich seiner Atmung. Es dauerte ein paar Sekunden, bis er hochschreckte. »Du warst wo?«
4 Ryanne Cimon
Schönheit ist vergänglich,
Wissen ist unendlich.
Nachdem ich mich um das Affenproblem gekümmert hatte, wollte ich mich in mein Zimmer zurückziehen. Mittlerweile hatte ich ein eigenes – einer der Vorteile, wenn man in Großmutter Yubabas Gunst stand. Wie alle anderen Wohnräume lag es über dem öffentlichen Teil des Freudentempels in einem bewachten Bereich. Aus meinem Zimmer konnte ich sogar den Ausblick auf einen ruhigen Garten voller Kirschbäume genießen.
Gerade wollte ich die Tür aufschließen, da tauchte eine vertraute Gestalt aus den Schatten. Ein blauer Kimono, honigblondes Haar, goldbraune Haut und dunkle Augen, in die ich mich einmal verliebt hatte.
»Ich wollte mich für deine Hilfe bedanken«, flüsterte Mirella beinahe schüchtern.
»Ich hab es nicht für dich getan. Nur fürs Geschäft«, entgegnete ich und wollte mich wieder der Tür zudrehen, aber Mirellas zierliche Hand schnellte vor und streifte den raschelnden Stoff meines Kimonos.
»Ich weiß, dass es nicht nur das war«, flüsterte sie.»Die anderen mögen dir die knallharte Chefin abnehmen, aber ich kenne dein Herz, Ry.«
Wie erstarrt stand ich da. Ihre Berührung sorgte für ein Kribbeln, so als würde sich mein Körper nur zu gut erinnern. Erinnern an das, was zwischen uns war.
»Du hast ein weiches Herz. Ein gutes Herz«, fuhr sie fort und ließ ihre Hand durch mein glattes schwarzes Haar streichen. Ihre Stimme war beruhigend wie ein rieselnder Bach. »Du hast dich immer um die gesorgt, die dir nahe waren.«
»Und wohin hat es mich gebracht?«
»Dahin, wo du jetzt stehst.«
Für einen Moment dachte ich darüber nach. Ich hatte meine Herzensentscheidungen immer als Fehler wahrgenommen und ihnen die Schuld für mein bisheriges Scheitern gegeben.
»Ich bin stolz auf dich, Ry.« Mirella stand direkt vor mir, ihre Finger immer noch in meinem Haar. Nur zu gut wusste sie, wie ich es liebte, wenn sie damit spielte.
Plötzlich lehnte sie sich vor. Für einen Moment war ich versucht, ihren süßen Worten nachzugeben. Ihren Kopf an meinen zu ziehen. Ihre Lippen auf meinen zu schmecken und ihre Hände auf meiner Haut zu spüren. Wie früher.
»Mira … Ich …« Ich kann das nicht noch einmal ertragen. Denn ich wusste, warum sie das tat. Sie erhoffte sich einen Vorteil. Das war der Grund für ihre Worte. Sie sagte mir genau die Dinge, die ich hören wollte, und nutzte die Gefühle von damals, um zu bekommen, was sie wollte. »Das mit uns ist vorbei.«
»Ich weiß, ich kann nicht wiedergutmachen, was ich getan habe, aber das Mindeste, was ich tun kann, ist es, mich bei dir für deine Rettung gerade zu bedanken.« Ihre Finger glitten über meine Hände. »Wenn du es zulässt.«
Ihr Blick verhakte sich mit meinem und ich stürzte in das dunkle Braun ihrer Augen. Schon immer war sie gut darin gewesen, mir genau das zu geben, was ich gerade brauchte. Ihr Haar roch so gut. Nach Erdbeeren, frisch gefallenem Schnee, tausend Erinnerungen und prickelnden Versprechen.
Sie lehnte sich weiter vor, bis ihre Lippen meinen Hals berührten. Ihr Atem hinterließ einen Schauer der Erregung auf meiner Haut. »Es gibt doch bestimmt etwas, das ich für dich tun kann«, flüsterte sie.
Es kostete mich all meine Überwindung, der Versuchung zu widerstehen. »Ja. Du kannst verschwinden. Es war ein anstrengender Tag.«
Bevor ich es mir anders überlegen konnte, schlüpfte ich in mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Seufzend lehnte ich mich gegen die Tür. Das Feuer, das sie in mir erweckt hatte, loderte immer noch und für einen Moment bereute ich meine Entscheidung.
Schmetterlinge überstehen jeden Sturm, sagte Großmutter immer. Aber ich wusste, sie taten es nicht gemeinsam, sondern allein.
∼
Es war der nächste Morgen, als mir eine der Anwärterinnen Frühstück brachte. Eine Schale Reis und ein paar Früchte. Ich aß auf, dann zog ich mich an. Allerdings schlüpfte ich heute nicht in den azurblauen Kimono, sondern in eine weite braune Hose, dazu ein beigefarbenes Hemd und einen Mantel in Erdtönen, um mich möglichst unauffällig durch die Straßen von Tokito bewegen zu können. Viele Angehörige des Lotusclans kleideten sich so. Ihre Loyalität demonstrierten sie dann mit bescheidenen Accessoires oder dezenten Stickereien.
Zuletzt stopfte ich meine Haare unter eine breite Mütze. So verkleidet verließ ich das Seligkeiten in aller Frühe, noch bevor die Sonne richtig aufgegangen war.
Ich nahm eine Rikscha, die mich aus dem Viertel meines Clans brachte. Kurz hielten wir an, damit ich an einem der Stände Erdbeeren kaufen konnte. Ich packte das Mitbringsel in meine Handtasche und wir fuhren weiter, bis wir eines der sterilen Hospitale erreichten, die dem Handclan gehörten. Der Platz davor war hell wie Marmor. Auf Dekoration, Blumen oder andere Verzierungen wurde hier vollkommen verzichtet. Der Handclan bestand aus Ärzten, Apothekern und Wissenschaftlern, die besonders seriös rüberkommen wollten. Sie wurden von allen respektiert, da jeder Clan ihr Wissen gleichermaßen benötigte, aber seitdem sie ihre Führung verloren hatten, hatte sich etwas verändert. Die Statue der ehemaligen Fürstin war mit Farbe beschmiert worden. Irgendein Spaßvogel hatte »Hier war ich!« auf den Hintern geschrieben. Vermutlich ein Affe. Der Humor würde zu einem passen. Ein derartiger Vandalismus wäre zur Regierungszeit von Hiraya Hun nicht denkbar gewesen.
Ich trat in das Krankenhaus und wie immer, wenn mich der Geruch nach Sterillium und Putzmitteln empfing, wurde mir kurz schwindelig. Er erinnerte mich daran, wie ich das letzte Mal in einem Hospital erwacht war und welcher Schrecken in den Katakomben darunter verborgen war.
Die Überlebenden des ausgerotteten Tigerclans hatten sich dort versteckt. Als der Handfürst erfahren hatte, dass er der Sohn des ehemaligen Tigerfürsten und einem entführten Schmetterling war, war er durchgedreht. Am Ende waren alle aus seiner Familie tot gewesen. Seine Ziehmutter Hiraya Hun. Er selbst. Wie auch die Letzten seines Clans.
Alle bis auf eine.
Großmutter Yubaba, der ehemals entführte Schmetterling und seine wahre Mutter, hatte wieder überlebt. Ich war mir sicher, dass sie den Tod der Handfürstin geplant hatte, um der Geisha mehr Macht zu verleihen. Nachdem ich von Tunichtgut erfahren hatte, dass bei der Nachfolge ausgerechnet ihre Favoritin vorne lag, festigte sich mein Verdacht: Sie hatte irgendeinen Plan, sich ihren Einfluss auf den Handclan zu sichern. Wenn jemand das Spiel der Clans perfekt beherrschte, dann war es Yubaba.
Der Fahrstuhl brachte mich ins oberste Stockwerk des Hospitals. Von hier ging ich auf einen kleinen Balkon, von dem aus eine Feuerleiter zum Dach führte. Ich hatte das Zelt im Schatten der Schornsteine noch nicht erreicht, da kam mir Mikko bereits entgegengeeilt. Trotz der frühen Stunde war er fertig angezogen. Wie ich war er ein Morgenmensch.
Seine schwarzen Haare waren etwas länger und wirrer als früher und auch die Brille saß schief. Die schwarze Uniform des Federclans hatte er gegen ein schlichtes, abgenutztes Baumwollhemd und eine Hose eingetauscht, aber sonst war er der Alte.
»Ryanne!« Er streckte seine Arme aus, schloss mich darin ein und drehte sich ein paarmal mit mir im Kreis. Seine Umarmungen waren die besten. Voller Ehrlichkeit, Herzlichkeit und Wärme. »Wie schön, dich zu sehen. O Mann, du siehst gut aus. Chefin sein steht dir.« Mikko war der einzige Mensch, den ich kannte, der so etwas wie Neid nicht kannte. Er schien sich einfach nur aufrichtig für die Menschen zu freuen, die er liebte. Auch wenn er selbst gerade kein Glück hatte.
»Wo ist Erin?«
»Schläft.«
»War sie wieder die ganze Nacht unterwegs?«
Mikko nickte.
Ich konnte sehen, dass das nicht alles war, aber er sprach nicht weiter. Vielleicht, um Erin zu schützen. Vielleicht wollte er mich auch einfach nicht beunruhigen.
»Lassen wir sie ausschlafen. Komm! Ich zeige dir unsere neue Terrasse.«
»Du meinst jetzt aber nicht die Reklametafel vom Krankenhaus.«
Er grinste. »Genau die. Von da aus haben wir den besten Ausblick auf die Stadt.«
Dann nahm er mich an der Hand und zog mich über das Dach zu den Buchstaben, die nachts hell erleuchtet waren. Von der Kante des Hochhauses kletterte er auf das H hinunter, bevor er mir eine Hand reichte, um mir zu helfen. In der kleinen Kuhle über dem Querbalken hatten sie es sich tatsächlich mit Kissen gemütlich gemacht.
Ich hasste Höhen. Eine von vielen Dingen, die ich fürchtete. Trotzdem war ich Erin und Mikko früher auf jedes Gerüst und jedes Dach gefolgt. Sie waren wie meine großen Geschwister, zu denen ich aufsah, die ich anhimmelte.
Wir nahmen so Platz, dass wir uns gegenübersaßen. Im Rücken jeweils ein Teil vom H.
»Willst du Tee?«
Verdutzt sah ich mich um. Grinsend griff Mikko in eine Lücke in der Wand und zauberte eine Thermoskanne hervor. Er verteilte zwei blecherne Becher und schenkte mir ein. Allein der Geruch des Grüntees brachte etwas in mir zum Schwingen. Mikko kaufte immer eine ganz bestimmte Sorte Blätter. Schon bevor ich ihn an die Lippen setzte, wusste ich genau, wie er schmecken würde. Nach zu Hause.
»Und wie geht es Erin wirklich?«, fragte ich, als ich ein paar Schlucke getrunken hatte. »Du machst dir Sorgen, oder nicht?«
»Sie kommt klar, aber … es ist viel passiert.« Die Falten auf seiner Stirn verrieten seine Gefühle. »Zwar ist sie noch dieselbe, aber irgendwie ist es auch anders. Sie hat Albträume. Manchmal redet sie im Schlaf mit sich selbst, aber kann sich am nächsten Morgen an nichts erinnern.«
»Das verstehe ich nur zu gut. Das, was ihr erleben musstet, ist sicherlich nicht leicht zu vergessen.«
»Ist es nicht.« Sein Blick wanderte in die Ferne.
»Was ist mit dir?«
»Ich komm klar.« Er blinzelte und als er sich wieder mir zuwandte, reckte er sein Kinn. Natürlich. Er wollte stark sein. Für Erin.
Sanft nahm ich seine Hand und inspizierte die Stelle, wo ihm ein Finger abgeschnitten worden war. »Du wurdest gefoltert, Mikko. So etwas ist auch nicht leicht zu vergessen.«
»Ich habe es nicht vergessen. Wie könnte ich …« Seine Hand zitterte leicht und er entzog sie meinem Griff. Mikko war jemand, den man schnell für weich oder schwach halten konnte, dabei war er ebenso stark wie Erin. Vielleicht sogar noch stärker. Nur auf eine andere Art und Weise.
»Dass ihr beide noch lebt, ist ein Wunder.«
»Dasselbe könnte ich über dich sagen.« Sein Blick wanderte zu meinem Herzen. Beide wussten, was mir widerfahren war, als ich aus dem Lotusclan geflogen war. Sie wussten, dass meine Mutter mich wie eine Prostituierte hatte verkaufen wollen und ich bereit gewesen war, mir das Leben zu nehmen, bevor das geschah. Ja, ich hatte mir meine Klinge ins Herz gerammt, um diesem verdammten Bordell zu entkommen.
»Was ist mit deiner Mutter geschehen?«, fragte Mikko.
Ich zuckte die Schultern. Von Tunichtgut wusste ich, dass Onkel Joe und sie das Bordell verlassen hatten und seitdem auf der Flucht waren. Mich bei ihren Freiern als Schmetterling auszugeben, war in den Augen unseres Clans unverzeihlich.
»Ich nehme an, sie schlägt sich irgendwie durch. Wenn sie eines gut kann, dann ist es überleben.«
»Tut mir leid. Ich weiß, wie wichtig sie dir ist. Trotz allem.«
Plötzlich spürte ich, wie sich Tränen in meinen Augen sammelten. Den ganzen Tag über spielte ich die Unnahbare, aber hier über den Häusern der Stadt an der Seite meiner besten Freunde brachen meine wahren Gefühle aus mir heraus. Mikko verurteilte mich nicht. Er nahm mich einfach in den Arm und hielt mich fest, so lange, wie es sein musste.
»Es ist nicht nur das«, presste ich zwischen meinen Lippen hervor. »Ich hab Angst …«
»Warum?«
»Meine neue Arbeit verschafft mir Ansehen und Respekt. Aber …« Für Außenstehende mochte die Position als Leiterin eines Freudenhauses in meinem Alter wie ein Traum wirken, aber mir reichte es nicht.
Yubaba hatte in mir eine Sehnsucht erweckt, als sie mir von den Schmetterlingen erzählt hatte, die nur der Geisha verpflichtet waren. Diese Frauen waren frei, stark und unberührbar. Das war mein Traum.
»Großmutter Yubaba meldet sich nicht bei mir. Ich habe Angst, dass ich etwas falsch gemacht habe. Eigentlich habe ich all ihre Prüfungen bestanden. Ich dachte, die Geisha würde mich in den Rang des Schmetterlings erheben.«
»Ich weiß, dass das dein Wunsch ist, aber du hast einen guten Job, von dem andere nur träumen. Du hast es geschafft, Ry.«
»Ich weiß. Und ich will es genießen, Mikko. Ehrlich. Trotzdem lässt es mir keine Ruhe. Alles, was Großmutter einem gibt, kann sie mit einem Fingerschnippen wieder nehmen. Nur die Flügel nicht … Als Schmetterling würde ich direkt der Geisha unterstehen. Ich wäre Yubaba und ihre Prüfungen endlich los. Ich wäre sicher. Stattdessen sitze ich im Seligkeiten fest. Was, wenn dies bloß ein weiterer Test ist und ich versage? Ich will nicht schon wieder alles verlieren. Ich will nicht erneut auf der Straße landen.«
Beruhigend strich er mir über den Kopf. »Das wirst du nicht, weil du der beste Schmetterling wirst, den der Lotusclan je gesehen hat. Und wenn das irgendjemand anders sehen sollte, sind wir da. Das weißt du, oder? Erin würde jede Tür eintreten, um dich zu retten.«
»Ich weiß.« Ich wollte seine Worte in mein Herz lassen, aber sie prallten an einer Mauer aus Furcht ab. Egal, wie oft er mir versichern würde, dass alles gut werden würde, ich konnte es nicht glauben.
Besonders wenn ich nachts allein im Bett lag, schälte die Angst sich aus der Dunkelheit und kitzelte Erinnerungen hervor, die ich vergessen wollte. Erinnerungen an Männer, die meine Stellung im Waisenhaus ausgenutzt und mich gegen meinen Willen auf ihren Schoß gezogen hatten. Ich war immer das kleine, süße Mädchen gewesen, aber niemand hatte Respekt vor kleinen, süßen Mädchen. In einer Stadt wie Tokito wurden sie nur ausgenutzt. Darum wollte ich diese Flügel. Ich wollte mit ihnen in die Höhe steigen, sodass niemand mehr ohne meine Erlaubnis an mich herankam.
»Es tut mir leid, dass ich dich mit meinen Problemen belaste«, flüsterte ich. »Ihr seid clanlos und ich heule dir vor, dass mir meine Position nicht reicht. Eine tolle Freundin bin ich.«
»Mach dir keine Sorgen.« Er tätschelte mir sanft den Arm. »Es ist wichtig, über seine Ängste zu sprechen und ich bin froh, dass du es mir erzählt hast.«
»Ist da etwa unser Baby Sonnenschein?«, rief eine vertraute Stimme und kurz darauf tauchte Erin kopfüber hängend über uns auf. Sie war groß, größer als die meisten Frauen im Lotusclan, muskulös und hatte kurzes, rotes Haar. Kurzum: Sie fiel auf. Mit einem Satz ließ sie sich zu uns herunter und brachte damit das H gefährlich zum Wanken. Als sie meine Tränen bemerkte, hielt sie inne. »Was ist los?«
»Nichts … Ich …«
»Das sieht nach einem klaren Fall für ein Gruppenkuscheln aus.«
»Nein, Erin, wir haben hier ein ernstes Ges…« Mikko wollte die Situation erklären, aber sie warf sich bereits auf uns drauf. Ich hatte das Gefühl, erdrückt zu werden, aber wollte mich trotzdem nicht befreien, denn die Arme meiner Freunde fühlten sich so an, wie ich mir Geborgenheit immer vorgestellt hatte.
»Du riechst so gut«, seufzte Erin.
»Du nicht …«
»Ich weiß. Ich bin durch einen Wal gefallen.« Sie löste sich von uns. Dann rutschte sie neben mir auf das Kissen und schlang ihren Arm wieder um mich. »Also? Wen muss ich verhauen?«
»Niemanden …«
»Diese Omma, die sich deine Ausbilderin nennt?«
»Man kann nicht alle Probleme mit Fäusten lösen.« Ich wischte mir die Augen trocken.
»Ich schon.«
»Das erklärt wohl, warum ihr auf einem Dach zeltet.«
»Autsch.« Sie wandte sich an Mikko. »Unser Baby hat ganz schöne Stacheln bekommen.«
Dieser zuckte mit den Schultern. »Ryanne hat recht. Vielleicht sollten wir hin und wieder auf sie hören. Immerhin hat sie es von uns am Weitesten gebracht.«
»Das habe ich immer gesagt«, sagte Erin und klopfte mir stolz auf die Schulter.
»Eigentlich hast du immer gesagt, du würdest am höchsten aufsteigen«, erinnerte sich Mikko.
»Ist das so?«
»Ja. Du wolltest den Affenkönig herausfordern, ihn im Zweikampf töten und Clanfürstin werden.«
Ihre Augen funkelten. »Ich halte das nach wie vor für einen guten Plan B.«
»Nein, Moji. Im Moment sollten wir die Bälle flach halten.«
»Aber …«
Warnend hob Mikko seine Augenbraue. »Das, was im Federclan passiert ist, sollte sich lieber nicht wiederholen.«
Damit hatte er recht. Als der Rabe Mikko gefoltert und ihm den Finger abgeschnitten hatte, war Erin durchgedreht und hatte es mit dem gesamten Clan aufgenommen. Deshalb waren sie nun nicht nur clanlos, sondern es gab auch noch ein saftiges Kopfgeld für ihre Ergreifung.
»Wie hast du das angestellt?«, flüsterte ich. Erin mochte stark und starrsinnig wie ein Ochse sein, aber die Federassassinen waren bewaffnet und besser ausgebildet. »Wie hast du ihn da rausbekommen?«
»So wie immer.« Sie küsste ihre Fäuste. »Ich hab dir doch gesagt, die hier können alles lösen. Sicher, dass ich mich nicht um dein Omma-Problem kümmern soll?«
Ich spürte, dass das nicht alles war. Auch wenn sie stark war, war sie nicht unverwundbar. Trotzdem beschloss ich, fürs Erste nicht weiter nachzubohren. »Vielleicht sollte ich wirklich darüber nachdenken.«
Ich öffnete meine Tasche und packte die Erdbeeren aus. Augenblicklich begannen die Augen der beiden zu glänzen.
»Ryanne, du bist die Beste!«
Ehe ich mich’s versah, stürzten sie sich auf die Früchte. Erin wie ein ausgehungerter Wolf. Mikko zurückhaltender. Ruckzuck war nur noch eine übrig.
»Will die jemand?«, fragte Erin mit vollem Mund.
»Ryanne ist unser Gast. Natürlich bekommt sie die letzte«, antwortete Mikko streng, aber ich winkte lachend ab.
»Nimm ruhig. Im Freudentempel bekomme ich mehr als genug davon.«
»Angeberin.« Erin verputzte auch die letzte, ohne zu zögern.
Mirella und die anderen Anwärterinnen waren gut darin, mich zu verwöhnen und zu umsorgen. Meine besten Freunde taten das nicht. Die beiden waren erfrischend ehrlich und verstellten sich nicht, wenn ich kam. Wenn man aus einer Welt kam, in der in jeder Silbe Manipulation steckte, war es wertvoll, etwas zu haben, was echt war.
»Also«, wechselte ich das Thema. »Wieso warst du in einem Wal?«
Erin berichtete von ihrer bahnbrechenden Erkenntnis, dass sich Wissenschaftler und Forscher nicht geirrt hatten und man in der Tat nicht auf einem Gaswal reiten konnte. Natürlich glaubte sie es erst, nachdem sie es selbst getestet hatte. Nichts an der Geschichte wunderte mich. So war Erin eben. Sie machte sich nichts daraus, was andere dachten, und folgte nur ihren eigenen Regeln.
Ich hob meinen Kopf auf der Suche nach einem Methanwal. Auch wenn Erins Versuch, auf einem zu reiten, ziemlich unüberlegt gewesen war, konnte ich sie verstehen. Wie oft hatte ich mir vorgestellt, auf einem davonzufliegen.
»Zu schade, dass es nicht geht«, flüsterte ich.
»Nun.« Mikko rückte seine Brille zurecht, wie immer, wenn er sich dafür rüstete, sein Wissen zum Besten zu geben. »Mit der geeigneten Ausrüstung …«
»Was meinst du?«
»Wisst ihr, wie man verhindert, im Treibsand zu versinken?«
»Ich weiß nicht mal, was Treibsand ist«, murmelte Erin.
»Flüssiger Sand, der einen in die Tiefe saugt. Man muss sich hinlegen, damit man nicht versinkt. Also dachte ich an einen Sattel, der das Gewicht des Reiters auf eine größere Fläche verteilt und so verhindert, dass man in die Membran rutscht.«
Erin und ich waren ganz Ohr. »Heißt das, man kann doch auf einem Wal fliegen?«
»Möglicherweise.«
Wir lauschten Mikkos verrückten Überlegungen und spannen ebenso verrückte Pläne, wie wir einen Wal anlocken könnten, um ihm Mikkos Erfindung auf den Rücken zu schnallen. Und für einen wunderbaren Moment war alles wie früher. Wir waren einfach nur drei Freunde, die sich einbildeten, dass nichts auf dieser Welt sie trennen konnte.
5 Erin Rider
Ich bin die Dunkelheit,
aber mein Herz schlägt im Licht.
»Sie hat sich verändert«, stellte ich fest, als Ryanne gegangen war.
»Das haben wir wohl alle«, entgegnete Mikko.
»Du nicht.« Ich stupste ihn sanft an. »Du bist immer noch der Junge, der alles für möglich hält.«
Er verzog die Lippen zu einem Lächeln, das seine Augen jedoch nicht erreichte. »Ich wünschte, es wäre so, aber ich bin schon lange nicht mehr naiv genug zu glauben, dass mit Fleiß und harter Arbeit alles zu meistern ist. Hin und wieder braucht man wirklich etwas von deinen Fäusten.«
»Oder meiner Dunkelheit …«, wisperten die Schatten ganz leise. Sie hatten sich in meinen Körper zurückgezogen, wo sie meist still verweilten. Denn während sie nachts große Töne spuckten, wagten sie sich im Licht der Sonne kaum von meiner Seite.
»Nein … Ihr hattet recht. Ich habe uns in diese Lage gebracht. Nur wegen mir campieren wir hier und hoffen, dass uns niemand erwischt.«
»Es ist nicht deine Schuld. Du hast nur getan, was notwendig war, um zu überleben. Außerdem mag ich unser neues Zuhause. Großartiger Ausblick. Frische Luft. Ruhige Lage.«
»Ich sag doch. Du hast dich nicht verändert. Immer noch der Optimist, den nichts und niemand unterkriegen kann.«
»Es ist zum Kotzen, nicht wahr?«, beschwerte sich der Distelkönig.
Ich rückte näher an Mikko heran. Wir saßen immer noch auf dem Querbalken der Reklame mit Ausblick auf die beschäftigte Stadt.
Mikko legte seinen Arm um mich und zog mich an sich. Wie selbstverständlich drückten sich seine Lippen auf meine. Sie waren eine Einheit, gehörten zusammen, seit sie sich das erste Mal gefunden hatten. Und genauso wie damals wurden wir plötzlich in leuchtendes Orange getaucht. Ich löste mich von ihm und hob meinen Blick. Über uns befanden sich drei neonfarbene Gasquallen, die sich aus dem Himmel zu uns herunterließen. Sie passierten uns und schwebten seelenruhig auf unser Zelt zu.
Mikko und ich sahen uns an. »O nein!«
Zeitgleich sprangen wir auf, zogen uns von dem H zurück aufs Dach und eilten zu unserem Lager, um unsere Vorräte zu sichern. Gerade noch rechtzeitig konnte ich mit einem Besen verhindern, dass die Mojis an der Plane vorbei ins Zelt schlüpften. Drohend schwang ich ihn über meinem Kopf. »Tentakeln weg von unserem Essen!«
Müllquallen waren nicht sehr streitlustig. Im Gegenteil. Sie gingen Konflikten aus dem Weg und zogen sich bei drohender Gefahr schnell zurück, um woanders nach Essbarem zu suchen.
Zufrieden lehnte ich mich auf den Besen, aber ich konnte sehen, dass Mikko ihnen mitleidig hinterhersah. »Was?«
»Wir haben noch ein paar Reste …«
»Mach das nicht. Wenn sie einmal etwas kriegen, kommen sie immer wieder.«
»Aber sie gucken so traurig.«
»Sie haben nicht mal Augen.«
»Schau sie dir doch an. Wabbeln sie nicht traurig?«
Ich sah zu den drei Mojis empor, die im sicheren Abstand zu mir und dem Besen auf- und abschwebten. Als könnten sie nicht entscheiden, ob sie weiterziehen sollten oder es doch noch Hoffnung gab. »Na schön. Tu, was du nicht lassen kannst.«
Das ließ sich Mikko nicht zweimal sagen. Er eilte ins Zelt und kratzte die Reste vom Abendessen zusammen. Dann marschierte er mit breitem Grinsen und einer kleinen Tüte zur Kante des Dachs. Dort reihte er die Essensreste auf und setzte sich wenige Meter entfernt hin. Seine Augen glänzten, während sich die Mojis wieder absenkten. Ihre Fangarme schlossen sich um die Krümel und sie beförderten das Essen in ihr Inneres.
Kurz zuckten die Mojis zusammen, als ich mich in Bewegung setzte, um neben ihm Platz zu nehmen, aber als ich nicht wieder mit dem Besen auf sie losging, beschlossen sie, sich nicht stören zu lassen. Schmatzend machten sie sich über Mikkos Essen her.
»Siehst du?«, sagte der. »Nun wabbeln sie viel glücklicher.«
»Das tun sie wohl.« Lächelnd lehnte ich mich gegen seine Schulter. Er hatte ein großes Herz und genau deswegen hatte ich mich damals in ihn verliebt. Ich griff nach seiner Hand und hielt sie fest. Gerade gab es nur uns. Uns und die Mojis. Und für diesen einen kleinen Moment war mein Leben perfekt.
Ich war glücklich.
Doch wie immer, wenn ich mir erlaubte glücklich zu sein, kam die Angst. Sie kroch mir den Rücken hoch, schlang ihre langen, dünnen Finger um mich und nahm mir die Luft zum Atmen.
»Verlass mich nicht«, japste ich.
Mit großen Augen sah Mikko mich an. »Was redest du da?«
»Du darfst mich nie verlassen«, wiederholte ich. »Versprich es mir.«
Damit meinte ich nicht, dass er sich in eine andere verlieben könnte oder einfach die Nase voll von mir hatte. Nein. Daran dachte ich keine Sekunde. Ich hatte Angst, ihn an die Grausamkeit dieser Welt zu verlieren, denn ich würde dieses Leben nicht ertragen, wenn es ihn nicht gab.
Er war mein bester Freund. Mein Geliebter. Mein Licht.
»Du hast doch noch mich«, säuselte der Dämon in mir.
»Versprich es«, forderte ich.
Mikko runzelte die Stirn. »Moji …«
»Sag es einfach. Bitte!«
»Ich verspreche es.«
»Gut.« Ich drückte meinen Kopf wieder an seine Schulter. Natürlich war es kindisch, dieses Versprechen einzufordern, denn das Böse in dieser Welt würde sich kaum daran halten.
»Das stimmt …«, säuselte der Distelkönig. »Es ist albern. Aber nur so aus Interesse: Was würde genau passieren, wenn man dein ach so geliebtes Licht auspustet?«
Ich weigerte mich zu antworten. Das musste ich auch nicht. Der Distelkönig wusste es bereits und der Gedanke schien ihm zu gefallen.
»Diese Stadt würde brennen.«
6 Kiran Seaborn
Ich folge dem Licht.
Und das Licht folgt mir.
In dem offiziellen senfgelben Fahrzeug, welches uns als Phari auswies, fuhren wir durch die unterschiedlichen Viertel von Tokito. Im Moment befanden wir uns auf einer dunkel und verwinkelten Straße, wie es die Federn bevorzugten. Zwischen den Häusern gab es unzählige kleine Gassen, in denen man schnell verschwinden konnte.
Mir gegenüber saß meine neue Lehrerin. Irgendjemand musste ja nach dem Tod meines vorigen Meisters Konoha meine Ausbildung übernehmen und die Menge an Freiwilligen tendierte gegen null. Niemand wollte den Unruhestifter mit den seltsamen Fähigkeiten übernehmen.
Letztendlich hatte sich die Heilerin Gaiana als Einzige dazu bereit erklärt, mich unter ihre Fittiche zu nehmen. Vielleicht tat sie es für Konoha, denn die beiden waren befreundet gewesen. Ihre Vorfahren stammten aus demselben Land. Normalerweise spielten Wurzeln in Tokito keine Rolle. Alles, was hier zählte, war die Zugehörigkeit zu einem der sechs Clans. Trotzdem schweißte Herkunft manchmal zusammen und gerade bei uns Phari war eh alles anders, da wir zu keinem der Clans gehörten.
Wir bildeten die neutrale Partei, standen außerhalb von all dem und waren doch mittendrin, denn wir waren die Wächter des Friedens. Zu helfen war die Mission, der sich die Phari aller Welt verschrieben hatten.
Trotzdem wusste ich, dass sich Konoha und Gaiana hin und wieder privat getroffen hatten, um … ja, was genau sie gemacht hatten, wusste ich nicht.
Früher einmal hatte ich vermutet, dass zwischen den beiden etwas lief. Konoha war kein Kind von Traurigkeit gewesen. Allerdings schien mir Gaiana nicht der Typ für eine geheime Romanze zu sein. Sie war … speziell und schien sich mehr für ihre Arbeit als für andere Lebewesen zu interessieren. Was auch immer die zwei verbunden hatte, war genug für Gaiana gewesen, sich nun für mich zuständig zu fühlen.
»Wo fahren wir hin, Meisterin?«
Bisher hatte sie kein Wort über den Grund verloren, weshalb sie mich in den Transporter gescheucht hatte, der nun Richtung Amphibienclan durch die Stadt bretterte. In puncto Geheimniskrämerei ähnelte sie Konoha.
»Meisterin?«