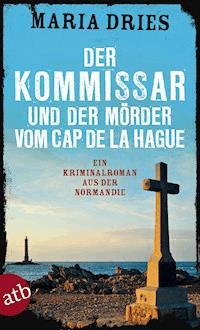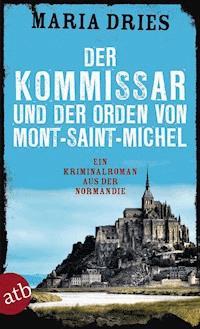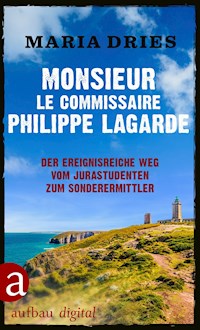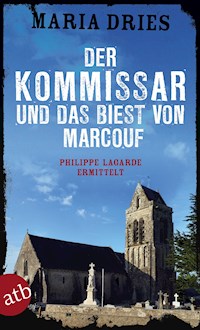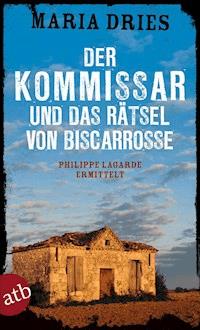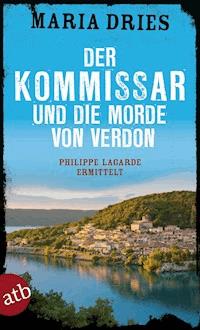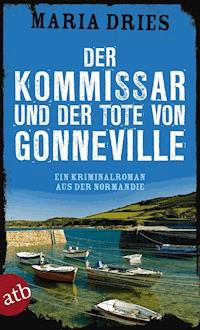Der Kommissar und der Orden von Mont-Saint-Michel & Der Kommissar und der Mörder vom Cap de la Hague E-Book
Maria Dries
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Fälle für Kommissar Lagarde in einem E-Book! Der Kommissar und der Orden von Mont-Saint-Michel. Philippe Lagarde aus Barfleur, als Kommissar eigentlich längst in Ruhestand, erhält einen Spezialauftrag. Ein junger Mann aus besten Kreisen wurde erstochen im Ferienhaus seiner Familie aufgefunden. Auf dem Film der Überwachungskamera ist ein Mönch zu sehen. Der Mord wurde mit einem Dolch der Templer begangen, und auf der Leiche lag eine weiße Christrose. Schnell findet Lagarde heraus, dass der Tote zur Gewalt gegen Frauen neigte. Aber wo genau ist das Motiv? Der Kommissar und der Mörder vom Cap de la Hague. Philippe Lagarde, Lebenskünstler und Kommissar im Ruhestand, wird von einer jungen Frau aufgesucht, die behauptet, der Tod ihrer Großmutter vor fünf Jahren sei kein Unfall gewesen, sondern Mord. Sie habe einen Mann beobachtet, der fluchtartig das Haus verließ, nur habe ihr niemand geglaubt. Lagardes Interesse ist geweckt – vor allem, als sich wenig später eine ähnliche Tragödie wiederholt. Eine alte Frau stürzt mitten in der Nacht die Treppe hinunter – offenbar wurde sie vorher betäubt. Bald weiß Lagarde, dass er auf der richtigen Spur ist ... Commissaire Lagarde ermittelt – zwei spannende Kriminalromane mit besonderem Flair.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Informationen zum Buch
Der Kommissar und der Orden von Mont-Saint-Michel:
Geheimnisvolle Normandie – Philippe Lagarde aus Barfleur, als Kommissar eigentlich längst in Ruhestand, erhält einen Spezialauftrag. Ein junger Mann aus besten Kreisen wurde erstochen im Ferienhaus seiner Familie aufgefunden. Auf dem Film der Überwachungskamera ist ein Mönch zu sehen. Der Mord wurde mit einem Dolch der Templer begangen, und auf der Leiche lag eine weiße Christrose. Schnell findet Lagarde heraus, dass der Tote zur Gewalt gegen Frauen neigte. Aber wo genau ist das Motiv?
Der Kommissar und der Mörder vom Cap de la Hague:
Bonne Nuit, Monsieur le Commissaire – Philippe Lagarde, Lebenskünstler und Kommissar im Ruhestand, wird von einer jungen Frau aufgesucht, die behauptet, der Tod ihrer Großmutter vor fünf Jahren sei kein Unfall gewesen, sondern Mord. Sie habe einen Mann beobachtet, der fluchtartig das Haus verließ, nur habe ihr niemand geglaubt. Lagardes Interesse ist geweckt – vor allem, als sich wenig später eine ähnliche Tragödie wiederholt. Eine alte Frau stürzt mitten in der Nacht die Treppe hinunter – offenbar wurde sie vorher betäubt.
Bald weiß Lagarde, dass er auf der richtigen Spur ist.
Commissaire Lagarde ermittelt – zwei spannende Kriminalromane mit besonderem Flair.
Über Maria Dries
Maria Dries wurde in Erlangen geboren und hat Sozialpädagogik und Betriebswirtschaftslehre studiert. Heute lebt sie mit ihrer Familie in der Fränkischen Schweiz. Schon seit vielen Jahren verbringt sie die Sommer in der Normandie. Im Aufbau Taschenbuch sind bisher ihre Krimis »Der Kommissar von Barfleur«, »Die schöne Tote von Barfleur«, »Der Kommissar und der Orden von Mont-Saint-Michel«, »Der Kommissar und der Mörder vom Cap de la Hague« zuletzt »Der Kommissar und der Tote von Gonneville«, »Der Kommissar und die Morde von Verdon«, »Der Kommissar und die verschwundenen Frauen von Barneville«, »Der Kommissar und das Rätsel von Biscarrosse« und »Der Kommissar und das Biest von Marcouf« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Maria Dries
Der Kommissar und der Orden von Mont-Saint-Michel & Der Kommissar und der Mörder vom Cap de la Hague
Zwei Normandie-Krimis in einem E-Book
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Der Kommissar und der Orden von Mont-Saint-Michel
Carolles, Basse-Normandie
Barfleur, eine Woche später – Die goldene Makrele (Erster Tag)
Der Christrosenorden (Zweiter Tag)
Das Kloster zwischen Himmel und Meer (Dritter Tag)
Sturmflut (Vierter Tag)
La Mère Poulard – Mutter Poulard (Fünfter Tag)
Der verzauberte Berg (Sechster Tag)
Die Abtei von Hambye (Siebter Tag)
Barfleur, zwei Wochen später
Der Kommissar und der Mörder vom Cap de la Hague
Karte
Die Zerstörung
Prolog
Barfleur
Erster Tag
Der Forst von Crasville
Zweiter Tag
Das Haus von Prévert
Dritter Tag
Der Leuchtturm von Noirmoutier
Vierter Tag
Das Wasserschloss Suscinio
Fünfter Tag
Die Klippen von Jobourg
Sechster Tag
Der Mörder vom Cap de la Hague
Siebter Tag
Drei Wochen später
Impressum
Maria Dries
Der Kommissar und der Orden von Mont-Saint-Michel
Ein Kriminalroman aus der Normandie
Für Nic
Engel voll Güte, kennst du das lautlose Hassen,
Fäuste im Dunkeln geballt und die Tränen der Wut,
Wenn Rachsucht und Wildheit den Weckruf erschallen lassen,
Zu Herren sich machen über den Geist und das Blut?
Engel voll Güte, kennst du das lautlose Hassen?
Charles Baudelaire,
»Die Blumen des Bösen«
(»Les Fleurs du Mal«)
Carolles, Basse-Normandie
Die Nacht hatte sich über die Bucht von Mont-Saint-Michel, ihre Polder, Salzwiesen und den erhabenen Klosterberg des heiligen Michael gelegt. Aus den hohen schmalen Fenstern des spätgotischen Chores der Abtei drang goldenes Licht. Die leuchtenden Punkte schienen über dem Wattenmeer zu schweben. Wer mit den Ritualen der Mönche vertraut war, wusste, dass die Ordensleute der Gemeinschaft von Jerusalem die eucharistische Anbetung zelebrierten. Die Brüder und Schwestern in ihren cremefarbenen Kutten verehrten anbetend den Leib Christi, der durch die Hostie symbolisiert wurde. Nach der Andacht empfing die monastische Gemeinschaft als Höhepunkt der Liturgie den sakramentalen Segen.
Ein leises Brausen war aus der Ferne zu vernehmen. Es kam vom Ärmelkanal und näherte sich mit hoher Geschwindigkeit der Südwestküste der Halbinsel Cotentin.
Der schwarze Schatten kauerte verborgen hinter dem mächtigen Stamm einer Silberzeder und beobachtete das Haus, das in der Dunkelheit lag. Vom Meer zog ein Sturm auf und zerrte an den Ästen des Baumes. Schwarzviolette Wolkengebirge jagten über den Himmel und verdeckten die weiße Mondsichel. Die Außenmauern des Erdgeschosses waren mit hellen Holzplanken verschalt. Darauf saß ein gläserner Würfel, der von einem leicht abgeschrägten Dach bedeckt wurde. Die Lichter im ersten Stock waren schon vor einer Stunde erloschen. Im Schutz der Finsternis glitt die Gestalt geräuschlos auf das Haus zu. Sie wusste, dass die Kellertür von innen verriegelt war, und näherte sich dem Haupteingang. Eine Ligusterhecke, an der die Windböen rüttelten, verhinderte den Blick auf die schmale Stichstraße oberhalb des Strandes. Das Zylinderschloss der Eingangstür ließ sich problemlos mit einem Dietrich öffnen.
Das dunkle Wesen betrat den Korridor und schritt entschlossen auf die Treppe zu. Durch ein Oberlicht drang für Sekunden der Lichtstrahl des Mondes und tauchte den Eingangsbereich in milchigen Glanz. Auf leisen Sohlen erklomm die Gestalt die Stufen. Im ersten Stock näherte sie sich zielstrebig der letzten Tür auf der rechten Seite. Der Eindringling wusste, wo das Schlafzimmer des Bewohners lag. Vorsichtig öffnete er die Tür und trat vor das breite Bett. Der junge Mann lag nackt zwischen zerknüllten Laken auf dem Rücken, schnarchte leise und schlief tief und fest. Der schwarze Dämon hielt einen Augenblick inne und betrachtete hasserfüllt dessen Gesicht. Während zackenförmige gelbe Blitze über den Himmel tanzten, beugte er sich über den Schlafenden und hob die Faust.
»Für dich, Mathilde«, flüsterte er.
Kurz blitzte die zweischneidige Klinge eines Dolches bronzefarben auf, dann rammte der Schatten die Waffe mit ganzer Kraft in die Brust des Mannes. Sie durchdrang sein Herz, so dass er augenblicklich tot war.
Behutsam holte der Mörder die Blüte einer Christrose unter dem Umhang hervor und platzierte sie auf dem Leib des Opfers. Dann trat er auf den Balkon, schwang sich über das Geländer und rutschte am Fallrohr der Regenrinne hinab. Sekunden später verschmolz das Phantom mit der Nacht.
Barfleur, eine Woche später Die goldene Makrele Erster Tag
Über dem malerischen Fischerhafen von Barfleur lag eine dicke Wolkenschicht. Der Vierungsturm der Pfarrkirche Saint-Nicolas nahe am Hafenausgang erhob sich schemenhaft im morgendlichen Dunst. Entlang der Mole reihten sich dicht gedrängt mittelalterliche Granitfassaden, deren Schieferdächer durch die feuchte Luft bleiern glänzten. Die kleine Fischereiflotte legte nach der Ernte der Miesmuscheln »Blonde de Barfleur« im Hafen an. Bunte Wimpel an den Booten flatterten im rauen Herbstwind.
Barfleur lag an der Nordostspitze der Halbinsel Cotentin in der Normandie. Die Küste entlang nach Süden zogen sich endlos erscheinende Muschelbänke. Nördlich des Ortes, auf der Pointe de Barfleur, erhob sich der Leuchtturm von Gatteville, von dessen oberster Plattform aus sich ein spektakulärer Ausblick über die Baie de Veys bis zu den Klippen von Grandcamps bot.
Das alte Granitsteinhaus von Philippe Lagarde mit seinen schmalen roten Kaminen lag etwas außerhalb von Barfleur inmitten einer sanften Dünenlandschaft. Unterhalb des Grundstückes schmiegte sich eine kleine henkelförmige Sandbucht an die Klippen. Vom Garten führte ein gewundener Pfad an den Strand. Im Sommer war dort sein liebster Badeplatz. Jetzt, Ende Oktober, stemmten sich die Seekiefern gegen den Wind. Die stürmische Brandung warf sich donnernd gegen graue senkrechte Felsnadeln und höhlte sie aus. Meerwasser strömte gurgelnd in die Grotten und schoss in hohen Fontänen durch Löcher und Ritzen im Gestein. Gischt bildete einen feinen Nebelschleier, der sich über die Klippen senkte.
Der Kommissar stand, nur mit schwarzen Boxershorts aus Seide bekleidet, in seinem Schlafzimmer. Die Shorts waren ein Geschenk von Odette, seiner Lebensgefährtin, und er trug sie immer, wenn er sie verlassen musste. Und sei es nur für einen Tag. Lagarde war mittelgroß und von kräftiger, muskulöser Statur. Sein dichtes schwarzes Haar war kurz geschnitten. Die saphirblauen Augen im gebräunten Gesicht leuchteten unternehmungslustig. Er trank einen Schluck von seinem Milchkaffee aus einer sonnengelben Bol und betrachtete seine Anzüge, die ordentlich aufgereiht auf Kleiderbügeln im Schrank hingen. Er entschied sich für den eleganten anthrazitfarbenen Anzug und legte ihn auf das französische Bett. Dazu würde er ein weißes Hemd und die dunkelrote Krawatte mit den grauen Streifen tragen. Die Wahl schien ihm für den Anlass angemessen. Er packte Unterwäsche, Socken und zwei Ersatzhemden in den kleinen Reisekoffer und schloss ihn. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass er sich auf den Weg machen musste.
Nachdem er Fenster und Türen verschlossen hatte, startete er seinen zerbeulten himmelblauen Renault Express und steuerte ihn in Richtung Nationalstraße. Sein Ziel war Avranches, eine alte Bischofsstadt an der Baie du Mont-Saint-Michel. Wenn er sich Zeit ließe, würde er knapp zwei Stunden brauchen. Die Tagung sollte um zehn Uhr bei einem Stehkaffee und einem Imbiss mit der Begrüßung durch den Polizeipräsidenten beginnen. Das Thema der Veranstaltung, die sich an Polizisten der Gendarmerie Nationale im Arrondissement Avranches richtete, lautete: »Mediation und Kriminalprävention«. Lagarde würde ein Referat mit dem Inhalt »Gewaltbereitschaft und Deeskalationsstrategien« vortragen. Anschließend stand eine Diskussion auf dem Programm. Nach den verschiedenen Vorträgen war am späten Nachmittag ein Plenum vorgesehen, bei dem die Ergebnisse der Arbeitsgruppen präsentiert und ein zukunftsweisendes Resümee gezogen werden sollte. Nach der Veranstaltung waren die Referenten zu einem exquisiten Abendessen in ein Feinschmeckerrestaurant eingeladen. Deshalb hatte Lagarde in der Innenstadt von Avranches ein Hotelzimmer reserviert.
Am nächsten Tag plante er, den Mont-Saint-Michel zu besuchen, der etwa fünfundzwanzig Kilometer von Avranches in westlicher Richtung lag. Der spirituelle Klosterberg faszinierte ihn. Bei jedem seiner Besuche entdeckte er neue architektonische Besonderheiten und wundersame Spielereien. Er liebte es, durch den stillen Kreuzgang zu spazieren und die wunderschönen Skulpturen aus Kalkstein auf den Eckverblendungen zu betrachten, die florale und figürliche Motive aus der Natur darstellten.
Der Kommissar war bis vor eineinhalb Jahren Mitglied einer Spezialeinheit der französischen Polizei gewesen, die unter anderem für Terrorismusbekämpfung, Geiselnahmen, Bombendrohungen und die Sicherheit bei politischen Großveranstaltungen zuständig war. Nach einer Schussverletzung der linken Schulter durch einen Attentäter hatte er sich entschlossen, in den Ruhestand zu gehen. Da ihn jedoch seine privaten Vorlieben und Interessen nicht gänzlich ausfüllten, unterrichtete er Polizeianwärter an der Polizeiakademie von Rennes und hielt gelegentlich Gastvorträge und Referate. Manchmal wurde er als Berater bei komplizierten Kriminalfällen und Gewaltverbrechen hinzugezogen. Er erhielt regelmäßig Einladungen aus verschiedenen Regionen Frankreichs und verreiste gerne für einige Tage. Am liebsten jedoch fuhr er mit seinem Boot aufs Meer hinaus und ließ sich die salzige, nach Tang riechende Luft um die Nase wehen. Auf diese Weise fand er innere Ruhe.
Als er Valognes, das normannische Versailles im Herzen des Cotentin, hinter sich gelassen hatte, setzte ein feiner Nieselregen ein. Die hügelige, von Hecken umsäumte Weidelandschaft war dunstverhüllt. In Buchenhainen, die beidseitig der Straße lagen, hingen Nebelschleier in den Baumwipfeln.
In Saint-Sauveur-le-Vicomte, einem mittelalterlichen Festungsort am Ufer der Douve, erhob sich dunkel das Château aus dem 11. Jahrhundert. Die massigen Befestigungswälle, die Flankentürme sowie der quadratische Bergfried hatten den Wirren des Hundertjährigen Krieges getrotzt.
Der Himmel klarte auf, und Philippe Lagarde schaltete die Scheibenwischer aus. Die Landschaft wurde flacher. Gemüsefelder breiteten sich aus, je weiter er sich der Westküste näherte. Er suchte im Radio einen Sender, der klassische Musik spielte, und summte zum Gesang von Montserrat Caballés Habanera aus der Oper »Carmen«.
Lächelnd dachte er an die letzte Nacht, die er mit Odette verbracht hatte. Sie war Eigentümerin eines Nobelrestaurants in der ländlichen Gegend westlich von Barfleur. »La Mirabelle«, ausgezeichnet mit einer Kochhaube des Gault Millau, war ein bevorzugtes Ziel von kulinarisch anspruchsvollen Genießern. Eine große ausgelassene Gesellschaft hatte die silberne Hochzeit eines hochrangigen Politikers der französischen Regierung und seiner Gattin gefeiert. Als Odette zu später Stunde, leise gähnend, unter die Bettdecke glitt, war ihr Liebster eingeschlafen. Mit zärtlichen Küssen hatte sie ihn geweckt. Dann liebte sie ihn mit einer erotischen Vehemenz, als würde er am Morgen zu einer monatelangen Expedition in die Antarktis aufbrechen.
Auf einem sanften Hügel gelegen, tauchte vor Lagarde Coutances auf. Dort bildete der Fluss Sienne die südlichste gewaltige Trichtermündung an der Côte des Îles. Auf dem höchsten Punkt war die Kathedrale Notre Dame errichtet worden, die die Stadt dominierte. Die Kirche mit den Spitztürmen und Steinbögen galt als eindrucksvolles Bauwerk normannischer Gotik.
Die Bucht des Mont-Saint-Michel begann bei Granville, dessen befestigte Oberstadt auf einem ins Meer hinausragenden Felssporn aus Schiefergestein lag. Südlich des bewehrten Ortes bog Philippe Lagarde auf den Parkplatz eines Aussichtsplatzes ab, der auf den Klippen oberhalb des Strandes von Carolles lag. Als er gemächlich auf den Felsenrand zulief, wurde er von einer Windböe gepackt und durchgeschüttelt. Seine Krawatte flatterte im Sturm. Die Hände in den Hosentaschen vergraben, betrachtete er fasziniert den Ausblick, der sich ihm darbot. Liebliche Flusstäler zogen sich durch die fruchtbare Ebene, und vor ihm erhob sich majestätisch das Wunder des Abendlandes, der heilige Klosterberg Mont-Saint-Michel, auf einem kreisrunden Granitkegel in der Baie. Er lag an der Mündung des Flusses Couesnon etwa einen Kilometer vor der Küste im Wattenmeer nahe der Grenze zur Bretagne. Der magische Ort war dem Erzengel Michael geweiht, dem Bezwinger des Satans und Führer der himmlischen Heerscharen, der beim Jüngsten Gericht über die Seelen befand. Als goldene Statue die Turmspitze der Abtei bekrönend, wachte er über die Gottesburg, die mächtigen Flügel ausgebreitet, das Schwert entschlossen erhoben, um den Lindwurm zu töten, in dessen Gestalt sich ihm der Teufel entgegenstellte.
Die dunkle Silhouette des Benediktinerklosters dominierte die Bucht. Die schlanke Turmspitze ragte in den Himmel. Das romanische Kirchenschiff und der spätgotische Chor zeichneten sich in scharfen Umrissen gegen einen schwefelgelben Himmel ab. Dunkelgraue Wolkengebilde jagten gen Osten. Das eisengraue Meer hatte sich zehn Kilometer zurückgezogen, um nun, brodelnd, schäumend, gurgelnd und tosend, mit der Flut zurückzukehren, schneller, als jedes Pferd galoppieren konnte. Der Tidenhub betrug bei Springflut bis zu fünfzehn Meter, und innerhalb von sechs Stunden wurden 40 000 Hektar überflutet. Drei Flüsse ergossenen sich in die Bucht. Es gab zahlreiche Nebenflüsse mit teils unterirdischen Läufen. Das unaufhörlich sprudelnde Wasser bedeckte den Grund mit einer glitschigen Schicht aus Tang und Algen, die Abgründe verbarg. Mönche und Pilger hatten zu früheren Zeiten große Angst vor dem Treibsand gehabt, der sie hinab in ein feuchtes Grab ziehen konnte. Selbst kundige Ortsansässige hatten es durch den sich ständig verändernden Untergrund schwer, sich zu orientieren, und plötzlich aufziehender Nebel konnte Wallfahrer ins Verderben führen. Seit 1877 gelangte man über einen Deich auf die Insel.
Das Schattenspiel der Wolken, plötzlich durchdringende Sonnenstrahlen sowie deren Reflexion durch die Wasserfläche tauchten die sakrale Pyramide in ein lavendelfarbenes magisches Licht. Ein Möwenschwarm erhob sich kreischend über den Klippen und drehte nach Süden ab. Die Vögel wirkten aus dieser Perspektive wie schwarze Drachen, die sich auf die Gottesburg und ihren Beschützer stürzen wollten.
Philippe Lagarde konnte seinen Blick nicht von dem Schauspiel losreißen. Erst als der Regen wieder einsetzte, lief er zu seinem Wagen zurück und setzte die Fahrt fort.
Nach knapp zwanzig Kilometern erreichte er den Bischofssitz Avranches. Die kleine Stadt lag auf einer felsigen Anhöhe. Sie war das landwirtschaftliche Zentrum des südlichen Départements Manche mit dem Schwerpunkt der Milcherzeugung und der Schafzucht. Die Tiere, die auf den Salzmarschen der Baie weideten, zeichneten sich durch ein besonders würziges Fleisch aus.
Philippe Lagarde fuhr die Rue Général de Gaulle entlang. Links erhob sich der Bischofspalast, der als einstiger Wohnsitz für die Bischöfe von Avranches im Mittelalter errichtet worden war. Schon im 4. Jahrhundert war Avranches unter gallorömischer Verwaltung Bischofssitz geworden. Dort war der Legende nach im Jahr 708 der Erzengel Michael dem Bischof Aubert in einem Traum erschienen. Er hatte den Diener Gottes beauftragt, auf dem Felsen in der Bucht eine Abteiburg zu bauen und sie ihm zu widmen.
Der Kommissar bog rechts ab in die Rue Louis Millet und näherte sich dem »Jardin des Plantes«, dem botanischen Garten gegenüber der Kirche Notre Dame des Champs. Von dessen Westseite konnte man auf den Mont-Saint-Michel blicken An der Place Carnot erreichte er das Kongresszentrum, in dem die Tagung stattfinden sollte. Der moderne gläserne Bau verfügte über ausreichend Stellplätze. Er parkte seinen Renault Express, griff nach seiner Aktentasche und schlenderte zum Eingang.
Philippe Lagarde erreichte den Portikus, bevor der nächste Regenschauer niederging. Die gläsernen Flügeltüren des Kongresszentrums standen einladend offen. Flankiert wurden sie von zwei riesigen Tontöpfen, die mit veredelten weißen Hortensien üppig bepflanzt waren. Zwei junge Polizistinnen begrüßten ihn mit einem strahlenden Lächeln. Sie trugen dunkelblaue Hosen, hellblaue Hemden mit der Aufschrift »Gendarmerie« auf der Rückseite, ein Koppel, in dessen Halfter eine Pistole steckte, und schwarze Stiefel. Auf ihren Köpfen saßen kleine blaue Hüte, die langen Haare waren zu einem Knoten gesteckt.
Die Polizistin mit den blonden Haaren hielt ein Klemmbrett mit einer Gästeliste in der Hand. Freundlich fragte sie nach seinem Namen. Bevor er ihn nennen konnte, stieß ihre Kollegin sie mit dem Ellbogen in die Seite.
»Das ist Philippe Lagarde«, raunte sie. »Er hat das grausame Verbrechen an einer Frau aufgeklärt, die man in einem Kiefernwäldchen in der Nähe von Barfleur gefunden hat. Das muss so Anfang Juli gewesen sein.«
Die blonde Gendarmin reichte Lagarde sein Namensschild, das er sich an das Revers seines Jacketts heftete. »Herzlich willkommen zur Tagung, Monsieur le Commissaire«, sagte sie mit ihrem schönsten Lächeln. »Ich werde mir Ihren Vortrag auf keinen Fall entgehen lassen.«
»Ich freue mich, wenn Sie mir zuhören«, erwiderte er charmant.
Er nickte ihnen zu und machte sich auf den Weg. Die blonde Polizistin starrte ihm hinterher.
»Mensch, der ist ja in Wirklichkeit noch viel attraktiver als im Fernsehen. Hast du seine Hände gesehen? So kraftvoll und doch so feingliedrig. Und dieses charmante Lächeln. Seine Augen haben die Farbe des Meeres in großer Tiefe.«
»Jetzt krieg dich mal wieder ein, Minou«, entgegnete ihre Kollegin. »Wie man so hört, ist er in festen Händen.«
»Schade.« Die Polizistin fixierte seinen breiten Rücken, als eine kräftige ungeduldige Stimme in ihr Bewusstsein drang.
»Wenn Sie Kommissar Lagarde lange genug angehimmelt haben, kann ich dann bitte mein Namenskärtchen haben. In zehn Minuten muss ich die Begrüßungsrede halten.«
Vor ihr stand Frank Lanoux, der Polizeipräsident.
Amüsiert über das aufgeregte Getuschel der beiden attraktiven Polizistinnen, hielt Lagarde nach dem Café Ausschau. Er betrat den angenehm warmen Raum, in dem sich bereits Dutzende von Menschen in Zivil und in Uniformen versammelt hatten. Sie bedienten sich am Büfett, saßen in bequemen kaffeebraunen Ledersesseln oder drängten sich um runde Bistrotische. Lebhafte Unterhaltungen waren im Gange, und ab und zu erklang ein Lachen aus einem der Grüppchen. An der karamellfarbenen Rückwand des Cafés hing ein riesiges Willkommensplakat mit dem Thema der Tagung. Daneben war an einer goldenen Stange die französische Flagge drapiert. Staatspräsident François Hollande lächelte huldvoll aus einem Bilderrahmen. Die raffinierte indirekte Beleuchtung tauchte den Raum in ein warmes gelbes Licht. Jenseits der geschlossenen breiten Glasschiebetüren lag eine gepflasterte Terrasse inmitten eines weitläufigen Gartens. Raucher hatten sich um einige Stehtische versammelt, bunte Sonnenschirme schützten sie vor dem Nieselregen.
Der Kommissar nahm das Büfett in Augenschein. Auf weißen Papiertischdecken standen silberne Tabletts, auf denen Kuchen, glasierte Obsttörtchen, Croissants und Schnittchen mit Käse, Schinken und Lachs angerichtet waren. Zu seiner Freude entdeckte er auf einer der Platten Eclairs, sein Lieblingsgebäck. Mit Hilfe einer Kuchenzange legte er zwei Stück auf einen Teller und bediente sich an der Kaffeetheke. Er goss reichlich Milch in das dampfende Getränk und steuerte auf einen Stehtisch zu, an dem noch Platz war. Er genoss den ersten Bissen des süßen Teilchens und kostete die Füllung, indem er sie auf der Zunge zergehen ließ. Die Creme schmeckte himmlisch. Mit halbem Ohr lauschte er dem Gespräch seiner Tischnachbarn. Es ging um einen Banküberfall in Avranches vor einigen Tagen, der einen unglücklichen Ausgang genommen hatte. Der Chef der kleinen Filiale, der einer Mitarbeiterin zu Hilfe kommen wollte, war vom Bankräuber kaltblütig erschossen worden. Daraufhin hatte das Einsatzteam den Schalterraum gestürmt und den Geiselnehmer lebensgefährlich verletzt.
»Der Kollege hätte den Mistkerl abknallen sollen«, empörte sich ein Mann neben Lagarde.
Als der Kommissar sich in das Gespräch einmischen wollte, versetzte ihm jemand einen freundschaftlichen Schlag auf die Schulter, und eine tiefe Stimme rief: »Philippe, ich wusste, dass ich dich in der Nähe des Kuchenbüfetts finden würde.« Ein dröhnendes Lachen folgte.
Lagarde drehte sich um und sah sich seinem alten Freund Henri Dugardin gegenüber. Die Männer umarmten sich und tauschten angedeutete Wangenküsschen aus.
»Das ist ja eine Überraschung«, meinte Lagarde lächelnd. »Was machst du denn hier, Henri?«
»Ich arbeite hier. Hast du das vergessen? Vor genau achtzehn Jahren habe ich mich von Paris in meine Heimat versetzen lassen.«
»Und hier bist du immer noch als Kommissar tätig?«
»So ist es, mein Freund.«
Philippe Lagarde und Henri Dugardin hatten in Paris in den neunziger Jahren einige Male zusammengearbeitet. Sie waren Weggefährten gewesen, die sich vertraut hatten. Nach ihrem letzten gemeinsamen Fall hatte Henri genug gehabt von der Großstadt, von Drogenhandel, Menschenschmuggel und Messerstechereien zwischen ethnischen Gruppen. Paris besaß jenseits der weltmännischen Eleganz und des schillernden Glamours eine Schattenwelt, die gefährlich war.
Damals hatte eine Bestie im Künstlerviertel von Montmartre gewütet, genauer gesagt zwischen dem Hügel, auf dem die Basilika Sacré-Cœur thronte, und dem Gewirr von Eisenbahnschienen im Osten. Die gesuchte Person, von der aufgeschreckten Pariser Bevölkerung »Das Monster von Montmartre« getauft, hatte zwei Prostituierte mit einem scharfen Messer, möglicherweise einem Skalpell, regelrecht abgeschlachtet. Es hatte keine Spur vom Täter gegeben. Er schien wie ein Phantom durch die nächtlichen Gassen des Viertels zu streifen. Nach langen aufreibenden Diskussionen entschloss sich das Team, einen Lockvogel einzusetzen. Chantal, eine junge Polizistin, erklärte sich bereit, ihn zu spielen. Lagarde war von Anfang an dagegen, er hielt das Risiko für viel zu hoch.
Es war bereits die dritte Nacht, in der Chantal in eisiger Kälte in einer schmalen Straße unter einer Laterne stand. Sie zitterte in ihrem kurzen Kleid und den dünnen Nylonstrümpfen. Das Kunstfelljäckchen wärmte sie kaum. Die Gasse war bei Nachtschwärmern beliebt, die auf dem Weg von der Kneipe zu ihrer Wohnung weibliche Gesellschaft suchten.
Henri Dugardin und Philippe Lagarde befanden sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einer leeren Wohnung im Erdgeschoss und ließen die Kollegin nicht aus den Augen. Polizisten in Zivil, getarnt als Liebespaare, schlenderten durch das Viertel, und auf dem Dach des verlassenen Hauses postierten Scharfschützen in höchster Alarmbereitschaft.
Ein leichter Schneefall setzte ein und puderte das Kopfsteinpflaster. Plötzlich trat eine Gestalt zu Chantal in den gelben Lichtkegel der Laterne, sie war aus dem Nichts erschienen, niemand hatte sie kommen sehen. Lagardes Muskeln spannten sich an, er war zum Sprung bereit, ebenso Henri. Als sie bemerkten, dass es sich um eine Frau handelte, entspannten sie sich. Eine Prostituierte sprach Chantal an, die sie sicherlich für eine Kollegin hielt. Sie trug einen kurzen getigerten Rock und hohe Stöckelschuhe im gleichen Muster. Die blonden Haare fielen wellenförmig über ihren breiten Rücken. Lagarde stutzte. Er musterte die Beine der Frau. Sie bildeten ein dünnes unförmiges Oval.
»Das ist keine Frau«, flüsterte er Henri zu und versuchte gleichzeitig, das Fenster hochzuschieben. Es hatte sich in der Kälte verzogen und klemmte. Als die blonde Prostituierte das Skalpell aus der Handtasche hervorholte und Chantal bei den Haaren packte, um ihr die Kehle durchzuschneiden, sprang Lagarde durch die Glasscheibe. Er stürzte sich auf den verkleideten Mann, riss ihn um und schlug mit ihm auf die Gasse. Chantal schrie gellend auf. Der Kommissar rang mit dem Mann, der über Bärenkräfte zu verfügen schien. Und er ließ das Skalpell nicht los. Die scharfe Waffe näherte sich dem Brustkorb von Lagarde, Millimeter um Millimeter. Sie keuchten. Henri wollte das Handgelenk des Angreifers packen, der mit einer blitzschnellen Bewegung reagierte und ihm dabei die Kuppe des rechten kleinen Fingers teilweise abtrennte. Diese kurze Unachtsamkeit nutzte Lagarde, zertrümmerte mit der Stirn das Nasenbein des Angreifers, sprang auf und trat so lange auf dessen Handgelenk, bis er das Messer losließ.
Gedankenverloren tranken die beiden Kommissare von ihrem Kaffee. Der Raum hatte sich ziemlich geleert. Die meisten Tagungsgäste lauschten der launigen Begrüßungsrede von Frank Lanoux im großen Saal.
»Ich freue mich, dass wir uns zufällig hier begegnet sind«, bemerkte Lagarde.
Henri blickte ihn an. Er sah schlecht aus. Seine Haut spannte sich wie brüchiges Pergamentpapier und war gelblich fahl. Die wässrig blauen Augen, die früher unternehmungslustig geblitzt hatten, lagen tief in den Höhlen und waren rot geädert. Die stattliche Figur wirkte gebückt, und der Bauchansatz hatte sich in eine unnatürlich wirkende Trommel verwandelt. Nur das borstige Haar stand wie immer unzähmbar vom runden Kopf ab. Inzwischen war es weiß. Hoffentlich ist er nicht krank, dachte Lagarde.
»Wir haben uns nicht zufällig hier getroffen, Philippe«, erwiderte Henri. »Ich habe dich auf der Referentenliste entdeckt und bin gekommen, um mit dir zu reden. Dein Vortrag beginnt in wenigen Minuten. Darf ich dich heute Abend zum Essen einladen?«
Lagarde überlegte. »Die Veranstalter erwarten mich und die anderen Referenten zum Abendessen in einem Restaurant.«
»Ich lade dich in die beste Brasserie von Avranches ein, in die Goldene Makrele. Das Restaurant ist traumhaft gelegen, direkt an der Flussmündung der Sée. Dort gibt es die besten Kutteln der Welt.«
Er zwinkerte seinem alten Kollegen zu.
Lagarde grinste. »Du weißt genau, dass ich Kutteln nicht mag.«
»Das war ein Scherz. Natürlich weiß ich das noch. Also, kommst du?«
Lagarde war kein Freund von Großveranstaltungen. Lieber wollte er mit Henri essen gehen und gemütlich plaudern. Außerdem hatte er das sichere Gefühl, dass sein Freund etwas auf dem Herzen hatte.
»Ich komme gerne, Henri, sagen wir um zwanzig Uhr? Ich möchte mich vorher auf meinem Hotelzimmer etwas frisch machen.«
»Einverstanden, um zwanzig Uhr in der Goldenen Makrele.« Henri kritzelte die Adresse und die Anfahrtsskizze auf eine Serviette.
Es wurde Zeit, den Raum aufzusuchen, in dem er seinen Vortrag halten sollte. Lagarde griff nach seiner Aktentasche und verließ das Café. Er folgte einem Gang und suchte nach der Zimmernummer, die auf dem Veranstaltungsprogramm vermerkt war. Als er den Raum betrat, stellte er fest, dass die Stuhlreihen gut besetzt waren. Er schätzte die Anzahl der Zuhörer auf etwa vierzig Personen. Auf dem Rednerpult standen ein Mikrofon, eine schmale Vase mit einer gelben Rose, eine Flasche Mineralwasser und ein Glas. Er schaltete das Mikro ein, begrüßte die Kolleginnen und Kollegen und stellte sich vor. Er stellte verschiedene Methoden der Deeskalation vor und untermauerte sie mit Beispielen aus seiner beruflichen Vergangenheit, um den Vortrag aufzulockern. Ein Schwerpunkt seiner Ausführungen betraf die Frage, wann ein Zugriff erfolgen sollte. Die Entscheidung traf der Einsatzleiter, und alle mussten ihm Folge leisten. Diskussionen waren ausgeschlossen. Hinterher folgte jedoch immer eine Manöverkritik, bei der jeder seine Meinung äußern konnte.
Die Polizistin mit dem blonden Haarknoten, die ihn am Eingang begrüßt hatte, meldete sich zu Wort.
»Ich habe eine Frage, Monsieur le Commissaire. Wie hält derjenige, der die Verhandlungen führt, den Druck aus? Ich meine, es geht ja immer um Menschenleben. Was ist, wenn er die falsche Entscheidung trifft?«
Lagarde lächelte. »Das ist eine gute Frage. Etliche Faktoren spielen eine Rolle. Der Verhandlungsführer muss psychologisch geschult sein und über Berufserfahrung verfügen. Er muss ein Gespür für den Täter entwickeln und versuchen, seine nächsten Schritte vorherzusehen. Letztendlich ist so ein Einsatz immer eine Gratwanderung. Entscheidungen müssen getroffen werden, auch wenn sie sich im Nachhinein als nicht optimal oder sogar als falsch herausstellen. Der Verhandlungsführer muss seine Entscheidung verantworten und auch mit den Konsequenzen fertigwerden. Sonst hat er den falschen Job.«
Die Polizistin nickte nachdenklich.
Jetzt meldete sich der Mann, der vorhin im Café neben ihm am Tisch gestanden hatte, als von dem Banküberfall in Avranches die Rede gewesen war.
»Warum erschießt man einen Geiselnehmer nicht einfach, bevor er anderes Leben auslöschen kann?« Der Tonfall klang aggressiv.
»Weil wir in einer Demokratie leben und nicht im wilden Westen«, antwortete Lagarde.
Die Polizistin mit dem kaffeebraunen Dutt hob den Zeigefinger in die Luft.
»Ja, bitte«, ermunterte Lagarde sie.
Sie zögerte, dann fasste sie sich ein Herz. »Wenn es auf einem Fest zu einer Schlägerei kommt und es gelingt mir nicht, die Streithähne durch ein Gespräch zur Vernunft zu bringen, habe ich dann die falsche Deeskalationsmethode gewählt?«
Lagarde grinste. »Nein, es gibt Situationen, da greift keine Deeskalationsmethode. Sie ziehen Ihre Pistole, legen den Rabauken Handschellen an und schaffen sie in die Ausnüchterungszelle.«
Vereinzeltes Lachen erklang.
Als keine Wortmeldungen mehr gab, beendete Lagarde die Veranstaltung und dankte den Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit. Es war Mittagszeit, und die Tagungsgäste strebten dem Kongressrestaurant zu. Er hatte jedoch keinen großen Hunger, organisierte sich ein Sandwich und machte einen Spaziergang durch den Pflanzengarten. Es regnete nicht mehr. Eine blassgelbe Sonne, die kaum wärmte, zeigte sich am Himmel. Hinter Dunstschleiern ragte erhaben die Ostfassade des Klosterberges auf. Die kühle frische Luft tat ihm gut.
Während er den Hauptweg entlangging, dachte er über seinen alten Freund Henri nach. Was hatte er wohl auf dem Herzen? Nun, heute Abend würde er es erfahren.
Lagarde wollte an keiner Arbeitsgruppe teilnehmen. Der Workshop einer Kollegin, einer Kommissarin aus Coutances, schien ihm viel interessanter. Als er den Raum betrat, stand sie bereits am Rednerpult. Rasch setzte er sich auf einen Stuhl in den hinteren Reihen. Er schätzte die Frau auf ungefähr vierzig. Sie war attraktiv und groß gewachsen. Das dunkelblonde Haar trug sie kurz und modisch geschnitten. An ihren Ohren funkelten winzige Brillanten. Der schwarze elegante Hosenanzug saß perfekt. Sie machte einen energischen, durchsetzungsfähigen Eindruck, und gerade deshalb war sie für das Thema, über das sie referierte, genau die richtige Person. Es ging darum, dass Polizistinnen, manchmal aufgrund von Vorurteilen, manchmal aus ethnischen Gründen, als Gesprächspartner nicht akzeptiert und ernst genommen wurden. Schwerpunkt des Vortrages waren Strategien, um mit solchen Situationen adäquat umzugehen. Anhand von Rollenspielen stellte sie das Thema anschaulich dar. Die Polizistin mit dem kaffeebraunen Haarknoten erklärte sich bereit, in einer gestellten Szene die Befragung eines algerischen Familienoberhauptes durchzuführen. Ein älterer, gemütlich wirkender Gendarm, der wahrscheinlich hauptsächlich Strafzettel verteilte, sollte diese Rolle übernehmen. Da er mit dem abweisenden überheblichen Verhalten enorme Schwierigkeiten hatte, coachte ihn die Kommissarin, und so verwandelte er sich in einen maghrebinischen Patriarchen, dass einem Hören und Sehen verging. Die Verwandlung schien ihm enormen Spaß zu machen. Er ließ die junge Polizistin komplett auflaufen.
Lagarde amüsierte sich großartig über sein schauspielerisches Talent. Der Kollege sollte sich einer Laienspielgruppe anschließen.
Dann übernahm die Kommissarin die Rolle der Frau, die das Gespräch führen sollte, und demonstrierte, wie es zu gestalten war. Sie folgte einer klaren Linie und ließ sich nicht beirren, sie agierte höflich, aber konsequent und mit einer unerschütterlichen Autorität. Schließlich warf sie der Polizistin den Ball zurück, die die Befragung fortsetzte und der demonstrierten Strategie eisern folgte. Der Gendarm meinte hinterher, sie hätte ihn so eingeschüchtert, dass er schon Straftaten gestehen wollte, die er gar nicht begangen hatte. Nach dem Nachmittagsimbiss versammelten sich die Tagungsgäste zum Plenum im großen Saal. Die Arbeitsgruppen präsentierten ihre respektablen Ergebnisse und ernteten anerkennendes Tischklopfen. Der Polizeipräsident Frank Lanoux zog ein zufriedenes Resümee und dankte den Gästen für die engagierte Teilnahme an der Veranstaltung. Er wünschte den Polizisten viel Erfolg bei ihrer weiteren Arbeit und kündigte eine Veranstaltung an, die im Januar in Saint-Lô stattfinden sollte. Dann erinnerte er an das gemeinsame Abendessen und verabschiedete sich.
Als der Kommissar das Kongresszentrum verließ, begegnete er Lanoux unter dem Portikus.
»Bonjour, Lagarde, schön, dass wir uns noch persönlich treffen.«
»Bonjour, Monsieur Lanoux.«
Die Männer schüttelten sich die Hand.
»Wie hat Ihnen die Tagung gefallen?«
»Sehr gut, Monsieur Lanoux. Fachlicher Input und ein kollegialer Austausch zwischen Kollegen außerhalb des Dienstplanes ist ganz wichtig für unsere Arbeit.«
»Sie sagen es, Lagarde. Arbeiten Sie zurzeit an einem Fall?«
»Nein, Monsieur Lanoux, alles läuft in ruhigen Bahnen.«
»Na, in unserer Branche wird es sicher nicht lange so bleiben. Sie entschuldigen mich. Sehen wir uns heute Abend?«
»Leider nicht, ich bin mit einem alten Freund verabredet.«
Lagarde hatte noch reichlich Zeit bis zu seinem Treffen mit Henri. Deshalb beschloss er, die kurze Strecke über die D 43 zum Mont-Saint-Michel zu fahren und das ambitionierte Renaturierungsprojekt zu besichtigen. Der Straßendamm, der den Klosterberg mit dem Festland verband, war 1869 gebaut worden. Die Aufschüttung, die die Wasserzirkulation behinderte, führte zu einer Verlandung der Bucht. Damit der Berg in Zukunft nicht im Schlamm stehen würde, sollte durch das Projekt die Bucht freigespült werden. Die Schleuse wurde bei Flut geöffnet, um gewaltige Mengen Meerwasser in den Unterlauf fließen zu lassen. Dann schlossen sich die Tore für sechs Stunden. Bei Ebbe öffneten sich die Schleusen, und die Sandpartikel wurden durch die enorme Kraft ins Meer zurückgeschwemmt. Die Parkplätze wurden auf das Festland verlegt, so dass die störende Blechlawine vor dem Berg verschwand. Man konnte nun mit einem Pendelbus oder einer Pferdekutsche zum Klosterberg gelangen. Auch ein Spaziergang war möglich, der etwa eine halbe Stunde dauerte.
Die Fahrt führte Lagarde über schmale Landstraßen durch kleine verschlafene Dörfer. Granitsteinhäuser mit spitzen Erkern und weißen Sprossenfenstern drängten sich aneinander, um sich gegen den Seewind zu stellen. Schafe grasten und ließen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Der Anblick des Glaubensberges im Watt war allgegenwärtig.
Zu Beginn des ersten Jahrtausends hatte sich zwischen der Halbinsel Cotentin und Cancale in der Bretagne der Wald von Scissy erstreckt. Die wüste verlassene Gegend hatte die Phantasie der Menschen im Mittelalter beflügelt, für die der Wald ein mythischer Ort war, in dem unvorstellbare Gefahren lauerten. Bevor der Berg im Jahr 708 dem heiligen Michael geweiht wurde, hatte das Meer den Wald von Scissy verschlungen, und der Mont Tombe war die letzte Zufluchtsstätte gegen das Meer.
Philippe Lagarde stellte seinen Renault Express auf dem neuen kostenpflichtigen Parkplatz ab. Der Mont-Saint-Michel wurde jährlich von mehr als zwei Millionen Menschen besucht. Die Hauptsaison war jedoch schon lange vorbei. Die Dämmerung setzte ein. Außerdem blies ein kalter Wind. Der Kommissar tauschte sein Jackett gegen eine warme Jacke, die er immer in seinem Auto liegen hatte. Die Hände in den Taschen vergraben, lief er zu der Aussichtsplattform der Stauanlage, von der man einen schönen Ausblick auf die Südseite des heiligen Berges und das Wattenmeer hatte. Die sich im Bau befindende Stelzenbrücke sollte sich unaufdringlich in die Küstenlandschaft einfügen. Lagarde betrachtete die Brücke, die einem dynamischen Schwung folgte. Die dünnen Stützen aus Stahl erinnerten an einen Bootsanlegesteg. Die Baustelle lag verlassen im Schlick, Stahlrohre ragten aus dem Gebilde. Graublauer Tang bildete einen dicken Teppich, und Salzpflanzen durchzogen die Wasserlandschaft.
Lagarde warf einen letzten Blick auf die Südfassade der Abtei, die im Abendlicht golden schimmerte. Bald würde die Dunkelheit hereinbrechen. Als er beschloss, zum Hotel zu fahren, erreichte eine gutgelaunte japanische Familie die Plattform und zeigte sich begeistert von der Aussicht auf den Berg. Lächelnd und pausenlos auf ihn einredend, reichte der Mann Lagarde eine Digitalkamera und deutete auf den Auslöser. Dann postierte sich das junge Paar vor dem Geländer, ihre kleine Tochter nahmen sie in die Mitte. Das niedliche Mädchen mit dem runden Gesicht und den lackschwarzen Haaren hielt eine Schnur in der Hand, an der ein herzförmiger Heliumluftballon im Wind tanzte.
Lagarde fand das Hotel Avranches mühelos. Es befand sich im Osten des Städtchens in einer Seitenstraße des Boulevards Amiral Gauchet. Hinter dem in einem frischen Hellgelb gestrichenen Gebäude lag ein beleuchteter Innenhof. Dort fand er einen Parkplatz. Das Hauptgebäude war durch einen Wintergarten mit rot gerahmten Glasscheiben mit einem Nebentrakt verbunden, der mit wildem Wein in grünen und herbstlichen Farbtönen überwuchert war. In einem Beet neben den weißen Stufen, die zum Hintereingang führten, blühten weißgelbe, rot-purpurne, rostrote und orangene Garten-Chrysanthemen. Lagarde betrat den Wintergarten, der als gemütlicher Aufenthaltsraum für die Gäste gestaltet war. Mit blauem Stoff bezogene Sofas und Korbstühle mit flaschengrünen Polstern gruppierten sich um runde Glastische. Bananenstauden und Palmen wuchsen aus türkisfarben glasierten Tontöpfen.
An der Rezeption war niemand. Lagarde läutete mit einem Messingglöckchen, das auf dem Tresen stand. Eine junge Frau erschien, die ihn herzlich willkommen hieß. Sie informierte ihn über die Frühstückszeit. Dann reichte sie ihm die Schlüssel für die Zimmertür sowie den ab zweiundzwanzig Uhr verschlossenen Haupteingang und erklärte den Weg. Er trug seinen Koffer eine steile Treppe hoch in den zweiten Stock. Die Decke dort war so niedrig, dass er sich fast den Kopf anstieß. Er trat in das Zimmer und schaute sich neugierig um. Es hatte schräge orangefarbene Wände. Freigelegte braune Holzbalken stützten die Decke. An der rechten Wand stand an einem dunkelbraunen Sockel ein französisches Bett mit einer glänzenden mokkafarbenen Tagesdecke. Ein großes Dachfenster gab den Blick auf die Dächer von Avranches frei. Rechts daneben in einer Nische befand sich ein kleiner Schreibtisch mit einem Lederstuhl, auf der Arbeitsfläche stand eine Tiffany-Lampe. Er knipste sie an, und bernsteinfarbenes Licht erstrahlte. Der Raum gefiel ihm. Er legte seinen Koffer auf eine Holztruhe vor dem Fenster. Links führte die Tür ins Bad, direkt neben dem Kleiderschrank und einer Kommode, auf der ein Fernseher seinen Platz hatte. Der Boden und die Wände des geräumigen Badezimmers waren mit hellen marmorierten Fliesen ausgelegt, die weiß getünchte Decke von Balken durchzogen. Er zog sich aus und betrat die ebenerdige Dusche. Eckige altmodische Seifenstücke in den Farben Rosa, Weiß und Lila lagen auf einer Glaskonsole. Er schnupperte – Rose, Maiglöckchen, Lavendel. Die kräftigen Aromen belebten ihn. Er entschied sich für Maiglöckchen und duschte lange heiß, dann eiskalt. Mit einem flauschigen Frotteehandtuch trocknete er sich ab. Er streckte sich auf dem weichen Bett aus und genoss die Ruhe. Sein Blick fiel auf ein Aquarell neben der Zimmertür. Es stellte die Kapelle des heiligen Aubert auf dem Mont-Saint-Michel in einem Sturm dar und wurde von einem weißen Passepartout umrahmt. Das Bild war wunderschön. Rechts unten steckte im Rahmen ein Kärtchen, auf dem das Motiv benannt war sowie die Galerie, die es ausstellte, und der Preis. Er würde es für Odette kaufen. Sie hatte bald Geburtstag, am 5. November.
Lächelnd griff er nach seinem Handy, tippte die Nummer des »Mirabelle« und lauschte.
Gérard, der Oberkellner, meldete sich. »Die Chefin ist in der Küche«, erklärte er, »und diskutiert mit Jacques.«
Jacques war der Chefkoch mit ausgeprägten Starallüren.
»Würdest du sie bitte holen, Gérard.«
Ein paar Sekunden später war Odette schon am Hörer.
»Philippe, schön, dass du dich meldest.«
»Bonsoir, mein Engel. Wie geht es dir? Streitet ihr schon wieder, Jacques und du?«
»Seltsamerweise nein. Er ist absolut friedfertig und kompromissbereit. Das ist vielleicht langweilig.«
Lagarde lachte.
»Wie war die Tagung?«
»Sie war interessant. Ich denke, das Konzept von Lanoux geht auf. Die Mitarbeiter fühlen sich ernst genommen und engagieren sich. Auch für kollegialen Austausch bleibt genug Zeit.«
»Schön, und jetzt gehst du mit den Kollegen essen?«
»Nein, mein Plan hat sich geändert. Ich habe einen alten Freund aus Pariser Zeiten getroffen, Henri. Er hat mich zum Essen eingeladen und möchte etwas mit mir besprechen.«
»Dann wünsche ich dir einen schönen Abend.«
»Salut, ma chère.«
Lagarde griff nach der Fernbedienung und zappte durch die Kanäle, bis er einen Nachrichtensender fand. Staatspräsident Hollande hielt eine Rede. Lagarde fand es erstaunlich, dass der Politiker so großen Erfolg bei Frauen hatte, er sah eher durchschnittlich aus.
Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es Zeit wurde aufzubrechen. Er würde im Wintergarten noch einen Milchkaffee trinken und dann zur »Goldenen Makrele« fahren.
Die Brasserie »Goldene Makrele« lag etwas außerhalb von Avranches bei La Roche direkt am Mündungsarm der Sée. Lagarde fand einen Parkplatz auf dem geschotterten Vorhof, der von altmodischen Laternen in honiggelbes Licht getaucht wurde. Die Blätter alter Platanen raschelten im Abendwind, von der Rückseite des Restaurants hörte man das Rauschen des vorbeiströmenden Flusses. Lagarde betrat die Brasserie durch ein steinernes Portal und eine zweiflüglige Glastür mit einem geschwungenen Schriftzug in Gold mit dem Namen des Restaurants. Er lief über einen dunkelroten Teppich durch den Eingangsbereich und wurde im Speiseraum von einem Ober empfangen. Lagarde entdeckte Henri an der Bar, der ihm freudig zuwinkte. Er erklärte dem Kellner, dass er verabredet sei und sein Bekannter sicherlich einen Tisch reserviert habe.
Lagarde blickte sich um und war erleichtert, dass er zum frischen Hemd wieder die Krawatte umgebunden hatte. Das Restaurant war sehr elegant und verspielt im Art-déco-Stil eingerichtet. Er sah stoffbespannte Wände in goldenen geschnitzten Rahmen, Wandbordüren aus meerblauen und türkisen Mosaiksteinen, Palmen, Jugendstilgemälde, die vornehme Damen mit großen Hüten und kleinen Hunden zeigten, Spiegel, Kronleuchter, hohe bogenförmige Sprossenfenster mit Buntglasscheiben, kunstvoll verzierte Holzgeländer, die als Raumteiler dienten, und eine imposante Bar aus glänzendem Mahagoniholz. Dazwischen standen weiß eingedeckte Vierertische mit weinroten Polsterstühlen. Er musste unbedingt einmal mit Odette hierherkommen. Sie würde begeistert sein. Über den Regalen der Bar, auf denen eine beeindruckende Auswahl an Spirituosen stand, entdeckte er ein großes rechteckiges Mosaik. Vor der Kulisse der glutroten untergehenden Sonne und eines Fischkutters sprangen goldene Makrelen aus einem tiefblauen Meer. Im azurblauen Rahmen tummelten sich Muscheln, Seesterne, Schnecken, Krebse und Seepferdchen.
Henri stieg von seinem Hocker, und die Freunde umarmten sich. Er trug einen dunkelbraunen Anzug mit Weste und weißem Hemd, dazu eine beige Fliege mit braunen Tupfen.
»Guten Abend, Philippe, es ist schön, dass du gekommen bist.«
»Henri, ein nobles Restaurant hast du ausgesucht.«
»Gefällt es dir?«
»Ich bin beeindruckt.«
»Wollen wir an der Bar einen Aperitif trinken, bevor wir an unseren Tisch gehen?«
»Gerne.« Lagarde setzte sich auf einen Hocker.
»Was möchtest du, Philippe? Champagner oder lieber etwas Stärkeres?«
»Einen Pastis, bitte.«
Henri winkte nach dem Barkeeper. »Zwei Pastis, bitte.«
Der Anisschnaps war mit Leitungswasser verdünnt und wurde von zwei Eiswürfeln gekühlt.
Die Männer stießen auf ihre alte Freundschaft an.
»Hast du eigentlich inzwischen geheiratet, Philippe?«, fragte Henri.
»Nein, es hat sich nie ergeben. Jetzt habe ich eine Freundin, die ich gerne heiraten würde. Bisher konnte ich sie jedoch nicht davon überzeugen. Sie ist mit ihrem Restaurant verheiratet. Und du, Henri?«
»Ich habe geheiratet, einige Monate nachdem ich Paris verlassen hatte. Colette lernte ich auf einem Trödelmarkt kennen. Sie machte hier in der Gegend Urlaub und war als Historikerin besessen von der Geschichte des Mont-Saint-Michel. Sie besuchte den Berg jeden Tag. Ansonsten schwamm sie bei jedem Wetter im Meer und stöberte auf Märkten nach antiken Möbeln. Sie war sehr charmant und sehr schön. Nach drei Jahren hat sie mich verlassen, um einen Lehrauftrag an der Universität von Bordeaux anzunehmen. Dort ist sie geboren. Durch den Schichtdienst und die vielen Überstunden musste ich sie oft alleine lassen.«
Er seufzte tief und ein wenig wehmütig.
»Unsere Tochter Caroline wohnt bei ihr, aber sie besucht mich oft. Sie ist ein zauberhaftes Mädchen und so klug wie ihre Mutter. Seit der Zeit bin ich wieder Single. Damals konnte ich mir ein Leben ohne meine Arbeit überhaupt nicht vorstellen. Das war dumm. Heute würde ich anders entscheiden.«
Lagarde nickte. Er verstand sehr gut, was sein Freund meinte.
Ein Ober trat zu ihnen und sprach Henri kurz an.
»Unser Tisch ist frei«, sagte er.
Sie gingen durch einen getäfelten bogenförmigen Durchgang, dann links durch einen schmaleren ornamentierten Türrahmen. Sie befanden sich jetzt auf der Rückseite des Hauses. Ein schmaler Wintergarten erstreckte sich über die ganze Hinterfront. Hintereinander aufgereiht standen jeweils ein Tisch mit vier Stühlen direkt neben einer niedrigen, grob behauenen Steinmauer und den Glasscheiben. Zwischen den Sitzgelegenheiten und der weiß verputzten Zwischenmauer zum Hauptgebäude waren ungefähr eineinhalb Meter Platz. In die Wand waren indirekte Leuchten versenkt, die den Anbau in goldgelbes Licht tauchten. Auf dem Fenstersims standen Kerzen in verschiedenen Größen und Farben in Kerzenständern, Gläsern, Schalen und winzigen Laternen und verursachten ein flackerndes Lichtermeer. Jenseits der Granitmauer beleuchteten weiße Strahler den dunklen murmelnden Fluss, der auf die Bucht des Mont-Saint-Michel zustrebte. Eine Terrasse, direkt neben dem Gebäude, war in den Fluss gebaut. Im Sommer war das sicherlich ein lauschiger Ort.
Sie setzten sich an den reservierten Tisch, und ein Kellner legte ihnen die Karte vor. Die Männer studierten die Speisekarte. Sie wählten als Vorspeise je ein halbes Dutzend Austern aus Cancale.
Als zweiten Gang bestellten sie gegrillten Seewolf. Lagarde wollte als Hauptgericht Ente mit Kirschen und Kartoffelkuchen, Henri entschied sich für das Lamm von den Salzwiesen mit grünen Speckbohnen. Zur Vorspeise tranken sie einen gekühlten Muscadet aus dem Loiretal.
»Sag mal, Henri, was ist eigentlich aus Chantal geworden?«, fragte Lagarde. »Ist sie noch bei der Polizei?«
Sein Freund träufelte Zitronensaft über eine Auster und schlürfte sie genüsslich.
»Nein, Philippe, sie hat den Polizeidienst quittiert. Einige Wochen nach dem Überfall des Monsters von Montmartre. Ihr Chef hat ihr professionelle psychologische Hilfe angeboten, doch die wollte sie nicht. Sie wollte nur noch weg.«
»Das kann ich verstehen«, meinte Lagarde. »Der Irre hätte ihr beinahe die Kehle durchgeschnitten.«
»Ja, natürlich«, entgegnete Henri. »Ihre Reaktion war völlig nachvollziehbar. Sie ist Hals über Kopf zu einer Tante in das Hinterland der Provence gezogen. Dort hat sie sich in einen Weinbauern verliebt. Sie haben vier Kinder zusammen. Jedes Jahr zu Weihnachten schickt sie mir eine Kiste ihres besten Rotweins.«
Der köstlich duftende Fisch wurde serviert, und sie genossen die ersten Bissen schweigend. Dann fragte Lagarde: »Bist du damals nicht auch wegen deiner kranken Mutter nach Avranches zurückgekehrt? Du wolltest in ihrer Nähe sein und dich um sie kümmern.«
»Du hast ein gutes Gedächtnis. Sie ist mit dreiundsechzig Jahren an Herzschwäche gestorben. So alt bin ich jetzt, und mit meiner Gesundheit sieht es auch nicht gut aus.«
Lagarde sah ihn erstaunt an. »Wie meinst du das?«
»Nun, ich habe wohl dieses Herzleiden geerbt. Mein Blutdruck ist viel zu hoch und trotz der Medikamente schwer einstellbar. Die Nieren sind bereits angegriffen, mein Herz auch. Wenn ich nur einige Treppen hochsteige, pumpe ich wie eine Lokomotive. Durch den Bewegungsmangel nehme ich ständig zu.«
»Das tut mir sehr leid, Henri.«
»Was soll man machen? Außerdem will ich dich während unseres schönen Essens nicht mit Details meiner Krankheit belästigen. Lass uns den Rotwein zum Fleisch aussuchen. Was hältst du von einem kräftigen Burgunder?«
»Wunderbar, eine gute Wahl.«
»Jetzt komme ich auf den Punkt, Philippe, du ahnst sicher schon, dass ich ein Anliegen habe.«
Henri probierte den Rotwein und nickte dem Kellner zu.
»Ich muss mindestens einmal in der Woche zum Kardiologen zur Herzkontrolle. Immer häufiger werde ich für mehrere Tage ins Krankenhaus eingewiesen, um die Nieren zu untersuchen und den Blutdruck einzustellen.«
Jetzt fiel bei Lagarde der Groschen. »Deine Fälle, Henri, du hast zu wenig Zeit für deine Fälle.«
»Genauso ist es, Philippe. Die Kollegen helfen mir natürlich, und meine Assistentin Violette ist sehr tüchtig und kompetent, aber sie ist eben eine Assistentin. Wir haben alles soweit im Griff, bis auf einen Fall.«
Lagarde begriff. »Der Mörder mit dem Dolch.«
Henri nickte. »Der Mörder mit dem Dolch. Über das Verbrechen wurde in allen Medien berichtet.«
»Ja, ich habe darüber in der Zeitung gelesen. Eine grausame Tat.«
»Kaltblütig und brutal in der Ausführung.«
»Warum gehst du nicht einfach in Rente und überlässt die Aufklärung deinem Nachfolger? Du musst dich um deine Gesundheit kümmern.«
»So einfach ist das nicht, Philippe. So ein Rentenantrag wird nicht von heute auf morgen bewilligt. Und aktuell bin ich für den Fall zuständig. Ich versuche in den Abendstunden und am Wochenende die verlorene Zeit nachzuholen, aber meine Kräfte reichen dafür nicht mehr aus. Hinzu kommt, dass ein enormer Druck auf mir lastet. Die Zentraldirektion in Paris will Ergebnisse sehen. Die Eltern des Opfers, steinreiche Hoteliers, verfügen über ausgezeichnete Beziehungen bis in die höchsten gesellschaftlichen und politischen Kreise. Man trifft sich jedes Jahr im Juli beim Pferderennen in Deauville. Ich glaube, die Mutter des ermordeten jungen Mannes hat mit der geschiedenen Frau des letzten Staatspräsidenten Tennis gespielt.«
Lagarde nickte. »Ich verstehe, eine unschöne Situation.«
»Da hast du den ganzen Schlamassel vornehm umschrieben. Wie schmeckt dir die Ente?«
»Sie ist hervorragend.«
»Mein Lammkarree auch, superb. Weißt du, Philippe, ich bin kein Anfänger. Zuerst hoffte ich, den Fall schnell lösen zu können. Aber es ist wie verhext. Es gibt keine Zeugen, keine Spuren, keine Indizien, einfach nichts, was uns weiterbringen könnte. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Wir tappen im Dunkeln.«
Nachdenklich schaute Lagarde auf die schwarzblaue Wasseroberfläche. Eine Entenfamilie durchschwamm in aller Ruhe den Fluss und verschwand am anderen Ufer im hohen Schilf.
»Du willst, dass ich dir helfe.«
»So ist es, Philippe. Ich bitte dich um deine Unterstützung. Ich kann das mit der zuständigen Stelle in Paris klären.«
»Davon bin ich überzeugt. Die haben sonst ein Imageproblem.«
»Genau! Also, was sagst du? Ich weiß, dass du gerne unabhängig und für dich bist. Du müsstest nicht in meinem Gästezimmer logieren oder im Hotel. Ich habe ein Strandhaus, nicht weit von hier, in Carolles. Dort wurde übrigens die Leiche des jungen Mannes gefunden. Im Feriendomizil seiner Familie. Bei meinem Haus handelt es sich um eine ehemalige ausgebaute Fischerkate. Dort kannst du wohnen. Du kannst auch mein Boot benutzen, es liegt gleich um die Ecke an der Hafenmole.«
Lagarde lächelte. »Du musst mir den Einsatz nicht schmackhaft machen, Henri. Ich helfe dir gerne und würde auch auf deinem Sofa schlafen. Es ist nur so, dass meine Lebensgefährtin Odette bald Geburtstag hat. Diesen Tag will ich mit ihr verbringen.«
Der Kellner brachte die Käseplatte. Lagarde nahm sich eine Ecke eines weichen weißen Käses und probierte.
»Der schmeckt ja köstlich.«
»Das ist Ziegenkäse hier aus der Gegend. Er zergeht einem auf der Zunge. Pass auf, Philippe, der Geburtstag ist doch kein Problem. Du lädst deine Freundin auf den Mont-Saint-Michel stilvoll zum Abendessen ein. Danach schaut ihr euch Son et Lumière an, das Lichterschauspiel. Sie wird begeistert sein.«
»Das ist eine gute Idee, Odette kennt den Berg noch nicht.«
»Na, siehst du«, erwiderte Henri und streckte seinem Freund die Hand entgegen. »Schlag ein.«
Lagarde ergriff sie und drückte sie fest.
»Jetzt können wir uns in aller Ruhe der Dessertkarte widmen«, meinte Henri schmunzelnd. »Ich favorisiere die Crêpes, flambiert mit Grand Marnier.«
Lagarde entschied sich für Profiteroles mit Vanilleeis und Schokoladensauce.
Anschließend tranken sie einen kleinen Mokka und verabredeten sich für den nächsten Nachmittag in Henris Büro.
Philippe Lagarde fuhr zurück zu seinem Hotel. Er parkte im Hof und umrundete das Grundstück. Unter einem grünen Pavillon ging er zum Haupteingang und gab den Code ein. Dann drehte er den Schlüssel im Schloss. Ein Nachtlicht brannte, und es war kein Mensch zu sehen. Leise stieg er in den zweiten Stock und ging in sein Zimmer. Dort schaltete er die Nachttischlampe ein und zog sich aus. Den Anzug hängte er an die Schranktür. Im Nebenzimmer lief der Fernseher. Er legte sich auf das Bett und knipste das Licht aus. Mit hinter dem Kopf verschränkten Armen starrte er an die dunkle Decke. Nun sollte er einen Mord aufklären. Wenn der alte Fuchs Henri bisher keine Spur hatte, musste der Fall ziemlich kompliziert sein. Er horchte in sich hinein. Hatte er nur seinem Freund zuliebe zugesagt? Nein, ganz und gar nicht. Die Nuss zu knacken reizte ihn.
Gerade fielen ihm die Augen zu, als ein Piepsen ertönte. Odette hatte eine SMS geschickt.
»Schlaf schön, mein Liebster«, stand da geschrieben.
»Küsschen von Odette, der Haubenköchin.«
Verliebt lächelnd, antwortete er sofort. Da er nicht oft SMS schrieb, brauchte er eine Weile.
»Schlaf du auch gut, schöne Haubenköchin. Ich freue mich auf dich. Bis morgen.«
Der Christrosenorden Zweiter Tag
Am nächsten Morgen unter der Dusche entschied sich der Kommissar für die Seife mit dem Rosenduft. Gut gelaunt stand er auf dem Vorleger im Badezimmer und rubbelte sich mit einem großen flauschigen Handtuch trocken. Er holte aus seinem Koffer eine hellblaue Jeans und einen kobaltblauen Pullover. Die schicken schwarzen Lederschuhe wurden eingepackt, und er schlüpfte in bequeme helle Leinenschuhe. Vor dem Badezimmerspiegel kämmte er sich die Haare und besprühte sich mit einem Eau de Toilette von Calvin Klein.
Frühstück gab es von acht bis zehn Uhr. Jetzt war es kurz nach acht, und er brauchte einen Kaffee. Den Koffer nahm er gleich mit nach unten und stellte ihn neben der Rezeption in eine Ecke, wo er niemanden störte. Nach dem Gespräch mit Henri hatte er seine Tagesplanung geändert. Der Besuch des heiligen Berges musste verschoben werden. Nach dem Frühstück würde er nach Barfleur fahren und Kleidung für mehrere Tage einpacken. Dann wollte er Odette über sein Vorhaben informieren. Sicherlich würde sie nicht begeistert sein, wenn sie sich einige Tage nicht sehen konnten, aber sie würde Verständnis dafür haben, dass er seinen alten Freund nicht im Stich lassen wollte.
Hungrig betrat er den Frühstücksraum und sah sich um. Die orange gestrichenen Wände harmonierten mit dem dunkelbraunen glänzenden Holzfußboden. An den Wänden hingen braun gerahmte filigrane Zeichnungen mit Motiven des Mont-Saint-Michel. Mehrere Tische waren bereits besetzt. Er wählte einen kleinen Tisch neben dem Fenster, der für zwei Personen gedeckt war. Da der Andrang am Büfett gerade recht groß schien, begnügte er sich zunächst mit einer Tasse Milchkaffee und musterte die Gäste. Deutsche Urlauber in Wanderkleidung waren bester Laune und ließen sich das Frühstück schmecken. Ein Geschäftsmann in dunklem Anzug saß alleine an einem Tisch und starrte mit gerunzelter Stirn auf den Bildschirm seines Laptops. In der Mitte an einem Vierertisch unterhielten sich lebhaft gestikulierend dänische Touristinnen. Vier Generationen waren vertreten, Lagarde tippte auf Großmutter, Mutter, Tochter und Enkelin, weil sie sich sehr ähnlich sahen und ganz vertraut miteinander umgingen.
Nach dem Frühstück sprach er die Frau an der Rezeption an, die Frühdienst hatte.
»Ich möchte gerne das Aquarell kaufen, das in Zimmer 24 hängt.«
»Sie meinen das Bild mit der Kapelle des heiligen Aubert? Ein junger einheimischer Künstler hat es gemalt. Im Hotel sind einige Gemälde von ihm ausgestellt, ich kann sie Ihnen zeigen, wenn Sie möchten.«
»Nein, danke. Genau dieses Bild soll es sein.«
»Ich laufe rasch nach oben und hole es für Sie.«
Lagarde zahlte mit Scheckkarte, nahm seinen Koffer und das Bild und verabschiedete sich.
Der kühle Wind blies kräftig vom Meer herüber und trieb weiße Wolken vor sich her. Lagarde steuerte sein Auto aus dem Hof, fuhr am Garten des Hotels entlang und fädelte sich an der Hauptstraße in den morgendlichen Verkehr ein.
Nach knapp zwei Stunden hatte er Barfleur erreicht. Er stellte den Renault Express in der Einfahrt ab und sperrte die Haustür auf. Dann hob er vorsichtig das Bild von der Rückbank und trug es in den ersten Stock. Er würde es bis zu Odettes Geburtstag im Gästezimmer aufbewahren.
Wieder im Erdgeschoss öffnete er die Glastür und trat auf die Terrasse. Das unruhige, bleigraue, schäumende Meer zog sich zurück, bald war Niedrigwasser. Ihm fiel ein, dass er noch seine Putzfrau Albertine anrufen musste. Er würde sie bitten, das Haus während seiner Abwesenheit zu lüften und die Pflanzen zu gießen. Ein empörtes Fauchen riss ihn aus seinen Gedanken. Ein Wildkater, der ihn vor einigen Tagen zum ersten Mal besucht hatte, saß mit vorwurfsvollem Blick neben einem leeren Porzellanschälchen. Er war grau meliert, hatte einen dicken Kopf, einen buschigen Schwanz mit schwarzen Kringeln und gelbe unergründliche Augen. Lagarde musste lachen. Durch das Geräusch aufgeschreckt, machte das Tier einen Satz rückwärts und fixierte ihn.
»Du meinst wohl, wenn du mich anfauchst, hole ich Milch für dich?«
Der Kater legte den Kopf schief.
»Da schätzt du die Lage richtig ein.«
Er nahm das Schälchen mit in die Küche, goss Milch hinein und gab ein wenig Wasser hinzu.
»Bitte schön«, sagte er und stellte das Gefäß an seinen Platz. Der Wildkater näherte sich der Milch, ohne ihn aus den Augen zu lassen, und trank.
Lagarde stand still und beobachtete ihn. Vielleicht sollte Albertine auch Katzenfutter kaufen.
»Ich werde dich Alexandre nennen«, informierte er das Tier.
Nachdem er einen größeren Koffer gepackt hatte, fuhr er zum Restaurant »Mirabelle«, um mit Odette zu sprechen. Unterwegs hielt er an seinem Lieblingsblumenladen und kaufte einen Strauß weißer Rosen für sie. Er folgte der Küstenstraße, die wie ein schmales Band nach Norden verlief. Der raue Westwind hatte die Wolken vertrieben. Die Sonne schien von einem lichtblauen Himmel. Unterhalb der Dünen lag verlassen eine weite sandige Bucht. Dahinter erstreckte sich endlos das Wattenmeer. An manchen Stellen ragten dunkle Felsformationen hervor, Priele zogen sich durch den Schlick, und Wasserlöcher bildeten kleine schwarze Teiche. Sanddisteln mit kugeligen bläulichen Dolden überwuchsen den Sattel einer Düne. Die kleinen Büsche krallten sich im Sand fest. Ein Traktor mit einem Trailer, auf den ein Fischerboot geladen war, stand einsam auf einem flaschengrünen Teppich aus Tang. Er bog von der Uferstraße nach links ab und fuhr landeinwärts. Bald erreichte er den Schotterweg, der zum Restaurant führte. Der Campingplatz, der sich rechts davon ausbreitete, hatte, obwohl es Spätherbst war, noch immer geöffnet. Etliche Autos, Wohnwagen und Wohnmobile, hauptsächlich mit deutschen und englischen Nummernschildern, standen weitläufig über das Terrain verstreut. Einige Camper, in dicke Jacken gepackt, hatten sich um einen gemauerten Grill versammelt und brutzelten ihr Mittagessen.
Odettes Wagen, ein silbernes Mercedes-Cabriolet, stand auf dem Parkplatz des »Mirabelle«. Die anderen Autos gehörten wahrscheinlich Logiergästen, die im Herbst einige Urlaubstage am Meer verbringen und vorzüglich speisen wollten. Das Mirabelle öffnete zu dieser Jahreszeit unter der Woche erst am Abend. Vor dem Haupthaus aus geschichteten grauen Granitsteinen stand der Herbstgarten in voller Farbenpracht. Rosarote Federbüsche erhoben sich zwischen hellviolettem Mönchspfeffer. Astern blühten weiß, rot und lila, und Azaleenbüsche zeigten hellrote und rosa Blüten. Blaue Hornveilchen und weiße Christrosen drängten sich in den ehemaligen Schafströgen. Das Restaurant war früher eine Schäferei gewesen, es lag gegenüber dem Haupthaus, umgeben von Eichen und Walnussbäumen. Sein kegelförmiges Dach aus Schieferplatten spitzte hinter den Zweigen hervor. Auf der Terrasse gruppierten sich um den alten Ziehbrunnen robuste, aber dennoch elegante Tische und Stühle. Gäste tranken am Wochenende den Nachmittagskaffee gerne im Garten, wenn es das Oktoberwetter erlaubte. Hinter einem niedrigen Holzzaun erstreckte sich eine weitläufige Wiese mit Apfelbäumen. Die Früchte eigneten sich hervorragend für das Keltern von Cidre. Um den imposanten runden Turm, der das Gebäude an der Nordostseite abschloss, rankte sich wilder Efeu.
Lagarde lief über eine Holztreppe in den ersten Stock und dann einige Meter über eine offene Galerie, die am Haus entlangführte. Die Tür zu den Privaträumen stand offen. Er klopfte mit der Faust an die schwere Eichenpforte und rief den Namen seiner Freundin. Odette kam aus der Küche und rieb sich die Hände an ihrer Jeans trocken. Als sie ihn sah, strahlte sie über das ganze Gesicht.
»Philippe, was für eine schöne Überraschung! Mit dir habe ich erst heute Abend gerechnet.«
»Hallo, meine Schöne, ich habe umdisponiert.«
Er umarmte sie und gab ihr einen Kuss. Dann reichte er ihr die Blumen. »Für meine bezaubernde Haubenköchin.«
»Weiße Rosen, wie schön!« Sie steckte die Nase zwischen die Blüten. »Und wie sie duften! Ich stelle sie gleich ins Wasser.«
Sie ging in die Küche und nahm aus einer Kommode eine rechteckige Vase. Mit einem kleinen scharfen Messer kürzte sie die Stiele. Dann arrangierte sie Rose für Rose in dem Gefäß und stellte es in die Mitte des Küchentisches.
»Du kommst gerade richtig zum Mittagessen. Hast du Hunger?«
»Ja, das Frühstück liegt schon lange zurück.«
Er lehnte an der Spüle und sah ihr zu. Odette werkelte auf der Arbeitsfläche. Sie trug eine weite Jeans, die auf den runden Hüften saß und die langen Beine betonte. Im Hosenbund steckte ein grüner Pullover, zu dem die gleichfarbigen Basketballschuhe gut passten. Die langen dunkelbraunen Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. In den kleinen Ohren steckten winzige goldene Kreolen. Er betrachtete ihr zartes Profil. Die fein gezeichneten Augenbrauen wölbten sich über den großen dunklen Augen mit den langen Wimpern. Ihr Mund war breit und sinnlich.
In ihrer Freizeit bevorzugte sie legere Kleidung. Für den Abend würde sie sich dann schick machen oder in ihrer Kochmontur durch die Restaurantküche und den Speisesaal wirbeln.
»Deckst du bitte den Tisch. Es gibt Andouilettes mit Kartoffelpüree und Sauerkraut.«
Sie mochte am liebsten einfache ländliche Gerichte, die schon ihre Oma für sie gekocht hatte. Andouillettes waren mit Innereien von Schwein und Kalb gefüllte Würste.
»Ach.«
Sie grinste ihn an.
»Ach«, äffte sie ihn nach. »Die Bauernmahlzeit ist zu derb für Monsieur.«
Sie wusste genau, dass man ihn mit deftigen Innereien jagen konnte.
Sie brach in ihr bezauberndes Lachen aus.
»Du solltest dein Gesicht sehen. Beruhige dich, mein Held. Ich brate dir ein saftiges Rindersteak, schön rosa in der Mitte. Im Kühlschrank habe ich noch selbstgemachte Kräuterbutter, sehr delikat, mit Knoblauch.«
Er umarmte sie von hinten und drückte ihr einen Kuss auf den Hals. Sie roch wunderbar.
»Ich danke dir, mein Engel.«
Sie runzelte die Stirn. »Sauerkraut zu Steak, das geht ja gar nicht. Ich habe heute Morgen im Treibhaus eine Gurke geerntet, du bekommst Salat als Beilage«, entschied sie, ohne ihn zu fragen. Konzentriert schälte und hobelte sie die Gurke mit beeindruckender Geschwindigkeit.
Als sein Fleisch fertig war, setzten sie sich an den Tisch und aßen. Odette schenkte sich und Lagarde Mineralwasser ein.