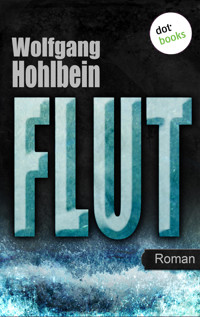4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Aufbruch ins Ungewisse: Der Mystery-Abenteuerroman „Der Kristall des Todes“ von Bestsellerautor Wolfgang Hohlbein jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Flugzeug hebt ab und verschwindet spurlos. Monate später stürzt sein notdürftig zusammengeflicktes Wrack vor einer Insel ins Meer – von den Passagieren keine Spur. Und was hat es mit den kryptischen Zeichnungen auf sich, die an Bord gefunden werden? Derweil erhält der berühmte Abenteurer Thor Garson einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll eine Expedition zu den Osterinseln unternehmen, die so geheim ist, dass er selbst kaum etwas darüber erfährt! Voller Fragen bricht Thor Garson auf, um die letzten Geheimnisse der Menschheit zu lüften – und gerät unversehens zwischen feindliche Fronten … Wem kann er jetzt noch trauen? Packend, spannend, mysteriös – die Kultserie für alle Fans von Indiana Jones und Lara Croft! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der vierte Roman der Thor Garson-Serie „Der Kristall des Todes“ von Wolfgang Hohlbein. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Flugzeug hebt ab und verschwindet spurlos. Monate später stürzt sein notdürftig zusammengeflicktes Wrack vor einer Insel ins Meer – von den Passagieren keine Spur. Und was hat es mit den kryptischen Zeichnungen auf sich, die an Bord gefunden werden? Derweil erhält der berühmte Abenteurer Thor Garson einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll eine Expedition zu den Osterinseln unternehmen, die so geheim ist, dass er selbst kaum etwas darüber erfährt! Voller Fragen bricht Thor Garson auf, um die letzten Geheimnisse der Menschheit zu lüften – und gerät unversehens zwischen feindliche Fronten … Wem kann er jetzt noch trauen?
Packend, spannend, mysteriös – Die Kultserie für alle Fans von Indiana Jones und Lara Croft!
Über den Autor:
Wolfgang Hohlbein, 1953 in Weimar geboren, ist Deutschlands erfolgreichster Fantasy-Autor. Der Durchbruch gelang ihm 1983 mit dem preisgekrönten Jugendbuch MÄRCHENMOND. Inzwischen hat er 150 Bestseller mit einer Gesamtauflage von über 44 Millionen Büchern verfasst. 2012 erhielt er den internationalen Literaturpreis NUX.
Die Romane der Die Abenteuer des Thor Garson-Reihe
Dämonengott Das Totenschiff Der Fluch des Goldes Der Kristall des Todes Das Schwert der Finsternis erscheinen bei dotbooks.
Wolfgang Hohlbein veröffentlicht bei dotbooks auch die folgenden eBooks:
Azrael Azrael – Die Wiederkehr Almanach des Grauens (mit Dieter Winkler)Fluch – Schiff des Grauens Das Netz Im Netz der Spinnen sowie die ELEMENTIS-Trilogie mit den Einzelbänden Flut, Feuer und Sturm und die große ENWOR-Saga
Die Jugendromane Nach dem großen Feuer, Der weiße Ritter: Wolfsnebel, Der weiße Ritter: Schattentanz, Drachentöter, Ithaka
und Kinderbücher Teufelchen, Saint Nick – Der Tag, den dem der Weihnachtsmann durchdrehte, NORG: Im verbotenen Land und NORG: Im Tal des Ungeheuers erscheinen ebenfalls bei dotbooks.
Wolfgang Hohlbein im Internet: www.hohlbein.de
***
eBook-Neuausgabe März 2018
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Verlag Carl Ueberreuter, Wien
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Tanja Winkler, Weichs
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (aks)
ISBN 978-3-96148-229-0
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Kristall des Todes an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wolfgang Hohlbein
Der Kristall des Todes
Die Abenteuer des Thor Garson – Vierter Roman
dotbooks.
DIE INSEL DER GÖTTER MITTE DES VORIGEN JAHRHUNDERTS
Noch vor zehn Minuten hätte er es nicht geglaubt, nicht um alles in der Welt; und wenn es ihm der Konstrukteur dieses Flugzeugs, der Chefingenieur und noch dazu die Gebrüder Wright und Otto Lilienthal zusammen in die Hand und beim Augenlicht ihrer Kinder versprochen hätten. Es war einfach unmöglich. Kein Flugzeug konnte diesen Absturz überstehen, von den Passagieren gar nicht zu reden.
Tressler hatte zwar in einem Augenblick der Verwirrung das Wort »Notlandung« benutzt, aber es war ein Absturz gewesen, ein Bilderbuch-Absturz sogar. Jonas hatte nach der siebten oder achten Rolle aufgehört zu zählen, wie oft sich das Flugzeug überschlug. Außerdem brauchte er seine ganze Kraft, sich irgendwo festzuklammern, um nicht wie der unglückselige Meyers quer durch die Maschine geschleudert zu werden und sich den Schädel einzuschlagen. Dabei sah er dann noch, dass in dem schwarzen Toben des Sturmes vor den Fenstern Metall schimmerte; und zumindest eines dieser davonwirbelnden Trümmerstücke hatte eine verdächtige Ähnlichkeit mit der rechten Hälfte des Leitwerks, die sich eigentlich zusammen mit der linken Hälfte am Ende des Flugzeugs hätte befinden sollen. Nein – sie konnten diesen Absturz gar nicht überstehen.
Aber genau das hatten sie.
Das Flugzeug hockte groß und fett im seichten Wasser der Lagune. Ein bisschen zerrupft und einer entschieden größeren Zahl von Teilen beraubt als nur des halben Leitwerks, aber trotzdem in einem Stück, und bis auf den unglückseligen Meyers und Seider, der sich das rechte Bein gebrochen hatte, waren sie alle mit Schrammen und Kratzern und Prellungen davongekommen; davon hatten sie allerdings reichlich abbekommen. Es gab keine Stelle an seinem Körper, die nicht wehtat, brannte oder sich taub anfühlte.
Das unregelmäßige Geräusch schwerer Schritte ließ Jonas aufsehen. Er wusste, dass Bell hinter ihm aufgetaucht war, noch ehe er sich herumgedreht und in das Gesicht des weißhaarigen Alten geblickt hatte. Der Engländer zog das rechte Bein nach, aber das verdankte er nicht dem Absturz, sondern einem Granatsplitter, den er sich während seiner Zeit als Sanitätsoffizier im Ersten Weltkrieg eingefangen hatte. Während der letzten Tage, die sie zusammen in dem schmuddeligen Hotel auf Pau-Pau verbracht und auf das Postflugzeug gewartet hatten, war Bell ihm mit seinen Kriegsgeschichten dermaßen auf den Nerv gefallen, dass Jonas ein paarmal kurz davor gewesen war, seine gute Erziehung zu vergessen und grob zu werden. Jetzt war er sehr froh, dass sie ihn dabeihatten. Er erwiderte Bells Kopfnicken mit einem Lächeln und machte gleichzeitig eine einladende Geste, sich neben ihn zu setzen.
»Wie geht es Seider?«, fragte er, als der Engländer sich neben ihn ins Gras sinken ließ und umständlich das steife Bein zurechtrückte.
»Er behauptet das Gegenteil, aber ich weiß, dass er ziemliche Schmerzen hat«, antwortete Bell besorgt. »Wenn er Fieber bekommt, dann weiß ich nicht, ob ich etwas für ihn tun kann.«
Jonas verzog besorgt das Gesicht. Er mochte den jungen Australier und er hatte dessen Bein gesehen. Es war kein glatter Bruch. Wenn es Komplikationen gab, dann würden sie ihn verlieren, denn ihr Erste-Hilfe-Kasten lag zusammen mit einem Teil des Flugzeugs und dem allergrößten Teil ihres Gepäcks hundert Meilen entfernt auf dem Meeresgrund. Sie hatten nicht einmal etwas, um seine Schmerzen zu lindern, geschweige denn eine Entzündung zu bekämpfen. Er war auf einmal fast sicher, dass sie Seider verlieren würden.
Trotzdem: zwei von zwölf. Seider würde das anders sehen, aber es war kein schlechter Schnitt. Sie hätten es wahrhaftig schlimmer treffen können.
»Und wie geht es Miss Sandstein?«, fragte er.
»Fräulein Sandstein«, korrigierte ihn Bell. Er lächelte flüchtig. Wie alle Engländer hatte er Schwierigkeiten mit dem deutschen »ä«, sodass es bei ihm wie »Fraulein« klang. »Sie wissen doch, wie eigen sie da ist. Es geht ihr gut. Ich glaube, ihr Arm ist nur verstaucht, nicht ausgerenkt. Sie ist eine tapfere kleine Person, unser deutsches Fräulein.«
»Die Deutschen sind überhaupt ziemlich tapfer, nicht wahr?«, sagte Jonas. Er sah Bell bei diesen Worten verstohlen von der Seite an, aber alles, was er auf dessen Gesicht entdeckte, war ein erschöpftes Lächeln.
»Ja. Sie bauen auch verdammt gute Flugzeuge.« Bell wies mit einer Kopfbewegung auf die zerbeulte Junkers im Wasser. »Gott sei Dank. Sonst wären wir jetzt alle tot.«
»Vielleicht sind wir das ja schon«, flüsterte Jonas.
Bell sah überrascht auf. »Nanu?«, fragte er. »Das sind ja ganz neue Töne, und das von Ihnen. Ich dachte immer, Sie wären von Berufs wegen Optimist.«
»Ich habe soeben gekündigt«, knurrte Jonas. Er nahm eine Handvoll Sand auf und warf sie den Abhang hinunter, aber der Wind packte sie und verwandelte sie in eine auseinandertreibende, rasch verblassende Wolke, ehe sie den Boden berührte. »Es sieht nicht besonders gut für uns aus, Mister Bell«, fügte er in etwas sanfterem Ton hinzu.
»Wir leben, oder?«
»Das ist aber auch schon alles«, antwortete Jonas. Er deutete nach Westen. Das Meer erstreckte sich blau und makellos wie ein gewaltiger geriffelter Spiegel, so weit das Auge reichte; und wie er wusste, lagen hinter dem Horizont auch noch etliche tausend Meilen. »Ist Ihnen eigentlich klar, wo wir sind?«
»Sicher«, antwortete Bell.
»So? Dann wissen Sie mehr als ich.« Jonas lächelte, aber es lag nicht viel echter Humor in diesem Lächeln. »Ich bin ziemlich sicher, dass diese Insel auf den meisten Karten nicht einmal zu sehen ist, Bell. Vermutlich sind wir überhaupt die ersten Menschen, die sie betreten haben. Wir sind bestimmt hundert Meilen von allen Schifffahrts- und Fluglinien entfernt. Unser Funkgerät liegt zusammen mit dem größten Teil unserer Ausrüstung auf dem Meeresgrund. Wir haben nichts zu essen, keine Medikamente, praktisch nichts anzuziehen und unser Navigator hat sich den Hals gebrochen; aber ansonsten haben wir wirklich richtiges Glück gehabt.«
»Zu essen gibt es auf dieser Insel sicher genug«, antwortete Bell. Er klang irgendwie eingeschüchtert. »Und bisher ist noch nicht bewiesen, dass die Insel unbewohnt ist. Sie ist ziemlich groß.«
»Stimmt«, antwortete Jonas trocken. »Vielleicht gibt es hier ja Kannibalen.«
Bell wurde ein bisschen blass um die Nase. »Sie haben eine reizende Art, Ihre Mitmenschen aufzumuntern; hat Ihnen das schon jemand gesagt?«
»Mehrmals«, antwortete Jonas, stand auf, nickte Bell noch einmal flüchtig zu und begann vorsichtig die steile Böschung hinunterzubalancieren. Er hatte das Gefühl, dass er mit Bell in Streit geraten würde, wenn er bliebe, und das wollte er nicht, denn Bell konnte schließlich nichts dafür. Niemand konnte etwas dafür. Der Sturm war ohne jede Vorwarnung losgebrochen.
Sie hätten auch in einem weitaus größeren Flugzeug keine Chance gehabt. Niemand konnte etwas dafür.
Trotzdem – wenn sie hier nicht wieder wegkamen und wenn sie hier nicht bald wegkamen, dann waren mehr als drei Jahre Arbeit umsonst gewesen. Es war zum Verzweifeln! Alles hatte er geschafft. Eine perfekte Tarnung aufgebaut. Feindliche Agenten gleich zu Dutzenden getäuscht. Alle nur vorstellbaren (und ein paar eigentlich unvorstellbare) Sicherheitsvorkehrungen durchschaut und überwunden – und dann kam so ein verdammter Sturm und machte alles zunichte!
Er verscheuchte den Gedanken und ging mit weit ausgreifenden Schritten über den feinen weißen Sandstrand auf das Flugzeug zu. Es war ein wirklich prachtvoller Strand, dachte Jonas sarkastisch, schneeweiß, unberührt und gut anderthalb Meilen breit. Das Wasser war so klar, dass man noch fünfzig Meter vom Ufer entfernt den Meeresboden sehen konnte. Ein perfekter Ort, um Urlaub zu machen. Aber das konnten sie jetzt ja, wenn sie Pech hatten, die nächsten fünfzig Jahre.
Aus dem Flugzeug drang ein helles, unrhythmisches Klopfen und Hämmern, und als Jonas durch das knietiefe Wasser auf die Tür zuging, erschien ein Paar ölverschmierter, kräftiger Hände über dem Rand der offen stehenden Motorhaube, gefolgt von zwei kaum weniger öligen Armen und Schultern und einem nur unwesentlich weniger schmutzigen Gesicht, das Jonas im Grunde nur an dem rot-weiß gemusterten Halstuch erkannte – so etwas wie Tresslers Markenzeichen.
»Hallo, Jonas!«, begrüßte ihn der Pilot und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Eine wellenförmige Bewegung lief über die schwarze Schmiere auf seinem Gesicht. Jonas nahm an, dass es ein Lächeln war. »Wie sieht es aus?«
»Dasselbe wollte ich Sie auch gerade fragen«, gab Jonas zurück, beantwortete Tresslers Frage aber trotzdem: »Perkins und ein paar von den anderen sind vor einer Stunde losgezogen, um die nähere Umgebung zu erkunden. Sie sind aber noch nicht zurück. Ist das ein gutes Zeichen? Sie sind schließlich der Spezialist für die Inselwelt hier, nicht ich.«
»Danke, zu viel der Ehre.« Tressler zog eine Grimasse und schwang sich ächzend aus den mechanischen Eingeweiden des Flugzeugs heraus. Jonas wich automatisch einen Schritt zurück, als er platschend im Wasser landete und dort in die Hocke ging. Tresslers Versuche, sich mit nichts anderem als Salzwasser die Schicht aus Maschinenöl und Schmiere von der Haut zu waschen, sahen irgendwie nicht sonderlich vielversprechend aus, fand Jonas.
»Die meisten dieser Inseln sind unbewohnt«, fuhr Tressler nach einer Weile fort. »Und selbst wenn nicht, brauchen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Die Polynesier sind ein sehr freundliches Volk. Jedenfalls waren sie das einmal, bevor sie von den Weißen entdeckt und zivilisiert wurden.« Er rieb heftig die Hände unter Wasser. Dunkle Schlieren begannen sich wie Rauch in dem glasklaren Salzwasser zu verteilen, bis er in einer schwarzen Wolke saß, als hätte er auf einen Tintenfisch getreten. Seine Hände waren allerdings kein bisschen sauberer, als er sich schließlich wieder aufrichtete.
»Ich würde es mit Sand versuchen«, schlug Jonas vor.
Tressler schien einen Moment lang ernsthaft über diesen Vorschlag nachzudenken, aber dann schüttelte er den Kopf. »Das lohnt sich nicht«, sagte er. »Ich werde noch eine ganze Weile an dem Ding herumbasteln müssen. Das gibt noch oft schmutzige Hände.«
Jonas betrachtete nachdenklich die verbeulte Junkers. Der Anblick dieser plumpen Maschine hatte ihm schon kein Vertrauen eingeflößt, als sie noch völlig in Ordnung gewesen war. Auf die Idee, ein Flugzeug aus Wellblech zu bauen, konnten auch wirklich nur deutsche Ingenieure kommen!
»Kriegen Sie sie wieder hin?«, fragte er.
»Der Motor ist in Ordnung«, antwortete Tressler. Jonas sah ihn zweifelnd an und der Pilot fügte hastig hinzu: »Jedenfalls ist nichts kaputt, was ich nicht in ein paar Stunden selbst reparieren könnte. Das abgerissene Leitwerk macht mir Sorgen.«
»Kommen wir hier nun wieder weg oder nicht?«, fragte Jonas.
Seine Stimme klang schärfer, als er beabsichtigt hatte. Tressler blinzelte verstört. Aber er ging nicht auf Jonas’ unangemessen rüden Ton ein, sondern zuckte nur mit den Schultern.
»Ich weiß es nicht«, antwortete er. »Ich verstehe zwar ein bisschen was von Motoren, aber ich bin Pilot, kein Mechaniker. Perkins ist Ingenieur und will mir helfen irgendetwas zusammenzubasteln, aber ob es hält und ob wir damit hochkommen und auch oben bleiben, das wissen die Götter.«
Plötzlich lachte er, trat auf Jonas zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Kopf hoch. Ich bin schon in schlimmeren Situationen gewesen und bisher immer mit heiler Haut davongekommen. Und wenn alle Stricke reißen, haben wir immer noch einen Trost.«
»So?«, fragte Jonas ärgerlich. Er musste sich beherrschen, um Tresslers Hand nicht grob abzustreifen. »Und welchen?«
Tressler grinste. »Nun, dies ist doch ein paradiesisches Fleckchen Erde«, sagte er. »Wir können hier jahrelang überleben, wenn es sein muss. Es gibt auf diesen Inseln Nahrung im Überfluss, frisches Wasser und kaum wilde Tiere und das Wetter ist fast immer gut. Und wir haben noch einen gewaltigen Vorteil.« Er grinste. »Ich habe mindestens fünf Mal ›Robinson Crusoe‹ gelesen. Sie nicht?«
Drei Tage später begann sich Jonas zu wünschen, es wenigstens ein Mal gelesen zu haben. Sie hatten die Insel erforscht, soweit ihnen dies möglich gewesen war, und Tressler hatte zusammen mit Perkins das Flugzeug repariert – ebenfalls, soweit es ihnen möglich gewesen war. Das Ergebnis ihrer Bemühungen sah ungefähr so aus wie ihre Zukunftsaussichten: abenteuerlich, aber nicht besonders vertrauenerweckend. Jonas jedenfalls war nicht wohl bei dem Gedanken, sich an Bord eines Flugzeugs begeben zu müssen, dessen Heck aus Draht, behelfsmäßig zugeschnittenen Wellblechstücken und allen möglichen anderen zusammenimprovisierten Ersatzteilen bestand.
Vielleicht würde er das aber gar nicht müssen. Tressler war in den letzten beiden Tagen jedes Mal wortkarger geworden, wenn Jonas ihn auf den Fortschritt seiner Arbeit angesprochen hatte.
Aber sie konnten auch nicht auf der Insel bleiben.
Jedenfalls nicht annähernd so lange, wie Tressler (und im Grunde auch Jonas) anfangs geglaubt hatte. Ihre Lage sah nicht sehr rosig aus. Seider war am Morgen gestorben, und die Insel war weder so groß noch so fruchtbar, wie sie gehofft hatten. Der Dschungel, der hier gleich hinter ihrem Lagerplatz begann, zog sich wie ein schier undurchdringlicher Wall am Strand entlang, aber er war nicht einmal eine Meile tief und endete vor einer Felswand, die die gesamte Insel zu teilen schien. Sie wussten nicht, was auf der anderen Seite lag, denn die Wand war mindestens dreißig Meter hoch und so glatt, dass an ein Überklettern ohne entsprechende Ausrüstung gar nicht zu denken war.
Jonas nahm einen tiefen, genießerischen Zug aus seiner letzten Zigarette, schnippte den Stummel ins Feuer und warf einen Blick in die Runde. Mit Ausnahme von Tressler und Perkins, die wie üblich unten am Strand waren und am Flugzeug herumbastelten, saßen sie alle zusammen, seit einer guten Stunde schon. Kaum jemand hatte bisher ein Wort gesprochen. Seiders Tod hatte sie alle tief getroffen. Nicht, weil er ein besonders guter Freund gewesen wäre. Im Grunde waren sie allesamt Fremde, die nur durch eine Laune des Schicksals hier zusammengewürfelt worden waren, und trotz einer Situation wie der ihren hatten drei Tage nicht ausgereicht, um so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufkommen zu lassen. Sein Tod hatte ihnen gezeigt, wie verwundbar sie waren. Ihre Umgebung sah auf den ersten Blick aus wie ein Paradies. Aber ein gebrochenes Bein bedeutete hier den Tod.
Jonas saß direkt neben Adele Sandstein, der kleinen deutschen Lady, die er vielleicht als Einzige in den letzten drei Tagen ein wenig ins Herz geschlossen hatte; daneben Bell, Stotheim, ein holländischer Kaufmann, der seit ihrer Notlandung fast kein Wort gesprochen hatte (vorher übrigens auch nicht), Anthony und Steve van Lees, zwei australische Brüder, Zwillinge sogar, die sich so unähnlich waren, wie es zwei Männer nur sein konnten, und sich praktisch ununterbrochen stritten; und schließlich waren da Stan Barlowe und seine mindestens zwanzig Jahre jüngere Frau, ein dummes Huhn, dessen gesamtes Vokabular aus nur zwei Lauten zu bestehen schien: hysterischem Gekreisch und albernem Kichern. Eine feine Truppe, um auf einer unbewohnten Insel am Rande der Welt ein neues Bollwerk der Zivilisation zu gründen, dachte Jonas sarkastisch.
Vielleicht war es doch ungefährlicher, sich Tresslers zusammengepflastertem Flugzeug anzuvertrauen ...
Er schob den Gedanken beiseite und wandte sich an die beiden Australier. »Wie weit sind Sie dem Bach gefolgt?«, fragte er.
Sie hatten am Vormittag ein Rinnsal entdeckt, das kaum den Namen Bach verdiente. Aber immerhin würde es sie mit Trinkwasser versorgen. Die beiden ungleichen Brüder hatten sich angeboten, seinem Lauf zu folgen; vielleicht entdeckten sie ja einen See oder einen Platz, an dem sie sich auf Dauer einrichten konnten. So malerisch es hier war, wenn man genau hinsah, erkannte man die Spuren, die Stürme und Springfluten im Laufe der Jahre im Dschungel hinterlassen hatten. Ein guter Platz für ein paar Tage, aber nicht für Wochen oder gar Monate.
Die Antwort der beiden Männer bestand nur aus einem Nicken des einen und einem Kopfschütteln des anderen: Ja, sie waren dem Bach gefolgt, und nein, sie hatten nichts gefunden, was ihnen irgendwie weiterhalf.
Es war Bell, der schließlich aussprach, was sie wohl alle dachten: »Wir sollten jemanden über die Felswand schicken. Vielleicht sieht es auf der anderen Seite besser aus.«
»Vielleicht lebt dort ja jemand«, sagte Barlowe.
»Ja«, sagte Jonas sarkastisch. »Vielleicht haben wir ja El Dorado wiedergefunden und es nur noch nicht gemerkt.«
»Seien Sie nicht so zynisch, junger Mann.«
Junger Mann? Jonassah Adele Sandstein einen Moment lang verwirrt an. Wenn er in einem Monat noch lebte, würde er seinen fünfzigsten Geburtstag feiern. Aber wer erst einmal ein Alter wie Adele Sandstein erreicht hatte, durfte wohl mit Fug und Recht jeden einen jungen Mann nennen, der noch ein bisschen jünger als Methusalem war. »Schon gut«, knurrte er. »Es war nicht so gemeint. Wir sind alle ein bisschen nervös.«
»Das mag stimmen«, sagte Adele Sandstein streng. »Aber das ist kein Grund, seine gute Erziehung zu vergessen, Herr Jonas. Oder grob zu werden. Ich glaube nämlich, dass Herr Barlowe recht hat.«
»Und wie kommen Sie auf diesen Gedanken, wenn ich fragen darf?« Jonas war nicht der Einzige, der sie anblickte und sich dabei bemühte, nicht allzu spöttisch auszusehen. Und Fräulein Sandstein schien dies keineswegs zu entgehen, denn für einen ganz kurzen Moment blitzte es verärgert in ihren Augen auf. Aber sie hatte sich wie immer perfekt in der Gewalt.
»Ich meine«, fuhr Jonas mit einer Geste in die Runde fort, »niemand von uns hat bisher auch nur den geringsten Anhaltspunkt dafür gefunden, dass es auf dieser Insel menschliches Leben gibt. Sie vielleicht?«
»Das habe ich in der Tat«, antwortete Adele Sandstein ruhig.
Hätte sie plötzlich eine Handgranate unter ihrem Kleid hervorgezogen und ins Feuer geworfen – der Schock hätte kaum größer sein können. Alle starrten sie an. Es wurde so still, dass man beinahe die berühmte Stecknadel fallen hören konnte.
»Wie bitte?«, fragte Jonas schließlich. Er versuchte zu lachen, aber es wollte ihm einfach nicht gelingen. »Sie haben ... Spuren gefunden, Miss ... Fräulein Sandstein?«
»Wann war das?«, fragte der ältere der beiden Australier.
»Und wo?«, fügte der jüngere hinzu.
Jonas hob hastig die Hand und brachte sie zum Schweigen.
Dann wiederholte er wörtlich die Fragen der beiden Brüder, was ihm einen verärgerten Blick der beiden Australier und einen eher amüsierten von Fräulein Sandstein einbrachte. Sie antwortete trotzdem.
»Heute Morgen, als ich unten am Strand war. Sie alle haben noch geschlafen, aber ich war bereits wach. In meinem Alter braucht man nicht mehr so viel Schlaf, müssen Sie wissen. Ich wollte niemanden stören, deshalb ging ich hinunter zum Strand. Und dort habe ich die Spuren gesehen.«
»Menschliche Spuren?«, fragte Jonas überflüssigerweise.
»Wie viele waren es?«, fügte Bell hinzu.
»Zwei«, antwortete Adele Sandstein nach kurzem Überlegen. »Jedenfalls ... glaube ich das. Es können auch mehr gewesen sein. Aber zwei ganz bestimmt.«
»Aber warum haben Sie nichts davon gesagt?« Jonas gab sich keine besondere Mühe, seinen zunehmenden Ärger zu verhehlen. Zumindest redete er sich selbst ein, dass das unbehagliche Gefühl, das sich immer mehr in ihm ausbreitete, Ärger war und nicht Furcht.
»Ich ... hielt es nicht für so wichtig«, gestand Fräulein Sandstein verlegen.
»Nicht wichtig!« Jonas riss ungläubig die Augen auf. »Sie hätten –«
»Und ich hatte Angst, dass Sie mir nicht glauben würden«, fuhr sie etwas lauter fort. »Die Flut löschte die Spuren aus und ... und da war noch etwas.«
»Noch etwas?« Jonas legte den Kopf schräg und sah die weißhaarige alte Dame neben sich aufmerksam an. »Was?«
Es war ihr anzumerken, wie schwer ihr die Antwort fiel. Sie wich seinem Blick aus. »Die Spuren führten nur in eine Richtung«, sagte sie schließlich.
»Wie meinen Sie das?«, fragte Barlowe.
»Sie führten nur ins Wasser hinein«, antwortete Adele Sandstein. »Nicht wieder heraus.«
»Sie werden ein Boot gehabt haben«, sagte Barlowes Frau. Nicht nur Jonas sah die schlanke Wasserstoffblondine überrascht an. Die Erklärung war so naheliegend und einfach, dass er sich beinahe ärgerte, nicht längst selbst darauf gekommen zu sein.
Aber Adele Sandstein schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie leise. Sie sah niemanden an, als sie weitersprach, sondern blickte aus beinahe starren Augen ins Feuer. »Das dachte ich auch, im ersten Moment. Aber dann ... habe ich ihn gesehen.«
»Wen?«, fragte Jonas.
»Den Riesen«, antwortete Adele Sandstein.
Tressler und Perkins kamen eine halbe Stunde später vom Strand hoch. Als Perkins von Sandsteins angeblicher Beobachtung erfuhr, reagierte er genauso, wie Jonas es erwartet hatte: Er schüttelte nur den Kopf, tippte sich bezeichnend an die Stirn, als er sicher war, dass sie nicht in seine Richtung blickte, und setzte sich dann wortlos ans Feuer. Tressler schien nicht ganz so amüsiert. Im Gegenteil: Auf seinem Gesicht erschien ein beinahe besorgter Ausdruck.
»Riesen?«, vergewisserte er sich.
»Ich sagte nicht Riesen«, verbesserte ihn Sandstein. »Ich sprach von einem Riesen, Herr Tressler.«
Der Pilot sah eine Weile ernst auf sie hinab und dann blickte er noch länger und irgendwie ... erschrocken in die Richtung, wo der Dschungel die Felswand verbarg. Aber er sagte nichts, sondern setzte sich schließlich nur wortlos zu den anderen ans Feuer.
Perkins war seine Reaktion allerdings nicht verborgen geblieben. »Was ist los mit dir?«, fragte er grinsend. »Du glaubst den Unsinn doch nicht etwa?«
»Ich ... habe übrigens auch etwas gesehen«, antwortete Tressler zögernd. »Während der Landung.«
»Einen Riesen?« Perkins’ Grinsen wurde noch breiter. »Oder war es vielleicht ein Drache oder eine siebenköpfige Seeschlange?«
Jonas brachte ihn mit einem eisigen Blick zum Verstummen. »Was haben Sie gesehen, Mister Tressler?«, fragte er.
»Ich ... bin nicht sicher«, antwortete der Pilot ausweichend. »Irgendetwas im Wasser. Es ging alles so schnell, und ich hatte alle Hände voll zu tun, uns heil hinunterzubringen, deshalb habe ich kaum darauf geachtet, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Aber ich weiß noch, dass ich ziemlich erschrocken war.« Er sah auf. »Ich glaube, Meyers hat es deutlicher gesehen. Er schrie irgendetwas wie: Das darf doch nicht wahr sein! oder so ähnlich, bevor –«
»– er sich das Genick gebrochen hat«, fiel ihm Perkins ins Wort. »Wie praktisch: Der einzige Zeuge ist tot!«
Tressler wandte sich ihm mit einem zornigen Ruck zu. Seine Hände zuckten und seine Lippen wurden zu einem dünnen, blutleeren Strich. Er sagte kein Wort, aber Jonas sah, dass es in seinen Augen zornig aufblitzte. Meyers und er waren Freunde gewesen.
»Was macht das Flugzeug?«, fragte er rasch, ehe Perkins weiterreden und womöglich noch mehr Schaden anrichten konnte.
Tresslers Hände sanken langsam wieder in seinen Schoß. Er entspannte sich sichtbar, und als er sich zu Jonas umwandte, glaubte der fast so etwas wie Dankbarkeit in seinem Blick zu erkennen. »Wir sind fertig«, sagte er.
»Fertig?« Bell richtete sich kerzengerade auf und auch die anderen sahen den Piloten verblüfft an.
»So weit wir sie reparieren konnten«, sagte Tressler hastig. »Das bedeutet nicht, dass sie in Ordnung ist. Aber für alles andere bräuchte ich Ersatzteile und eine richtige Werkstatt.«
»Aber sie fliegt?«, vergewisserte sich Barlowe.
Tressler schwieg einen Moment. Schließlich zuckte er mit den Schultern, nickte aber absurderweise gleichzeitig. »Ich glaube schon«, sagte er. »Ich müsste sie hochbekommen. Aber es ist gefährlich. Ich weiß nicht, wie lange die Verspannungen halten, die Perkins und ich gebaut haben. Ein kräftiger Windstoß und ...« Er machte eine Handbewegung, als würde etwas auseinanderplatzen, und ließ den Rest des Satzes offen.
»Was heißt das?«, fragte einer der beiden Australier. »Kommen wir hier nun weg oder nicht?«
Tressler wollte auffahren, aber Jonas brachte ihn mit einer raschen Handbewegung zum Schweigen und drehte sich betont langsam zu den beiden Brüdern um. »Natürlich können Sie hier weg«, sagte er freundlich. »Nur kann Ihnen niemand garantieren, wo Sie landen werden, mein Freund. Auf Pau-Pau oder auf dem Meeresgrund.«
Der Australier wurde sichtlich blass, aber er sagte nichts mehr und Jonas wandte sich wieder an Tressler. »Sie glauben also, dass Sie aufsteigen könnten?«
Der Pilot nickte zögernd. Er sah nicht sehr begeistert aus. Aber vielleicht war er auch nur müde. Während der letzten drei Tage hatte er kaum geschlafen, sondern fast ununterbrochen an seinem Flugzeug gearbeitet.
»Und wie schätzen Sie Ihre Chance ein?«, fragte Jonas. Tressler überlegte einen Moment. »Wenn das Leitwerk hält und ich nicht in einen Sturm gerate ... nicht einmal so schlecht. Der Treibstoff reicht noch für gut dreihundert Meilen.«
»Dann riskieren wir es!«, sagte Barlowe aufgeregt. »Was haben wir denn noch zu verlieren?«
»Zum Beispiel unser Leben, Mister Barlowe«, sagte Tressler ruhig. »Sie haben nicht richtig zugehört. Ich sagte: wenn. Und ich weiß noch nicht einmal, ob ich die Kiste überhaupt hochbekomme.« Er machte eine Geste in die Richtung, aus der das Rauschen der Brandung in der Dunkelheit herüberdröhnte. »Dort draußen herrscht ein ziemlicher Seegang und es gibt ein paar tückische Riffe. Ich habe weniger als eine Meile, um den Vogel aus dem Wasser zu bekommen. Unter normalen Umständen wäre das wahrscheinlich kein Problem. Aber im Moment stehen die Chancen fünfzig zu fünfzig, dass die Maschine auseinanderbricht, sobald ich sie aus dem Wasser hebe.«
Barlowe starrte ihn an. »Und was ... bedeutet das?«, fragte er stockend.
»Dass wir hierbleiben werden«, sagte Jonas an Tresslers Stelle.
»Wie bitte?« Barlowe klang fast feindselig.
»Sie haben doch gehört, was er gesagt hat, oder?«, fragte Jonas.
Er sah Barlowe an, aber er war sich auch der Blicke bewusst, mit denen die anderen ihn maßen. Im Moment waren sie einfach viel zu verblüfft über das, was er gesagt hatte. Doch das würde nicht lange so bleiben. »Abgesehen von dem Risiko, das der Flug darstellt, ist nicht einmal gesagt, dass der Start gelingt, Barlowe. Jedes Pfund Gewicht mehr, das er mitnimmt, kann schon zu viel sein. Tressler fliegt und Perkins hilft ihm, falls er dazu bereit ist, als Navigator und wo sonst nötig. Und wir bleiben hier.«
»Sie ... Sie müssen den Verstand verloren haben!«, sagte Barlowe stockend. »Wir haben ein Flugzeug und eine gute Chance, von hier wegzukommen, und Sie erwarten allen Ernstes, dass ich hierbleibe und in aller Ruhe zusehe, wie es abfliegt?«
Jonas antwortete nicht gleich. Er spürte, wie viel von den nächsten Worten abhing, die er sagte. Sie alle hatten gehört, wie Tressler ihre Chancen einschätzte, aber Menschen in verzweifelten Situationen neigen dazu, Risiken zu unter- und ihr Glück zu überschätzen.
»Was haben wir schon zu verlieren, Barlowe?«, fragte er so ruhig wie möglich. »Wenn Tressler und Perkins es schaffen, dann ist in spätestens zwei Tagen ein Schiff oder ein anderes Flugzeug hier, das uns abholt. Und wenn nicht, dann leben wir wenigstens noch.« Er warf Tressler einen raschen Blick zu, um sich für diese Worte zu entschuldigen, aber der Pilot nickte nur. Er hatte verstanden. Perkins hatte glücklicherweise gar nicht zugehört.
»Zwei Tage, Barlowe«, sagte Jonas noch einmal. »Wollen Sie wirklich Ihr Leben und das Ihrer Frau riskieren, nur um zwei Tage früher wieder in diesem verwanzten Hotel auf Pau-Pau zu sein?«
Barlowe antwortete noch immer nicht. In seinem Gesicht arbeitete es. Doch im selben Moment bekam Jonas von unerwarteter Seite Hilfe.
»Herr Jonas hat völlig recht, Herr Barlowe«, sagte Adele Sandstein. »Es wäre sehr unvernünftig, ein solches Risiko einzugehen. Und noch dazu unverantwortlich. Uns allen gegenüber. Sie schmälern unsere Chancen, hier wegzukommen, wenn Sie das Gewicht des Flugzeugs erhöhen. Das ist doch so, oder?«
Sie sah Tressler fragend an und der Pilot nickte. »Ja. Jedes Pfund Gewicht kann schon zu viel sein.«
Und das war die Entscheidung. Barlowe protestierte weiter, aber nicht nur Jonas spürte, dass er es im Grunde nur noch tat, um sein Gesicht zu wahren und sich nicht kampflos geschlagen zu geben. Auch die anderen fügten sich – widerwillig – Jonas’ und Tresslers Argumenten. Schließlich schlug Jonas vor, die Diskussion zu beenden und schlafen zu gehen.
Sie würden am nächsten Morgen früh herausmüssen, denn Perkins hatte vorgeschlagen, das Flugzeug vollkommen leer zu räumen, um jedes Gramm überflüssiges Gewicht zu sparen.
Tressler brauchte für seinen Flug jede Minute Tageslicht, die er bekommen konnte.
Obwohl es sein eigener Vorschlag war, fand Jonas keinen Schlaf. Er lag länger als eine Stunde mit geschlossenen Augen da und wartete, dass Erschöpfung und Müdigkeit ihren Dienst taten, aber seine Gedanken waren zu sehr in Aufruhr. Schließlich resignierte er, öffnete die Augen und setzte sich behutsam wieder auf; sehr leise, um keinen der anderen zu wecken.
Das Feuer war zu einem dunkelroten Gluthaufen heruntergebrannt, der kaum Wärme und noch weniger Licht spendete, doch es war trotzdem nicht völlig dunkel, denn am Himmel stand keine einzige Wolke. Und in zwei Nächten würde Vollmond sein, sodass der Dschungel in einen silberblauen, unwirklichen Schimmer getaucht dalag. Der Anblick war bizarr, fremdartig – und beunruhigend.
Es war nicht das erste Mal, seit sie hier gestrandet waren, dass Jonas dieses Gefühl überkam. Bisher hatte er es einfach auf die äußeren Umstände geschoben und ein wenig auch auf die Tatsache, dass er innerlich keineswegs so ruhig und gelassen war, wie er tat, sondern genauso viel Angst hatte wie alle anderen.
Aber vielleicht war das nicht der einzige Grund. Fräulein Sandsteins Worte – und vor allem das, was Tressler dazu gesagt hatte – hatten ihn mehr beunruhigt, als er zugeben wollte. Natürlich glaubte er nicht wirklich an Riesen oder dergleichen Unsinn. Aber irgendetwas ... stimmte hier einfach nicht. Er hatte es vom allerersten Moment an gespürt und er war plötzlich fast sicher, dass es den anderen genauso erging und dass das der wahre Grund für die gereizte Stimmung war, die seit drei Tagen hier herrschte.
Hinter ihm knackte etwas, wie ein Zweig, der unter einem Schuh zerbricht. Jonas fuhr zusammen, drehte sich erschrocken um und schrak ein zweites Mal und noch heftiger zusammen, als er einen schwarzen Schatten am Waldrand gewahrte.
Aber noch ehe er etwas sagen konnte, hob die Gestalt in einer eindeutigen Geste einen Finger an den Mund, und in derselben Sekunde erkannte Jonas auch, um wen es sich bei dem Schatten handelte. Offenbar war er nicht der Einzige, der in dieser Nacht keinen Schlaf gefunden hatte.
So leise, wie es ihm möglich war, stand er auf und ging zu Tressler hinüber. Der Pilot bedeutete ihm erneut, still zu sein, und Jonas folgte ihm bereitwillig schweigend ein gutes Dutzend Schritte in den Dschungel hinein, bis sie sicher waren, keinen der anderen zu wecken.
»Tressler!«, flüsterte er überrascht. »Was tun Sie hier? Sie brauchen morgen einen klaren Kopf!«
»Ich konnte nicht schlafen«, antwortete der Pilot. »Genauso wenig wie Sie.«
»Ich muss morgen früh aber kein Flugzeug starten, das mit Kaugummi und Blumendraht zusammengeflickt worden ist.«
Er war in der fast vollkommenen Dunkelheit hier im Dschungel nicht sicher, aber er glaubte zumindest, ein Lächeln über Tresslers Gesicht huschen zu sehen. »Ich bin das gewohnt, keine Sorge«, antwortete der Pilot. »Ich schlafe manchmal nur eine Nacht pro Woche richtig.« Er wurde übergangslos wieder ernst. »Kommen Sie mit, Jonas. Ich muss Ihnen etwas zeigen.«
Der Ton, in dem er den letzten Satz hervorstieß, gefiel Jonas nicht. Aber er verzichtete darauf, eine Gegenfrage zu stellen.
Wenn Tressler nur ihn allein hatte holen wollen, dann gab es dafür bestimmt gute Gründe. Und Jonas hatte das ungute Gefühl, dass ihm diese Gründe nicht gefallen würden.
Er sollte recht behalten.
Tressler führte ihn in weitem Bogen um das Lager herum und dann wieder zurück zum Strand; allerdings nicht dorthin, wo das Flugzeug lag, wie Jonas erwartet hatte. Stattdessen näherten sie sich einer Stelle, die eine gute Meile davon entfernt hinter der Biegung der Lagune lag, sodass sie sie von ihrem Lagerplatz aus nicht direkt einsehen konnten.
Das war wahrscheinlich auch der Grund, aus dem das halbe Dutzend Gestalten diesen Platz ausgesucht hatte, um sich zu versammeln, und nicht den Strand weiter westlich, wo Sandstein in der vergangenen Nacht die Spuren aufgefallen waren ...
Tressler und er standen sicher fünf Minuten reglos da und blickten die schwarzen Gestalten am Strand aus der Deckung des Unterholzes heraus an. Sie bewegten sich unruhig und Jonas hörte erregte Stimmen in einer unverständlichen fremden Sprache. Manchmal gestikulierte eine der Gestalten aufgeregt; und immer in die Richtung, in der das Flugzeug lag. Und das Lager.
Schließlich wich Jonas einen Schritt weiter in den Dschungel zurück und ließ sich in die Hocke sinken. Die Dunkelheit, die sie einhüllte, schien mit einem Mal keinen Schutz mehr zu bieten, sondern zu etwas Feindseligem, Bösem zu werden.
»Also hat sie sich nicht getäuscht«, murmelte er, als Tressler ihm folgte und sich neben ihm auf ein Knie herabsinken ließ.
»Nein«, antwortete der Pilot. »In keiner Beziehung.«
Jonas fragte sich, was er wohl genau damit meinen mochte, verfolgte den Gedanken aber nicht weiter. »Vielleicht«, sagte er zögernd, »sollten wir doch versuchen von hier wegzukommen. Die Burschen gefallen mir nicht.«
»Sie sind harmlos«, antwortete Tressler. Er schien Jonas’ zweifelnden Gesichtsausdruck trotz der Finsternis zu sehen, denn er fuhr nach einer Sekunde hastig fort: »Jedenfalls glaube ich das. Wenn sie uns hätten angreifen wollen, dann hätten sie es längst getan. Gelegenheit dazu hatten sie genug.«
Seine Worte klangen allerdings eher nach einem frommen Wunsch als nach wirklicher Überzeugung, und Jonas sprach das auch aus. »Ja. Oder sie beobachten uns und warten auf den passenden Moment, um zuzuschlagen.«
Diesmal verging eine geraume Weile, bis Tressler antwortete. Seine Stimme war sehr viel leiser als zuvor und sie klang eindeutig besorgt. »Hören Sie zu, Jonas. Ich ... ich habe vorhin nicht ganz die Wahrheit gesagt, als wir über das Flugzeug gesprochen haben.«
»Inwiefern?«
»Wenn ich ganz ehrlich sein soll – ich glaube kaum, dass ich die Mühle noch einmal in die Luft kriege«, gestand Tressler. »Und unsere Aussichten, weiter als zehn Meilen damit zu kommen, sind erbärmlich. Ich kann niemanden mehr mitnehmen. Selbst wenn wir jede überflüssige Schraube aus der Maschine drehen und ich noch den Pilotensitz rausschmeiße, um Gewicht zu sparen, brauche ich ein ganzes Bataillon Schutzengel, wenn ich es über die Riffe schaffen will.«
»Warum versuchen Sie es dann überhaupt?«, fragte Jonas. »Keinem hier ist damit gedient, wenn Sie sich umbringen.«
»Weil es unsere einzige Chance ist«, antwortete Tressler. »Haben Sie Lust, die nächsten fünfzig Jahre hierzubleiben? Diese Insel ist noch nie von Weißen betreten worden. Wahrscheinlich weiß man nicht einmal, dass es sie gibt! Es kann noch hundert Jahre dauern, bis hier ein Schiff vorbeikommt!«
»Unsinn!«, widersprach Jonas heftig. »Woher wollen Sie das wissen? Es gibt Tausende von Inseln hier.«
Tressler lachte leise. »Glauben Sie mir. Ich wüsste bestimmt, wenn man diese Insel bereits entdeckt hätte. Und Sie wüssten es sicher auch.«
»Wie meinen Sie das?«
Tresslers Stimme klang überrascht. »Sie haben sie nicht gesehen?«
»Wen, zum Teufel? Die Eingeborenen?«
Der Pilot erhob sich wieder und machte eine Geste, die Jonas in der Dunkelheit viel mehr spürte als sah. Offensichtlich sollte er ihm folgen. Sie gingen zurück zum Waldrand und Tressler deutete zum Strand hinunter. Die Eingeborenen standen noch immer da und redeten und gestikulierten heftig.
»Rechts von ihnen«, flüsterte Tressler. »Direkt neben den Felsen, im Wasser. Sehen Sie sie?«
Jonas’ Blick folgte Tresslers ausgestreckter Hand. Im allerersten Moment sah er nichts außer Schatten und Felsen in schwarzem Wasser, auf dem sich das Mondlicht spiegelte, doch dann ...
»O mein Gott!«, flüsterte er.
WASHINGTON, D. C. ACHT MONATE SPÄTER
»Nein!«, sagte Hensley. »Nur über meine Leiche!« Er ballte die Faust und ließ sie wuchtig auf die Schreibtischplatte krachen, um seinen Worten gehörigen Nachdruck zu verleihen.
Vielleicht hätte er das besser nicht tun sollen, denn gleich darauf verzog er schmerzhaft das Gesicht, und einer der beiden Regierungsbeamten machte eine Miene, als denke er ernsthaft darüber nach, Hensleys Vorschlag wörtlich zu nehmen. Der andere lächelte unverändert weiter, so wie er es die ganze Zeit getan hatte. Er hatte Thor mit diesem Lächeln begrüßt, und es hatte sich nicht um einen Deut geändert, obwohl Thor jetzt bereits seit fast einer halben Stunde dasaß und ihn beobachtete.
Er war mittlerweile fast sicher, dass der Beamte mit diesem dämlichen Grinsen auf dem Gesicht geboren worden war und dass es sein größtes und womöglich einziges Kapital darstellte.
Hensley jedenfalls schien es langsam, aber sicher in den Wahnsinn zu treiben. Er tat Thor beinahe leid. Es gab wohl kaum etwas Schlimmeres, als sich mit jemandem streiten zu müssen, der unentwegt lächelte, ganz egal was man ihm an den Kopf warf. Vor allem wenn dieser Jemand in einer Position war, wo er sich dieses überhebliche Lächeln leisten konnte.
Und das waren die beiden Regierungsbeamten. Thor hätte nicht einmal ihre Ausweise sehen müssen, um das zu wissen. Im Laufe der Jahre hatte er für so etwas ein feines und beinahe untrügliches Gespür entwickelt.
»Mister Garson, bitte sagen Sie doch auch einmal etwas!« Hensley begann fast verzweifelt die Hände zu ringen. »Ich flehe Sie an, seien Sie wenigstens vernünftig!«
Thor genoss den Moment wie einen Schluck kostbaren Wein. Es kam sehr selten vor, dass Hensley ihn um etwas bat.
Und im Moment bettelte er regelrecht. Deshalb zögerte er seine Antwort auch so lange hinaus, wie es gerade noch möglich war.
»Vernünftig bin ich schon, Mister Hensley«, sagte er. »Aber was soll ich machen, wenn das Vaterland mich ruft? Immerhin hat man meine Eltern und mich nach der Emigration aus Deutschland hier in Amerika überaus freundlich aufgenommen und als guter Patriot kann ich meine Hilfe kaum verweigern.«
Hensleys Gesicht verlor auch noch das letzte bisschen Farbe, und Thor schenkte ihm nicht nur sein herzlichstes Lächeln, sondern gönnte sich auch noch weitere zehn Sekunden, in denen Hensley sich in ungesunder Nähe eines Schlaganfalls bewegte, ehe er, an die beiden Regierungsbeamten gewandt, fortfuhr: »Andererseits müssen Sie Mister Hensley verstehen, meine Herren. Immerhin hat er eine erfolgreiche Zeitschrift herauszubringen, und meine Artikel, vor allem die umfangreichen Reisereportagen, erfreuen sich bei den Lesern von Living Past nun einmal großer Beliebtheit. Zum Glück, wie ich sagen muss. Leider bin ich mit einigen Artikeln schon weit im Rückstand, weil ich einfach nicht zum Schreiben gekommen bin, doch ich habe sie bis Ende nächster Woche fest zugesagt. Und ich breche nur ungern mein Wort.«
Hensley war für einen Moment völlig perplex. Ganz offensichtlich hatte er mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass Thor Garson sich auf seine Seite schlug.
Was Thor auch nicht wirklich getan hatte.
Hensley war ihm herzlich egal. Er mochte ihn menschlich nicht sonderlich, musste jedoch zugeben, dass er seinen Job hervorragend beherrschte. Living Past war eine ausgezeichnete Zeitschrift, nicht umsonst der Marktführer im Bereich Geografie und Geschichte. Hensley schaffte es, genau die richtige Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, reinen Spekulationen, Reiseberichten und Abenteuergeschichten zu bringen (am besten alles in einer einzigen Reportage), die die Leser ansprach. Thor war stolz darauf, regelmäßig in seinem Blatt vertreten zu sein und trotz seiner Jugend zu den beliebtesten Autoren zu gehören.
Wenn er wollte, dass das so blieb, musste er allerdings auch gelegentlich Nachschub liefern. Es nutzte ihm herzlich wenig, wenn er ständig unterwegs war, aber nicht dazu kam, seine Erlebnisse auch tatsächlich niederzuschreiben – sofern sie nicht entweder schlichtweg zu fantastisch waren, als dass er sie als Tatsachenberichte präsentieren konnte, oder politisch oder militärisch so brisant, dass sie der Geheimhaltung unterlagen und er sie aus diesem Grund nicht an die Öffentlichkeit bringen durfte. Gerade Letzteres war ihm nun schon mehrfach passiert, und er hatte schlicht und einfach keine Lust, schon wieder zu irgendeinem vergessenen Winkel der Welt zu reisen, um für die Regierung oder sonst wen die Kastanien aus dem Feuer zu holen, ohne wenigstens darüber schreiben zu dürfen.
»Sie haben Mister Garson gehört, meine Herren.« Hensley hatte nicht nur seine Überraschung überwunden, sondern bekam bereits wieder Oberwasser. »Wir können Ihnen nicht helfen. Es tut mir leid.«