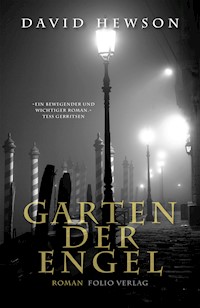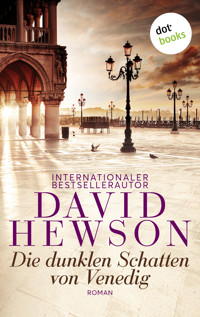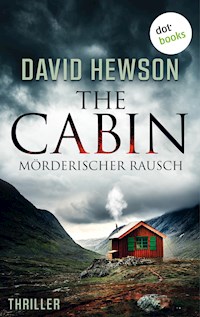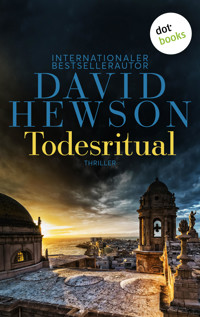5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die tödlichen Geheimnisse Roms: Der fesselnde Kriminalroman »Der Kult des Todes« von David Hewson jetzt als eBook bei dotbooks. Dunkle Wolken brauen sich über der Ewigen Stadt zusammen …Bei der römischen Polizei ist zunächst niemand alarmiert als der Schlamm am Ufer des Tibers eine vermeintlich antike Leiche mit einer Münze im Mund freigibt. Doch dann stellt sich heraus, dass es sich keineswegs um eine gut erhaltene Mumie, sondern um eine kürzlich verschwundene junge Frau handelt! Ist hier ein Wahnsinniger am Werk – oder ein Kult, der Menschen nach altem Ritus opfert? Nic Costa, ein junger Polizist mit dunkler Vergangenheit, wird auf den Fall angesetzt und findet sich schon bald in einem Wettlauf mit der Zeit wieder: Denn eine britische Touristin hat ihre 16-jährige Tochter vermisst gemeldet – und das Mädchen sieht der ermordeten Frau vom Tiber erschreckend ähnlich … »David Hewsons Rom ist düster und verlockend, verführerisch und gefährlich, ein Ort, an dem das Echo der Geschichte noch in den Verbrechen von heute zu hören ist.« Tess Gerritsen Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Kriminalroman »Der Kult des Todes« ist der zweite Band der packenden Nic-Costa-Reihe von David Hewson, auch bekannt unter dem Titel »Villa der Schatten«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Dunkle Wolken brauen sich über der Ewigen Stadt zusammen… Bei der römischen Polizei ist zunächst niemand alarmiert als der Schlamm am Ufer des Tibers eine vermeintlich antike Leiche mit einer Münze im Mund freigibt. Doch dann stellt sich heraus, dass es sich keineswegs um eine gut erhaltene Mumie, sondern um eine kürzlich verschwundene junge Frau handelt! Ist hier ein Wahnsinniger am Werk – oder ein Kult, der Menschen nach altem Ritus opfert? Nic Costa, ein junger Polizist mit dunkler Vergangenheit, wird auf den Fall angesetzt und findet sich schon bald in einem Wettlauf mit der Zeit wieder: Denn eine britische Touristin hat ihre 16-jährige Tochter vermisst gemeldet – und das Mädchen sieht der ermordeten Frau vom Tiber erschreckend ähnlich …
»David Hewsons Rom ist düster und verlockend, verführerisch und gefährlich, ein Ort, an dem das Echo der Geschichte noch in den Verbrechen von heute zu hören ist.« Tess Gerritsen
Über den Autor:
David Hewson wurde 1953 geboren und begann bereits im Alter von 17 Jahren für eine Lokalzeitung im Norden Englands zu arbeiten. Später war er Nachrichten-, Wirtschafts- und Auslandsreporter bei der »Times« und Feuilletonredakteur bei »The Independent«. Heute ist er ein international bekannter Bestsellerautor. Sein Thriller »Todesritual«, auch bekannt unter dem Titel »Semana Santa«, wurde mit dem W. H. Smith Fresh Talent Preis für einen der besten Erstlingsromane ausgezeichnet und verfilmt. Er schrieb die Bücher zur dänischen Fernsehserie »The Killing« und seine Nic-Costa-Kriminalromane wurden weltweit zum großen Erfolg.
Die Website des Autors: davidhewson.com
Bei dotbooks erscheinen von David Hewson die Nic-Costa-Kriminalromane »Das Blut der Märtyer« und »Der Kult des Todes«, außerdem der Thriller »Todesritual« und der Spannungsroman »Die dunklen Schatten von Venedig«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Originaltitel »The Villa of Mysteries« bei Macmillan, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Villa der Schatten« bei Ullstein.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2003 by David Hewson
Copyright © der deutschen Erstausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung von Motiven von Nikolay Antonov / shutterstock.com und Malivan_Iuliia / shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-225-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Kult des Todes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Hewson
Der Kult des Todes
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Hedda Pänke
dotbooks.
Pentheus:
Den heil’gen Dienst – begehst du nachts ihn oder tags?
Dionysos:
Bei Nacht zumeist, weil heilig uns das Dunkel ist.
Euripides, Die Bakchen
Teil Eins: Luperkalien
Kapitel 1
Bobby und Lianne Dexter waren ehrbare, rechtschaffene Leute. Sie besaßen ein nagelneues, luxuriöses Holzhaus auf einem riesigen Waldgrundstück dreißig Meilen außerhalb von Seattle und arbeiteten ebenso hart wie fleißig bei Microsoft, Bobby im Marketing, Lianne in der Finanzabteilung. An jedem Wochenende wanderten sie, und einmal im Jahr kletterten sie auf den Gipfel des Mount Rainier. Außerdem gingen sie regelmäßig ins Fitness-Center, obwohl das Bobby auch nicht viel gegen sein »familiäres Erbe« half – das Bäuchlein, das sich unübersehbar über seinen Jeans wölbte. Und das mit gerade einmal dreiunddreißig.
Die Dexters führten das friedliche, angenehm sorgenfreie Leben der US-amerikanischen Middle Class. Mit Ausnahme der beiden Wochen in jedem Frühjahr, in denen sie Urlaub im Ausland machten. Sie betrachteten das einfach als eine Frage des Ausgleichs. Fünfzig Wochen im Jahr hart arbeiten und die restlichen zwei feiern. Vorzugsweise dort, wo niemand sie kannte, wo andere Regeln galten. Oder auch gar keine. Und so saßen sie an diesem kühlen Februartag rund zwanzig Kilometer vor Rom benebelt von Rotwein und Grappa in ihrem gemieteten Renault Clio und bretterten in waghalsigem Tempo über die Schlaglöcher einer Schotterpiste, auf die sie hinter dem Flughafen in Fiumicino eingebogen waren und die nun auf das graue Band des Tiber zuführte.
Lianne warf einen vorsichtigen Seitenblick auf ihren Mann. Bobby schäumte noch immer vor Wut. Den ganzen Vormittag lang hatte er am Rand der Ausgrabungen von Ostia Antica, dem römischen Hafen der Antike, mit einem Metalldetektor emsig den Boden abgesucht. Doch gerade als er dem Ding die ersten Pieptöne entlocken konnte, waren zwei grimmige Archäologentypen aufgetaucht und hatten sie angeschrien. Keiner der beiden verstand Italienisch, aber der Sinn des Gebrülls war eindeutig. Entweder sie packten ihren Detektor ein und verschwanden, oder der Jahresurlaub der Dexters würde in Handgreiflichkeiten mit zwei stämmigen Italos ausarten, die ganz so aussahen, als täten sie nichts lieber, als kräftig auszuteilen.
Gekränkt suchten Bobby und Lianne Zuflucht in einer Osteria am Straßenrand, wo der Kellner, ein unrasierter Flegel in schmuddeligem Sweatshirt, alles noch schlimmer machte, indem er sie darüber belehrte, dass es Pasta hieß und nicht »Pästä«.
Bobbys kalkweiße, schlaffe Wangen röteten sich verdächtig. »Dann bringen Sie mir eben ein verdammtes Steak«, knurrte er und bestellte dazu einen Liter Rosso della casa. Lianne schwieg. Sie wusste, wann es klüger war, Bobbys Launen einfach hinzunehmen. Wenn es in Sachen Alkoholkonsum zu bedenklich wurde, konnten sie das Auto am Flughafen zurücklassen und mit einem Taxi nach Rom fahren. Nicht, dass Italiener etwas dagegen hätten, angetrunken Auto zu fahren. Sie taten es ständig. Zumindest kam es Lianne so vor. So war Italien nun mal. Lax. Sie und Bobby benahmen sich lediglich wie Einheimische.
»Ich kann diese Leute echt nicht begreifen«, maulte Bobby, als er den Clio über betonharte Spurrillen holpern ließ. »Tun ja gerade so, als ob ... Ich meine, haben sie denn nicht wirklich mehr als genug von dem Zeug?«
Lianne wusste, was ihn erbitterte. Im vergangenen Herbst hatten die Jorgensens von ihrem Urlaub in Griechenland eine fußballgroße Marmorbüste mitgebracht. Den Kopf eines jungen Mannes – wahrscheinlich Alexander der Große, erklärten die Jorgensens –, voller dichter Locken und mit attraktiven, leicht femininen Gesichtszügen. Um den genau richtigen Moment abzuwarten, ließen die beiden zunächst kein Wort über ihr Mitbringsel verlauten. Doch dann, buchstäblich aus heiterem Himmel, lud Tom Jorgensen Lianne und Bobby in ihr »Häuschen« im skandinavischen Stil – mit immerhin zwei Obergeschossen und einem parkähnlichen Garten –, um endlich einmal ein Glas miteinander zu trinken, wie er sagte. Natürlich ging es dabei nur um die Marmorbüste. Tom berichtete ausführlich davon, wie er den Marmorkopf bei der Besichtigung einer Ausgrabungsstätte außerhalb von Sparta entdeckt und abends nach dem Heimgang der Ausgräber einen Einheimischen bestochen hatte, ihn auf das Gelände zu lassen. Dann rühmte er sich noch seiner Pfiffigkeit, den Marmorkopf als Übergepäck aus dem Land geschmuggelt zu haben. Doch das war nur wieder eine von Toms Lügengeschichten, vermutete Lianne. In Wahrheit hatte er das Ding in irgendeinem Laden gekauft wie jedermann sonst. Um sich interessanter zu machen, log dieser Bursche doch nach Strich und Faden. Auf diese Weise hatte er es auch geschafft, sich über Bobby hinweg in die Musik- und TV-Projekte von Microsoft hineinzudrängen, um mit Rockstars und Filmleuten zusammenzutreffen, während Bobby, der genauso intelligent war, vielleicht sogar intelligenter, sich mit den langweiligen Freaks herumplagen musste, die höchstens bei der Erwähnung von Datenbanken ausflippten.
Aber Toms Märchen blieb nicht ohne Wirkung. Zwei Wochen später verkündete Bobby, dass sie ihren Urlaub im kommenden Frühjahr in Italien verbringen würden. Er fragte nicht einmal, was sie davon hielt. Insgeheim hatte Lianne zwar von Aruba geträumt, aber sie fügte sich. Und wie sich dann herausstellte, war Rom gar keine so schlechte Wahl. Die Stadt begann ihr ernsthaft zu gefallen. Doch heute Morgen wendeten sich die Dinge zum Schlechten. Irgendein britischer Sonderling konnte seine Gelehrsamkeit nicht für sich behalten und dozierte am Frühstücksbüfett des Hotels darüber, dass im antiken Rom der heutige Tag den Toten gewidmet war, an dem sie eine Ziege oder einen Hund opferten und mit dem Blut die Stirn ihrer Kinder bestrichen, nur damit diese sich an ihre Vorfahren erinnerten. Bobby reagierte reflexartig. Eine Viertelstunde später telefonierte er mit einer Mietwagenfirma und lieh sich einen Metalldetektor.
Und jetzt befanden sie sich inmitten einer trostlosen Einöde, waren sturzbetrunken und hatten keine Ahnung, was sie als Nächstes tun sollten. Lianne träumte von Aruba, und der Schmerz war umso schlimmer, da sie nicht wusste, wie es dort aussah. Verstohlen legte sie eine Hand ans Lenkrad und steuerte den Clio an einem Felsbrocken vorbei, der rechts vor ihnen auftauchte. Die Straße wurde zunehmend schmaler. Möglicherweise blieben sie bald stecken und mussten zur nächsten größeren Straße laufen, um Hilfe zu holen. Das war eine Vorstellung, die ihr überhaupt nicht behagte. Sie hatte nicht die richtigen Schuhe an.
»Es ist schlicht und einfach Habgier, Bobby«, sagte sie. »Wie könnte man es sich sonst erklären?«
»Ich meine ... was macht es denn schon aus? Wenn ich den Mist nicht finde, bleibt das Zeug, wo es ist. Im Boden! Ein Italiener denkt doch nicht einmal im Traum daran, das Zeug aus der Erde zu buddeln.«
Doch da irrte er sich. Lianne hatte überall Gruben und Ausschachtungen bemerkt. Die meisten sahen stillgelegt aus, aber vielleicht fehlten auch die nötigen Arbeitskräfte. Trotzdem war es besser, ihm nicht zu widersprechen. »Sie brauchen es nicht, Bobby. Sie haben bereits mehr als genug. So viel, dass es ihnen zu den Ohren rauskommt.«
Mit Sicherheit war es so. Wenn Lianne an all die Museen dachte, die sie in den vergangenen Tagen besucht hatten, wurde ihr ganz schwindelig. Diese gigantischen Massen an Altertümern und Relikten. Im Gegensatz zu Bobby hatte sie die Reiseführer gelesen und wusste, dass sie gerade mal eben an der Oberfläche gekratzt hatten. Sie würden eine ganze Woche in Rom verbringen und doch nicht alles sehen können. Die Anhäufung wirkte exzessiv. Ungerecht. Ungehörig. Bobby hatte Recht. Wenn die Italiener auch nur einen Funken Anstand besäßen, würden sie etwas abgeben.
Der Wagen geriet in ein riesiges Schlagloch, schoss an der anderen Seite wieder heraus, hob kurz ab und landete mit einem lauten Knall auf seinen Reifen. Es hörte sich an, als hätte sich am Unterboden etwas gelöst. Lianne blickte durch die Windschutzscheibe. Hinter Grasflächen, die eher nach Sumpf- und Moorvegetation als nach Strandbewuchs aussahen, lag eine graue, schaumbedeckte Wasserfläche. Kurz vor dem flachen Ufer endete die Straße im Nichts. Bobby musste wohl oder übel hier aussteigen, um seinen kleinen Spaß zu haben, aber dann sollten sie den Wagen so schnell wie möglich zu Avis bringen und in der Stadt untertauchen, bevor jemand die Dellen oder noch Schlimmeres bemerkte.
»Keine Sorge«, sagte sie. »Hier wirst du etwas entdecken, Bobby. Da bin ich mir ganz sicher. Du wirst bestimmt etwas finden, was diesen Mistkerl Tom Jorgensen total neidisch macht. Du ...«
Abrupt trat er auf die Bremse und brachte den kleinen Wagen zwanzig Meter vor dem Ende der Fahrbahn zum Stehen. Er blickte sie mit diesem kalten Gesichtsausdruck an, den sie nur ein- oder zweimal im Jahr sah, aber so abgrundtief hasste, dass sie sich manchmal nicht sicher war, ob die Heirat mit Bobby Dexter, dem pummeligen Bobby, über den sich alle Frauen hinter seinem Rücken lustig machten, wirklich eine so gute Idee gewesen war.
»Was?«, fragte Bobby fast tonlos.
»Ich habe doch nur, wollte doch nur ...«, stammelte Lianne und verstummte.
Mit einem Wurstfinger stieß er gegen ihre Brust. Sie konnte seine Fahne riechen.
»Glaubst du etwa, es geht mir nur um diesen verdammten Tom Jorgensen?«
»Nein. Natürlich nicht!«
»Glaubst du wirklich, ich hätte diesen ganzen verdammten Urlaub geplant, gebucht und bezahlt, dich zu diesen wundervollen Stätten mitgenommen – allein wegen Tom Jorgensen und seinem beschissenen Marmorschädel?«
Lianne ließ sich Zeit mit der Antwort. In den drei Jahren ihrer Ehe hatte Bobby sie nur einmal in Tränen ausbrechen lassen. Damals in Cancun, wegen eines sexuellen Ansinnens, das sie als absurd, unnötig und zutiefst unhygienisch empfand. Die Erinnerung schmerzte noch immer. Sie begriff nicht, warum sie es nicht vergessen konnte.
»Natürlich glaube ich das nicht. Ich hatte den Eindruck. Ach, ich weiß auch nicht ...« Offenbar kamen ihr nur die falschen Worte über die Lippen.
»Großer Gott!«, schrie Bobby. »Allmächtiger Himmel!«
Er trat das Gaspedal durch, rammte den ersten Gang ein und ließ die Kupplung los. Mit markerschütterndem Getöse schoss der Clio vorwärts, schwenkte zur Seite und saß zwei Sekunden später auf einem massiven Schlammbuckel fest, in dessen Inneren sich – zumindest für Lianne – die Reste eines Zaunpfahles zu verbergen schienen. Das rechte Vorderrad drehte sich kreischend, als der Berg aus fest gebackenem Schlamm die gesamte rechte Vorderfront des Clio in die Luft stemmte.
Anklagend starrte Bobby seine Frau an. »Na wundervoll«, knurrte er. »Einfach großartig.«
Sie schluchzte trocken und versuchte verzweifelt, die Tränen zurückzudrängen.
»Tu mir das nicht an, Lianne. Nicht hier und nicht heute. Wir sind nicht in Cancun. Du kannst deinen Berserker von einem Vater nicht anrufen, damit er mir droht, mir den Schädel einzuschlagen, nur weil du Kopfschmerzen hast.«
Es war ein Fehler, ihrem Vater davon zu erzählen. Das war ihr von Anfang an klar gewesen. Aber Bobby hatte es darauf angelegt. In Cancun war eine Grenze überschritten worden. Sie wollte, dass er das begriff.
»Bobby ...«, schluchzte sie.
Er starrte zum Fenster hinaus auf den trägen, grauen Fluss.
»Was ist?«
»Ich rieche Benzin.« Aufkommende Angst ließ ihre Tränen spontan versiegen. »Du nicht?«
»O Gott«, keuchte er, fummelte an ihrem Gurt und schob die Beifahrertür auf. Mit glasigen Augen lächelte sie ihn selig an. Er hatte an sie gedacht. Bevor er seinen eigenen Sicherheitsgurt öffnete.
»Bobby ...«
Er stieß sie zur Tür hinaus. »Um Himmels willen, steig aus. Raus mit dir, dumme Kuh ...«
Mit einem letzten Blick vergewisserte sich Bobby Dexter, dass seine Frau in Sicherheit war, drehte sich um und schleuderte hastig ein paar Dinge vom Rücksitz ins Freie, bevor er sich aus dem Wagen fallen ließ. Er war so betrunken, dass er ungeschickt aufkam und sich bei der Landung auf dem harten Boden die Ellbogen prellte. Es tat höllisch weh.
Fluchend rappelte er sich hoch, sammelte seine Sachen ein und blickte sich um. Lianne stand zehn Meter vom Clio entfernt am Straßenrand, mit auf dem Rücken verschränkten Händen wie ein Schulmädchen, das darauf wartete, dass man ihm sagte, was es tun sollte.
Er ging zu seiner Frau hinüber.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte er und wirkte fast ein bisschen besorgt. Immerhin, dachte sie.
»Sicher.« Sie hatte aufgehört zu weinen. Es schien ihn zu freuen. Nun, das war wirklich erstaunlich.
Das Auto gab ein Geräusch von sich, eine Art zischendes Keuchen. Sie sahen, wie eine dünne Flamme unter der Motorhaube hervorschoss und zur Windschutzscheibe emporzüngelte.
»Genau das gefällt mir an Mietwagen«, sagte Bobby. »Sie gehen vor deinen Augen in Flammen auf und man kann nichts anderes tun, als einen Schritt zurückzutreten und die Show zu genießen. Jetzt wünschte ich wirklich, ich hätte ein größeres Auto gemietet.«
Der leichte Wind erfasste die Flammen, trieb sie über das Dach, wirbelte sie durch die Fenster ins Wageninnere, über die Sitze, auf denen noch vor einer guten Minute Bobby und Lianne Dexter gesessen und miteinander gestritten hatten. Dann, mit einem plötzlichen Getöse aus Dröhnen und Rauschen, brannte der ganze Renault, ging in einer Wolke aus Flammen und Rauch auf.
Lianne klammerte sich an den Arm ihres Mannes und betrachtete das Schauspiel mit angehaltenem Atem. Bobby hatte Recht. Es war das Problem von Avis. Dafür waren sie schließlich da. Deshalb die exorbitanten Preise.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte sie. Sie blickte Bobby an und stellte fest, dass er lächelte. Zum ersten Mal seit Stunden.
Er hielt einen der vom Autorücksitz geretteten Gegenstände hoch. Es war der Metalldetektor, den sie sich heute Vormittag in einem Geschäft in der Nähe des Hotels geliehen hatten.
»Genau das, wofür wir hergekommen sind«, erklärte Bobby Dexter. »Daddy geht auf die Jagd.«
Sie versuchte es mit einem Lachen und fragte sich, ob es sich echt anhörte, natürlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das war egal. Bobby achtete gar nicht auf sie. Er lief auf den Fluss zu, marschierte über den morastigen Boden, der sich anfühlte, als könnte er jeden Moment unter einem nachgeben. Er hatte die Kopfhörer aufgesetzt und lauschte. Schon bald lachte auch Bobby Dexter. Offenbar hörte er etwas. Etwas Verheißungsvolles. Lianne ging ihm nach. Sie standen jetzt etwa zwanzig Meter vom Flussufer entfernt. Meilenweit war keine andere Menschenseele zu sehen. Alles, was sie hier finden würden, gehörte mit Sicherheit ihnen.
»Hörst du das?«
Sie nahm ihm die Kopfhörer ab und hielt eine Muschel an ihr Ohr. Es piepte wie ein Vogel, dessen Nest in Gefahr war.
»Wart’s nur ab, Tom Jorgensen«, zischte Bobby, und sie wagte nicht, ihm in die Augen zu sehen. »Du verdammtes Großmaul, ich werd’s dir zeigen. Lianne, bring mir Hacke und Spaten.«
Kapitel 2
Er hockte trübsinnig vor einem Kaffee, als Barbara Martelli die kleine Bar nahe der Questura betrat. Sie steckte in ihrer makellosen, schwarzen Uniform, hatte den Helm in der Hand, und ihre kinnlangen, blonden Haare wippten mit jedem Schritt.
»Nic? Sie sind wieder im Dienst?«, fragte sie überrascht.
»Ja.« Er blickte auf seine Armbanduhr. »Mein erster Tag.«
»Verstehe.«
»Wie geht’s, Barbara?«
»Gut. Wie immer. Und Ihnen?«
Er trank den letzten Schluck Macchiato. »Wie man’s nimmt.«
»Vielleicht haben Sie es inzwischen vergessen, aber das Café ist nicht der Treffpunkt für Bullen.«
»Und warum sind Sie dann hier?«
Sie lachte. Barbara Martelli besaß in etwa seine Größe, eine Figur, nach der sich auf dem Revier alle Köpfe umdrehten, und einen Kopf voller blonder Locken, die kaum unter den kleinen, schwarzen Helm zu passen schienen. Für eine Polizistin hatte sie das falsche Gesicht. Zu attraktiv, zu bereit für ein liebenswürdiges Lächeln. Sie sah aus, als gehörte sie auf den Fernsehschirm, um das Wetter vorherzusagen oder irgendeine Show zu moderieren. Stattdessen flitzte sie auf ihrer schweren Maschine durch Rom und verteilte Strafzettel auf eine so hinreißend charmante Art, dass manche extra aufs Gaspedal traten, sobald sie erkannten, wer ihnen da auf den Fersen war.
Früher, vor der Schießerei, die ihm zum Verhängnis geworden war, hatte sich Nic Costa gelegentlich gefragt, ob er ihr vielleicht nicht ganz gleichgültig war. Einige der Jungs hatten ihn grinsend aufgefordert, sich mit ihr zu verabreden – natürlich unter der Bedingung, dass er ihnen danach alles haarklein berichtete. Doch dazu kam es nie. Sie war schlicht zu perfekt. Sie absolvierte jede Fahrprüfung mit Auszeichnung, ganz gleich ob hinter dem Lenkrad oder in der Motorradtruppe. Darüber hinaus galt sie als brillante Schützin, was sie für heikelste Aufgaben prädestinierte. Barbara Martelli war einfach eine Spur zu vollkommen. Das verlangte Distanz.
»Manchmal muss man für eine Weile abtauchen, Nic. Tun Sie das auch gerade? Wenn ja, dann ist es dafür noch ein bisschen früh. Sie müssen zurück in den Ring, um den Gong hören zu können.«
»Ich habe mir nur einen kleinen Kaffee genehmigt«, murmelte er.
»Wie lange ist es jetzt eigentlich her?«
»Sechs Monate.« Sechs endlose Monate der langsamen Genesung von seinen Schussverletzungen und der daraus resultierenden Verunsicherung. Manchmal fragte er sich, ob er sich jemals ganz erholen würde, ob er das überhaupt wollte.
Barbara Martelli sah ihm direkt in die Augen. Sie war höchstwahrscheinlich die attraktivste Frau in der Questura. Es erstaunte ihn, dass er sie nie zum Essen oder auf ein Glas eingeladen hatte. Nicht, um mit ihr anzubändeln. Er fand sie einfach sympathisch. Sie war eine Frau, mit der man gern zusammen war, die einem das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. Im Grunde kannte er sie kaum.
»Aber Sie wollten doch wieder arbeiten? Oder hat Falcone Sie unter Druck gesetzt?«
»Nein. Ich meine ... Ich wüsste auch nicht, was ich sonst tun sollte. Sie?«
»Nein.«
»Wir sind alle gleich, oder? Arm an Alternativen.«
Nic Costa lauschte seiner Stimme nach, und ihm gefiel nicht, was er hörte. Was klang da mit? Verbitterung? Selbstmitleid? Er war achtundzwanzig Jahre alt. Früher wäre ihm so etwas nie über die Lippen gekommen. Aber der noch immer nicht befriedigend gelöste Fall Denney, durch den sein Partner Luca Rossi das Leben verloren hatte und er selbst an den Rand des Todes gebracht worden war, hatte ihn verändert. Der neue Nic Costa rannte nicht mehr jedes Mal los, wenn er einen klaren Kopf bekommen wollte, joggte nicht mehr wie ein Wahnsinniger durch die Straßen rund um den Campo dei Fiori. Sein kleines Apartment am Vicolo del Bologna hatte er verkauft und wohnte nun im Haus seines verstorbenen Vaters, einem alten Landsitz nahe der Via Appia Antica, auf dem er seine Kindheit verbracht hatte. Costas physische Wunden waren größtenteils verheilt, die psychischen schmerzten noch immer von Zeit zu Zeit.
Er vermisste Luca Rossis wortkarge Intelligenz, seine scharfsinnigen Einsichten, und bedauerte, diese Fähigkeiten während der kurzen Zeit ihrer Zusammenarbeit nicht genügend geschätzt zu haben. Nic Costa wusste, dass er als ein anderer in den Polizeidienst zurückkehren würde. Es war notwendig, für seine Arbeit das zu übernehmen, was Falcone, der ihn durch eindringliche Gespräche aus dem Rollstuhl herausgeholt hatte, Pragmatismus nennen würde.
Diese Wandlung hielt der kühle, sachorientierte Inspektor Falcone für unvermeidlich. Vielleicht hatte er Recht. Costa war sich da noch immer nicht ganz sicher. Dieser Zynismus, demzufolge der Zweck die Mittel heiligte, weil man mitunter das Beste aus einem miesen Job machen musste, um den Kampf nicht gänzlich zu verlieren, behagte ihm ebenso wenig wie die Vorstellung, seine Prinzipien der grausamen Realität anzupassen. Das hatte er von seinem Vater – einem unbeugsamen kommunistischen Politiker, der sich durch seine gradlinige Offenheit mehr Feinde gemacht hatte als die meisten Menschen durch Tricksereien.
Barbara Martelli leerte ihre Espressotasse. Sie wirkte nachdenklich. Und ein bisschen besorgt, fand Nic, als gäbe es da etwas, was sie nicht aussprechen wollte. »Ich weiß, was Sie meinen.«
»Womit?«
»Den fehlenden Alternativen.«
Ein Schatten überflog ihr Gesicht, fast so etwas wie Traurigkeit, und ihm kam der Gedanke, dass Barbara Martellis Attraktivität nicht immer nur ein Vorteil war. Sie konnte auch eine Last sein. Die Menschen sahen vor allem ihr Äußeres, nicht den Menschen dahinter, der eigenartig unnahbar blieb.
»Aber es ist das Beste, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie nun einmal sind, und weiterzumachen, Nic. Und sich nicht in irgendeiner Ecke zu verkriechen. Das passt nicht zu Ihnen. Zumindest bilde ich mir ein, Sie dafür gut genug zu kennen.«
Er war bereits spät dran. Wenn sie nicht gekommen wäre, würde er weiter hier herumsitzen und zaudern. Bis irgendwann der Moment käme, an dem er zum Landsitz zurückkehrte, um eine Flasche Wein zu öffnen und alles zu ruinieren, was er in den letzten paar Monaten erreicht hatte – die Wiederherstellung seiner Gesundheit, die Wiederbelebung seiner letzten Reste an Würde und Selbstachtung. Es brachte eine gewisse Erleichterung, auf diese Weise auszubrechen. Wenn man das doch nur bewahren könnte. Dann würde es möglicherweise für ein Leben reichen. Leider war das nicht möglich. Man wurde immer wieder wach. Die Realität steckte den Kopf durch die Tür und sagte: »Sieh dich um.« Es gab kein Entrinnen, und das aus einem sehr einfachen Grund: Er lief vor etwas davon, das tief in ihm lag.
»Muss ich Sie etwa persönlich zum Dienst schleppen?«, wollte sie wissen.
»Ich könnte mich krank melden.«
»Nein!« Vor Empörung wurden ihre grünen Augen ganz groß.
Sie flirteten miteinander, aber nicht ernsthaft. Das war nur Barbaras Art, ihn aufzurütteln. Wenn sie es für nötig hielt, würde sie das mit jedem machen.
»Es ist unser selbst gewählter Beruf, mit dem wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Halbe Sachen gibt es nicht. Entweder ist man voll dabei oder draußen. Also?«
Ein verwegener Gedanke schoss ihm durch den Kopf, sprudelte ihm über die Lippen, ohne ihm Zeit zu lassen, die Konsequenzen zu erwägen. »Könnten Sie sich vorstellen, mit mir auszugehen, Barbara? Halten Sie das für möglich?«
Eine leichte Röte stieg in ihre Wangen. Barbara Martelli wurde mindestens zehnmal am Tag um ein Date gebeten.
»Fragen Sie mich das morgen noch einmal. Unter einer Bedingung.«
Er schwieg, eigenartig verlegen über die plötzliche Vertrautheit.
Sie hob eine Hand, zeigte in die Richtung der Questura. »Dass Sie mir die Frage da drinnen stellen.«
Kapitel 3
In Italien machten sie alles ganz falsch. Im Cappuccino war nicht genug Milch. Die Pasta schmeckte nicht wie sie sollte. Die Pizzas waren zu dünn. Und dann der Alkohol ... Lianne Dexter konnte sich beim besten Willen nicht erklären, was damit nicht stimmte. Normalerweise ließ die Wirkung zwei Stunden nach dem Lunch nach. Aber sie fühlte sich noch genauso berauscht wie beim Verlassen der Osteria, und das begann sie nervös zu machen. Die Flasche Pellegrino aus dem Rucksack, den Bobby aus dem Auto gerettet hatte, bevor es in Flammen aufging, war leer. Jetzt hatten sie nichts mehr zu trinken, nichts zu essen und auch nur wenig Geld. An den mühsamen Fußmarsch über die holprige Landstraße zur nächsten Autostrada wagte sie nicht einmal zu denken. Wie brachte man einen Italiener dazu, anzuhalten und einen zu Avis zu bringen, um sich den Mietpreis für den beschissenen Wagen erstatten zu lassen? Und was war mit dem Zeug, das Bobby ausgebuddelt hatte? Bisher bestanden seine Fundstücke in einer Münze, die ganz so aussah, als wäre sie sehr alt, einem riesigen Nagel und einem schmutzverkrusteten Gegenstand von der Größe einer Kinderhand, von dem Bobby versicherte, es handele sich garantiert um ein antikes römisches Halsband, das in alter Schönheit erglänzen würde, wenn er erst einmal den Dreck abgekratzt habe. Das wäre natürlich ganz großartig – bis auf die Tatsache, dass sie hier gar nicht graben durften. Was die Italiener mit Sicherheit wussten. Und vielleicht war das Halsband auch nur ein Stück Bremsbelag. Als Tochter eines Automechanikers kannte sich Lianne mit diesen Dingen aus, ein bisschen zumindest. Und für sie sah der Fund ganz nach einem Bremsbelag aus.
Sie leckte sich die Lippen. Ihr Mund fühlte sich staubtrocken an. Der billige Wein machte sich mit stechenden Kopfschmerzen bemerkbar. Es ging auf drei Uhr nachmittags zu, und es wurde schon dunkler. Sie mussten endlich etwas unternehmen. Auf keinen Fall wollte sie die Nacht in dieser grässlichen Wildnis zubringen, mit den sonderbaren Gerüchen und Flugzeugen, die alle zwei Minuten über ihre Köpfe hinwegdonnerten.
»Bobby ...«
Doch der war nicht zufrieden mit seiner Beute. Tom Jorgensen besaß immerhin einen Marmorkopf, und der stellte alle seine Fundstücke in den Schatten.
Er riss sich die Kopfhörer ab. »Was ist?«
»Es wird langsam dunkel. Wir müssen hier weg.«
Bobby Dexter warf einen Blick auf den düsteren Himmel und grunzte verächtlich. »Noch fünf Minuten.« Dann setzte er die Kopfhörer wieder auf und schlenderte zum Ufer. Dort war es sumpfig, das erkannte Lianne an dem eigentümlich sauren Geruch, den sie mit den Cranberryfarmen in Maine verband, einer Gegend, die sie in einem ihrer früheren Urlaube besucht hatten.
»Torf ...«, sagte sie versonnen. »Was zum Teufel ist jetzt wieder los?«, brüllte Bobby. Eine 747 donnerte so tief über sie hinweg, dass die Erde erbebte. Sie musste sich die Ohren zuhalten.
»Nichts«, flüsterte Lianne und wünschte sehnlichst, sie wäre anderswo. Ihretwegen sogar zu Hause. Die Cranberryfarmen waren angenehm gewesen. Interessant. Mit Menschen, die ihre Sprache sprachen und ihr nie das Gefühl gaben, fehl am Platze zu sein. In Rom war das anders. Hier hatte sie ständig den Eindruck, dass alle Gesichter auf den Straßen sie anstarrten und nur darauf warteten, dass sie etwas Falsches sagte, um die falsche Ecke bog. Es war alles so fremd.
Ein neues, unerwartetes Geräusch ließ sie zusammenzucken. Bobbys Pfiff. Aufgeregt zerrte er sich die Kopfhörer vom Schädel und zeigte auf eine dünn mit Gras bewachsene Erdfläche vor sich.
»Nur noch ein Versuch, Süße. Dann können wir verschwinden. Gib mir den Spaten.«
Sie tat es. Bobby Dexter setzte den Spaten senkrecht an und sprang mit beiden Füßen auf die Kante. Das Blatt drang in den Boden wie ein Messer in Butter. Bobby schüttelte die Erde vom Spaten und stieß erneut zu.
»Torf«, sagte Lianne noch einmal und sah zu, wie Bobby sich fluchend abmühte. »Das Zeug ist weich, Bobby. Du brauchst dich nicht so anzustrengen. Warte ...«
Sie hob die mitgebrachte Schaufel auf und hockte sich neben ihren Mann. Im Discovery Channel hatte sie einmal eine Sendung über Ausgrabungen gesehen und wusste, wie Archäologen zu Werke gingen. Obwohl sie wohl nie begreifen würde, warum die mitunter sechs oder acht Stunden am Tag in der Erde wühlten.
»Man muss behutsam vorgehen«. Lianne drückte die Spitze der Schaufel in den Boden. Ein säuerlicher Geruch schlug ihr entgegen. Er erinnerte sie an Cranberries, an ihren herben, mit Wodka vermischtem roten Saft. »Sieh her ...«
Sie kratzte an der Oberfläche und bemühte sich, den Geruch nicht einzuatmen. Und dann traf die Schaufel auf etwas Hartes. Lianne Dexter schluckte krampfhaft und fragte sich, ob sie sich möglicherweise gleich erbrechen musste. Tastend schob sie die Schaufel durch die Erde. Aber das Werkzeug traf offenbar immer wieder auf dasselbe geheimnisvolle Objekt.
Bobby bückte sich, nahm ihr die Schaufel ab und begann im Boden zu stochern. Ein wenig zu grob, wie sie fand.
»Was ist es?«, fragte Lianne.
Ein Gegenstand wurde sichtbar. Es hatte die Farbe von Torf, ein dunkles Holzbraun, und fühlte sich hart an. Bobby kratzte das Objekt noch ein wenig mehr frei, dann holten beide tief Luft und hockten sich auf die Fersen. Was sie vor sich sahen, schien die Darstellung eines menschlichen Arms zu sein. Eines weiblichen vermutlich, denn die Falten eines Kleiderärmels waren dem unbekannten Künstler verblüffend naturgetreu gelungen.
»Er sieht unglaublich echt aus«, stellte Lianne schließlich fest.
»Hallo«, rief Bobby mit ätzender Ironie. »Erde an Planet Lianne. Es ist eine Statue. Die müssen echt aussehen.«
»Aber sie haben nicht diese Farbe.«
»Lianne ...« Stöhnend verdrehte er die Augen. »Die Statue liegt seit Tausenden von Jahren in der Erde. Wie soll sie nach dieser Zeit denn aussehen? Strahlend weiß? Glaubst du denn, das Ding wurde schutzversiegelt, bevor es hier gelandet ist?«
Sie schwieg. Ein Punkt für ihn.
Bobby kratzte weiter. Am Ende des Arms tauchte eine Hand auf. Schmale Finger krallten sich um den Schaft eines massiven Geräts. Verblüfft starrten die beiden das Objekt im Boden an. Jetzt kam Lianne ihr Fund sehr feminin vor und überraschend bekannt. Dann klickte es und sie wusste, woran sie der Anblick erinnerte. Diese leblose – Gestalt da vor ihr sah aus wie eine kleinere Version der Freiheitsstatue, die eine Steinfackel umfasste, als wollte sie die hoch in den Himmel recken.
»Das ist kein Metall, Bobby«, erklärte sie mit einer Bestimmtheit, die sie fast ein wenig beunruhigte. »Warum hat dein Detektor sie trotzdem aufgespürt? Hast du dir das schon mal überlegt?«
Er funkelte sie finster an. »Manchmal verblüffst du mich wirklich. Da bin ich dabei, Tutenchamuns Sarkophag oder noch was Tolleres auszugraben, aber du kannst nichts anderes als nörgeln. Und jetzt lass mich gefälligst in Ruhe. Ich muss nachdenken.«
Er stand auf, ging einen halben Meter entfernt wieder in die Hocke und begann da zu scharren, wo er offenbar den anderen Arm vermutete. Und fand ihn natürlich, nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche. Vielleicht hatten die Regenfälle der letzten Tage etwas von der obersten Dreckschicht fortgespült. Vorsichtig entfernte Bobby die Erde zwischen den Armen. Der Oberkörper der Gestalt wurde sichtbar. Sie trug eine Art klassisches Gewand mit einem tiefen V-Ausschnitt, der den Ansatz der ungemein lebensechten Brüste freigab. Sie hatten die Farbe alten Leders und einen sonderbaren Schimmer. Einen Moment lang kam es Lianne vor, als würde die »Haut« unter dem Druck von Bobbys Schaufel nachgeben, aber vermutlich waren das immer noch Nachwirkungen des billigen Weins.
Bobby rutschte auf den Knien weiter und machte sich da zu schaffen, wo er den Rest des Körpers vermutete. Und das zu Recht. Schon bald sahen sie zwei Schienbeine vor sich, mit leicht gespreizten Knöcheln. Aber von keinerlei Gewandfalten bedeckt.
»Sie ist lebensgroß, Bobby«, sagte Lianne.
»Das sehe ich selbst!«
»Und was wirst du nun tun?«
»Himmel! Wenn dieser verdammte Tom Jorgensen mich jetzt sehen könnte. Hast du die Kamera mitgenommen?«
Lianne schüttelte den Kopf. »Vergessen.«
»Typisch. Vielen Dank.«
»Bobby!«
Er sah seine Frau an. Lianne wusste, wie streitlustig sie sich für ihn anhörte. Es machte ihr nichts aus. Irgendetwas ging hier vor sich, und vielleicht war es Zeit, sich endlich einmal zu behaupten.
»Was ich jetzt tun werde?«, äffte er sie nach. »Was ich will, Lianne. Genau das, was ich will, verdammt noch mal.«
»Das Ding ist zu groß. Du kannst es nicht als Übergepäck deklarieren. Außerdem hat es die Farbe von Scheiße. Und es stinkt. Riechst du das nicht?«
»Es lag Jahrtausende im Sumpf. Wie soll es da wohl riechen? Nach verdammten Rosen?«
Sie trat einen Schritt von der Statue zurück und verschränkte trotzig die Arme. »Ich finde den Gestank grauenhaft. Und hör auf so zu fluchen. Das gehört sich nicht.«
Unterdrückt fluchend rutschte Bobby zu der Stelle, wo sich der Kopf befinden musste, und begann, die Erde fortzuschaufeln. Lianne hoffte, dass der Kopf nicht mehr da war. Wünschte sich, dass Bobby einen Torso mit zwei Beinen fand. Musste Tom Jorgensen das nicht zum Schreien komisch finden?
Aber da war ein Kopf. Ein möglicherweise sogar schöner Kopf, wenn ihn erst jemand von Erde und Dreck befreit hatte. Während Bobby Dexter emsig schaufelte, begann seine Frau zu begreifen, was sie da gefunden hatten. Eine lebensgroße, römische Statue, vielleicht ein paar tausend Jahre alt. Durch diese ganze Zeit im Sumpf vielleicht ein wenig fleckig und verfärbt, aber sonst absolut perfekt erhalten. Sie wusste auch, was Bobby dachte. Wozu gab es Restaurateure? Vielleicht konnte einer von ihnen die Statue wieder in den strahlenden, weißen Marmor verwandeln, in den ursprünglichen Zustand, als Julius Cäsar oder irgendein anderer längst verblichener Italiener die Statue hatte anfertigen lassen.
Es gab nur ein kleines Problem. Sie war einfach zu groß. Nie im Leben konnten sie beide die Statue aus der Erde heben. Eine lebensgroße Steinfigur wog bestimmt eine Tonne. Selbst wenn sie sich von jemandem helfen ließen, gab es absolut keine Chance, das Ding in die USA zu schaffen.
»Lass uns verschwinden, Bobby«, flehte Lianne. »Wir können irgendwo anrufen und von unserem Fund berichten. Vielleicht erhalten wir eine Belohnung. Vielleicht kommen wir in die Zeitung. Den Artikel kannst du dann Tom Jorgensen unter die Nase halten und dich an seinem Neid weiden.«
»Die Belohnung kannst du vergessen«, fauchte er sie an. »Wir sind in Italien, Lianne. Wahrscheinlich reißen sie sich das Ding selbst unter den Nagel und bringen uns hinter Gitter, weil wir hier unbefugt herumgestöbert haben.«
»Und was willst du sonst tun?«
Sie widersetzte sich ihm, das war beiden klar. Sie standen an einer Art Wendepunkt in ihrer Ehe. Von dem aus jeder von ihnen nur in eine von zwei Richtungen gehen konnte: in die Selbstständigkeit oder die Unterwerfung.
Bobby Dexter stand auf und griff nach dem Spaten. Er fühlte das Gewicht in seinen Händen und starrte begierig auf die halb in der Erde verborgene Gestalt.
Lianne beobachtete ihn, und so etwas wie kalte Furcht stieg ihn ihr hoch.
»Bobby?«, fragte sie fast flehend. »Bobby ...?«
Kapitel 4
Nic Costa steuerte den unauffälligen Polizei-Fiat die Uferstraße am Tiber entlang. Neben ihm auf dem Beifahrersitz hockte Gianni Peroni, der Partner, den man ihm an diesem Morgen zugeteilt hatte, und stopfte sich ein dick mit Schweinebraten belegtes Panino in den Mund. Er war ein hoch gewachsener, muskulöser Mann Ende vierzig, mit unvergesslichen Zügen. Irgendwann musste er mit dem Gesicht – und Costa wusste, dass er sich entsprechende Fragen nicht mehr lange verkneifen konnte – gegen eine Wand geprallt sein. Seine Nase war übler zugerichtet als die eines Rugbyspielers. Unter seiner niedrigen Stirn saßen helle, schlaue Schweinsäuglein. Eine zerklüftete Narbe verlief diagonal über seine rechte Wange. Zur Vervollständigung des Bildes trug Peroni seine grauen Haare kurz geschoren wie ein US-Marine. In seinem dunklen Anzug über einem schneeweißen Hemd sah er aus wie ein Gangster, der sich für die Teilnahme an einer Hochzeit fein gemacht hatte. Es war in der Questura allgemein bekannt, dass der Mann in seiner gesamten Laufbahn gegenüber einem Kunden noch nie handgreiflich geworden war. Das brauchte er auch nicht, dachte Costa. Die Typen warfen einen Blick auf ihn, schluckten trocken und benahmen sich anständig. Das war einer der Gründe dafür, dass Peroni als einer der beliebtesten und am meisten respektierten Kommissare der Truppe galt. Ein Mann, von dem Costa nie erwartet hätte, dass er ganz selbstverständlich mit ihm Streife fahren würde.
»Keine Ahnung, woher sie die Frechheit nehmen, dieses Zeug porchetta zu nennen«, murrte Peroni. »Da, wo ich herkomme ... aus einem kleinen Ort in der Nähe von Siena. Da gibt es nichts anderes als Landwirtschaft – zu gewöhnlich für die Touristen. Da wird an jedem Wochenende porchetta zubereitet. Mein Onkel Freddo war Bauer. Er hat mir gezeigt, wie es gemacht wird. Man schlachtet das Ferkel und beint es aus. Dann nimmt man die Leber und legt sie in Grappa ein. Dann bleibt man die ganze Nacht auf, um das Vieh im Ofen zu backen. Freddo sagte immer, das wäre die einzige Nacht in der Woche, die er neben einem Schwein verbringt, das nicht schnarcht.«
Peroni musterte ihn, wartete auf eine Reaktion. »Schon gut. Vielleicht müssten Sie seine bessere Hälfte kennen, um den Scherz zu kapieren. Aber das war wenigstens porchetta. Warm, saftig und mit einer knusprigen Kruste. Dieser Mist lag doch tagelang im Kühlschrank. Wollen Sie mal probieren?«
Misstrauisch beäugte Costa das blasse, trockene Fleisch. »Nein, danke. Nicht hinter dem Steuer. Außerdem esse ich kein Fleisch.«
Peroni zuckte mit den Schultern, kurbelte das Fenster herunter und schleuderte die fettige Papierhülle in den römischen Frühlingsmorgen hinaus. »Oh, habe ich ganz vergessen. Ihnen entgeht einiges.«
Costa nahm kurz den Blick von der belebten Straße und sah Peroni an. »Das ist Umweltverschmutzung. So etwas lasse ich aus meinem Auto heraus nicht zu.«
»›Das ist Umweltverschmutzung, commissario‹ wollten Sie wohl sagen.«
»Nein«, widersprach Costa. »Sie haben gehört, was Falcone gesagt hat. Solange wir miteinander Dienst tun, sind wir gleichgestellt.«
In Peronis eigentümlich starren Gesichtszügen begann es zu zucken. »Gleichrangig, gleichberechtigt ... Wie kann Leo mir das nur antun? Nicht zu fassen, was er sich erlauben darf, ohne dass ihn jemand zur Rechenschaft zieht. Dabei sollten Leo und ich dicke Kumpel sein. Hat denn Freundschaft in dieser Welt überhaupt keine Bedeutung mehr?«
Sobald Costa erfuhr, dass Peroni sein neuer Partner sein würde, hatte Costa einen Entschluss gefasst. Auf keinen Fall würde er sich irgendwelchen Mist anhören, sich wie ein Untergebener verhalten. Vielleicht hatte Falcone sie sogar deshalb zu Partnern gemacht. Es war eine Lektion, eine Art Bestrafung für sie beide.
Gianni Peronis Vergehen war in der Questura allgemein bekannt und wurde mit einer gewissen Ehrfurcht weiterverbreitet, als Gleichnis dafür, dass selbst die Gescheitesten und Besten in Ungnade fallen konnten, und das, wegen einer eher lässlichen Sünde. Jahrelang hatte er sich im Sittendezernat nach oben gearbeitet, ohne sich auch nur das Geringste zu Schulden kommen zu lassen. Als Kommissar war es ihm gelungen, drei der größten Zuhälterringe zu knacken und den Einfluss der albanischen Ganoven auf das Prostitutionsgewerbe einzudämmen, die begonnen hatten, auch in anderen Bereichen des Verbrechens die Macht an sich zu reißen. Allerdings hatte er sich nicht nur Freunde gemacht. Nie machte er einen Hehl aus der Tatsache, dass er im tiefsten Herzen ein Bauernsohn aus der Toskana geblieben war, der sich in den oberen Etagen der Polizeitruppe nicht unbedingt wohl fühlte. Dennoch schien ihm ein Karrieresprung vorbestimmt. Ohne sein bizarres Aussehen wäre der möglicherweise inzwischen sogar erfolgt. Doch an einem Abend vor wenigen Wochen verpatzte er alles. Durch einen kleinen Fehltritt, auf den sich die Medien mit geradezu hämischer Freude stürzten.
Es sollte ein großer Coup der Direzione Investigativa Anti-Mafia werden, der zivilen Eingreiftruppe zur Abwehr des organisierten Verbrechens. Mit in Bologna rekrutierten Zuhältern hatte die DIA in Testaccio ein Bordell etabliert. Nach drei Wochen lief der Betrieb bereits so gut, dass die wirklich großen Bosse der Branche die Stirn runzelten. Lange würden sie es sich nicht gefallen lassen, dass andere ihnen den Profit streitig machten.
An einem Donnerstagabend tauchten prompt drei schwere Jungs auf. Als die DIA zuschlug, stellten sie – rein aus Interesse – die Personalien der Kunden fest, bevor sie die an die Polizei weitergaben. Gianni Peroni hatte das Unglück, im Zimmer einer jungen, blonden Tschechin erwischt zu werden. Er versuchte mit Erklärungen und Ausreden seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aber es half nichts. Schon bald wusste die Questura Bescheid. Zunächst wurde Peroni beurlaubt und dann zum einfachen Kriminalpolizisten zurückgestuft. Dabei konnte er sich noch glücklich schätzen. Jeder andere hätte sich einen neuen Beruf suchen müssen.
Wenn den Gerüchten in der Questura Glauben geschenkt werden konnte, waren Degradierung und Gehaltseinbußen Peronis geringste Sorgen. Er wurde nicht nur als hervorragender Polizist geschätzt, sondern auch als rührender Familienvater. Seine Frau und seine beiden halbwüchsigen Kinder, ein Mädchen und ein Junge, waren allen bekannt. Er lud Angehörige seines Dezernats regelmäßig zum Essen zu sich nach Hause ein. Wenn sie Probleme hatten, verhielt sich Peroni wie ein besorgter Vater, bot seinen Rat und seine Hilfe an.
All das wurde an einem kalten Januarabend zunichte gemacht. Peroni wurde nicht vor Gericht gestellt. Er hatte gegen kein Gesetz verstoßen. Er hatte nur alles verloren. Seine Frau war mit beiden Kindern nach Siena zurückgekehrt, bestand auf unverzüglicher Scheidung und schrie Zeter und Mordio über seinen schändlichen Ehebruch. Innerhalb weniger Wochen war Peroni von einem hoch angesehenen Polizisten und geliebten Familienvater zu einem allein stehenden Mann in mittleren Jahren geworden, dessen berufliche Zukunft mehr als vage aussah. Und jetzt hatte ihn Leo Falcone mit Nic Costa zusammengetan, dessen Aussichten bei der Polizei ähnlich ungewiss waren. Costa wusste nicht recht, wie er damit umgehen sollte. Doch das ging Gianni Peroni nicht anders, nahm er an.
Die kleinen römischen Tempel an der Piazza della Bocca della Verità tauchten vor dem Fenster auf, zwei harmonische Rundbauten aus einer anderen, idyllischen Welt. Es war ein sonniger Tag und warm genug, um das Kommen des Frühlings anzudeuten. Nic Costa wünschte, er könnte sich eine Weile da draußen neben die Säulen setzen und nachdenken.
»Was halten Sie von ein paar grundsätzlichen Bemerkungen?«
Costa blickte in Peronis Gesicht und fragte sich, wann er sich an den Gedanken gewöhnen würde, seinen Dienstwagen mit jemandem zu teilen, der aussah wie die Karikatur eines Schurken. »Wenn Sie mögen.«
»Lassen Sie mich ganz offen sein. Es ist noch nicht lange her, seit Sie durchgedreht sind. Sie haben auch mehr als einen über den Durst getrunken. Mich hat man mit heruntergelassenen Hosen bei einer tschechischen Nutte erwischt. So wie ich es sehe, muss ich jetzt dafür den Bewährungshelfer geben. Wenn ich es schaffe, Sie etwa einen Monat lang von der Flasche fern zu halten, und es uns gelingt, ein paar Kriminelle dingfest zu machen, kann ich mir Pluspunkte bei Leo verdienen. Möglicherweise kann ich dann bald wieder das tun, was ich am besten verstehe – ein Ermittlungsteam leiten –, und brauche nicht länger in einem stinkenden Dienstwagen zu sitzen, um den Aufpasser für einen Untergebenen zu spielen, damit der nicht zur Flasche greift. Ich werde alles tun, um Leo zufrieden zu stellen. Aber Sie müssen mir helfen. Je eher Sie das tun, desto schneller sind Sie mich los und bekommen einen anderen Partner. Verstanden?«
Costa nickte.
»Und noch etwas. Ich hasse Alkohol. Ich musste zu oft erleben, wie Männer zu stinkbesoffenen Scheißkerlen wurden. Wenn Sie mir das antun, kann ich sehr unangenehm werden. Und das wird Ihnen bestimmt nicht gefallen. Es gefällt niemandem.«
»Ich werde mich bemühen, daran zu denken. Wie wäre es mit einer Gegenleistung? Mit einem Versprechen, Nutten aus dem Weg zu gehen?«
Peroni musterte ihn so finster, dass es Costa unwillkürlich mit der Angst zu tun bekam. »Nehmen Sie den Mund nicht so voll. Ich weiß, dass Leo sein Händchen über Sie hält. Der dumme Hund fühlt sich schuldig für das, was Ihnen zugestoßen ist. Keine Ahnung warum. Soweit mir bekannt ist, haben Sie sich selbst in die Scheiße geritten.«
Costa biss nicht auf den Köder an. »Nein, ich meine es ernst. Es interessiert mich. Jedermann war überzeugt, Sie ganz genau zu kennen. Den ehrenwerten Polizisten mit der harmonischen Familie, dem untadeligen Lebenswandel. Jetzt denken alle, sie hätten sich geirrt. Und fragen sich, bei wem der Fehler lag. Bei ihnen oder bei Gianni Peroni.«
»Bei mir«, entgegnete Peroni ohne zu zögern. »Aber lassen Sie mich Ihnen eins klarstellen. Alle haben irgendwo einen dunklen Punkt. Jeder fragt sich, wie es wäre, dem nachzugeben. Selbst Sie. Wenn Sie zu wissen glauben, was gut für Sie ist.«
»Ich dachte, das wäre etwas, was Sie sich nie erlauben würden.«
»Ich spreche vom Alkohol. Menschen, die trinken, tun es mit einer bestimmten Absicht. Um etwas zu töten. Vielleicht wäre es besser, wenn sie stattdessen ihren verborgenen Wünschen nachgeben würden. Nur dann und wann.«
Wie philosophisch, dachte Costa. So etwas hätte er von einem Polizisten kaum erwartet, und schon gar nicht von Gianni Peroni.
»Eine letzte Bemerkung, Junge. Ich habe gesehen, wie Sie heute mit Barbara Martelli in die Questura gekommen sind. Ist sie nicht wirklich das zauberhafteste Wesen von der Welt? Was wäre, wenn sie eines schönen Tages, an dem Sie Ihre Ehe für ebenso glücklich halten wie Ihre Zukunft gesichert, auch wenn Sie nicht mehr der Jüngste sind, zu Ihnen sagen würde: ›Nic, ich wüsste zu gern, wie das ist. Nur ein einziges Mal. Was kann es schon schaden? Wer sollte etwas davon erfahren?‹«
»Ich bin nicht verheiratet.«
»Das weiß ich. Wenn, habe ich gesagt.« Peroni schien auf eine Reaktion zu warten, aber es kam keine. »Sie sollten sich mit dem Mädchen verabreden. Da ist so etwas in ihren Augen, wenn sie Sie ansieht. So etwas entgeht mir nicht.«
Costa lachte. »Wirklich?«
»Wirklich. Und noch eins. Ich kenne ihren Vater. Er war bis vor wenigen Jahren bei der Sitte. Einer der übelsten Burschen, die mir je unter die Augen gekommen sind. Wie der eine solche Frau zeugen konnte, wird mir unbegreiflich bleiben. Na, ist das etwa kein guter Grund, sich nicht mit ihr zu verabreden? Sonst müssten Sie den Mistkerl irgendwann kennen lernen.«
»Danke.«
»Keine Ursache. Sie scheinen ein Typ zu sein, der Begründungen dafür schätzt, etwas nicht tun zu müssen. Bis ich aus diesem Dienstwagen erlöst werde, kann ich damit gut leben. Haben wir uns verstanden?«
Costa brauste nicht auf. Auf gewisse Weise fühlte er sich erleichtert. Zumindest wusste er jetzt, woran er war.
»Ich denke schon«, sagte er. »Können wir uns darauf verständigen, dass wir einfach zwei Bullen sind, die auf den Straßen von Rom für Ordnung ...?«
Aber der Hüne auf dem Beifahrersitz brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. Die Zentrale plärrte ihre Nummer. Peroni griff nach dem Mikro und meldete sich. Wenig später trat Nic Costa aufs Gas, raste durch Piramide und auf die Autostrada Richtung Flughafen und Küste. Er schaltete Blaulicht und Sirene ein, um die anderen Autos aus dem Weg zu scheuchen.
»Was für ein Tag«, stöhnte Peroni. »Erst muss ich den Babysitter spielen, jetzt sind wir die Feuerwehr. Schwer zu sagen, was schlimmer ist.«
Kapitel 5
Bobby Dexters Gesicht hatte den entschlossenen Ausdruck, den Lianne gut kannte. Normalerweise verhieß der nichts Gutes.
»Ich werde dir sagen, was wir machen«, erklärte er. »Wir werden einen Kopf mitnehmen, der Tom Jorgensen vor Neid erblassen lässt. Einen, der tausendmal besser ist als sein griechischer Mist.«
Entsetzt riss die die Augen auf. »Was?«
Bobby hob den Spaten in Schulterhöhe und schwang ihn wie eine Axt. »Sieh her. Sieh zu, du kannst etwas lernen.«
Wuchtig hieb er auf die Stelle ein, wo der Hals der Statue sein musste. Viel geschah nicht. Ein paar Erdbrocken flogen hoch. Aber Lianne schrie wie am Spieß, lauter als jemals zuvor in ihrem Leben.
»Bobby Dexter! Was zum Teufel tust du da? Das ist ein Kunstwerk. Von geschichtlichem Wert. Und du willst es zerschlagen, nur um zu beweisen, dass du einen größeren Schwanz hast als Tom Jorgensen?«
Leicht schwankend hob er erneut den Spaten. »Woher weißt du, wie groß Jorgensens Schwanz ist?«
»Das war eine Metapher, du Schwachkopf.«
Bobby Dexter blinzelte sie an. Er sah geradezu abstoßend aus. Die Dämmerung hüllte die Welt in einen unheimlichen, düsteren Schein. Bobby schlug mit dem Spaten auf den Hals der Statue ein, verfehlte ihn aber und wirbelte nur Erde auf, die ihm ins Gesicht spritzte. Ein paar Krümel gerieten ihm in den Mund. Er spuckte das Zeug aus, als wäre es giftig.
»Wenn du die Statue zerstörst, ist es aus mit uns, Bobby«, sagte sie kalt. »Das ist keine leere Drohung. Diesmal beschwere ich mich nicht bei meinem Vater. Ich nehme mir einen Anwalt. Sobald wir in Seattle gelandet sind.«
Er zögerte, schien zu überlegen, ob sie es tatsächlich ernst meinte. »Sag das noch einmal, wenn wir mit diesem Prachtstück wieder zu Hause sind. So etwas findest du im ganzen Staat Washington nicht in Privatbesitz. Ich wette, du hast keine Ahnung, wie dekorativ sich das auf Dinnerparties macht.«
»Bobby ...«, schrie Lianne.
»Halt den Mund.« Er holte aus.
Diesmal traf er. Tief drang die scharfe Kante des Spatens in den Hals. Sie hätten ein scharfes Knacken hören müssen, das auf eine gelungene Spaltung des Steins hinwies, mit gerade so viel Absplitterungen, um überzeugend zu wirken. Lianne kannte ihren Mann gut genug, um zu wissen, was er dachte. Vermutlich zuckten bereits die verrücktesten Pläne durch seinen Kopf.
Doch davon konnte keine Rede mehr sein, nachdem der Spaten zugestoßen hatte. In diesem Moment begriff Lianne Dexter ihren verhängnisvollen Irrtum. Sie hatten gesehen, was sie sehen wollten. Nicht das, was da war. Vielleicht sogar mit Grund. Denn die Realität erwies sich als etwas, dem sie nirgendwo auf diesem Planeten begegnen wollten, am wenigsten ganz allein an einer kleinen Landstraße, neben einem grauen, stinkenden Fluss in einem Land, in dem ihre Sprachkenntnisse gerade einmal ausreichten, um Pizza, Bier und Wein zu bestellen.
Das Spatenblatt hatte keinen harten Stein durchtrennt, sondern Fleisch, zumindest eine Art von Fleisch. Eine Substanz, die wie braunes, zähes Leder wirkte, aber elastisch war. Das Werkzeug hatte den Hals an der Stelle durchschnitten, wo er in die Schultern überging, und etwas verletzt, das aussah wie eine menschliche Sehne, und sie dabei beide mit einer übel riechenden feuchten Masse bespritzt, die eindeutig etwas Organisches, fast Lebendiges zu enthalten schien.
An Liannes Gesicht klebten Erdbröckchen, die sie bei Bobbys Fehlschlag überrieselt hatten. Hilflos schluchzend und würgend spieh sie Torffasern aus.
Sie hielt kurz inne und beobachtete, wie Bobby sich bückte, um das Objekt genauer zu betrachten. Irrte sie sich, oder zeigten seine Züge tatsächlich einen Anflug ehrfürchtiger Scheu?
Auf dem Boden vor ihnen lag der halb vom Körper getrennte Kopf eines jungen Mädchens von sechzehn oder siebzehn Jahren. Es trug ein klassisches Gewand und hielt einen großen Stab in der linken Hand. Die Wucht des Spatenhiebs hatte die Torfschicht über ihrem Gesicht größtenteils entfernt. Was jetzt von ihren Zügen zu sehen war, konnte nicht anders denn als schön bezeichnet werden. Sie hatte eine hohe Stirn und ausgeprägte Wangenknochen. Kein Fältchen verunzierte ihre makellose Lederhaut. Die Augen waren geschlossen, die Lippen wie zu einem letzten Seufzer leicht geöffnet. Sie hatte perfekte Zähne, deren einstmals strahlendes Weiß inzwischen durch das Liegen in der Torferde bräunlich verfärbt waren. Ihre langen Haare waren im Nacken zusammengefasst und zu festen Strähnen verklebt. Ihr Gesichtsausdruck wirkte unendlich friedlich. Sie sieht glücklich aus, dachte Lianne Dexter, was unter den gegebenen Umständen natürlich völlig absurd war.
Falls noch ein Hauch des Zweifels daran bestehen sollte, was da vor ihnen lag, schwand der beim Anblick des Halses. Mit seinem letzten Hieb war Bobby genau das gelungen, was er erhofft hatte: eine saubere Trennung. Jetzt blickten Bobby und Lianne Dexter in das Innere eines menschlichen Rachens, und das war ein Durcheinander von schwärzlichem Gewebe, Knochen, Sehnen und Röhren, die sie vage an eine längst vergangene Schulstunde in Anatomie erinnerten.
»Großer Gott«, murmelte Bobby und begann zu zittern.
Eine 474 dröhnte tief über ihre Köpfe hinweg. Sie spürten die Hitze der Abgase, rochen Kerosingestank. Als das Getöse verklang, drang ein anderes Geräusch an Bobby Dexters Ohren. Es war das heulende Schluchzen seiner Frau.
»Nein«, flehte er. »Nicht jetzt, Lianne. Verdammt noch mal, ich muss nachdenken.«
Lange dachte er nicht mehr nach. Zwei Männer kamen auf sie zu. Irgendwo hinter ihnen rumpelte ein Feuerwehrwagen auf die verkohlten und rauchenden Trümmer des Clio zu.
Die Männer schwenkten Dienstmarken. Sie sahen nicht sympathisch aus.
Der Ältere war ein stiernackiger Gorilla mit einem entstellten Gesicht und durchdringenden, bohrenden Augen, die ganz so aussahen, als würde ihnen absolut nichts entgehen. Der jüngere, kleinere Mann betrachtete das Objekt in der Erde, die lederfarbene Leiche mit ihrem nahezu abgetrennten Kopf.
»Dieser Tag wird immer verrückter«, knurrte Gianni Peroni. »Kneifen Sie mich. Sagen Sie mir, dass ich träume.«
»Sie träumen nicht.« Wie gebannt starrte Nic Costa auf die halb von Schlamm verdeckte Gestalt. Warf keinen Blick auf die schluchzende Frau, die aussah, als hätte sie sich übergeben, und nun zusammengekauert am Flussufer hockte. Auch nicht auf den Mann, der leicht schwankend einen Spaten in seinen Händen hielt.
»Hören Sie. Legen Sie sich bloß nicht mit mir an. Ich bin amerikanischer Staatsbürger.«
Teil Zwei: Die Iden des März
Kapitel 6
»Wie lange hat sie da in der Erde gelegen? Können Sie mir das vielleicht sagen?«
Teresa Lupo stand vor den bräunlich verfärbten menschlichen Überresten, die jetzt auf dem glänzenden Stahltisch im Leichenschauhaus lagen. Die Pathologin benahm sich noch gluckenhafter als sonst hinsichtlich der Toten in ihrer Obhut und wirkte ungemein zufrieden mit sich selbst. Vor zwei Wochen waren Nic Costa und Gianni Peroni am Ufer des Tiber auf die Leiche und das verstörte amerikanische Ehepaar gestoßen, wenige Kilometer von der Mündung in Ostia entfernt. Bobby und Lianne Dexter befanden sich längst wieder in Seattle, um mit ihren Anwälten über ihre Scheidung zu sprechen und darüber, wer das Sorgerecht für die Katzen bekam. Sie schätzten sich noch immer glücklich, Europa ohne eine einzige Anklage entronnen zu sein. (Was Lianne wieder einmal bewies, was für seltsame Menschen Italiener waren.) Costa und Peroni hatten sich inzwischen irgendwie zusammengerauft, wenn auch nicht zu einem echten Team, so doch zu Partnern, die ihre gemeinsamen Stunden mit Pflichtgefühl überstanden – und mit der Hoffnung, dass ihre Zwangsbeziehung bald enden würde.
Die Leiche machte ein paar Tage lang international Schlagzeilen. Irgendjemand hatte den Medien ein Foto zugespielt, das die starren Gesichtszüge der Leiche aus dem Tibersumpf zeigte. Man stand vor einem Rätsel. Niemand konnte etwas über das Alter der Toten sagen. Niemand wusste, ob das Mädchen eines natürlichen Todes gestorben oder einem obskuren Verbrechen zum Opfer gefallen war. In den Massenblättern wurden wilde Spekulationen angestellt. Es gab Geschichten über altertümliche Kulte, deren Anhänger getötet wurden, wenn sie das Aufnahmeritual nicht bestanden.
Nic Costa enthielt sich allen Mutmaßungen. Bevor Teresa Lupo ihr Urteil gefällt hatte, blieb alles ein Stochern im Nebel. Jetzt schien sie zu Erkenntnissen gekommen zu sein, denn sie hatte sie für zehn Uhr zu sich zitiert. Um zwölf wollte Teresa den Journalisten ihre Befunde mitteilen. Die Tatsache, dass sie die Pressekonferenz einberufen hatte, ohne Leone Falcones Erlaubnis einzuholen, sprach Bände. Es bedeutete, dass es keine kriminalpolizeilichen Ermittlungen geben würde. Nic Costa und Peroni waren lediglich aus Höflichkeit ins Leichenschauhaus gebeten worden. Als Finder des Untersuchungsobjekts hatten sie es verdient, über seine Geheimnisse aufgeklärt zu werden. Costa wünschte, Teresa hätte sie verschont. Er bekam langsam wieder ein Gefühl für die Polizeiarbeit, freundete sich sogar mit der Idee an, in seinem Job gut sein zu können. Wenn das hier gar kein Fall war, verschwendete er nur Zeit, die er bei echten Ermittlungen verbringen konnte.
Falcone, Peroni und Costa saßen nebeneinander auf einer kalten, harten Bank und sahen zu, wie die Pathologin pedantisch ein paar letzte Untersuchungen anstellte. Costa wusste, was das hier war: ein Probelauf für die Pressekonferenz, die zu ihrer Rückkehr in den Polizeidienst gehörte. Nach dem Fall Denney hatte Teresa Lupo ihren Job aufgegeben und geschworen, ihn nie wieder aufzunehmen. Als Luca Rossis Freundin war sie tief betroffen über seinen Tod. Vielleicht sogar noch mehr als Nic Costa. Mit Sicherheit mehr als Falcone, der sich zwar insgeheim mit Schuldgefühlen herumschlug, aber viel zu besessen von seinem Job war, um sich lange ablenken zu lassen.
Trauer hatte Teresa Lupo aus der Truppe vertrieben, die Abhängigkeit brachte sie wieder zurück. Sie war wie sie alle: süchtig und unfähig, sich zu enthalten. Sie befasste sich intensiv mit ihren Toten, versuchte deren Leben zu erforschen und was sie auf ihren Untersuchungstisch gebracht hatte. Diese Geheimnisse zu ergründen ist Erfüllung für sie, dachte Costa, und das sieht man ihr an. Sie hatte ein bisschen Gewicht verloren. Der Pferdeschwanz war verschwunden. Jetzt trug sie ihre schwarzen Haare kurz geschnitten, mit modischen Fransen, um ihren kräftigen Nacken zu kaschieren. Sie besaß ein schmales, lebhaftes Gesicht und leicht vorquellende blaue Augen, die unablässig herumzuhuschen schienen. Die Frau hatte fast etwas Obsessives an sich, etwas, das die meisten Männer, die ihr näher kommen wollten, sehr schnell wieder vertrieb. Vielleicht war es das, was sie trotz ihres unberechenbaren Temperaments und ihrer scharfen Zunge bei den Polizisten zur beliebtesten Pathologin machte ...
»Zehn Jahre, höchstens zwanzig«, äußerte Peroni. »Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein degradierter Bulle von der Sitte. Falls ich irgendwelchen Mist baue, tragen Sie die Verantwortung, Leo. Ich bin den Umgang mit Leuten gewöhnt, an deren Schuld von Anfang an kein Zweifel besteht. Diese ganze Vermuterei ... ist einfach nicht mein Bier.«
Falcone hielt sich eine Hand ans Ohr. »Wie bitte?«
»Wie gesagt, Ispettore«, murmelte Peroni unterwürfig. »Sie müssen mir mögliche Schnitzer schon nachsehen, Ispettore.«
Nachdenklich strich sich Falcone durch seinen grauen Spitzbart und blickte auf die Leiche. Sein grauer Anzug sah aus, als hätte er ihn erst heute früh gekauft. Gestern war er aus einem Urlaub irgendwo im Süden zurückgekehrt. Tiefe Bräune überzog sein Gesicht und den kahlen Schädel. Seine Haut hatte fast die Farbe der Leiche auf dem Untersuchungstisch. Der Inspektor schien meilenweit weg zu sein. Vielleicht war er in Gedanken noch immer am Strand oder wo er sonst seine Ferien verbracht hatte. Vielleicht dachte er über die Dienstpläne nach. Eine Grippewelle hielt die Stadt fest im Griff. In der Questura standen so viele Schreibtische leer wie sonst nur an Weihnachten.
Teresa schmunzelte. Peroni hatte genau das gesagt, was sie hören wollte. »Das ist eine durchaus vernünftige Annahme, selbst für einen degradierten Bullen von der Sitte. Ihre Begründung ...«
Er zeigte auf die Leiche. »Sehen Sie sie an. Ihr Zustand ist nicht der Beste, aber sie stinkt kaum. Keine Spuren von Verwesung. Ich wette, Sie haben schon Schlimmeres gesehen. Und gerochen.«
Sie nickte. »Das kommt von der Behandlung. Seit sie hier ist, liegt sie in einer Lösung. Fünfzehn Prozent Polyäthylen-Glycol in destilliertem Wasser. Ich habe mich gründlich informiert. Bücher gelesen. Mit Leuten gesprochen. Per E-Mail stehe ich in Kontakt mit Wissenschaftlern in England, die wissen, wie eine Leiche in diesem Zustand behandelt werden muss. In etwa zehn Wochen werden wir sie gefriertrocknen müssen, um unsere Arbeit korrekt abschließen zu können.«
»Müssen wir sie denn nicht irgendwann begraben?«, fragte Costa. »Ist das bei Toten nicht üblich?«
Teresa Lupo verzog erstaunt ihr Gesicht. »Machen Sie Witze? Glauben Sie denn, dass die Universität das gestattet?«
»Seit wann gehört sie der Universität?«, wandte er ein. »Sie war ein Mensch – ganz unabhängig davon, wie alt sie ist. Offenbar gibt es keinerlei Grund für kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Wo liegt dann das Problem? Seit wann wird aus einer Leiche, die eines natürlichen Todes gestorben ist, ein Untersuchungsobjekt? Wer entscheidet das?«