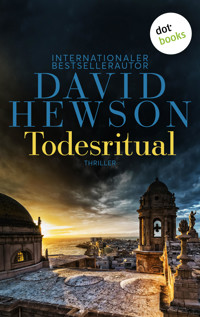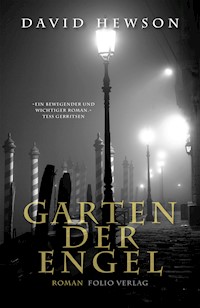
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Vor der einzigartigen Kulisse Venedigs erzählt David Hewson eine mitreißende Geschichte von Widerstand, Liebe und Zivilcourage. Als der fünfzehnjährige Nico Uccello seinen Großvater Paolo im Krankenhaus besucht, vertraut ihm der todkranke Mann ein Manuskript an, das Nicos Leben und seinen Blick auf den geliebten "Nonno" radikal verändern wird. Im Herbst 1943 ist Venedig von deutschen Truppen besetzt. Der junge Paolo Uccello kämpft nach dem Tod seiner Eltern um den Erhalt des Familienunternehmens, einer traditionsreichen Seidenweberei. Nur widerwillig bietet er im heruntergekommenen Palazzo der Familie dem jüdischen Geschwisterpaar Mika und Giovanni Unterschlupf. Beide gehören dem italienischen Widerstand an und sind auf der Flucht vor den Nazischergen. Bald aber droht die Deportation der gesamten jüdischen Gemeinde Venedigs und Paolo muss eine Entscheidung treffen. Wird er den Mut aufbringen, das Richtige zu tun? Könnten wir es? Vom Autor der Bücher zur TV-Serie "Kommissarin Lund – Das Verbrechen". "Eine der Fragen, die ich beantworten wollte, war: Was bringt einen ganz normalen, nicht besonders heldenhaften Bürger dazu, sein Leben und das seiner Familie zu riskieren, um sich dem Terror entgegenzustellen? Woher kommt dieser Mut?" (David Hewson)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: privat
David Hewson, geboren 1953, lebt in Kent. Er hat zwölf Romane geschrieben, die in Italien spielen. Mit siebzehn verließ er die Schule und arbeitete von da an als Reporter, u. a. für The Times, The Sunday Times und The Independent. Bekannt wurde er durch die Krimiserie um den römischen Kommissar Nic Costa und seine Roman-Adaption der dänischen TV-Serie The Killing (dt. Das Verbrechen). Venedig besucht er seit dreißig Jahren.
Birgit Salzmann, geboren 1964, studierte Deutsche Sprache und Literatur, Anglistik und Romanistik und übersetzt englischsprachige Literatur ins Deutsche. Nach Venedig zieht es auch sie seit über 25 Jahren. Sie lebt in Marburg.
Vor der einzigartigen Kulisse Venedigs erzählt David Hewson eine mitreißende Geschichte von Widerstand, Liebe und Zivilcourage.
Als der fünfzehnjährige Nico Uccello seinen Großvater Paolo im Krankenhaus besucht, vertraut ihm der todkranke Mann ein Manuskript an, das Nicos Leben und seinen Blick auf den geliebten »Nonno« radikal verändern wird.
Im Herbst 1943 ist Venedig von deutschen Truppen besetzt. Der junge Paolo Uccello kämpft nach dem Tod seiner Eltern um den Erhalt des Familienunternehmens, einer traditionsreichen Seidenweberei. Nur widerwillig bietet er im heruntergekommenen Palazzo der Familie dem jüdischen Geschwisterpaar Mika und Giovanni Unterschlupf. Beide gehören dem italienischen Widerstand an und sind auf der Flucht vor den Nazischergen.
Bald aber droht die Deportation der gesamten jüdischen Gemeinde Venedigs und Paolo muss eine Entscheidung treffen. Wird er den Mut aufbringen, das Richtige zu tun? Könnten wir es?
»Einfühlsam geschrieben, mit einer unglaublichen Wendung am Ende, ist Garten der Engel vor allem eine hervorragende Schilderung der Zeit und der einmaligen Stadt am Wasser.«The Times
Foto: Shutterstock
1. San Pietro di Castello. Kleine bewohnte Insel neben dem Arsenale. Erreichbar über die Via Garibaldi.
2. Basilika San Pietro di Castello. Einst die wichtigste Kirche Venedigs, bis ihr die Basilika San Marco den Rang ablief. Riesiges Gebäude mit ungewöhnlichem, getrennt vom Kirchengebäude stehendem Glockenturm.
3. Giardino delle Vergini. Standort des fiktiven Haupthandlungsortes, aber ohne Skulpturen. Der Garten der Engel ist ein Hybrid aus diesem Park und dem Parco „Villa Groggia“ in Cannaregio.
4. Garibaldi-Denkmal. Es zeigt im Park der Giardini Giuseppe Garibaldi auf einem Steinsockel, am Fuß flankiert von einem Löwen und einem Soldaten.
5. Via Garibaldi. Hauptstraße dieses Teils von Castello. Früher ein Kanal, der fast zur Gänze zugeschüttet wurde. Castello ist bis heute ein Arbeiterviertel. Die lokale kommunistische Partei hat hier noch immer ein Vereinslokal.
6. San Francesco della Vigna. Schöne Kirche mit einer Fassade von Palladio in der Nähe des Hauses von Chiara Vecchi.
7. Ospedale SS Giovanni e Paolo. Das „schönste Krankenhaus der Welt“ befindet sich in der ehemaligen Scuola Grande di San Marco mit kunstvollem Eingang aus der venezianischen Frührenaissance. Die Person des Diamante wurde von Giuseppe Jona inspiriert, dem jüdischen Direktor des Krankenhauses, der seine Stelle durch die faschistischen Rassengesetze verlor.
8. Rosa Salva – SS Giovanni e Paolo. Berühmtes Café. Diamante und Garzone treffen sich hier zu ihren Gesprächen.
9. San Michele in Isola. Friedhofsinsel, die Paolo Uccello von seinem Krankenhausbett im „Giovanni e Paolo“ aus sehen kann.
10. Ca’ Giustinian. Nach 1943 Hauptquartier der Deutschen. Eine von Partisanen im Juli 1944 gelegte Bombe zerstörte das Gebäude fast völlig. Die Vergeltungsmaßnahme folgte zwei Tage darauf: Dreizehn inhaftierte Partisanen wurden auf den Trümmern erschossen. Heute Sitz der Biennale. Diente als Vorbild für das Ca’ Loretti.
11. Jüdisches Museum. Modernes Museum, erzählt vom jüdischen Leben in Venedig im Laufe der Jahrhunderte und dokumentiert die Gräueltaten der Nazis und der faschistischen Helfer im Krieg.
12. Ghetto. Erstes Ghetto der Welt – ein Viertel, in dem die Juden im 16. Jahrhundert von der Republik Venedig gezwungen wurden zu leben. Es war das Viertel der Gießereien, das Wort Ghetto leitet sich vom venezianischen „géto“ ab, dem Gießen des flüssigen Eisens.
13. Parco „Villa Groggia“. Ruhiger Park mit Skulpturen. Zusammen mit dem Giardino delle Vergini Inspiration für den fiktiven Garten der Engel.
14. Jüdischer Friedhof. Jüdische Begräbnisstätte auf dem Lido.
DAVID HEWSON
GARTEN DER ENGEL
ROMAN
Aus dem Englischen von Birgit Salzmann
Ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der die Zeitzeugen dieser schrecklichen Phase deutscher Geschichte mehr und mehr sterben, in der wir als nachfolgende Generationen vor der Verantwortung stehen, richtige Entscheidungen zu treffen, und dass sich in dieser Phase entscheiden wird, ob wir wirklich aus der Geschichte gelernt haben oder ob das von den zukünftigen Generationen sozusagen doch nicht so verinnerlicht wurde.
Angela Merkel, 20. Juli 2018
Inhalt
Kapitel 1
Die Frau in der Lagune
Kapitel 2
Die Besucher
Kapitel 3
Wirrungen und Irrungen
Kapitel 4
Verrat
Kapitel 5
Blut auf dem Pflaster
Kapitel 6
Monster aus Gewohnheit
Anmerkungen des Autors
Zitatnachweise
1
Ich muss vier oder fünf gewesen sein. Nonno Paolo las mir in meinem kleinen, nach vorne gelegenen Zimmer im dritten Stock eine Gutenachtgeschichte vor. Sie stand in einem Geschichtsbuch und hatte sich wirklich zugetragen. Ein Mann, ein alter König oder Kaiser, blickte am Ende seiner Herrschaft auf seine Erfolge und Misserfolge zurück und fragte sich, während er auf dem Sterbebett lag, was wohl als Nächstes kommen würde.
Ob das ein besonderes Bett sei, fragte das Kind von damals. Eins, das zum Sterben vorgesehen war? Konnte man dem Tod vielleicht entkommen, wenn man nie darin schlief?
Er las mir immer aus schlechtem Gewissen etwas vor, glaube ich. Mein Vater war gewöhnlich auf Reisen, in Amerika oder Japan, in Russland, in Frankreich, um den berühmten Samtstoff des Hauses Uccello zu verkaufen. Als Besitzer einer der letzten traditionellen Webereien Venedigs war das unser Geschäft. Meine Mutter hatte ihre Koffer gepackt und war zu ihren Eltern in England zurückgekehrt. Venedig schien ihr nicht zu gefallen. Genauso wenig wie wir. Bald darauf hatte sie schon einen neuen Mann und eine neue Familie.
Nein, sagte mein Großvater. Ein Sterbebett sei nichts Besonderes. Nur der Ort, an dem man sich befand, wenn die Zeit gekommen war. Dazu sei jedes Bett gut genug.
Selbst jetzt, nach all den Jahren, kann ich die kleine Welt meiner Kindheit wieder heraufbeschwören. Die Geräusche unter dem Fenster meines aufgeräumten Kinderzimmers im Palazzo Colombina. Vaporetti und Motorboote, das sanfte Schwappen der trägen Wellen gegen bröckelnden Backstein und das modernde Holz unseres Privatanlegers. Möwen kreischten, Tauben glitten vom Himmel und flatterten mit ihren luftigen Flügeln. Manchmal hörte ich einen Gondoliere, der für die Touristen eine Opernmelodie sang. Aus dem Kanal stieg der vertraute Geruch nach Diesel und Chemikalien auf, stets mit einem Hauch Fäulnis vermischt.
„Ist in meinem Bett schon einmal jemand gestorben?“
„Aber nein. Dein Bett ist doch nagelneu, Nico!“
„Werde ich darin sterben?“
Er lachte und strich mir übers Haar. Nonno Paolos Gesicht war schmal und grau, mit kantigen Wangenknochen, weshalb ich fand, dass er wie ein lebendig gewordenes Standbild aussah. Er zeigte stets ein freundliches Lächeln, obwohl er oft erschöpft wirkte, nachdem er sich sieben Tage in der Woche um die Angelegenheiten unserer Weberei und ihre betriebsamen Verkaufsstellen gekümmert hatte.
„Natürlich nicht. Das ist ein Kinderbett. Du wirst noch wachsen und bald kaufen wir dir ein neues. Dir stehen in diesem Leben noch viele Betten bevor. Und jede Menge Aufregung. Das wird ein richtiges Abenteuer, in unserer turbulenten Welt groß zu werden. Du willst doch Abenteuer erleben, oder?“
„Ich glaub schon.“
„Alle Jungen wollen Abenteuer erleben.“
„Aber werde ich dann auch sterben? Eines Tages?“
Er machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Ach was, der Zeitpunkt ist noch so weit weg, darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Denk doch lieber an … jetzt. Diese Woche. Samstag, wenn Chiara dich mit zum Lido nimmt. Du kannst im Sand spielen. Paddeln gehen. Es gibt Eiscreme. Und andere Kinder, mit denen du herumtoben kannst.“
Chiara Vecchi war eine kräftige, lebhafte Frau, die früher einmal für uns als Weberin gearbeitet hatte. Später, nach dem Weggang meiner Mutter, war sie zu einer unentbehrlichen Hilfe geworden, die einkaufte, kochte und mich zur Schule brachte, wenn sonst keiner konnte.
„Du sollst nicht sterben. Niemals.“
Großvater schlug das Buch zu.
„Du bist schon zu müde hierfür.“
„Nein … Ich will eine Geschichte. Noch eine.“
Er beugte sich herunter, gab mir einen Kuss auf die Stirn und fuhr mir mit den Fingern durchs Haar.
„Alles zu seiner Zeit, mein Junge.“ Sein freundliches Gesicht verdunkelte sich und nahm einen Ausdruck an, den selbst ein Kind wie ich deuten konnte. Einen Ausdruck des Zweifels, und des Bedauerns vielleicht. „Ob du mir für die Geschichte, die ich im Sinn habe, allerdings dankbar sein wirst …“
Bevor ich noch etwas sagen konnte, beugte er sich wieder herunter und gab mir noch einen Kuss. Dann ging er zum Fußende des Bettes, stellte den Fernseher an und suchte einen Kanal mit Zeichentrickfilmen.
Juni 1999. Ich war inzwischen ein nervöser, schlaksiger Fünfzehnjähriger geworden, der ein Einzelzimmer im Krankenhaus Santi Giovanni e Paolo betrat. Jetzt war ich an der Reihe, am Bett zu sitzen. Wie sehr ich mir auch wünschte, anderswo zu sein. Am Strand auf dem Lido zum Beispiel, um Musik zu hören und zu versuchen, mit meinen Altersgenossen mitzuhalten. Um Mädchen zu erobern, wenn ich nur gewusst hätte, wie. Mein Vater war ein Meister darin, hatte sein Talent aber nicht an mich weitergegeben.
Noch lieber wäre ich mit meinen Kameras unterwegs gewesen, um Fotos von den Sümpfen bei Torcello oder den Dünen von San Nicolò zu machen. Das Fotografieren war mein größtes Hobby, fast schon eine Sucht. Großvater hatte ein Kundenkonto bei einem Fotogeschäft in der Nähe von San Giacomo dell’Orio für mich eröffnet. Dort war ich gern gesehen, angesichts der Tatsache, dass ich ein Vermögen für Spiegelreflexkameras, Objektive, Filme und Entwicklungsarbeiten ausgab. Wovon ich natürlich keine Lira selbst bezahlte.
Alle Wände waren weiß. Durch die Flure hallten Schritte und leise Stimmen. Überall hing der strenge Geruch nach Desinfektionsmittel in der Luft, der mir die Kehle zuschnürte. Oder vielleicht war es bloß Angst. Auf der einen Seite des Zimmers gaben zwei hohe Fenster den Blick auf die Fondamente Nove und die Lagune frei. Die stille Wasseroberfläche lag flirrend in einer Hitze, wie sie normalerweise nicht vor Ende Juli hereinbrach. Schwül, drückend, voller sirrender Stechmücken.
Kaum war ich eingetreten, mit gesenktem Kopf und erkennbar lustlos, deutete nonno Paolo auf den Stuhl neben dem Bett. Noch nie hatte ich ihn so schwach gesehen. Schon allein deswegen wäre ich am liebsten weggelaufen, fort aus dieser grell erleuchteten Zelle mit ihrem Desinfektionsmittelgestank und dem stetigen, beharrlichen Surren des Ventilators an der Decke.
Es war nicht einfach, sich eine Welt ohne ihn auszumalen, und weil ich noch ein Kind war, ging ich allem, was nicht einfach war, aus dem Weg. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie die Uccellos fortbestehen sollten, ohne dass er sich um die täglichen Abläufe in unserem Palazzo und um unseren kleinen Männerhaushalt kümmerte. Er war unser Fels, der feste Bestandteil in unserem Leben, von dem ich geglaubt hatte, dass er immer da sein würde. Doch bald schon, meinten nun alle – die Schwestern, die Ärzte, mein Vater und Paolo Uccello selbst –, würde der Patriarch einer der berühmtesten Weberfamilien Venedigs nicht mehr sein.
„Wie ich höre“, sagte er mit schwacher Stimme, was seiner Autorität aber keinen Abbruch tat, „gab es Ärger in der Schule.“
Eigentlich hatte ich kaum etwas damit zu tun gehabt. Mein Vergehen bestand eher in einer Unterlassung. Zur Strafe war ich zusammen mit Maurizio Scamozzi, dem Anstifter, und zwei anderen Jungen eine Woche vom Unterricht suspendiert worden. Es war nicht das erste Mal, dass Scamozzi uns in Schwierigkeiten brachte, und offen gesagt war es hauptsächlich eine Mischung aus Neugier und Angst, die mich manchmal dazu brachte, bei seinen Aktionen mitzumachen. Dass ich deswegen aus der Schule geworfen wurde, wenn auch nur vorübergehend, war allerdings neu.
„Tut mir leid“, war alles, was ich herausbrachte.
„Was ist passiert?“
Sie hatten einen Jungen schikaniert. Und ich hatte dabeigestanden und zugesehen. Hatte nicht mitgemacht. Aber auch nicht eingegriffen.
„Ich weiß, dass ich eine Strafe verdient habe“, sagte ich. „Eine Woche Schulverweis …“
„Ach, vergiss es.“ Er fuhr mit der Hand durch die Luft. Es war eine kraftlose Geste für einen Mann, den ich immer für so stark und gesund gehalten hatte. „Ich wollte sowieso, dass du mich besuchen kommst. Du sollst etwas lesen.“
Als ich noch klein war, war mir nonno Paolo wie der größte Mann der Welt erschienen. Alter und Krankheit hatten ihn gekrümmt und ergrauen lassen. Nun lag er hier unter einem weißen Laken im Krankenhausbett, von ein paar Kissen gestützt, ein Buch und einen Krug Wasser auf dem Nachttisch zwischen sich und dem offenen Fenster. Draußen verlief der ruhige Fußweg über die Fondamente Nove, der zum Arsenale, der riesigen, größtenteils leer stehenden ehemaligen Schiffswerft, führte. Wie jeden Sonntag war auf der Lagune Richtung Murano viel los. Ruderboote glitten über die funkelnde Wasseroberfläche, Vaporetti fuhren hin und her, zum Lido hinüber oder zurück zur Stadt.
„Siehst du sie?“, fragte er und deutete aus dem Fenster.
Zwischen uns und Murano lag die kleine Friedhofsinsel San Michele mit ihren festungsartigen Mauern. An der Anlegestelle empfing eine Kirche die Besucher, die Lebenden wie die Toten. Das Ganze sah aus wie eine Kreuzung aus Burg und dem Grab eines Riesen.
„Du warst auch früher schon einmal krank“, sagte ich zu ihm. „Du wirst bald wieder gesund werden. In einer Woche bist du bestimmt wieder zu Hause. Papà hat gesagt …“
„Ach was. Es dauert nicht mehr lange, dann befördern sie mich in einem Sarg ans andere Ufer.“
Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte.
„Der Junge, den ihr gepiesackt habt. Wer war das?“
„Ich hab ihn nicht gepiesackt. Ich war bloß dabei.“
„Und du hast nichts unternommen?“
Ein Vaporetto fuhr Richtung Lido am Fenster vorbei. Normalerweise hätte ich nach Unterrichtsschluss an Bord sein können, meine Badesachen in der Tasche und mit ein paar Jungs aus der Schule auf dem Weg zum Strand. Wir würden Eiscreme und Getränke kaufen. Wir würden im flachen grauen Wasser der Adria schwimmen, Fußball spielen, in der Sonne liegen und uns vielleicht mit einem der ausländischen Mädchen unterhalten, die in den Hotels wohnten. Ich würde die Augen schließen und dem Walkman lauschen, den ich zu Weihnachten bekommen hatte. Abends gab es Discos, und ich konnte meistens jemanden überreden, mir ein Bier zu kaufen. Die Musik war immer so laut, dass sie alle anderen Gedanken aus dem Kopf vertrieb; das gefiel mir. Das gehörte offenbar dazu, wenn man jung war.
Oder ich hätte ein paar Nikon-Kameras und Objektive in meine Kameratasche gesteckt und mich zu den ruhigeren Gegenden der Lagune aufgemacht. Vielleicht zum südlichen Küstenstrich um diese Jahreszeit. Dem unberührten Strand von Ca’ Roman auf Pellestrina. Oder ich hätte das Boot genommen, das im Sommer von den Zattere am Hotel Cipriani vorbei zum Strandbad von Alberoni fuhr.
Ich unternahm gerne etwas mit den anderen Jungen. Doch ich genoss es auch, allein zu sein. Vielleicht lag es daran, dass ich ein Einzelkind war. Manchmal fragte ich mich, wie es wohl wäre, einen Bruder oder eine Schwester zu haben, in einer großen Familie aufzuwachsen, mit Frauen, Mädchen, Lärm und Leben. Nicht nur ich, Vater und nonno Paolo, die scheinbar immer mit irgendetwas beschäftigt waren. Unsere Schritte hallten wie das Trapsen einsamer Gespenster durch die steinernen Flure und Treppenaufgänge des Palazzo Colombina. Wenn Mama bei uns geblieben wäre und ich jüngere Geschwister bekommen hätte, wäre das vielleicht anders gewesen. Ich weiß es nicht, und nonno Paolo sagte immer, es sei zwecklos, sich Gedanken über Dinge zu machen, die man sowieso nicht ändern kann. Wir waren die Uccellos, drei Generationen von Männern, gemeinsam gefangen in diesem verstaubten Palazzo am Canal Grande. Es gab kein Entrinnen, nur das lange Warten darauf, was wohl als Nächstes kommen würde.
„Ich habe mich entschuldigt. Ich weiß, ich hätte eingreifen müssen.“
„Wer war er? Der Leidtragende?“
Eine Hänselei war aus dem Ruder gelaufen. Maurizio hatte angefangen, dann hatte auch sein rabiater Kumpel Scacchi mitgemacht. Und ich war bloß auf Abstand gegangen. Dass es zu einer Schlägerei kommen würde, hatte ich nicht erwartet.
„Ich habe um Verzeihung gebeten.“
„Wer … war … er?“
„So ein nerviger Zwerg. Amerikaner. Maurizio hat ihm gesagt, dass er nicht hierhergehört. Da ist er wütend geworden. Wäre er einfach weggelaufen …“
„Menschen werden oft wütend, wenn man ihnen sagt, dass sie irgendwo nicht hingehören.“
„Ich hab ihn nicht angerührt. Ich hab bloß zugesehen.“
„Glaubst du, das spricht dich von jeder Schuld frei, Nico? Nur zuzusehen. Nicht … zuzuschlagen?“
„Tut mir leid. Es kommt nicht wieder vor.“
„Wie heißt er? Dieser Amerikaner?“
„Carmine. Maurizio sagt, er ist einer von diesen neuen Juden. Von den Ausländern. Sie machen sich im Ghetto breit, als würde es ihnen gehören.“
Er schauderte.
„Ein Scamozzi macht sich Sorgen ums Ghetto?“
„Maurizio sagt, es gehört uns. Den Italienern. Nicht ihnen.“
„Die Scamozzis leben hier schon seit Jahrhunderten, Nico. Sie bilden sich ein, ihnen gehört jeder und alles. Aber das Ghetto gehört den Juden, oder? Wir haben sie damals selbst hinter seine Mauern verbannt. Ins erste Ghetto, das es je gab. Ein Gefängnis. Wo wir sie einsperren und im Auge behalten konnten, von wo wir sie holen konnten, um sie nach unserer Pfeife tanzen zu lassen und sie dann wieder zurückzuschicken. Mit einem gelben Stern auf der Brust.“
„So ist es heute nicht mehr“, murmelte ich.
Den Blick, den er mir daraufhin zuwarf, hatte ich noch nie gesehen. Es schien fast eine Spur Hass darin zu liegen.
„Deine Strafe …“
„Eine Woche Schulverweis.“
„… und eine zusätzliche Geschichtsstunde.“ Er langte zum Nachttisch und zog die Schublade auf. „Schau her, Junge. Das ist deine Hausaufgabe.“
In der Schublade lagen fünf Umschläge. Dicke, braune Kraftpapierumschläge. Nummeriert.
Er nahm den ersten heraus und gab ihn mir.
„Das wurde kurz nach dem Tod deiner Großmutter fertiggestellt. Den ersten Teil habe ich heimlich geschrieben. Sie sollte nichts davon wissen. Ach ja … bevor du deinem jüdischen Schulkameraden die Schuld dafür gibst, dass du diese Lektüre aufgebrummt bekommst; sie war sowieso für dich gedacht. Diese Geschichte bewahre ich schon für dich auf, seit du ein kleiner Junge warst.“
„Was?“
„Ich habe sie für dich geschrieben. Für dich ganz allein.“
„Warum nicht für papà?“
Einen Moment lang schien diese Frage ihn in Verlegenheit zu bringen. Er wirkte beinah schuldbewusst.
„Weil es nun mal so ist. Eines Tages wirst du es verstehen. Hoffe ich zumindest. Aber wie lange das …“ Er hielt kurz inne und überlegte. „Ich kann nicht alles wissen. Diese Geschichte hat fünf Teile. Jetzt nimmst du den ersten Teil mit. Du liest ihn, und wenn du morgen früh zurückkommst, reden wir darüber. Dann bekommst du den nächsten mit. So machen wir es die ganze Woche lang. Keine Sorge, bis Samstag sind wir mit allem durch. Das nächste Wochenende kannst du mit deinen Freunden auf dem Lido am Strand verbringen, um schwimmen zu gehen und Mädchen zu treffen, wie es sein sollte. Entschuldige die Unterbrechung.“ Wieder hatte er diesen merkwürdigen Ausdruck im Gesicht. „Aber jetzt oder nie.“
Als ich den Umschlag öffnen wollte, legte er seine zitternden Finger, inzwischen nur mehr Haut und Knochen, um meine.
„Nicht hier. Später, wenn du allein in deinem Zimmer zu Hause im Palazzo bist. Dein Vater weiß nichts davon. Versprich mir, dass das so bleibt, bis du die ganze Geschichte kennst und ich diese Welt verlassen habe. Danach gehört sie dir und du kannst damit machen, was du willst.“
Natürlich versprach ich es ihm.
„Das ist die unerzählte Geschichte unserer Familie. Unserer jüngeren Vergangenheit. Meiner vor allem. Kein dunkles Geheimnis bleibt verborgen. Keine grausame Tat. Kein Verrat. Kein …“ Er begann wieder zu husten, und dieses Mal hörte er kaum mehr auf. „Kein Blut wird vergossen, ohne dass es Spuren hinterlässt.“
Geschichte. Von allen Fächern, mit denen sie uns in der Schule malträtierten, verabscheute ich dieses am meisten. Zu trocken. Zu langweilig. Zu fern.
„Du willst sie nicht lesen, stimmt’s?“
„Vielleicht wäre es besser, wenn papà …“
„Für ihn ist sie nicht bestimmt, habe ich gesagt! Sie ist für dich. Für niemanden sonst. Ich wurde geboren, um diese Geschichte zu erzählen. Und du wurdest geboren, um sie zu hören. Keine Sorge. Sie ist ziemlich abenteuerlich. Wir beginnen im letzten Krieg, der vor vierundfünfzig Jahren zu Ende ging. Vierundfünfzig Jahre. Kaum ein Wimpernschlag für einen alten Mann wie mich. Ich sehe es vor mir, als wäre es gestern gewesen. Die Menschen …“ Ihm stockte die Stimme. „Diejenigen, die siegten. Diejenigen, die verloren. Diejenigen, die dazwischen gefangen waren und nicht genau wussten, wohin sie gehörten.“ Er tippte mir auf die Schulter. „Und diejenigen, die nur abwarteten und zusahen, die glaubten, Dunkelheit, Schmerz und Verlust würden an ihnen vorübergehen, solange sie sich im Hintergrund hielten.“
Ich liebte nonno Paolo mehr als jeden anderen auf der Welt. Natürlich würde ich seine Aufzeichnungen lesen. Ich würde alles tun, worum er mich bat.
„Wenn du es möchtest, nonno. Ich … fühle mich geschmeichelt.“
Er lachte wieder, ein wenig traurig dieses Mal.
„Du hast es noch nicht gelesen. Bald wirst du Dinge erfahren, die dein eigener Vater nicht für möglich halten würde.“ Dann tippte er sich lächelnd an die Nase, und ich erkannte die freundliche Gestalt wieder, die früher an meinem Bett gesessen und mir Märchen von Pinocchio und der Befana vorgelesen hatte. „Dann ist es an dir zu entscheiden, was du damit anfängst. Mit unseren Geheimnissen, verstehst du. Dunklen, tiefen Geheimnissen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, Nico. Mach dich auf den Weg.“
Wie immer war der Palazzo Colombina leer. Vater war wieder einmal auf Geschäftsreise.
Ich hätte ein paar Freunde aus der Schule anrufen und sie zu einer Runde Tischtennis einladen können. Oder einen Spaziergang nach Rialto machen, wo sie auf dem Markt wahrscheinlich die Anlage für einen DJ aufbauen würden oder am Abend vielleicht sogar eine Band spielen würde. Ich hätte auch meine Kamera mit zur Salute-Kirche nehmen und noch einen Sonnenuntergang fotografieren können, einen prächtigen orangen Feuerball, der hinter den Dächern der Stadt versank.
Doch nonno Paolo, mein geliebter Großvater, hatte mir eine Aufgabe gestellt. Also nahm ich mir eine Dose Chinotto, stieg die lange Marmortreppe zu meinem abgedunkelten Zimmer hinauf, machte es mir auf meinem Bett gemütlich und knipste das Licht an.
Die Frau in der Lagune
Samstag, 13. November 1943.
Sie tauchte um kurz nach acht in der Frühe aus dem bleigrauen, winterlichen Wasser auf: nackt, die Arme voller Blutergüsse, das eingeschlagene Gesicht weiß und wächsern. Ihre gedrungene Gestalt war von Seegras umschlungen und verrenkt wie ein Heiliger bei einem der vielen Martyrien, deren Darstellungen die Kirchenwände zierten.
Über dem sich lichtenden Morgendunst kreischten hungrige Möwen, die Futter witterten. Paolo Uccello sah nicht allzu genau hin, aber es schien, als wären die Fische schon da gewesen. Eine unnachgiebige Wintersonne kämpfte sich durch den Nebel und warf den blassen Schatten des Glockenturms von San Pietro auf Schlamm und Kiesel. Mittlerweile hasste er das Geschrei der Seevögel. Sie verfolgten ihn überall.
Der Krieg schien nicht enden zu wollen und war noch schlimmer geworden, seit die Deutschen die Stadt im September besetzt hatten, an dem Tag, an dem König Viktor Emanuel den Waffenstillstand mit den vorrückenden Alliierten verkündet hatte und mit seiner provisorischen Regierung aus Rom nach Brindisi geflohen war. Das zweigeteilte Italien lag im Todeskampf, und eine blutige Trennlinie in der Mitte des Landes schob sich schwer umkämpft langsam nach Norden. Die Eindringlinge hatten sich entlang der deutschen Verteidigungslinien verschanzt, die von Kampanien bis zu den Abruzzen verliefen. Eine neue „Republik“ war geboren, nominell unter der Führung Mussolinis, obwohl jedem klar war, dass Berlin den Ton angab. Der Duce, der sich in Salò in der Lombardei verkrochen hatte, war nichts weiter als eine Marionette Hitlers, was aber niemand laut auszusprechen wagte. Italienische Soldaten, die wie alle anderen nicht wussten, wem sie folgen sollten, hatten sich der jeweils nächstgelegenen Seite angeschlossen oder waren von den Deutschen gefangen genommen oder in einigen Fällen niedergemetzelt worden. Immer mehr legten einfach die Waffen nieder, schlugen sich in die Büsche und versuchten, irgendwie nach Hause zu kommen, auf die Gefahr hin, erwischt und sofort exekutiert zu werden.
Paolo Uccello versuchte, das alles so weit wie möglich auszublenden. Politik war wie die Welt als Ganzes, am besten, man mied sie. Er war gerade erst achtzehn geworden, ein schüchterner, magerer Junge und nach dem Tod seiner Eltern auf sich gestellt; ein jugendlicher Einsiedler, der seine Tage und Nächte in der alten Weberei seiner Familie am äußersten Rand von Castello in der Nähe des Arsenale verbrachte. Um Essen zu kaufen, musste er allerdings herauskommen, in diesem Fall, um sich in die Warteschlange für ein trockenes, fade schmeckendes Brot beim Bäcker in der Via Garibaldi einzureihen. Auf dem Heimweg bemerkte er den Menschenauflauf am Ufer vor der Kirche. Männer, die er von der nahe gelegenen Bootswerft kannte, wateten fluchend und weinend über den Kieselgrund ins seichte Wasser, wo eine Leiche trieb, an der ein paar Möwen pickten, bis sie sie verscheuchten.
Es war unmöglich, nicht hinzuschauen. Die armselige durchnässte Gestalt, die aus dem trüben Wasser des kleinen Hafens gezogen wurde, trug ein ärmelloses rotes Kleid, das vorn und am Saum zerrissen war und an ihrem stämmigen Körper klebte wie ein buntes Leichentuch. Paolo wollte lieber nicht zu lange in ihr Gesicht sehen, erst recht nicht, als er merkte, dass er sie kannte.
Am Ufer stand padre Filippo Garzone, seine Miene ein Bild des Jammers. Neben ihm Chiara Vecchi, die Frau, die schon an den Webstühlen der Familie Uccello arbeitete, seit Paolo denken konnte. Sie war noch nicht einmal dreißig und schon Witwe; ihr Mann war irgendwo im Kampf gefallen. Bei den Partisanen vielleicht oder als Deserteur von seiner Einheit. Paolo wusste es nicht, und er traute sich nicht, danach zu fragen.
Der Geistliche und Chiara beobachteten das Ganze schweigend, und das war auch besser so, denn auf Bänken ganz in der Nähe saßen drei deutsche Soldaten und ein ernst blickender Mann in dunklem Mantel. Die Uniformierten hielten ihre Gewehre im Arm, der Zivilist rauchte eine Zigarette. Für die Leiche schienen sie sich nicht sonderlich zu interessieren.
„Ich sag’s doch … Es ist Isabella!“, rief einer der Bootsbauer, während er die traurige, durchnässte Gestalt durch den Schlamm zog. „Um Gottes willen …“
Die Helfer bargen die Tote, einer von ihnen versuchte, ihre entblößten Gliedmaßen zu bedecken, und bekreuzigte sich.
Isabella Finzi. Eine zänkische alte Jungfer, die einen Gemüsestand in der Salizada Santa Giustina betrieben hatte, bis die Polizei es ihr untersagte. Eine Jüdin. Die durften heutzutage nur noch an ihresgleichen verkaufen, und davon hatte Isabella Finzi nichts wissen wollen, obwohl sie es sich hätte leisten können. Paolo beobachtete, wie der Mann im dunklen Mantel sich erhob, den Männern einen Ausweis zeigte und sie auf Venezianisch ansprach. Jemand von hier, vermutete er, ein Polizist, oder was zurzeit als einer durchging, der kühlen Reaktion nach zu urteilen, die er erntete. Er hatte ein lockeres, selbstbewusstes Auftreten und ein schroffes, verschlagenes Gesicht, dessen Ausdruck sich in Sekundenschnelle von einem Lächeln in einen finsteren Blick und zurück verwandeln konnte. Er sagte etwas und ging wieder zu seinem Platz.
Isabella Finzi war schon immer eine eigentümliche Erscheinung in Castello gewesen, der Paolos Eltern möglichst aus dem Weg gingen. Es war nicht klug, sich mit Juden einzulassen, vor allem wenn sie so hitzköpfig waren wie Isabella. Er erinnerte sich, wie sie ihn einmal angebrüllt hatte, als er so dreist gewesen war, eine Orange anzufassen. Damals war er vielleicht sieben oder acht gewesen, jedenfalls hatte seine Mutter die Orange sofort gekauft. Mit Geld lässt sich ein Streit mit solchen Leuten immer schlichten, hatte sie gesagt.
Die Zeit vor dem Krieg war nur noch eine blasse Erinnerung, genau wie die Familie Uccello, als sie noch halbwegs wohlhabend war. Mutter, Vater, Sohn, die die kleine Handweberei im Giardino degli Angeli kurz hinter der Brücke von San Pietro in Richtung Arsenale betrieben. Einem abgeschiedenen Zufluchtsort, der nur über eine schmale Holzbrücke über den rio zugänglich war, die zu einem Tor in einer hohen Backsteinmauer führte. Rückblickend kam es Paolo vor, als wären sie andere Menschen gewesen, die in einer ganz anderen Welt gelebt hatten. Jetzt war er plötzlich der Besitzer des Betriebs und des kleinen Hauses, eines Nebengebäudes inmitten der Überreste des ehemaligen Palazzos einer vornehmen venezianischen Familie. Fast noch ein Kind, zumindest in den Augen der Bewohner des Stadtteils, die die Uccellos in den letzten Jahren meist gemieden hatten. Bis auf Chiara Vecchi, eine herzensgute Frau, die sich die größte Mühe gab, Paolos tote Mutter zu ersetzen. Doch auch sie behandelte ihn manchmal wie einen kleinen Jungen. Was er nicht mehr war, obwohl sie das nicht zu bemerken schien.
Nachdem die Nazis Isabella Finzis Marktstand geschlossen hatten, hatte sie angefangen, sich billigen Wein zu kaufen, mit der Flasche in der Hand durch die Straßen zu streifen und die Deutschen und alle italienischen Faschisten, die ihr über den Weg liefen, laut zu beschimpfen. Gelegentlich meinte er, sie auf der anderen Seite der Brücke herumgrölen zu hören. Eine riskante Sache in diesen gefährlichen Zeiten. Bestimmt hatte sie irgendwer gewarnt – padre Filippo vielleicht, der seine Gemeindemitglieder stets zu beschützen versuchte, und sogar die Juden. Doch Isabella Finzi hatte nicht zu den Frauen gehört, die gute Ratschläge beherzigten, wie ernst sie auch gemeint sein mochten.
Chiara Vecchi stand mit verschränkten Armen am Ufer, wippte mit grimmigem Gesichtsausdruck vor und zurück und wirkte wie immer älter auf Paolo, als sie in Wirklichkeit war. Neben ihr stand der Geistliche in seinem dunklen Gewand, bekreuzigte sich kopfschüttelnd und murmelte ein Gebet. Die Männer hoben die Leiche vom Ufer auf die angrenzende Grasfläche, ebenso traurig wie zornig offenbar. Einer der Soldaten auf der Bank gähnte und sah auf seine Uhr.
Ein großer älterer Mann, der ernst und entschlossen wirkte, trat zu der trauernden Gruppe, die um die Leiche herum stand.
Paolos Mutter hatte für alte Malerei geschwärmt und diese Begeisterung an ihren Sohn weitergegeben. Am Wochenende hatte sie ihn oft in die Galerien und Kirchen der Stadt mitgenommen, wo sie ihm die vielen berühmten und weniger bekannten Gemälde zeigte. Jetzt fragte er sich unwillkürlich, welcher Künstler die Szene, die sich ihm da bot, wohl am besten eingefangen hätte. Bellini vielleicht. Oder die Lebenden und die Tote vor ihm hätten allesamt Akteure in einer dieser verblüffend realistischen Darstellungen schmerzerfüllter Venezianer sein können, die Tintoretto überall für die Altäre gemalt hatte.
Der Neuankömmling ergriff den Arm des Geistlichen und drückte ihn. „Wie furchtbar, mein Freund“, sagte er so laut, dass jeder ihn hören konnte.
„Aldo“, murmelte Garzone. Er wischte sich übers Gesicht und schüttelte dem Mann die Hand, was ihm eine beißende Bemerkung des Polizisten einbrachte.
Paolo wusste, wer Aldo Diamante war, und verstand, warum der Polizist es missbilligte, dass ein Venezianer sich mit ihm abgab. Als er noch klein und einmal krank gewesen war, hatte seine Mutter ihn zum Krankenhaus Santi Giovanni e Paolo gebracht. Dort hatte ihm Diamante, der damals einen weißen Kittel trug und ein Stethoskop um den Hals hängen hatte, ein Bonbon gegeben, ihn auf eine Untersuchungsliege gesetzt, ihm das Hemd ausgezogen und war mit der kalten Metallscheibe über seine Brust gefahren. Die Untersuchung hatte lange gedauert und der Arzt hatte sich für den Schmerz entschuldigt, den Paolo bei der Blutabnahme gespürt hatte. Ein paar Tage später hatte man sie wieder in sein Sprechzimmer bestellt, wo Paolo die Anweisung bekam, immer schön sein Gemüse zu essen und sich mehr zu bewegen. Er sei ein sensibles Kind, hatte Diamante gesagt, nicht krank, nur groß für sein Alter, wodurch einige seiner natürlichen Kräfte aufgebraucht seien und er etwas schwächlich geworden sei. Das sei ein lästiger Zustand und recht ungewöhnlich in Castello, einem Viertel, wo körperlich gearbeitet wurde und sich niemand müßig den Tag vertrieb wie die Adeligen in San Marco und Dorsoduro. Aber es sei nichts, was die Zeit, ausreichend Bewegung und eine gesunde Ernährung nicht wieder in Ordnung bringen könnten.
Inzwischen waren die Tage des alten Arztes in Santi Giovanni e Paolo vorbei. Mussolinis Rassengesetze schrieben vor, dass ein jüdischer Arzt nur jüdische Patienten behandeln durfte, genau wie eine jüdische Marktfrau wie Isabella Finzi nur ihresgleichen zu bedienen hatte. Paolo hatte gehört, dass man den Juden sogar den Eintrag ihres Namens im Telefonbuch verwehrte, was die Arbeit eines Mannes, der bekannt dafür war, zu jeder Tages- und Nachtzeit auf Notfälle zu reagieren, unmöglich machte. Statt ihm das Tragen eines Arztkittels zu erlauben, hatten die Schwarzen Brigaden – oder besser die dahinterstehenden Deutschen – Diamante gezwungen, Vorsteher der jüdischen Gemeinde Venedigs zu werden, ein Posten, der vakant war, seit sie den amtierenden Rabbi auf dem Lido inhaftiert hatten; in Erwartung seiner Deportation in ein ungewisses Schicksal.
All das wusste Paolo natürlich von Chiara, die es ihm in einer Pause zwischen der Arbeit an ihren beiden Webstühlen zugeflüstert hatte. Davon dürfe nichts nach außen dringen, hatte sie gesagt. Tratschen sei gefährlich. Es gebe immer jemanden, der bereit sei, eine unbedachte Kritik an den Faschisten oder den Nazis den Behörden zu melden; im Austausch gegen Geld, Privilegien oder einfach um einen alten Groll zu befriedigen. Warum sie ihn allerdings gewarnt hatte, wusste Paolo nicht, denn er ging sowieso nicht unter die Leute, wenn es sich vermeiden ließ. Genauso wenig, wie seine Eltern es getan hatten. Die meisten Venezianer schienen die Uccellos zu ignorieren. Sie waren Außenseiter, früher wohlhabend, in ihren Augen zumindest, inzwischen verarmt und für niemanden mehr von Nutzen. Wenn er sich große Mühe gab, konnte er sich zurückgezogen hinter den Mauern des Giardino degli Angeli fast einreden, es gäbe keinen Krieg.
Doch jetzt nicht mehr.
Chiara kam herüber und fasste Paolo am Arm.
„Du solltest das nicht sehen“, sagte sie so leise, dass die Deutschen es nicht hörten. „Das ist kein Anblick, den man im Kopf behalten sollte. Wir müssen doch noch einen Auftrag erledigen, oder?“
„Drei Banner. Das schaffen wir schon.“
„Das ist viel Arbeit, Paolo. Ich weiß, dass du noch trauerst, aber du hättest es mir früher sagen müssen. Uns läuft die Zeit davon.“
Er hatte keine Lust auf diese Diskussion.
„Ich kannte sie. Die tote Frau.“
„Wir kannten sie alle.“ Chiara warf den Uniformierten auf der Bank einen finsteren Blick zu. „Lass uns gehen. Bitte.“
„Ich bin achtzehn, ich bin kein Kind mehr“, erwiderte er und rührte sich nicht vom Fleck.
Diamante hockte neben dem übel zugerichteten Körper im Gras. Man hatte Isabella Finzi die Arme um die Brust gelegt. Überall auf ihrer nackten Haut waren Blutergüsse zu sehen, lila, rot, blaugrau. Als hätte man sie verprügelt. Gefoltert sogar; ein Gedanke, bei dem Paolo sich noch stärker zwingen musste hinzuschauen. Er hatte davon gehört, dass so etwas passierte, wenn die Schwarzen Brigaden oder die SS glaubten, jemanden gefasst zu haben, der Geheiminformationen besaß. Obwohl es schwerfiel, sich vorzustellen, dass eine geistig verwirrte Frau in diese Kategorie fiel. Es wäre vernünftig gewesen, auf Chiara zu hören und in die Werkstatt und sein kleines Haus zurückzukehren, an diesen ruhigen, sicheren Ort fernab der Stadt und einer angstbeladenen, konfliktzerrissenen Welt, die er nicht einmal ansatzweise verstand.
Außerdem fühlte er sich unwohl in der Nähe von Toten. Als man seine Eltern in Särgen zurückgebracht hatte, nachdem sie bei einem Luftangriff der Alliierten in Verona ums Leben gekommen waren, hatte er ihre verstümmelten Leichen identifizieren müssen. Danach hatte Paolo die ganze Nacht geweint, allein in seinem am Wasser gelegenen Zimmer hinter der Werkstatt, in der sie zu dritt gewohnt und gearbeitet hatten. Manchmal tauchte noch immer das zerfetzte Gesicht seiner Mutter in seinen Träumen auf. Er hatte seine Eltern gebeten, nicht nach Verona zu fahren. Reisen war immer gefährlich, während ihr Haus, das verborgen am Rand von San Pietro stand, zu den sicheren Orten in Venedig gehörte. Aber sie müssten fahren, hatte sein Vater beharrt, wie immer zu zweit, wenn es um etwas Geschäftliches ging. Der Kunde kam aus Turin, war nur auf der Durchreise in Verona und wünschte ein persönliches Treffen. Es ging um einen einträglichen Auftrag, den sie brauchten, weil Arbeit und Geld so knapp waren.
Chiara zog ihn am Arm.
„Moment noch“, zischte er.
An dem Tag, als sie auf dem Friedhof in Mestre begraben wurden, traf ein Brief ein, in dem der Auftrag bestätigt wurde: drei Banner aus handgewebtem Stoff nach einem speziellen Entwurf. Eine Anzahlung würde durch eine Bank in Turin ausgezahlt werden. Sein Vater hatte recht gehabt. Die Aufträge waren rar. Und doch waren sie es nicht wert gewesen, an jenem Abend in Flammen und Trümmern zu sterben, als amerikanische Bomber ihre tödliche Fracht auf das Veneto regnen ließen, weil sie ein Wohngebiet für ein Militärlager hielten.
Nur einen Augenblick noch. Er musste das sehen, wenn er auch nicht genau wusste, warum.
„Alberti!“ Diamante hatte noch dieselbe feste Stimme, mit der er damals im Krankenhaus mit dem kleinen Hänfling namens Paolo Uccello gesprochen hatte. Der Mann, an den er das Wort richtete, war der mürrische Bursche in dem dunklen Mantel, der neben den Soldaten auf der Bank saß. „Kommen Sie bitte mal.“
Der Mann grummelte etwas in ungehobeltem Venezianisch, trat seine Zigarette aus und schlenderte zu der Gruppe hinüber, die rund um die Leiche auf dem dürren Wintergras von San Pietro stand. Isabella Finzi musste um die vierzig gewesen sein, eine kräftige Frau mit entschlossenem Blick und Hakennase. Ein paar der Männer hätten ihr nachgestellt, hatte seine Mutter erzählt, aber nicht sehr lange. Ihr aufbrausendes Temperament hatte sie rasch vertrieben.
„Was ist?“, fragte Alberti.
Paolo kannte seinen Namen. Chiara hatte ihn gewarnt, er solle sich von dem Mann fernhalten. Ein ehemaliger Carabiniere, der zur Nationalgarde versetzt worden war, die Mussolini erfunden hatte, um die vormalige Militärpolizei abzulösen. Er hatte einen zweifelhaften Ruf, auch wenn er die dunkelblaue Uniform der Carabinieri trug. Chiara, die bei der Arbeit immer gern tratschte, hielt ihn für genauso gewissenlos wie diejenigen, die er verhaften sollte. Er war bekannt dafür, von Geschäftsinhabern Bestechungsgaben einzufordern: Geld, Fisch, Fleisch, Käse, was immer ihm gefiel. Und von den Frauen erwartete er Gefälligkeiten.
„Die Frau hier wurde geschlagen. Sie hat Abschürfungen an den Armen. Einen Bluterguss auf der Stirn. Meiner Ansicht nach wurde sie überfallen und zum Sterben ins Wasser geworfen. Vergewaltigt möglicherweise. Wenn Sie eine Obduktion veranlassen würden …“
Der Mann würdigte die Verletzungen, auf die der Arzt deutete, kaum eines Blickes.
„Wie kommen Sie dazu, das zu behaupten?“, erwiderte er. „Sie sind kein Arzt mehr. Diese verrückte Schlampe … Wir kannten sie doch alle. Ist nachts stockbesoffen durch die Gegend gezogen und hat die Leute angeschrien.“
Er trat einen Schritt vor, sah kurz auf die Leiche und spuckte aufs schlammige Ufer.
„Wenn Sie mich fragen, hat sie sich voll Wein laufen lassen, ist ins Wasser gefallen und ertrunken. So wird’s in meinem Bericht stehen. Ein Unfall. Juden begehen selten Selbstmord.“
„Unsinn!“, rief Diamante.
Der Priester nahm seinen Arm und versuchte, ihn zu beruhigen.
„Unsinn! Sehen Sie sie sich an, Mann. Sie sind Venezianer. Einer von uns. Sie sind hier aufgewachsen, Alberti. Ich habe Ihre Schwester behandelt …“
„Das war einmal. So lauten die Vorschriften. Jetzt lassen wir nicht mehr zu, dass uns Juden mit ihren schwitzigen Händen anfassen.“
„Vorschriften? Vorschriften?!“ Padre Filippo versuchte, den alten Arzt zurückzuhalten. „Welche Vorschriften diktieren Ihnen denn, eine vergewaltigte Frau zu ignorieren? Deren Leben ausgelöscht wurde, als wäre es nichts wert? Kennen Sie Ihre Pflicht denn nicht?“
Der Polizist lachte nur.
„Meine Pflicht?“
„Bitte, Aldo“, sagte der Priester, und drängte sich zwischen die beiden. „Das führt doch zu nichts. Wir müssen uns um die arme Isabella kümmern.“
„Meine Pflicht?“, wiederholte Alberti und schob Garzone zur Seite. Er war einen guten Kopf kleiner als Diamante und hatte die Statur eines Straßenschlägers. „Meine Pflicht ist es, Mussolinis Gesetze durchzusetzen. Und darin steht …“ Er wandte sich grinsend zu den Deutschen um. „Ihr zählt nicht länger. Also halt jetzt dein Judenmaul und geh nach Hause.“ Er nickte in Richtung der Leiche auf dem Kies. „Und nimm dieses Dreckstück hier gleich mit.“
„Luca!“, rief der Priester. „Überleg dir, was du sagst.“
„Oh, das tue ich, padre. Wir wurden gewarnt. Wir alle. Dieses Land wird gesäubert. Denken Sie an meine Worte. Sobald wir die öffentliche Ordnung wiederhergestellt haben. Und sobald alle Terroristen hingerichtet wurden. Und jetzt, Diamante, schaffen Sie Ihre jüdische Hure hier weg. Es interessiert mich nicht, was Sie mit ihr machen.“ Er drehte sich wieder um und zwinkerte den Deutschen zu, die sich bereits erhoben hatten, um zu gehen. „Wir haben Wichtigeres zu tun.“
Mit diesen Worten marschierten die vier davon. Als sie schon fast außer Sichtweite waren, richtete einer der Männer, die Isabella Finzi aus dem Wasser gezogen hatten, eine imaginäre Pistole auf ihre Rücken und drückte drei Mal ab.
„Peng“, murmelte er.
Peng.
Peng.
„Dreckige crucchi.“
Crucchi. Ein Schimpfwort, das man vor den Deutschen nicht laut aussprach. „Und Alberti, dieser Verräter … kriegt es irgendwann auch noch heimgezahlt.“
Paolo kannte den Mann: Rocco Trevisan, Besitzer des kleinen Bootes, mit dem er ihre Lieferungen in der Stadt transportierte, manchmal auch Material für die Werkstatt, wenn sie viel zu tun hatten. Ein aufbrausender Kerl aus den Mietshäusern in der Nähe der Biennale-Pavillons, die inzwischen geschlossen waren; rechthaberisch und stur. Ein Kommunist, sagte Chiara, obwohl er nicht verstanden hatte, was das genau bedeutete. Rund um die Via Garibaldi gab es eine Reihe kleiner Bars, in der Männer wie er tranken und stritten und wo die Abende gelegentlich mit Schlägereien endeten. Orte, die jene, die ein sichereres Leben suchten, lieber mieden.
„Haben Sie einen Bestatter für sie?“, fragte der Bursche neben Trevisan.
„Natürlich“, antwortete Diamante.
Der Mann runzelte die Stirn.
„Sie war ’ne durchgeknallte Jüdin, aber was soll’s.“
„Sie war Venezianerin!“, rief Paolo außer sich. „Eine von uns“, fügte er hinzu. „Sie dürfen uns nicht behandeln, als … wären wir nichts wert.“
Trevisan starrte ihn an und rief nach einem Boot.
„Paolo.“ Chiara Vecchis strenger Blick traf ihn. „Ich habe dich gebeten, dir das nicht anzusehen. Und jetzt verlierst du die Beherrschung. Das ist nicht klug.“
Paolo spürte eine ungekannte Wut in sich aufsteigen.
„Ich weiß, was richtig und was falsch ist.“
Aus irgendeinem Grund sahen in dem Moment padre Filippo und Diamante zu ihm herüber, und der alte Arzt warf auch Chiara einen Blick zu.
„Du kommst jetzt hier weg, zur Not mit Gewalt“, erklärte sie und schob Paolo energisch in Richtung der hölzernen Brücke, die nach Hause führte.
„Ich hab dir doch gesagt, ich bin kein Kind mehr.“
„Trotzdem, ich habe es deiner Mutter versprochen …“
In dem Augenblick kam der Priester zu ihnen gehastet.
„Überlass das mir, bitte“, sagte er, und in seiner Stimme lag eine Entschiedenheit, die selbst ihr nicht entgehen konnte. „Ich begleite den jungen Herrn nach Hause …“
Chiara warf dem Mann in Schwarz einen beinah feindseligen Blick zu.
„Das ist nicht nötig, padre …“
„Ich bestehe darauf“, antwortete er und nahm Paolo Uccello am Arm.
Einst war die Werkstatt der Uccellos ein eleganter Pavillon im Garten eines Palazzos gewesen, der einer adeligen Familie aus Vicenza gehörte. Durch Handel reich geworden, hatte sie sich im Schatten des Arsenale ihre eigene Nachbildung einer Palladio-Villa gebaut. Umgeben von Gartenlauben, Rosenbeeten und Obstbäumen, bildete sie einen schattigen Rückzugsort vor der glühenden Hitze des Sommers.
Während der Wirren der italienischen Einigung schlug sich die Familie auf die falsche Seite und endete schließlich finanziell ruiniert, fortgespült von einer politischen Acqua-alta-Welle, außerhalb der Stadt. Während sie über Schulden, Besitzansprüche und Eigentumsrechte stritten, wurde der Palazzo verlassen und später von anderen Einwohnern geplündert und teilweise abgetragen, die Baumaterial für ihre eigenen Häuser oder zur Befestigung des Uferstreifens am Kanal von San Pietro suchten. Hinter der hohen Mauer und dem schmalen Kanal, über den eine kleine Holzbrücke führte, blieben nur der Pavillon mit dem Wintergarten und der Garten übrig; verborgen in einem abgelegenen Teil Venedigs, in den nur noch wenige kamen. Wozu auch? Das westlich davon gelegene Arsenale war militärisches Sperrgebiet, während San Pietro und Castello im Osten und Süden arme Arbeiterviertel waren, wo die meisten Mühe hatten, ihre Miete zu zahlen. Richtung Norden, hinter einem verfallenen, sechseckigen Wachturm, erstreckte sich die träge Lagune bis zu den wenig besuchten Inseln La Certosa und Le Vignole.
Es war eine abgeschiedene Einsiedelei in einer Stadt, in der, mit Ausnahme der Wohlhabenden, die meisten Menschen eng zusammen-gedrängt in Mietskasernen lebten. Die verfallenen Überreste hatten leer gestanden, bis Paolos Großvater, ein geschäftstüchtiger Stoffhändler, die Gelegenheit wahrnahm und die Immobilie günstig erwarb. Nachdem Napoleon die Handwerksbruderschaften verboten und die Weberschule der Republik an der Fondamenta San Lazzaro geschlossen hatte, war das Seidenweben im frühen neunzehnten Jahrhundert praktisch aus Venedig verschwunden. Doch Simone Uccello, an den Paolo sich nur noch dunkel erinnerte, weil sein Großvater starb, als er erst vier war, hatte herausgefunden, dass das Werkstattinventar der alten Schule sich noch immer in dem verlassenen Gebäude befand. Gewieft wie er war, brachte er die Stadt dazu, es für wenig Geld ausräumen zu dürfen, und sicherte sich auf diese Weise sechzehn hölzerne Jacquardwebstühle und ausreichend Material, um das Weberhandwerk neu zu etablieren.
Das war Anfang der 1880er-Jahre gewesen. Jahrzehntelang hatte niemand mehr einen Jacquardwebstuhl benutzt, obwohl sich noch ein paar alte Fachleute daran erinnerten, wie sie funktionierten. Mit ihrer Hilfe und mithilfe von ein paar Handbüchern eröffnete Simone eine kleine, hochqualifizierte Weberei. Nach ein paar Jahren waren sie in der Lage, anhand alter Muster den gleichen feinsten Samt herzustellen, wie er auf dem Höhepunkt der venezianischen Republik produziert worden war.
Europa war fasziniert von den luxuriösen Stoffen aus einer anderen Zeit. Jahrzehnte voller Wohlstand folgten. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts war aus dem Hause Uccello ein kleines, aber etabliertes Unternehmen geworden, das ein beachtliches Sortiment an Stoffen nach traditionellen Mustern herstellte; für wohlhabende Venezianer wie für Kunden in ganz Italien, die es sich leisten konnten. Auf seinem Höhepunkt, im Jahr 1928, beschäftigte das Unternehmen sechzehn Weberinnen in Vollzeit, an jedem der Jacquardwebstühle eine. Ihre Erzeugnisse gewannen Medaillen in Turin und Paris, New York und Barcelona. Samtstoff von Uccello fand sich in englischen Landsitzen, in den Rathäusern von Kopenhagen und Reykjavík, in Opern und in den Ballsälen großer Überseedampfer.
Als Paolo auf die Welt kam, ließ der Erfolg schon langsam nach. Durch die Wirtschaftskrise der Dreißigerjahre wurde handgewebter Samt zu einem Luxusprodukt, das sich kaum noch jemand leisten konnte. Mit zwölf wurde der Junge aus der Schule genommen, die er ohnehin verabscheute, um im Familienbetrieb mitzuarbeiten. Mit der Aussicht, dass er eines Tages von seinem Vater die Leitung der Firma übernehmen würde, lernte er dort als Lehrling, mit dem Webstuhl umzugehen.
Trotzdem waren die finanziellen Mittel knapp, was seine Familie nicht gewohnt war. Bald schon begriff Paolo, dass die Verkürzung seiner Schulzeit mehr mit Geld zu tun hatte, als er dachte. Sie brauchten billige Arbeitskraft. Sie brauchten Aufträge. Als er dreizehn wurde, war die Familie gezwungen, ihre geliebte Wohnung an den Zattere mit dem fantastischen Blick über den Giudecca-Kanal auf Palladios Redentore-Kirche aufzugeben. Sein Vater hatte einen Teil der Lagerräume hinter der Werkstatt in einen Wohnbereich mit zwei Schlafzimmern umgebaut; von nun an würden sie dort wohnen.
Doch immer noch gingen die Aufträge zurück. Wenn ein Webstuhl kaputtging, rentierte sich die Reparatur nicht mehr, also wurde er als Alt- oder Feuerholz verkauft. Als Paolos Eltern zu ihrer letzten verhängnisvollen Reise nach Verona aufgebrochen waren, waren nur noch drei übrig gewesen. Die Familie musste sich darauf beschränken, meistens nur noch billige Pasta und Gemüse zu essen, und ging Gläubigern, wann immer möglich, aus dem Weg. Chiara Vecchi hatte mit dreizehn angefangen, für seinen Vater zu arbeiten. Jetzt, mit nicht einmal dreißig und als Witwe, war sie ihre letzte Angestellte in dieser seltsam unwirklichen Welt, die der Krieg Venedig aufgebürdet hatte.
Es schien wie grausame Ironie des Schicksals, dass Verona dem untergehenden Betrieb zuerst eine Rettungsleine zuwarf und dann Paolos Eltern in Särgen zurückschickte. Am Tag der Beerdigung in Mestre war der Auftrag eingetroffen, zusammen mit einer Anzahlung von zehntausend Lire – was fast fünfhundert amerikanischen Dollar entsprach – und der Zusage über weitere zwanzigtausend bei Fertigstellung der Artikel, dreier identischer kleiner Banner nach einem ganz bestimmten Muster. Auf der Bank hatten sie ihn schief angesehen, als er den Scheck einlösen wollte, und nachgefragt, ob er überhaupt alt genug sei, über die Geschäftskonten zu verfügen. Durch eine Ausnahmegenehmigung, die es ihm erlaubte, nach dem Tod seiner Eltern die Geschäfte zu führen, war er das, auch wenn er darauf angewiesen war, dass Chiara ihm erklärte, wie man damit umging.
Die Ausführung der Bestellung war einfacher. Seine Eltern hatten schon eine genaue Mustervorlage vorbereitet, inklusive der dazugehörigen Lochkarten für den Webstuhl, so verzweifelt hatten sie auf die Bestellung gehofft. Als Paolo dann mit dem Brief in der Hand auf der alten Holzbank unter dem Orangenbaum gesessen und um seine toten Eltern geweint hatte, war ihm klar gewesen, dass ihm keine andere Wahl blieb, als den Auftrag anzunehmen. Um wen es sich bei dem Kunden handelte, spielte kaum eine Rolle. Er brauchte Arbeit, um auf andere Gedanken zu kommen und um der treuen Chiara etwas Geld geben zu können. Um die zerrüttete Welt hinter der roten Backsteinmauer auszublenden, die den Zufluchtsort umgab, den der Giardino degli Angeli ihm bot.
Über ihm sangen die Vögel, während er den Brief aus Turin durchlas. Die letzten Goldhähnchen, ein ganzer Schwarm dieser kleinen farbenfrohen Gesellen, saßen zwischen den orangegelben Früchten auf den Zweigen. Ihre Melodie – zwei helle Töne, die sich mehrmals wiederholten – hatte den Rhythmus, an den er denken sollte, während er am Webstuhl arbeitete und den Schussfaden anschlug, um das von den Lochkarten vorgegebene Muster zu erzeugen. Das hatte sein Vater ihm beigebracht.
Si-tah-si-tah-si-tah-sitschi-si-piu.
Uccello. Ihr Nachname bedeutete „Vogel“, vielleicht war es also nur ein Scherz. Bald schon würden die Goldhähnchen sich auf den Weg Richtung Süden machen, um dem kalten venezianischen Winter zu entfliehen. Wenigstens sie konnten die belagerte Stadt verlassen, wann immer sie wollten. Nicht ein einziger Vogel sang, als er mit padre Filippo Garzone an seiner Seite von San Pietro nach Hause ging.
Im Garten neben dem herabgefallenen Kopf eines verwitterten Engels blieben sie stehen. Auf dem Rasen lagen Bruchstücke der Statuen des alten, verfallenen Palazzos. Köpfe, Rümpfe, Arme. Sein Vater hatte versucht, ein paar davon zu verkaufen, als sie in finanzielle Schwierigkeiten gerieten, doch in Kriegszeiten mangelte es an reichen Touristen. Also blieben sie liegen, wo sie waren, wie gefallene Kämpfer einer lang vergessenen Schlacht.
„Du hast ein schönes Zuhause, Paolo. Darum würden dich viele beneiden.“
Padre Filippo war eine allseits bekannte Gestalt, ein Mann, der in seinem dunklen Priestergewand durch die nördlichen Teile Castellos schlenderte und bei jedem stehen blieb, um ein bisschen zu plaudern. Er war vielleicht fünfzig, nicht so wohlbeleibt wie manch anderer Geistlicher, der ständig Essen oder Gefälligkeiten von seinen Gemeindemitgliedern erbat, sondern fast schon mager, als wäre er krank oder hungerte aus Mitleid selbst angesichts der Entbehrungen seiner Schäfchen. Seine Haare waren lang, kastanienbraun mit etwas Grau durchzogen, und seine Aussprache trug den Akzent seiner Heimatstadt Vicenza. Wäre er nicht Priester geworden, hätte er Paolos Meinung nach einen guten Hotelier oder Gastwirt abgegeben. Er hatte eine liebenswürdige Ausstrahlung und eine beständige, geduldige Wesensart, die stets nach Besonnenheit inmitten von Zwietracht strebte.
Genau genommen gehörten die Uccellos zu seiner Gemeinde, denn sie reichte von der Insel San Pietro bis zu ihnen herüber und schloss auch die Häuserreihen, die Richtung Arsenale verliefen, mit ein. Aber sie waren nie regelmäßige Besucher seiner Messen gewesen und ebenso wenig zur Beichte gegangen. Die Arbeit ging vor, auch sonntags, hatte sein Vater gesagt. Doch es hatte mehr dahintergesteckt. Seine Eltern waren in erster Linie Geschäftsleute gewesen und dann erst Katholiken. Passionierte Gläubige, die sich eifrig bekreuzigten, wenn es einen kirchlichen Auftrag zu ergattern galt. Als die Aufträge vor Jahren jedoch versiegten, war mit ihrem Glauben anscheinend dasselbe passiert.
„Um was sollten sie mich beneiden, padre? Meine Eltern sind tot. Und ich habe keine Ahnung, wie wir die Webstühle am Laufen halten sollen. Selbst wenn ich es wollte.“
Garzone schloss einen kurzen Moment die Augen, wie vor Schmerz.
„Verzeih mir. Ein Priester sagt ebenso leicht unbedachte Dinge wie jeder andere. Ich meinte …“ Er deutete auf den Garten. „… das hier. Abgeschiedenheit. Einsamkeit. Frieden.“ Er lächelte. „Nun ja, soweit man es in diesen Zeiten Frieden nennen kann. Ein persönlicher Frieden. Das ist doch schon mal was. Kommst du zurecht? Kann ich irgendetwas für dich tun?“
Paolo wusste nicht, wie er auf diese Fragen antworten sollte. Die Erinnerung an die tote Isabella Finzi, die man nass und steif aus der kalten Lagune gezogen hatte, ging ihm nicht aus dem Kopf.
„Ich gebe mir Mühe.“
„Und Chiara …?“
„Sie hilft mir.“
„In Zeiten wie diesen braucht man Freunde. Es tut mir leid, dass du das alles mit ansehen musstest, Paolo.“ Der Priester konnte schon immer gut Gedanken lesen. „Ich wünschte, es wäre dir erspart geblieben. Manchmal ist es besser, einfach weiterzugehen.“
Es lag ein merkwürdiger Unterton in seiner Stimme. Beinah, als wollte er etwas Bestimmtes hören.
„Ich bin gerade vorbeigekommen. Da hab ich gesehen, dass etwas passiert ist. Ich konnte nicht … nicht hinschauen.“
Garzone nickte.
„Hält Chiara dich über Neuigkeiten auf dem Laufenden?“
„Manchmal. Und ich höre Radio.“
„Es ist am besten, hinter diesen Mauern zu bleiben. Sich unauffällig zu verhalten. Viele Informationen bekommen wir hier nicht, das weiß ich. Keine zutreffenden jedenfalls. Aber es kursieren Gerüchte. Die Amerikaner und die Briten rücken von Süden herauf vor. Jetzt, wo sie schon Rom im Visier haben, kann es nur noch auf eins hinauslaufen. Die Deutschen verlieren den Krieg, und das wissen sie.“
„Die von ihnen, die man hier sieht, glauben das offenbar nicht. Sie sehen aus wie Sieger. Mehr als je zuvor.“
Das stimmte. Doch als Insel, die nur durch eine einzige schmale Brücke mit dem Festland verbunden war, sei Venedig etwas ganz Besonderes, sagten alle. Durch seine Lage am nordöstlichen Rand der Adria war es kaum von militärischer Bedeutung. Deshalb und wegen seines historischen Erbes würden die Amerikaner und die Briten es nicht bombardieren, glaubte man. Die Deutschen und die Faschisten nutzten die Stadt hauptsächlich als Urlaubsziel, wo man ein paar Tage lang den Schrecken des Krieges entfliehen konnte. Es gäbe jetzt mehr Bordelle als jemals vor dem Krieg, hatte seine Mutter eines Abends nach ein paar Gläsern Wein gesagt. Obszöne Theater und Nachtklubs hatten ebenfalls eröffnet. Die Bars in San Marco und die vornehmen Hotels am Canal Grande und an der Riva degli Schiavoni hatten so viel zu tun wie eh und je, wenngleich ihnen, während nun Deutsche und Faschisten dort wohnten, die internationalen Gäste früherer Tage fehlten. Selbst La Fenice hatte einen vollen Spielplan, mit berühmten Namen.
„Die crucchi, die wir hier in Venedig sehen, sind größtenteils unfähige Schwachköpfe, Paolo. Deshalb sind sie hier und nicht auf dem platten Land, um die einfachen Leute zu terrorisieren. Sie ermorden keine Partisanen oder andere, deren Gesicht ihnen nicht gefällt. Wir müssen nur Geduld haben. Wir müssen abwarten.“
Wieder schien es, als versuchte der Mann etwas herauszufinden.
„Wie lange? Wie lange müssen wir warten?“
„Ich weiß es nicht.“
Das glaubte Paolo nicht.
„Mein Vater hat gesagt, die Amerikaner und die Briten würden bald schon in Frankreich einmarschieren. Wenn sie das tun, versuchen sie von da aus, den Krieg zu gewinnen.“ Geschichte. Ein bisschen davon wusste er noch aus der Schule. „Wenn sie quer durch Italien kommen würden, müssten sie die Alpen überqueren, wie Hannibal, nur in umgekehrter Richtung. Wozu sollten sie die Mühe auf sich nehmen, wenn sie Berlin auf einem viel einfacheren Weg erreichen können?“
Wieder dieses freundliche Nicken.
„Du kennst dich besser aus, als ich dachte.“
„Ich bin kein Kind mehr!“
„Wie könntest du auch?“, antwortete Garzone mit ruhiger, mitfühlender Stimme. „Nach allem, was du durchgemacht hast.“
„Selbst wenn Italien befreit wird, sind wir wahrscheinlich als Letzte an der Reihe. Sie könnten noch jahrelang hierbleiben.“
„Schon möglich. Aber eines Tages werden wir frei sein. Dieser Krieg wird vorüber sein. Diese Welt wird sich wieder zum Guten wenden. Das tut sie immer. Gott verlangt es so. Und die Menschen letztendlich auch. Mussolini und die Deutschen werden besiegt werden. Daran habe ich keinen Zweifel. So wie viele Venezianer, auch wenn wir es in der Öffentlichkeit nicht laut aussprechen. Das wäre unklug.“ Ein kurzer neugieriger Blick. „Dein Radio …“
„Das ist nicht verboten.“
„Es kommt darauf an, was du hörst.“ Er holte tief Luft. „Darf ich es mal sehen?“
„Warum?“
Der Priester zog seinen Mantel fester um sich.
„Wenn das ein Problem ist …“
„Sollten Sie sich nicht um Isabella Finzi kümmern?“, fragte Paolo.
„Sie war Jüdin. Diamante wird einen jüdischen Bestatter für sie suchen.“ Er fasste Paolo kurz am Arm und beugte sich zu ihm. „Was hältst du von den Amerikanern und den Briten? Gibst du ihnen die Schuld am Tod deiner Eltern?“
Was für eine merkwürdige Frage.
„Sie haben die Bomben geworfen.“
„Ja. Das ist wahr. Bomben töten und verstümmeln. Anonym, glauben diejenigen, die sie zünden. In der Zeitung stand, die Flieger hätten absichtlich auf Zivilisten gezielt. Aber die Presse wird von den Nazis kontrolliert. Du kannst kein Wort von dem glauben, was sie drucken. Ein Freund aus Verona hat mir erzählt, das Ziel sei eine Kaserne gewesen. Sie haben die Eisenbahn versehentlich beschossen.“
Paolo hatte keine Lust, auf die Frage zu antworten. Doch der Priester ließ nicht locker.
„Und die Partisanen … die Italiener, die gegen die Schwarzen Brigaden und die Deutschen kämpfen?“
„Was ist mit denen?“
„Sind sie tapfer? Sind sie dumm? Sind sie auch deine Feinde?“ Garzone zögerte, als wäre er sich bezüglich der Antwort selbst nicht sicher. „Oder sollten sie sich wie der Rest von uns verhalten? Untätig, gehorsam. Gefügig. Hoffen, irgendwie durchzukommen, bis wir wieder frei sind? Was denkst du?“
„Ich denke, dass ich es nicht weiß.“
Der Priester lächelte und blickte sich im Garten um.
„Wenn ich hier leben würde, würde ich sicher auch hinter dieser Mauer bleiben wollen, bis die Sonne durch die dunklen Wolken bricht und der Krieg vorbei ist. Meine Arbeit, meine Pflichten … sie erlauben das leider nicht.“
Chiara hatte nicht gewollt, dass Garzone ihn nach Hause bringt. Dafür hatte sie bestimmt einen Grund gehabt.
„Ich frage dich nur nach deiner Meinung, Paolo. Wer immer Isabella ermordet hat, denn ermordet wurde sie sicher, weder die Polizei noch die Deutschen werden etwas unternehmen, um den Kerl seiner gerechten Strafe zuzuführen. Selbst wenn dieser Polizist Alberti es wollte, würden ihn die Nazis daran hindern. Sie betrachten uns jetzt als ihr Eigentum, mit dem sie tun und lassen können, was sie wollen.“ Der Mann in Schwarz legte ihm den Arm um die Schulter. Er hatte einen festeren Griff, als Paolo erwartet hätte. „Bomben unterscheiden nicht, obwohl ich weiß, dass sie dir Leid gebracht haben. Die Schwarzen Brigaden, die SS … sie erzeugen mit Absicht Schmerz und Qual und wählen bewusst die Menschen aus, um sie abzuschlachten. Ein zufälliger Tod ist eine Tragödie. Ein vorsätzlich herbeigeführter ist kaltblütiger Mord. Diese Leute kennen keinen Gott. Sie grinsen ihren Opfern ins Gesicht, während sie zustechen oder ihnen die Schlinge um den Hals legen. Ich weiß, dass du an diesem abgeschiedenen Ort glücklich bist. Aber in der Welt da draußen tobt ein Sturm. Wirst du hier auf Dauer zufrieden sein, Paolo? Wenn es eine kleine, ungefährliche Gelegenheit gäbe, einen Funken Hoffnung in der Dunkelheit zu entzünden … würdest du sie ergreifen?“
Wäre es doch nur Sommer gewesen und hätte er die Vögel wieder singen gehört. Wenngleich auch er sich fragte, wie oft er noch in diesem Garten sitzen und seine Mutter und seinen Vater betrauern könnte. Was würden sie wohl jetzt sagen? Keiner von beiden hatte sich je für Politik interessiert. Aber dafür, ob etwas Recht oder Unrecht war, schon. Das, so wurde ihm jetzt klar, war auch der Grund für seinen Gefühlsausbruch im dünnen grauen Nebel von San Pietro gewesen. Er hatte ihre Stimmen gehört, die dagegen protestierten, dass noch jemand der sinnlosen Grausamkeit dieses Krieges zum Opfer fiel.
„Ich würde wirklich gern einmal dein Radio sehen“, fuhr der Priester fort. „Meins ist schon alt und muss, fürchte ich, bald ersetzt werden. Denn die Chancen, es reparieren zu lassen, stehen zurzeit … nun ja …“ Er trottete auf die staubigen Scheiben des Wintergartens zu. „Wir sollten diese Unterhaltung lieber drinnen fortführen.“
Luca Alberti war neununddreißig. Seine Tätigkeit bei der Polizei war die einzige, die er je ausgeübt hatte. Zuerst im Stützpunkt der Carabinieri in der Nähe der griechisch-orthodoxen Kirche in Castello, wo er schnell Karriere gemacht hatte. Später, nach der Gründung von Mussolinis Marionettenstaat, als Hauptmann bei deren Nachfolger, der Republikanischen Nationalgarde.