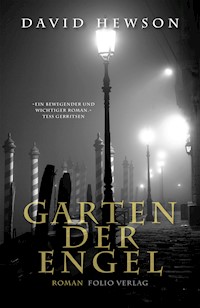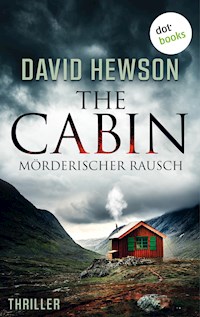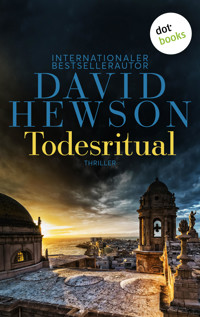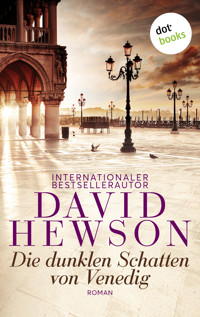
3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Verführung des Bösen … Der fesselnde Spannungsroman »Die dunklen Schatten von Venedig« von David Hewson jetzt als eBook bei dotbooks. Venedig: eine Stadt voller Pracht, erhabener Kunst – und finsterer, lang gehüteter Geheimnisse … Der junge Engländer Daniel Forster kommt in die Lagunenstadt, um eine altehrwürdige Bibliothek zu katalogisieren. Als er dort die Noten eines verlorenen Meisterwerks aus Vivaldis Zeit entdeckt, weckt dies die Aufmerksamkeit des reichen Kunstmäzens Hugo Massiter. Schon bald zieht der ebenso charismatische wie undurchschaubare Mann Daniel in seinen Bann – überredet ihn zu kleinen Betrügereien, dann zu Straftaten … Erst als Daniels Freunde ermordet werden, begreift der junge Student, wie nah er bereits am Abgrund steht: Kann er sich noch aus der Hand dieses Puppenspielers befreien? Als hätten Patricia Highsmith und Donna Leon gemeinsam einen psychologischen Thriller geschrieben: Meisterhaft verwebt der internationale Bestsellerautor David Hewson das Venedig der Gegenwart mit den Erinnerungen an die Lagunenstadt zu Lebzeiten Vivaldis. »Großartige Unterhaltung: intelligent und fesselnd!« The Sunday Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der düstere Spannungsroman »Die dunklen Schatten von Venedig« von David Hewson. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Venedig: eine Stadt voller Pracht, erhabener Kunst – und finsterer, lang gehüteter Geheimnisse … Der junge Engländer Daniel Forster kommt in die Lagunenstadt, um eine altehrwürdige Bibliothek zu katalogisieren. Als er dort die Noten eines verlorenen Meisterwerks aus Vivaldis Zeit entdeckt, weckt dies die Aufmerksamkeit des reichen Kunstmäzens Hugo Massiter. Schon bald zieht der ebenso charismatische wie undurchschaubare Mann Daniel in seinen Bann – überredet ihn zu kleinen Betrügereien, dann zu Straftaten … Erst als Daniels Freunde ermordet werden, begreift der junge Student, wie nah er bereits am Abgrund steht: Kann er sich noch aus der Hand dieses Puppenspielers befreien?
Als hätten Patricia Highsmith und Donna Leon gemeinsam einen psychologischen Thriller geschrieben: Meisterhaft verwebt der internationale Bestsellerautor David Hewson das Venedig der Gegenwart mit den Erinnerungen an die Lagunenstadt zu Lebzeiten Vivaldis.
»Großartige Unterhaltung: intelligent und fesselnd!« The Sunday Times
Über den Autor:
David Hewson wurde 1953 geboren und begann bereits im Alter von 17 Jahren für eine Lokalzeitung im Norden Englands zu arbeiten. Später war er Nachrichten-, Wirtschafts- und Auslandsreporter bei der »Times« und Feuilletonredakteur bei »The Independent«. Heute ist er ein international bekannter Bestsellerautor. Sein Thriller »Todesritual«, auch bekannt unter dem Titel »Semana Santa«, wurde mit dem W. H. Smith Fresh Talent Preis für einen der besten Erstlingsromane ausgezeichnet und verfilmt. Er schrieb die Bücher zur dänischen Fernsehserie »The Killing« und seine Nic-Costa-Kriminalromane wurden weltweit zum großen Erfolg.
David Hewson veröffentlichte bei dotbooks bereits »Das Blut der Märtyer« und »Der Kult des Todes«, außerdem den Thriller »Todesritual«.
Die Website des Autors: davidhewson.com
***
eBook-Neuausgabe April 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2001 unter dem Originaltitel »Lucifer’s Shadow« bei HarperCollinsPublishers, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Luzifers Schatten« bei Ullstein.
Copyright © der englischen Originalausgabe David Hewson 2001
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung eines Motivs von Cara-Foto/shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-196-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die dunklen Schatten von Venedig« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Hewson
Die dunklen Schatten von Venedig
Roman
Aus dem Englischen von Hedda Pänke
dotbooks.
Für Helen, Catherine und Thomas, deren Musik mich inspirierte.
Kapitel 1: San Michele
Er trug Schwarz. Den billigen, dünnen Anzug von Standa. Gewienerte Lederschuhe. Imitierte Ray-Ban Predators, die er irgendeinem japanischen Touristen auf der Piazzale Roma aus dem Bus geklaut hatte.
Rizzo zündete sich eine Zigarette an und wartete am Eingang von San Michele. Es war der erste Sonntag im Juli. Träge Hitze stieg vom Wasser auf, zwitschernd schossen Schwalben über seinen Kopf hinweg, in der Lagune wurde es Sommer. Ein leichter Wind bewegte die Zypressen, die auf dem Friedhof aufragten wie dunkelgrüne Ausrufezeichen. Im diskreten Halbdunkel einer Nische rechts von ihm stand ein Stapel leerer Kiefernholzsärge. Er sah, wie sich etwas auf die sonnenbeschienene Ecke des obersten Sargs zubewegte. Eine Eidechse huschte in den Lichtstrahl, hielt kurz inne und sauste in die Ritzen des Mauerwerks zurück.
Toller Job, dachte Rizzo, eine Leiche zu überprüfen.
Der Friedhofsverwalter kam aus seinem Büro und starrte auf die Zigarette, bis Rizzo sie auf den Boden warf und austrat. Der Mann war ungefähr vierzig, klein, korpulent und schwitzte in seinem weißen Baumwollhemd. Er hatte fettige, strähnige Haare und einen Schnurrbart, der aussah, als hätte man einen abgebrochenen Kamm über seine fleischigen Lippen geklebt.
»Sie haben die nötigen Papiere?«
Rizzo nickte und rang sich ein Lächeln ab. Der Verwalter beäugte ihn misstrauisch. Rizzo war fünfundzwanzig, wirkte aber, so wie er angezogen war, glatt fünf Jahre älter. Dennoch sah er vielleicht ein bisschen zu jung aus, um Anspruch auf einen wurmzerfressenen Kadaver zu erheben, als wäre er ein Koffer in einem Bahnhofsschließfach.
Er zog die Dokumente hervor, die ihm der Engländer am Morgen im Palazzo neben dem Guggenheim-Museum gegeben hatte. Damit müsste es klappen, hatte Massiter gesagt. Teuer genug waren sie gewesen.
»Sie sind ein Angehöriger?«, fragte der Verwalter und studierte die Unterlagen.
»Ein Cousin.«
»Weitere Angehörige gibt es nicht?«
»Alle verblichen.«
»Soso.« Der Mann faltete die Unterlagen zusammen und stopfte sie in seine Hosentasche. »Sie hätten sich noch vier Wochen Zeit lassen können, wie Sie vielleicht wissen. Liegedauer zehn Jahre. Auf den Tag. Aber viele lassen den Zeitpunkt verstreichen. Die wenigsten tauchen rechtzeitig auf.«
»Termine, Verpflichtungen.«
Der Verwalter verzog das Gesicht. »Verstehe. Die Toten haben sich nach uns zu richten. Nicht umgekehrt. Aber ...« Er bedachte Rizzo mit einem Blick, der möglicherweise sogar einen Funken Sympathie enthielt. »Jetzt sind Sie ja hier. Sie wären überrascht, wie viele dieser armen Kreaturen offenbar einfach vergessen werden. Sie liegen ihr Jahrzehnt hier ab und dann bringen wir sie ins städtische Beinhaus. Uns bleibt keine andere Wahl, wissen Sie. Kein Platz.«
Das weiß doch jeder in Venedig, dachte Rizzo. Wer auf San Michele bestattet werden will, muss sich an die Regeln halten. Die kleine Insel zwischen Murano und dem Norden der Lagunenstadt war voll. Die prominenten Toten, für die sich die Touristen interessierten, waren ihrer Gräber natürlich sicher. Allen anderen wurde ein Liegerecht von genau zehn Jahren eingeräumt. Sobald die Pachtdauer für die kleine Parzelle abgelaufen war, blieb es den Angehörigen überlassen, die Knochen anderswo zu bestatten oder diese Aufgabe der Stadt zu überlassen.
Auch dem Engländer war das bekannt. Aus Gründen, die Rizzo nicht wissen wollte, hatte er die Exhumierungspapiere früh genug besorgt, um als Erster zu erfahren, was sich in der Kiste befand. Vielleicht interessierte sich noch jemand für die verwesende Leiche, jemand, der die Zehnjahresfrist einhalten würde. Vielleicht auch nicht. Irgendwie begriff Rizzo den Sinn des Ganzen nicht recht. Ging es um die Frage, ob sich tatsächlich eine Leiche im Sarg befand? So musste es sein. Aber eigentlich war es ihm egal. Wenn ihm der Typ zwei Millionen Lire dafür zahlte, dass er mit gefälschten Dokumenten herumwedelte, konnte es ihm nur recht sein. Es war doch mal was anderes, als die Touristen in der Umgebung von San Marco um ihre Portemonnaies und Brieftaschen zu erleichtern.
»Wir haben Erfahrung in diesen Dingen«, sagte der Mann. »Und erledigen sie pietätvoll und würdig.«
Er setzte sich in Bewegung und Rizzo folgte ihm an den Stapeln nagelneuer Särge vorbei in die glühende Sonne. Sie durchquerten den ersten Abschnitt des Friedhofs, in dem die Toten Dauerwohnrecht genossen, und gelangten in die Bereiche, in denen Verstorbene im Dekadenrhythmus permanent rotierten. Grüne Planen markierten die Flächen, wo die aktuelle Skeletternte eingebracht wurde. Jeder Grabstein trug ein Foto. Junge und Alte blickten in die Kamera, als wären sie fest überzeugt, nie sterben zu müssen. In Recinto 1, Campo B, blieben sie inmitten eines Meeres duftender Blumen stehen. Der Verwalter deutete auf einen Stein. Und da stand ihr Name, der Familienname zuerst, wie üblich auf diesem Friedhof: Gianni Susanna. Gerade achtzehn Jahre alt, als sie starb. Das Grab war leer, die Erde ockerfarben.
Rizzo konnte die Augen nicht von dem ovalen Porträt auf dem Marmorgrabstein losreißen. Susanna Gianni war das hübscheste Mädchen, das er je gesehen hatte. Sie lächelte ihn an und wirkte eher wie einundzwanzig. Das Foto musste an einem sonnigen Tag irgendwo im Freien aufgenommen worden sein, kurz vor ihrem Tod. Aber sie wirkte überhaupt nicht krank. Sie trug ein violettes T-Shirt. Die schwarzen Haare fielen ihr auf die Schultern. Gesicht und Hals waren sonnengebräunt und die Lippen zu einem natürlichen, offenen Lächeln geformt. Sie sah aus wie eine Studentin vielleicht, unschuldig, aber etwas in ihrem Blick deutete an, dass sie so naiv nicht mehr war. Rizzo schloss die Augen und versuchte, sich zu beherrschen. Es war absurd, aber er spürte, dass er angesichts dieses unbekannten Mädchens, das vor fast einem Jahrzehnt aus ihm unbekannten Gründen gestorben war, einen Ständer bekam.
»Legen Sie Wert auf den Stein?« Die Stimme des Verwalters riss ihn aus seinen Träumen. »Sie können ihn mit dem Sarg mitnehmen. Ich vermute, Sie lassen ihn mit dem Boot abtransportieren?«
Rizzo antwortete nicht. Er steckte die Hände tief in die Taschen, hielt das Sakko vor sich und überlegte, ob der Mann etwas bemerkt hatte.
»Wo ist sie?«, fragte er.
»Sagen Sie den Bootsleuten nur Bescheid. Sie wissen, wo sie anlegen müssen.«
»Wo ist sie?«, wiederholte er. Der Engländer hatte sich sehr präzise ausgedrückt.
»In einem dafür vorgesehenen Gebäude.« Der Verwalter seufzte, als wüsste er genau, was nun kam.
»Führen Sie mich hin.«
Wortlos drehte sich der Mann um und lief zu einer verlassenen Ecke im nördlichen Teil des Friedhofs. Rechts von ihnen kam eine der großen Fähren auf ihrem Weg nach Burano und Torcello vorbei. Möwen segelten mit der Luftströmung. Vor ihnen bewegten sich Leute durch die Reihen von Grabsteinen, manche mit Blumensträußen in den Händen. Rizzo war erst einmal hier gewesen, mit einer alten Freundin, die ihre Großmutter besuchen wollte. Der Friedhof war ihm unheimlich. Wenn sein letztes Stündlein geschlagen hatte, wollte er im Krematorium in Mestre auf dem Festland in Asche und Rauch aufgehen. Und nicht hier in der Erde von San Michele liegen und darauf warten, ein Jahrzehnt später wieder ausgebuddelt zu werden.
Sie kamen zu einem kleinen, flachen Gebäude mit einem einzigen winzigen Fenster. Der Verwalter zog einen Schlüsselbund aus der Tasche und öffnete die Tür. Rizzo nahm die Sonnenbrille ab und folgte ihm ins Innere. Dann wartete er, dass der Mann Licht anmachte, ließ seinen Augen Zeit, sich an den abrupten Wechsel zwischen strahlendem Sonnenschein, Dunkelheit und der flirrenden Neonröhre an der Decke zu gewöhnen.
Der Sarg war in der Mitte des Raums aufgebockt. Sein Holz hatte eine stumpfgraue Farbe. Der Boden von San Michele muss wirklich trocken sein, dachte Rizzo. Es sieht so aus, als wäre die Kiste mitsamt ihrem Inhalt über die Jahre hinweg in der Erde einfach verdorrt.
»Wie gesagt«, wiederholte der Mann. »Schicken Sie Ihre Männer her. Sie wissen, was zu tun ist. Sie brauchen nicht zuzusehen. Glauben Sie mir.«
Rizzo kannte seinen Auftrag.
»Öffnen Sie ihn.«
Unterdrückt fluchend verschränkte der Verwalter die Arme vor der Brust. »Unmöglich«, murmelte er. »Welches Spielchen spielen Sie hier eigentlich mit mir, junger Freund?«
Rizzo griff in die Tasche und holte ein paar Hunderttausend-Lire-Scheine heraus. Massiter hatte mit Nebenausgaben gerechnet.
»Hören Sie, die Giannis haben einen ausgeprägten Familiensinn. Lassen Sie mich einen letzten Blick auf meine liebe kleine Cousine werfen, dann sind Sie mich los. Einverstanden?«
»Mist«, sagte der Mann, sackte die Geldscheine ein und griff nach einem an der Wand lehnenden Brecheisen. »Soll ich den Deckel abnehmen? Oder ist Ihr Familiensinn so ausgeprägt, dass Sie es lieber selbst machen?«
Rizzo gierte nach einer Zigarette. Im Raum war es unerträglich stickig. Der Sarg strömte einen muffigen Geruch aus. »Na, hören Sie mal. Wer wird hier für so was bezahlt?« Er machte eine herrische Kopfbewegung Richtung Sarg.
Widerstrebend hob der Mann das Brecheisen und schob es zwischen Sarg und Deckel. Er beachtete kaum, was er tat. Vermutlich hat er diese Kisten schon millionenfach aufgebrochen, dachte Rizzo. Es ist so, als würde man in einem Schlachthaus oder einem Leichenschauhaus arbeiten. Nach einer Weile denkt man über seine Beschäftigung nicht einmal mehr nach.
Langsam arbeitete sich das Brecheisen um den Sarg herum, hob den Deckel jeweils nur wenige Zentimeter an, entblößte die verbogenen, rostigen Nägel, die das Ding zusammenhielten. Als das Brecheisen seine Runde gemacht hatte, sah der Mann Rizzo an.
»Na, wollen Sie es sich nicht noch mal überlegen, Junge? Ich habe schon viele von euch große Töne spucken gehört, aber dann, wenn es wirklich zur Sache geht, seid ihr plötzlich ganz klein.«
Rizzo ließ sich nicht gern »Junge« nennen. »Öffnen«, sagte er.
Der Verwalter schob das Brecheisen weit unter den Deckel und drückte ihn hoch. Mit einem lauten Knacken zerbrach das Holz in zwei Stücke. Unwillkürlich zuckte Rizzo zusammen. Staub und Holzspäne erfüllten die Luft. Dann ein anhaltend widerlicher Geruch, eindeutig menschlichen Ursprungs. Nur ein Blick, dachte er. Mehr will der Engländer nicht.
Er beugte sich vor und spähte in den Sarg. Ihr Kopf lag im Schatten der Sargwand. Die langen Haare waren grau. Dünn und vertrocknet aussehend hingen sie zu beiden Seiten des Schädels herab, an dem noch immer Reste von brauner, ledriger Haut hingen. In den Augenhöhlen war irgendwas, aber das sah er sich lieber nicht so genau an. Auf ihren Schultern entdeckte er die Trägerreste eines einstmals weißen Totenhemdes.
Rizzo glaubte, er müsse lange auf den Schädel starren und darüber nachdenken, wohin die Schönheit des Gesichtes verschwunden war. Von seiner Erektion spürte er nichts mehr. Er fröstelte. Die Luft vor ihm begann zu flirren und zu wabern. Fast rechnete er damit, sich erbrechen zu müssen. Nicht aus Entsetzen oder Ekel, sondern wegen der stickigen Atmosphäre im Raum. Es kam ihm vor, als stünde er in einer dichten Wolke von Staub – menschlichen Staubs, hinterlassen von all den Toten, die im Lauf der Jahrhunderte die Tore von San Michele durchquert hatten.
Aber er hielt sich nicht lange mit dem Schädel auf. Ihre Arme waren auf der Brust gekreuzt, lange, skelettdünne Arme. Zu seiner Überraschung umklammerten sie einen Gegenstand, der ihr vom Kinn bis zu den Hüften reichte. Verblüfft starrte er das Ding an und wusste, dass der Verwalter das Gleiche tat. Er brauchte eine Weile, um es anhand seiner Form zu identifizieren. Susanna Gianni war mit einem alten Geigenkasten beerdigt worden und drückte ihn so zärtlich an sich, als wäre er ein Baby.
Davon hatte der Engländer nichts gesagt. Nur: Werfen Sie einen Blick auf die Leiche, und das wär’s. So lautete die Abmachung, also konnte es ihm niemand verübeln, wenn er nebenbei ein kleines Geschäft machte.
Behutsam lockerte Rizzo die Griffe der knochigen Arme und wollte den Kasten darunter hervorziehen.
Der Verwalter musterte ihn finster. »Das sollten Sie nicht tun.«
Seufzend hielt Rizzo inne. Er hatte genug von diesem Zwerg, mehr als genug von diesem erdrückenden Raum. Er griff in seine Tasche und zog das kleine Schnappmesser heraus, das er stets bei sich trug. Dem Dicken fest in die Augen blickend, ließ er die silberne Klinge vorschnellen, ging auf ihn zu und packte ihn am Kragen. Er drückte die Messerspitze gegen das linke Augenlid des Mannes, hob die schlaffe Haut an und ritzte sie gerade so weit ein, dass ein winziger Blutstropfen hervorquoll.
»Was wollen Sie?«, fragte er kalt. »Ich tue doch gar nichts.«
Der Mann wirkte wie erstarrt. Rizzo griff in seine Gesäßtasche, zog eine billige Kunststoffbrieftasche heraus und warf einen Blick auf den Ausweis. Der Verwalter lebte in den Behördenwohnhäusern nördlich von ihm in Cannaregio. Ein Fußweg von fünf Minuten.
»Keine Faxen«, zischte Rizzo. »Sonst sorge ich dafür, dass du dich selbst beerdigen kannst!«
Mit angsterfüllten glasigen Augen starrte der Mann ihn an. Rizzo ließ ihn los, trat wieder an den Sarg, hob die knochigen Arme an und zog den Violinkasten darunter hervor. Mit dem Jackettärmel wischte er den Staub ab und las ihren Namen auf einem verblichenen Papieretikett. Dann schlossen sich seine Finger um den Griff. Schwer hing der Kasten an seinem Arm. Irgendwas war da drinnen. Vielleicht nur Steine. Heutzutage gaben nicht einmal mehr Verrückte ihren Toten Kostbarkeiten mit ins Grab.
Der Verwalter verharrte reglos im Schatten, machte sich wahrscheinlich vor Angst in die Hose und wünschte sich sehnlichst, zu Hause bei seiner Frau zu sein. Rizzo zog eine Grimasse, holte ein paar weitere Hunderttausend-Lire-Scheine hervor und stopfte sie dem Dicken in die Hemdtasche. »Dein Glückstag, Freundchen. Nur eine kleine Familienangelegenheit. Alles klar?«
Der Mann zog die Banknoten heraus und faltete sie knisternd zusammen. Das Geld gab ihm etwas von seiner Würde zurück. In gewisser Hinsicht waren sie jetzt quitt. Dafür hatte Rizzo jedes Verständnis. Es gab zu wenig Würde auf der Welt. Er schob sich die Predators-Imitation wieder auf die Nase, machte auf dem Absatz kehrt und trat ins Freie.
»Moment mal!«, schrie der Verwalter ihm nach. »Wo sind die Bootsleute? Sie haben sich um das hier zu kümmern.«
Rizzo blieb an der Tür stehen und sah zu dem kleinen Dicken neben dem Sarg zurück. »Welche Bootsleute?«
»Um die Leiche fortzuschaffen, natürlich! Ich dachte, Sie wären so früh gekommen, um alles Weitere selbst zu übernehmen.«
»Das habe ich nie gesagt«, entgegnete Rizzo.
»Allmächtiger! Und was fange ich jetzt mit den Knochen an?«
Rizzo zuckte mit den Schultern. Sein Sakko engte ihn ein. Er hasste es, sich mit diesen billigen Klamotten zufrieden geben zu müssen, denn was er wirklich wollte, waren die Sachen, die in San Marco verkauft wurden: Moschino, Valentino und Armani.
»Machen Sie damit, was Sie wollen«, sagte er und betrachtete sich den Mann dann genauer. Vielleicht hatte er es doch zu weit getrieben. Der Kerl sah aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen oder es auf einen Kampf ankommen lassen, obwohl er wusste, dass Rizzo ein Messer zücken würde. Es ist ein Fehler, Idioten auf Friedhöfen arbeiten zu lassen, dachte Rizzo. Aber vielleicht sind das die Einzigen, die man für diesen Job bekommt.
»Beruhigen Sie sich, Mann«, sagte er. »Halten Sie den Mund, und hören Sie auf, wie ein Idiot auszusehen. Damit verschrecken Sie ja die Leute.«
Dann trat er endgültig auf den Friedhof hinaus, lief zügig durch den Recinto 1 und vermied jeden Blick auf ihren Grabstein, weil eine innere Stimme ihm eindringlich davon abriet, sich noch einmal ihr Bild anzuschauen.
Das Vaporetto aus Murano war halb voll. Er blieb im offenen Mittelteil stehen und merkte, dass die Leute vor ihm zurückwichen. Der Geigenkasten stank erbärmlich, selbst in der frischen Luft der Lagune. Das Linienschiff verlangsamte seine Fahrt und hielt. Vor dem Fondamente Nuove, der nächsten Haltestelle, fand eine Art Regatta statt. Angefeuert von Zuschauern auf der Anlegeplattform rasten Rennboote über das Wasser. Rizzo wünschte sie alle zum Teufel. Der Geigenkasten war schwer. Der Gestank nahm zu. Wie betrunken schaukelte das Vaporetto auf den grauen, unruhigen Wellen.
Genervt schloss Rizzo die Augen. Als er sie wieder öffnete, blickte er zur Insel zurück. Unter Sirenengeheul hielten drei Polizeiboote auf sie zu. Er wollte seinen Augen nicht trauen, wollte nicht glauben, dass der dicke kleine Verwalter so dämlich gewesen sein konnte.
Den Geigenkasten fest umklammernd, schwankte er zur Sicherheitsbarriere und erbrach sich ins ölige, graue Wasser. Die Möwen unter dem hellblauen Himmel beobachteten ihn aufmerksam. In der Ferne wurde San Michele zu einem undeutlichen weißgrünen Fleck zwischen Stadt und Murano. Finster starrte Rizzo zur schneeweißen Kirche neben der Bootsanlegestelle hinüber. Er schwor sich, es nie wieder zu betreten.
Kapitel 2: Himmelfahrtstag
Man schreibt den Himmelfahrtstag im Jahr des Herrn siebzehnhundertdreiunddreißig. Lorenzo Scacchi, ein hochgewachsener und gut aussehender Bursche von neunzehn Jahren und sieben Monaten, steht am breiten Uferkai von San Giorgio Maggiore, blickt über das San-Marco-Becken und beobachtet, wie der Doge seine Vermählung mit dem Meer erneuert. Das Wasser wimmelt von Menschen. Nachtschwarze Gondeln kämpfen um ihren Platz in der Nähe des scharlach- und goldfarbenen Bucintoro, der gerade am Rio del Palazzo vorbeigleitet und auf die beiden Säulen von San Marco und San Teodoro zuhält.
Eine erwartungsvolle Spannung liegt in der Luft. Der Doge sei leidend, heißt es, und sinne darüber nach, wen er dem Großen Rat als Nachfolger empfehlen könne. Die ehrwürdige Republik schwankt zwischen Glanz und Verfall. Wer kann sie retten? Wer den Wohlstand der Stadt wiederherstellen und die tückischen Türken dorthin zurückjagen, wohin sie gehören, nach Konstantinopel?
Niemand scheint es zu wissen. Doch plötzlich wendet der Bucintoro, dreht ab von den filigranen Säulenreihen des Dogenpalastes und der wartenden Menschenmenge am Molo. Angetrieben von einem Wald golden schimmernder Ruder, die funkeln wie die juwelenbesetzten Beine eines künstlichen Insekts, gleitet das Staatsschiff über den Bacino di San Marco und auf den jungen Mann zu, der mit in die Hüften gestemmten Händen und breitbeinig am Rand des Beckens steht. Seine blonden Haare leuchten in der Sonne. Die Ruderer legen sich in die Riemen, bis das Prunkschiff pfeilschnell die Wellen durchschneidet, um dann, kurz vor Erreichen der kleinen, flachen Insel, die Fahrt zu verlangsamen und direkt vor dem jungen Mann stehen zu bleiben. Der zuckt mit keiner Wimper.
»Lorenzo!«, ruft der Doge mit altersschwacher Stimme, der dennoch die ganze gebieterische Macht seiner Position anzuhören ist. »Ich frage Euch noch einmal, Signore. Bei Eurer Liebe zur Serenissima! Bei allem, was unserer Republik teuer ist! Bedenkt es noch einmal, ich flehe Euch an! Führt uns aus der drohenden Dunkelheit, führt uns ins Licht!«
Einen Moment lang verdunkelt eine Wolke die Sonne am azurblauen Himmel. Vielleicht sieht deshalb kaum jemand die Besorgnis auf dem Gesicht des jungen Mannes. Doch gleich darauf ist sie verschwunden und sein warmes und doch entschlossenes Lächeln teilt sich allen mit.
»Wenn Ihr meint, principale«, antwortet er. Seine Aussprache ist unkultiviert, ländlich gefärbt, und er zuckt ergeben mit den Schultern. Ein Freudenschrei aus tausend Kehlen braust über die Lagune, steigt zum Himmel empor. Ein neuer Doge ist gefunden, und schon bald ...
Nun, liebe Schwester, wie ist es? Weckt wenigstens das deine Aufmerksamkeit? Wenn ich Briefe schreiben muss, die sich anhören wie die wohlfeilen Geschichten, die Bettler und Krüppel in den Straßen verhökern, nur damit du sie liest, dann werde ich es tun, dessen sei versichert. Nunmehr sind sechs Wochen vergangen, seit wir, verwaist durch ein grausames Schicksal, Treviso verlassen haben. Gib mir nicht das Gefühl, allein auf dieser Welt zu sein. Du bist zwei lange, entscheidende Jahre älter als ich. Ich brauche deine Klugheit, deine Liebe. Ein einziger Brief, und noch dazu einer, in dem du vorwiegend über Verdauungsstörungen klagst, gewährt mir kaum den Beistand, nach dem ich verlange.
Doch es liegt mir fern, dich zu langweilen. Also lass mich mit meiner Schilderung fortfahren. Von dem bereits Geschriebenen magst du bis auf den Anfang getrost alles vergessen. Es ist in der Tat der Tag von Christi Himmelfahrt, und ich stand lange Zeit unter dem großen Monolithen von San Giorgio. Es bedarf eines besseren Briefeschreibers, als ich es bin, um dir die Bilder des heutigen Tages mit Worten zu schildern, also versuche ich es gar nicht erst. Venedig ist gewisslich eine Welt der Wunder. Selbst wenn ich um ganz schäbige Ecken biege, erstarre ich immer wieder in Ehrfurcht vor einer Pracht, die jeglicher Vorstellung spottet. Wenn es etwas zu feiern gibt und das Boot – verzeih dieses gewöhnliche Wort – zu Wasser gelassen wird, kann man nur stehen bleiben und mit offenem Mund staunen. Ich glaube, du bist einmal mit Papa hier gewesen. Mit Ausnahme des traurigen Tags der Beerdigung habe ich nie etwas anderes zu Gesicht bekommen als unsere kleine Stadt. Einem Strohhalm kauenden Bauernlümmel kann es in Venedig schon den Atem verschlagen.
Es gibt Männer hier, von denen ich wünschte, du könntest ihre Bekanntschaft machen. Stell dir unseren Onkel Leo am Ufer vor, einen dünnen, knochigen Burschen, der einfach gekleidet und mit verschränkten Armen zusieht, wie das Prunkschiff langsam am Palast vorbeigleitet. Er macht den Eindruck, als hätte er dieses Schauspiel bereits tausende Male gesehen, als könnte ihn auf dem gesamten Erdball nichts mehr erschüttern. Aber er ist Venezianer, ein Mann von Welt, der niemals mit einem schlichten Leben auf dem Lande zufrieden wäre, wie es unser lieber Vater gewesen ist. Spektakel sind für ihn so notwendig wie die Luft zum Atmen. Er wird mir ein guter Vormund sein und mich die Feinheiten des Buchdruckgewerbes lehren, so dass ich mir meinen Lebensunterhalt auf ehrliche Weise verdienen kann.
Neben ihm steht Oliver Delapole, ein nobler Engländer im Alter unseres Onkels, also etwa Mitte dreißig, aber von gänzlich anderer Herkunft und mit einem kleinen Schmerbauch unter seinem eleganten Rock. Mister Delapole ist ein begüterter Bursche, der feine, manchmal vielleicht etwas zu extravagante Kleidung bevorzugt. Er hat ein rosiges, freundliches Gesicht, ein gewinnendes Lächeln und wohltuende Manieren, die jeden Mann wie auch jede Frau – ich bitte dich, wir sind vom Land und sollten deshalb keine Hemmungen haben – unverzüglich für ihn einnehmen.
Geld ist das wichtigste Wort überall in der Lagune und Mister Delapole das personifizierte Kapital. Aus diesem Grund hängt sich die halbe Stadt an seine Rockschöße, sobald er irgendwo auftaucht. In der vergangenen Woche stattete er uns einen Besuch ab und ließ seinen Hut im Salon zurück. Ich schnappte ihn mir und rannte in der Hoffnung aus dem Haus, Mister Delapole rechtzeitig zu erreichen, bevor er am Canal Grande einen von diesen ungehobelten Gondolieri fand und sich von ihm nach Hause bringen ließ. Als ich ihn endlich erreicht hatte und vor lauter Atemlosigkeit kein Wort herausbrachte, lachte er schallend. »Warum diese Eile, Junge?«, wollte er wissen. »Bin ich der letzte Mann in Venedig mit ein paar Münzen in der Tasche?«
Dukaten öffnen Türen, hier nahezu alle Türen, und Mister Delapole geht auf großzügigste Weise mit ihnen um. Es heißt, er bringe das Kapital so flink unter die Leute, dass Geldverleiher die Kluft zwischen seiner Wohltätigkeit und der Ankunft neuer Mittel aus London schließen müssen. Doch versteh mich richtig, ich beklage mich nicht darüber. Mit ein wenig Glück wird das Haus Scacchi die Werke von etlichen neuen Dichtern und Komponisten veröffentlichen können, und das alles auf Mister Delapoles Kosten. Er hat bereits Antonio Vivaldi, dem berühmten komponierenden Priester am Ospedale della Pietà, ein paar kleine Gefälligkeiten erwiesen. Ebenso wenig stieß der Maler Canaletto (so genannt, um ihn von seinem Vater Canal zu unterscheiden, der das gleiche Handwerk ausübt) bei Mister Delapole auf taube Ohren. Dieser Bursche kann offenbar Silber über Meilen riechen. In dieser Minute sitzt er auf einem hölzernen Podest hoch über uns allen und plagt sich mit einem Gemälde für die Sammlung eines reichen Mannes ab.
Dieser Canaletto ist ein eigenartiger Bursche, überaus streitlustig und vermutlich sogar ein Betrüger. Er bedient sich eines Hilfsmittels namens Camera obscura, das er angeblich selbst erfunden hat. Das Objekt ist vor unseren Blicken in dem schwarzen Stoffzelt verborgen, in dem der Künstler arbeitet und das er von Zeit zu Zeit verlässt, um zu überprüfen, ob die Welt noch besteht. Dem Anschein nach wirft der Apparatus ein Abbild der Szenerie durch eine Glaslinse auf eine Leinwand im Inneren des Zeltes, wo es dann nachgezeichnet werden kann. Aus Neugierde kletterte ich auf das Holzgerüst und untersuchte das, was von der Vorrichtung sichtbar war, erntete jedoch mürrische Blicke und einen Schwall venezianischer Flüche, als der Maler, aufgestört durch mein Gepolter, den Kopf aus dem Zelt steckte.
»Sollte auch nur ein neunmalkluger Lump jemals behaupten, ich betrüge, blase ich ihm bei Gott sein armseliges Lebenslicht aus«, zischte mir Canaletto zu.
Unbeirrt spähte ich durch den von seiner Hand geschaffenen Spalt in der Zeltplane. Die Vorrichtung dünkte mich ungemein gescheit. »Wie könnte man es Betrug nennen, wenn die Wissenschaft der Kunst dient, Signore?«, erkundigte ich mich unschuldig. »Wenn das so wäre, müsste man Euch doch auch der Gaunerei bezichtigen, wenn Ihr Farben benutzt, die schon die Römer für ihre Wände bevorzugten.«
Es glückte. Zumindest gewährte mir Signor Canaletto ein Kopfnicken, das einer Zustimmung gleichkam.
»Was Ihr nunmehr braucht«, fuhr ich fort, »ist eine alchimistische Leinwand, die das Bild eigenständig übernimmt und seine Atome in die farbgebenden Stoffe umsetzt. Dann benötigt Ihr nicht einmal mehr einen Pinsel!«
Ich hörte Mister Delapoles Diener Gobbo vor Lachen glucksen und verließ das Podest auf schnellstem Wege. In ihm habe ich wahrlich einen Freund gewonnen. Luigi Gobbo ist ein hässlicher Kerl mit genau dem Ansatz von Buckel, den sein Name vermuten ließe. Er ist vor geraumer Zeit in die Dienste des Engländers getreten, in Frankreich, glaube ich. In dieser ganzen Gesellschaft ist er mir der Angenehmste von allen, stets zu einem schelmischen Scherz aufgelegt. Sobald er von meinem traurigen Schicksal erfahren hatte, nahm er mich unter seine Fittiche und schwor, dass mich kein venezianischer Spitzbube um meine magere Börse erleichtern würde. Ich schätze ihn sehr, obwohl wir nicht viel gemein haben. Unsere Eltern haben uns gewisslich mit Bildung verwöhnt. In der Annahme, auch Gobbo kenne sich ein wenig in Literatur aus, fragte ich ihn, ob er möglicherweise ein Nachfahre des berühmten Lancelot wäre und einen allseits bekannten Juden verlassen hätte, um in die Dienste von Mister Delapole zu treten, eines ebenso liebenswürdigen Mannes wie Bassiano, wenn auch noch wohlhabender. Er blickte mich an, als hätte ich den Verstand verloren oder, noch schlimmer, wollte ihn verspotten. Englische Schauspiele gehörten offensichtlich nicht zu Gobbos Ausbildung. Nichtsdestotrotz liegt ihm mein Wohlergehen am Herzen und mir das seine. Es gibt also doch so etwas wie Freundschaft in dieser Stadt.
Nun aber zu bedeutenderen Angelegenheiten. (Ich fasse mich kurz, du brauchst also nicht zu gähnen und das Blatt sinken zu lassen.) Vor einer Woche erhielt ich Manzinis letzten Bericht über unser Vermögen. (Ja, ich teile deine Ansicht, dass er sich diesbezüglich an dich wenden müsste und nicht an mich. Aber so will es nun einmal das Gesetz.) Meine Hoffnungen halten sich in Grenzen. Unsere Eltern haben große Summen für das Landgut und die kostbare Bibliothek aufgewendet. Wäre ihnen ein längeres Leben beschieden gewesen, hätten wir mit Sicherheit aus ihrer Großzügigkeit allesamt Nutzen gezogen. Aber da die Cholera anders entschieden hat, müssen wir das Beste aus dem machen, was wir haben. Und so möchte ich dir einen Vorschlag unterbreiten. Lass uns getreulich Rechenschaft über unsere Fehler und Schwächen ablegen. Berichten wir einander wahrheitsgemäß über jene, mit denen wir Umgang haben. Und arbeiten wir mit Eifer daran, uns des Namens Scacchi würdig zu erweisen. Bis dir ein schneidiger Spanier das Herz stiehlt, selbstverständlich!
Ich liebe dich, Lucia, meine teure Schwester, und würde die gesamte Pracht Venedigs für einen Augenblick des Zusammenseins mit dir und unseren geliebten Eltern in dem kleinen Bauernhaus inmitten der blühenden Wiesen unserer Heimat hingeben. Da uns das verwehrt ist, müssen wir in die Zukunft blicken.
Warte! Wie ich sehe, blickt der berühmte Canaletto erneut grollend von seinem Podest herab. Eine Schar Niederländer versucht, seinen Horst zu erklimmen und einen Blick auf sein wertvolles Gemälde zu erhaschen.
»Verfluchte Ausländer«, keift der Maler und lässt eine Flut dunkler Flüche hören, die außerhalb von Cannaregio vermutlich kein Mensch versteht. »Bleibt mir vom Leibe mit euren hässlichen Visagen und Eurem nach Hering stinkenden Atem!«
»Nur Mut!«, stachelt Mister Delapole sie an. »Zeigt ihm Eure Gulden, meine Herren. Canaletto weiß jeden zu schätzen, der Münzen in der Tasche hat!«
Unverständliches murmelnd verdrücken sich die Eindringlinge. Ich nehme an, unser Malerfreund übersteigt ihre Mittel. Während ihnen Canaletto fäusteschwingend nachblickt, hat er den Zugang zu seinem geheimnisvollen Zeltpalast offen gelassen. Ich schleiche die Leiter hinauf und sehe zu meinem höchsten Erstaunen, wie weit das Gemälde in kaum mehr als einer Stunde gediehen ist. Dieser Mann ist kein Gauner. Ich glaube, es wird ein ganz vorzügliches Gemälde. Eines schönen Tages, wenn du dich in Sevilla ausreichend eingelebt hast, um genügend Zeit und Geld für einen Besuch in deinem heimatlichen Veneto zu erübrigen, werde ich es dir zeigen. Dann werden wir auch wissen, auf welche Weise unser Schmerz geringer und unser Vermögen größer geworden ist, seit der Bucintoro seinen Weg auf diese Leinwand fand. Hier hat ein außerordentliches Talent einen ruhmreichen Moment der Geschichte eingefangen, um ihn allen kommenden Generationen zu bezeugen. Mehr als diese Worte habe ich dir nicht zu bieten, aber sie kommen aus einem aufrichtigen und bewundernden Herzen.
Kapitel 3: Ein Name aus der Vergangenheit
Giulia Morelli, Dienst habende Kommissarin der Spätschicht, sichtete die Berichte auf ihrem Schreibtisch. Es war heiß in dem modernen Polizeigebäude an der Piazzale Roma und ihre Tätigkeit begann sie zu langweilen. Hin und wieder dachte sie daran, sich versetzen zu lassen. Nach Rom vielleicht oder Mailand.
Plötzlich hielt sie inne, starrte auf die vor ihr liegende Seite und hatte das Gefühl, dass zehn Jahre wie im Nu an ihr vorbeizogen. Der Name des toten Mädchens schien sie förmlich anzuschreien. Giulia Morelli griff zum Telefon, und es gelang ihr, den zuständigen Polizisten noch zu erwischen. Er hatte Dienstschluss, wollte sich gerade umziehen und war nicht sonderlich erpicht darauf, noch länger auf der glutheißen Polizeistation herumzuhängen. Doch ihr Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass er erst gehen konnte, wenn er seine Geschichte erzählt hatte.
Sie hörte fünf Minuten lang gespannt und zunehmend verblüfft zu, legte den Hörer auf, ging zum Fenster, riss es auf und steckte sich eine Zigarette an. Draußen eilten die letzten Pendler zu ihren Autos im Parkhochhaus nahe der Brücke zum Festland und nach Mestre, wo die meisten von ihnen wohnten. Sie sah ihnen zu und dachte über das nach, was sie gerade gehört hatte. Es ergab einfach keinen Sinn. Vielleicht hatte es gar nichts mit dem Fall Susanna Gianni zu tun.
Ein ungehaltener Bestatter hatte die Polizei nach San Michele gerufen. Seine Kunden waren rechtzeitig zur Trauerfeier auf der Insel erschienen, hatten aber feststellen müssen, dass der Verwalter durch Abwesenheit glänzte. Schließlich wurde der Mann in einem für exhumierte Tote genutzten Gebäude aufgespürt. Als der Bestatter ihm Vorhaltungen machte, fuhr der Verwalter aus der Haut und griff zwei Angehörige der Trauergesellschaft tätlich an, bevor er überwältigt werden konnte.
Der hinzugezogene Polizist wollte den Friedhofsangestellten zu den Vorgängen befragen, hatte aber wenig Erfolg. Dem Bericht nach war davon auszugehen, dass der Mann wegen der Hitze die Beherrschung verloren hatte. Er wurde wegen geringfügiger Tätlichkeit verwarnt und nach Hause entlassen. Man würde die Friedhofsbehörde in Kenntnis setzen, aber keine weiteren Maßnahmen ergreifen. In dem Bericht fand sich lediglich ein ungewöhnliches Detail, was der Polizist im Gespräch mit ihr ausdrücklich bestätigte, wenn auch ohne weitere Informationen. Im Gebäude für exhumierte Leichen befand sich der Sarg einer gewissen Susanna Gianni. Er war aufgebrochen und, so schien es dem Polizisten zumindest, etwas war daraus entfernt worden. Die Umrisse eines etwa ein Meter langen Gegenstands zeichneten sich deutlich auf den sterblichen Überresten ab.
Mit der Sorgfalt und dem Weitblick, die Giulia Morelli mittlerweile von den uniformierten Kollegen gewöhnt war, hatte er diese Beobachtung zwar für erwähnenswert gehalten, aber keinen Anlass für weitere Schritte gesehen. Nachdem er dafür gesorgt hatte, dass ein Polizeiboot den Verwalter nach Hause brachte, hatte er den Sarg und mit ihm Susanna Giannis sterbliche Reste freigegeben. Da von einer privaten Verfügung durch Angehörige nichts bekannt war, wurde der Sarg am Nachmittag von Mitarbeitern der städtischen Friedhofsverwaltung abgeholt. Den Sarg hatte man vermutlich längst verbrannt und das, was von Susanna Gianni übrig war, auf den Bergen anderer Knochen auf einer der kleineren Inseln in der Lagune verstreut.
Giulia Morelli brachte nicht genug Energie auf, den Schwachkopf zu verwünschen. Sie telefonierte nach einem Polizeiboot, fuhr fünf Minuten später den Canal Grande hinauf nach Cannaregio und fragte sich, was einen Friedhofsverwalter, der doch mit Sicherheit an den Umgang mit Leichen gewohnt war, dazu gebracht haben konnte, derart schnell die Beherrschung zu verlieren. Sie fragte sich auch, wer den mysteriösen Gegenstand aus dem Sarg entfernt hatte und warum.
Sie ließ das Polizeiboot in Sant’ Alvise anlegen, stieg aus und begab sich zügig in das Straßengewirr mit Wohnblocks aus der Zeit des Faschismus. Sie hatte der Bootsbesatzung befohlen, auf sie zu warten, und wollte die Befragung allein durchführen, was eindeutig gegen die Bestimmungen verstieß. Die Einzelheiten des Falls Gianni waren ihr im Lauf der letzten zehn Jahre entfallen. Aber sie erinnerte sich genau an die Zurückhaltung, mit der über ihn gesprochen wurde, vor allem in Hörweite einer jungen Polizeianwärterin. Es bestand keine Notwendigkeit, etwas an die große Glocke zu hängen, bevor sie mehr wusste.
Die Wohnung des Verwalters lag am Rand des kommunalen Wohngebiets. Das Haus wirkte ärmlich, aber sauber. Sie öffnete die Tür und drückte auf den Lichtschalter. Eine Reihe trübgelber Glühbirnen flackerte über ihr auf. Seine Wohnung lag im zweiten Stock. Sie suchte nach dem Schalter für die Treppenbeleuchtung. Er funktionierte nicht. Aus Gründen, die sie sich nicht ganz erklären konnte, fühlte Giulia Morelli nach ihrer Tasche, in der sich ihre kleine Dienstpistole befand.
»Absurd.« Kopfschüttelnd begann sie hinaufzusteigen.
Auf der dritten Etage war es stockdunkel. Sie ärgerte sich, die Taschenlampe zurückgelassen zu haben, und fragte sich, warum sie so erpicht darauf gewesen war, die Befragung allein durchzuführen. Der Fall lag ein Jahrzehnt zurück. Als Susanna Gianni starb, war der uniformierte Kollege am Steuer des Streifenboots noch gar nicht bei der Polizei gewesen.
Die Wohnung lag ganz am Ende des Flurs, irgendwo in absoluter Dunkelheit. Sie rief den Namen des Mannes und wusste sofort instinktiv, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Vor sich nahm sie ein Geräusch wahr. Aus einer kaum zwei Zentimeter offen stehenden Tür drang ein Lichtschimmer. Vorsichtig trat sie einen Schritt näher und hörte es nun deutlicher: ein lang gezogenes heiseres Stöhnen, das zwischen sexueller Ekstase und Todesqual alles ausdrücken konnte.
Giulia Morelli griff in ihre Tasche und holte das Funkgerät heraus. Sie bekam keine Verbindung. Mussolinis Handwerker hatten massiv und solide gebaut. Sie umklammerte das Gerät mit der linken Hand, zog mit der rechten ihre Pistole aus der Tasche, entsicherte sie, schob geräuschlos die Tür auf und hielt sich außerhalb des Lichtkegels der einsamen Glühbirne.
Sie wollte etwas von sich geben, strenge polizeiliche Aufforderungen, die fast immer wirkten und den kleinen Schmalspurganoven, mit denen sie es meistens zu tun hatte, einen heilsamen Schrecken einjagten. Aber die Worte erstarben ihr auf den Lippen. Giulia Morelli nahm die Szene in sich auf, so gut sie konnte. Die Beleuchtung war jämmerlich und der Unbekannte stand im Schatten, sein Gesicht blieb ihr verborgen. Sie nahm nur einen Arm wahr, der ein langes, blutiges Messer schwang, und Gerüche: nach starken, billigen Zigaretten, afrikanischer Provenienz möglicherweise, und Angstschweiß.
Sie musste an das Gemälde denken, das verdammte Bild, das sie seit ihrer Kindheit verfolgte. Tiepolos Martyrium des heiligen Bartholomäus befand sich im Altarraum von San Staè und zeigte einen offenbar entrückten Mann, der die Arme gen Himmel reckte, während ein halb verborgener Angreifer wie prüfend mit einer Messerklinge über seine Haut fuhr und sich zu fragen schien, wo er zustechen sollte. Sie hatte ihre Mutter gefragt, was das Bild darstellte, und die unverständliche Antwort erhalten, dass der Heilige »geschunden« worden war. Erst später, als sie das Wort in einem Lexikon fand, begriff sie. Es war der Moment vor dem absoluten Grauen. Der Henker war dabei, sein Opfer bei lebendigem Leibe zu häuten. Und der Märtyrer blickte verzückt zum Himmel, erwartete freudig seine Erlösung. Gefühle, die sie vermutlich nie verstehen würde.
Der Friedhofsverwalter von San Michele befand sich nicht im Stadium der Entrückung. Er war tot, zumindest hoffte sie es für ihn. Seine durchschnittene Kehle zeigte ein breites blutiges Band aus Fleisch- und Muskelgewebe. Und obwohl sein Mörder außer Sicht blieb, wusste sie, dass er daranging, seine Arbeit zu beenden, und langsam und sorgfältig alle Sehnen durchschnitt, die er im Hals des Mannes finden konnte.
Sie wollte die Pistole fester packen, die drohte, ihrer schweißnassen Hand zu entgleiten. Aber ihre Finger schlossen sich nicht richtig um den Griff und sie hörte Metall auf den Fliesenboden scheppern. Giulia Morelli konnte nichts anderes tun, als den Toten fassungslos anzustarren.
Links von ihr baute sich ein Schatten auf. Ein Fuß stieß vor und traf sie mit voller Wucht. Sie stürzte auf die Knie, wartete auf den nächsten Schlag und fragte sich, ob sie den Mut aufbringen würde, nach oben zu blicken, zum Himmel, ins Nichts, wie der Heilige auf Tiepolos Gemälde. Aber da war er, und sie wollte ihm nicht ins Gesicht sehen.
Sie wollte etwas sagen, aber ihr fiel nichts Vernünftiges ein. Vor ihren Augen blitzte es silbern auf. Sie spürte einen plötzlichen Schmerz in der Seite, gefolgt vom Rinnen warmen Bluts. Ihr Atem ging in schnellen, abgehackten Stößen. Sie wartete.
Und dann erwachte das Funkgerät in ihrer Hand zum Leben. In ihrer Panik hatte sie offenbar auf sämtliche Knöpfe gedrückt. Irgendwie musste ihr schwacher Hilfeschrei Mussolinis Mauern durchdrungen und ein menschliches Ohr erreicht haben. Eine Stimme schrie sie an. Irgendwo weit unten im Hausflur hörte sie Schritte. Die Polizei konnte das noch nicht sein, aber das wusste der dunkle Schatten über ihr nicht, von dessen Messer Blut auf ihr Gesicht tropfte.
»Sie sind festgenommen«, sagte Giulia Morelli und stellte verwundert fest, dass sie fast lachen musste. Er war fort. Im Raum war niemand mehr außer dem toten Verwalter, der sie mit glasigen Augen über seiner fürchterlichen Halswunde anstarrte.
Sie tastete nach der Wunde an ihrer Seite. Sie würde leben. Den Mann aufspüren und herausfinden, warum er Susanna Giannis Totenruhe gestört, was er aus ihrem Sarg geraubt hatte. Es gab viel zu tun.
Mühsam kam Giulia Morelli auf die Füße. Schritte vor der Tür. Ein Hausmeister vielleicht. Ein anderer Mieter. Es war wichtig, die Kontrolle zu übernehmen.
»Nichts anrühren«, sagte sie und versuchte, logisch und sachlich zu denken.
Halb verwundert, halb entsetzt starrten sie alle an. Giulia Morelli folgte ihren Blicken und sah, wie Blut ihre Jacke durchdrang, ihren kurzen Rock hinablief, warm und klebrig auf ihren Knien gerann.
»Nichts ...«, wiederholte sie und merkte, wie der Blick ihrer Augen nach oben glitt, sah das trübe Licht der Wohnung immer dunkler werden und schließlich ganz erlöschen.
Kapitel 4: Spritz! Spritz! Spritz!
Drei Wochen nach der Öffnung von Susanna Giannis Sarg und dem gewaltsamen Tod eines Friedhofsverwalters in Cannaregio betrat Daniel Forster die Ankunftshalle des Marco-Polo-Flughafens mit einem Violinkasten, der weder alt war noch unangenehm roch. In ihm befand sich eine ganz normale Geige, und der kleine Koffer in seiner anderen Hand enthielt nahezu seine gesamte Garderobe, die hoffentlich die nächsten fünf Wochen reichen würde. Der Flug von Stansted hatte zwei Stunden gedauert, und die Maschine hatte die schneebedeckten Alpen überquert, bevor sie in steilem Winkel in der nordöstlichen Ecke der Adria landete. Er war gerade zwanzig geworden und es handelte sich um seine erste Auslandsreise. In der Tasche seines grünen Anoraks steckten sein nagelneuer Pass und ein Plastikumschlag von Thomas Cook mit sechshunderttausend Lire – etwa zweihundert Pfund und damit fast das gesamte Guthaben auf seinem Girokonto.
Er war knapp unter einsachtzig, hatte lange blonde Haare und ein sympathisches, noch immer irgendwie jungenhaftes Gesicht. Wie er da unsicher in der Ankunftshalle herumstand, wirkte er wie ein frisch gebackener Fremdenführer, der auf seine ersten Kunden wartet. Dann trat ein großer Mann in dunklen Hosen und einem voluminösen blauen Sweatshirt auf ihn zu und fragte: »Mister Forster?«
Daniel zwinkerte überrascht. »Signor Scacchi?«
Der Mann lachte dröhnend. Er war vielleicht Ende dreißig und hatte die frische, wettergegerbte Gesichtsfarbe eines Farmers oder Fischers. Eine leichte Alkoholfahne umwehte ihn. »Signor Scacchi! Sehe ich vielleicht aus wie ein Pfau? Glauben Sie, ich könnte trällern? Kommen Sie, kommen Sie.«
Daniel folgte dem Mann zur Halle hinaus und fand sich nach wenigen Schritten an der Lagune wieder. Ein Dutzend oder mehr Wassertaxis warteten auf Fahrgäste. Ihre Holzdecks schimmerten in der Sonne. Sie gingen an ihnen vorbei zu einem alten blauen Fischerboot mit Außenborder. Im Bug schmiegten sich zwei schlanke Männer aneinander. Mittschiffs machte sich eine Frau in Jeans und rotem T-Shirt an zwei Picknickkörben zu schaffen. Neben ihr versuchte ein kleiner schwarzer Spaniel mit kurzen Ohren und stumpfer Nase, einen neugierigen Blick auf den Inhalt zu werfen, wurde aber immer wieder verscheucht.
Der große Mann musterte die Passagiere, wartete vergebens auf ihre Aufmerksamkeit, klatschte in die Hände und rief: »Bitte! Unser Gast ist da! Wir müssen ihn willkommen heißen.«
Der kleinere der beiden Männer stand auf. Er trug einen gut geschnittenen rehbraunen Anzug und musste etwa Ende sechzig sein. Sein Gesicht war sonnengebräunt, faltig und bis zur Auszehrung mager. Er wirkte krank, wie auch der junge Mann neben ihm, der den Ankömmling ausdruckslos betrachtete.
»Daniel!« Lächelnd entblößte der alte Mann zwei Reihen zu weißer Zähne. Er war nicht sonderlich groß und stand leicht gebeugt. »Seht ihr, Paul, Laura? Ich habe es euch gesagt. Erst vor zehn Tagen haben wir ihm geschrieben und wir sind Fremde für ihn. Dennoch ist er gekommen!«
Die Frau drehte sich zu ihm um. Sie hatte ein attraktives Gesicht mit runden Wangen. Ihre Augen schimmerten dunkelgrün, die glatten, kastanienbraunen Haare fielen ihr auf die Schultern. Sie sah ihn an, als wäre er ein Wesen vom anderen Stern, aber mit einer freundlichen Neugier, als würde seine Anwesenheit sie irgendwie erheitern.
»Er ist gekommen«, wiederholte sie fast automatisch mit einem leicht venezianischen Akzent, griff in ihre Handtasche, holte eine gewaltige Plastiksonnenbrille heraus und setzte sie auf.
»Nun, wer hätte das gedacht?«, murmelte Paul. Daniel hielt ihn für einen Amerikaner. Er trug ein ausgeblichenes Denimhemd und Jeans in der gleichen Farbe. Wie er da am Bug lümmelte, hatte er die Schlaksigkeit eines Teenagers und wirkte auf den ersten Blick auch so jung, aber auf den zweiten sah er aus wie ein Fünfzigjähriger, der sich den Anschein eines Dreißigjährigen gibt.
»Natürlich«, sagte der große Mann, reichte Laura das Gepäck und streckte eine Pranke aus, um Daniel beim Betreten des leicht schaukelnden Bootes zu helfen. »Wer würde nicht nach Venedig kommen, wenn er eingeladen wird?«
Daniel akzeptierte die angebotene Hand und trat mit einem Schritt von der Anlegestelle auf das Boot.
»Da sonst niemand eine Vorstellung für nötig zu halten scheint ...«, begann der Hüne. »Ich bin Piero. Der Trottel der Familie. Aber nur weitläufig verwandt, daher macht es nicht viel aus. Und das ist mein Boot, die prachtvolle Sophia, eine treue und verlässliche Dame, die stets anspringt, wenn man sie braucht, was vermutlich heißt, dass sie gar keine Dame ist. Nicht, dass ich mich mit derlei auskennen würde. Ich habe es nur gesagt, um Laura zuvorzukommen.«
Der Hund zupfte an Daniels Hosen. Piero bückte sich und zauste ihn zärtlich an den Ohren. »Und das ist Xerxes. So genannt, weil er der König der Marschen ist. Seinen flinken Augen entgeht keine einzige Wildente, was?«
Bei dem Wort »Wildente« begann Xerxes aufgeregt mit dem Schwanz zu wedeln. Piero kraulte ihn unter dem Kinn, griff in einen der Picknickkörbe und schob eine Salamischeibe in seine aufgerissene Schnauze.
Scacchi beugte sich so heftig vor, dass das kleine Motorboot schwankte. »Spritz! Spritz! Spritz!«, rief er. Seine Hand deutete Trinkbewegungen an.
»Sofort.« Laura holte ein paar Flaschen aus dem zweiten Picknickkorb.
»Setzen bitte«, rief Piero, zog am Starterseil und kletterte nach hinten. Einer der Wassertaxi-Fahrer musterte das schäbige kleine Boot und machte eine Bemerkung, die sich Daniel nicht einmal ansatzweise enthüllte. Piero entgegnete etwas ähnlich Unverständliches und zeigte dem Mann den kleinen Finger. Das Boot setzte sich in Bewegung, verließ die Anlegestelle, den Flughafen und knatterte in die Weiten der Lagune von Venedig hinaus. Was jahrelang eine Vorstellung in Daniel Forsters Kopf gewesen war, eine imaginierte Welt, wurde nun Wirklichkeit. In der Ferne stiegen die Umrisse von Venedig aus dem Meer – ein bizarres Gewirr von campanili und Palästen – und wurden qualvoll langsam größer.
»Spritz«, wiederholte Scacchi.
Laura streckte ihm drei Flaschen entgegen: Campari, Weißwein aus dem Veneto, Mineralwasser. Dann füllte sie fünf Becher mit Eiswürfeln, jeweils einer Zitronenscheibe und einer Olive und reichte sie dem alten Mann.
Scacchi sah ihn an und zum ersten Mal bemerkte Daniel etwas Durchtriebenes in seinem Blick. »Wissen Sie, was das ist?«
»Ich habe davon gelesen und mich immer gefragt, wie es schmeckt.«
»Habt ihr das gehört?« Begeistert sah Scacchi die anderen an. »Eine wundervoll reine italienische Aussprache. Ruinieren Sie sich die bloß nicht mit dem venezianischen Dialekt, mein Junge. Wenigstens nicht zu schnell. Das hier ist Spritz, und es sagt Ihnen alles, was Sie über die Stadt wissen müssen. Sehen Sie her. Campari steht für unser Temperament, Wein für unsere Lebensfreude, Wasser für unsere Reinheit. Lach nicht, Paul. Eine Olive für unsere Erdverbundenheit. Und die Zitrone soll Ihnen sagen, dass wir notfalls zurückbeißen. Hier, bitte.«
Er reichte Daniel einen randvollen Becher. Er trank einen Schluck. Es war hauptsächlich Campari, und das bittersüße Aroma erinnerte ihn an Pieros Atem.
Laura lächelte ihn an, als erwarte sie irgendeine Reaktion. »Und etwas zu essen«, sagte sie und reichte einen Teller mit Weißbrot herum. Es war mit Käse und Parmaschinken belegt. Daniel griff zu und versuchte, ihr Alter zu schätzen. Vermutlich war sie Ende oder erst Mitte zwanzig und nicht Mitte dreißig, wie ihre einfache Kleidung und die dunkle Sonnenbrille vermuten lassen könnte.
»Auf Daniel!« Scacchi hob seinen Becher. Die anderen taten es ihm nach. Xerxes bellte leise. Das Boot schaukelte und Scacchi nahm schnell seinen Sitz neben Paul wieder ein. »Mögen ihm die kommenden Wochen die Augen für die Schönheit der Welt öffnen!«
»Auf Daniel!«, wiederholten die anderen.
»Ich fühle mich geehrt«, antworte Daniel. »Und hoffe, den Auftrag zur Zufriedenheit auszuführen.«
»Davon bin ich überzeugt.« Scacchi machte eine abwehrende Handbewegung. »Sonst hätte ich mich nicht an Sie gewandt. Der Rest der Zeit gehört Ihnen.«
»Ich werde mich bemühen, sie gut zu nutzen.«
»Ganz wie Sie wollen.« Scacchi gähnte.
Der alte Mann nahm einen tiefen Schluck, stellte seinen Plastikbecher auf die Bank an der Innenwand des Bootes, lehnte seinen Kopf gegen Pauls Schultern und schlief ein.
Zügig durchschnitt die Sophia die Wellen, hielt sich anfangs an die Fahrrinne vom Flughafen und schlug dann eine kürzere Route zur Lagunenstadt ein. Um Scacchi nicht zu wecken, herrschte Stille an Bord. Paul fuhr dem alten Mann gelegentlich über die Haare. Piero trank. Laura bot Daniel eine Zigarette an, schien angenehm überrascht, dass er ablehnte, steckte sich selbst aber eine an und schnippte die Asche ins Wasser. Nach einer Weile schlief auch Paul ein, schlang die Arme um Sacchi und legte seinen Kopf auf die Brust des alten Mannes. Es war eine anrührende Geste, die eigentümlich traurig wirkte. Piero und Laura tauschten Blicke aus. Mehrmals füllte sie sein Glas auf. Der Julitag neigte sich dem Ende zu und hüllte die Stadt vor ihnen in ein rosafarbenes, goldenes Licht.
Piero pfiff leise und der Hund kam zum Heck gelaufen. Er streckte Xerxes eine mit dem Ruder verbundene Lederschlaufe entgegen und wartete, bis der Hund sie zwischen die Zähne genommen hatte.
»Avanti!«, flüsterte Piero, und sofort richteten sich die Augen des Hundes über das Boot hinaus auf den Horizont. »Immer geradeaus, mein Kleiner. Papa braucht eine Ruhepause.«
Piero setzte sich zu ihnen auf die Mittelbank und blickte auf die beiden schlafenden Männer.
»Sehen Sie, Daniel? Die beiden lieben sich wie Turteltauben. Stören Sie sich nicht an dem Amerikaner. Er ist nun einmal Scacchis Wahl und Eifersucht ist eine böse Sache. Männer lieben Männer ... Ich fasse es nicht. Aber was geht es mich an? Nichts.«
Daniel schwieg.
»Und Sie auch nicht, mein neuer Freund«, fuhr Piero fort. »Deshalb hat Scacchi Sie nicht eingeladen, wie ich weiß. Nicht, dass er sich mir groß anvertraut oder ich kleines Licht annehmen dürfte, etwas davon zu verstehen. Aber er sagte, die Sachen, die Sie geschrieben haben ...«
»In meiner Examensarbeit«, warf Daniel ein.
»Ja. Sie wären ganz ausgezeichnet, hat er gesagt. Bene? Aber ... warten Sie’s ab. Sehen Sie den Hund da?«
»Er ist ein Wunder«, bemerkte Daniel und meinte es ehrlich.
»Mehr als das. Er ist ein Beweis für die Existenz Gottes.«
»Piero!«, schimpfte Laura. »Das ist Gotteslästerung.«
Der Hüne verdrehte die Augen. Daniel wollte nicht darüber nachdenken, wie viel Campari er auf der langen Fahrt über die Lagune zum Flughafen konsumiert haben könnte.
»Überhaupt nicht. Er ist ein Beweis für die Existenz Gottes, und ich werde Ihnen sagen, warum. Ihnen ist wahrscheinlich bewusst, dass er ein J-Hund ist. Ich spreche das Wort natürlich nicht aus, weil er sonst sofort das Ruder loslassen, uns im Kreis herumschicken und so laut kläffen würde, dass die beiden da drüben aufwachen. Aber Sie wissen, was ich meine?«
Sich so drehend, dass der Hund ihn nicht sehen konnte, tat Daniel, als würde er ein Gewehr an die Schulter heben und abdrücken.
»Genau. Und doch gehört er zur allerältesten Rasse. Wenn Sie wollen, bringe ich Sie eines Tages mit der Sophia nach Torcello und zeige Ihnen dort auf einer Mosaikwand den Ururahnen dieses Hundes. Und das alles, bevor es die J ... überhaupt gab. Und wie lautet deine Erklärung, Mädchen?«
Laura schlug ihm mit der flachen Hand aufs Knie. »Das nennt man Evolution, du Narr.«
»Das nennt man Gottes Werk. Denn Gott kennt sich mit der Zeit nicht so gut aus wie wir. Als er den Spaniel erschuf, wusste er nicht, dass eines Tages ein anderes seiner Geschöpfe die J ... erfinden würde. Daher hat er dem Tier gleich alles Nötige mitgegeben, um sich zu ersparen, im Fall des Falles ein neues Tier erschaffen zu müssen. Für Gott ist die Zeit nur eine weitere seiner Schöpfungen. Wie Bäume. Und Menschen. Und Wasser. Und ...«
Er streckte Laura seinen Plastikbecher entgegen. »Spritz! Darüber hinaus ...«
Kopfschüttelnd füllte Laura den Becher zur Hälfte. »Und darüber hinaus bist du sturzbetrunken, Piero.«
Unvermittelt sah der Hüne ganz bekümmert aus. »Vermutlich hast du Recht.« Er reckte die Nase in den Wind, als wäre der umgeschlagen, und drehte sich zu Xerxes um. Das Boot war nach Osten abgedriftet, ohne dass es jemand bemerkt hatte. Piero ging zum Heck und korrigierte den Kurs.
»Avanti, Xerxes«, sagte er liebevoll. »Wir fahren erst später nach Sant’ Erasmo. Nachdem wir diese guten Leute in der Stadt abgesetzt haben. Erst dann geht’s nach Hause.«
Laura warf ihm ein paar Kissen zu.
»Nach Hause«, wiederholte er und sah Daniel an. »Scacchi sagte, Sie haben kein Zuhause. Stimmt das?«
»Meine Mutter ist vor einem Jahr gestorben. Und mein Vater hat uns schon vor meiner Geburt verlassen. Aber natürlich habe ich eine Wohnung.«
»Keine Verwandten?«
»Keine nahen.«
»Und trotzdem sind Sie so ein schlaues Kerlchen?« Piero wirkte überrascht. »Was sagt man dazu?«
Laura hob die Brauen, stand auf, machte aus den Kissen eine Art Bett für Piero und setzte sich wieder neben Daniel.
»Ein Mensch ohne Zuhause hat gar nichts«, erklärte Piero. »Wie dieser Paul da. Nun gut, Scacchi hat ihn sich ausgesucht. Aber dafür wird er weiß Gott bezahlen, mit dieser Krankheit, mit der dieser Amerikaner ihn angesteckt hat. Aber hier ist nicht sein Zuhause. Er hat keins. Wohin wird man ihn bringen, nachdem er gestorben ist? Vermutlich in einen Sarg stecken und mit dem Flugzeug nach Amerika zurückschicken.«
»Piero ...« Lauras Stimme war lediglich ein Hauch Ungeduld anzumerken. »Schlaf jetzt. Bitte.«
»Ja.« Piero streckte sich auf den Kissen aus und passte seine hünenhafte Gestalt der schmalen Bank mit einer Geschicklichkeit an, die nur von jahrelanger Übung herrühren konnte. Xerxes jaulte leise auf, ließ aber die Lederschlaufe nicht los. Daniel Forster blickte Laura an. Sie hob ihren Plastikbecher. »Salute«, sagte sie. Links von ihnen tauchte San Michele mit endlosen Reihen recycelter Gräber auf. Er stieß mit ihr an und versuchte sich an die Berühmtheiten zu erinnern, die auf der Insel bestattet waren: Diaghilew, Strawinsky und Ezra Pound fielen ihm ein. Lange Monate hatte er sich intensiv mit der Stadt vertraut gemacht, ihre Viertel auswendig gelernt, ihre Geschichte in sich aufgenommen. Er war gespannt gewesen, ob die Wirklichkeit eine Enttäuschung sein würde, ob er einen für Touristen konservierten Vergnügungspark vorfinden würde. Nein, sagte etwas in ihm, aber auch, dass sich die reale Stadt, die reale Lagune von dem Bild unterscheiden würden, das er sich mit Hilfe der aus der Uni-Bibliothek ausgeliehenen Bücher von ihnen gemacht hatte.
Sie streckte eine schmale, gebräunte Hand aus, riss ihn aus seinen Gedanken, und er bemerkte, dass sie in der Tat sehr hübsch war.
»Ich bin hier das Mädchen für alles«, sagte sie. »Köchin, Haushälterin, Kindermädchen in einer Person. Sie sollten wissen, dass Scacchi trotz seiner Schwächen der liebenswürdigste Mensch auf Erden ist. Vergessen Sie das bitte nicht.«
»Nein.« Ein bisschen verlegen schüttelte er die Hand und fragte sich, ob sie etwa erwartete, dass er sie küsste.
»Piero ist ein einfältiger Narr«, fuhr sie fort. »Paul und Scacchi sind ... nun ja, gleiche Brüder, Seelenverwandte, sagt man wohl. Allerdings findet sich einer besser mit seinem Schicksal ab als der andere, wenn auch ein gewisses Schuldgefühl nicht zu übersehen ist. Ich habe beide sehr gern und wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie während Ihres Aufenthalts Sympathie für sie empfinden oder zumindest so tun könnten.«
»Das werde ich mit Sicherheit.«
Sie schlug ihm spielerisch aufs Knie. »Unsinn. Wie können Sie so etwas jetzt schon behaupten? Sie kennen uns doch noch gar nicht.«
Er lächelte. Eins zu null für sie. »Und was soll ich dann Ihrer Meinung nach sagen?«
»Nichts. Einfach zuhören. Und die Dinge auf sich zukommen lassen. Das fällt Männern nicht immer leicht, wie ich weiß. Oh, verdammt!«
Das Boot hatte erneut die Richtung geändert. Aufgeregt zitternd saß Xerxes am Heck.
»Wie kann man nur einen Hund ein Boot steuern lassen!«
Laura kletterte zum Heck und übernahm das Ruder. Zufrieden hockte sich der Hund an den Bootsrand, hob das Bein und erleichterte sich in die Lagune. Dann sah er Laura traurig an, bis er merkte, dass sie nicht die Absicht hatte, ihm das Steuer wieder zu übergeben. Der Hund schleppte sich zu Piero, legte die Schnauze auf seinen Oberschenkel und schloss die Augen.
Drei schlafende Betrunkene und ein Hund mit Namen Xerxes. Und eine faszinierende Frau, die ihn vom Heck her musterte und das Boot umsichtig auf die Stadt zusteuerte. In der Phantasie hatte sich Daniel Forster seine Ankunft in Venedig oft und auf unterschiedlichste Weise vorgestellt. Nichts davon kam der Realität auch nur ansatzweise nahe. Noch hätte er vorhersehen können, was als Nächstes geschah. Als das Boot langsam, aber stetig an Cannaregio entlangtuckerte, näherte sich ein Polizeiboot, verlangsamte die Fahrt und passte sich ihrer Geschwindigkeit an. Scheinbar ungerührt saß Laura am Heck. Hinten im Streifenboot stand eine schlanke Frau mit kurzen blonden Haaren. Sie trug eine dunkelblaue Dienstuniform mit knapper Jacke und knielangem Rock. In der Hand hielt sie ein Megaphon. Daniel warf einen Blick auf die drei schlafenden Männer. Die Polizistin auch. Dann sah sie Laura an, die nur lächelnd mit den Schultern zuckte.
Es war zu laut und die Entfernung zu groß, aber Daniel hätte schwören können, dass die uniformierte Frau kurz fluchte und dem Polizisten am Steuer etwas zurief. Schlingernd beschleunigte das Polizeiboot und raste in einer Gischtwolke davon.
»Sehen Sie, Daniel? Sogar die Polizei ist zu Ihrer Begrüßung erschienen«, bemerkte Laura.
Aber er konnte ihre Worte kaum verstehen. Die Sophia hatte scharf gedreht und fuhr nun auf eine Wasserstraße zu, die Daniel für die Mündung des Canale di Cannaregio hielt. Eine Unmenge kleinerer Boote flitzte über die Wellen. Ein Vaporetto der Linie 52 kam auf sie zu, kurz bevor sie die Tre-Archi-Brücke unterquerten. Geschickt wich Laura den anderen Booten aus und zügig machte sich die Sophia auf den Weg zum Canal Grande. Mit einigem Stolz stellte Daniel fest, dass er die Geographie der Stadt wenigstens einigermaßen im Kopf hatte. Links von ihm lag der ältere Teil von Cannaregio, in dessen Mitte sich irgendwo das ehemalige jüdische Ghetto verbarg. Rechts lag das belebte Geschäfts- und Touristenviertel rund um den Bahnhof.
»Wissen Sie, warum Sie hier sind?«, fragte Laura, unbeeindruckt vom Gewimmel der Boote in allen erdenklichen Formen, Größen und Farben um sie herum.
»Um Signor Scacchis Bibliothek zu katalogisieren«, antwortete er laut, um sich verständlich zu machen.
»Die Bibliothek katalogisieren!« Wenn sie lacht, wirkt sie viel jünger, dachte er. »Hat er das so genannt?«
Vor ihnen lag die Einmündung in den Canal Grande, und die Sophia schaukelte auf den Wellen, die von der »schönsten Straße der Welt« in den Cannaregio-Kanal schwappten.
»Und warum bin ich in Wahrheit hier?«, rief er und wusste nicht, wohin er zuerst blicken sollte.