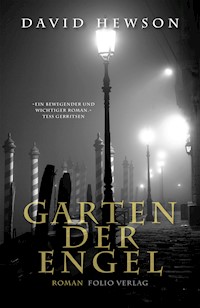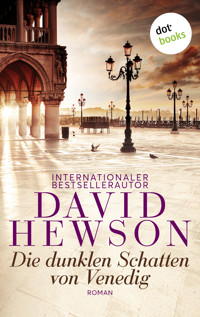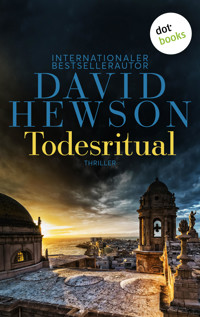
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein gnadenloser Killer hält Spanien im Würgegriff: Der fesselnde Thriller »Todesritual« von David Hewson jetzt als eBook bei dotbooks. Im spanischen Cádiz hat die heilige Woche begonnen: Brütende Hitze flirrt über der Stadt, in die Millionen Menschen strömen. Mitten unter ihnen lauert ein eiskalter Schlächter, dessen Grausamkeit keine Grenzen kennt und der seine Opfer nach der Art eines Stierkampfs tötet. Sogar die Akademikerin Maria Gutierrez, die eigentlich nur die Arbeit der Polizei überwachen soll, wird immer tiefer in die Ermittlungen verstrickt – auch wenn sie hofft, sich dadurch nicht selbst in Gefahr zu begeben. Doch dann stößt sie auf totgeschwiegene Geheimnisse aus der Zeit des Bürgerkriegs – und zieht damit den alles verzehrenden Zorn des Killers auf sich, so blutig rot wie das Tuch des Matadors … »Hewson ist geradezu einschüchternd talentiert!«, urteilt Bestsellerautor Jeffery Deaver. Die britische Zeitung Daily Telegraph jubelt: »Die Lösung bleibt bis zum Schluss offen … Die Spannung wird fast unerträglich!« Jetzt als eBook kaufen und genießen: der abgründige Thriller »Todesritual« von David Hewson, auch bekannt unter dem Titel »Semana Santa«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im spanischen Cádiz hat die heilige Woche begonnen: Brütende Hitze flirrt über der Stadt, in die Millionen Menschen strömen. Mitten unter ihnen lauert ein eiskalter Schlächter, dessen Grausamkeit keine Grenzen kennt und der seine Opfer nach der Art eines Stierkampfs tötet. Sogar die Akademikerin Maria Gutierrez, die eigentlich nur die Arbeit der Polizei überwachen soll, wird immer tiefer in die Ermittlungen verstrickt – auch wenn sie hofft, sich dadurch nicht selbst in Gefahr zu begeben. Doch dann stößt sie auf totgeschwiegene Geheimnisse aus der Zeit des Bürgerkriegs – und zieht damit den alles verzehrenden Zorn des Killers auf sich, so blutig rot wie das Tuch des Matadors …
»Hewson ist geradezu einschüchternd talentiert!«, urteilt Bestsellerautor Jeffery Deaver.
Die britische Zeitung Daily Telegraph jubelt: »Die Lösung bleibt bis zum Schluss offen … Die Spannung wird fast unerträglich!«
Über den Autor:
David Hewson wurde 1953 geboren und begann bereits im Alter von 17 Jahren für eine Lokalzeitung im Norden Englands zu arbeiten. Später war er Nachrichten-, Wirtschafts- und Auslandsreporter bei der »Times« und Feuilletonredakteur bei »The Independent«. Heute ist er ein international bekannter Bestsellerautor. Sein Thriller »Todesritual«, auch bekannt unter dem Titel »Semana Santa«, wurde mit dem W. H. Smith Fresh Talent Preis für einen der besten Erstlingsromane ausgezeichnet und verfilmt. Er schrieb die Bücher zur dänischen Fernsehserie »The Killing« und seine Nic-Costa-Kriminalromane wurden weltweit zum großen Erfolg.
Bei dotbooks erscheinen von David Hewson die Nic-Costa-Kriminalromane »Das Blut der Märtyer« und »Der Kult des Todes« und der Spannungsroman »Die dunklen Schatten von Venedig«.
Die Website des Autors: davidhewson.com
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Semana Santa« bei Harper Collins Publishers, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Semana Santa« bei Ullstein.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1996 by David Hewson
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung eines Motivs von pabloavanzini / shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-094-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Todesritual« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Hewson
Todesritual
Thriller
Aus dem Englischen von Hedda Pänke
dotbooks.
Kapitel 1
La Soledad.
Die Worte hallten im Kopf der alten Frau nach, als sie aus schnell verblassenden Träumen erwachte. Wie das leise Knurren eines unsichtbaren Tieres drang der Lärm der Stadt durch die Tür unter dem Mauerbogen. Oleanderduft mischte sich mit dem Geruch von Diesel und Zigaretten. Von ihrem Sessel aus, dessen brüchiges Rohrgeflecht ihr in die Glieder stach, konnte sie über den Garten in den Patio blicken. Ein paar Orangen- und Zitronenbäume mit schrumpeligen, in der Nachmittagssonne verstaubt wirkenden Früchten, die wächsernen, roten Samenhülsen an einem einsamen Granatapfelbaum, der plötzliche Gestank von Katzenpisse in der für die Jahreszeit zu warmen Nachmittagsluft.
Caterina Lucena sah, wie sich die Geister wieder versammelten: heiter, unbeschwert, geräuschvoll. Lachen klang zwischen den glänzenden Wänden wider, die Kacheln schimmerten neu in der Sonne. Sie sah, wie die Leute von Gruppe zu Gruppe schlenderten, genau wie vor mehr als sechzig Jahren, als sie sie als junges Mädchen, von Hochachtung und Bewunderung erfüllt, von ebendiesem Fenster aus beobachtet hatte. Alle großen Persönlichkeiten der Zeit waren hier gewesen. Einmal hatte sie sogar ihn, Lorca, gesehen. Unter Orangenblüten hatten sie Fino und Manzanilla getrunken und über Dinge gesprochen, die sie nicht verstand. Sie hatte gesehen, wie sich der Ausdruck ihrer Mienen im Verlauf zweier Jahreszeiten von strahlender Zuversicht in unausgesprochene Besorgnis verwandelt hatte, dann in bange Furcht und schließlich in nackte, brutale Angst.
Und während dieser ganzen Zeit hatten die Bäume geblüht und Früchte getragen. Ungepflückt blieben sie an den Zweigen hängen und wurden von den Kutschen und Autos, die sie hinter der Mauer hören konnte, mit staubigem Sand bedeckt.
Eines Tages kam sie, von unbekannten Geräuschen geweckt, aus ihrem kleinen, sonnigen Zimmer herunter und fand die Erde mit faulenden Früchten bedeckt vor. Es war, als hätte ein plötzliches Erdbeben sie von den Ästen geschüttelt. Zerfetzt und verformt lagen sie auf der trockenen rotbraunen Erde. Verwesendes Fruchtfleisch quoll aus den aufgeplatzten orangefarbenen und gelben Schalen hervor. Das hatte etwas Obszönes und war über den reinen Anblick hinaus beängstigend.
Eine Lebensspanne später sah sie sich wieder so, wie sie damals war, beobachtete das junge Mädchen in seinem weiten Kleid aus kühler Baumwolle, das an der blaugold gefliesten Tür des Patios in der Sonne stand und schockiert und ahnungsvoll auf die bittere Ernte blickte.
Sie wartete. Es würde kommen. Es kam immer.
Eine Explosion hinter der Patiomauer, so ohrenbetäubend, so gewaltsam, als würde die Welt auseinandergerissen. Die Luft, der Himmel erbebte. Sie schrie, und die Zeit spielte verrückt, die Sekunden wurden zu Stunden, als wollte sie die Schmerzen, das Leid verlängern.
Die Bäume waren wie elektrisiert. Ihre Äste zuckten, als durchliefen sie stahlharte Muskeln, die sich plötzlich aus Wut oder Angst verspannten. Sie ballten sich wie Fäuste, entspannten sich wieder, und die Luft füllte sich mit Blättern, Zweigen und dem widerlich süßen Aroma faulender Früchte. Die Detonation der Kanone trieb einen neuen Geruch heran, den scharfen Gestank von Kordit und Verbranntem.
Über ihr Flügelschläge, angstvolle Schreie der Vögel, Flattern, Flattern.
Ein Gegenstand taucht vor ihr auf, sinkt vom Himmel, blutige Tränen auf Weiß, nahe genug, um ihn zu berühren. Er schwebt wie eine Feder herab, langsam, fast anmutig. Sie kann das Rot, tiefdunkel und sehr real, auf den Federn sehen. Kann den blutigen Streifen am Hals sehen, wo die Explosion den Kopf abgerissen hat. Und spürt irgendwo in ihrem Hinterkopf, dass sie schreit. Doch da ist kein Laut, kein Schmerz, überhaupt keine Empfindung. Die Welt ist zu einem einzigen Ereignis zusammengeschrumpft: Vor ihr schwebt eine kopflose Taube mit unwirklicher Langsamkeit zu Boden.
Sie sieht, wie der Hals krampfhaft zuckt. Sie sieht, wie Blut aus dem Körper pulst. Die Tropfen fliegen langsam durch die Luft, perfekte rote Perlen, halb erstarrt in ihrer Bewegung. Sie fallen auf ihr Kleid, ihre Haut. Sie sieht das Rot auf ihren Armen, spürt es klebrig in ihrem Nacken. Sie schreit, fühlt den leichten roten Regen auf ihrer Zunge und kommt nicht umhin, ihn zu schmecken – frisch, warm und salzig –, als sie sich automatisch mit der Zunge über die Lippen fährt. Und die gedankliche Umsetzung dreht ihr den Magen um, lange bevor die physische Reaktion einsetzt.
Die Zeit bleibt stehen. Die Taube verharrt vor ihr, als wolle sie sagen: Das ist der Moment. Dann setzen die Sekunden wieder ein. Mit einem plötzlichen, brutalen Klatschen prallt sie auf der Erde auf, und als sie zu würgen beginnt, weiß sie, dass dieses Ereignis, obgleich nur Vorbote anderer, weit verhängnisvollerer Geschehnisse, sie für den Rest ihres Lebens prägen wird. Irgendwann, in einer anderen Zeit, erbricht sich ein junges Mädchen im Patio seines Elternhauses, den kleinen, zerfetzten Körper einer Taube vor seinen Füßen. Draußen der Lärm der Waffen, der Geruch von Blut.
La Soledad.
Doña Caterina sieht ihre Geister schwinden, langsam in der Nachmittagssonne verblassen. Unvermittelt kommt Ärger in ihr hoch: Warum jetzt? Warum ruhen die Toten nicht in ihren Gräbern? Tränen brennen in ihren Augenwinkeln. Sie empfindet Scham über den sauren schalen Nachgeschmack von Manzanilla in der Kehle. Ein kleines Mittagessen, ein Schluck aus dem Plastikbehälter, den die Stundenhilfe um die Ecke kauft, heiße, schlafträge Nachmittage. Aber wenigstens hat das die Träume vertrieben, schon seit Jahren, fast so erfolgreich, dass sie sie vergessen konnte.
Ein Geräusch erregt ihre Aufmerksamkeit. Bei aller Hinfälligkeit sind ihre Augen, ihre Ohren so scharf wie eh und je. Eine Bewegung in einer Ecke des Patios. Sie beobachtet, wie eine Gestalt hinter der purpurfarbenen Bougainvillea in Richtung Mauer verschwindet. Die Gestalt ist halb von den Bäumen verdeckt. Sie sieht nur Rot, überall Rot. Kein Gesicht, keine Identität.
Tiefes Rot, die Farbe von Taubenblut.
Sie spürt, wie ihre Verärgerung zunimmt, stützt sich auf die Armlehnen ihres Sessels und stemmt sich hoch. Ihre Glieder schmerzen. Sie greift nach dem alten Krückstock, ohne den sie inzwischen nicht mehr auskommt; und ihre Hilflosigkeit macht sie noch zorniger.
»Gesindel, Gesindel, Gesindel«, schreit sie durch die geöffnete Tür. Ihre Stimme hallt durch den Patio, klingt in ihren Ohren wie das Krächzen einer Krähe. Neue Tränen treten ihr in die Augen.
»Du diebischer Nichtsnutz! Spionierst einer alten Frau hinterher, anstatt dir dein Essen durch ehrliche Arbeit zu verdienen. Komm her. Du kriegst von mir, was du verdienst. Ich schiebe dir meinen Stock ins Hinterteil, du nichtsnutziger Lümmel!«
Blätterrascheln in der Ecke des Patios, ein Schnaufen. Die rote Gestalt klimmt an der Mauer empor und verschwindet.
Sie verspürt Erleichterung, dann Scham über ihr Leben: Sie erwacht, isst, schläft und zählt dann die Pesetas, um sich zu vergewissern, dass sie morgen das gleiche machen kann. Und jetzt muss sie junge Diebe anschreien, die sie berauben wollen.
Sie lehnt sich in ihrem Sessel zurück und sieht sich im Raum um. Die wertvollsten Möbel sind längst fort, im Auktionshaus an der Calle Mayor gelandet. Die Gemälde, das Porzellan, die chinesischen Teppiche. Das Gefüge ihrer Erinnerungen an die Kindheit hat sich aufgelöst, wurde verstreut. Vor ihrem inneren Auge, dem aktiven, vielgestaltigen Bereich ihrer Imagination, den sie neuerdings bevorzugt, kann sie die Wohnungen der nouveaux riches in den neuen Vierteln sehen, in denen sie in engen Schuhkartons leben, Schulter an Schulter wie die Armen, aber mit Fernsehgeräten und lauten Radios. Die Symbole ihres Lebens und ihrer Herkunft verleihen ihren oberflächlichen, schäbigen Existenzen zwischen den dünnen Gipswänden einen Hauch von Authentizität.
Aber es fehlt nichts. Dessen ist sie sich fast sofort gewiss. Alles, was noch da ist, stellt einen festen, greifbaren Eckpfeiler in ihrem Leben dar. Den Verlust einer Vase, einer Scherbe der Vergangenheit, hätte sie sofort bemerkt.
Blinzelnd macht sich Doña Caterina bewusst, dass ihr Denken für kurze Zeit ausgesetzt hatte. Keine Überlegung, nicht einmal das vertraute und willkommene Aufwallen von Ärger, dieses plötzliche, stechende Gefühl, das sie am Leben erhielt. Das Alter fing an, sie zu versteinern, langsam, von Tag zu Tag mehr. Dieser Prozess hatte bereits vor Jahrzehnten begonnen, mit dem sanften Herabstürzen einer kopflosen Taube. Doch dem unvermeidlichen Ende entgegen beschleunigt er sich jetzt. Es macht ihr nichts aus.
Sie schnuppert und weiß Bescheid. Es ist der Geruch, der alte Geruch.
Wieder quält sie sich aus dem Rohrsessel hoch. Sie trägt ein altes ausgeblichenes Kleid, das wie ein Sack an ihr herabhängt. Die aufgedruckten, einst azurblauen Rosen heben sich blass vom Untergrund schwärzlicher Blätter ab. Ihre Haare, grau mit wenigen hellbraunen Strähnen, sind zu einem strengen Knoten zusammengefasst. Ihre zerfurchten, walnussbraunen Züge wirken noch immer aristokratisch: ein Blick, der Unbedachte vernichten kann, eine Hakennase, mindestens seit der Reconquista ein Merkmal ihrer Familie, Wangenknochen, die fast spitz unter den Augen aufragen. Als sie sich an ihrem Stock zur Tür müht, sieht sie aus wie ein gebrechlicher alter Adler, der auf Beute aus ist.
Doña Caterina dreht am Türknauf und betritt die Halle. Sie ist groß und hoch, vornehmer als ihr Zimmer. Sonnenlicht strömt durch die staubtrüben Fensterscheiben über der messingbeschlagenen Flügeltür. Der Boden ist gefegt, die Fliesen glänzen, wie das nur hundertjährige Keramik kann. Eine Wand wird von einem riesigen Spiegel bedeckt, blind an den Stellen, wo die Quecksilberbeschichtung schadhaft geworden ist. Sie kann sich aus der Entfernung in ihm sehen: ein ätherisches, blasses Wesen, das mit dem Haus zu verschmelzen scheint.
So enden die großen Familien, denkt sie, im Verfall, in Schäbigkeit, im blassen Abglanz ihrer Vergangenheit. Das haben die Narren im Krieg nicht begriffen. Es gibt keinen entscheidenden Wendepunkt, keinen apokalyptischen Moment. Alles ... vergeht einfach, bis nichts bleibt als eine Auswahl zufälliger Eintagserscheinungen, ohne Bezug zueinander – es sei denn für eine Geschichte, die kein Lebender je ergründen kann.
Wieder schnuppert sie, und ein kalter Schauer läuft ihr über den Rücken. Sie beginnt zu ahnen, was sie geweckt hat. Der Dieb im Garten war es nicht.
Sie schlurft zu den anderen Räumen des Erdgeschosses. Sie sind unbewohnt, aber wer kann sich da heutzutage schon sicher sein? Je weiter sie sich von der Treppe entfernt, desto schwächer wird der Geruch. Dennoch zieht sie die Kette mit den Schlüsseln aus der Tasche, dreht sie rasselnd in den alten Schlössern und blickt hinein, schiebt das Unvermeidliche auf. Doch sie sieht nur mit Tüchern verhüllte Möbel, die wie missgestaltete Gespenster darauf warten, dass jemand sie zum Leben erweckt. Alle drei Räume bieten das gleiche Bild: leblos, verstaubt, leer.
Nachdem sie die Tür des letzten Zimmers wieder verschlossen hat, setzt sich Doña Caterina auf einen kleinen, hochlehnigen Stuhl neben dem Spiegel. Gegenüber, auf der anderen Seite des Raums, gibt es bequemere Sitzgelegenheiten, aber sie möchte ihr Spiegelbild nicht sehen. Sogar der Anblick ihres eigenen Gesichts könnte sie erschrecken.
»Die Angel-Brüder«, sagt sie vor sich hin und schüttelt den Kopf. Im letzten Jahr hatten sie gut gezahlt, sie in dieser Hinsicht nicht betrogen. Sie waren nur selten anwesend. Sie hätten einen guten Ruf, sagten sie. Das stimmte. Sie zeigten ihr die Zeitungsausschnitte über die Ausstellungen in London und New York, die Artikel in ausländischen Hochglanzmagazinen. Aber sie hatten auch einen anderen Ruf, was sehr schnell ersichtlich wurde. Das Knallen von Türen zu mitternächtlicher Stunde. Seltsame Besucher in absonderlicher Kleidung. Eine Andersartigkeit, die sie gelegentlich ängstigte, ihr eine Furcht einflößte, die sie nur zu gut kannte.
Eines Tages, in der Halle, sah sie sie gemeinsam die Treppe herunterkommen. Hand in Hand, kichernd wie Kinder und in exotische Lederanzüge gekleidet, die sie absolut schwachsinnig aussehen ließen. Sie war nicht dumm. Sie kannte sich mit derlei aus.
»Sie sind aus Barcelona«, sagte sie und sah ihnen mit diesem Adlerblick in die Augen, den niemand, nicht einmal die Brüder Angel mit ihren Adern voller Drogen ignorieren konnten.
Pedro, der ruhigere, der mit dem blonden Haar, bei dem sie sich immer fragte, ob es gefärbt war, nickte.
»Sind Sie Brüder? Richtige Brüder?«
»Si, Doña Caterina«, antwortete er (und sie erkannte, dass der andere aus irgendeinem Grund der Sprache nicht mächtig zu sein schien). »Mehr als das. Wir sind Zwillinge.«
Sie starrte die beiden an. Zwischen ihnen gab es absolut keine Ähnlichkeit. Sie konnte es nicht glauben.
Pedro wirkte gekränkt. »Es stimmt. Wir würden Sie doch nicht anlügen. Sehen Sie.«
Er schüttelte seinen Bruder, dessen dunkle Augen leer und unergründlich wirkten. »Wir werden es der guten Frau zeigen.«
Sie öffneten die Reißverschlüsse ihrer Lederjacken und zogen ihre weißen, gerüschten Baumwollhemden aus den Hosen. Doña Caterina roch den Duft, der von ihnen ausging: schwer, feminin.
»Sehen Sie her.«
Pedro deutete auf eine blasse Narbe an seiner Taille. Seine Finger waren mit Farbe verschmiert: rot, blau, gelb. Seine Nägel waren lang und schmutzig. Die Narbe war etwa zehn Zentimeter lang und fünf breit, mit kleinen Schwielen an den Rändern, wie die Risse einer selbstzugefügten Wunde. Sie befand sich an seiner linken Körperseite. Der andere Bruder hob sein Hemd und enthüllte eine blasse, schmale Taille. Auf der rechten Seite sah sie eine nahezu identische Narbe.
»Sehen Sie«, sagte Pedro, »ich bin der rechte Zwilling, Juan ist der linke. Bis zu unserem zweiten Lebensjahr waren wir miteinander verbunden. Wir sind nicht nur Brüder, wir sind Zwillinge. Wir sind nicht nur Zwillinge, wir sind himmlische Zwillinge.«
Er lachte wie berauscht, doch da war eine Energie in ihm, die nicht vom Alkohol kommen konnte.
»Das ist das Geheimnis, das Geheimnis unserer Kunst. In unseren ersten beiden Lebensjahren waren wir ein Wesen mit zwei Seelen. Jetzt sind wir zwei Wesen, zwei Seelen, und doch schaffen wir« – er sprach das Wort aus, als wäre es heilig – »wie ein Mensch. Zwei Seelen, ein Ziel.«
Sie sah ihn an. Ihre Abneigung stieß ihr sauer auf. »Verhalten Sie sich nachts bitte ruhiger«, sagte sie. »Und unterlassen Sie alles, was dieses Haus in einen schlechten Ruf bringen könnte. Nicht alles, was in Barcelona erlaubt sein mag, ist es auch hier. Jedenfalls nicht unter meinem Dach.«
»Wir werden Ihnen nur Ehre bereiten, Madame.« Das Französisch ging ihm glatt über die Lippen, nicht zum ersten Mal. »Eines Tages wird man eine Gedenktafel an Ihrer Tür anbringen.«
Bei diesen Worten waren sie aus dem Haus gestolpert. Aber der Lärm hatte nachgelassen. Im letzten Monat war kaum noch ein Laut von ihnen zu vernehmen gewesen. Und ihr Geld war willkommen. Nein, das Geld war lebensnotwendig.
Sie steht auf und macht sich bewusst, dass es das ist, was sie am meisten fürchtet. Sie ist zu alt, um neue Menschen unter ihrem Dach aufzunehmen. Deshalb hat sie sich nie bemüht, auch die anderen Zimmer zu vermieten. Die Aufgabe, neue »Gäste« zu finden, sie zu überprüfen, sie im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass sie rechtzeitig zahlten – das alles überstieg ihre Kräfte. Ganz gleich, was sich hinter ihren verschlossenen Türen abspielte: Die Brüder Angel zahlten regelmäßig und störten sie inzwischen nicht mehr. Sie waren ihre Rückversicherung, bis das Ende kam. Zu verkaufen hatte sie nichts mehr, nur noch das Haus selbst, aber wenn sie das tat, würde sie das ebenso umbringen wie eine Krankheit oder ein junger Tunichtgut von der Straße.
Doña Caterina seufzt und geht ohne einen Seitenblick an dem riesigen Spiegel vorbei auf die Treppe zu. Früher einmal ist sie das Geländer hinunter in die Arme ihres Vaters gerutscht. Früher einmal. Jetzt umfasst sie es mit einer faltigen, altersschwachen Hand, setzt einen Fuß auf eine Stufe, zieht den anderen nach. Siebenundzwanzig Stufen sind es – als Vierjährige hat sie sie gezählt –, und die Bewältigung jeder einzelnen kostet sie fast eine Minute. Als sie oben angekommen ist, sinkt sie auf den Boden. Tränen laufen ihr über die Wangen. Ihr Atem kommt in keuchenden Stößen. Die Tür zum Zimmer steht halb offen, der Gestank ist unerträglich: ein übler, miasmatischer Geruch, der sie bis ins Mark frösteln lässt.
La Soledad.
Das Telefon, ihr Telefon steht auf einem kleinen Tisch nur einen Schritt hinter der geöffneten Tür. Aber nichts in der Welt, nicht einmal der Herrgott persönlich, könnte Doña Caterina dazu bewegen, die Schwelle zu überqueren. Sie weiß nicht, wie lange sie dort auf dem Boden sitzt, und die Erinnerungen, die Schrecken zucken mit einer Deutlichkeit durch ihren Kopf, die ihr die Galle die Kehle herauftreibt.
Als die Welt aufhört, sich um sie zu drehen, wischt sie sich mit dem Ärmel über das Gesicht, steht auf, greift nach dem Geländer und müht sich, Stufe um Stufe, weiter hinauf. Das durch das Fenster über der Tür dringende Sonnenlicht wird blasser. Draußen stimmen die Vögel ihr Abendlied an. Sie braucht weitere zwanzig Minuten, um an das Telefon in ihrem Zimmer zu gelangen.
In der Notrufzentrale des großen Polizeipräsidiums hinter der Plaza de la Paz blinkt ein rotes Signal auf. Miguel Domingo, ein übergewichtiger Zivilist, der überzeugt ist, mit seiner Zeit etwas Besseres anfangen zu können, als wirre Anrufe entgegenzunehmen, sieht es vor sich blinken. Er trinkt eine San-Miguel-Dose leer, beißt von seinem fetten Schinkenbrot ab, kaut, schluckt, rülpst und streckt die Hand aus. Mit einem Höchstmaß an gelangweilter Aggressivität legt er den Schalter um und knurrt: »Digame.«
Aber es dauert eine Minute, bis Doña Caterina mit dem Schluchzen aufhören und zu sprechen beginnen kann.
Kapitel 2
Um sechs Uhr morgens ist die mehrspurige Fernstraße nahezu leer. In einer Stunde werden die schweren Laster aus Cádiz, Sevilla und Córdoba die neue Autobahn verstopfen, die am Rand stehenden Palmen in Wolken schwarzen Dieselrauchs hüllen und Auseinandersetzungen mit den Einheimischen anzetteln, die aus den Vororten zu ihren Arbeitsstätten wollen. Doch noch ist alles paradiesisch friedlich.
Maria Gutierrez hält ein gleichmäßiges Tempo von fünfzig mit ihrem gemieteten Seat Ibiza, ihre müden, schmerzenden Augen sind auf die Fahrbahn gerichtet. Der kleine rote Wagen bleibt so lange wie möglich auf der inneren Fahrspur. Sie hat keine Eile, lässt sich vom Verkehr treiben und versucht nicht daran zu denken, wohin er sie bringt. Seit zehn Jahren, seit einer Dekade, ist sie nicht mehr in der Stadt gewesen. Und die Rückkehr kommt ihr vor wie ein unerwünschtes Eindringen in ihre eigene Vergangenheit. Die Haare fliegen ihr um den Kopf, zerzaust vom Fahrtwind, der durchs halbgeöffnete Fenster hereinweht. Sie sind hellbraun, mit blonden Strähnen, zu jung, zu ungebärdig für sie, ein Relikt von gestern. Ihre klaren blauen Augen, sehr intensiv, fast bohrend, verlassen die Fahrbahn, blicken auf Abfahrten und wieder zurück, halten nach Richtungen Ausschau, registrieren Anblicke, die alte Erinnerungen wachrufen, die Vergangenheit aufstören, die irgendwo in ihrem Kopf begraben ist. Es sind kluge, abgeklärte Augen in einem blassen, wachen Gesicht, das eher faszinierend ist als schön. Maria Gutierrez ist dreiunddreißig: Sie hat die Augen einer zehn Jahre älteren Frau und die Frisur einer Zwanzigjährigen.
Vor sieben Stunden, mitten in der Nacht, hat sie ihre Wohnung in einem Apartment-Hochhaus in der Neustadt von Salamanca verlassen. Eine helle, saubere, aseptische Umgebung. Der Abstand der Hochhausblöcke ist von den Behörden auf den Zentimeter genau genormt. Die grauen Steinbauten strahlen Exaktheit aus, Korrektheit und eine Art kalte, komfortable Teilnahmslosigkeit. Niemand stellt um drei Uhr morgens seinen Müll vor die Tür. Lautes Singen, nächtliche Parties und lärmende Familienauseinandersetzungen sind nicht gern gesehen. Keiner kennt den anderen: Man steht morgens auf, geht zur Arbeit, kommt heim, legt sich ins Bett. Man ist im Norden, und das ist die »neue Stadt«: distanziert, abweisend und doch von dem unausgesprochenen Gefühl beherrscht, etwas verloren zu haben. Aber auch sicherer. Im Norden kennen Emotionen ihren Platz. Unter der Oberfläche, wohlverwahrt.
Im Süden ist es anders.
Sechs Stunden lang fuhr Maria Gutierrez über unbekannte Autobahnen. Ihr gefiel die Dunkelheit, die Anonymität, die Sicherheit, die sie verhieß. Dann, als die Sonne strahlend über der Bergkette im Osten aufging, erreichte sie die Stadt.
Die Schnellstraße umfährt die Altstadt entlang der äußeren Stadtmauer, die im neunten Jahrhundert von den Arabern errichtet wurde. Dreihundert Jahre später kehrten die Christen im Triumph zurück. Hinter diesen Mauern planten sie den Feldzug, der zwei Jahrhunderte später die christliche Wiedereroberung Spaniens vollendete. Fünfhundert Jahre später zerstörte ein anderer Bürgerkrieg die Hälfte des honigfarbenen Mauerwerks. Den Rest besorgten dann die Städteplaner der sechziger Jahre. Sie rissen sie ab, um Platz für eine Verkehrsader aus Asphalt zu schaffen.
Aber Reste der alten Umfriedung sind geblieben: hier ein überwölbtes Tor, dort ein Mauerfragment. Ein junger Mann, jemand, der von ihren Haaren, ihren Augen fasziniert gewesen war, hatte sie ihr einmal gezeigt, als sie die Universität besuchte. Damals, als ihre Gefühle sie verunsicherten, sie noch nicht gelernt hatte, sie zu beherrschen und fest in sich zu verschließen. Jetzt kommt sie an den Mauerresten vorbei, und in dem kleinen inneren Spiegel, der unerwünscht aus dem Nichts auftaucht, sieht sie sein Gesicht. Sie fragt sich, wo er jetzt ist – falls er noch lebt. Irgendwo in ihrem Kopf regt sich eine Erinnerung an ihren letzten Streit, an den Augenblick, als ihr seine Intensität, seine Nähe zu viel wurde. Als sie sich für die Sicherheit des Alleinseins und gegen das Risiko des Zusammenseins entschied. Die Erinnerung rührt sich, dreht sich im Schlaf, und nur für den Fall, dass sie erwacht, hält sie den Atem an, bis alles in ihr wieder ruhig ist.
Das Auto fährt an der alten Abzweigung nach Cádiz vorbei, passiert die innere Stadtmauer, biegt rechts ab und hält auf den Fluss zu, eine träge braune Wassermasse von rund zweihundert Meter Breite. Auf seinem Weg aus den Bergen in Cazorla zum Atlantik teilt sich der Guadalquivir vor dem niedrigen Felsplateau, auf dem die Stadt ursprünglich erbaut wurde. Er umfließt es, bildet eine kleine natürliche Insel: leicht zu verteidigen, aber zu klein, um all die Menschen aufzunehmen, die die Stadt bald anziehen sollte. Vorbei an den mittelalterlichen Kaianlagen – Columbus ist hier einst gelandet –, vorbei an den Ausflugsbooten, die auf Passagiere warten. Hinter der blankpolierten Messingreling eines kleinen Dampfers schrubbt jemand das Deck, von einer Zigarette fällt Asche auf schimmernde Holzplanken.
Sie fährt jetzt direkt am Ufer entlang. Nur ein schmaler, tiefer gelegter Fußweg trennt sie vom Fluss. Auf ihm üben ein paar Jugendliche für die Fiesta: Horn, Trompete und Trommeln quälen sich durch eine der alten Melodien. Sie dringt einen Moment lang durch das halbgeöffnete Fenster und verklingt dann über dem Wasser, treibt auf den Alfabia-Park auf dem gegenüberliegenden Ufer zu. Tauben stieben auf, wie hochgescheucht von den Missklängen.
Vier Brücken führen in die Altstadt. Jede trägt den Namen des Stadtviertels, in das sie führt: Carmona, Veracruz, Santana. Und El Viejo. Der Alte. Der barrio. Sie erinnert sich an den Namen – der Spiegel ist wieder da und diesmal nicht zu verdrängen –, denkt an kleine Räume in kleinen Wohnungen, schmale Betten, das Knacken von Eisengestellen unter dem Gewicht von zwei Körpern. Sie braucht nur an zwei der Brücken vorbei, um dann nach El Viejo einzubiegen, doch stattdessen umkreist sie die ganze Altstadt, lässt sich Zeit, weitere zwanzig Minuten, sucht nach Ausreden und denkt an den vor ihr liegenden Tag. Es gibt keine Entschuldigung. Heute wird es ruhig bleiben. Die großen Feiern, die Höhepunkte finden erst am Wochenende statt. Die Semana Santa hat gerade erst begonnen. Die Absperrungsgitter scheinen noch sauber gestapelt zu sein. Sie wurden noch nicht von nächtlichen Zechern in den Fluss geworfen. Niemand hat die Holztribünen für die Paraden in Brand gesetzt. Niemand schläft seinen Rausch aus auf einer Bank am Fluss.
Golden und alt, mit drei eleganten Bögen, taucht die Brücke nach El Viejo rechts vor ihr auf. Sie gibt Zeichen, sieht in den Rückspiegel und biegt auf die einspurige Straße ein. Die Ampel zeigt Grün, und der Wagen rauscht durch, der Fahrtwind hallt an den alten Hauswänden wider. Sie fährt unter dem Almohadentor hindurch, einem machtvollen, von Alter und Luftverschmutzung verwitterten Triumphbogen, und erreicht die Plaza de la Paz, biegt nach links, in den barrio. Sie erinnert sich an die Straße, findet die kleine unterirdische Parkgarage, stellt das Auto ab und läuft zum Apartment hinauf. Sie öffnet die Tür, wirft ihre Tasche auf den Boden, reißt die Fenster auf, wirft sich auf das Bett und starrt zur Decke.
Die Geräusche und Gerüche der Stadt treiben von draußen herein. Ein Jahrzehnt ist vergangen, aber sie sind die gleichen.
Kapitel 3
»Vielleicht ist sie eine Lesbe. Das muss es sein. Das ist es. Eine Lesbe. Höchstwahrscheinlich, eindeutig.«
Sergeant Felipe Torrillo, »der Bär«, hörte intensiv zu, mit hochrotem Gesicht. Das war ungewöhnlich für die Tageszeit. Torrillo, eins achtzig groß, zweieinhalb Zentner schwer und mit dem Gesicht eines übergewichtigen Cherub, platzte fast vor unterdrücktem Ärger. Er hörte Quemada zu, dem Schandmaul des Reviers, und wünschte sich meilenweit weg.
»Weißt du, Torrillo, du bist nicht firm in diesen Dingen. Tief im Innern haben alle Lesben Schuldgefühle. Sie zerreißen sich zwar pausenlos über uns das Maul, aber in Wirklichkeit brennen sie nur darauf, einen richtigen Schwanz zu spüren. Darauf gebe ich dir mein Wort. Und die da drüben« – Quemada zeigte so auffällig auf die zierliche Gestalt im Warteraum gegenüber dem Dienstzimmer, dass ihr das nicht entgehen konnte – »ist eine waschechte Lesbe. Ich fress einen Besen, wenn ich mich irre. Sie fühlen sich von Bullen angezogen, weil sie wissen, dass wir ganze Kerle sind, anders als die kleinen Tunten, mit denen sie sich sonst umgeben. Und weißt du, warum? Weil sie hoffen, dass wir sie eines Tages kurieren.«
Das elektrische Licht beschien die Halbglatze des älteren Mannes, spiegelte sich in seinem dünnen Lächeln wider, dem dünnen Stoff seines Anzugs. Ein Jahr trennte die beiden, aber es wirkte wie ein Jahrzehnt. Torrillo stand auf. Sein Leinenanzug zeigte Knitterfalten, seine langen braunen Haare waren hinten zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammengefasst – ein Relikt seiner längst vergangenen Dienstzeit im Drogendezernat. Quemada sah aus wie ein unterbezahlter Bankdirektor, er war fast dreißig Zentimeter kleiner, eindeutig zu dick und hatte sich die verbliebenen Haarsträhnen wie Sardellen um seine Glatze gelegt. Er keuchte beim Sprechen, Schweißperlen bedeckten seine Stirn. Quemada verschob einen Stapel Unterlagen auf dem Schreibtisch, der aussah, als hätte jemand einen Papierkorb darauf ausgeleert.
»Sag deiner kleinen Lesbe, wenn sie geheilt werden will, könnte ich mich unter Umständen bereitfinden, den Arzt zu spielen.«
Drei der anderen Polizisten hinter ihm lachten dreckig auf, sahen Torrillos Miene und verstummten.
»Du bist ein Blödmann, Quemada«, sagte der größere Mann mit steinernem Gesicht. »Ein Blödmann.«
Torrillo suchte nach weiteren Worten, fand keine und wiederholte sich noch einmal. Die Tür ging auf, und Rodríguez trat ein. Der Capitán schnupperte: Zigaretten, Schweiß, billige chorizo und abgestandene Fürze. Er warf einen Blick in den Warteraum, sah Torrillo an, dessen Gesicht inzwischen purpurrot war, und deutete in die Richtung seines Büros. Die beiden Männer gingen über den Flur, und Torrillo öffnete die Glastür. Sie traten ein und setzten sich.
Aus seinem Ledersessel sah Rodríguez aus dem Fenster über den Platz zur Kathedrale hinüber, einer kuriosen Mischung aus christlicher Gotik und muslimischer Moschee, durch die sich die Touristen tagtäglich in langen Schlangen hindurchwanden. Das war der Ausblick, sein Ausblick. Er genoss ihn seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Art, wie er nachdenklich zur Kathedrale hinüberblickte, wenn die Fälle knifflig wurden, und dort Erkenntnisse zu gewinnen schien, die dem Rest von ihnen verschlossen blieben, war in Polizeikreisen zur Legende geworden. Sie nannten ihn schon den »Alten«, lange bevor er das seinen Jahren nach verdient hätte. Aus dem Chaos und der Korruption, für die die Polizei unter Franco stand, hatte er etwas geschaffen, was funktionierte, Erfolge vorzuweisen hatte. Und wenn sie nicht immer verstanden, wie er das machte, trug das nur weiter zum Mythos bei, zur Magie. Manchmal brauchte man eben nicht alles zu verstehen.
Der Torre del Oro, der dreihundert Jahre alte Glockenturm, der einmal als Minarett gedient hatte, warf einen langen, schmalen Schatten über den Platz. Es war halb neun Uhr morgens, und Rodríguez konnte sehen, dass im Alarcon, der kleinen Bar, die die Polizisten frequentierten, ein großer Teil der Morgenschicht Berge von churros verputzte, Unmengen Kaffee und Schokolade in sich hineinschüttete, Gläser mit coñac leerte. Torrillo ließ dem Capitán Zeit, sich mit dem Tag anzufreunden, und empfand erneut die unbehagliche Besorgnis, die ihn seit kurzem immer wieder überfiel. Der Alte, der Capitán, zu dem sie seit undenklichen Zeiten aufgeblickt hatten, sah alt aus. Es hatte eine Zeit gegeben, in der sich jeder auf ihn verlassen hatte. In der man sicher sein konnte, dass Rodríguez schon regeln würde, was bei ihnen auch immer schieflief, und das auf eine Weise, die ihnen unerfindlich blieb. Aber das war jetzt schon lange her. Nun wirkte er alt, bequem und zufrieden. Er musste knapp sechzig sein, am Horizont winkte der Ruhestand, und er fing an zurückzuwinken: eine kleine casita an der Küste. Endlich mehr Zeit für die Familie, von der er so oft sprach. Torrillo sah ihn schon als Ruheständler vor sich, wie sich das lebhafte Gesicht unter der Sonne langsam mahagonibraun verfärbte, die lebendigen dunklen Augen ihren Glanz verloren. Das geschah bereits. Sie wussten es alle. Wenn die Dinge heikel wurden, wenn sie mit einem Fall nicht weiterkamen und im Alarcon missmutig in ihre Gläser starrten, sagte garantiert jemand: »Der Alte wird’s schon richten.« Diese Zeit verging. Die Generationen wechselten, und mit ihnen veränderte sich die Welt.
Torrillo dachte darüber nach, wie der Alte abbaute, und fragte sich, warum ihm jemand das übelnehmen sollte. Dann sagte er: »Großer Gott, warum ausgerechnet zu uns?«
Rodríguez sah seinen Sergeant lächelnd an. »Warum nicht zu uns? Sie will etwas lernen. Und wo könnte sie das besser als bei uns? Es ist eine Anerkennung.«
»Sie scheinen das nicht so zu sehen.« Torrillo reckte den Daumen über die Schulter Richtung Dienstzimmer.
»Sie sind eben – wie war doch gleich das Wort, das ich durch die Tür hörte? Blödmänner.«
Torrillo lachte. »Das bin ich auch. Manchmal.«
»Manchmal.«
Rodríguez’ Augen funkelten humorvoll und – auch wenn das vielleicht nicht anhielt – hellwach. Torrillo rief sich ins Gedächtnis, dass keiner – kein einziger – im ganzen Gebäude so agil wirkte, besonders nicht zu dieser Morgenstunde während der Semana Santa.
»Holen Sie sie herein. Und besorgen Sie uns dann Kaffee. Wir werden das ganz sachlich über die Bühne bringen und uns dann um unsere Arbeit kümmern.«
Torrillo sprang auf die Beine. »Selbstverständlich. Es gibt da etwas Neues. Aber genaues weiß ich noch nicht. Kam erst kurz vor Ihrer Ankunft rein. Der Bericht liegt auf Ihrem Tisch.«
Rodríguez nickte und vertiefte sich in die Unterlagen. Er las noch immer, als sich die Tür wieder öffnete und Maria Gutierrez eintrat.
Torrillo folgte ihr, schloss die Tür und hüstelte. »Ich werde Kaffee besorgen.«
»Und ein Glas Wasser für mich, bitte«, sagte sie ruhig. Der Akzent war leicht, aber unüberhörbar: nördlich, Mittelklasse, selbstsicher.
Rodríguez sah sie an. Das Memo über den Neuzugang – von ihm kaum gelesen – hatte ihn auf eine andere Frau vorbereitet. Maria Gutierrez war klein und zierlich, kaum größer als ein Meter fünfundfünfzig. Sie trug ein blassblaues Batisthemd und ausgeblichene Beuteljeans, die so aussahen, als hätte sie sie bei einem Straßenhändler gekauft. Ihre Haare schienen vom Kopf in alle Richtungen emporzustreben, um an irgendeinem Punkt wieder von der Gravität herabgezogen zu werden. Rodríguez konnte nicht entscheiden, ob das eine beabsichtigte Frisur oder mangelnde Sorgfalt war. Zusammen mit ihrem feingeschnittenen, faszinierenden Gesicht machte das Ganze den Eindruck nachlässiger Eleganz, aber dies war keine Frau, die Wert auf Äußerlichkeiten legte. Sie trug kein Make-up auf ihrer hellen Haut, die eher nordeuropäisch als spanisch wirkte. Wache, intelligente Augen sahen ihn an, schätzten auch ihn ab. Rodríguez wünschte sich, das Memo sorgfältiger gelesen zu haben. Er kam nicht auf ihr Alter. Sie konnte nahezu alles zwischen zwanzig und dreißig sein. Alterseinschätzungen waren noch nie seine Stärke gewesen.
Torrillo kehrte zurück, stellte drei Kaffeegläser auf den Schreibtisch und reichte ihr einen Plastikbecher mit Wasser.
»Danke«, sagte sie. »Und vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir Einblick in Ihre Arbeit zu geben.«
Torrillo lächelte errötend.
»Señora Gutierrez«, fragte Rodríguez, »studieren Sie in Salamanca?«
»Nein, Capitán. Ich bin Professorin.«
»Ah.«
»Professorin der Geisteswissenschaften. Ich nahm an, das wäre Ihnen mitgeteilt worden.«
»Geisteswissenschaften?« wiederholte Torrillo verblüfft. »Wir sind hier bei der Polizei. Was hat die mit Geisteswissenschaften zu tun?«
»Ich bin von der Qualifikation her Professorin für Geisteswissenschaften. Im Moment bin ich für das Innenministerium tätig«, erläuterte sie freundlich und geduldig. »Wir befassen uns mit einer Reihe von Projekten, die die Effektivität der Polizei untersuchen sollen. Unter Umständen versetzen unsere Arbeitsergebnisse die Regierung in die Lage, Veränderungen in der Ausbildung und in der Ermittlungspraxis zu empfehlen. Auch in den Universitäten sind neue Zeiten angebrochen, Capitán. Wir müssen uns bezahlt machen, daher übernehmen wir diese Aufträge. Meine Entscheidung war das nicht. Wir haben unsere Untersuchungen in Madrid, Barcelona und Málaga durchgeführt, wir arbeiten an weiteren, hier ebenso wie in Burgos und Santander. Schließlich wird ein Bericht verfasst ... Es gibt eine Methodik für das Projekt, die ich Ihnen zur Verfügung stellen kann, wenn Sie das wünschen. Im Grunde geht es darum, Ihre Arbeit an einem Fall zu verfolgen und später darüber zu berichten.«
»Eine Methowas?« Torrillo hob verdutzt die Brauen.
»Eine Methodik. Die Vorgehensweise, wenn Ihnen das lieber ist.«
»Es ist mir lieber, erinnert mehr an Polizeiarbeit.«
»Capitán?«
Rodríguez hatte sich wieder seinen Unterlagen zugewandt. Er ließ nur zögernd davon ab.
»Möchten Sie, dass ich Ihnen erkläre, wie ich gern vorgehen würde, Capitán?«
»Nur kurz, bitte. Ich wurde brieflich aus Madrid angewiesen, Sie hier bei uns aufzunehmen und Ihnen soweit wie möglich freie Hand zu lassen. Also heißen wir Sie willkommen, aber Sie werden sicher verstehen, dass wir zunächst einmal die Arbeit erledigen müssen, für die wir bezahlt werden. Ich werde Sie nach Kräften unterstützen, vorausgesetzt – und das sollte ganz klar sein –, vorausgesetzt, dass es unsere Arbeit in keiner Weise beeinträchtigt.«
Die blauen Augen blitzten, und Rodríguez entging die kühle Entschlossenheit keineswegs.
»Selbstverständlich. Ich habe nicht vor, Sie zu behindern. Ich möchte lediglich Arbeitsvorgänge beobachten und Notizen machen. Und danach Ihnen und Ihrem Sergeant ein paar Fragen stellen. In einer Abschlussbesprechung, wenn Sie so wollen. Und ich werde Ihnen eine Kopie des fertigen Berichts zuschicken.«
Rodríguez wedelte mit der Hand über den Schreibtisch, zeigte zu den gefüllten Regalen hinüber. »Berichte, Berichte, Berichte. Das Leben eines Polizisten besteht aus Papier.«
Ausdruckslos sah sie ihn an.
»Nein. Verzeihen Sie. Selbstverständlich erhalte ich sehr gern Ihren Bericht. Aber im Moment muss ich mich mit einem anderen befassen.«
Er hob ein Schriftstück hoch. »Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es Ihnen darum, einen Fall vom Anfang bis zum Ende zu verfolgen. Einen ganz x-beliebigen Fall.«
Sie nickte.
»Vielleicht gibt es kein befriedigendes Ende. Wir haben hier eine recht gute Aufklärungsrate, aber niemand ist vollkommen.«
»Das ist mir klar. Am einfachsten wird es sein, wenn Sie mich einem verhältnismäßig personalintensiven Fall zuteilen, an dem ich dranbleibe, bis die Ermittlungen erfolgreich abgeschlossen sind oder Sie sie einstellen.«
»Verstehe.« Rodríguez blickte wieder die Unterlagen auf seinem Schreibtisch an. »Sind Sie empfindlich, Frau Professor?«
Die blauen Augen zuckten mit keiner Wimper.
»Nun, das wird sich zeigen. Haben Sie schon einmal von den Angel-Brüdern gehört?«
»Den Künstlern? Ja, selbstverständlich. Wer hätte das nicht?«
Torrillo schüttelte den Kopf. »Ich.«
»Sie werden Sie kennenlernen. Sie wurden gestern Abend tot aufgefunden. Wahrscheinlich ermordet. Ausgerechnet am Beginn der Semana Santa, muss ich schon sagen. Ich hatte gehofft, Ihre Aufmerksamkeit auf unser hervorragendes System zur Bewältigung von Verkehrsströmen und Menschenansammlungen zu lenken, Frau Professor, doch offenbar ist mir das nicht vergönnt. Das Haus liegt in Carmona. Ich habe Hauptkommissar Menéndez auf den Fall angesetzt. Sie treffen ihn auf dem Parkplatz.«
Sie rührte sich nicht. »Gestern Abend, Capitán?«
»Wie ich schon sagte.«
»Und jetzt ist es fast neun Uhr vormittags? Braucht ein höherer Polizeiangehöriger so lange, um am Tatort zu erscheinen?«
»Sie wurden gestern Abend von einer sehr alten Dame entdeckt. Sie ist sehr hinfällig und war von daher begreiflicherweise ein bisschen verwirrt. Als sie in unserer Zentrale anrief, beschwerte sie sich lediglich über einen äußerst unangenehmen Geruch. Mehr nicht.«
»Und?«
»Der aufnehmende Beamte vermittelte ihr einen Installateur, der um diese Tageszeit gar nicht leicht zu bekommen ist. Nach seiner Ankunft im Haus rief uns der Installateur an und erläuterte die wahre Sachlage. Ich glaube, man könnte mit einigem Recht sagen, dass es hier ein kleines Problem mit unserer ... Methodik gab. Bitte. Hauptkommissar Menéndez wartet.«
Torrillo stand auf, ging zum Garderobenhalter und zog seinen Sakko an. Sie folgte ihm zur Tür hinaus und kritzelte beim Laufen fieberhaft etwas in ein kleines Notizbuch.
Vor dem Tisch mit dem Dienstbuch blieb Torrillo stehen und trug sich aus. Quemada saß am Nebentisch und grinste breit. Er musterte sie von Kopf bis Fuß, schnalzte mit der Zunge und hob die Schultern, als wollte er sagen: Vielleicht irgendwann, wenn ich nichts Besseres zu tun habe.
Maria Gutierrez hörte auf zu kritzeln, beugte sich vor und sah Quemada direkt in die Augen. Sie war so nahe, dass sie seinen Tabakatem riechen konnte. Torrillo spürte die veränderte Atmosphäre und drehte sich neugierig um.
Quemada spannte den Arm an. Ein wabbliges Polster bildete sich zwischen Ellbogen und Schulter.
»Gefallen Ihnen Muskeln, Señora?« grinste Quemada.
»Nicht, wenn sie zwischen den Ohren liegen.«
Torrillo lachte laut auf, ein tiefes, sonores Röhren, das durch den ganzen Raum hallte. Stumm und mit hochrotem Gesicht saß Quemada da. Maria Gutierrez straffte die Schultern, steckte ihr Notizbuch in einen kleinen grauen Lederaktenkoffer und verließ unter schüchternem Applaus den Raum.
Torrillo sah Quemada an, dessen Kinn sich auf Schreibtischhöhe befand, und empfand fast so etwas wie Mitleid.
»Sie mag vielleicht eine Lesbierin sein, mein Freund«, sagte er. »Aber wenn, dann ist sie unsere Lesbierin.«
Dann folgte er ihr die zwei Treppen hinunter. Auf dem Parkplatz ging Torrillo auf einen Ford zu und öffnete ihr die Tür. Der Mann auf dem Beifahrersitz drehte sich nicht einmal um.
»Das ist Hauptkommissar Menéndez«, knurrte Torrillo, leicht verlegen.
»Guten Morgen, Herr Kommissar«, sagte sie zu dem dunkelgekleideten Rücken vor ihr. Sie erhielt keine Antwort.
Zwei Minuten später fuhren sie schnell und schweigend auf die Straße hinaus. In diesem Jahr war die Hitze früh gekommen, schwer und feucht hing sie in der Luft.
Auf dem Platz begannen Arbeiter damit, die Tribünen an der Prozessionsstrecke für den folgenden Sonntag zu errichten. Sie erkletterten die riesigen Metallgerüste und hingen an ihnen wie Insekten, die die Knochen eines längst toten Tiers inspizieren.
Am Torre del Oro fuhr Torrillo auf die rechte Spur und wartete auf Grün, um auf die Campillos einzubiegen und am riesigen Rund der Stierkampfarena vorbeizufahren, die sanftgolden in der Morgensonne schimmerte.
»Semana Santa. Eine Schande.«
Er wollte gerade durch das halbgeöffnete Fenster spucken, als er sich an die Beifahrerin im Fond erinnerte.
Menéndez blickte auf die Straßen hinaus, drehte sich dann aber um und sah sie an. Ein langes, kaltes Gesicht, nicht älter als dreißig, mit einem schmalen schwarzen Schnurrbart. Der Hauptkommissar trug einen adretten dunkelblauen Anzug über einem makellos weißen Hemd und weinroter Seidenkrawatte. Er sah aus wie ein Börsenmakler.
»Auf Traditionen gibt man nicht allzu viel in Polizeikreisen, Frau Professor«, sagte er mit ausdrucksloser Stimme. »Wir neigen dazu, in den Tag hineinzuleben.«
»Traditionen«, knurrte Torrillo verächtlich zum offenen Fenster hinaus. »Heilige Woche, dass ich nicht lache! Wissen Sie, wie das abläuft? Die ersten drei Tage der Woche liegen sie auf den Knien und die nächsten vier auf dem Rücken. Sie besaufen sich oder b..., Sie verstehen schon, was ich meine. Zur Karwoche kommen an die hunderttausend Besucher in die Stadt, und sie benehmen sich genauso. Drei Tage in Sack und Asche« – Seine Stimme ging in ein Falsett über, er ließ kurz das Steuer los und rang die Hände – »›Bitte, Herr Jesus, vergib uns unsere Schuld, wir haben im letzten Jahr schwer gesündigt.‹ Und dann nichts wie ab in den Park, zur feria, die ganze Nacht in den casitas. Da können Sie zusehen, wie der Gratis-Fino ihnen alle Hemmungen wegschwemmt. Während der Semana Santa regelt man als Polizist entweder den Verkehr, schleppt Betrunkene ab oder bekommt Ärger mit Leuten, die sich nicht entscheiden können, ob sie nun saufen oder vögeln wollen. Entschuldigen Sie, Señora, aber das schreiben Sie sich doch hoffentlich nicht auf, oder?«
Torrillo blickte in den Rückspiegel und sah sie lächeln.
»Gut. Wäre mir auch nicht recht. Könnte bei den Leuten, die unsere Löhne zahlen, zu Missverständnissen führen.«
Das Auto bog um die Ecke in eine kleine Straße, vorbei an weißgetünchten Hauswänden, an Passanten, die über handtuchschmale Bürgersteige stolperten. Dann verbreiterte sich die Straße. Die Häuser waren hier größer, halbgeöffnete Holztore gewährten Einblicke in schattige Innenhöfe, in denen rote Pelargonien und purpurfarbene Jacarandablüten leuchteten.
»Das ist Carmona. Sehen Sie die Kirche? Die wohltätigste Jungfrau der Stadt, sagt man. Da, wo ich herkomme, gibt es überhaupt keine Jungfrauen. In Carmona sollen sie noch ein paar haben. Und auf keinen Fall bringen wir hier schmutzige Wörter über die Lippen«, sagte Torrillo. »Wenn wir es tun, brechen die Leute auf der Straße tot zusammen. Sie sind so empfindsam.«
Torrillo beobachtete, wie eine Pferdekutsche mit einer Ladung Betrunkener gemächlich in eine Seitenstraße einbog. Er zeigte auf ein großes altes, quadratisches Gebäude. Davor parkten ein weißer Citroën-Krankenwagen und zwei Polizeikombis. Torrillo passierte Eisentore, von denen die Farbe abblätterte, und parkte auf einer Kiesauffahrt unter dem Mimosenbaum. Wie ein Taxifahrer stieg er aus, rannte hinten um den Wagen herum und riss die Fondtür auf.
»Sie können mich Bär nennen, wenn Sie wollen. Das macht jeder, nur der Hauptkommissar nicht.«
Maria Gutierrez schwang ihre Beine vom Rücksitz und stieg aus. Ihr Kopf befand sich irgendwo in Torrillos Brusthöhe.
»Bär?«
»Ich denke, es ist liebevoll gemeint. Meistens jedenfalls.«
Als sie sich dem Haus zuwandten, unterhielt sich Menéndez bereits intensiv mit einem Polizisten. Sein Gesicht hinter der dunklen Sonnenbrille war ausdruckslos.
Kapitel 4
»Ich glaube, der Capitán hat Sie das schon gefragt, Frau Professor, aber ich möchte mich noch einmal vergewissern. Sind Sie empfindlich?«
Die Halle erinnerte sie an Buñuel-Filme der siebziger Jahre: verblichene Größe, Staub, ein Gefühl von Verfall. Menéndez’ Miene zeigte eine Spur von Ungeduld.
»Ich folge Ihnen. Notfalls kann ich immer noch umkehren.«
»In Ordnung.«
Sie gingen die Treppe hinauf, vorbei an Männern in weißen Overalls, die das Geländer mit Pinseln einpuderten und Kreise um kaum erkennbare Fingerabdrücke zogen. Je näher sie dem Treppenabsatz kamen, desto widerlicher wurde der Geruch. Sie holte ein Taschentuch hervor, besprengte es mit Eau de Cologne und drückte es sich kurz an die Nase. Es half ein bisschen.
Wortlos betraten Menéndez und Torrillo das Zimmer. Sie folgte ihnen auf den Fersen.
Die Tür führte in einen riesigen, sonnendurchfluteten Raum. In der Mitte sah sie etwas Dunkles, Undefinierbares, umgeben von Vertretern der Gerichtsmedizin. Über dem Ganzen surrte ein Fliegenschwarm. Von Zeit zu Zeit versuchte eine weiße Hand ihn zu verscheuchen. Vergeblich. Irgendein innerer Instinkt riet ihr, keinen Blick auf die Mitte zu werfen, noch nicht.
Sie sah daran vorbei und betrachtete das, was für die ermittelnden Beamten nicht von Interesse zu sein schien: den irdischen Besitz der verstorbenen Brüder Angel. Ein Marmorkamin beherrschte die linke Wand des Raums, über ihm hing ein großer, vergoldeter Spiegel. Auf dem Kaminsims stand eine fast meterhohe Uhr aus Goldbronze. Die Zeiger standen auf zwölf. An der gegenüberliegenden Wand ein Sammelsurium moderner Kunst: ein Wandgemälde, das sie vage Gilbert und George zuordnete, ein Seidenparavent von Warhol sowie einige Werke, die vermutlich von den Brüdern selbst stammten. Nahe der Tür eine Pinnwand mit Zeitungsausschnitten und Fotos: Ein Bild aus einem englischen Magazin zeigte die Brüder auf einer Party in London, die Rezension einer Ausstellung in New York, ein paar Amateuraufnahmen der Brüder mit Angehörigen der internationalen Glitzerwelt.
Zwischen ihr und dem Fenster ein Durcheinander von Möbeln. Konnte das ihr Geschmack gewesen sein? Wohl kaum. Die Möbel waren zur Seite geräumt worden, um mitten im Zimmer Platz zu schaffen. Unter anderen Voraussetzungen hätte sie über die Ungereimtheit der Stilarten lachen können. Vier Esstische sahen nach englischem Chippendale aus. Der fünfte Tisch war jedoch die Darstellung einer halbnackten Frau auf allen vieren, die die Plexiglas-Tischplatte auf dem Rücken balancierte. Sie trug kniehohe Lederstiefel, ihre Vulva war grotesk vergrößert, und ihre Brüste hingen bis fast auf den Boden. Ihre Augen waren geschlossen, die Lippen geöffnet: Ein Ausdruck, den Künstler eines bestimmten Alters für Ekstase zu halten schienen.
Aus der Mitte des Raums drang Menéndez’ Stimme zu ihr: leise, drängend, fragend. Sie konnte es nicht länger aufschieben. Maria Gutierrez trat auf die von Fliegen umsurrte Männergruppe zu. Torrillo bemerkte sie und trat einen Schritt zur Seite. Unwillkürlich musste sie blinzeln und war überrascht, dass sie sich nicht auf der Stelle übergeben musste.
Die Brüder Angel lagen direkt unter einer kleinen modernen Lampe, die tief von der Decke herabhing. Ihre Leichen ruhten Seite an Seite auf der dunkelroten Samtdecke des übergroßen Doppelbetts. Sie waren gekleidet wie spanische Höflinge – in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, vermutete sie. Ein Zwilling trug Grün, der andere Rot: Brokatwämser, Kniebundhosen aus Samt, weiße Kniestrümpfe, schwarze Lederschuhe. Die rechte Leiche hielt ein Schwert vor der Brust. Die Hand des anderen Bruders ruhte auf einem kleinen Schmuckkästchen. Menéndez streckte die Hand aus und öffnete den Deckel: glitzernder Talmischmuck. Menéndez’ Hand steckte in einem Plastikhandschuh, wie sie Verkäuferinnen an der Feinkosttheke der Supermärkte benutzen.
Beide Brüder trugen Rüschenhemden von der Art, wie sie von picadores in der Stierkampfarena noch immer bevorzugt werden. Der Arm mit dem Schwert verdeckte fast die gesamte Brust des Toten, aber auf der seines Bruders sah sie einen großen, schwarzverkrusteten Blutfleck. Darüber und darunter Pfeile, ähnlich den Darts-Pfeilen in englischen Pubs. An ihnen waren rote, gelbe und blaue Bänder befestigt, und die Spitzen steckten tief im Fleisch. Mindestens sechs Pfeile durchbohrten den Oberkörper, von knapp unterhalb des Halses bis zum Nabel. Noch weitere Blutflecke bedeckten den Oberkörper, deren Ursache aber nicht ersichtlich war.
Menéndez trat an die andere Seite des Betts und hob den starren Arm mit dem Schwert an. Darunter das gleiche Bild: eine große Wunde in der Mitte, eine Reihe bebänderter Pfeile, weitere Blutflecke. Er ging wieder zurück und berührte das Hemd. Es war nicht zugeknöpft. Er öffnete es, und einen Moment lang befürchtete sie, sich übergeben zu müssen. Die Fliegen waren nicht von draußen gekommen. Der Körper wimmelte vor gelben und weißen Maden, belebt durch die Verwesung.
Auf unsicheren Knien drehte sie sich um und verließ den Raum. Sie schwankte die Treppe hinunter, zur Tür hinaus und sank auf die Eingangsstufen. Selbst hier schien die Luft vom Verwesungsgeruch verpestet zu sein. Sie fragte sich, ob sie ihn jemals wieder loswerden würde.
Maria Gutierrez verschwamm es vor den Augen, als sie zum Polizeiwagen ging und die hintere Tür öffnete. Sie ließ sich auf den Rücksitz fallen und verlor das Bewusstsein.
Menéndez sah sie nicht gehen. Er lief konzentriert um das Totenbett herum, untersuchte die Leichen, hob Kleidungsstücke an, berührte das wächserne Fleisch mit einem Stift und hielt seine Feststellungen auf einem kleinen Tonbandgerät fest. Torrillo notierte die Anmerkungen zusätzlich auf seinem Block. Menéndez hatte ihn nie darum gebeten. Es schien irgendwie selbstverständlich zu sein.
Der Rest der Truppe trat zurück. Niemand sagte ein Wort. Sie beobachteten die Kriminalpolizisten bei der Arbeit, einige gelangweilt, die meisten fasziniert.
Draußen erwachte die Stadt zum Leben. Vögel sangen in den Mimosenbäumen entlang der Straße vor den Patiomauern. Eine Prozession zog vorüber, erst drang Weihrauchgeruch durch die Fenster, dann das heitere Geplauder der Teilnehmer. Charterjets zogen in tausend Meter Höhe letzte Landeschleifen und luden Tausende weiterer Besucher der Heiligen Woche auf dem Flughafen Murillo ab. Die Straßenhändler bemühten sich halbherzig um Geschäfte mit Touristen und Einheimischen, stellten aber fest, dass die Mischung aus Hitze und kurzlebiger religiöser Leidenschaft für die meisten nur schwer erträglich war. Ein Polizist wurde mit dem Messer angegriffen, aber nicht ernsthaft verletzt, als er den Tumult in einer Bar schlichten wollte, der in einer harmlosen Auseinandersetzung über Fußball seinen Anfang genommen hatte. Auf der Plaza de la Paz errichteten sieben Mitglieder einer Sekte einen Stand, an dem über den bevorstehenden Weltuntergang am nächsten Sonntag informiert wurde. »Vor oder nach dem Stierkampf?« erkundigte sich ein beunruhigter Zuschauer, als sie ihre Transparente entrollten. Und sie nahmen an, er mache sich über sie lustig. Ein unvorschriftsgemäß beladener Lastwagen mit Knoblauch kippte auf der Umgehungsstraße um und verursachte einen Rückstau bis zur Autobahn nach Cádiz. Aufgrund der Hitze und der Erregung erlitt ein Mann einen Herzanfall, diverse Autofahrer gerieten mit den Fäusten aneinander, und eine jugendliche Mutter brachte vorzeitig ein Mädchen zur Welt. Als Hebamme fungierte eine Busschaffnerin.
Und Maria Gutierrez schlief und hatte einen Alptraum, in dem kopflose Tauben wie roter Regen aus einem strahlendblauen Himmel zu Boden fielen. Wieder und immer wieder.
Abrupt fuhr sie hoch, die grauenerregenden scharlachroten Bilder noch immer irgendwo eingebrannt. Einen Moment lang wusste sie nicht, wo sie sich befand. Dann erinnerte sie sich, zog ihre Jeans glatt, fuhr sich durch die Haare, blickte prüfend in den Innenspiegel und stieg aus. Ein Mann mit Arzttasche kam durch das Eingangstor.
Zu spät, wie üblich, dachte sie, rief sich dann aber zur Ordnung. Sie war hier, um den Polizisten auf die Finger zu sehen, nicht, um einer von ihnen zu werden. Schon gar nicht, wie einer zu denken.
Als sie das Haus wieder betrat, kamen Menéndez und Torrillo gerade die Treppe herunter. Der Hauptkommissar wirkte unnatürlich aufgekratzt, auf eine Weise konzentriert, die jede Ablenkung ausschloss. Die Arbeit – die Morde – hatte ihm neue Energien verliehen, denen etwas Dunkles, fast Fanatisches anhaftete. Sein Gesicht schien zu leuchten, seinen wachen braunen Augen entging nichts. Sein Blick fiel auf sie. Er hob eine Hand, winkte ihr zu, sanft, fast weiblich, deutete in die Richtung einer Tür und ging auf sie zu, Torrillo im Schlepptau.
»Geht es Ihnen wieder besser?«
Sie nickte.
»Gut. Es ist aber auch ein schockierender Anblick. Die meisten Menschen wären auf der Stelle umgefallen. Sie haben sich hervorragend gehalten. Und jetzt ...«
Sie wartete.
»Jetzt müssen wir kurz mit der Señora sprechen, der das Haus gehört. Ich glaube zwar nicht, dass sie uns viel Neues mitzuteilen hat, dennoch dürfte es eine ganz interessante Unterhaltung werden.«
Menéndez zeigte erneut auf die Tür. Sie betraten den Raum. Eine Polizistin in prallsitzender Uniform stand neben einer alten Frau, die kerzengerade auf einem ausgeblichenen Polstersessel saß und mit beiden Händen die Armlehnen umkrallte. Sie wirkte uralt, zu alt, um überhaupt noch am Leben sein zu können. Ihr Gesicht sah aus wie eine griechische Maske, resolut, gelassen, voller Tragik. »Sie wissen, wer ich bin. Ich wünsche keinen Skandal. Der Name meiner Familie sollte in dieser Stadt noch bekannt genug sein, um das zu verhindern, denke ich.«
Kapitel 5
Menéndez konnte Caterina Lucena mehr über die Brüder erzählen als sie ihm. Er hatte sich die Vorstrafenregister sowie Zeitungsausschnitte aus der Bibliothek ins Haus bringen lassen und kurz überflogen. Sie enthüllten fast alles, was bereits in den Printmedien erschienen war: stubenrein in Hola!, schlüpfriger in Esquire und Playboy.
Pedro und Juan Angel waren vor vierunddreißig Jahren in einem der ärmsten Viertel von Barcelona zur Welt gekommen. Als siamesische Zwillinge, seit der Geburt an den Hüften zusammengewachsen – jedoch nur äußerlich, obwohl das seinerzeit den Ärzten nicht bekannt war. Sie besaßen keine gemeinsamen inneren Organe. Aber im damaligen Spanien waren sie medizinische Monstrositäten, und niemand sah sich in der Lage, eine zutreffende Diagnose zu stellen.
Ihr Vater verdiente sich sein Geld als Deckarbeiter in der Frachtschifffahrt. Ein Jahr nach ihrer Geburt heuerte er auf einem Frachter nach Kowloon an und wurde nie wieder gesehen. Die meisten Leute waren der Ansicht, er hätte den Anblick der Rechnungen nicht mehr ertragen, die das Krankenhaus der Heiligen Jungfrau in regelmäßigen Abständen schickte. Kurz vor ihrem zweiten Geburtstag wurden die Brüder durch eine einfache Operation getrennt, für die die öffentliche Gesundheitsfürsorge zahlte, und danach verschwanden sie aus den Zeitungen, aus dem öffentlichen Bewusstsein.
Zunächst hatten die Zeitungen das Bild einer armen, aber aufrechten Ghettofamilie gezeichnet, die sich tapfer mit dem Los herumschlug, das ihr vom Schicksal aufgebürdet worden war. Barcelona ist eine große Stadt, aber dennoch ein Dorf. Die Mutter arbeitete als Hure in den Docks, und das sprach sich schnell herum. Die Operation beruhigte das Gewissen der Leute und versetzte sie in die Lage, sich wieder anderen Dingen zuzuwenden. Für die Familie änderte sich nichts. Die Mutter arbeitete weiter als Prostituierte und überließ die Kinder meistens der Obhut einer Tante, die selbst sechs Kinder hatte, alles Jungen. Die verabscheute die Aufgabe, vor allem aber die Tatsache, dass es Jungen waren. Seit der Geburt ihres ersten Sohnes hatte sie die Jungfrau Maria um ein Mädchen angefleht, aber ihre Gebete waren nie erhört worden. Pedro und Juan waren zierliche, ruhige, brave Kinder, und so ergab es sich für die Tante wie von selbst. In den ersten acht Jahren ihres Lebens wurden beide wie Mädchen behandelt. Sie trugen Kleider, sie erhielten Tanzunterricht, sie nahmen an den Umzügen teil. Sie wurden mit Mädchennamen gerufen: Anna und Belen. Gelegentlich, wenn sie ihren Sonntagsstaat trugen, ein wenig Rouge auf den Wangen, sagten die Leute lächelnd Guapas zu ihnen. Niemand brachte sie mehr mit den siamesischen Zwillingen in Verbindung. Die Sache gehörte der Vergangenheit an.
Als sie acht Jahre alt waren, entblößten sich die Brüder während des Kommunionsunterrichts und wurden demzufolge der Kirche wie der Schule verwiesen, die von der Kirche unterhalten wurde. Es bestand allgemeine Übereinstimmung darüber, dass ihre Notlage selbstverschuldet war und ihre Zukunft ihrer eigenen Verantwortung unterlag. Das nahmen sich beide zu Herzen und verbrachten die nächsten anderthalb Jahrzehnte auf der Straße, boten sich als Strichjungen an, verhökerten weiche und harte Drogen und traten in die sattsam bekannte Spirale jugendlicher Verbrechen ein: Diebstähle von Handtaschen und Kameras von Touristen, Spritztouren mit gestohlenen Autos, kleinere Raubzüge im Umkreis der Docks. Viermal wurden sie zu Jugendstrafen verurteilt, später zu Gefängnis, stets gemeinsam, da sie es ablehnten, getrennt zu werden. Bei ihrem letzten Gefängnisaufenthalt beteiligten sie sich an Kursen zum Thema bildende Kunst.
Nach ihrer Entlassung erklärten sich die Brüder zu Künstlern und produzierten eine Reihe von Werken, die zunehmend Beifall und Kritik auslösten, zunächst in Barcelona, dann auch international. Mit Hilfe von Sotheby’s in New York verkauften sie ein Paar Stierhoden in Acryl für 32 000 Dollar. Lammfromme Katholiken gerieten in höchste Empörung, als sie vor der Kathedrale der Heiligen Familie in ihrer Heimatstadt ein fünfzig Meter hohes Kondom aufblasen ließen. Spätere Werke umfassten die in Kunststoff eingeschweißte Totgeburt eines Lamms, das in London für 25 000 Pfund an den Kunstkenner gebracht wurde. (»Das muss ich meinem Cousin Carlo erzählen«, sagte Torrillo, als er das hörte, »er ist Schafzüchter in Antequera. Ich könnte mir vorstellen, dass er bereit ist, genau so was abzugeben, vielleicht sogar zum halben Preis.«) Ein Objekt mit dem »Stillleben«, ein Karton voller Kleenextücher, auf die die Brüder masturbiert hatten, blieb unverkäuflich, als es auf einer Auktion in Los Angeles zu einem Mindestpreis von 50 000 Dollar angeboten wurde.
Im Alter von dreißig Jahren, vier Jahre vor ihrem Tod, waren die Brüder Angel feste Größen in den internationalen Kunstkreisen. Sie waren in drei Almodóvar-Filmen in Erscheinung getreten und hatten für Benetton eine Werbekampagne entwickelt. Die Magazine schätzten, dass sie beide Dollar-Millionäre waren, mit vier Wohnsitzen: in Spanien, einem an der Riviera und einem kleinen Apartment auf der Lower East Side in New York.
Die Polizeiakten wiesen nach, dass sie ihre Vergangenheit nicht gänzlich aufgegeben hatten. Mitte der achtziger Jahre waren beide wegen Heroinbesitzes belangt worden, und es gab den Fall eines zwölfjährigen Jungen in Barcelona, der sie sexuellen Missbrauchs und verschiedener Perversitäten beschuldigte, aber die Anzeige zurückzog – vermutlich nach der Zahlung eines Schweigegeldes. Zwei Jahre vor ihrem Tod wurde bekannt, dass sie HIV-positiv waren, aber es gab keinerlei Hinweise darauf, dass die Immunschwäche bei einem von ihnen inzwischen akut ausgebrochen war.
Die obszöneren Aspekte verkniff sich Menéndez. Señora Lucena war eine alte Frau. Sehr wahrscheinlich vertrat sie höchst katholische Wertvorstellungen. Als er fertig war, funkelte sie ihn zornig an.
»Sie haben ihre Miete gezahlt, waren aber kaum jemals hier«, erklärte sie, verbittert darüber, dass sie ihre Geldnot eingestehen musste. »Sie waren nicht ... nicht nach meinem Geschmack. Aber sie zahlten.«
Menéndez dachte an die Gegebenheiten des Hauses. »Sie sahen nichts, Sie hörten nichts.«
»Das habe ich nicht gesagt«, widersprach die alte Frau bestimmt. »Danach haben Sie noch nicht gefragt.«
»Bitte ...«
Sie trank einen Schluck Wasser aus dem Glas auf einem antiken Beistelltisch. »Als ich gestern erwachte, hörte ich etwas im Patio. Jemand war im Garten, einer von diesen jungen Ganoven. Er ist über die Mauer geklettert.«
»Warum ist er nicht einfach zum Tor hinausgegangen?«
»Weil das verschlossen ist – und sehr hoch. Das müssen Sie doch gesehen haben.«
»Haben Sie es selbst verschlossen?«
Sie musterte ihn verächtlich. »Sehe ich so aus, als wäre ich dazu fähig? Das macht die Zugehfrau. Sie kommt stundenweise. Sie kommt auf Anforderung der Angels. Wenn sie sie nicht brauchen, hilft sie mir. Das ist eine Übereinkunft.«
»Wie sah dieser Eindringling aus?«
»Rot. Er war rot gekleidet. Es war ganz hinten in der Ecke. Hinter den Bäumen. Ich habe nur kurz hinübergeblickt, aber ...«
»Ja?«
»Meine Augen sind nicht besonders gut.«
Sie trank das Glas aus und wandte sich an die Polizistin. »In dem Schrank da drüben steht eine Flasche Fino. Ich hätte gern einen Schluck.«
Die Polizistin holte die Flasche, eine billige Supermarkt-Marke, die Menéndez nicht kannte.
»Ich glaube, er könnte ein Kostüm getragen haben.«
»Was für ein Kostüm?«
»Eine ... Robe. Vielleicht. Das Gesicht konnte ich nicht erkennen und ...«
Sie verstummte, und einen Moment lang glaubte Menéndez, sie würde in Tränen ausbrechen.
»Ich glaube, wir haben jetzt genug Fragen gestellt. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.«