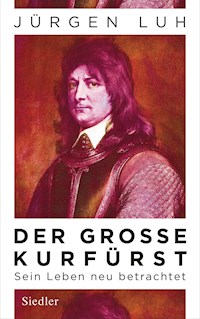19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Napoleons Erbe. Preußen am Beginn der Moderne
Als Napoleons Armee 1806 die Schlacht bei Auerstedt gewann, war Preußen am Boden, ein hartes Besatzungsregime prägte die »Franzosenzeit«. Doch mit den Ideen der Französischen Revolution kam zugleich die Hoffnung auf Reformen, Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit. Jürgen Luh entwickelt aus einem Gemälde Schinkels ein überraschendes Porträt dieser Schlüsselepoche preußischer Geschichte – in der ein kurzer Traum der Freiheit am Ende jäh zerbrach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Ähnliche
Jürgen Luh
DER KURZE TRAUM DER FREIHEIT
Preußen nach Napoleon
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Erste Auflage
August 2015
Copyright © 2015 by Siedler Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg
Lektorat und Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Register: Nadja Bender, Berlin
ISBN 978-3-641-15835-4
www.siedler-verlag.de
Helga, Hans und Martina
INHALT
SPIEGELBILD
TRIUMPH
DEMÜTIGUNG
BEDRÜCKUNG
SELBSTBESTIMMUNG
ENTTÄUSCHUNG
DANK
ANMERKUNGEN
QUELLEN UND LITERATUR
PERSONENREGISTER
SPIEGELBILD
Die Besucher der Berliner Akademie-Ausstellung 1818 waren ratlos. Das Gemälde, das sie vor sich an der Wand sahen, konnten sie nicht deuten. Selbst der fachkundige Berichterstatter der Originalien aus dem Gebiet der Wahrheit, Kunst, Laune und Phantasie wusste nicht, was er denken sollte: »Diese letzten Tage wurde ein neu vollendetes allegorisches Bild von Schinkel aufgestellt, das ich nicht verstehe und das Sie sich aus der Beschreibung erklären mögen«, forderte er seine Leser in der Januar-Ausgabe 1819 auf. »Im Vorgrunde ein das Bild begränzender antiker Triumphbogen, unter dem zwei eherne Bildsäulen zu Pferde, [die] des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm und [die] Friedrich[s] des Großen [zu sehen sind]; hinter dem Bogen links der Rücktheil einer reichen gothischen Kirche, und im Prospekt die Stadt Berlin hinter einem Flusse. Aus einem Hohlwege an besagter Kirche in Begleitung einer zahllosen Menschenmenge sieht man die Victoria des Brandenburger Thores von acht Zeltern gezogen sich herbewegen, der eine unermeßliche Menge von Truppen zur Bedeckung dient, und an deren Spitze man die Fürsten und Führer mit zahlreicher Suite unterscheidet. Der Zug scheint herwärts zu dem Triumphbogen seine Richtung zu nehmen, wo auf der Ballustrade ein Lorbeerkranz auf einem rothen Kissen liegt und eine Mischung verschiedener Zeitalter und Himmelsstriche in den zum Empfang bereiten Figuren angedeutet ist. … Schade«, so der anonyme Autor am Ende seiner Besprechung, »daß sich der Künstler nicht die Mühe gab, durch eine kleine schriftliche Erklärung die volle Bedeutung [des Bildes] dem Beschauer zu erklären.«
Das in der Ausstellung gezeigte Werk war ein Geschenk Karl Friedrich Schinkels an den preußischen Thronfolger Friedrich Wilhelm (IV.), die Botschaft des Bildes delikat, denn sie war politisch und – kritisch. Öffentlich erläutern wollte Schinkel sie deshalb nicht. Um sie zu entschlüsseln und zu verstehen, muss man das Gemälde, anders als der Berliner Korrespondent der Originalien dies wohl getan hat, sehr genau und lange betrachten und sich in die ereignisreichen, bewegten Jahre zu Beginn des 19. Jahrhunderts zurückversetzen, als Preußen im Schatten Napoleons stand.
Es war die Zeit zwischen Anpassung und Widerstand, zwischen alten Denkmustern und neuen Ideen. »Krieg und Eroberung, Ausbeutung und Unterdrückung, Imperium und Neuordnung« bestimmten das Schicksal der Bevölkerung, schreibt Thomas Nipperdey. Napoleons Armee hatte Preußen vernichtend geschlagen; der Staat war zusammengebrochen. »Neue Ideen einer bürgerlichen Gesellschaft, die auf bürgerlicher Freiheit und rechtlicher Gleichheit sich aufbaute, hatten dem feudal-ständischen System seine Legitimität genommen.« Jetzt sollten Staat und Gesellschaft modernisiert, ja europäisiert werden. An die Stelle der verkommenen Ständegesellschaft sollte eine Gesellschaft rechtsgleicher Bürger treten und »die Kräfte des Einzelnen im Interesse gerade der Gesamtheit von feudal-korporativen Bindungen und staatlicher Bevormundung emanzipieren«, so die Gedanken der Reformer und Patrioten. Aus Untertanen sollten Bürger werden, und die Trennung von Staat und Gesellschaft, von Regierung und Volk sollte aufgehoben werden. »Freilich Teilhabe der Nation, des Volkes am Staat konnte es erst geben, wenn die Ständegesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft geworden war – insofern bestand zwischen den gesellschaftlich-politischen Zielen und Möglichkeiten eine deutliche Spannung.«
Schinkel zählte damals zu den preußischen Patrioten, zu den Männern und Frauen, die eine »innere Teilhabe am Gemeinwesen auf der Basis eigener Überzeugungen und eigenen Wollens« für sich in Anspruch nahmen. Er war gut bekannt mit den Ideen und Köpfen der Reformbewegung, mit August Wilhelm Neidhardt von Gneisenau, mit Wilhelm von Humboldt, mit Barthold Georg Niebuhr, Friedrich Schleiermacher und auch mit Johann Gottlieb Fichte. Gerhard von Scharnhorsts Handeln hat er verfolgt. Seine Begeisterung für die gute, patriotische Sache war »durch die berühmten Vorlesungen von Fichte, welche er eifrig besuchte, auf das stärkste angefacht worden«. Er hatte die Reden an die deutsche Nation gehört, die der Philosoph im Winter 1807/08 in Berlin gehalten hatte. Das überliefert uns Gustav Friedrich Waagen, der seit einer gemeinsamen Italienreise 1824 mit Schinkel eng befreundet war, sich mit ihm austauschte, ihn sehr gut kannte. Überhaupt, lässt Waagen uns wissen, sei der Einfluss, »welchen die hohe moralische Kraft, die Tüchtigkeit der Gesinnung dieses Philosophen auf Schinkel ausübte, auf die Ausbildung seines Charakters für das ganze Leben von der entschiedensten Bedeutung« gewesen, »wie er denn auch mit den populairen Schriften desselben sehr vertraut war«. Viele Vorstellungen, die Fichte in seinen Reden entwickelte, hat Schinkel aufgenommen und auf seine Weise verarbeitet. Von Fichtes Denkmodell, die Ideen der Französischen Revolution aufzugreifen, die französische Vorherrschaft aber abzuschütteln und eine »neue Welt« mit neuer Staats- und Gesellschaftsordnung zu schaffen, hat er sich anstecken lassen.
»Das Gefühl der Fremdherrschaft in Deutschland … lastete besonders empfindlich auf der Brust eines so tief fühlenden Mannes«, berichtet Waagen. »Als endlich im Jahre 1813 die Stunde der Befreiung von der langen Schmach geschlagen hatte, wurde Schinkel von diesem großen Moment auf das lebhafteste ergriffen, und seine stets arbeitende Phantasie suchte diesem Gefühl in den verschiedensten Formen den großartigsten, würdigsten Ausdruck zu geben, um so auch von seiner Seite, für die Gegenwart begeisternd, für die Zukunft die Eindrücke festhaltend, thätig einzugreifen.«
In seiner Euphorie für die patriotische »gute Sache« ließ Schinkel sich mit Fichte und Schleiermacher in Berlin zum Landsturm einexerzieren und rüstete, obwohl »keineswegs in einer glänzenden Lage«, seinen Schwager Wilhelm Berger als Freiwilligen Jäger aus. »Ich habe ihn so mit Gelde und allem nöthigen versehn, dass er sich nicht allein ganz vollständig equipiren und armiren kann …, sondern auch auf mehrere Monate eine Zulage hat«, schrieb er im Januar 1813 an seinen Schwiegervater.
Der Brief an Georg Friedrich Berger offenbart mehr als jedes andere Zeugnis Schinkels politische Denkart und Überzeugung. »So sehr diese Ereignisse« – die Niederlage gegen Frankreich, die fremde Besatzung, der gesellschaftliche Aufbruch, der Freiheitskampf – »einen jeden … im ersten Augenblick erschüttern«, heißt es darin, »so müssen wir doch, wenn wir nur einen kleinen Rückblick machen auf unsere verlebten Tage, mit wahrer Herzenserhebung dieselben in unsere Empfindung aufnehmen.« Die Aussichten für jeden Menschen in Preußen und Deutschland seien ohne Hoffnung, nur trübe und düster gewesen. »Denn wo war die Aussicht, dass auch nur der geringste Theil billiger Wünsche für ihr künftiges Glück realisirt werden konnte. … Ein Entscheidendes musste unternommen werden, und der Himmel scheint für die gute Sache mitwirken zu wollen.« Seit langer Zeit sei es »beinahe das erste Mal«, dass »sich die Stimme des Fürsten« – Friedrich Wilhelms III. – »mit der des Volks ganz« begegne. »Diese Zeit, lieber Vater«, schrieb Schinkel voller Hoffnung, »müssen wir noch standhaft … überstehn, und wir sehn das Aufblühn eines glücklichern Zeitalters.« In der neuen Zeit, war er sich sicher, werde »alles leichter werden«, was man unternimmt, und man werde alle Dinge mit »einer andern Lebensfreude« anpacken. Wie die vielen in den Krieg ziehenden, opferbereiten jungen Menschen an dieser vielversprechenden Zukunft mitgewirkt zu haben, wünschte er sich in jener Zeit der Hoffnung.
1817, zwei Jahre nachdem Napoleon bei Waterloo endgültig besiegt worden war, malte der zu dieser Zeit 36-jährige, zwischen einstiger Erwartung und gegenwärtiger Enttäuschung schwankende Schinkel das »Bild mit dem Triumphbogen«. So wurde es ein Jahr später in der Ausstellung bezeichnet, denn einen Titel besaß es damals noch nicht. Darauf lassen sich, wenn man genau hinschaut, die Hoffnungen und Sehnsüchte der preußischen Patrioten, ja des größten Teils der Bevölkerung auf eine bessere, freiere Zukunft finden. Die Anliegen und Erfahrungen vieler Preußen waren auch die vieler Deutscher, ja vieler Europäer. Diese Wünsche der »Weltbürger«, wie die Hoffnungsvollen abwertend von jenen genannt wurden, die die Ständehierarchie erhalten wollten, zielten dank Aufklärung und Französischer Revolution auf den Aufbruch des Individuums und des Denkens. Es waren übernationale, allgemeine, menschliche Erwartungen, die formuliert und an die Herrschenden herangetragen wurden: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – Menschenrechte, die europäischsten aller Werte. An erster Stelle wollten die Untertanen Friedrich Wilhelms III. staatsbürgerliche Freiheiten, verbürgt von einer Verfassung. Jahrelang hofften sie, aber alle ihre Rufe verhallten. Während Schinkel malte, forderte die akademische Jugend diese Freiheiten am 18. Oktober 1817 lautstark auf der Wartburg. Studenten von wenigstens elf Universitäten hatten sich dort versammelt, um den hundertsten Jahrestag der Reformation und den vierten der Völkerschlacht bei Leipzig zu feiern – bedeutende geschichtliche Ereignisse für die sich nach Freiheit sehnende Jugend. Während sie die Freiheit forderten, verbrannten die Studenten Publikationen königstreuer, reaktionärer Autoren wie die des Direktors der Berliner Universität Theodor Anton Heinrich Schmalz, der behauptete, die Ideen der Patrioten hätten rechtschaffene preußische Bürger in Angst und Schrecken versetzt, weil sie »Umwälzung, keinen dauernden Zustand, nichts als sich selbst« wollten; 1813 hätten sie nichts zur »Begeisterung der preußischen Nation« beigetragen, vielmehr habe das Volk »in ruhiger Kraft … auf den Wink des Königs« gewartet. Das wollten sich die vielen Freiwilligen des Krieges nicht gefallen lassen, und so hörte man am Ende dieses hochgestimmten studentischen Festes auch wenig friedliche deutschtümelnde Töne.
Die Ideen und Ideale der Französischen Revolution hatten sich mit den militärischen Erfolgen Frankreichs seit den 1790er Jahren über die anderen europäischen Mächte auf dem Kontinent verbreitet; immer mehr Menschen waren mit ihnen in Berührung gekommen. Napoleon und seine Soldaten hatten vor allem die preußische und deutsche Bevölkerung umfassender und eindringlicher, als das je zuvor geschehen war, mit den Ideen der Revolution bekannt gemacht. Napoleon, stellte Golo Mann treffend fest, habe den Menschen einen neuen Begriff von der Politik, vom Staat, von der Macht, vom Krieg, vom Erfolg, von der Größe gegeben. »Sie nahmen diese Lehre an; könnte man dergleichen überhaupt messen, so würde man wohl zu sagen versucht sein, der Napoleon-Mythos habe nachmals in Deutschland kräftiger geblüht und wirksamere Folgen gehabt als in Frankreich selber.« Zwar zeigte sich die napoleonische Herrschaft »absolut, weil der Befehl von oben kam, die riesige Maschinerie des Beamtentums gelenkt wurde vom Kaiser und seinen Ministern«. Sie erwies sich aber gleichzeitig als »liberal, weil vor dem Gesetz jeder gleich galt, Christ und Jude, Ritter, Bürger und Bauer, und unter dem Gesetz jeder einzelne frei war, sein Leben, wie es ihm beliebte, zu gestalten«.
Auf solche Euphorie und Aufbruchstimmung, die in der preußischen Bevölkerung trotz der demütigenden Niederlage 1806 bei Jena und Auerstedt allenthalben spürbar war, folgte in der anschließenden Besatzungszeit jedoch bald Ernüchterung. Zwischen 1806 und 1809 verspielten die Franzosen durch die Willkürherrschaft, die sie in Preußen übten, viel von der Begeisterung, die sie bei den Deutschen für die Ideen und das Anliegen der Revolution geweckt hatten. Vorbildlich konnten sie nun nicht mehr sein. Doch der Wunsch nach Freiheit, Gleichheit, Selbstbestimmung und Teilhabe am Staat blieb in der Bevölkerung wach. Allerdings hoffte man nun, er werde »von oben« erfüllt werden. Der Wunsch nach Freiheit wandelte sich allmählich zum Wunsch nach »Befreiung vom französischen Joch« – dieses Ziel wurde zuallererst angestrebt –, also nach persönlicher Freiheit.
Die Reformen, die in Preußen unter dem Freiherrn Heinrich Friedrich Karl von und zum Stein angepackt wurden, enthielten hoffnungsvolle, durchaus demokratische Ansätze, aber am Ende – nach dem endgültigen Sieg über Napoleon 1815 – waren sie nur noch eine »ideenreiche Reaktion gegen das Elend der Niederlage, welches sie notwendig machte«. Im Jahr 1817, als Schinkels Gemälde entstand, konnte der Gegensatz zwischen dem, »was die Patrioten wollten, die führenden Köpfe der preußischen Armee, der Freiherr vom Stein und seine Publizisten, und dem, was die Diplomaten verwirklichten«, nicht größer sein – zur Enttäuschung der Bevölkerung.
Schinkel hat diese Höhen und Tiefen von 1805 bis 1817 erlebt und wie viele seiner preußischen Zeitgenossen eine kurze Zeit lang große Hoffnungen gehegt. Er hat das alles in seinem Bild allegorisch festgehalten. Das 104 mal 76,5 Zentimeter große Gemälde spiegelt die Zeitläufte wie die Gefühle und Empfindungen der Menschen jener Zeit: den Wunsch nach Veränderung, nach Selbstbestimmung und rechtlich verbrieften, von einer Verfassung verbürgten Freiheiten, alles Ziele, für die man gegen Napoleons Armeen gekämpft, für die Soldaten in ihren Regimentern und Freiwillige in Freikorps- und Landwehrverbänden ihr Leben eingesetzt hatten.
Indem Schinkel das Gemälde Friedrich Wilhelm schenkte, forderte er den Kronprinzen auf, das Bild zu lesen, die darin dargestellten Gegensätze zu erkennen, sie aufzulösen und das – berechtigte – Begehren der Untertanen nach Freiheit, Recht und Verfassung zu erfüllen. Schinkel sprach den Thronfolger vielleicht sogar ganz direkt an, denn es ist behauptet worden, Friedrich Wilhelm sei in dem Bild zu sehen, der »Jüngling mit langen, blonden Haaren« sei es, der auf dem »apsisartigen, reliefgeschmückten Vorbau einer Aussichtsplattform unter dem Bogen« steht. Unbedingt aber, so lässt sich das ins Bild gesetzte Ersuchen lesen, sollte der Kronprinz für die allgemeinen, menschlichen, europäischen Werte eintreten, die sich seit der Französischen Revolution in den Köpfen der nach Freiheit strebenden Menschen festgesetzt hatten.
Friedrich Wilhelm tat es nicht, wie der Blick zurück zeigt. Der Kronprinz, erst recht der konservative König und die Regierung, aber auch die Regenten und Politiker aller anderen europäischen Mächte haben damals die Chancen nicht ergriffen, welche die Verständigung auf gemeinsame Grundwerte für eine brüderliche europäische Zukunft bedeutet hätten. Stattdessen haben sie die Ideen der Französischen Revolution und die Wünsche der Bevölkerung missachtet und noch über hundert Jahre lang eigensüchtige nationale Interessen verfolgt – nicht immer zum Besten der Menschen dieses Kontinents.
TRIUMPH
Zweifach ist der Triumph, den wir in Schinkels Gemälde erblicken: Hell glänzend und leuchtend ist der eine, ganz wie man ihn erwartet und wie er sein sollte; dunkel dagegen und düster der andere, so matt, dass man von einem Triumph im Grunde nicht sprechen mag. Doch dieser dunkle dominiert. Zwielichtig-trüb füllt er den Bildvordergrund aus. Großflächige Finsternis und zwei schwarze Reiter auf hohen Sockeln bestimmen den ersten Eindruck des Betrachters. Es ist dieser mächtige, dunkle Triumph, der in Erinnerung bleibt, den man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Das war Schinkels Absicht.
Der helle, strahlende Triumph ist kaum wahrnehmbar. Er ist in den Hintergrund gedrängt, leuchtet nur schwach auf. Man muss dicht an das Gemälde herantreten und ganz genau hinsehen, dann erst erkennt man den bewegenden Siegeszug in der Bildmitte. Die Menschen, Preußens Bürger und Soldaten, sind zu Tausenden zusammengeströmt, um die Rückkehr der vom Brandenburger Tor geraubten Quadriga zu feiern. Ihre ausgelassene, freudige Stimmung an diesem denkwürdigen Tag hat Schinkel festgehalten.
Den Siegeswagen mit der Göttin Viktoria hatten die Franzosen im Dezember 1806 geraubt und nach Paris verbracht. Im Juni 1814 kehrten Göttin und Gespann in die preußische Hauptstadt zurück; es war ein erhebender, mit großen Erwartungen verknüpfter Moment. Berlins Silhouette ist deutlich zu erkennen. Leicht lassen sich die Kirchen und Dome vor dem Blaugrau des Himmels unterscheiden: der Berliner Dom gegenüber dem Schloss, die Hedwigskathedrale am Opernplatz, die Marienkirche am Alexanderplatz, der Deutsche und der Französische Dom am Gendarmenmarkt, die Nikolai- und die Petrikirche. Das freudige Ereignis der Heimkehr hat die Menschen herbeigelockt und die Menge in ihren Wünschen und Sehnsüchten vereint. Der Augenblick weckt die Hoffnung auf eine freie, freudvolle Zukunft. Davon soll zunächst die Rede sein.
Die Quadriga, »jenes Meisterwerk, das einstens eine Zierde der schönen Stadt Berlin war, wurde von den Feinden Europa’s nach jener Stadt geschleppt, von wo aus Despotie und Unglück über die Menschheit verbreitet wurde. Aber Preußens mächtiger Arm demütigte den Stolz des Feindes, und seine Heere zogen nach jener Stadt, wo dieses Kunstwerk – von deutscher Hand verfertigt – prangte – das nun wieder seine Stelle in Preußens Königs-Stadt einnehmen wird«, verkündeten die Berlinischen Nachrichten stolz im Mai 1814. Sie drückten aus, was die Menschen der Stadt, ganz Preußens und vieler anderer deutscher Länder empfanden.
»Jene Stadt« war Paris. Die alliierten Truppen hatten sie am 31. März erobert. »Paris ist unser. … Heute sind wir hier eingerückt«, schrieb August Wilhelm Neidhardt von Gneisenau, Stabschef der Schlesischen Armee, an diesem Tag noch »vom Pferde« aus an seine Frau Karoline.
Der Weg dorthin aber war steinig und lang gewesen, dass man ihn bis zum Ziel gehen würde, nicht von Anfang an ausgemacht; nicht einmal, dass man ihn überhaupt beschreiten würde. Zu Beginn des Jahres 1812 hatte es danach nicht ausgesehen. Am 5. März war von Preußens Regierung ein Vertrag ratifiziert worden, der Napoleon ein Hilfskorps von 20 000 Mann, dazu alle Waffenvorräte und Heeresbedürfnisse für den Feldzug gegen Russland zur Verfügung stellte und Berlin französischer Besatzung auslieferte. Darüber hinaus war dem König die Verfügung über die verbliebenen Streitkräfte untersagt; keine Einberufung, keine Ergänzung, keine Truppenverschiebung durfte ohne Einverständnis der französischen Verantwortlichen geschehen, zwei der acht Landesfestungen mussten ausgeliefert werden, die Übergabe der übrigen drohte.
Es war, so die Empfindung vieler, der Tiefpunkt preußischer Geschichte. »Mit Feigheit haben wir einen Unterwerfungsvertrag unterzeichnet, der uns mit Schande besudelt, Blut und Vermögen des Volkes fremder Willkür preisgibt, und die königliche Familie der augenfallendsten Gefahr bloßstellt«, hatte Gneisenau, »in allen Beziehungen ein ritterlicher Mann, ein edler Mensch, höchst gerecht« und »ohne Verachtung des einzelnen«, damals beklagt und vorwurfsvoll festgehalten: »Als im Jahre 1808 uns in Königsberg die Nachricht von den Bayonner Vorfällen« – der Entthronung des Königs von Spanien durch Napoleon – »erreichte, sagte der König: ›Mich soll Bonaparte wohl so nicht fangen!‹ Und nun gibt er sich seinem bittersten Feinde, Hände und Füße gebunden, hin, der ihn sicherlich, wofern Russland besiegt werden sollte, vom Throne stoßen, oder falls er selbst ein Unglück erfahren sollte, als Geisel bewahren wird. Freiwilliger und unbedingter hat sich wohl noch kein Herrscher unterworfen.« Damals hatte Gneisenau Friedrich Wilhelm III. um seinen Abschied aus der Armee gebeten – und ihn erhalten. Die »scheußlichen Folgen des Schandpaktes« hatte er »nicht in der Nähe mit ansehen« wollen.
Doch nicht nur der lebhafte, wortgewandte Gneisenau sagte sich vom König los. Auch andere Offiziere gingen und ebenso zivile Staatsdiener: Der Freiherr Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein hatte schon Ende 1808 das Beispiel gegeben. Er war nach Österreich gegangen. Karl Friedrich von dem Knesebeck, Anfang 1812 noch Sondergesandter in Wien und St. Petersburg, verließ Preußen im April. Im selben Jahr trat auch Ludwig August Friedrich Adolf von Chasôt, der ehemalige Berliner Stadtkommandant, in russische Dienste. Hermann von Boyen, vortragender Offizier im Kabinett, war am 8. November 1811 beim König um seine Entlassung eingekommen, fünf Tage nachdem sich Friedrich Wilhelm III. für das Bündnis mit Frankreich entschieden hatte. »Sollte ich«, hat Boyen rückschauend geschrieben, »in die Armee eintreten [und] für [Napoleon] kämpfen? Sollte ich bey einer damahlen wahrhaftig nicht unwahrscheinlichen gäntzlichen Zertrümmrung des Preußischen Staates mich ruhig diesem Schicksal ergeben und bey einem neuen uns von Napoleon gegebenen Fürsten um Dienste oder Pension betteln?« Auch Karl Ludwig Heinrich von Tiedemann, ein Freund des nachmals so berühmten Militärtheoretikers Carl von Clausewitz, der Boyens Nachfolger hätte werden sollen, ferner Friedrich zu Dohna, Schwiegersohn des Reformgenerals Gerhard Johann David von Scharnhorst, sowie zahllose Ungenannte begaben sich, von fremden Gesandten in Berlin mit Pässen versehen, über die Grenzen zum österreichischen Kaiser oder zum russischen Zaren. Am Ende war etwa ein Viertel der preußischen Offiziere gegangen, rund 500 an der Zahl.
Ihrer aller Beweggründe hat Clausewitz im Februar 1812 in einer Denkschrift dargestellt: »Man kann es bei aller Anhänglichkeit an die Regierung sich nicht verhehlen, dass vorzüglich der Mangel an Vertrauen zu ihr die Quelle der allgemeinen Muthlosigkeit ist«, schrieb er und: »Eben so wenig Vertrauen hat die Regierung gegen die Untertanen, ja sogar gegen sich selbst.« Von der Regierungspolitik, nach der Frankreich sich unterzuordnen für richtig und notwendig erachtet wurde, da dies »dem reinen Gefühl für das Wohl Aller entsprungen« oder gar »eins mit demselben« Gefühl sei, sagte sich Clausewitz »feierlich los«: »von der leichtsinnigen Hoffnung einer Errettung durch die Hand des Zufalls«; »von der kindischen Hoffnung, den Zorn eines Tyrannen durch freiwillige Entwaffnung zu beschwören [und] durch niedrige Unterthänigkeit und Schmeichelei sein Vertrauen zu gewinnen«; »von der falschen Resignation eines unterdrückten Geistesvermögens«; »von dem unvernünftigen Misstrauen in die uns von Gott gegebenen Kräfte«; »von der schamlosen Aufopferung aller Ehre des Staats und Volks, aller persönlichen und Menschen-Würde. Ich glaube und bekenne«, schrieb er, »dass ein Volk nichts höher zu achten hat als die Würde und Freiheit seines Daseins [und] die Ehre des Königs und der Regierung eins ist mit der Ehre des Volks und das einzige Palladium seines Wohls.« Diese Ehre hatten Friedrich Wilhelm III. und seine Regierung in seinen Augen verwirkt, auf das Wohl des Volkes hatten sie keine Rücksicht genommen. Die Zeichnung des »Unterwerfungsvertrags« auf Gnade und Ungnade war dafür nur der letzte Beweis. Am 31. März verließ Clausewitz Preußen unter Missbilligung des Königs, der ihm erst am 23. April den förmlichen Abschied gewährte.
Friedrich Wilhelm III. und seine Umgebung konnten und wollten die Beweggründe des Oberstleutnants – und aller anderen, die gingen – nicht verstehen. Bei den Herrschenden schürten die Ideen der Französischen Revolution Argwohn, die in Clausewitz’ Bekenntnis mitschwangen, die auch Gneisenau bewegten, Freiheit und Gleichheit vor allem, zumindest aber die geforderte Rücknahme monarchischer Absolutheit. »Ein politisches Programm, das darauf abgezielt hätte, die Französische Revolution durch rechtzeitige Reformen« – und Zugeständnisse an den Einzelnen, muss man hinzufügen – »für seinen Herrschaftsbereich obsolet zu machen, ging über den Horizont« des Königs und seiner Vertrauten, urteilte Thomas Stamm-Kuhlmann, der Biograph Friedrich Wilhelms III. Anders als Clausewitz und dessen Gesinnungsgenossen fürchtete sich der preußische König »vor der Mobilisierung der unteren Schichten, davor, daß man das ganze Gefüge des sozialen Aufbaus [der Gesellschaft] ins Wanken bringen könnte, wenn man die ›Massen‹ in Bewegung setzte«. Auf seine Untertanen, auf das Volk, die einfache, nichtadlige Bevölkerung wollte Friedrich Wilhelm sich nicht verlassen. Den »Massen« mochte er nichts schuldig sein und nichts zugestehen müssen. Eine »gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem matt gewordenen Glanz des Adels« war das Äußerste, »was der König an demokratischen Gefühlen« aufbringen konnte.
In Friedrich Wilhelms Kreisen vermochte man 1812 höchstens die Wut auf die französischen Besatzer zu tolerieren. Luise Radziwiłł dagegen, eine Tochter Prinz Ferdinands von Preußen und Großtante des Königs, duldete das Antinapoleonische in Clausewitz’ Haltung. An den Freiherrn vom und zum Stein schrieb sie: Clausewitz ginge als einer der Ersten, gewiss geleitet von reinen Motiven; und obgleich sie gut vertraut war mit den liberalen Gedanken Steins, Wilhelm von Humboldts und all der anderen, schloss sie ihren Brief mit dem Vorwurf gegen Clausewitz: »Ich glaube, dass er zu wenig Wert auf seine Untertanenpflicht legt« – er sich nicht respektvoll und – vor allem – nicht fügsam gegenüber seinem Fürsten verhält, sollte das heißen. »Wer also nicht verzweifelt an der Erhaltung des Staates auf dem Wege der Pflicht und der Ehre, wer nicht glaubt, dass nur die bedingungsloseste schändlichste Unterwerfung Pflicht sei, und dass es der Ehre nicht bedürfe, der ist ein Staatsverräther«, urteilte Clausewitz über solches Ansinnen.
Er ging nach Russland. Dort scharten sich viele der mit der preußischen Politik Unzufriedenen um den Freiherrn vom Stein, der seit seiner erzwungenen Absetzung 1808 am Hof des Zaren weilte. Alexander I. war auf dem Kontinent der einzige Fürst, der Napoleon noch Widerstand leistete, zunächst vorsichtig und verdeckt, schließlich ganz offen und energisch. Vom Erfolg der russischen Waffen hing 1812 Preußens Zukunft ab, für die Friedrich Wilhelm III. an der Seite des Zaren nicht zu kämpfen wagte – und auch sein Staatskanzler Karl August von Hardenberg nicht, der das Bündnis mit Frankreich ebenfalls für minder gefährlich hielt als eine Verbindung mit Russland.
Rund 244 000 Soldaten konnte das Russische Reich ins Feld stellen, keine geringe Zahl. Aber auf der Gegenseite stand Napoleons Grande Armée, 590 687 Mann stark auf dem Papier mit 157 878 Pferden und 1150 Kanonen, das größte Heer, das die Welt je gesehen hatte. Am 24. Juni marschierte diese Grande Armée mit 450 000 Soldaten und einem Tross von mehr als 75 000 Menschen in mehreren Kolonnen in Russland ein. Ganz im Süden, bei Lemberg, gingen die mit Frankreich verbündeten Österreicher unter Fürst Karl Philipp zu Schwarzenberg gegen die 3. russische Armee unter Alexander Petrowitsch Tormasow vor. In der Mitte der Front, zwischen Grodno und Brest-Litowsk, rückten Fürst Josef Poniatowskis V. (polnisches) Korps, Jean Louis Reyniers VII. (sächsisches) und Jérôme Bonapartes VIII. (westfälisches) Korps gegen die 2. russische Armee von Fürst Pjotr Iwanowitsch Bagration vor. Napoleon selbst marschierte nördlich davon mit seiner starken Hauptmacht auf Wilna zu, bestehend aus Louis-Nicolas Davouts I. Korps, dem III. Korps Michel Neys, dem IV. Eugène Beauharnais’, Laurent Gouvion Saint-Cyrs VI. und Joachim Murats Reservekavalleriekorps. Bei Wilna stand die 1. russische Armee unter Michail Barclay de Tolly und Zar Alexander. Napoleon wollte sie mit seinem Heer umfassen und zerschlagen, wenigstens aber zwingen, zu kapitulieren. Doch das misslang. Mit Pyrrhussiegen und unter schweren Verlusten drängten Napoleons Truppen die nicht zu fassenden Russen daraufhin immer weiter ins Land – bis nach Moskau.
Unabhängig und etwas abgesetzt bewegte sich ganz im Norden, von Ostpreußen aus, Jacques Joseph Alexandre Macdonalds X. Korps auf Riga zu. Es bestand aus zwei Divisionen, deren eine, die 27., ganz aus den preußischen Hilfstruppen gebildet war. Die Division umfasste sechs Regimenter Infanterie, sechs Regimenter Kavallerie und siebeneinhalb Batterien Artillerie. Sie wurde kommandiert von dem General Julius August Reinhold von Grawert als erstem, dem General Hans David Yorck von Wartenburg als zweitem Befehlshaber.
Grawert war ein Mann Friedrich Wilhelms III. und Napoleon ehrfurchtsvoll zugetan; der französische Kaiser hatte ihn für das Kommando bestimmt. Der General kämpfte aus Überzeugung an der Seite der Franzosen. »Er sah in Napoleon und dessen Handlungen etwas Übermenschliches und in den Feldherren Davoust und Macdonald die Jünger eines Propheten.« Grawert hoffte, an ihrer Seite Preußens Ansehen durch Siege über Russland zurückzugewinnen. »Wir können es uns nicht leugnen, daß von dem Benehmen unseres Korps das künftige Schicksal unseres Staates abhängt, sowie, daß diese Gelegenheit, wenn sie mit gehöriger Kraft benutzt wird, den alten preußischen Waffenruhm wiederherstellen und uns von neuem die Achtung der übrigen Mächte sichern kann«, schrieb er am 29. März an seinen Stellvertreter Yorck. Auf den Sieg der preußischen Truppen im ersten Gefecht des Krieges am 19. Juli bei Eckau und auf Macdonalds Anerkennung für diese Leistung war Grawert stolz. Dass seine Einstellung Preußen in der Abhängigkeit Frankreichs hielt, bedachte er nicht. Von Frankreich abzufallen wäre ihm nie in den Sinn gekommen.
Aber Yorck und fast alle anderen Offiziere waren wenig überzeugt von der Sache, für die sie kämpfen sollten, und schon gar nicht begeistert. Johann Gustav Droysen hat Yorck, 1812 eine Schlüsselfigur für den Fortgang der preußischen Geschichte, als standfesten Gegner Napoleons und jeglicher französischen Verführung porträtiert. »Den Marschall Macdonald, als seinem Korpschef, machte Yorck, als er in Königsberg eintraf, seine Aufwartung; er sah ihn vorübergehend in Tilsit wieder; dann während des weiteren Feldzuges seltene Male, ›und ich glaube nicht‹, sagte ein Offizier von Yorcks Umgebung, ›dass sie bei den seltenen Gesprächen aus den Formen der Geschäfte und konventionellen Höflichkeiten herausgekommen sind‹.« Yorck selbst schrieb viele Jahre später in einer Denkschrift: »Ich musste ins Feld rücken, in einen Kampf gegen mein Gefühl und unter so widrigen Verhältnissen, dass nur meine Unterwürfigkeit gegen den stets mir heiligen Willen meines Königs mir Gehorsam gebot.« Dieser strikte Gehorsam gegenüber dem königlichen Willen unterschied ihn von Gneisenau, Clausewitz und vielen anderen preußischen Offizieren und brachte ihn jetzt in eine Zwangslage. »Der erste Teil des Feldzuges von 1812 war sehr niederdrückend für mich; mein Obergeneral hatte ganz andere und leidenschaftliche Ansichten über die öffentlichen Verhältnisse als ich.«
Es war ein glücklicher Zufall für Preußen, dass Yorck am 13. August das Kommando über die Truppen übernahm, weil der General Grawert an »einer bedeutenden Abspannung, bei welcher das Gemüt im Spiel ist«, litt, »welcher abzuhelfen«, so der Generalchirurg der Division, »die Entfernung [des Generals] von [den] Geschäften, wenn auch nur für kurze Zeit, durchaus nötig ist«. Ein Glück auch, dass Grawert nicht zurückkehrte und Yorck das Kommando behielt.
Yorcks Abneigung gegen Napoleons Feldzug war damals noch nicht offensichtlich, zumal er im Grunde als Adliger auch den antiständischen Patrioten, vor allem Gneisenaus generellen Gemeinsinn, kritisch gegenüberstand. Aus seinen Aufzeichnungen geht zunächst Stolz auf die gewonnenen Gefechte seiner Preußen hervor. Darin glich er Grawert. Für die auf russischer Seite umgekommenen oder verwundeten Exilpreußen zeigte er keinerlei Mitleid. Zum Tod des Oberstleutnants von Tiedemann, einem preußischen Patrioten, der zu Yorcks Missfallen immer wieder versucht hatte, preußische Truppenteile zur Kapitulation zu bewegen, und preußische Gefangene, Offiziere wie Soldaten, überredete, in die russisch-deutsche Legion einzutreten, schrieb er: »Dieser Mann ist bei dem Gefecht [von Dahlenkirchen] das Opfer seiner Leidenschaft und seiner politischen Meinung geworden … schon nach dem Gefecht bot er einem blessierten auf der Erde liegenden [preußischen] Jäger Pardon an, der sich aber bei seinem Anblick wütend erhob und ihn in den Leib schoss, an welcher Wunde er 24 Stunden nachher unter den größten Qualen gestorben ist. Übrigens ist es gut, dass er tot ist; wir werden jetzt mehr Ruhe haben.« Daraus spricht wenig Verständnis für die preußischen Patrioten und deren Sicht auf die Verhältnisse.
Erst der Argwohn Friedrich Wilhelms III. hat Yorck die »Unterwürfigkeit gegen den ihm heiligen Willen seines Königs« vergessen lassen. Obwohl der König lobte, »dass Meine braven Truppen … sich neue Ansprüche auf die hohe Achtung der Waffenbrüder und der Alliierten erworben haben«, und obwohl ihm das eine Auszeichnung einbrachte, sah er sich von den Adjutanten des Königs überwacht. Gegenüber Graf Wilhelm Ludwig Viktor Henckel von Donnersmarck, Friedrich Wilhelms Flügeladjutanten, der ihm den Roten Adlerorden erster Klasse überbrachte, hat Yorck dies deutlich erkennen lassen: »Der König schickt Sie her, zu spionieren, wie die Sachen hier betrieben werden, und Rapports von den Details zu machen, die ich vielleicht nicht berichte.« Wie wir aus Henckels Erinnerungen wissen, lag er damit richtig.
Auch Macdonald misstraute York, allerdings erst spät: »Ich kenne die Anlässe nicht, welche Ew. Exzellenz seit lange erbittert haben gegen den Kaiser, gegen Frankreich, gegen die französischen Generale und gegen die französische Armee. Ich verkenne keine der täglich sich wiederholenden Wendungen, die dahin zielen, die Meinungen irrezumachen und die Entmutigung unter den Führern und Truppen zu verbreiten. Aber unzweifelhaft werden sie auf den guten Geist, die Tüchtigkeit und das Ehrgefühl, die die Truppen beleben, ohne Einfluss sein«, warnte er den preußischen General am 27. November. »Ich habe zu viel Freimütigkeit, als dass ich Ihnen nicht mitteilen sollte, das ich Sr. Majestät dem Kaiser über das Betragen und die Gesinnung des gegenwärtigen Chefs der preußischen Truppen Rechenschaft gebe, die man nicht unterlassen wird, dem Könige [von Preußen] vorzulegen.« Henckel von Donnersmarck, der von Macdonalds Missmut wusste, empfahl Friedrich Wilhelm III. daraufhin die Absetzung Yorcks.
Dem General wäre seine Abberufung zu diesem Zeitpunkt sogar recht gewesen. Sie hätte ihm den Loyalitätskonflikt, die Entscheidung »König oder Vaterland«, erspart. Schon früh wusste er durch Magnus von Essen, den Gouverneur von Riga, von der Katastrophe der Grande Armée. Am 1. November hatte der General ihm geschrieben, Napoleon sei gezwungen worden, Moskau zu verlassen, seine Armee befinde sich in Auflösung, der Rückweg sei ihr verlegt, die Soldaten und der französische Kaiser gingen ihrem vollständigen Untergang entgegen. Von Essen hatte vorgeschlagen, Macdonald festzunehmen und von den Franzosen abzufallen. Yorck hatte diesen Vorschlag am 5. November an Friedrich Wilhelm III. weitergeleitet, aber noch keine Antwort erhalten, als Essens Nachfolger, Philipp Osipowitsch Paulucci, eine Woche später das Ansinnen wiederholte und Yorck umwarb mit den Worten: »Sie werden der Befreier Ihres Vaterlandes sein.« Der General müsse dazu auf die russische Seite übertreten oder seine Truppen hinter die Memel zurückziehen und alle weiteren Bewegungen unterlassen. »Ich offeriere Ihnen die Mitwirkung meiner Armee zur gemeinschaftlichen Vertreibung der grausamen Bedrücker, welche Preußen genötigt haben, an den unsinnigen Plänen Napoleons teilzunehmen; ich schlage Ihnen vor, gemeinschaftlich mit mir Ihrem König seine Gewalt zu restituieren und dann Deutschland von den Schrecken des Barbaren zu befreien«, hatte auch der General Peter Wittgenstein an Yorck geschrieben.
Yorck nahm die Schreiben als »schmeichelhaftes Zeichen des Vertrauens … in die Loyalität meines Charakters«. Er zögerte aber zu handeln: »Die Sachen stehen noch so, dass ich jetzt mehr denn je gegen meinen König und gegen das Vaterland verpflichtet bin, mit der größten Vorsicht zu Werke zu gehen«, beschied er am 26. November Wittgenstein, und Paulucci ließ er am 5. Dezember wissen, der Inhalt seines Schreibens sei so wichtig, »dass es erst einer genauen Beratung und Prüfung bedarf, ehe ich darauf antworten kann. Ich muss daher um eine kleine Frist bitten.« Paulucci vermutete richtig, dass Yorck sich in Berlin rückversichern wollte. Tatsächlich schickte der General seinen Adjutanten Major Florian von Seydlitz, einen Mann, der sein ganzes Vertrauen besaß, in die preußische Hauptstadt, »die Entschließung Sr. Majestät zu erbitten«. Yorck erhoffte sich vom König oder vom Staatsminister einen Hinweis, und sei er noch so klein, wie er nun handeln sollte.
Er bekam keinen. In Berlin wartete man darauf, dass sich »andere politische Verhältnisse« aufklärten, damit »die Politik Preußens sich ändern könne«. Das konnte angesichts der allgemeinen europäischen Lage nur bedeuten, dass Österreich – nicht Preußen – den ersten Schritt weg von Frankreich wagen sollte. Nach einer gut verbürgten mündlichen Überlieferung, so berichtet Droysen, der noch mit den Zeitzeugen gesprochen hatte, soll Friedrich Wilhelm III. Seydlitz, der definitive Befehle an Yorck erbat, geantwortet haben: »Aber nicht über die Schnur hauen«, und als Seydlitz um eine etwas präzisere Weisung nachsuchte: »Napoleon sei ein großes Genie, wisse immer Hilfsmittel zu finden.« Weil dies diffus und unerforschlich war, fragte Yorcks Adjutant zum dritten Mal: »Ob, wenn der Untergang der französischen Macht so vollständig sei, wie man vermuten müsse, der König gebiete, dass Yorck streng bei der Allianz verharre, sein General bitte flehentlich um des Königs Befehle, wie er handeln solle.« Darauf habe Friedrich Wilhelm III. geantwortet: »Nach den Umständen.« Mit dieser Auskunft war Seydlitz entlassen. Eine eindeutige, unmissverständliche Anweisung war das nicht, vielmehr lassen sich mangelndes Verantwortungsbewusstsein, bestenfalls Unsicherheit, auf alle Fälle Unentschlossenheit aus der Replik des Königs herauslesen. Yorck hat jedenfalls keine geheime Instruktion erhalten, wie bald schon Gerüchte verbreiteten. Einige Zeit später wurden daraus Behauptungen, die noch heute gerne aufgestellt werden, wenn man dem König und Hardenberg Weitsicht und politische Klugheit attestieren will. Einen Befehl gab Friedrich Wilhelm III. aber erst Jahre später, als ihm Seydlitz’ Memoiren, das Tagebuch von 1812, zur Zensur vorgelegt und des Königs Unentschlossenheit und Ausweichen offenbar wurden: »Der Nichtexistenz geheimer Instruktionen für den General Yorck darf keine Erwähnung geschehen«, beschied er da.
Ohne Anordnung aus Berlin musste Yorck nach eigenem Gutdünken handeln und damit in alleiniger Verantwortung anstelle des Königs, der sich drückte, Entscheidungen über die Zukunft seines Vaterlandes zu treffen. Der Zar, nicht sein König, erleichterte Yorck diese schwierige Aufgabe. Über Paulucci ließ Alexander dem General ausrichten: Er sei geneigt, mit Friedrich Wilhelm III. »einen Vertrag zu machen, in dem festgestellt würde und Ich gegen ihn die Verpflichtung übernähme, nicht eher die Waffen niederzulegen, als bis es mir gelungen wäre, für Preußen eine Gebietsvergrößerung durchzusetzen, groß genug, um es unter den Mächten Europas die Stelle wieder einnehmen zu lassen, die es vor dem Kriege von 1806 gehabt hat«. Im Vertrauen auf diese Versicherung begab sich Yorck am Weihnachtsabend zwischen die preußischen und russischen Vorposten zu einer Unterredung mit dem General Hans Karl von Diebitsch auf der Gegenseite.
Der russische General erschien jedoch nicht alleine, sondern in Begleitung von Clausewitz. Es war die entscheidende Situation, denn mit Clausewitz trat, wie Droysen treffend formulierte, »ein Repräsentant jener Richtungen, die Napoleon mit dem ›Unterwerfungsvertrage‹ gebrochen zu haben glaubte, unterhandelnd jetzt dem gegenüber, der mit König und Vaterland auch in schwersten Stunden auszuharren für Pflicht gehalten«. Und er fuhr fort: »Wir kennen Yorcks strenge Begriffe von Gehorsam, von militärischer Pflicht. Er hatte bewiesen, in welchem Maße er sich ihnen unterwarf. Doppelt scharf schnitt in sein Gewissen die Alternative ein, die ihm jetzt vorlag.« Nun zeigte sich, dass Yorck, »der, von Kindheit an Militär …, nie Gelegenheit gehabt, die vielfachen Verschlingungen der Politik zu erlernen«, wie er selbst von sich sagte, unter außergewöhnlichen Umständen für einen kurzen, aber bedeutenden Moment ein ebenso politischer Offizier war wie Clausewitz. Yorck verhandelte aus der Einsicht, dass dies nicht nur das Beste für seine Soldaten, sondern vor allem für den Staat sei.
»Ihr habt mich. Sagt dem General Diebitsch, dass wir uns Morgen früh auf der Mühle von Poscherun sprechen wollen und dass ich jetzt fest entschlossen bin mich von den Franzosen und ihrer Sache zu trennen«, beschied Yorck dem drängenden Clausewitz. Am 30. Dezember schloss er dann bei den russischen Vorposten nahe Tauroggen eine Konvention mit Russland ab. Wie Clausewitz hielt er den Zeitpunkt für gekommen, »wo wir unsere Selbständigkeit wiedergewinnen können, wenn wir uns mit dem russischen Heere vereinigen«. Die Konvention bestimmte die preußischen Truppen, den Landstrich zwischen Memel, Tilsit und dem Kurischen Haff zu besetzen und dort teilnahmslos so lange stehenzubleiben, bis der König entschieden hatte, ob man an der Seite der Franzosen weiterfechten, neutral bleiben oder sich den Russen anschließen sollte. Damit separierte die Konvention Preußen von Frankreich.
Man muss die Entscheidung Yorcks ausdrücklich würdigen. Er hat sie eigenmächtig, trotz der Gefahr, in Ungnade zu fallen, gegen den bekundeten und selbst gegen den wahrscheinlichen Willen Friedrich Wilhelms III. getroffen; der hatte ihm zuletzt von »Meinem und des Kaisers von Frankreich engverbundenem Interesse« geschrieben. Der Präsident des Breslauer Landes-Oeconomie-Collegiums, Ernst Freiherr von Lüttwitz, war öffentlich mit Gefängnis bestraft worden, weil er gewagt hatte, dem König zu schreiben: »Es ist Stimme des Volkes, dass, wenn auch der König seine Selbständigkeit aufgeben wollte, dennoch der Anspruch des Volkes auf Unabhängigkeit ein nicht zu verjährendes Recht des Volkes verbleibe, [und] dass aus diesem Recht die Verpflichtung der Nation folge, auch ohne Verlangen des Königs demselben die verlorene oder aufgegebene Selbständigkeit muthig zu erringen.« Lüttwitz hatte Friedrich Wilhelm III. durch diese Rede vor seinen Untertanen bloßgestellt. Yorck musste deshalb damit rechnen, vors Kriegsgericht zitiert und verurteilt zu werden.
Er wusste sehr wohl, dass er sein Leben und seine Ehre aufs Spiel gesetzt hatte. »Ihr habt gut reden, ihr jungen Leute, mir Alten aber wackelt der Kopf auf den Schultern«, äußerte er seinen Offizieren gegenüber. »Geht unser Vorhaben gut, so wird der König mir meinen Schritt vielleicht vergeben; geht es misslich, so ist mein Kopf verloren.« Doch endete seine Rede entschlossen: »So möge denn unter göttlichem Beistand das Werk unserer Befreiung beginnen und sich vollenden.« Unverzüglich sandte er seinen Adjutanten Major Adolf Eduard von Thile (II) zum König mit der von ihm selbst, Diebitsch und Clausewitz – alle drei gebürtige Preußen – unterschriebenen Konvention und einem Begleitschreiben, in dem er seine Handlungsweise erläuterte. Es schloss mit den Worten: »Ew. Majestät lege ich willig meinen Kopf zu Füßen, wenn ich gefehlt haben sollte; ich würde mit der freudigen Beruhigung sterben, wenigstens nicht als treuer Unterthan und wahrer Preuße gefehlt zu haben. Jetzt oder nie ist der Zeitpunkt, wo Ew. Majestät sich von den übermüthigen Forderungen eines Alliierten losreißen können, dessen Pläne mit Preußen in ein mit Recht Besorgniss erregendes Dunkel gehüllt waren, wenn das Glück ihm treu geblieben wäre. Diese Ansicht hat mich geleitet, gebe der Himmel, dass sie zum Heil des Vaterlandes führt!« Er hatte sich bewusst und eindeutig entschieden: Für das Vaterland und gegen den König.
Friedrich Wilhelm III. reagierte, wie zu erwarten war: Er setzte Yorck ab, nachdem er am 2. Januar von dessen Konvention erfahren hatte, wollte ihn gar festnehmen lassen. Dass ein General Preußens Politik bestimmte, war ihm unerträglich. »Ich ernenne Sie hierdurch zum kommandierenden General des Corps und trage Ihnen auf, den General von Yorck zu verhaften«, schrieb der König am 6. Januar 1813 an den General Friedrich Heinrich von Kleist, Yorcks Stellvertreter. »Da das mobile Corps Seiner Majestät dem Kaiser von Frankreich gänzlich zur Disposition gestellt ist, so kann Ich Sie auch lediglich an die Befehle des Königs von Neapel, seines jetzigen Stellvertreters, zurück verweisen und erwarte von Ihrer bewährten Klugheit und treuen Ergebung, dass Sie bemüht sein werden, das Geschehene möglichst gutzumachen.«
Doch die Dinge ließen sich nicht mehr aufhalten, der Befehl an Kleist sich nicht durchsetzen. Dieser weigerte sich nämlich, das Kommando über das Korps zu übernehmen, zu groß war der allgemeine Jubel. Die Nachricht vom Abschluss der Konvention hatte unter den Soldaten des preußischen Hilfskorps »höchsten Enthusiasmus« ausgelöst. Wie Leopold von Ranke, der große Historiker des 19. Jahrhunderts, es ausdrückte, ist die Konvention »dem weit Entfernten wie ein Blitzstrahl erschien[en], der den Gesichtskreis durchzuckte«, nur nicht dem König, dem einzig einfiel, auf Mittel zu sinnen, wie diesen »unüberlegten Meinungen und Handlungen … amtlich zu begegnen sei«. Zum Glück sei Friedrich Wilhelm III. aber nicht mehr in der Lage gewesen, die Begeisterung zu unterdrücken, die sich beinahe aller Gemüter bemächtigt habe, bemerkte der englische geheime Gesandte Ludwig von Ompteda. Anders als der König waren die Untertanen schon im September und Oktober des Jahres 1812 der Meinung gewesen, dass Napoleon den Krieg trotz seiner Siege und der Einnahme Moskaus verlieren werde. Begierig hatten sie auf Nachrichten gewartet, die dieses Gefühl bestätigten. Die Menschen hofften, dass Gneisenau mit »Geld und Kraft« aus England zurückkommen würde, um die in Russland aufgestellte Deutsche Legion gegen die Franzosen zu führen. Im Januar 1813, so Droysen, war das »Jetzt oder nie« dann in jedermanns Seele. »Jetzt oder nie ist der Moment, Freiheit, Unabhängigkeit und Größe wiederzuerlangen«, hatte Yorck dem König am 3. Januar geschrieben.
Als in den Berliner Zeitungen vom 19. Januar verkündet wurde, Friedrich Wilhelm III. habe bei der unerwarteten Nachricht der Kapitulation (!) des Yorckschen Korps den höchsten Unwillen empfunden und verfügt, die Truppen sollten »nach dem Inhalte des mit Frankreich abgeschlossenen Traktates zur alleinigen Disposition des Kaisers Napoleon oder seines Stellvertreters des Königs von Neapel verbleiben«, waren Enttäuschung und Unmut der Bevölkerung groß. In Ostpreußen verbreitete sich »allgemeines Missvergnügen«, schwoll die »bittere Stimmung« mächtig an. Bei längerem Zaudern war ein Gutteil der Bevölkerung bereit, mit den Russen zu gehen, was bedeutete, man würde diese Menschen verlieren, sich auf solche Weise verzetteln. Mit Theodor von Schön, dem Regierungspräsidenten von Gumbinnen, verabredete Yorck deshalb, »daß man einzelne Aufstände nicht fördern, sondern die Sache nur im Ganzen aufnehmen« wolle.