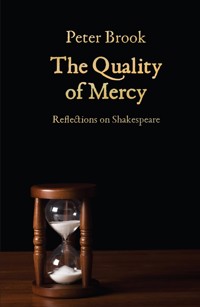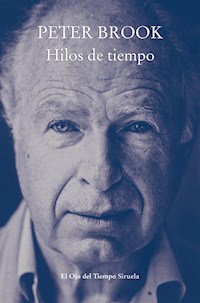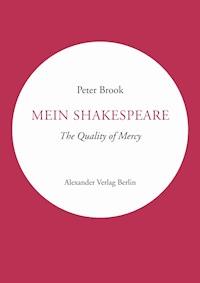15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der leere Raum ist der Klassiker unter den Büchern zum Theater. Es basiert auf vier Vorlesungen, die Peter Brook unter dem Titel The Empty Space: The Theater Today in den sechziger Jahren an den Universitäten von Hull, Keele, Manchester und Sheffield hielt. 1968 erschienen diese Gedanken zum Gegenwartstheater in Buchform. Nachdem der Band für längere Zeit vergriffen war, machte ihn der Alexander Verlag 1983 wieder greifbar für das deutsche Publikum. Brook unterteilt das Theater in vier verschiedene Formen: Das konventionelle Theater definiert er als "tödlich", das an Ritualen festhaltende Theater als das "heilige", das leicht verständliche, volksnahe Theater als "derbes" und das von ihm favorisierte als "unmittelbares Theater".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Peter Brook, Der leere Raum
Peter Brook, geb. 1925 in London, zählt zu den besten und bekanntesten Regisseuren der Welt. Seinen besonderen Ruf begründete er mit eigenwilligen Shakespeare-Interpretationen und radikalen Inszenierungen zeitgenössischer Bühnenstücke, so von Genet, Dürrenmatt, Weiss und Williams. 1962 wurde er Kodirektor der Royal Shakespeare Company und gründete gleichzeitig eine eigene experimentelle Gruppe – das Lamda Theatre. 1968 erschien sein Buch Der leere Raum, der »Klassiker der Theaterliteratur. Kaum ein anderes Buch hat für das Theater ähnliche Bedeutung erlangt.« DISKURS
Seit 1970 lebt Peter Brook in Paris und arbeitet mit einem international besetzten Ensemble, das seine Aufführungen im Théâtre des Bouffes du Nord und auf zahlreichen Tourneen im Ausland zeigt.
www.bouffesdunord.com
Peter Brook
Der leere Raum
Aus dem Englischen von Walter Hasenclever
Alexander Verlag Berlin
Die Originalausgabe erschien 1968 unter dem Titel
»The Empty Space« bei MacGibbon & Kee Ltd, London.
Re-issued by Granada Publishing in Hart-Davis,
MacGibbon Ltd, 1977.
© Peter Brook 1968.
13. Auflage
© der deutschsprachigen Ausgabe Alexander Verlag Berlin 1983
Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, D -14050 Berlin
www.alexander-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlag: Michael Klein, Stefan Wewerka, Köln, unter Verwendung
einer Zeichnung von Oskar Schlemmer (aus: O. Schlemmer,
L. Moholy-Nagy, F. Molnar, »Die Bühne im Bauhaus«, mit freundlicher
Genehmigung des Florian Kupferberg Verlags, Mainz/Berlin).
ISBN 978-3-89581-415-0 (eBook)
Für meinen Vater
Dieses Buch basiert auf vier Vorlesungen, die Peter Brook unter dem Titel »The Empty Space: The Theatre Today« an den Universitäten von Hull, Keele, Manchester und Sheffield gehalten hat.
Inhalt
IDas tödliche Theater
IIDas heilige Theater
IIIDas derbe Theater
IVDas unmittelbare Theater
Werkverzeichnis
I
Das tödliche Theater
Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen. Ein Mann geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist. Allerdings, wenn wir vom Theater sprechen, meinen wir etwas anderes. Rote Vorhänge, Scheinwerfer, Blankverse, Gelächter, Dunkelheit – alles dies ist wahllos zu einem wirren Bild übereinanderkopiert und unter einen Allzweckbegriff subsumiert. Wir sprechen davon, daß der Film der Tod des Theaters sei und beziehen uns mit diesem Satz auf das Theater zur Zeit der Entstehung des Films, ein Theater mit Kasse, Foyer, Klappsesseln, Rampenlichtern, Szenenwechsel, Pausen, Musik, als sei das Theater wesentlich das und wenig mehr.
Ich will versuchen, den Begriff vierfältig aufzuspalten und ihn durch vier verschiedene Definitionen zu kennzeichnen – will daher von einem »tödlichen Theater«, einem »heiligen Theater«, einem »derben Theater« und einem »unmittelbaren Theater« sprechen. Manchmal sind diese vier Theaterarten tatsächlich vorhanden und nahe benachbart: im Westen von London oder in New York unweit Times Square. Manchmal gibt es sie Hunderte von Meilen voneinander entfernt, das Heilige in Warschau, das Derbe in Prag, und manchmal sind sie metaphorisch: zwei gehen an einem Abend, in einem Akt ineinander auf. Manchmal sind einen einzigen Augenblick lang alle vier, das Heilige, Derbe, Unmittelbare und Tödliche, ineinander verwebt.
Das tödliche Theater kann man auf den ersten Blick daran erkennen, daß es schlechtes Theater ist. Da es die Theaterform darstellt, die wir am häufigsten zu sehen bekommen, und da es dem verachteten, viel geschmähten kommerziellen Theater am nächsten steht, könnte jede weitere Kritik wie Zeitvergeudung erscheinen. Aber wir müssen erst sehen, wie das Tödliche täuschen und überall auftreten kann, um das Problem in seinem Umfang zu begreifen.
Die Lage des tödlichen Theaters ist zumindest ziemlich offenkundig. In der ganzen Welt hat sich das Theaterpublikum verringert. Es gibt gelegentlich neue Bewegungen, gute neue Schriftsteller und so weiter, aber im großen und ganzen fehlt dem Theater nicht nur die Erhebung und Belehrung, sondern auch die Unterhaltung. Man hat das Theater oft eine Hure genannt, womit man meinte, daß die Kunst unrein ist, aber heute bewahrheitet sich das in einem anderen Sinne – Huren bieten für das gezahlte Geld nur spärliche Lust. Die Broadway-Krise, die Paris-Krise, die West-End-Krise sind sich gleich: es bedarf nicht der Theaterkassen, um festzustellen, daß das Theater ein tödliches Geschäft geworden ist und das Publikum den Braten riecht. Wenn das Publikum wirklich einmal die Unterhaltung verlangte, von der es so oft spricht, dann wüßten wir alle kaum, woher nehmen und nicht stehlen. Ein richtiges Theater der Freude existiert nicht, und nicht nur die Trivialkomödie oder das schlechte Musical bleiben uns etwas schuldig – das tödliche Theater findet tödlichen Eingang in die Große Oper, die Tragödie, die Dramen Molières und die Stükke Brechts. Selbstverständlich nistet es sich nirgends so sicher, behaglich und listig ein wie bei William Shakespeare. Das tödliche Theater kommt leicht zu Shakespeare. Wir sehen seine Stücke mit guten Schauspielern und scheinbar richtig inszeniert – sie geben sich lebendig und farbig, man spielt Musik, und alle sind in feiner Kluft, wie es sich im besten klassischen Theater gehört. Aber insgeheim finden wir’s sterbenslangweilig und schieben’s im Herzen entweder auf Shakespeare oder das Theater als solches oder gar auf uns selber. Denn zu allem Unglück gibt es auch immer einen tödlichen Zuschauer, der aus besonderen Gründen die mangelnde Intensität oder sogar Unterhaltung begrüßt, wie zum Beispiel den Gelehrten, der die Routineaufführungen eines Klassikers mit einem Lächeln verläßt, weil ihn nichts im Wiederkäuen und Bekräftigen seiner Lieblingstheorien gestört hat, wenn er seine Lieblingszitate leise mitsprach. Im Herzen wünscht er sich sehnlichst ein Theater, das edler ist als das Leben und verwechselt eine Art intellektueller Befriedigung mit dem wahren Erlebnis, das er erstrebt. Unseligerweise leiht er das Gewicht seiner Persönlichkeit der Langeweile, und so geht das tödliche Theater munter weiter.
Wenn man die jährlich herauskommenden großen Theatererfolge betrachtet, dann gerät man einem seltsamen Phänomen auf die Spur. Man erwartet, daß der sogenannte Hit lebhafter, rascher, spritziger ist als der Durchfall – aber das stimmt nicht immer. In fast jeder Spielzeit gibt es in den meisten theaterfreudigen Städten einen großen Erfolg, der dieser Regel zuwiderläuft: ein Stück kommt an, nicht obgleich, sondern weil es langweilig ist. Schließlich verbindet man mit der Kultur ein gewisses Pflichtgefühl, historische Kostüme und lange Reden mit dem Gefühl der Langeweile: also ist das richtige Maß an Langeweile nur die beruhigende Garantie für ein lohnendes Ereignis. Natürlich ist diese Dosis so schlau bemessen, daß man unmöglich eine genaue Formel dafür finden kann – zu viel, und das Publikum wird aus den Sitzen gescheucht, zu wenig, und es findet vielleicht das Theater unangenehm eindringlich. Aber mittelmäßige Autoren scheinen sich ohne Fehl auf die richtige Mischung zu verstehen – und sie verewigen das tödliche Theater mit öden Erfolgsstücken, die aber allgemein gepriesen werden. Das Publikum giert nach etwas im Theater, das es als »besser« bezeichnen kann als das Leben, und ist aus diesem Grunde bereit, die Kultur, oder ihre Requisiten, mit etwas zu verwechseln, was es nicht kennt, von dem es aber dunkel spürt, daß es existieren könnte – und dadurch, daß es etwas Schlechtes zum Erfolg erhebt, betrügt es tragischerweise nur sich selbst.
Wenn wir von »tödlich« sprechen, wollen wir zu bedenken geben, daß der Unterschied zwischen Leben und Tod, der beim Menschen so kristallklar ist, auf anderen Gebieten etwas im Zweifel bleibt. Ein Arzt kann auf der Stelle zwischen Spuren des Lebens und dem nutzlosen Knochensack unterscheiden, den das Leben verlassen hat. Dagegen fällt uns die Beobachtung viel schwerer, wie eine Idee, eine Auffassung oder eine Form den Übergang vom Lebendigen zum Todgeweihten vollzieht. Es ist schwer zu definieren, aber dennoch kindlich leicht. Hier ein Beispiel. In Frankreich gibt es zwei Schulen, die klassische Tragödie zu spielen. Eine ist unverblümt traditionell, und das bedeutet eine besondere Stimmlage, ein besonderes Gebaren, einen edlen Blick und eine gehobene musikalische Deklamation. Die andere Schule bringt nicht mehr als eine etwas andere und lauere Fassung derselben Sache. Majestätische Gesten und königliche Werte verschwinden schnell aus dem alltäglichen Leben; daher findet jede neue Generation den großen Stil immer hohler und sinnloser. Deshalb begibt sich der junge Schauspieler auf eine zornige und ungeduldige Suche nach dem, was er Wahrheit nennt. Er will seine Verse realistischer ausspielen, will sie wie echte, unverfälschte Rede klingen lassen, findet jedoch, daß das Geschriebene in seiner Formalität so starr ist, daß es sich seinen Versuchen widersetzt. Er wird zu einem unbefriedigenden Kompromiß gezwungen, dem weder die Frische der natürlichen Rede eigen ist noch das trotzig Histrionische dessen, was wir Schmiere nennen. Daher wirkt sein Spiel schwach, und da die Schmiere stark ist, gedenkt man ihrer mit einer gewissen Wehmut. Zwangsläufig verlangt jemand, daß die Tragödie so gespielt wird, »wie sie geschrieben ist«. Das läßt sich durchaus hören, nur kann uns leider das gedruckte Wort allein verraten, was aufs Papier gesetzt wurde, nicht wie man es einst zum Leben erweckt hat. Es gibt keine Schallplatten, keine Tonbänder – nur Fachleute, die aber ihre Kenntnis selbstverständlich auch nicht aus erster Hand haben. Das echte Alte ist ganz verloren – nur einige Imitationen sind erhalten geblieben, in Gestalt traditioneller Schauspieler, die immer noch im traditionellen Stil spielen und ihre Inspirationen nicht aus alten Quellen beziehen, sondern aus eingebildeten, wie der Erinnerung an die Töne eines verflossenen Schauspielers – Töne, die ihrerseits der Erinnerung an den Stil eines Vorgängers entstammten.
Ich habe einmal eine Probe in der Comédie Française miterlebt – ein ganz junger Schauspieler stand vor einem sehr alten und sprach und mimte die Rolle mit ihm wie ein Spiegelbild. Man sollte so etwas nicht mit der großen Tradition etwa der No-Spieler verwechseln, die ihr Wissen mündlich vom Vater auf den Sohn überliefern. Dort ist es ein Inhalt, der überliefert wird – und ein Inhalt gehört nie der Vergangenheit an. Er kann im gegenwärtigen Erleben eines jeden Mannes nachgeprüft werden. Aber die Nachahmung der schauspielerischen Äußerlichkeiten verewigt nur die Manier, die man kaum zu irgend etwas in Beziehung setzen kann.
Auch bei Shakespeare hören oder lesen wir immer die Mahnung: »Spiele, was geschrieben steht.« Aber was steht geschrieben? Gewisse Zeichen auf Papier. Shakespeares Worte sind Aufzeichnungen der Worte, die er sprechen lassen wollte, Worte, die als Laute aus dem Mund der Menschen kommen, mit Stimmlage, Pause, Rhythmus und Geste als Bestandteilen des Sinns. Ein Wort beginnt nicht als Wort – es ist ein Endprodukt, das als Impuls anfängt und, durch Überzeugung und Verhalten beflügelt, den notwendigen Ausdruck findet. Dieser Vorgang spielt sich im Schriftsteller ab und wiederholt sich im Innern des Schauspielers. Beide sind sich vielleicht nur der Worte bewußt, aber für beide, den Autor und den Schauspieler, ist das Wort nur ein kleines sichtbares Teilchen eines riesigen unsichtbaren Gebildes. Manche Dramatiker bemühen sich, ihre Sinngebung und Absichten in Bühnenanweisungen festzulegen, aber uns fällt unweigerlich auf, daß sich die besten Dramatiker am wenigsten erklären. Sie erkennen, daß weitere Anweisungen höchstwahrscheinlich zwecklos sind. Sie erkennen, daß die einzige Methode, den wahren Zugang zum Wort zu finden, in der Wiederholung des ursprünglichen Schöpfungsvorgangs liegt. Das läßt sich nicht umgehen oder vereinfachen. Unseligerweise beeilen wir uns, sobald ein Liebender spricht oder ein König sich äußert, diesen ein Schildchen umzuhängen: der Liebende ist »romantisch«, der König ist »edel« – und ehe wir’s merken, sprechen wir von romantischer Liebe und königlichem Edelmut oder von fürstlichem Gebaren, als seien das Dinge, die man in der Hand halten und deren Darstellung man von den Schauspielern verlangen kann. Aber sie sind nicht gegenständlich und existieren nicht. Wenn wir nach ihnen suchen, dann halten wir uns am besten an hypothetische Rekonstruktionen nach Büchern oder Bildwerken. Wenn man einen Schauspieler auffordert, im »romantischen Stil« zu spielen, wird er sich brav darin versuchen, weil er zu wissen glaubt, was damit gemeint ist. Woran kann er sich tatsächlich halten? Eingebung, Phantasie und eine Kladde von Theatererinnerungen, die ihm alle eine vage »Romantizität« vermitteln. Dazu wird er unbewußt einen älteren Schauspieler, den er bewundert, imitieren. Wenn er in seinen eigenen Erlebnissen nachgräbt, würde sich vielleicht das Ergebnis nicht mit dem Text vermählen; wenn er bloß das spielt, was er für den Text hält, wird es ein Spiel aus zweiter Hand und konventionell. So oder so ist das Resultat ein Kompromiß, und in den meisten Fällen kein überzeugender.
Es ist zwecklos, so zu tun, als hätten die Wörter, die wir den klassischen Stücken anhängen wie »musikalisch«, »poetisch«, »überlebensgroß«, »erhaben«, »heroisch«, »romantisch«, einen absoluten Sinn. Sie sind Reflexionen der kritischen Haltung einer gewissen Epoche, und der Versuch, heute eine Aufführung aufzubauen, die sich diesen Gesetzen anbequemt, ist die sicherste Straße zum tödlichen Theater – tödlichen Theater von einer Achtbarkeit, die es als lebendige Wahrheit gelten läßt.
Als ich in Sheffield einen Vortrag über dieses Thema hielt, konnte ich es gleich einem praktischen Versuch unterziehen. Zufällig war unter den Zuhörern eine Frau, die König Lear weder gelesen noch gesehen hatte. Ich gab ihr Gonerils erste Rede und bat sie, sie, so gut sie konnte, nach den von ihr entdeckten Worten vorzutragen. Sie las sie sehr einfach – und die Worte entfalteten sich voller Beredsamkeit und Charme. Ich erklärte ihr dann, dies sollte die Rede eines bösen Weibes sein, und sie sollte jedes Wort als Heuchelei lesen. Sie versuchte es, und das Publikum merkte, welch ein schweres und unnatürliches Ringen mit der einfachen Musik der Worte nötig war, als sie nach einer Definition zu agieren versuchte:
Mein Vater,
Mehr lieb’ ich Euch, als Worte je umfassen,
Weit inniger als Licht und Luft und Freiheit,
Weit mehr, als was für reich und selten gilt,
Wie Schmuck des Lebens, Wohlsein, Schönheit, Ehre,
Wie je ein Kind geliebt, ein Vater Liebe fand,
Der Atem dünkt mich arm, die Sprache stumm,
Weit mehr als alles das lieb’ ich Euch noch.
Das kann jeder für sich selbst ausprobieren. Schmeckt es auf der Zunge. Es sind Worte einer vornehmen, aristokratischen Frau, die gewohnt ist, sich in der Öffentlichkeit zu äußern, einer Frau mit Gelassenheit und gesellschaftlichem Aplomb. Als Schlüssel zu ihrem Charakter wird nur die Fassade geboten, und die ist, wie wir sehen, elegant und verführerisch. Wenn man sich jedoch die Inszenierungen vergegenwärtigt, in denen Goneril diese Zeilen als makaber böses Weib spricht, und sich die Rede daraufhin noch einmal betrachtet, dann weiß man eigentlich nicht, was darauf hindeutet – außer vielleicht die vorgefaßte Meinung über Shakespeares Moral. Wenn aber tatsächlich Goneril beim ersten Auftreten kein »Ungeheuer« spielt, sondern nur das, was der gegebene Text verlangt, dann verschiebt sich das gesamte Gleichgewicht des Stückes – und in den späteren Szenen sind ihre Bosheit und Lears Martyrium weder so grob noch so simpel, wie sie erscheinen könnten. Natürlich erfahren wir gegen Ende des Stückes, daß Gonerils Handlungsweise sie zum »Ungeheuer« stempelt – aber zu einem wahren Ungeheuer, komplex und bannend.
In einem lebendigen Theater würden wir bei der täglichen Probe die Entdeckungen des Vortages auf die Probe stellen und bereit sein zu glauben, daß uns das eigentliche Stück wieder durch die Lappen gegangen ist. Aber das tödliche Theater geht an die Klassiker mit der Auffassung heran, daß irgendwo irgendwer entdeckt und festgelegt hat, wie man so ein Stück aufführt.
Das ist das ständige Problem des sogenannten Stils. Jedes Werk hat seinen eigenen Stil. Es könnte nicht anders sein: jede Periode hat ihren Stil. Sobald wir versuchen, diesen Stil festzulegen, sind wir verloren. Ich weiß noch genau, wie die Pekingoper nach London kam, und kurz darauf eine konkurrierende chinesische Operntruppe aus Formosa. Die Pekingoper konnte noch auf die Quellen zurückgreifen und schuf die alten Formen jeden Abend neu; die Truppe aus Formosa, die die gleichen Stücke spielte, ahmte nur Erinnerungen nach, verkürzte einige Einzelszenen, übertrieb die Klamaukpassagen und vergaß den Sinn – nichts wurde neu geschaffen. Selbst in diesem fremden, exotischen Stil war der Unterschied zwischen Leben und Tod unverkennbar.
Die echte Pekingoper war ein Beispiel der dramatischen Kunst, deren äußere Formen sich nicht von Geschlecht zu Geschlecht ändern, und doch schien sie noch vor einigen Jahren so völlig versteinert, daß sie in alle Ewigkeit so weitermachen konnte. Heute ist selbst diese großartige Reliquie verschwunden. Ihre Kraft, ihr Gehalt hätten ihr das Leben weit über ihre Zeit hinaus garantiert wie einem Monument – aber der Tag brach an, an dem die Kluft zwischen ihr und dem Leben der sie umgebenden Gesellschaft zu groß wurde. Die roten Garden reflektieren ein anderes China. Sinn und Haltung der traditionellen Pekingoper haben nur wenig Beziehung zu der neuen Sinnstruktur, in der das Volk jetzt lebt. Heute sind in Peking der Kaiser und die Prinzessinen durch Landarbeiter und Soldaten ersetzt, und es wird die gleiche unglaubliche akrobatische Geschicklichkeit wie früher eingesetzt, um von ganz anderen Dingen zu künden. Im Westen wird das zutiefst bedauert, und es ist für uns leicht, kultivierte Tränen darüber zu vergießen. Natürlich ist es tragisch, daß dieses wunderbare Erbe zerstört ist – und doch habe ich das Gefühl, daß die unerbittliche Einstellung der Chinesen zu einem ihrer stolzesten Besitztümer den Sinn des lebendigen Theaters in seinem Kern berührt – Theater ist stets eine sich selbst zerstörende Kunst und immer in den Wind geschrieben. Ein professionelles Theater zieht jeden Abend die verschiedensten Leute an und spricht zu ihnen in der Sprache des Verhaltens. Eine Aufführung fährt sich ein und muß gewöhnlich wiederholt werden – und dazu noch so gut und genau wie möglich wiederholt –, aber vom Tage, an dem sie sich eingefahren hat, beginnt etwas Unsichtbares zu sterben.
Im Moskauer Künstlertheater und in der Habimah von Tel Aviv werden Produktionen vierzig Jahre und länger gespielt. Ich habe eine genaue Reproduktion von Wachtangows Inszenierung der Turandot aus den zwanziger Jahren gesehen, ich habe Stanislawskis vollständig erhaltene Arbeit gesehen, aber nichts davon hatte mehr als antiquarisches Interesse, nichts hatte die Vitalität einer neuen Gestaltung. In Stratford, wo wir uns grämen, weil wir unser Repertoire nicht lange genug spielen, um den gesamten Kassenwert auszumelken, behandeln wir das nun ganz empirisch: ungefähr fünf Jahre, einigen wir uns, ist die längste Zeit, die eine bestimmte Inszenierung überleben kann. Es sind nicht nur die Haartracht, die Kostüme und die Masken, die veraltet erscheinen, sondern alle verschiedenen Elemente einer Aufführung – die Kurzhandschrift von Verhaltensmustern, die bestimmte Gefühle ausdrücken sollen, Gesten und Gestikulationen und Stimmlagen – alle fluktuieren die ganze Zeit an einer unsichtbaren Börse. Das Leben geht weiter, Einflüsse wirken auf Schauspieler und Publikum, und andere Stücke, andere Künste, Film, Fernsehen, Tagesereignisse schreiben dauernd die Geschichte neu und wandeln die tägliche Wahrheit. In Modehäusern haut jemand auf einen Tisch und sagt: »Stiefel sind einfach wieder Mode«, das ist eine existentielle Tatsache. Ein lebendiges Theater, das glaubt, von solchen Trivialitäten wie der Mode unberührt zu bleiben, wird dahinwelken. Im Theater ist jede Form, die einmal geboren ist, sterblich, jede Form muß neu konzipiert werden, und ihre neue Konzeption wird die Zeichen aller Einflüsse tragen, die sie umgeben. In diesem Sinne ist das Theater ein Stück Relativität. Immerhin ist ein großes Theater kein Modehaus; unzerstörbare Elemente tauchen immer wieder darin auf, und gewisse grundlegende Probleme bedingen jede dramatische Betätigung. Die tödliche Falle liegt darin, daß man die ewigen Wahrheiten von den oberflächlichen Variationen zu trennen sucht; denn das ist eine versteckte Form des Snobismus und daher verderblich. Heute gilt es als Binsenweisheit, daß Szenenbild, Kostüme und Musik ein gefundenes Fressen für Regisseure und Ausstatter und im höchsten Maße erneuerungsbedürftig sind. Wenn es zu bestimmten Auffassungen und Verhaltensfragen kommt, sind sie viel unsicherer und neigen zur Ansicht, daß man diese Elemente, wenn sie im Text stimmen, in der alten Art weiterbehandeln kann.
Eng damit verknüpft ist der Konflikt zwischen Theaterregisseuren und Musikern in Opernaufführungen, wo zwei völlig verschiedene Formen, Schauspiel und Musik, behandelt werden, als seien sie ein und dasselbe. Ein Musiker hat mit seinem Stoff zu tun, der den Menschen in die größte ihm gegebene Nähe des Unmittelbaren führt. Seine Notenschrift trägt dieser Unsichtbarkeit Rechnung, und sein Klang wird von Instrumenten hergestellt, die sich kaum je verändern. Die Persönlichkeit des Spielers hat damit nichts zu schaffen: ein dünner Klarinettist kann oft dickere Töne erzeugen als ein dicker. Der Träger der Musik ist von der Musik selbst geschieden. So kommt und geht der Stoff der Musik immer in gleicher Weise, frei von dem Zwang, revidiert und neu bewertet zu werden. Aber der Träger des Schauspiels ist Fleisch und Blut, und hier walten ganz andere Gesetze. Der Träger und die Aussage lassen sich nicht trennen. Nur ein nackter Schauspieler könnte beginnen, einem reinen Instrument wie einer Geige zu ähneln, und auch nur dann, wenn er ganz klassisch gebaut ist und weder einen Wanst noch O-Beine hat. Ein Ballettänzer kommt diesem Zustand manchmal nahe und kann auch formale Gesten reproduzieren, die weder von seiner Person noch von seinen äußeren Lebensumständen modifiziert sind. Sobald sich aber der Schauspieler kostümiert und mit eigener Zunge spricht, begibt er sich auf den schwankenden Boden der Manifestation und Existenz, den er mit den Zuschauern teilt. Weil die Erfahrung des Musikers eine so andere ist, findet er es schwer verständlich, warum die traditionellen Mätzchen, die Verdi zum Lachen brachten und Puccini sich auf die Schenkel schlagen ließen, heute weder komisch noch aufklärend wirken. Die Große Oper ist selbstverständlich das zur Absurdität geführte tödliche Theater. Die Oper ist ein Alptraum riesiger Fehden über winzige Nebensächlichkeiten, surrealistischer Anekdoten, die sich alle um dieselbe Behauptung drehen: nichts braucht sich zu ändern. Alles in der Oper muß sich ändern, aber in der Oper ist die Änderung blockiert. Wieder müssen wir uns vor Entrüstung hüten, denn wenn wir versuchen, das Problem zu vereinfachen, indem wir die Tradition zum Haupthindernis zwischen uns und einem lebendigen Theater erklären, gehen wir wieder an der eigentlichen Frage vorbei. Es gibt überall eine tödliche Substanz, in der kulturellen Struktur, in unseren überkommenen künstlerischen Werten, im wirtschaftlichen Rahmen, im Leben des Schauspielers und in der Funktion des Kritikers. Wenn wir dies alles untersuchen, werden wir finden, daß verwirrenderweise auch das Gegenteil wahr zu sein scheint, denn im tödlichen Theater zeigen sich oft quälende, unfruchtbare oder sogar auch augenblicklich befriedigende Funken wirklichen Lebens.
In New York ist zum Beispiel das tödlichste Element bestimmt wirtschaftlicher Natur. Das bedeutet nicht, daß die ganze dort geleistete Arbeit schlecht ist, aber ein Theater, das aus wirtschaftlichen Gründen nicht länger als drei Wochen probt, ist von vornherein gelähmt. Die Zeit ist nicht ein absolut entscheidender Faktor; es ist nicht unmöglich, innerhalb von drei Wochen etwas Erstaunliches auf die Beine zu stellen. Manchmal bringt im Theater das, was man salopp und bündig Glück nennt, einen verblüffenden Energietaumel hervor, und dann folgt Einfall auf Einfall wie ein Kettenblitz. Aber das ist selten: Der gesunde Menschenverstand beweist, daß bei einem System, das in den meisten Fällen eine mehr als dreiwöchige Probezeit unnachsichtig ausschließt, fast alles zu kurz kommen muß. Man kann kein Experiment ausprobieren, und künstlerische Wagnisse sind nicht möglich. Der Regisseur muß die Ware liefern oder gehen, und der Schauspieler ebenfalls. Natürlich kann man die Zeit auch sehr schlecht nutzen, man kann monatelang herumsitzen, diskutieren, grübeln und improvisieren, ohne daß sich das im geringsten niederschlägt. Ich habe in Rußland Shakespeare-Aufführungen gesehen, die in der Anlage so konventionell waren, daß zwei Jahre Diskussion und Archivstudium kein besseres Resultat erzielt hätten als eine Schmierentruppe in drei Wochen. Ich habe einen Schauspieler getroffen, der sieben Jahre lang den Hamlet probte, ihn aber nie spielte, weil der Regisseur starb, ehe er damit fertig war. Andererseits haben russische Aufführungen, die jahrelang im Stanislawski-Stil geprobt worden sind, noch immer ein Niveau, von dem wir nur träumen können. Das Berliner Ensemble nützt die Zeit gut, macht von ihr großzügigen Gebrauch, wendet etwa zwölf Monate an eine neue Inszenierung und hat über eine Reihe von Jahren ein Repertoire von Aufführungen aufgebaut, von denen jede sehenswert ist – und das Theater bis zum letzten Platz füllt. Nach einfachen kapitalistischen Grundsätzen ist das ein besseres Geschäft als das kommerzielle Theater, in dem die zusammengewürfelten und -geflickten Stücke so selten Erfolg haben. Am Broadway oder in London macht in jeder Saison eine Anzahl kostspieliger Inszenierungen nach einer oder zwei Wochen zu, und es ist ein seltener Zufall, wenn sich eine durchboxt. Trotzdem hat der Prozentsatz von Katastrophen das System oder den Glauben nicht erschüttert, daß sich am Schluß alles einrenken wird. Am Broadway steigen dauernd die Preise, und ironischerweise verdienen in jeder Saison die »Hits« desto mehr Geld, je katastrophaler sich die Saison entwickelt. Während immer weniger Leute durch die Türen gehen, fließen immer größere Summen in die Theaterkassen, bis schließlich ein letzter Millionär ein Vermögen für eine nur für ihn bestimmte Privataufführung bezahlen wird. So kommt es, daß die Ul des einen zur Nachtigall des anderen wird. Alle stöhnen, aber viele wollen dennoch, daß es so weitergeht.
Die künstlerischen Folgen sind schlimm. Der Broadway ist kein Dschungel, sondern eine Maschine, in die eine große Anzahl von ineinandergreifenden Teilen eingesetzt ist. Und doch ist jeder dieser Teile vergewaltigt: er ist deformiert worden, um reibungslos zu passen und zu funktionieren. Hier ist das einzige Theater der Welt, wo jeder Künstler – und damit meine ich die Bühnenbildner, Komponisten, Beleuchter ebensosehr wie die Schauspieler – zu seinem persönlichen Schutz einen Agenten braucht. Das klingt melodramatisch, aber in gewissem Sinne ist jeder ständig in Gefahr; seine Stelle, sein Ruf, sein Lebensstil sind täglich in der Schwebe. Theoretisch müßte diese Spannung zu einer Angststimmung führen, und wäre dies der Fall, dann wäre ihre zermürbende Wirkung klar ersichtlich. In der Praxis jedoch bringt die unterlegte Spannung ganz unmittelbar die berühmte Broadway-Atmosphäre zustande, die sehr emotional und von spürbarer Wärme und guter Laune durchpulst ist. Zum ersten Probetag des Stückes House of Flowers kam der Komponist, Harold Arlen, mit einer blauen Kornblume im Knopfloch sowie mit Champagner und Geschenken für uns alle. Als er sich durch die Schauspieler hindurch umarmte und küßte, flüsterte mir Truman Capote, sein Librettist, unheilverkündend zu: »Heute ist’s Liebe. Morgen sind’s die Anwälte.« So war’s auch. Pearl Bailey hatte mir einen Vollstreckungsbefehl über 50.000 Dollar zugeschickt, bevor noch die Aufführung nach New York kam. Für einen Ausländer war das (rückblickend) alles spaßig und aufregend – alles ist mit dem Begriff »Showbusiness« gesagt und erklärt –, aber bei genauer Analyse steht diese brutale Wärme in direkter Beziehung zu dem Mangel an wirklichem Feingefühl. Unter solchen Bedingungen findet man selten die Ruhe und Sicherheit, in der man wagen würde, sich zu exponieren. Ich meine die wahre, schlichte Intimität, die sich bei langer Arbeit und echtem Vertrauen zu anderen Menschen einstellt – am Broadway gelangt man leicht zu einer krassen Geste der Selbstdarstellung, aber das hat nichts zu tun mit der feinfühligen, sensiblen Wechselbeziehung zwischen Menschen, die vertrauensvoll miteinander arbeiten. Wenn die Amerikaner die Briten beneiden, dann meinen sie diese seltsame Sensibilität, dieses ungleiche Geben und Nehmen. Sie nennen es Stil und halten es für ein Mysterium. Wenn man in New York eine Inszenierung besetzt und hört, daß ein Schauspieler »Stil« hat, dann bedeutet das gewöhnlich Nachahmung der Nachahmung eines Europäers. Im amerikanischen Theater spricht man ernsthaft von »Stil«, als sei das eine Manier, die man sich aneignen kann – und die Schauspieler, die klassische Stücke gespielt haben und von den Kritikern in den Glauben hineingeschmeichelt wurden, daß sie »das Gewisse« besitzen, tun alles, um den Eindruck zu verewigen, daß »Stil« ein rares Etwas ist, das nur einige wenige Gentleman-Schauspieler ihr eigen nennen. Und doch könnte Amerika leicht ein eigenes großes Theater haben. Es besitzt dafür alle dazugehörigen Elemente: Kraft, Mut, Humor, Bargeld und die Fähigkeit, harten Tatsachen ins Auge zu sehen.
Eines Morgens stand ich im Museum of Modern Art und beobachtete die Leute, die für einen Dollar Eintrittsgeld hineinströmten. Fast alle hatten die lebhaften Züge und das individuelle Aussehen des guten Publikums – wenn man den einfachen persönlichen Maßstab für ein Publikum gebrauchen will, für das man gern Stücke inszeniert. In New York gibt es potentiell ein Publikum, das zu den besten der Welt zählt. Nur geht es leider selten ins Theater.
Es geht selten ins Theater, weil die Eintrittspreise zu hoch sind. Gewiß kann es sich diese Preise leisten, aber es ist zu oft enttäuscht worden. Nicht umsonst sind gerade in New York die Kritiker am mächtigsten und schonungslosesten. Das Publikum hat sich Jahr um Jahr gezwungen gesehen, einfache, fehlbare Menschen zu hochbezahlten Experten zu erheben, denn es ist, wie wenn ein Sammler ein teures Stück kauft: er kann allein dafür das Risiko nicht übernehmen. Die Tradition des sachverständigen Liebhabers von Kunstgegenständen, wie zum Beispiel Duveen, macht sich auf einmal an den Theaterkassen bemerkbar. So hat sich ein Kreis geschlossen; nicht nur die Künstler, sondern auch das Publikum müssen geschützt werden; die Menschen – und zwar meistens gerade die neugierigen, intelligenten, nonkonformistischen – bleiben fern. Diese Situation beschränkt sich nicht auf New York. Ich habe etwas sehr Ähnliches erlebt, als wir im Pariser Athenée John Ardens Sergeant Musgraves Tanz aufführten. Es war ein eklatanter Durchfall – fast die gesamte Presse war schlecht –, und wir spielten vor praktisch leeren Häusern. Überzeugt, daß das Stück irgendwo in Paris sein Publikum hätte, gaben wir bekannt, daß wir drei eintrittsfreie Abende veranstalten würden. So groß war die Lockung der freien Eintrittskarten, daß die Abende praktisch zu wilden Premieren wurden. Die Mengen prügelten sich um den Eintritt, die Polizei mußte quer durchs Foyer eiserne Gitter ziehen, und das Stück ging großartig, weil die Schauspieler, durch die Wärme der Aufnahme beflügelt, ihr Bestes gaben, was ihnen dann wieder Ovationen einbrachte. Das Theater, das noch am Vorabend ein zugiges Totenhaus gewesen war, summte vom Flüstern und Raunen des Erfolgs. Am Ende machten wir die Lichter an und betrachteten unser Publikum. Es war vorwiegend jung, durchweg gut und ziemlich formell angezogen, mit Schlips und Jackett. Françoise Spira, die Leiterin des Theaters, kam auf die Bühne.
»Ist hier einer, der sich den Eintrittspreis nicht hätte leisten können?«
Ein Mann hob die Hand.
»Und ihr anderen, warum habt ihr auf den freien Eintritt warten müssen?«
»Es hatte schlechte Kritiken.«
»Glaubt ihr an Kritiken?«
Lauter Chor: »Nein!«
»Warum dann …?«
Und von allen Seiten dieselbe Antwort – das Risiko ist zu groß, zu viele Enttäuschungen. Hier sehen wir, wie der Teufelskreis gezogen ist. Stetig gräbt sich das tödliche Theater sein eignes Grab.
Oder wir können dem Problem von der anderen Seite beikommen. Wenn das gute Theater auf ein gutes Publikum angewiesen ist, dann hat jedes Publikum das Theater, das es verdient. Und doch muß es für den Zuschauer sehr schwer sein, über die Verantwortung des Publikums belehrt zu werden. Wie kann sich das in der Praxis gestalten? Es wäre ein trauriger Tag, wenn das Publikum nur noch aus Pflichtgefühl ins Theater ginge. Ist es einmal im Theater, kann sich das Publikum nicht zu einem »besseren« steigern, als es ist. In gewissem Sinne gibt es nichts, was ein Zuschauer wirklich tun kann. Und doch herrscht hier ein Widerspruch, der nicht übersehen werden darf, denn von ihm hängt alles ab.
Als die König-Lear-Aufführung