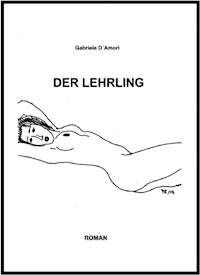
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paul ist mitten im 2. Weltkrieg geboren. Er wächst während der Nachkriegszeit in Oggersheim, einem Vorort von Ludwigshafen am Rhein, auf, dort wo auch der ehemalige Bundeskanzler Kohl wohnt. Es wird geschildert, wie ein Vierzehnjähriger bereits berufstätig werden muss, was damals normal ist; wie sein Alltag aussieht, wie er sich die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt. Die Lehre ist für ihn ein harter Lebensabschnitt, der schließlich, infolge eines hoffnungslosen Liebeserlebnisses, in die Katastrophe führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele D`Amori
Der Lehrling
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Warum?
Tiefflieger
Großvater Alfred
Volksschule Oggersheim
Oggersheim
Platzangst
Volksschule Ludwigshafen
Krankenhaus
Leonardo
Beginn der Lehre
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Berufsschule
Reißzeug
Tag der Kälte
Fleisch und Fahrrad
Käfertaler Wald
Konnexion
Rechenschieber
Rheinüberquerung
Wanderung zum Trifels
Rudolfs Colt
Baustellenpraxis
Wanderung zur Rietburg
Drei Freunde
Sein und Nichtsein
Angst
Zuhören
Wege zur Weisheit
Persönlichkeit
Erstes Auto
Peter und Gabriele
Lena
Ende
Impressum neobooks
Warum?
Warum lebe ich? Ich frag michs oft. Es muss einen Sinn doch haben, dass ich atme, gehe sehe. Manchmal aber, wenn ich so durch grüne Fluren gehe und es riecht nach regenfeuchter Erde, mein ich, es gibt gar nichts mehr zu fragen. Gabriele D`Amori
Tiefflieger
Der Tiefflieger kam von Süden. Sie sahen ihn erst, als er bereits über dem Weinberg hinweg auf sie herunter stieß und das Geräusch seines Maschinengewehrfeuers in die Ohren und in das Herz eindrang. Anna Zola warf sich auf ihre drei Kinder zwischen die Rebzeilen. Die vier anderen Frauen gingen ebenfalls zu Boden, während die Kuh, welche das Fuhrwerk gezogen hatte, in wilder Flucht, den Wagen hinter sich herziehend, den Feldweg entlang, davon stürmte.
Anna hatte in diesem Moment aufgehört zu denken; sie verspürte nur noch Todesangst und gleichzeitig eine seltsame Empfindlichkeit der Haut, wie in Erwartung des Kugeleinschlages und des Schmerzes. Die Einschläge ließen die Erde aufspritzen, aber sie verfehlten die kleine Gruppe. Sie wussten alle, der Flieger würde zurückkehren und erneut auf sie feuern.
Doch das Maschinengewehrfeuer entfernte sich und wurde durch eine Explosion unterbrochen, gefolgt durch ein lautes Zischen. Im nahen Bahnhof des Weinortes hatte ein Personenzug gehalten und die Aufmerksamkeit des Piloten von der Frauengruppe abgelenkt. Das neue Ziel erschien ihm sehr viel lohnender und so flog er eine Schleife, um den Zug erneut zu attackieren.
Diese Chance erlöste die Frauengruppe aus ihrer Starre und half ihnen auf die Beine. Anna riss ihre Kinder von der Erde hoch und zog sie hinter sich her, die Rebzeilen entlang, in Richtung Dorf. Sie hatte nur zwei Hände, aber es waren sechs kleine Kinderarme, die sie nicht gleichzeitig erfassen konnte. Es entwickelte sich eine wilde, ungeordnete Flucht, die Kinder weinten vor Angst, fielen hin, wurden wieder hochgerissen und sie schrie fast hysterisch die Kinder an: „Beeilt euch doch, kommt doch, es ist gleich geschafft!“ Die vier anderen Frauen waren bereits, außer Sichtweite, im Dorf angekommen und in ihren Häusern verschwunden.Anna hörte hinter sich aus der Richtung des Bahnhofs lautes Schreien der getroffenen und verwundeten Passagiere, das Zischen des Dampfes der zerschossenen Lokomotive und das Dröhnen des englischen Jagdflugzeuges, das erneut einen Angriff flog.
Endlich hatte sie den Anfang des Dorfes Maikammer erreicht und rannte die gepflasterte Dorfstraße entlang, die Kinder hinter sich herziehend, auf die Behausung zu, in welcher sie untergekommen war. Diese war ein ehemals stattliches Weingut, mitten in dem pfälzischen Weinort gelegen und einer jüdischen, alteingesessenen Winzerfamilie gehörend, die inzwischen nicht mehr am Leben war, ermordet durch nationalsozialistischen Wahnsinn. Das Wohngebäude war mit sogenannten Ausgebombten belegt, die in drangvoller Enge die Räume bewohnten.
Anna war inzwischen mit den Kindern am Weingut angelangt. Das Tor stand offen. In der Ferne war immer noch der Lärm aus Richtung des Bahnhofes zu vernehmen, vermischt mit dem Geräusch der abdrehenden Maschine, deren Pilot den Heimflug antrat. Links neben dem Eingangstor, nur einige Schritte über den Hof, war die Haustüre erreicht, und damit die Sicherheit, wenigstens in diesem Augenblick.
Der große Kampf des Tausendjährigen Reiches lag in seinen letzten Zügen. Drunten in der Ebene brannten die großen Städte. Die Wohnung von Anna in Ludwigshafen am Rhein, der Großstadt, die nach dem bayerischen König Ludwig I. benannt war (die Pfalz gehörte sehr lange zu Bayern), wurde durch Brandbomben zerstört. Das Leben und immerhin die Federbetten wurden gerettet. Anna warf letztere unter Lebensgefahr aus dem Fenster des bereits brennenden Schlafzimmers. Wenigsten etwas vom bisherigen Leben sollte noch ihr gehören, so dachte sie in diesem Augenblick und dieser Gedanke verschaffte ihr den nötigen Mut. Beinahe wäre alles vergeblich gewesen, denn die stets anwesenden, plündernden Mitbürger griffen begierig zu. Die bereits auf der Straße stehenden Kinder von Anna sahen, immer noch entsetzt über die Ereignisse nach dem großen Bombardement, nunmehr, kaum dass die Federbetten auf der Straßenoberfläche auftrafen, wie fremde Leute nach diesen griffen. Sie hörten, wie die Mutter von oben aus der brennenden Wohnung fortwährend schrie: „Nein, mein Gott, nein!“ und begriffen unbewusst, dass sie um etwas Wichtiges beraubt wurden. Instinktiv klammerten sie sich an diese Federbetten und begannen laut ebenfalls zu schreien, von Weinen begleitet. Umstehende Menschen erfassten die Dramatik und griffen ein, die Federbetten rettend. Paul behauptet bis heute, dies sei der Moment gewesen, woran er eine erste, bleibende Erinnerung als kleines Kind habe. Daran, wie die weißen Federbetten über den Schutt der zerstörten Häuser, welcher die Straße bedeckte, gezerrt wurden und schnell eine schmutzige Farbe angenommen hätten. Diese verschmutzten Federbetten, die er doch stets blütenweiß gekannt habe, hätten sich unlöschbar, für immer in sein Gedächtnis eingeprägt.
Der nächste Erinnerungssplitter betraf die weiteren Folgen der Wohnungszerstörung. Mit den geretteten Federbetten und den Kindern hatte sich Anna von der Innenstadt nach dem Vorort Mundenheim durchgeschlagen, in dem ihre Mutter Katharina, welche die Kinder Oma Kati nannten, wohnte. Hier in der Fürstenstraße fanden sie zwar provisorisch eine Bleibe für die kommende Nacht, jedoch waren ins Haus ebenfalls Brandbomben eingeschlagen und hatten zu Zerstörungen geführt (ohne, dass das Haus abgebrannt war), so dass sie nicht länger bleiben konnten. Paul erinnerte sich, wie die Wohnzimmerlampe schief nach unten hing und in ihm ein Gefühl der Angst auslöste, für die er bis heute keine Erklärung finden konnte. Paul war zu diesem Zeitpunkt etwas über zweieinhalb Jahre alt.
Im Winzerort Maikammer an der Deutschen Weinstraße war eine angespannte Ruhe eingekehrt. Die Verwundeten und die Toten des Tieffliegerangriffes am Morgen waren in den etwas größeren Nachbarort Edenkoben geschafft worden, da es dort ein kleines Krankenhaus gab. In diesem Nachbarort, ebenfalls ein bekannter Weinort, befand sich übrigens, direkt neben der Kirche auf dem zentralen Dorfplatz, das Denkmal König Ludwigs I., diesem bayerischen König, der sich ein Freund der Pfälzer nannte und sich hinter dem Ort am Hang des Haardgebirges ein Sommerschloss bauen ließ. Weit weg von München genoss er von dieser, Ludwigshöhe genannten, Residenz aus, einen großartigen Blick vom umgebenden Pfälzerwald über die Weinberge hinweg in die oberrheinische Tiefebene.
Das alles war sehr lange her, über ein Jahrhundert. Nun herrschte Krieg im Endstadium. Im Weinort, mit Anna und ihren Kindern, brach die Abenddämmerung herein. Anna kleidete die Kinder vollständig an, ehe sie diese zu Bett brachte. Diese Maßnahme hatte ihre Berechtigung, wie sich noch zeigen sollte. Es war gegen einundzwanzig Uhr, als ein Dröhnen vom Westen her vernehmbar wurde, welches ständig an Stärke zunahm. Die Luftschutzsirenen des Dorfes begannen zu heulen. Anna riss die Kinder aus dem Schlaf und zerrte die schlaftrunkenen Kleinen über den Hof des Gutes. Das Dröhnen in der Luft hatte nun ein gewaltiges Ausmaß erreicht. Paul blickte nach oben in den Abendhimmel, wo dicht an dicht im Pulk die Bombenflugzeuge in Richtung der Großstadt am Rhein flogen, um sie zu vernichten. Paul stand wie verwurzelt da, um dieses gewaltige Schauspiel zu schauen; etwas, was er nie mehr vergaß. Anna riss Paul an sich und stürzte mit ihm die Kellertreppe hinunter, die von außen aus zum Keller des Wohngebäudes führte.
Der Kellerraum war als provisorischer Luftschutzraum ausgebaut, das heißt er war weitgehend leer geräumt und mit Bänken ausgestattet. Obwohl kein eigentliches Ziel des Luftangriffes, war es nicht ausgeschlossen, dass durch vorzeitigen, unvorhergesehenen Bombenabwurf, auch ein fast dreißig Kilometer von diesem Ziel entfernt liegender Weinort, wie etwa Maikammer, in Mitleidenschaft gezogen werden konnte. Der Kellerraum war bereits von den Mitbewohnern des Hauses vollständig belegt. Widerwillig räumte man der Mutter mit ihren drei Kindern etwas Platz frei. Paul machte dieser Raum jedes Mal besondere Angst. Es war weder die drangvolle Enge noch die stickige Luft. Nein, es war diese rote Teufelsfratze, die gegenüber seinem Platz unter der Bank hervorgrinste, welche in ihm großes Entsetzen hervorrief. In Wahrheit waren es rote Feuerwehrschläuche, die hier deponiert waren, um einen etwaigen Brand schneller löschen zu können. Der schwach beleuchtete Raum und die merkwürdig verschlungenen Schläuche konnten in der Tat mit etwas Phantasie an ein Gesicht erinnern; besonders ab dem Zeitpunkt, als das elektrische Licht ausfiel und nur flackerndes Kerzenlicht als Ersatz angezündet wurde.
Bewegte dieses Gesicht nicht sein hässliches Maul, formten sich nicht etwa die Worte „Komm, komm, komm doch“? Paul drückte sich eng an die Mutter, die ihn mit den Worten zu beruhigen suchte: „Keine Angst Paulchen, es wird uns schon nichts passieren“. Anna versuchte dabei jedoch das leise dumpfe Grollen, das trotz der großen Entfernung des Bombardements im Keller zu vernehmen war, zu übertönen. Als sie das Wort Angst aussprach, die jeder spürte und sich in diesem Verließ mit Händen greifen ließ, zischten einige, man möge doch still sein. Paul kroch in dieser angstdurchtränkten Atmosphäre die Furcht immer weiter hoch und steigerte sich zur Panik. Die Fratze sagte zu ihm schon wieder und immer wieder: „Komm, komm, so komm doch“. Er konnte nicht mehr anders, er schrie es heraus, laut und schrill: „Nein, nein, nein, ich will nicht, ich komme nicht!“ Der ganze Keller war nun in Aufregung, die eigene Furcht brach sich Bahn. Sie schrien Anna an: „Stellen sie ihr Balg sofort ruhig“, oder, „schmeißt doch die Sippschaft raus“ und noch andere bösartige Worte fielen. Die Erlösung kam wie durch ein Wunder von den Dorfsirenen, die Entwarnung meldeten. Alles stürzte nach draußen in die Nacht, die jedoch in der Ferne erhellt wurde durch einen riesigen Feuerschein. In diesem Feuersturm ging dort die Großstadt am Rhein endgültig unter, ganz so als würde ein Höllenschlund sie verschlingen. Paul schaute mit seinen Geschwistern voller Staunen gebannt in die Richtung des grandiosen Schauspiels am Horizont, bis die Mutter sie in die Wohnung zurückholte.
Nachdem die Wohnung in der nach Ludwig I. benannten Stadt Ludwigshafen am Rhein verloren war und der Aufenthalt bei der Oma Kati nicht von Dauer sein konnte, verfügten die Behörden einen Umzug aufs Land, weg aus der direkten Gefahrenzone. Dabei fiel die Wahl auf Maikammer, den erwähnten Weinort in der Pfalz an der Deutschen Weinstraße, unterhalb der Ludwigshöhe. Dort, und das beförderte die Genehmigung, wohnten nahe Verwandte von Annas Ehemann Emil, dessen Mutter aus diesem Ort gebürtig war, und die Winzer waren. So kam es, dass die kleine Familie (deren Oberhaupt Emil an der Westfront kämpfte, wie es hieß), hilfreich unterstützt von Annas Schwester Margarete, welche die Kinder Marga nannten, sich zu diesem Fluchtort aufmachten.
Zunächst erfolgte eine Zugfahrt nach der größten Stadt am Fuße des Pfälzerwaldes, der Bezirksstadt Neustadt an der Weinstraße. Dort angekommen gab es ein Problem. Die Überlandstraßenbahn, welche dieses Neustadt mit dem künftigen Wohnort verband und darüber hinaus bis zum Ludwigsdenkmalort führte, war durch die Kriegsereignisse stillgelegt. Eingleisig, neben der Deutschen-Weinstraße verlaufend, war sie durch Tieffliegerangriffe beschädigt worden, die Fahrstromleitungen waren zerstört und die Fahrzeuge ausgebrannt. So waren die zwei Frauen mit den drei Kindern, Eva, Paul und Gerhard, gezwungen, die vielen Kilometer Wegstrecke zu Fuß zurückzulegen. An diesem heißen Augusttag sah dieser Treck dergestalt aus, dass die zwei älteren Kinder Eva und Paul neben dem kleinen Leiterwagen, der abwechselnd von Anna und Marga gezogen wurde, einher liefen. Auf dem Wagen befanden sich die Federbetten, ein wenig Kleidung und Hausrat und obenauf der Jüngste der Familie, Gerhardle. Die Deutsche Weinstraße führte durch schier endlos scheinende Weinberge und war an diesem Tag kaum befahren. Die Sonne brannte herab auf die heranreifenden Weintrauben, die eine zwar quantitativ gute Ernte, jedoch keine besondere Qualität versprachen. Es fehlte an allen Ecken und Enden die pflegende Hand des Winzers, der in den meiste Fällen an der Front stand. Die kleine Gruppe atmete die klare Luft ein und genoss die friedvolle Natur als etwas Außergewöhnliches in diesen kriegerischen Zeiten. Nach einigen Kilometer zurückgelegten Weges jedoch verwandelte sich das Wohlbehagen stetig und zunehmend in Anstrengung und Mühe. Pauls kleine Füße begannen zu schmerzen. Er beneidete nun seinen jüngeren Bruder, aber zunehmend stärker auch seine um ein Jahr ältere Schwester, die immer öfter auf dem Wagen mitfahren durfte. Als er darüber klagte, sagte die Mutter wie auch die Tante, er sei doch ein ausdauernder und willensstarker Junge und solle durchhalten. Dies erfüllte ihn derart mit Stolz, dass er weiterlief. Er hielt durch bis zu der neuen Behausung im Weinort Maikammer und genoss die Bewunderung der Erwachsenen, obwohl er total erschöpft war und keinen Meter mehr gehen konnte.
Die Ankömmlinge waren nicht sehr willkommen. Der Bürgermeister, bei welchem sie ihre Ankunft meldeten, klagte über die Belastung des Ortes durch die vielen Zwangszugewiesenen, vor allem über fehlenden Wohnraum, und zeigte sich als wenig verständnisvoll. Die Verwandtschaft von Anna verwies auch prompt auf die eigenen, beengten Wohnverhältnisse und die vorhandene schlechte Ernährungslage, da mit Wein in diesen Zeiten kaum etwas zu verdienen sei und man mit Wein nicht satt werden könne. Nur durch Mitarbeit im Wingert sei eine gewisse Hilfe möglich, so offerierten sie Anna. Wie sollte sie dies aber mit ihren drei kleinen Kindern bewerkstelligen? Tante Marga musste schnell wieder abreisen, da sie in der Kriegswirtschaft gebraucht wurde. Anna war nun ganz auf sich selbst gestellt in diesen unerfreulichen Verhältnissen. Die Kinder hatten es ebenfalls nicht leicht im Dorf. Erwachsene wie Kinder des Ortes sahen in ihnen unerwünschte Fremde und behandelten sie entsprechend unfreundlich. Der Mensch war in dieser Zeit reduziert auf das Überleben des eigenen Ichs; ein Selbsterhaltungswille, der alles andere dominierte. Anna war gezwungen ihre Kinder überallhin mit zunehmen, auch zur Arbeit in den Weinbergen.
Um für den kommenden Winter Brennholz zu besorgen, zog sie mit ihren Kindern in den nahen Wald, in dem es jedoch nur erlaubt war, Reisig aufzusammeln, nicht aber Äste oder kleine Bäume zu schlagen oder gar Hölzer von Holzstapeln zu entnehmen. Alles wurde genauestens beobachtet und notfalls geahndet. Vor Wildtieren brauchte sich Anna jedoch nicht zu fürchten. Wildschweine, Rehwild, Hasen und anderes Getier waren längst aus dem Pfälzerwald verschwunden und als Mahlzeit geendet. Paul erinnerte sich später noch genau an eine solche Reisigsammelaktion. Auf einem Weg zur Kalmit (einer Bergeshöhe nahe des Weinortes), als Anna eine Anhöhe an der Straße erklomm und damit aus seinem Blickfeld verschwand, überkam ihn ein panikartiges Gefühl des Verlustes, das ihn dazu trieb, der Mutter hinterher zu steigen. Der Hügel war jedoch zu steil. Auf halber Höhe verlor er den Halt und stürzte ab. Im Sturz spürte er zum ersten Mal in seinem bisher kurzen Leben Todesangst, die sich von allen bisherigen Ängsten unterschied, unbeschreiblich und grauenhaft. Er landete glücklicherweise im Gestrüpp ohne eine Schramme.
Der Krieg neigte sich dem Ende, im Weinort allerdings einem Höhe- punkt, zu. Die amerikanischen Truppenverbände waren in die Pfalz vom Westen her eingedrungen und standen kurz vor dem Einfall in die Ebene, den Rhein als Ziel. Im Weinort sprach man von nichts anderem, als von dem bevorstehenden Einmarsch der Amerikaner am nächsten Tag. Vor Sorge um Beschuss und Zerstörung des Ortes ordnete der Bürgermeister an, weiße Flaggen oder Tücher an den Häusern auszuhängen und den Ort somit zu übergeben. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages waren bereits Kettengeräusche von Kampfpanzern zu vernehmen, als ein Militärfahrzeug mit SS Besatzung am Rathaus vorfuhr. Eilig zerrten sie den Bürgermeister heraus und, vor den Augen der Bürger, hängten sie ihn an der Laterne davor auf. Dann fuhren sie davon. Wenig später, zu spät, rollten die amerikanischen Panzer durch den Ort, um ohne Halt weiter in die Ebene vorzustoßen. Man hängte den Bürgermeister ab, schaffte ihn zum Friedhof, legte ihn in die Leichenhalle und kehrte in die Häuser zurück, um die weiteren Dinge abzuwarten. Bis zum späten Nachmittag geschah nichts. Dann ging schnell das Gerücht um, die mit den Amerikanern verbündeten französischen Soldaten würden nun nachrücken und ihre marokkanischen Truppenteile vorausschicken. Diese Schreckensmeldung hatte zum Inhalt, dass diese Marokkaner, mit dem Messer quer im Mund, völlig enthemmt, jede deutsche Frau, ob jung oder alt, vergewaltigen oder töten würden, ohne, dass französiche Vorgesetzte einschritten.
Anna und die vielen Frauen im ehemaligen Weingut waren verzweifelt und standen noch im Hofgelände herum, als der polnische Zwangsarbeiter Rudkowski, ein kräftiger Mann, welcher in den Weinbergen arbeiten musste und den die Frauen wegen seiner vielfältigen Dienste, die er ihnen nebenbei leistete, man spricht durchaus auch von einigen Liebesdiensten, sehr gut behandelt hatten, herbeieilte und ihnen befahl, sie sollten sich augenblicklich in ihre Räume begeben und ihm alles weitere überlassen. Etwa eine Stunde später rückten die marokkanischen Truppen tatsächlich in den Ort ein und begannen mit der befürchteten Plünderung. Rutkowski stand am verschlossenen Tor des Weingutes, angetan mit seiner Jacke, die ihn als Zwangsarbeiter kenntlich machte, und erklärte den immer wieder Einlass begehrenden dunkelhäutigen Soldaten in einem recht passablen Französisch, dass in diesem heruntergekommenen Haus nur Zwangsarbeiter wie er selbst, untergebracht seien. Sie glaubten ihm, zumal die französischen Offiziere zur Eile drängten, da diese die Bezirkshauptstadt als lohnenderes Objekt vor Augen hatten. Rutkowski hatte sich menschlich gezeigt, weil er zuvor entsprechend behandelt worden war und, bei uns Menschen selten genug, dafür Dankbarkeit zeigte. Keiner wusste später zu sagen, was aus ihm geworden war. In der Erinnerung der Frauen blieb er für immer ein Held. Paul hatte diese Geschichte nicht von seiner Mutter Anna, sondern später von seiner Großmutter Kati erfahren. Obwohl die doch gar nicht dabei gewesen war. Also, ob sich alles genauso zugetragen hatte? Jedenfalls schwor die Großmutter, so und nicht anders sei es gewesen.
Der Krieg war noch nicht zu Ende, die Pfalz jedoch war erobert. Die Front verlief jetzt mitten durch den Rhein. In der Stadt Ludwigs I. standen die Amerikaner und Franzosen. In der Schwesterstadt Mannheim mit dem größten Barockschloss Deutschlands, nur durch den breiten Strom getrennt, die deutschen Truppen. Im hastigen Rückzug der deutschen Armee wurde ein großer Teil der Ausrüstung zurückgelassen. Paul konnte sich noch genau erinnern, dass auf dem Weg von ihrem Evakuierungsort Maikammer, dem Weinort an der Deutschen Weinstraße, zu dem neuen Wohnort Oggersheim, einem Vorort der zerstörten Großstadt am Rhein, links und rechts der Landstraße Fahrzeuge aller Art sowie Geschütze, Panzer, Gewehre, Helme und andere Dinge in wildem Durcheinander herumlagen.
Zu diesem Zeitpunkt, also der Rückkehr der kleinen Familie zum Ausgangspunkt ihrer Flucht, war der Krieg vorbei. Amerikanische Truppen hatten zuvor den Rhein trotz zerstörter Brücken überquert und schnell den Rest Deutschlands, mit ihren Alliierten zusammen, erobert. Für kurze Zeit, das heißt für wenige Wochen, blieben die Amerikaner noch in der Pfalz, ehe sie diesen Landesteil den Franzosen überließen. In diesen amerikanischen Tagen, so konnte sich Paul weiter erinnern, trafen mit ihm noch andere Kinder auf die amerikanischen Soldaten, die ihnen die noch unbekannten Kaugummis schenkten und die Zigaretten rauchten, auf deren Packungen die Aufschrift Luky Strike stand. Einmal warfen vorbeifahrende Amerikaner aus dem Lastwagen Rosinenbrote zu den am Straßenrand winkenden Kindern hinunter. Paul eroberte zusammen mit seinen Geschwistern ein solches Brot, das sie triumphierend nach Hause trugen.
Die Heimstadt von Annas Familie nach Kriegsende war zunächst das Haus der Schwiegereltern, die Eltern von Annas Mann Emil, welcher sich in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, fern der Heimat, befand. In Frankreich gefangen genommen, war er gerade unterwegs nach den Vereinigten Staaten. Man fuhr diese Gefangenen mit dem Schiff an der Freiheitsstatue vorbei und dann weiter nach Kanada, wo sie bei klirrender Kälte mit Pferden als Transportmittel, in den Wäldern der Rocky Mountains Bäume fällen mussten.
Die Schwiegereltern waren ein seltsames Paar. Die Schwiegermutter Maria, kurz Ria, war fünf Jahre älter als ihr Mann Alfred. Diese Ria war einmal eine sehr schöne, rassige Frau gewesen, die jedoch vom Schicksal wenig rücksichtsvoll behandelt wurde, so dass sie vorzeitig gealtert war. Als junge Frau gerade ein Jahr verheiratet und mit einem männlichen Nachkommen gesegnet, welcher Emil getauft wurde und später einmal Annas Ehemann werden sollte, verlor ihren geliebten Paul, Großvater unseres Paulchen, in den ersten Tagen des Ersten Weltkrieges. Als Tambour, im Namen des Großherzogs von Baden die Anhöhen der Vogesen erstürmend, wurde er verwundet und starb am fünfzehnten September des Jahres 1914. Sein Grab kann heute noch bei St. Die auf einem Soldatenfriedhof gefunden werden.
Eigentlich besaß Paul drei Großväter, anstatt nur zwei, wie es normal ist. Aber von den dreien war nur einer, nämlich Alfred Jasper, verfügbar. Von den anderen zwei, das heißt den leiblichen Großvätern, war der eine, Paul Zola, bereits, wie geschildert, im Ersten Weltkrieg auf dem Feld der Ehre gestorben, so dass Paul ihn nur aus Fotos kannte. Der Andere, der dritte schließlich, Ludwig Reich, der Ehemann von Großmutter Kati, war Anfang der zwanziger Jahre, der Arbeitslosigkeit überdrüssig, in die USA ausgewandert; unter Zurücklassung von Frau und drei Kindern! Wie man Paul einmal sagte, hätten nur die Ehefrau, nicht jedoch die Kinder, aufgrund der amerikanischen Einwanderungsbestimmungen, mit Ludwig einreisen können. Das lehnte Kati natürlich ab. Ansonsten war das Thema amerikanischer Großvater tabu. Letztlich blieb Paul ein Großvater erhalten, der Stiefgroßvater Alfred, auf welchen wir in dieser Geschichte noch oft stoßen werden.
Großvater Alfred
Eine Gruppe wartender Menschen stand sehr früh an diesem Sonntagmorgen an der Haltestelle für den Postbus am Schillerplatz in Oggersheim. Die Kinder und Erwachsenen trugen feste Schuhe und zum Wandern geeignete Kleidung und, was besonders auffiel, fast jeder, ob alt oder jung, hielt einen Wanderstock in der Hand, welcher mehr oder weniger umfangreich mit aufgenagelten blechernen Abzeichen, manche sogar in emaillierter Ausführung, bestückt war. Es waren Trophäen von erwanderten Orten im Pfälzerwald, denn hier standen etwa dreißig erwachsene Mitglieder des Pfälzer Waldvereins, Ortsgruppe Oggersheim, mit Kindern und Jugendlichen, zusammen etwa fünfzig Personen.
Der gelbe Postbus kam jetzt in Sicht. Großvater Alfred sagte nun zu Paul: „Sieh zu, dass du für deine Großmutter und mich ein paar schöne Plätze im Bus reservierst.“ Paul drängte sogleich nach vorne, mitten in die ebenfalls vordrängende Kinderschar, die vermutlich dieselbe Aufgabe hatte, hinein. Der Busfahrer hupte, trotz Sonntagsstille im Ort, aus Sorge, er könne eines der herandrängenden Kleinen verletzen, bog langsam in die Haltebucht ein und hielt an. Kaum hatte sich die Bustür geöffnet, ergoss sich die Kinderschar ins Innere wie ein vorher aufgestautes Gewässer nach Entfernung des Dammes. Paul war von der Meute mitgerissen worden und fand in der Mitte des Busses noch zwei freie Plätze, die er belegte, indem er den zum Gang liegenden Platz einnahm und seinen Stock auf den Fensterplatz legte. Danach folgten die Erwachsenen, welche mit ihren Blicken die Platzhalter suchten und, durch Winken und Rufen aufmerksam gemacht, auf ihre reservierten Plätze zusteuerten. Großvater Alfred und Großmutter Maria waren mit ihren Plätzen zufrieden und schickten Paul nach hinten zu den anderen, wie sie sich ausdrückten. Die Jugend saß hinten im Bus. So war es Brauch, wie Paul von einem der Kinder erfuhr. Er war zum ersten Mal dabei und kannte niemanden hier. Seine Geschwister Eva und Gerhard waren längst schon einmal oder mehrmals von den Großeltern mitgenommen worden, nur er, Paul, nicht. Warum? Wie er später erfuhr, war sein jüngerer Bruder Gerhard, der zuallererst dabei war, den Wünschen des Großvaters nur widerwillig oder gar nicht gefolgt. Zudem hatte er wohl nicht zur Geselligkeit beigetragen, sondern nur laufend nach Essen und Trinken verlangt. Die ältere Schwester Eva, die auch schon mitgenommen wurde, hatte jedoch, da sie fast stets das Wochenende bei ihrer Tante Marga verbrachte, gar keine Zeit, obwohl gerade Großvater Alfred wegen des kleinen niedlichen, blonden Mädchens viel Aufmerksamkeit unter den Mitwanderern erhalten hatte und sie deshalb gerne bevorzugt mitgenommen hätte. Nun also war der stille Paul dabei, sozusagen als Notnagel! Er hatte die erste Probe bestanden, denn er konnte von hinten aus beobachten, dass der Großvater, auf dem Gangplatz sitzend, in reger Konversation mit einem Nachbarn vertieft war. Dies liebte der alte Mann, der sehr viel von gepflegter Unterhaltung und Gedankenaustausch hielt.
Die Tour am heutigen Sonntag sollte von der zurückzulegenden Strecke nicht allzu anspruchsvoll sein. Andere Wanderungen hatten jedoch auch schon mal acht oder neun Stunden betragen. Die Wanderungen waren stets so organisiert, dass eine ausgiebige Zwischenrast nach etwa der Hälfte der Strecke, sowie eine noch ausgiebigere Schlusseinkehr vorgesehen waren. Zur Vorreservierung in Hütten und Gaststätten für die große Gruppe war am Wochenende davor einer, in der Regel aus zwei Vereinsmitgliedern bestehender, Vortrupp unterwegs, der auch die Strecke klarmachte. Der gelbe Bus war noch keine halbe Stunde unterwegs, als er Bad Dürkheim erreichte und mitten im Ort auf dem Stadtplatz anhielt. Alles stieg nun aus, richtete die Kleidung und Hüte zurecht und bewegte sich langsam durch die Gassen des Ortes in Richtung der Limburg, auf die ein Wegweiser hinwies. Der grüne Hut von Großvater Alfred zierten mehrere Abzeichen des Pfälzerwaldvereins, die sich in Details ein wenig voneinander unterschieden. Paul, der neben dem Großvater Schritt hielt, erkundigte sich danach und erhielt einen längeren Vortrag über die Länge der Mitgliedschaft und der damit verbundenen Ehrenabzeichen.
Großvater Alfred war bereits lange vor dem Krieg Mitglied im Pfälzerwaldverein aus zweierlei Gründen geworden. Zunächst war er, der im Schwarzwald in der Nähe von Waldshut, der Stadt an der Schweizer Grenze, geboren wurde, von der Pfalz begeistert und bezeichnete sie als die Toskana Deutschlands und zum anderen, war er, der eine Praxis für Naturheilkunde in Oggersheim betrieb, an Kontakten mit Personen interessiert, die er während der Waldspaziergänge als zukünftige Patienten zu gewinnen suchte. Dieser, nunmehr etwas über sechzigjährige Mann mit dem Schnäuzer, äußerlich dem berühmten Chirurgen Sauerbruch zum Verwechseln ähnlich sehend, hatte bereits ein bewegtes Leben hinter sich. Als zweitjüngster Sohn eines Schreinereibesitzers hatte er nach der Lehre als Schreiner nur die Möglichkeit den Heimatort zu verlassen. Er versuchte es in verschiedenen Berufen, wie beispielsweise im Badischen als Gerichtvollzieher in Karlsruhe oder als Straßenbahnführer in Mannheim. Als junger Mann hatte er sich im ersten Weltkrieg freiwillig zur Marine gemeldet, jedoch diese, wegen nicht ausreichender Schulbildung, nach Kriegsende nur mit einem niedrigen Dienstgrad verlassen. Allerdings hatte er sich eine verbesserte Aussprache angeeignet; er sprach nun ein fast perfektes Hochdeutsch ohne Anlehnung an sein ursprüngliches Alemannisch. Er versuchte mit einem Partner zusammen sich in die Naturheilkunde einzuarbeiten. Hier erschienen sich ihnen aussichtsreiche berufliche Perspektiven zu eröffnen, zumal Alfred, der schrecklichen Weltkriegserfahrung zufolge, sich dem katholischen Glauben und der Natur in besonderer Weise geöffnet hatte. Dabei waren ihm Schriften der Hildegard von Bingen in die Hände gefallen, die ja bekanntlich in der katholischen Kirche als Heilige verehrt wird. Diese Frau, die im zwölften Jahrhundert im Kloster Rupertsberg bei Bingen am Rhein, lebte, hatte sowohl auf den Gebieten der Theologie, der Biologie und der Medizin, wie auch der Musik, Erstaunliches geleistet und schriftlich hinterlassen. Wenn auch Alfred zu der Lehrmeinung in der katholischen Kirche tendierte, dass Frauen aus eigener Kraft und Gedankenstärke nicht zu theologischen Erkenntnissen in der Lage seien, so war er doch von ihren Abhandlungen über Pflanzen und Krankheiten fasziniert. Das Buch über Ursachen und Heilungen (Causae et Curae), welches über die Entstehung und Behandlung von verschiedenen Krankheiten, sowie das Buch über Beschaffenheit und Heilkraft der verschiedenen Kreaturen und Pflanzen (Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum), die beide zu den Standardwerken der Naturheilkunde zählen, hatte er zwar nicht im Original, jedoch einiges über den Inhalt der Bücher, gelesen. Was ihm einzuleuchten schien, war die grundlegende Beschreibung der menschlichen Lebenskräfte in der Einheit von Seele, Leib und Sinnen, die in ständiger Wechselwirkung stehen und aufeinander einwirken würden. Und was ihm sehr gut gefiel, waren die Empfehlungen Hildegards von Bingen hinsichtlich einer religiösen Lebensführung, der Beachtung göttlicher Naturgesetze und das Wissen um die heilsamen Kräfte der Pflanzen.
Mit seinem Partner zusammen besuchte er nunmehr fleißig Veranstaltungen des Deutschen Heilpraktikerbundes, um die Zulassung zum Heilpraktiker zu erlangen. Was ihm dabei als besondere Mahnung eines Dozenten in Erinnerung blieb, war dessen Zitat des römischen Politikers und Philosophen Seneca: Ein Teil der Heilung ist noch immer, geheilt werden zu wollen und damit verbunden die Aufforderung, in diesem Sinne, auch auf das mentale Verhalten des Patienten einzuwirken. Was Alfred aber öfter schmerzlich bewusst wurde, war der Mangel an medizinischen Kenntnissen, der nur durch ein Medizinstudium zu beheben war. Daher beschloss er, auch ohne Studienberechtigung, an entsprechenden Vorlesungen in Heidelberg teilzunehmen, in vollem Bewusstsein an deren Illegalität und der besonderen Schwierigkeiten des Zugangs zu den Vorlesungsräumen. Sein Partner wollte da nicht mitmachen und blieb lieber zu Hause.
Alfred hatte gerade die altehrwürdige Heidelberger Universität verlassen, wo er sich die Vorlesung zur Allgemeinen Anatomie, das heißt speziell zum Bewegungsapparat und der Eingeweidelehre, wie erwähnt, ohne Studienberechtigung, heimlich angehört hatte und war auf dem Weg in Richtung Neckarufer, als er auf dem Promenadenweg einer sehr schönen Frau begegnete, die ihm im Vorübergehen scheinbar anzulächeln schien. Das war der Moment, der in ihm den Gedanken auslöste, dass er mit seinen sechsundzwanzig Jahren vielleicht bald heiraten sollte, möglichst eine gute Partie, um seine finanzielle Misere zu beheben. Nur was hatte er anzubieten? Er hatte außer seinem Aussehen, seinen guten Manieren und seiner geschliffenen Aussprache wenig sonst vorzuweisen: Kein geregeltes Einkommen, keinen Titel, ja noch nicht einmal tanzen konnte er! Ach was, sagte er zu sich, nur keine Bescheidenheit, so was kommt bei Frauen nicht an. Am nächsten Kiosk erstand er die Mittwochausgabe der Rhein Neckar Zeitung , in welcher stets an diesem Wochentag eine umfangreiche Beilage mit Heiratsanzeigen enthalten war, stieg in die Straßenbahn nach Mannheim ein, setzte sich in eine Ecke und schlug die Zeitung auf. Sein Blick fiel nach einigem Suchen auf eine Anzeige, die seine Aufmerksamkeit fesselte. Da stand: „Junge, gut aussehende Kriegerwitwe, achtundzwanzig Jahre, vermögend, sucht gebildeten katholischen Partner zwecks Eheanbahnung.“ Das Wort vermögend gefiel ihm sehr gut; dass die Kriegerwitwe zwei Jahre älter war als er selbst, etwas weniger. Er schrieb dennoch an die in der Zeitung angegebene Chiffre: „Als junger, vielseitig interessierter, angehender Mediziner, habe ich Ihr Inserat in der Rhein Neckar Zeitung gelesen und würde mich sehr über ein Treffen mit Ihnen freuen. Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt und katholisch. Mit vorzüglicher Hochachtung Alfred Jasper.“ Die Kriegerwitwe erhielt zahlreiche Zuschriften mit mehr oder weniger schwülstigen oder angeberischen Texten, weshalb ihr das kurze Schreiben von Alfred Jasper auffiel und sie ihm zurück schrieb. Man traf sich in einem Cafe´ am Wasserturm in Mannheim. Alfred fand ihr rassiges Aussehen sowie die Vermögensverhältnisse, eine größere Geldsumme auf der Bank, verführerisch, während sie sein sicheres Auftreten und seine rhetorischen Fähigkeiten bewunderte. Man war sich schnell einig, möglichst schnell zu heiraten.
Doch stellte sich beim Bestellen des Aufgebotes heraus, dass Maria Förster, so hieß die Kriegerwitwe, bei ihrem Alter geschwindelt hatte; anstatt zwei war sie tatsächlich fünf Jahre älter als Alfred. Alfred wiederum gestand ihr nach dem Standesamt, dass sein Medizinstudium lediglich ein Selbststudium der Naturheilkunde und der Homöopathie und seine gelegentlichen Vorlesungsbesuche illegal seien, da er mangels Abitur gar keine Studienberechtigung besitze. Der eigentliche Tiefschlag aber traf Alfred bei dem von Maria direkt nach der kirchlichen Trauung gemachten Geständnis, sie habe einen fünfjährigen Sohn von ihrem im Krieg gefallenen ersten Ehemann sowie über die Wahrheit des Geldbetrages auf der Bank. Letzterer sei das Mündelgeld für diesen Sohn namens Emil und eigentlich für dessen Unterhalt und Ausbildung gedacht. Alfred sah sich schwer getäuscht und schwor insgeheim, da er katholisch und damit die Ehe untrennbar war, ihr alles Zug um Zug zukünftig heimzuzahlen. Schon in der Hochzeitsnacht verlangte er die Herausgabe des Mündelgeldes zum Zwecke der von ihm zu bestimmenden Verwendung. Ferner wolle er weitgehend von der Erziehung des Stiefsohnes entbunden werden, da er seine Pläne hinsichtlich der Einrichtung einer Praxis für Naturheilkunde ungestört weiter verfolgen müsse. Maria war mit allem einverstanden und Söhnchen Emil, der bisher die meiste Zeit bei Marias Eltern in der Pfalz verbracht hatte, kam nun zurück; zuerst in die Mannheimer Wohnung und später in das mit dem Mündelgeld gekaufte Haus in Ludwigshafen Oggersheim, welches zuvor einem Mann gehörte, der im Anbau des Hauses eine Steinmetzwerkstatt betrieb.
Wie bereits berichtet, tat sich Alfred mit Herbert, einem Kriegskameraden, der wie er, Heilpraktiker werden wollte, zusammen. Gemeinsam entwickelten sie eine Reihe verschiedener Rezepturen aus Heilkräutern, die sie Kräuterkomplex nannten. Als sie ihre Ausbildung in Naturheilkunde erfolgreich beendet hatten und in den Deutschen Heilpraktikerbund eingetreten waren, trennten sich ihre Wege. Zu dieser Zeit war Alfred bereits Hausbesitzer und begann sich in Oggersheim eine Praxis einzurichten. Er nahm Kontakt zu einem Philippsburger Pharmazieunternehmen auf, welches in seinem Auftrag die Kräuterrezepturen umsetzte und sie in Tablettenform als Jaspers Kräuterkomplex in runden Pappröhrchen lieferte. Nur das Naturmittelchen gegen Herzbeschwerden wurde als Flüssigkeit in einem Fläschchen geliefert. Neben diesen Naturprodukten wendete Alfred hauptsächlich die Augeniris-Diagnose, sowie Bestrahlung und Massage, in seiner Praxis an. Zusammen mit seiner überzeugenden Redeweise, dem weißen Arztkittel und seinem Sauerbruch-Aussehen gewann er schnell Patienten aus nah und fern. Die Mund zu Mund Propaganda half dabei vortrefflich.
Das Haus in der Dürkheimerstraße, eigentlich eine Doppelhaushälfte, sah von der Straße, relativ klein, von der Seite her gesehen jedoch recht stattlich aus. Diesen Eindruck erzeugte die Bauweise eines vorne tief herabreichenden Daches und einer seitlich hohen Fassade. Neben dem Haus, rechter Hand gelegen, befand sich ein großer Garten mit Obstbäumen. Den Eingang vorne zierten zwei leicht bauchige Holzsäulen vor einem offenen kleinen Vorraum mit Geländer. Den idyllischen Eindruck vervollkommnete eine im Frühjahr herrlich blühende Glyzinie, welche an Hauswand und Säulen nach oben rankte. Nach Betreten des Erdgeschoßes betrat man gleich rechts das Behandlungszimmer, geradeaus das Wartezimmer und durch beide Räume gleichermaßen erreichbar, den Bestrahlungsraum. Links vom Eingang befandt sich eine Toilette sowie die Treppe nach oben zu den Privaträumen. Diese bestanden aus dem vorderen Zimmer des Stiefsohns Emil, dem dahinter liegenden Schlafzimmer von Maria und Alfred und geradeaus, aus der Wohnküche, von welcher es weiter nach hinten auf eine schmale Terrasse ging, die den Anbau überdachte. Das Wartezimmer war eigentlich das selten benutzte Wohnzimmer, das mit einem Standspiegel, einem Spieltischchen zum Aufklappen, Polsterstühlen und einem Klavier ausgestattet war und damit einen gutbürgerlichen, ja gehobenen Eindruck machte. Wie gesagt, wurde der Wohnraum nur selten, höchstens an Feiertagen, genutzt; meist saß die Familie in der Wohnküche.
Eine Besonderheit und, für damalige Verhältnisse eine Errungenschaft, bestand in einer Luftheizung, in welcher im Kachelofen des Bestrahlungszimmers erhitzte Luft in die Nachbarräume und nach oben in das Schlafzimmer sowie in das Zimmer des Sohnes gelangte, ohne Ventilator, einfach durch den Auftrieb der heißen Luft. Dieses Heizungssystem war das unfreiwillige Haus-Telefon, denn über den Luftkanal hindurch, verstand man fast jedes Wort, welches unten im Behandlungszimmer gesprochen wurde, wenn man nur dicht genug an der geöffneten Luftklappe im Schlafzimmer das Ohr anlegte. Pauls Großmutter Maria machte davon reichlich Gebrauch und erhob oft unberechtigte Vorwürfe gegenüber dem Großvater, insbesondere was gewisse Geräusche betraf, die bei der Massage entstanden, und von ihr missgedeutet wurden. Hier lag eine der Ursachen für die ständigen Streitereien, vor denen Stiefsohn Emil in eine Bäckerlehre mit Unterkunft flüchtete, sobald er vierzehn geworden war.
Im zweiten Weltkrieg wurde der Heilpraktiker wieder zur Marine für den Sanitätsdienst eingezogen, überlebte die Kriegsereignisse weitgehend durch Stationierung auf der Insel Sylt und kehrte in den ersten Nachkriegstagen mit dem Dienstgrad Feldwebel nach Oggersheim zurück, um hier gleich wieder seine Praxis zu eröffnen. Sein streng katholischer Glaube und seine humanistische, konservative Haltung, verbunden mit den Erlebnissen in zwei Weltkriegen, bewogen ihn, die Ortsgruppe der Christlich demokratischen Partei mit Gleichgesinnten in Oggersheim zu gründen. Jedoch als er in der damals heftig diskutierten Frage der Wiederbewaffnung auf einer Parteiveranstaltung äußerte: Ein demokratischer Staat kann nicht ohne Armee existieren, darauf aufs schärfste angegriffen wurde und sich die Worte gefallen lassen musste: Der Herr Feldwebel will wohl General werden, zog er sich aus der Politik zurück, ohne auf seine Parteimitgliedschaft zu verzichten. Die Praxistätigkeit wurde wesentlich erschwert, als er nach Kriegsende als Hausbesitzer Wohnraum für die ausgebombte Bevölkerung freimachen sollte und er sich für seine Schwiegertochter Anna mit ihren drei Kindern entschied, die noch in Maikammer an der Weinstraße in einem einzigen Raum des überbelegten ehemals jüdischen Weingutes hausten. Das Sprechzimmer wurde nun deren Wohnzimmer und das ehemalige Zimmer des Stiefsohns und in Kriegsgefangenschaft befindlichen Ehemanns von Mutter Anna wurde das Schlafzimmer für vier Personen. Das Sprechzimmer von Großvater Alfred war jetzt der ehemalige Bestrahlungsraum.
Volksschule Oggersheim
Die Schulzeit begann für Paul im Herbst zwei Jahre nach Kriegsende an der Volksschule in Oggersheim, es war die Schillerschule, mitten im Ort gelegen, nicht weit vom Altstadtplatz entfernt, mit der bitteren Erfahrung, einen halben Tag lang einen Raum mit vierundvierzig Mitschülern teilen zu müssen. Es mangelte so kurz nach Kriegsende an Lehrpersonal. Entsprechend groß waren die Klassen. Man musste zwangsläufig auch noch, von der Bevölkerung so genannte, Nazilehrer beschäftigen, worauf noch zurückzukommen ist.
Paul lief am zweiten Schultag während der ersten Pause nach Hause und sagte zu seiner erstaunten Mutter: „Es gefällt mir dort nicht, ich bleibe lieber hier bei dir“. Doch es half nichts, er musste am nächsten Tag zurück in die ungeliebte Lehranstalt. Nach vier Wochen bekam Paul von seiner Klassenlehrerin Fräulein Liebel einen Zettel mit nach Hause, auf welchem stand: Frau Zolar, ich bitte Sie am Freitag, nach der letzten Schulstunde um ein Gespräch in Klasse 2b. Hochachtungsvoll Marianne Liebel. Anna fragte Paul, was das zu bedeuten habe. Aber Paul wusste keine Antwort. Am Freitagmittag, nachdem die Schüler gegangen waren, sagte Fräulein Liebel zu Anna: „Ich glaube ihr Sohn Paul benötigt Sonderunterricht, weil er in Allem nicht folgen kann. Er kann beispielsweise das, was ich an die Tafel schreibe, noch nicht einmal wiederholen“. Anna und Fräulein Liebel sahen zu Paul hin, der nun murmelte: „Ich kann ja auch nicht so genau sehen, was an der Tafel steht“. Paul benötigte also eine Brille! Tage später trug er das Modell Kassenbrille, ein Drahtgestell mit kreisrunden Brillengläser, wie sie viele Jahre später der Beatle Sänger John Lennon populär machte. Zu Pauls Zeit jedoch war einer der eine solche Brille trug, der Brillenglotzer der Klasse. Der stark kurzsichtige Paul trug schwer unter diesem Makel. Das Alphabet erlernte er schnell, und zwar in Schreib- und Druckschrift. Dazu hatte der Deutschlehrer die sogenannte Sütterlinschrift, allgemein als Deutsche Schrift bezeichnet, als weitere Schrift- und Schreibart unterrichtet. Als dieser altgediente Lehrer und Parteigenosse in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurde, war es mit Sütterlin wieder vorbei.
Dieser Lehrer, Herr Wagner, war ein übler Kettenraucher. Seine sämtlichen Finger waren vom Nikotin seiner filterlosen, selbstgedrehten Zigaretten, gelb verfärbt. Seine ganze Erscheinung roch nach Nikotin und Zigarettenasche. Einem geregelten Unterricht waren die ständigen Pausen unzuträglich, in welchen er den Klassenraum verließ um auf dem Flur zu rauchen. Die zurückgelassenen Schüler mussten sich alleine beschäftigen, indem einer von ihnen benannt wurde, einen Text aus dem Lesebuch an die Tafel zu schreiben; natürlich in Deutscher Schrift. Die anderen mussten dann den Tafeltext abschreiben. Diese unsinnige Prozedur wiederholte sich etwa alle Viertelstunde. Herr Wagner mit frischem Aschenbecher-Geruch betrat wieder die Klasse und korrigierte die Fehler des Textes an der Tafel bis ihn erneut die Sucht packte, er einen weiteren Lesebuchtext aussuchte und wieder den Raum verließ. Paul wunderte sich, dass seine Großeltern diese Sütterlinschrift nicht ablegen wollten und sogar Mutter Anna immer noch Elemente dieser Schrift benutzte.
Am liebsten mochte Paul in der Schule das Vorlesen, darin war er eindeutig der Beste in der Klasse. Am wenigsten gefiel ihm jedoch der Rechenunterricht bei Lehrer Biehl. Dieser pflegte intensiv die Kunst des Kopfrechnens in Form der Kettenaufgabe. Paul verlor bei dieser Rechenart meist vorzeitig den Faden. Wenn Herr Biehl dann nach der Lösung fragte: „Wer das richtige Ergebnis hat, streckt den Finger hoch“, war es sinnvoll, stets den Finger hoch zu strecken, denn, falls ein Schüler den Finger unten ließ, wurde er als Erster gefragt: „Na, was hast du denn raus?“ Natürlich war es das falsche Ergebnis. Dann nach dieser Demütigung, wurde es gefährlich. Jetzt kam nämlich einer der Fingerhochstrecker dran. Und wehe, derjenige hatte geblufft. Den nahm sich Herr Biehl mit einer Sonderaufgabe vor. War diese auch falsch gelöst, dann gab es einen Eintrag ins Klassenbuch und entsprechende Bemerkungen hinsichtlich der geringen Intelligenz des Schülers. Paul kamen diese Rechenstunden wie eine Strafe vor. Nicht viel besser fand er die Deutschstunde bei Fräulein Distel, die nach Herrn Wagner an die Schule kam. Diese liebte die Grammatik und das Diktat. Während eines Diktats verordnete sie totale Ruhe. Reden und Abschreiben wurden sofort bestraft, indem der betreffende Schüler die Finger einer Hand zusammengedrückt nach oben strecken musste und Fräulein Distel mit dem flachen Lineal blitzschnell zuschlug und dadurch die Fingernägel stauchte. Ein heftiger Schmerz war die Folge, so dass nach dem Aufschrei manche Träne floss. Einigen empörten Eltern erklärte sie, dies sei eine nicht unübliche Erziehungsmethode an deutschen Volksschulen.
Der Höhepunkt einer Bestrafung im Auftrag pädagogischer Erziehung jedoch gelang dem jungen Vikar Herrn Meissner, welcher den evangelischen Religionsunterricht abhielt. Seinem langweiligen Unterricht, mit entsprechender Unaufmerksamkeit und Unruhe unter den Schülern, folgte als Abschluss regelmäßig eine Hausaufgabe, die mit dem Katechismus zusammenhing. Paul konnte sich noch genau an den Tag erinnern, an welchem es passierte. Herr Meissner hatte die Woche vorher gewarnt: „Wer beim nächsten Mal die Hausaufgaben nicht gemacht hat, wird sein blaues Wunder erleben!“ Paul hatte diese Worte nicht vergessen, vor allem nicht das bedrohliche blaue Wunder. In letzter Minute hatte er am Abend zuvor die ungeliebte Hausaufgabe erledigt; das entsprechende Kapitel aus dem Katechismus gelernt und herausgeschrieben. Nun stand Herr Meissner vor der Klasse mit fünfundzwanzig evangelischen Schülern und teilte diese von Beginn an räumlich in zwei Teile. Der eine Teil umfasste fünfzehn Schüler, welche keine Hausaufgaben vorweisen konnten. Sie kamen nach rechts zur Wandseite. Der Rest der Schüler musste sich links an der Fensterseite hinsetzen. Herr Meissner brüllte nicht, nein er sagte es sanft, mit Zynismus in der Stimme und nach der rechten Seite blickend: „Euch werde ich es zeigen! Glaube bedeutet Gehorsam! Ich werde daher für euch und in euch ein Zeichen setzen, welches lange nachwirkt“. Nach diesen Worten holte er einen Stock hervor, der etwa die Länge von über einem Meter besaß und von einer Weide hätte stammen können. Paul hatte solche Stöcke schon selbst im Maudacher Bruch gefertigt und wusste um deren Möglichkeiten der Schmerzerzeugung. Herr Meissner bat den ersten Schüler, von der rechten Seite, nach vorne und befahl ihm, sich bäuchlings über die vordere Schulbank zu legen. Dann zog er dem verängstigten Kerlchen die kurze Hose stramm und schlug aus voller Kraft mit dem Stock zu. Einmal, zweimal, dreimal, ja bis zu fünfmal drosch der kräftige junge Vikar auf den zarten Hintern ein. Dann kam der Nächste dran. Die Schmerzen waren derart groß, dass einige keine Luft mehr bekamen, während die Tränen flossen. Paul saß da und glaubte an eine Art von Vorsehung. Warum hatte er in letzter Minute die Hausaufgaben gemacht? Er könnte doch genauso jetzt über der Strafbank liegen. Welch ein Glück! Herr Meissner musste nach dem zehnten Schüler eine Pause einlegen, so sehr war er außer Atem geraten. Er sprach immer noch kein Wort, sondern starrte nur aus dem Fenster. Wo ist das Mitleid, die Barmherzigkeit und die Nächstenliebe des Christenmenschen, wie im Katechismus geschrieben, dachte Paul. Pünktlich zum Ende des Religionsunterrichtes hatte der Vikar alle fünfzehn Schüler durchgehauen. Eine Woche später wurde er nach massivem Protest der Eltern zu einer anderen Schule versetzt.
Paul war ein ruhiger und zurückhaltender Schüler, was einige Mitschüler so verstanden, dass er wohl ein Duckmäuser und Prügelknabe sein müsse. Er versuchte jedem Streit rechtzeitig aus dem Weg zu gehen, was aber auf Dauer nicht gelingen konnte. Bei Kindern und Jugendlichen zählt sehr stark die körperliche Überlegenheit, aber auch Verwegenheit und Großmeierei, was zu einem dominierenden Verhalten gegenüber den Mitschülern führt. Paul stand nach Ende eines Schultages im Schulhof plötzlich Hans gegenüber. Der körperlich überlegene Anführer einer Clique in seiner Klasse befahl Paul, er solle seinen Schulranzen öffnen und den Inhalt vorzeigen, sonst setze es Ohrfeigen. Paul rannte jedoch davon und Hans hinterher. Die ersten zehn Meter kam Hans, der keinen Ranzen trug, zum Greifen nahe an Paul heran. Doch dann bekam der schwergewichtige Hans keine Luft mehr und, als Paul halb um das Schulgebäude gelaufen war, hatte er ihn abgeschüttelt. Nun machte Paul den Fehler, ganz um das Gebäude herum wieder zum Ausgangspunkt zurück zu laufen. Dort stand Hans völlig ausgepumpt, inmitten seiner Clique, als Paul ankam. „Wie, du lässt dich hier noch mal blicken“? rief Hans Paul entgegen. „Du kannst mich ja doch nicht erwischen“, entgegnete Paul und trat einen Schritt näher. Da packte Hans den Hemdkragen von Paul und versuchte ihm den linken Arm zu verdrehen. In diesem Moment geschah mit Paul etwas, was ihn im Nachhinein noch lange beschäftigen sollte. Die große Angst vor körperlichem Schmerz, die ihn erfasste, verwandelte sich urplötzlich in eine ungewohnte, unheimliche Aggressivität. Wie mit einem Killerinstinkt ausgestattet, umschlang er blitzschnell mit dem rechten freien Arm den Hals von Hans und drückte unerbittlich zu. Für Hans kam diese plötzliche Attacke so überraschend, dass er ohne Gegenwehr nur noch um Luft rang. Die umstehende Clique schrie nun Paul an: „Du bringst ihn ja um!“ Und dieser kam rechtzeitig zur Besinnung; er ließ los und trat einen Schritt zurück. Hans fasste sich an seinen Hals und mit trockener Stimme, immer noch nach Atem ringend, sagte er zu Paul: „Das hast du falsch verstanden; das war doch nicht so ernst gemeint; du musst verrückt sein, gleich so zu reagieren.“ Paul drehte sich um und schlug den Weg nach Hause ein. Nach diesem Ereignis begegnete man Paul in der Klasse mit gewisser Vorsicht, da seine Überreaktion Eindruck gemacht hatte. Paul fragte sich danach oft, was mit ihm geschehen war in diesem Moment der Not; könnte er auch einen Menschen töten, in Notwehr? Aber das war doch noch keine echte Notwehr. Wer entschied das für ihn?
In Pauls Klasse gingen auch die Kinder einiger Honoratioren des Ortes, das heißt der strohblonde Bernd, Sohn des Brauereibesitzers Meierhofer, der großgewachsene Maximilian, Sohn der praktischen Ärztin Frau Doktor Windenau und der kleine Erwin von der Schillerapotheke. Diese Mitschüler verhielten sich ganz normal, wie alle anderen in der Klasse; jedoch waren sie für Höheres vorgesehen. Nach der vierten Klasse verließen sie die Volksschule in Oggersheim und besuchten fortan das Gymnasium in Ludwigshafen. Damals war es nur wenigen Volksschülern vergönnt, auf eine sogenannte Oberschule zu wechseln; zumal das Gymnasium Schulgeld kostete. Meierhofers Bernd hatte die Erlaubnis seiner Eltern erhalten, einige Schulfreunde zu einer Abschiedsfeier bei sich zu Hause einzuladen. Paul gehörte auch zu diesem Kreis. Vorauszuschicken ist, dass das Meierhoferbräu an der Schillerstraße sowohl die Privatbrauerei, die Brauereigaststätte sowie die Brauereivilla, als geschlossenes Ensemble mitten im Ort gelegen, umfasste und den Besitzern einen für damalige Verhältnisse im Jahre 1951, beneidenswerten Wohlstand bescherte. Aus seinen bescheidenen Wohnverhältnissen in der Beethovenstraße kommend, betrat Paul an diesem Nachmittag ein Wunderland. Bernd Meierhofers Eltern hatten ihrem Sohn bei dem schönen Wetter im Lampion geschmückten Hof der Villa einen Tisch eingedeckt und die fünf Schüler, die Bernd eingeladen hatte, mit Torte und Limonade traktiert. Es sollte später, wie Paul hörte, noch eine große Feier für Bernd geben, zu welcher Freunde der Familie eingeladen waren und welche im Hause an der langen Tafel im Esszimmer der Villa stattfinden würde. Paul wunderte sich über solch einen Aufwand, nur für den Schulwechsel des kleinen Bernd. Der Höhepunkt für Bernds Schulfreunde bestand dagegen, nach all den Kuchenbergen und vielen Süßigkeiten, darin, dass Bernd die Freunde ins Haus bat, sie durch die prächtigen Räume führte und mit ihnen die Treppe ins Untergeschoß hinab stieg. Gleich bei der ersten Tür im Flur blieb er stehen und sagte: „Ihr dürft mir aber nichts anfassen, sonst könnt ihr sofort gehen.“ Paul rätselte noch darüber, was diese Warnung bedeuten könne, als die Tür aufging. In dem dahinterliegenden Raum tat sich ein Wunderland auf. Die Blicke fielen auf eine riesige Modelleisenbahnanlage, bestehend aus einer Miniaturlandschaft mit Bergen, Häuschen und Straßen, und vor allem mit zahlreichen Eisenbahngleisen, die durch Bahnhöfe und in Tunnels, über Brücken und Weichen, führten. Eisenbahnzüge der Marke Märklin bevölkerten die Gleise und setzten sich plötzlich in Bewegung, nachdem Bernd auf einen großen roten Knopf gedrückt hatte. „Es ist alles automatisiert“, sagte jetzt Bernd zu den anderen. „Gehört das alles dir?“ fragte Paul zurück. Bernd nickte stolz. Die Demonstration dauerte etwa fünfzehn Minuten, die die sogenannte Nacht als High Light hatte, bei der das Raumlicht aus und die vielen Lämpchen der Anlage eingeschaltet wurden. Ein grandioser Anblick, wie die Züge mit beleuchteten Wagen durch die Dunkelheit fuhren! Dann ging das Licht wieder an. Bernds Mutter stand in der Tür und drängte die Fünf zum Aufbruch, ohne Bernd gefragt zu haben. Der sah immer noch stolz aus und erhob keinen Widerspruch. Jeder der Schulfreunde erhielt noch eine Tüte mit Süßigkeiten. Dann schloss sich das große Tor zum Hof hinter ihnen. Paul sollte nie wieder mit Bernd Kontakt haben. Dieser gehörte fortan zu einer anderen Klasse.
Nach der sechsten Klasse wechselte Paul mit der Hälfte seiner Klassenkameraden von der Schillerschule zur neuen, kleineren Schlossschule, wo man die Konduktion ausprobieren wollte. Aus einer Mädchen und einer Jungenklasse wurden so zwei gemischte Klassen. Es funktionierte erstaunlicherweise gut, vielleicht weil in Pauls Klasse die alten Anführer in der Parallelklasse landeten. Paul empfand jetzt die Harmonie in seiner Klasse, die sich dort schnell zwischen Schülerinnen und Schülern entwickelte, als sehr wohltuend. Wahrscheinlich trug auch der Lehrer, Herr Hansen, viel dazu bei. Dieser, kurz vor der Pensionierung stehender Pädagoge, war von Altersmilde und Verständnis für die Schüler geprägt. Seine Unterrichtsmethode bestand vor allem darin, kleine Gruppen, stets ausgewogen mit der gleichen Anzahl von Mädchen und Jungen, zusammenarbeiten zu lassen. Am beliebtesten war der Sachkundeunterricht bei Herrn Hansen. Beispielsweise mussten die Schüler die Funktionsweise eines Viertakt-Ottomotors an einem selbstgebauten, zweidimensionalen Modell demonstrieren. Paul ging jetzt sehr gern zur Schule. Da beschlossen Pauls Eltern von Oggersheim in die Innenstadt von Ludwigshafen umzuziehen, wo eine vernünftige Wohnung und für Vater Emil ein kürzerer Weg zur Arbeitsstelle in der BASF warteten.
Oggersheim
Oggersheim, das seit etwa dem Jahr 1317 die Stadtrechte besaß, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Man muss sich Oggersheim nach Kriegsende so vorstellen: Der Ort blieb vor Zerstörungen verschont. Es war überwiegend mit kleinen Häusern bebaut, viele renovierungsbedürftig, die oft mit einem niedrigen Sanitärkomfort ausgestattet waren. So lagen viele Plumpsklosetts oft außerhalb des Hauses. Die Straßen waren in der Regel unbefestigt; nur die Durchgangsstraßen nach Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal trugen eine Fahrbahndecke aus Pflastersteinen. Mittelpunkt des Ortes war der Schillerplatz, der zu Ehren des großen Dichters, welcher auf der Flucht vor seinem württembergischen Landesherrn Herzog Carl Eugen, im Jahre 1782 für siebeneinhalb Wochen in Oggersheim nächtigte, dessen Namen trug. Friedrich Schiller, ein fahnenflüchtiger Regimentsarzt und im Begriffe einer der größten deutschen Dichter zu werden, der bereits mit seinem Theaterstück Die Räuber bei der Uraufführung im Mannheimer Nationaltheater im Januar 1782 einen ersten Erfolg hatte, hoffte auf die Aufführung eines weiteren Stückes: Die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Leider vergeblich. Während der kurzen Aufenthaltszeit in Oggersheim schrieb er an dem Drama Kabale und Liebe.





























