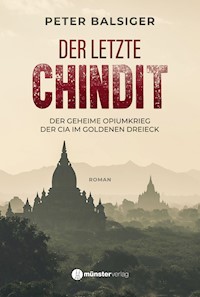
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Münsterverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Antoine Steiner glaubt das Leben zu kennen. Es hat ihn von Abenteuer zu Abenteuer geführt. Vom Kriegsreporter in Vietnam und Biafra in die Glitzerwelt der Casinos von Las Vegas, von den Handelsräumen der Börsen an einen paradiesischen Ort am Indischen Ozean. Er ahnt nicht, dass ihm das größte Abenteuer seines Lebens noch bevorsteht: Als sein bester Freund im Goldenen Dreieck Burmas, dem größten Opium-Anbaugebiet der Welt, spurlos verschwindet, erhält er den Auftrag, Joachim zu suchen. Es ist eine "Mission Impossible". Sein Weg führt ihn über gefährliche Dschungelpfade in ein Gebiet, in dem brutale Banden, kriegerische Bergstämme und korrupte Drogenbarone um die Macht – und das Opium – kämpfen. Allen voran der grausame und mächtige chinesische Warlord Xu, gegen den Joachim kämpft und in dessen Visier bald auch Antoine gerät. Eine Veränderung bahnt sich an, als die französische Journalistin Claire Antoine im Dschungel aufspürt. Er ist inzwischen der "Chindit", der "Löwe", wie die Shan-Stämme ihren militärischen Anführer nennen. Doch Gefühle machen selbst einen Löwen verwundbar, und der Warlord Xu hat ihm ewige Rache geschworen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Balsiger
Der letzte Chindit
Der geheime Opiumkrieg der CIA im goldenen Dreieck
Roman
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Prolog
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil II: Claire
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil III: Der Chindit
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Nachwort
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
1. Auflage Februar 2022
©Münster Verlag, Zürich und Peter Balsiger
Verlag: Münster Verlag, Zürich und D-Singen
Lektorat: Renate Haen
Coverdesign und Satz: Cedric Gruber
unter Verwendung von Bildern: ©unsplash.com Sven Scheuermeier
Klappentext: Peter Balsiger
Druck und Einband: CPI Buch bücher.de GmbH, Printed in Germany
ISBN: 978-3-907301-34-0
elSBN: 978-3-907301-35-7
Audio ISBN: 978-3-907301-36-4
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buchs darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags
reproduziert werden.
Verlagsanschrift:
Münster Verlag Deutschland
Werner-von-Siemens-Straße 22, D-78224 Singen
Tel: +49 7731-8380, [email protected]
www.muensterverlag.ch, www.rosenegg.de
Chindit, eigentlich Chinté, ist die Bezeichnung für eine mächtige Löwenfigur in der burmesischen Mythologie. In der Geschichte des burmesischen Shan-Stammes trug der oberste Krieger stets die Bezeichnung „Chindit“. Im Zweiten Weltkrieg nannte sich eine Spezialeinheit der britischen und indischen Armee, die in Burma operierte, Chindits.
Prolog
April 2019
Es gibt Momente im Leben, da man wieder mit Erinnerungen konfrontiert wird, von denen man geglaubt hatte, sie wären längst vom Grau des Vergessens zugedeckt worden. Umso schmerzhafter sind diese Erinnerungen, wenn sie mit einem Gefühl der Schuld verbunden sind. Und mit der Ahnung, dass man irgendwann einen Preis dafür würde bezahlen müssen.
Dreissig Jahre lang hatte ich den Moment hinausgezögert, diese Orte wieder zu besuchen, die mein Leben und das Leben anderer Menschen verändert hatten. Wie ein Pilger, der Abbitte leisten will. Und hier in Chiang Rai, in dieser lauten Provinzstadt im Norden Thailands, ahnte ich, dass jetzt der Moment gekommen war, diesen Preis zu bezahlen.
Denn hier in Chiang Rai hatte damals alles begonnen.
Ich war mit der Air France von Paris nach Bangkok geflogen und zwei Tage in der Stadt geblieben. Ich hatte wie damals im Hotel „Mandarin Oriental“ eingecheckt, jener prächtigen Oase am Fluss Chao Phraya, die ihren kolonialen Charme längst verloren hatte und dank chinesischer und japanischer Investoren zu einem prunkvollen, aber seelenlosen Refugium für reiche Touristen geworden war.
Das „Oriental“: eine Lobby aus Marmor, ein halbes Dutzend lächelnde, weiß gekleidete Angestellte, die mich begrüßt, mir die Taschen abgenommen, einen Drink gereicht, die Check-in-Formalitäten erledigt, nach Sonderwünschen gefragt, mich zum Lift begleitet und mir am Eingang meines Zimmers einen ebenfalls weiss gekleideten Butler vorgestellt hatten, der sich persönlich um mein Wohl kümmern würde.
Ich blieb die ganze Zeit im Hotel. Schaute vom Balkon meines Zimmers im vierzehnten Stock hinab auf die Lastkähne und Vergnügungsboote auf dem Fluss und widerstand der Versuchung, die „Bamboo Bar“ zu besuchen oder gar einen Abstecher ins Amüsierviertel zu machen. Ob Patrick wohl noch lebte, der Besitzer der „Hangover Bar“ in Patpong, der mir damals die junge Thai-Frau Mai vorgestellt hatte, der ich zum Verhängnis hatte werden sollen?
Am nächsten Morgen flog ich nach Chiang Rai. Am Flughafen erwartete mich eine klimatisierte Limousine, die ich vom „Oriental“ aus für mich hatte buchen lassen. Wir fuhren auf breiten Strassen an modernen Glaspalästen vorbei. Aus der verschlafenen Provinzstadt von damals, auf deren von Schlaglöchern durchsetzten Strassen noch Ochsenkarren verkehrt hatten, war eine moderne Metropole geworden.
Ich drückte dem Fahrer einen Zettel mit der Adresse von Xus Villa in die Hand. Xu, der chinesische Warlord und Opiumhändler, den sie den „Schlächter“ genannt hatten, schmorte, wie ich hoffte, schon lange in der Hölle. Der Fahrer hielt an und wies auf ein Geschäftsviertel. Ich erkannte die Gegend nicht wieder. Die Villa hatte offensichtlich einem Bürogebäude mit einer Burger-King-Filiale im Erdgeschoss weichen müssen.
Ich hatte noch eine zweite Adresse notiert. Jene des Wahrsagers, dessen Prophezeiungen sich auf so wundersame Weise erfüllt hatten. Aber letztlich gab ich auf. Das Haus hatte damals gleich hinter dem Markt gestanden, der inzwischen von einer grossen Shopping Mall verdrängt worden war.
In Mae Sai überquerten wir die Grenze zu Burma. Kaum Formalitäten. Der Wagen bahnte sich hupend einen Weg durch Hunderte von Touristen, die sich durch das grosse, goldfarbene Grenztor drängten, um im nahen Tachilek billige Souvenirs oder elektronische Artikel aus China einzukaufen.
Hinter Tachilek bogen wir zum Kloster ab. Ich erkannte es gleich wieder, sah die langen Steintreppen, die von in Sandstein gehauenen Nagas – halb Mensch, halb Kobras – gesäumt waren. Nichts hatte sich hier verändert. Friedliche Stille lag über allem. So wohltuend nach der Hektik von Chiang Rai und Tachilek.
Ein Mönch in der traditionellen roten Robe erwartete mich am Fuss der Treppe.
„Sie sind Mr. Steiner, nicht wahr?“, sagte er. „Der ehrwürdige Abt wird Sie gleich empfangen.“
Auf diesen Moment hatte ich lange hingearbeitet und dafür mein ganzes Netzwerk mobilisiert. Ich hatte Jahre gebraucht, um zu erfahren, was aus Somchai geworden war. Jahre, um eine Besuchsbewilligung der Behörden Myanmars, wie Burma nun hiess, und der buddhistischen Geistlichkeit zu erhalten.
Somchai wartete im Gästeraum des Klosters.
Er war dünn, fast gebrechlich geworden. Seine dunkelrote Robe hing schlaff an seinem Körper herunter. Aber seine Augen leuchteten auf, als er mich sah.
Ich faltete meine Hände zum traditionellen Wai-Gruss vor der Brust und verneigte mich. Aber Somchai nahm mich einfach in seine Arme, hielt mich lange fest.
„Antoine, mein Freund. Es ist so lange her. So lange. Aber du bist zurückgekommen. Endlich.“
Ein Mönch servierte Jasmintee. Somchai hielt meine Hand. Wir redeten nicht viel. Es gab auch nichts zu bereden. Er wusste, warum ich hier war.
„Wir fahren gleich mit einem Jeep nach Baan Saw hinauf. Es gibt jetzt eine Strasse, die zum Teil schon asphaltiert ist. In etwa zwei Stunden sind wir dort.“
Der weisse Toyota wartete vor dem Kloster. Ein Mönch setzte sich ans Steuer, Somchai und ich sassen im Fond des geräumigen Fahrzeugs, das sich jetzt in endlos scheinenden Kurven durch die dichte Dschungellandschaft über die Hügel kämpfte.
Vor dreissig Jahren hatten wir für diese Strecke drei Tage gebraucht. Zu Fuss über einen schmalen Dschungelpfad, der gerade breit genug war für unsere Maultierkolonne.
Dann sah ich das Dorf. Wir hielten am Eingang an, parkten den Jeep und gingen in Richtung Zentrum. Vorbei an kleinen Läden, die Lebensmittel und Souvenirs anboten. Ich glaubte einige der alten Häuser wiederzuerkennen. Aber vielleicht war es auch nur sentimentales Wunschdenken. Im Zentrum, oben auf dem Hügel, wo früher das Camp gestanden hatte, befand sich jetzt eine Schule. Die drei Wachtürme waren längst abmontiert, die Bunker eingeebnet.
Ein teilweise vom Dschungel überwucherter Pfad führte rund hundert Meter hoch auf einen winzigen Platz, der sorgfältig von allem Unkraut gesäubert schien. Irgendjemand kümmerte sich offenbar um das Grab.
„Hier muss es sein“, sagte Somchai, der etwas ausser Atem war.
Der grobe graue Stein war verwittert, die Inschrift stellenweise nicht mehr lesbar. Somchai beugte sich vor, setzte umständlich eine Brille auf und las langsam die Inschrift vor.
„Joachim“ stand in grossen Lettern auf dem Stein. Darunter in das Grau gemeisselt eine Inschrift in der Sprache der Shan: „Zwischen Gedanke und Tat fällt der Schatten“. Zeilen aus einem Gedicht des englischen Dichters T.S. Eliot. Es war Joachims Lieblingsgedicht, und die paar Zeilen, die er oft zitiert hatte, waren auch irgendwie zum Motto seines Lebens geworden.
Wir blieben noch lange vor dem Stein stehen. Somchai sprach leise vor sich hin. Eine buddhistische Sutra offensichtlich. Ich würde ihn nachher fragen, was er gesagt hatte.
Und ich? Was sollte ich sagen? Dass es mir leidtat? Dass ich mich immer noch schuldig fühlte an seinem Tod? Und am Tod anderer Menschen? Ich hatte mit dieser Schuld schon so lange gelebt. Und jetzt fand ich keine Worte mehr dafür.
Wir gingen zum Parkplatz zurück. Eine alte Frau stand dort. So, als ob sie auf uns wartete. Die eine Hälfte ihres zerfurchten Gesichts war tätowiert. Sie starrte mich lange ungläubig an, ging dann auf mich zu, berührte mit einer Hand behutsam die tiefe Narbe auf meinem Gesicht.
„Ba?“, sagte ich fragend. „Ba?“
Sie nickte, lächelte.
Es war Ba, die Frau, die mich damals gesund gepflegt hatte, als ich mit Malaria darniedergelegen hatte und dem Tod nahe gewesen war.
Und jetzt erkannte auch Somchai sie wieder. Nahm sie ebenfalls in die Arme.
Inzwischen waren ein paar Dorfbewohner zum Parkplatz gekommen und verfolgten neugierig das Schauspiel.
Dann nahm Ba meinen Arm, hob ihn in die Höhe und rief laut und immer lauter etwas in der Sprache der Shan. Tanzte dazu, während Tränen über ihre Wangen liefen.
„Was sagt sie?“, fragte ich den Mönch, der den Dialekt verstand.
„Sie sagt: ‚Der Chindit ist zurück, der Chindit ist zurück.‘“
Und nun drängten sich auch ein paar Alte vor. Menschen, die mich offensichtlich wiedererkannten. Sie stimmten in die Rufe ein, bis sie schliesslich zu einem Chor anschwollen:
„Der Chindit ist zurück!“
Teil I
Kapitel 1
Goa (Indien), März 1990
Der Brief, der sein Leben verändern sollte, lag inmitten von Prospekten in dem mit einer Buddhafigur verzierten Holzbriefkasten am Eingang der alten Kolonialvilla.
Ein Brief aus München. Von Beatrix, der Tochter Joachims, seines besten Freundes.
Antoine steckte den Brief in seine Tasche und ging durch das schmiedeeiserne Tor durch den Palmengarten auf die schattige Terrasse. Die Villa lag am Rand eines grossen Reisfelds, ein paar Kilometer von den exotischen Stränden des Hippie- und Aussteigerparadieses am Indischen Ozean entfernt.
Antoine blickte hinaus auf die abendliche Szenerie. Fischreiher schwebten majestätisch ein, stapften durch das knöcheltiefe Wasser. Die Reisbauern pflügten wie vor tausend Jahren: Wasserbüffel zogen träge einen hölzernen Pflug durch die von Deichen gesäumten Felder.
Die Deiche waren wie Verkehrswege. Hier spielte sich das Leben ab. Frauen mit Einkaufstaschen, Ochsen und streunende Hunde benutzten sie, hier schwatzte und flirtete man. So hatte es schon vor hundert Jahren da gelegen, das Reisfeld. Und nichts hatte sich seither verändert. Hier war alles eingebettet in den ewigen Kreislauf der Natur.
Dann las er den Brief.
Joachim sei seit Monaten im Norden Thailands oder in Burma verschollen, schrieb Beatrix. Er habe dort für die amerikanische Hilfsorganisation Global Helpgearbeitet, die von der thailändischen Grenzstadt Chiang Rai aus operiere und die Shan-Bergstämme im nahen Burma mit Hilfslieferungen versorge. Angeblich sei Joachim entführt worden. Aber es gab keine Lösegeldforderung. Die Polizei habe die Ermittlungen eingestellt. Sie könne jedoch nicht an den Tod ihres Vaters glauben und bitte Antoine um Hilfe.
Beatrix hatte eine Kopie von Joachims letztem Brief beigefügt. Er war bereits vier Monate alt. Ihr Vater schrieb, dass er nicht mehr an seine humanitäre Mission glaube. Die Shan brauchten keine Konserven, sondern Gewehre und Patronen. Denn die burmesische Zentralregierung, Drogenbarone und chinesische Warlords unterdrückten die Bergstämme brutal. Er sei Zeuge von Massakern geworden. Er habe tote Kinder und vergewaltigte Frauen gesehen. Und nun könne er einfach nicht mehr zuschauen. Er sei selbst zum Täter geworden. „Ich habe mit meiner Vergangenheit gebrochen. Ich habe jetzt Blut an meinen Händen. Suche mich nicht.“ Und er hatte hinzugefügt: „Frag Antoine, er wird mich verstehen.“
Beatrix hatte ein Polaroidfoto beigelegt. Aufgenommen vor einem buddhistischen Tempel. Es zeigte einen lachenden Joachim, der den Arm um eine hübsche Asiatin gelegt hatte. Neben ihm ein junger Mann in der roten Robe eines buddhistischen Mönchs. „Nisha und Somchai – meine Freunde“ stand hingekritzelt unten auf dem breiten weissen Rand des Fotos.
Antoine goss sich einen Feni ein, einen einheimischen Schnaps aus Kokosmilch, und zündete ein Räucherstäbchen an.
Er schaute lange hinaus auf das Reisfeld, über dem es allmählich dunkel wurde. Es war nicht der spektakuläre Sonnenuntergang der Strände von Goa, mit seinem reichen Farbenspiel und der atemberaubenden Kulisse. Aber für Antoine hatte er seinen ganz eigenen Charme. Das Licht wurde allmählich weich, milderte die Konturen, die ersten Feuer flackerten auf. Und dann, als die Dämmerung einsetzte, hob im Reisfeld, als ob ein unsichtbarer Dirigent den Taktstock gehoben hätte, ein tausendstimmiges Konzert von Fröschen und Zikaden an. Und durch das Dunkel drang, wie eine Lightshow, der pulsierende Lichtschein von Hunderten von Glühwürmchen.
Er las den Brief noch einmal durch. Dann bestieg er sein Motorrad, eine rote Enfield, und fuhr in den nahen Küstenort Baga. Er hielt an einer der windschiefen Bretterbuden am Strassenrand, die internationale Telefon- und Faxverbindungen anboten, und rief Beatrix an. Es war kurz vor Mitternacht in München. Aber Beatrix nahm sofort ab.
Seit ihrem Brief, der eine Woche unterwegs gewesen war, hatte sich nichts Neues ergeben. Global Help schloss, wie Beatrix berichtete, nicht aus, dass Joachim, der grosse Sympathien für die Shan-Guerillas gezeigt habe, irgendwie in derenKämpfemit den Regierungstruppen verwickelt worden sei. Und nein, sie habe keine Ahnung, wer Nisha oder Somchai seien.
Am nächsten Morgen joggte Antoine noch vor Sonnenaufgang den um diese Zeit noch menschenleeren Strand entlang bis zum Hotel „Fort Aguada“ und zurück – seine Morgenroutine. Die Luft war angenehm kühl. Die Strandbars waren noch geschlossen, ein paar Touristen schliefen unter den Palmen ihren Rausch aus, die Fischer machten ihre Holzboote zum Auslaufen bereit.
Zurück in seinem Haus nahm er eine Dusche, zog sich um und trank einen Espresso. Dann fuhr er mit seinem Motorrad nach Anjuna, einer rund zehn Kilometer entfernten Künstlerkolonie. Er nahm den Weg durch das fast menschenleere indische Hinterland, fuhr an den alten Bewässerungskanälen entlang, über uralte Brücken, durch Reisfelder, in denen sich die Sonne spiegelte, über die versandeten und schwer befahrbaren Wege durch die Bauerndörfer. Er wich Schweinen, spielenden Kindern und Bauern aus, die mit ihren von Wasserbüffeln gezogenen Karren von den Feldern kamen.
In Anjuna parkte er sein Motorrad am Rande des Flohmarkts, der jeden Mittwoch stattfand und scharenweise Touristen anzog, drückte dem Wächter ein paar Rupien in die Hand und bahnte sich einen Weg durch die Besuchermassen. Der Flohmarkt war eine bizarre Mischung aus indischem Markt und Karneval, Folkloreshow und Esoterik-Happening. Hunderte von Händlern hatten ihre Waren auf Tüchern auf dem Sandboden unter den Palmen ausgelegt. Dunkelhäutige, tätowierte Frauen aus Rajasthan in ihren roten Saris verkauften Decken, Kissen, Halsketten und mit Glasperlen bestickte Taschen. Dazwischen Flüchtlingsfamilien aus Tibet, die Silberschmuck und Buddhastatuen anboten, Händler aus Kaschmir mit ihrem billigen Tand, Kartenleser, Astrologen, Bettler, Wahrsager, Ayurveda-Heiler, Masseure und Feuerschlucker.
Überall wurde gehandelt, gefeilscht, geschrien, verwünscht, gedrängelt. Touristen aus den Luxushotels mischten sich mit glatzköpfigen Freaks im Guru-Look und struppigen Trampern. Es roch nach Safran und Räucherstäbchen, nach frittierten Bananen, Marihuana und Schweiss. Aus grossen Lautsprecherboxen vor dem Restaurant „Sea Breeze“ dröhnte Techno-Sound, der die Flötenmelodien der Schlangenbeschwörer wegfegte.
Antoine drängte sich zu dem kleinen vietnamesischen Imbissstand am Rande des Flohmarkts durch, der Pho-Suppen und echten italienischen Espresso anbot. Er war eingeklemmt zwischen den Ständen einer jungen Deutschen mit Dreadlocks, die Tarotlesungen und Rebalancing-Massagen offerierte, und einem Inder, der „magische Teemischungen“ verkaufte.
Ky, der Besitzer, sass entspannt an dem klapprigen Tisch und trank einen Espresso. „Antoine, mein Freund, ban có khe không – wie geht es dir?“
Ky war Vietnamese, ehemaliger Offizier der vietnamesischen Armee. Um die fünfzig. Weisses T-Shirt. Grüne Uniformhose. Militärisch kurz geschnittenes Haar. Der Imbissstand und eine Bäckerei in Anjuna wurden von seiner Familie betrieben, die 1975 im Chaos des untergehenden Regimes aus Vietnam geflohen war.
„Ky, ich brauche deinen Rat“, sagte Antoine nach dem üblichen Small Talk und Austausch von Höflichkeiten.
Er nahm vorsichtig auf dem zweiten wackligen Stühlchen am Tisch Platz, liess sich von Ky einen Espresso zubereiten und schilderte ihm die Fakten. Sein Freund Joachim war offensichtlich in Burma verschwunden, hatte seinen Job als Koordinator der amerikanischen Hilfslieferungen für die Shan-Bergstämme geschmissen und kämpfte nun möglicherweise an der Seite der Guerillas. Schliesslich hatte er geschrieben, dass er jetzt Blut an den Händen habe. „Ausgerechnet Joachim, der Buddhist geworden und immer gegen den Krieg gewesen ist. Vermutlich ist er tot. Ermordet oder bei den Kämpfen gefallen. Seine Tochter will das aber nicht glauben und hat mich gebeten, Joachim zu suchen.“
„Warst du schon mal in Burma?“, fragte Ky.
Antoine schüttelte den Kopf.
„Du weisst ja, dass ich nach dem Kriegsende dort war. Meine Geschichten kennst du. Drogenschmuggel zur Finanzierung der Fluchtrouten für untergetauchte vietnamesische Soldaten und Zivilisten. Alte Geschichten.“
„Alte Geschichten?“, fragte Antoine lächelnd. „Ich weiss doch, dass du immer noch Kontakte nach Saigon hast und dort Menschen hilfst, ins Ausland zu flüchten. Nach Laos oder Thailand. Oder auch nach Burma.“
Ky zuckte nur die Achseln.
„Burma versinkt im Chaos, jeder kämpft dort gegen jeden“, sagte er schliesslich. „Die Kämpfe sind grausam. Massaker sind an der Tagesordnung. Alles dreht sich um Opium. Vergiss nicht, Burma ist der grösste Opiumproduzent der Welt. Und jeder will davon profitieren. Ich war mehrmals im Shan-Gebiet. In einem Umkreis von hundert Kilometern hast du burmesische Polizei, die Thailändische Befreiungsarmee, Shan-Guerillas, kommunistische Pathet Lao, reguläre nordvietnamesische Einheiten, Banditen und chinesische Warlords, sogar noch Reste der Kuomintang-Armee, die Tschiang Kai-Shek nach der Flucht nach Formosa dort zurückgelassen hat. Und nicht zuletzt mischt auch die CIA mit. Wie gesagt: Jeder kämpft dort gegen jeden.“
Antoine schwieg eine Weile.
„Du hast kaum Chancen, da lebend herauszukommen. Vergiss es“, sagte Ky. „Ausserdem beginnt bald der Monsun. Da ist fast kein Durchkommen mehr im Dschungel.“
Ky erzählte weitere Einzelheiten über Burma. Über das Goldene Dreieck im Grenzgebiet von Laos, Thailand und Burma. Dort, wo in schwer zugänglichen Berggegenden der Schlafmohn angebaut und dann mit Maultieren meist nach Thailand transportiert wird. Über die vielen Bergstämme im Gebiet der Shan, die mit dem Opiumhandel den Kampf gegen die Zentralregierung finanzieren. Über die Geheimdienste, die chinesischen Händler und die Mafia, die mitmischen. Und die korrupten thailändischen, laotischen und burmesischen Generäle, die von dem Geschäft profitieren. „Ich glaube nicht, dass dein Freund noch lebt“, schloss er. „Ein Menschenleben gilt dort nichts. Dieses Land ist schlimmer als die Hölle.“
Antoine versank ins Grübeln. Wollte er wirklich sein entspanntes Leben als vermögender Privatier in Goa aufgeben? Wofür? Für eine gefährliche Reise in ein gesetzloses und barbarisches Land, in dem nur das Recht des Stärkeren galt? Im Dschungel und in den Reisfeldern Vietnams hatte er den Krieg – und den Tod – aus nächster Nähe erlebt. Eine Erfahrung, die ihn geprägt und verändert hatte. Aber das lag fast zwanzig Jahre zurück. Und der Krieg, der damals eine gefährliche Faszination auf ihn ausgeübt hatte, der Exotik und Abenteuer versprach, war für ihn längst ein abgeschlossenes Kapitel. Ihm war klar, dass seine Chancen, Joachim zu finden, nicht gross waren und dass er in Burma Gefahr lief, von einem dieser Warlords umgebracht zu werden.
Andererseits … Joachim war sein bester und ältester Freund. Und höchstwahrscheinlich in grosser Gefahr. Nachforschungen konnte er doch wenigstens anstellen. Sich an Global Help wenden, deren Niederlassung sich ja im sicheren Thailand befand. Im persönlichen Gespräch mit deren Leiter würde er bestimmt mehr erfahren als Beatrix telefonisch von München aus. Und vielleicht konnte er auch in einer anderen Sache mehr in Erfahrung bringen …
„Sag mal, Ky, du hast mir doch neulich erzählt, dass sie dieses Umerziehungslager jetzt endlich aufgelöst haben – hast du irgendwas rauskriegen können?“
„Über Thuy? Tut mir leid, mein Freund. Ich weiss immer noch nicht mehr, als dass sie, wie so viele Studenten nach dem Fall von Saigon, in dieses Umerziehungslager gesteckt wurde – irgend so ein Malariadreckloch im Mekongdelta. Die Gefangenen mussten auf den Reisfeldern arbeiten. Und als das Lager kürzlich aufgelöst wurde, war Thuy nicht unter den Überlebenden. Das weiss ich mit Sicherheit.“
Antoine nickte. Er hatte eigentlich nichts anderes erwartet, sonst hätte Ky ihn schon längst informiert. Er gab sich einen Ruck.
„Ich werde trotzdem nach Joachim forschen. Kannst du dich in den nächsten Wochen um mein Haus kümmern? Die Miete ist bis Ende des Jahres bezahlt.“
Er verabschiedete sich von seinem Freund, der ihm besorgt „Viel Glück!“ wünschte, und fuhr hinunter zum Strand. Zur wöchentlichen Pokerrunde im „21Coconuts“, einer Strandbar mit dem angeblich besten Essen in Goa. Geführt von Sonja und Thomas, einem Schweizer Ehepaar.
Thomas war ein ehemaliger Pokerprofi, und so traf sich in seinem Lokal jeden Mittwoch ein harter Kern von Playern. Alle waren gut betucht, sogar ein indischer Milliardär war darunter, ein Bierbaron.
Wie immer spielten sie um hohe Summen, und wie fast immer hatte der Milliardär das Nachsehen. Wütend warf er die Karten auf den Tisch. „Verdammt, Antoine, warum verliere ich eigentlich ständig? In meinem Business habe ich Millionen gemacht. Und hier bin ich andauernd der Loser …“
„Ganz einfach, Vijay“, antwortete Antoine, der sich ein Lachen nicht verkneifen konnte, „es ist dein Ego. Du gibst deine Gewinne leichtfertig her, weil du uns etwas beweisen und uns beeindrucken willst. Und du erhöhst dann den Einsatz, weil du glaubst, dass sich das Blatt noch wendet. Aber du hast nicht die Disziplin, rechtzeitig aufzugeben.“
Normalerweise gab der Verlierer ein paar Flaschen indischen Champagner der Marke Marquise de Pompadour aus, den sich Antoine sonst nur ungern hätte entgehen lassen. Heute jedoch hatte er Wichtigeres zu tun. Er stand auf.
„Ich habe noch einen Termin“, erklärte er. „Und übrigens werde ich ab jetzt ein paar Wochen fehlen. Eine Auslandsreise. Geschäftlich. Aber keine Angst, ich komme zurück.“
Er verabschiedete sich ohne grosses Tamtam und fuhr mit seiner Enfield davon.
Ihm war klar, dass er seinen Mitspielern ein Rätsel war. Sie wussten kaum etwas über ihn, da er keine Lust hatte, vor diesen Menschen, mit denen ihn abgesehen vom Pokerspiel nichts verband, über sich zu reden. Für sie war er im Vorjahr am Ende des Monsuns plötzlich aufgetaucht und hatte die Villa gemietet. Ein Aussenseiter. Alleinstehend. Keine Freunde, keine Frauengeschichten. Bestimmt fragten sie sich, wovon er lebte. Aber es ging seine Pokerkumpel nichts an, dass er an der Börse hübsche Gewinne gemacht hatte, die ihm dieses angenehme, sorglose Leben unter der Sonne Goas ermöglichten.
Und jetzt wollte er also wieder in den Krieg ziehen? Sich hineinbegeben ins mörderische Goldene Dreieck? Warum? Wegen Joachim! Er war es seinem Freund schuldig, ihn nicht im Dschungel Burmas verrecken zu lassen. Oder war es doch wieder die Abenteuerlust? Wie damals, als er nach Vietnam gegangen war, weil er den Krieg hatte erleben wollen? Weil der Vietnamkrieg für seine Generation das war, was für Hemingway der Spanische Bürgerkrieg gewesen war? Weil er das Alltägliche im Grunde als fad und sinnlos empfand? Er wusste es nicht. Aber irgendetwas trieb ihn an.
Kapitel 2
Bangkok (Thailand), April 1990
Antoine war mit dem Jumbo der Air India von Bombay nach Bangkok geflogen und hatte im Hotel „Oriental“ eingecheckt. Er kannte das legendäre Hotel am Ufer des Chao-Phraya-Flusses, in dem so berühmte Schriftsteller wie Joseph Conrad, Graham Greene und Somerset Maugham abgestiegen waren, aus seiner Zeit in Vietnam.
Es war noch früh am Morgen, er setzte sich in das Café unten am Fluss. Die Hitze drückte bereits, aber vom Chao Phraya her wehte eine kühle Brise. Nach Bangkok zurückzukehren, das ist, wie wenn man seine erste Liebe wiedertrifft, dachte Antoine. Hier hatte er zum ersten Mal den Geruch der Tropen eingeatmet, jene schwüle und süssliche Luft, die nach Verwesung riecht, aber auch nach exotischen Blumen und frischen Früchten. Die Stadt mochte schmutzig und chaotisch, vulgär und laut sein. Aber sie hatte einen fiebrigen Rhythmus, sie stand nie still, sie lebte, als gäbe es kein Morgen.
Bangkok heisst „Stadt der Engel“. Mag sein, dass sie das früher mal war, dachte Antoine. Damals waren die Häuser auf Pfählen gebaut, statt Strassen gab es Kanäle, und die Menschen waren mit Booten unterwegs. Die wenigen festen Strassen waren von hohen Bäumen gesäumt, deren Äste Schutz boten vor der Hitze. Die vergoldeten Türme der Pagoden überragten die Häuser und Paläste, selbst den Palast des Königs.
Er riss sich von seinen Betrachtungen los, um George Larson anzurufen, der in der amerikanischen Botschaft stationiert war, offiziell als Landwirtschaftsexperte. Aber eigentlich arbeitete er für die CIA. Antoine kannte ihn noch aus Vietnam. George war damals Leutnant bei den Marines gewesen. Später studierte er internationale Beziehungen an der amerikanischen Eliteuniversität Harvard und wurde schon während des Studiums von der CIA rekrutiert und nach Südostasien zurückgeschickt.
Sie trafen sich gegen Mittag in der „Bamboo Bar“ des „Oriental“, der ältesten Bar Asiens. Kolonialer Charme. Ein Jazzorchester spielte melancholischen Blues.
George war etwas fülliger geworden. Er trug jetzt Anzug und Krawatte. Für Antoine ein höchst ungewohnter Anblick – bei ihrem letzten Zusammentreffen vor über zwanzig Jahren, in den Schützengräben von Khe Sanh, trug George noch eine dreckverschmierte Uniform und hatte einen blutigen Verband am rechten Oberarm.
„Du siehst fit aus“, sagte George mit einem leicht spöttischen Grinsen. „Das Leben meint es offenbar gut mit dir. Erst machst du Kasse an der Börse, dann geniesst du an den Stränden Goas das Dolce Vita. Du bist und bleibst einfach ein Liebling der Götter. Während hart arbeitende Menschen wie ich versuchen, Südostasien vor dem Kommunismus zu retten.“
Antoine und George waren nach ihrer Rückkehr aus Vietnam in Kontakt geblieben, hatten gelegentlich miteinander telefoniert. Auch die Frage, ob George seine akademische Karriere für einen CIA-Job in Bangkok aufgeben solle, hatten sie ausführlich erörtert. Am Ende hatte sich George gegen Harvard, gegen seine damalige Ehefrau, gegen Eigenheim und Mitgliedschaft im exklusiven Country Club entschieden. Er war, nach seinen Worten, „aus dem Land der Toten geflohen“, um den vorgezeichneten Lebensweg gegen Nervenkitzel, Adrenalin, Abenteuer und nicht zuletzt die verlockende Exotik des Orients einzutauschen.
„Was führt dich denn nun eigentlich hierher? Zu viele Touristen in Goa? Oder vermisst du das verführerische Lächeln der mandeläugigen Schönen?“, fragte George nach dem einleitenden Small Talk.
Antoine erzählte ihm Joachims Geschichte.
„Ich kenne natürlich die Gerüchte, dass Westler sich den Guerillas in Burma angeschlossen hätten. Hauptsächlich Exmilitärs, ehemalige Angehörige der US Special Forces oder der Fremdenlegion, die jetzt die Opiumtransporte beschützen oder die Guerillas ausbilden. Söldner halt, die sehr gut bezahlt werden. Allerdings bei geringen Überlebenschancen.“
„Auch im Gebiet der Shan?“, fragte Antoine. „Das ist der Stamm, für den Joachim die Hilfslieferungen organisiert hat.“
George schwieg. „Es gibt angeblich Hinweise“, sagte er dann zögernd, „auf die Präsenz eines Weissen in einem Rebellenlager der Shan im Hochland. Schwer erreichbar. Dichter Dschungel, hohe Berge, keine Strassen, sondern nur Pfade für die Maultierkolonnen, die im Monsun zu Schlammpisten werden.“
„Wo ist dieses Lager?“, fragte Antoine. Plötzlich verspürte er einen Anflug von Hoffnung.
George schwieg wieder, dachte offenbar nach. „Keine Ahnung. Ich bin nicht sicher, ob das Lager tatsächlich im Shan-Gebiet liegt. Ich blicke auch nicht mehr durch, es gibt da oben ja über ein Dutzend Stämme, die sich abwechselnd bekriegen und dann wieder verbünden. Aber ich versuche, den Namen des Dorfes herauszufinden. Ruf mich … sagen wir, übermorgen in der Botschaft an. Dann kann ich dir vielleicht Genaueres sagen.“
Antoine überlegte. Wenn er sich tatsächlich auf eine Reise in den Dschungel einließe, konnte das bedeuten, dass er sich in Lebensgefahr brachte. Andererseits übertrieb George womöglich – es war ja bekannt, dass die CIA sich niemals in die Karten blicken liess und bei ihren geheimen Operationen im Dschungel Burmas, die sie vermutlich durchführte, einfach keinen Beobachter dabeihaben wollte.
„Gut“, sagte er schliesslich. „Einverstanden.“
George warf Antoine einen fragenden Blick zu. „Ich hoffe allerdings, du willst nicht selber da rauf. Vergiss es! Das wäre Wahnsinn. Da oben hast du keine Chance.“
Antoine grinste ihn an und sagte nichts, bestellte stattdessen zwei weitere Whiskys. Zum Abschied erhielt er von George den Rat, einen alten Kumpel aufzusuchen, der in der Patpong Road eine Bar betrieb. Der Mann war Sergeant in seiner Kompanie gewesen.
Am frühen Nachmittag nahm Antoine also ein Tuk-Tuk, eine dreirädrige motorisierte Rikscha, zur berüchtigten Patpong Road, dem Zentrum des Bangkoker Nachtlebens, wo das „Hangover“ lag. Es war die grösste Bar in der von neonbeleuchteten Bars und Clubs gesäumten Strasse, wo fast alle sexuellen Wünsche der Touristen befriedigt wurden. Schlepper priesen lautstark die Vorzüge von Sexshows an, verteilten Flyer mit schlüpfrigen Fotos.
Diese Strasse ist nur nachts so faszinierend, sinnierte Antoine, tagsüber wirkt sie wie eine schäbige Geisterstadt, mit Strassen und Gehsteigen, die von Schlaglöchern übersät sind, mit Fassaden, an denen die Farbe in tellergrossen Schichten abblättert, und Neonbeleuchtungen, deren abenteuerliche elektrische Verkabelungen in jedem anderen Land verboten wären.
Er betrat das „Hangover“ und sah, dass die Bar zwei lange Theken hatte, an denen sich bereits am Nachmittag Gäste und Hostessen in Bikinis drängten. Fiebrige Stimmung. Es war schwülstig heiss. Aus riesigen Lautsprecherboxen dröhnten die neuesten Hits. Iron Maiden, AC/DC, Bon Jovi … Zuckende Lichtblitze von den Discokugeln an der Decke. Blutjunge Thai-Girls, die fast nackt und mit lasziven Bewegungen auf einer Bühne an Stangen tanzten.
Er stellte sich Patrick, dem Besitzer, vor. Ein massiger Mann. Narben im Gesicht. Patrick führte ihn an einen einigermassen ruhigen Tisch.
„George hat mich bereits angerufen“, sagte er. „Er war mein Leutnant.“
Sie redeten über Vietnam. Über Orte, die sie beide kannten. Über Einsätze, bei denen sie beide dabei gewesen waren. Über das Nachtleben von Saigon, die Bars an der Tu Do Street. Die üblichen Gespräche bei einem Treffen von Vietnamveteranen. Die gemeinsame Erfahrung dieses Krieges war wie ein unsichtbares Band, das auch nach so vielen Jahren noch immer eine vertraute Nähe und ein Gefühl der Kameradschaft schuf.
Patrick war nicht gut zu sprechen auf die Politiker in Washington, die er für die Niederlage in Vietnam verantwortlich machte. „Vietnam war ein Verrat an einer ganzen Generation junger Amerikaner. Ein Scheisskrieg. Wir wurden alle missbraucht, Mann! Schau dir den Typen dort drüben an. Ein ehemaliger Green-Beret-Offizier. Ein Kriegsheld, jede Menge Tapferkeitsorden. Als er nach New York zurückkehrte, wurde er beschimpft und bespuckt von diesen langhaarigen Hippies, deren reiche Väter sich einen teuren Arzt leisten konnten, um ihre Jungs vom Militärdienst zu befreien. Er fand keinen Job. Niemand wollte ihn haben. Nicht mal als Nachtwächter. Seine Frau hat ihn verlassen. Jetzt ist er wieder hier. Macht Gelegenheitsjobs als Bodyguard. Und wohl noch ein paar andere Dinge, über die er aber nicht redet.“
Patrick gab dem Mann ein Zeichen. „Hey, Captain, komm mal rüber.“
Eigenartig, dachte Antoine. Dass sich hier alle noch mit ihrem militärischen Grad ansprechen. Dabei ist der Krieg schon so lange vorbei.
„Antoine, das ist Peter Mallory“, stellte ihn Patrick vor. Mallory war muskulös, etwa so alt wie Antoine, noch keine fünfzig. Kurz geschorene blonde Haare, Schnauzbart, wacher Blick.
„Wir reden gerade über alte Zeiten. Über Vietnam“, sagte Patrick.
„Ach Sergeant, verschon uns mit deinem politischen Bullshit. Ich kann’s nicht mehr hören.“
Patrick lachte. „Jaja, ich weiss, dass du Vietnam vermisst. Du bist ein Kriegsjunkie. Übrigens, Antoine war auch dort. Allerdings als Reporter.“
Mallory horchte auf. „Und, was hast du gelernt in diesem Krieg?“
Eine Frage, die Antoine sich oft gestellt hatte. Dieser Krieg hatte ihn verändert. In diesen vielen, oft unspektakulären Gefechten hatte er die alten Erfahrungen gemacht, die die Menschen in allen Kriegen machen. Erfahrungen von Angst, Feigheit, Mut, Grausamkeit, Leid und Kameradschaft. Er hatte den Tod aus nächster Nähe erlebt. Dies in einem Alter, in dem man sich für unsterblich hält. Eine Illusion, die im Dschungel, in den Reisfeldern oder in irgendwelchen namenlosen Stützpunkten sehr schnell platzte.
Jeder weiss, dass er sterben muss. Im zivilen Leben dauert es meist bis ins hohe Alter, bis dies zur Gewissheit wird. In Vietnam aber war man ständig mit dem Tod konfrontiert. Mit dem Wissen um die Endlichkeit der Existenz. Diese jungen Soldaten, meist nicht mal zwanzig, die noch nie eine Frau geliebt hatten, wurden alt. Innerhalb weniger Monate. Vietnam hatte ihre Jugend gestohlen. Oder ihr Leben.
Antoine erinnerte sich an Khe Sanh, den Marines-Stützpunkt oben an der Grenze zu Laos. An „Charlie Med“, die Sanitätsstation. An die grün-grauen Plastikleichensäcke mit den toten Marines, die vor dem Bunker zum Abtransport mit der nächsten Maschine oder dem nächsten Hubschrauber gestapelt worden waren.
Die beiden Veteranen hatten Antoines langes Schweigen bemerkt. Sie ahnten, dass er keine einfache Antwort hatte.
„Ein Freund, ein Marine, hat mir mal gesagt, dass er dieses Land oft verflucht habe. Dass er aber die Schönheit Vietnams vermisse. Und dass diese Kombination aus Schönheit und Gefahr einen eigenartigen Reiz besitze. Dieser Krieg werde immer ein Teil von ihm sein. Denn dort sei er zum Mann geworden. Und da er inzwischen in Oxford englische Literatur studierte, pflegte er dann den Schriftsteller Rudyard Kipling zu zitieren: ‚Wir haben nur eine Jungfräulichkeit zu verlieren. Und dort, wo wir sie verloren haben, werden unsere Herzen sein!‘“
Nachdenkliche Stille in der Runde.
„Lasst uns auf Kipling trinken“, sagte Patrick schliesslich.
Das Gespräch hatte offensichtlich eine Wendung genommen, die auf die Stimmung drückte.
Patrick wechselte das Thema. „George Larson hat mir von deinem Problem erzählt. Aber Burma, das ist doch der gleiche Schlamassel wie Vietnam. Halt dich da raus“, sagte er und musterte Antoine skeptisch. „Sei ehrlich, Mann. Du bist nicht hart genug. Das sehe ich doch. Schau dich mal im Spiegel an. Krieg ist eine Sache für junge Männer.“
Mallory mischte sich ein: „Wie heisst übrigens diese Organisation, für die dein Freund arbeitet?“
„Global Help. Sie arbeitet von Chiang Rai aus.“
Mallory wirkte plötzlich nachdenklich. „Ich habe ja noch immer Kontakte zu …“, er suchte nach dem richtigen Ausdruck, „…zu gewissen Kreisen. Global Help ist wahrscheinlich bloss eine Fassade. Nur Gerüchte zwar. Aber vor ein paar Monaten haben sie den Chef ausgewechselt. Der Neue heisst Max Wilkinson. Ich kenne ihn noch aus Vietnam. Eine Legende bei den Special Forces. Verwegen und unerbittlich, immer volles Risiko. ‚Mad Max‘ nannten sie ihn. Eigentlich kaum glaubhaft, dass er jetzt eine Wohltätigkeitsorganisation kommandiert.“
Antoine hatte den Eindruck, dass er sich trotz Patricks Bedenken rechtfertigen sollte. „Joachim ist mein bester Freund. Ich muss ihn finden.“
Patrick schüttelte den Kopf. „Ihn finden? Um ihm was zu sagen? Dafür willst du dein Leben riskieren? Das ist doch total verrückt. Der Mann ist höchstwahrscheinlich tot.“
„Er ist mehr als ein Freund. Wir sind zusammen aufgewachsen. Er war wie mein älterer Bruder. Er hat mich beschützt. War immer für mich da. Er hat mich daran gehindert, grosse Dummheiten zu machen – wie damals, als ich in die Fremdenlegion wollte.“
Patrick blickte so skeptisch drein, dass Antoine mit einem Mal genug hatte. Er stand auf. „Weisst du, Joachim liebt das Leben. Er glaubt an das Gute. An altmodische Dinge wie Loyalität. Oder dass man für die Schwachen kämpfen muss. Gegen das Unrecht. Deshalb arbeitet er auch in diesem gottverdammten Dschungel für ein Hilfswerk, statt als Jurist in der Schweiz Karriere zu machen. Ich glaube nur an wenige Dinge in diesem Leben. Aber ich glaube an Freundschaft. Und Treue. Gerade dumüsstest das doch verstehen, Sergeant. Wielautet noch mal das Motto der Marines? Semper Fidelis, nicht wahr? ‚Immer treu‘. Steht doch sogar auf eurer Fahne …“
„Warte“, sagte Patrick und versank in Schweigen. Schliesslich sagte er: „Oben in Khe Sanh waren wir eingekesselt von den Nordvietnamesen. Ein Zug war einen Kilometer vor den eigenen Linien in einen Hinterhalt geraten. Fast alle tot. Darunter auch mein bester Freund. Verzweifelte Hilferufe am Funk. In aller Eile habe ich einen Stosstrupp aus Freiwilligen organisiert, um die Überlebenden rauszuhauen und die Toten zu bergen. Im Feuergefecht hat mir irgend so ein Scheiss-Vietcong den halben Arm zerfetzt. Aber ich hab alle zurückgeholt. Tot oder lebendig.“
Antoine nickte schweigend. Jeder hatte in Vietnam so etwas erlebt, oder wenigstens etwas Ähnliches. Auch Mallory starrte vor sich hin.
„Okay“, sagte Patrick schliesslich. „Aber du brauchst einen Führer, Antoine, der die Sprache spricht: Thai und den Dialekt der Shan. Du musst dich in Chiang Rai umhören. Von da aus weiterforschen. Ohne Hilfe schaffst du das nie.“
Er winkte eine Bedienung herbei. „Hol mal Mai. Jetzt gleich. Sie ist oben im Büro. Und bring uns noch drei Singha-Bier. Mai war mal Bargirl hier“, fügte er an Antoine gewandt hinzu. „Und viel zu intelligent für den Job. Jetzt macht sie die Buchhaltung. Sie kommt aus der Gegend, spricht den Shan-Dialekt. Gib ihr … na, sagen wir, fünfhundert Dollar und nimm sie mit. Aber in einer Woche muss sie zurück sein.“
Mai hatte pechschwarz glänzendes langes Haar, anmutige Bewegungen, ihre Haut war braun, aber im Licht der Discokugeln nahm sie einen goldenen Glanz an. Eine grosse Impfnarbe auf der rechten Schulter. Armbänder am rechten Handgelenk. An einem der Bänder hing eine kleine goldene Glocke, die bei all ihren Armbewegungen leise klingelte. Ihr Alter war schwer zu schätzen, wie bei allen Asiatinnen. Vielleicht fünfundzwanzig, dachte Antoine. Mai warhübsch und anmutig, und sie lachte viel. Ihr Englisch war präzise und einigermassen akzentfrei. Sie willigte ein, Antoine als Dolmetscherin zu begleiten.
„Wir nehmen morgen den Nachtbus nach Chiang Rai“, sagte sie. „Ich hole Sie im ‚Oriental‘ ab. Und Sie sollten sich unbedingt einen Pullover besorgen. Im Nachtbus wird es kalt.“
Es war weit nach Mitternacht, als er im Hotel ankam. Die „Bamboo Bar“ hatte noch geöffnet. Er trank zwei Calvados, der Barpianist spielte „As Time Goes By“ aus dem Film Casablanca.
Langsam leerte sich die Bar. Aber er hatte noch keine Lust, auf sein Zimmer zu gehen. Er war der letzte Gast, die Kellner räumten bereits die Tische ab. Ein letzter Calvados, der Pianist spieltefürihn„Autumn Leaves“, einen Song, den er oft mit Thuy gehört hatte. Damals. In ihrer Wohnung in Saigon. Antoine kannte den Text noch auswendig, brummte leise mit:
„Since you went away the days grow long
And soon I’ll hear old winter’s song
But I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall…“
Mit einem ziemlich lauten Knall schloss der Pianist den Klavierdeckel. Deutlicher hätte das Signal nicht sein können. Antoine erhob sich und machte sich widerwillig auf den Weg zu seinem Zimmer. Dort öffnete er die Schiebetür zum Balkon und schaute hinab auf den Chao Phraya. Lastkähne tuckerten vorbei. Ein schmaler Mond hing am Himmel. Das Mondlicht spiegelte sich glitzernd auf dem schwarzen Wasser des Flusses.
Der Song wollte nicht aus seinem Kopf weichen. Schwermut überkam ihn. Er gestattete sich nicht oft, an jene Zeit des Glücks zurückzudenken. Die jetzt so unwiderruflich vorbei war. Noch immer betrachtete er Thuy als die grosse Liebe seines Lebens. Nicht dass er seither wie ein Mönch gelebt hätte, gewiss nicht, aber nie mehr hatte eine Frau es verstanden, sein Herz so weit zu öffnen. Oder er hatte zu viel Angst gehabt. Angst vor dem Schmerz, der eine Trennung unweigerlich begleitet.
Since you went away the days grow long …
Er war noch immer nicht müde, versuchte es mit Schattenboxen. Er stellte sich vor den grossen Spiegel im Entree, betrachtete sich kurz. Er sah noch immer fit aus. Das tägliche Joggen in Goa. Und im Jahr vor Goa war er den New Yorker Marathon in einer guten Zeit gelaufen. Langsam bewegte er den Oberkörper hin und her. Drei Geraden auf den Kopf. Zurück. Ein linker Haken. Angetäuscht. Dann gleich ein Uppercut. Sein Trainer hatte ihm beigebracht, wie man die Rechte hochhält, um das Gesicht zu decken. Das Gewicht zu verlagern, ohne die linke Schulter fallen zu lassen.
Antoines Bewegungen waren ungeschickt und steif. Aber langsam kam die Beweglichkeit zurück. Die Muskeln lockerten sich. Und er war wieder zurück in dem Boxclub in Bern. Er war wieder sechzehn, konnte den Geruch von Schweiss, Zigarettenrauch, Alkohol, Leder und Muskelöl wieder riechen. Der Gestank von Boxerträumen. Wie hiess doch der Typ, der seine Träume bei den Stadtmeisterschaften in der zweiten Runde beendet hatte? Rigozzi … oder so. Er war ein bisschen hungriger als Antoine. Ein bisschen gemeiner, schneller und ernsthafter bei der Sache. Ein Italo-Kid von der Strasse. In der zweiten Runde schlug er Antoine k.o. Das Ende der Träume.
„Du bist gut trainiert, technisch top“, hatte ihm der Trainer nach dem Kampf gesagt. Aber gegen einen solchen Streetfighter hast du keine Chance. Dem ist es egal, wenn er überall blutet und wenn es gemein wehtut.“
Was zum Teufel ist eigentlich mit mir los, dass ich mitten in der Nacht in einem Hotel in Bangkok boxen muss, um müde zu werden …
Er nahm noch eine Dusche. Legte sich aufs Bett. Langsam wich die Anspannung, und er schlief ein, bevor er die Lichter ausschalten konnte.
Der Bus nach Chiang Rai, der am nächsten Abend vom Hauptbahnhof losfuhr, war voll. Es roch nach scharfem Essen, das die Passagiere ausgepackt hatten. Die Klimaanlage lief auf Hochtouren. Aus den Lautsprechern über den Sitzen dröhnten sentimentale Songs. Thai-Pop. Mai summte gelegentlich mit, während sie die Stadt allmählich hinter sich liessen und in die Dunkelheit der Landstrasse eintauchten. Draussen zogen schemenhaft die kaum beleuchteten Dörfer und Reisfelder vorbei. Gelegentlich bremste der Bus scharf ab, wenn ein Wasserbüffel auf die Strasse trottete.
„Antoine ist ein französischer Name, oder?“, sagte Mai plötzlich. „Sind Sie Franzose?“
„Nein. Schweizer.“
„Leider kann ich kein Französisch. Und Ihr Name ist schwer auszusprechen für mich.“ Sie lächelte ihn entschuldigend an.
Sie ist bezaubernd, dachte Antoine. Laut sagte er: „Dann nenn mich doch einfach Tony.“
Die Antwort war ein neuerliches strahlendesLächeln. Füreinen Moment liess es Antoine die Unbequemlichkeit des schmuddeligen und klapprigen Busses vergessen. Die Sitze waren durchgescheuert, eine entspannte Haltung unmöglich. Offenbar waren auch die Stossdämpfer am Ende: Man spürte jedes Schlagloch.
„Mai, erzähl mir doch von deinem Leben“, sagte er.
Mais Geschichte unterschied sich kaum von der vieler tausend anderer junger Frauen in Thailand. Sie gehörte dem Stamm der Shan an. Ihre Eltern waren Bauern. Nach mehreren Missernten verloren sie erst den einzigen Wasserbüffel, dann auch noch ihr kleines Stück Land an die chinesischen Händler.
Mai war zwölf, als ihre ältereSchwester sie für zweihundert Dollar an einen Restaurantbesitzer in Chiang Rai verkaufte. Sie konnte irgendwann fliehen, arbeitete in der „White Rose Bar“ als Masseurin. Dort lernte sie Patrick kennen, der auf einem nahen Stützpunkt der Amerikaner stationiert war. Sie wurde Patricks Girl, nach dem Ende seiner Dienstzeit nahm er sie nach Bangkok mit.
„Patrick ist reich. Er hat drei Bars in Bangkok und zwei in Pattaya. Ich bin jetzt nicht mehr sein Girl. Er hat eine Frau und zwei Kinder. Aber gelegentlich schlafen wir noch miteinander.“
„Kannst du nicht zurück in dein Dorf?“, fragte Antoine.
Mai schüttelte den Kopf. „Diese Schande kann ich meinen Eltern nicht antun. Alle im Dorf würden glauben, dass ich eine Prostituierte war.“
„Und heiraten?“
„Ich bin schon zu alt. Und Männer sind doch nur wie Schmetterlinge, die von Blume zu Blume fliegen und Nektar saugen.“
Mai verstummte. Und irgendwann schlief sie ein. Den Kopf an Antoines Schulter gelehnt.
Kapitel 3
Chiang Rai (Thailand), April 1990
Am frühen Morgen kamen sie völlig übernächtigt in Chiang Rai an, einer kleinen Provinzstadt an der Grenze zu Burma. Mai hatte eine Unterkunft organisiert, ein kleines Haus unten am Maenam-Kok-Fluss. Es gehörte Freunden von Patrick, die für eine Woche nach Bangkok geflogen waren.
„Wie wär’s mit Frühstück, Tony? Ich hole schon mal Croissants“, sagte Mai. Sie hatte sich umgezogen, trug knappe Shorts und ein rotes Tanktop. Sie hatte lange, schlanke Beine. Ihr Busen zeichnete sich unter dem Shirt ab. Offenbar trug sie keinen BH.
Ich kann verstehen, dass Patrick heiss auf sie war, dachte Antoine.
Während sich Mai auf den Weg in die Stadt machte, spazierte er zum nächstgelegenen Hotel. Von dort aus rief er die amerikanische Botschaft in Bangkok an und liess sich mit George Larson verbinden. Es dauerte eine Weile, bis er George am Apparat hatte.
„Hallo Antoine, wo steckst du?“
George war kaum zu verstehen. Die Verbindung war schlecht, ausserdem lärmten ein paar Gäste an der Rezeption, wo sich das einzige Telefon des Hotels befand.
„In Chiang Rai. Ich bin gerade mit dem Bus angekommen und habe kaum geschlafen.“
„Na ja, zumindest warst du in netter Begleitung, wie mir Patrick verraten hat.“
Antoine lachte. „Hast du inzwischen herausgefunden, wo ich diesen geheimnisvollen Weissen aufspüren kann?“
George zögerte mit der Antwort. „Hör zu, ich möchte dir wirklich helfen. Aber ich habe ein Problem. Du ahnst ja wahrscheinlich, dass die CIA ein grosses strategisches Interesse an Burma hat. Und vor allem am Opiumhandel im Goldenen Dreieck. Unsere Aktionen in dem Gebiet sind aber streng geheim, sorry. Eigentlich darf ich gar nicht darüber reden. Aber als altem Freund kann ich dir zumindest einen Tipp geben.“
Antoine presste den Hörer ans Ohr, um nichts zu verpassen.
„Schreib auf. Das Dorf, in dem angeblich ein Weisser lebt, heisst Baan Saw. Es liegt am Nam-Pang-Fluss. Etwa drei Tagesmärsche von Chiang Rai entfernt. Alles Dschungel und Berge. Mehr kann oder besser: darf ich dir nicht sagen.“ Seine Stimme wurde plötzlich ernst. „Ich habe mit einem meiner burmesischen Agenten gesprochen, der die Gegend sehr gut kennt. Es ist absoluter Wahnsinn, nach Baan Saw raufzugehen! Das ist Opiumanbaugebiet. Da oben wird gekämpft. Jeden Tag. Das ist nicht Khe Sanh, mein Freund, da gibt es keine Hubschrauber der Marines, die dich rausholen. Ich kann dich natürlich nicht daran hindern, in dieser verdammten Dschungelhölle nach deinem Freund zu suchen. Aber wenn du meine Meinung hören willst: Lass es sein, Antoine! Selbst wenn der Kerl überhaupt noch lebt, musst du ihn erst mal finden. Und du weisst noch nicht mal, ob es sich bei ihm tatsächlich um diesen Joachim handelt.“
„Ich gehe, mit oder ohne deine Hilfe!“
„Ich hab´s befürchtet.“ Ein lautes Seufzen war durch die Leitung zu hören.
„Ich gebe dir mal die Funkfrequenzen der Botschaft: 243.0 Megahertz und 282.8 Megahertz. Beide Frequenzen werden ständig abgehört. Die wenigen Hilfsorganisationen, die noch in der Gegend operieren, haben PRC-25-Funkgeräte, die du ja noch aus Vietnam kennst. Mit den Zusatzantennen, die man an Heliumballons hochsteigen lässt, kannst du uns erreichen. Die Reichweite beträgt dann über hundert Kilometer.“ Er zögerte einen Moment. „Aber mach dir nichts vor. Du wirst dort oben ganz auf dich allein gestellt sein. Selbst wenn du mich über Funk erreichen solltest, würde ich wahrscheinlich nichts für dich tun können. Die CIA interessiert sich nämlich nicht für romantische Abenteurer, die das Schicksal herausfordern.“
Antoine hatte das Gefühl, dass George ihm noch was sagen wollte. Etwas Wichtiges. George liess ein paar Sekunden verstreichen, begann einen Satz mit „Noch etwas …“, brach dann aber das Gespräch ab mit der Bemerkung: „Ich wünsche dir viel Glück, mein Freund. Du wirst es brauchen. Melde dich, wenn du zurück bist.“
Antoine bezahlte an der Rezeption die Gebühr für das Telefonat, setzte sich an die Bar und bestellte einen Espresso. Er war nachdenklich geworden. George weiss mehr, als er zugibt, überlegte er. Und für ihn steht anscheinend fest, dass Joachim mit Opium handelt. Aber … Joachim ein Rauschgiftdealer? Nein. Völlig unmöglich. Trotzdem will George nicht, dass ich da hochgehe. Vielleicht hat er ja recht, vielleicht ist das wirklich Selbstmord. Aber er würde so schnell nicht aufgeben. Mal sehen, was wir heute rausfinden.
Mai kam auf einem knallroten Motorrad zurück. Einer 175er Honda, die sie in der Zwischenzeit gemietet hatte. An ihren zierlichen Hals schmiegte sich eine Blumenkette aus weissen Jasminblüten, die frisch und verführerisch dufteten.
Beim Frühstück besprachen sie die Tagesplanung. Zuerst zur Polizei, dann zu Global Help.
Mai fuhr. Verkehrschaos schon am Morgen in den engen, oft nicht mal asphaltierten Strassen. Hupende Autos. Rikschas. Kleinlaster mit Waren vom Markt. Sogar ein Ochsenkarren. Alle waren in Eile, genervt. Mit Ausnahme der Ochsen natürlich. Mai fuhr schnell und aggressiv, kurvte im Zickzack zwischen den Autos herum, bog in der falschen Richtung in Einbahnstrassen ein, raste notfalls über die Bürgersteige.
Er drückte das Innere seiner Schenkel gegen ihre Hüften und klammerte sich an ihr fest, um nicht abgeworfen zu werden. Ab und zu drehte sie sich lachend zu ihm um und machte sich über ihn lustig, weil er ihren Fahrküsten offensichtlich nicht vertraute. Als sie eine breitere Strasse erreichten und schneller wurden, streichelten ihre langen Haare, die vom Fahrtwind aufgewirbelt wurden, sein Gesicht. Bei der Ankunft im Polizeigebäude fühlten sich seine Hände an, als wären sie mit ihrer Taille verschmolzen.
Das Provinzhauptquartier der Royal Thai Police befand sich an einer belebten Durchgangsstrasse im Zentrum der Stadt. Ein dreistöckiges, weiss gestrichenes Gebäude. Mai parkte das Motorrad verbotenerweise direkt vor dem Eingang, über dem ein überlebensgrosses Bild des Königs Bhumibol hing.
Der Wachposten führte sie über eine Treppe mit ausgetretenen Stufen in den ersten Stock. Die Luft war feuchtheiss und roch faulig wie in fast allen alten Gemäuern in Asien. Am Ende eines langen, schwach beleuchteten Korridors bat sie der Posten in einen Warteraum. Die Wände waren blau gestrichen. An einer Wand hing ein Bild des Königs. Das einzige Möbelstück im Raum war ein Holztisch in der Mitte mit drei Stühlen.
Ein junger Polizist hatte Dienst. Braune, frisch gebügelte Uniform. Umgeschnallte Pistole. Er sprach kein Englisch, Mai erklärte ihm wortreich Antoines Anliegen. Er holte aus dem Nebenzimmer eine dünne Akte, blätterte gelangweilt, sah gelegentlich auf, um Mai zudringlich zu mustern. Joachim Kern habe Anfang Dezember in Mae Sai die Grenze nach Burma passiert, erklärte er. Hier sei die Kopie des Formulars, das er vor dem Grenzübertritt ausgefüllt habe. Aber er sei nicht zurückgekommen. Es gebe keinen Vermerk der Grenzpolizei. Er müsse demnach noch in Burma sein.
„Es ist also nicht unser Problem“, sagte er und schloss die Akte wieder. „Warum wenden Sie sich nicht an seinen Arbeitgeber? Oder besser gleich an die burmesischen Behörden in Rangun?“
Mai und der Polizist diskutierten noch eine Weile. Sie lachten ab und zu.
„Was hat er gesagt?“ fragte Antoine beim Hinausgehen. „Ihr scheint euch ja gut amüsiert zu haben.“
„Er hat gefragt, ob ich dein Girl sei. Und ob wir uns nicht heute Abend treffen könnten. Er bietet mir fünfhundert Baht für Sex.“ Sie zuckte die Achseln. „Alles Schweine, diese Polizisten.“
„Was hast du geantwortet?“
„Dass ich lieber bei dir bleibe. Du würdest mir tausend Baht bezahlen.“
Schwüle Mittagshitze. Antoines Jeanshemd klebte bereits am Körper. Er hatte höchstens zwei Stunden geschlafen, vergangene Nacht in dem klapprigen Bus.
Erste Regentropfen fielen, als Mai mit dem Motorrad durch das Verkehrschaos auf der Ausfallstrasse Richtung Flughafen kurvte. Vorboten des Monsuns, der in diesem Jahr früher beginnen sollte. Die Mittagssonne verblasste plötzlich und verschwand hinter dräuenden grauen Wolken, und eine fast unheimliche Dunkelheit legte sich über die Stadt, so unvermittelt wie eine Sonnenfinsternis. Und dann öffnete sich der Himmel mit donnernden Regengüssen. Innerhalb von Sekunden leerten sich die Bürgersteige, die Menschen drängten sich in überdachte Gassen, die Rikschafahrer deckten ihre Passagiere mit fensterlosen Verdecken aus Segeltuch zu.
Antoine und Mai hatten in einem Café Zuflucht gesucht. Nach einer halben Stunde hörte der Regen ebenso plötzlich auf, wie er begonnen hatte, und die Stadt fiel schnell in ihren gewohnten Rhythmus zurück: Der Himmel hellte sich auf, die Sonne brannte wieder unerbittlich, Autos und Motorräder fuhren ohne Rücksicht auf Fussgänger durch die Pfützen, die sich in den vielen Schlaglöchern gebildet hatten.
Ein eher diskretes Schild am Eingangstor zu einem grossen Gebäudekomplex in der Nähe des Flughafens wies auf Global Help hin. Hohe, mit Stacheldraht gesicherte Mauern umgaben die Anlage. Der einzige Eingang wurde von zwei bewaffneten Angestellten bewacht.
Der Posten sprach kein Englisch. Mai erklärte ihm Antoines Anliegen. Der Mann ging ins Wachthäuschen. Telefonierte.
Es dauerte lange, bis sich schliesslich ein junger Amerikaner näherte, der sich als Bill Cummingham vorstellte. Er blickte erst missbilligend auf Mais knappes T-Shirt, hörte sich dann Antoines Erklärungen an. Schliesslich bat er die beiden in sein Büro.
Sie gingen an langgestreckten Gebäuden vorbei, von deren grauen Fassaden bereits der Putz abblätterte. Typische Militärarchitektur, dachte Antoine. Wahrscheinlich ein ehemaliges Lager der US Army. Einheimische Arbeiter luden Jutesäcke auf Lastwagen. Die Säcke, offenbar mit Reis gefüllt, hatten aufgedruckte Symbole: „Spende des amerikanischen Volkes“, darunter das Bild zweier Hände, die sich umschliessen. Eine helle und eine dunkle Hand. Die Lastwagen waren Zweieinhalbtonner, ehemalige „Deuce“ der amerikanischen Armee. Der weisse Stern auf den Türen war nur notdürftig übermalt.
Bill Cumminghams Büro lag in einem der drei grossen Lagerhäuser. Es war spartanisch eingerichtet. An der Wand hing eine grosse Landkarte. Sie zeigte den Norden Thailands und Teile von Burma und Laos. Rote und blaue Stecknadeln markierten bestimmte Positionen. Keine der bei Hilfswerken sonst üblichen Werbeplakate mit Fotos hungernder Kinder und der dramatischen Bitte um Spenden. Auf einem Nebentisch standen zwei Funkgeräte.
Cummingham, der sich als Koordinator von Global Help und Joachims Nachfolger vorstellte, bot Kaffee und Mineralwasser an. Er war bestimmt noch keine dreissig, trug die Haare kurz, weisses Hemd, dunkelblaue Hose.
Das Gespräch kam nur schleppend in Gang. Cummingham wirkte unsicher. Antoine hatte den Eindruck, dass er sie möglichst schnell wieder loswerden wollte.
Für Joachim sei es damals ein planmässiger Einsatz gewesen, erklärte er. „Er hat drei mit Hilfsgütern beladene Lastwagen begleitet. Bei Mae Sai sind sie über die burmesische Grenze gefahren und dann weiter bis zur Verteilstelle. Die liegt im Landesinneren. Etwa fünfzig Kilometer von Mae Sai entfernt. Hier … hier … hier …“ Mit einem Aluminiumstock zeigte er auf der grossen Karte den Grenzübergang und die Route bis zur Verteilstelle. Fast wie bei einem militärischen Briefing.
„Und dann? Wie kommen die Güter von der Verteilstelle weiter?“, wollte Antoine wissen.
„Mit Maultierkolonnen. Es gibt dort keine Strassen mehr. Nur Pfade. Der Dschungel ist sehr dicht und das Gelände sehr steil. Die Dörfer liegen fast alle auf Berg- oder Hügelspitzen. Zum Teil über tausend Meter hoch.“
Es hörte sich nicht so an, als ob er das Gebiet je mit eigenen Augen gesehen hätte. Einer wie Bill Cummingham hielt sich wohl lieber im klimatisierten Büro auf.
„War es normal, dass Joachim vom Verteilzentrum aus mit der Maultierkolonne weiterging?“
Cummingham wirkte verlegen. „Nein. Aber es hat öfter Probleme bei der Verteilung gegeben. Er wollte wahrscheinlich persönlich sicherstellen, dass alles in Ordnung ist.“
„Was für Probleme?“
„Zum Beispiel mit den Maultierführern. Oder mit dem Begleitschutz. Der Konvoi und die bewaffneten Begleiter stehen nicht bei uns unter Vertrag, dafür ist eine andere Organisation zuständig.“
„Eine andere Organisation?“, fragte Antoine misstrauisch.
„Darüber darf ich keine Auskunft geben. Aus Sicherheitsgründen. Das … ähm … ist ein sehr heikles Thema. In Burma kommt es oft zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppen und Organisationen.“
„Ist denn der Konvoi hierher zurückgekehrt?“
„Ja, natürlich“, erwiderte Cummingham steif.
„Und wieso war Joachim nicht dabei?“
„Wie der Chef des Konvois berichtete, hat Mr. Kern eines der Dörfer besucht, sich zum vereinbarten Zeitpunkt jedoch nicht zurückgemeldet. Der Rückmarsch wurde mehrfach hinausgeschoben, aber dann hat sich wohl das Wetter verschlechtert. Der Konvoi ist schliesslich ohne Mr. Kern aufgebrochen.
„Haben die Maultiere auf dem Rückweg ebenfalls etwas transportiert?“
„Das wissen wir nicht. Global Help ist nur zuständig für den Transport der Hilfsgüter bis zu den Verteilzentren. Der Weitertransport untersteht unseren Vertragspartnern.“
Er lügt, dachte Antoine. Mit Sicherheit waren die Maultiere mit Opium beladen. Laut sagte er: „Gab es damals Kämpfe in der Gegend?“
„Ja, gelegentlich werden auch die Konvois überfallen und ausgeraubt.“
„Und stimmt es, dass Joachim Sympathien für die Shan-Rebellen hatte? Halten Sie es für möglich, dass er an ihrer Seite kämpft?“
„Wir mischen uns nicht in die Politik ein. Wir sind ein neutrales Hilfswerk“, antwortete Cummingham mit verbindlichem Lächeln. „Uns geht es nur darum, den Menschen zu helfen. Ob Mr. Kern Sympathien für die Rebellen hatte, kann ich nicht sagen. Ich habe Mr. Kern nicht gekannt.“
Antoine zeigte ihm das Foto, das Beatrix ihm geschickt hatte. „Wissen Sie, ob ihn gelegentlich ein Mönch besucht hat? Oder kennen Sie vielleicht das Kloster im Hintergrund?“
Cummingham warf einen kurzen Blick auf das Foto und dann auf seine Armbanduhr. „Ja, anscheinend ist Mr. Kern in der Stadt mit einem Mönch gesehen worden. Einigen Mitarbeitern fiel das auf. Dieses Kloster kenne ich nicht. Ausserdem sehen die eh alle gleich aus.“
„Eine letzte Frage – sagt Ihnen der Name Baan Saw etwas? Das Dorf?“
Cummingham zögerte. Die Frage schien ihm unangenehm zu sein. Er suchte nach den passenden Worten. „Vielleicht reden Sie besser mit meinem Chef“, sagte er schliesslich. „Ich bringe Sie hin. Vielleicht kann die junge Dame solange unten beim Empfang warten.“
Cummingham führte ihn direkt zu Max Wilkinson.
Das ist er also, der legendäre „Mad Max“, dachte Antoine, während er sein Gegenüber so unauffällig wie möglich musterte. Um die Fünfzig. Gross gewachsen. Kurz geschnittene braune Haare mit ersten Spuren von Grau. Ein wettergegerbtes, kantiges Gesicht. Durchtrainiertes Äusseres, knappe Bewegungen, selbstbewusste Stimme. Das ist ein Mann, der es gewohnt ist, Befehle zu geben, dachte Antoine. So müssen die gefürchteten Söldnerführer der italienischen Renaissancezeit ausgesehen haben.
In Wilkinsons Büro fehlten die persönlichen Fotos an der Wand oder auf seinem metallenen Schreibtisch. Fotos zum Beispiel, die ihn beim Handshake mit wichtigen Persönlichkeiten zeigten, wie sonst bei amerikanischen Chefs üblich. Oder mit seiner Frau und seinen Kindern.
Antoine stellte sich vor und schilderte dem Global-Health-Boss in knappen Worten, warum er hergekommen war.
Wilkinson schien beeindruckt: „Solche Beweise von Freundschaft sind heute selten geworden … Kennen Sie die Gegend hier?“, fügte er unvermittelt an.
„Nein, ich war noch nie in Burma. Aber ich kenne Laos und Vietnam.“
„Vietnam? Waren Sie im Krieg?“
„Ja, zwei Jahre lang. Als Reporter.“
„Reporter?“ Ein fast verächtliches Lächeln umspielte Wilkinsons Gesicht.
Wahrscheinlich denkt er, dass Vietnam für mich nur eine exotische Szenerie war, so wie für viele meiner Kollegen, vor der sie sich dann mit ihren übertriebenen Heldengeschichten inszenierten.
„Waren Sie auch im Gebiet der Bergstämme im zentralen Hochland – oder nur in Saigon?“ Nun war der Sarkasmus in Wilkinsons Stimme unüberhörbar.
„Ich kenne das Hochland sogar sehr gut. Ban Me Thuot. Kontum. Dak To. Ben Het …“
Beim Namen Ben Het horchte Max plötzlich auf. Schaute Antoine kurz prüfend an, als wolle er sich an etwas erinnern. Ben Het war ein Camp der amerikanischen Special Forces an der Grenze zu Kambodscha, das monatelang von den Nordvietnamesen belagert und beschossen worden war. Die Amerikaner hatten hohe Verluste.
Der Name Ben Het muss etwas in ihm ausgelöst haben, vermutete Antoine. Wahrscheinlich war er dort. Einer dieser Green Berets.
Für einen Moment stellte er sich Wilkinson in der grünen Dschungeluniform der US Army vor. 20 Jahre jünger. Erinnerungsfetzen tauchten auf. Gut möglich, dass ich ihn in einem der Camps der Special Forces getroffen habe, dachte er. Aber sicher war er sich nicht.
Wilkinson erklärte ihm, dass die Vegetation in Burma ähnlich sei wie die des Hochlands. Aber die militärische Lage sei noch viel komplizierter als damals in Vietnam. „Es gibt keine Fronten, und …“
„Ich kenne die Lage sehr wohl“, unterbrach ihn Antoine. „Und bin mir auch der Gefahren sehr wohl bewusst. Trotzdem wird mich nichts davon abhalten, Joachim zu suchen.“
Wilkinson sah ihn lange an, als wäge er ab, ob er diesen Mann in einen Einsatz in den burmesischen Dschungel schicken könne. Dann erhob er sich und drückte Antoine die Hand. „Ich kann Sie nicht daran hindern. Aber seien Sie sich bewusst, dass Sie sich in höchste Gefahr begeben. Auch hier in Chiang Rai – je länger Sie hierbleiben. Je länger Sie rumfragen. Die vielen Gegner, die sich dort oben bekämpfen, haben alle ihre Spione in Chiang Rai. Ein Menschenleben zählt hier nichts.“





























