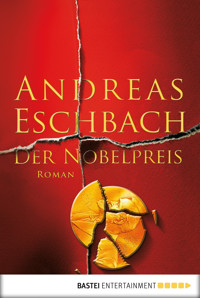Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Verbindung von Mensch und Maschine: ein perfekter Soldat? Oder ein schwacher Invalide?
In einem kleinen irischen Fischerdorf lebt ein Mann, der ein Geheimnis hütet. Nein, mehr als das, er ist das Geheimnis ...
Sie hatten ihm übermenschliche Kräfte versprochen. Stattdessen wurde er zum Invaliden. Er hatte gehofft, ein Held zu werden. Stattdessen muss er sich vor aller Welt verbergen. Denn Duane Fitzgerald ist das Ergebnis eines geheimen militärischen Experiments, eines Versuchs, der auf tragische Weise fehlgeschlagen ist. Für seinen Opfermut erhielt er die Freiheit, den Rest seines Lebens dort zu verbringen, wo er es sich wünschte. Im Gegenzug musste er sich verpflichten zu schweigen.
Doch es gibt da jemanden, der sein Geheimnis kennt - und er ist ihm bereits auf der Spur.
Mit seinem Roman Der Letzte seiner Art hat Bestsellerautor Andreas Eschbach eine Mischung aus Science Fiction- und Wissenschaftsthriller geschrieben, der bis zur letzten Minute fesselt!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:5 Std. 44 min
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Danksagung
Andreas Eschbach
DER LETZTESEINER ART
Thriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2003 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Textredaktion: Helmut W. Pesch
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1144-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1 Am Samstagmorgen erwachte ich blind und halbseitig gelähmt. Ich bin schon oft blind gewesen und auch schon oft halbseitig gelähmt, aber in letzter Zeit bin ich öfter beides gleichzeitig, und das fängt allmählich an, mir Sorgen zu machen.
Ich lag auf der rechten Seite, das Gesicht halb im Kissen vergraben. Alles, was ich bewegen konnte, waren mein Kopf, der linke Arm und ein paar Muskeln, die mir in dem Moment allesamt nichts nützten. Ziemlich ärgerlich. Ich war versucht, einfach noch eine Weile zu dösen und zu hoffen, dass es sich von selber geben würde. Aber das würde es nicht, das wusste ich. Außerdem drückte meine Blase.
Also ruderte ich mit der linken Hand umher, wühlte hinter mir über Kissen und Matratze, bis ich das Bettgestell zu fassen bekam. Es ist alles andere als leicht, sich mit nur einem und zudem halb verrenkten Arm in eine neue Position zu ziehen, wenn man dreihundert Pfund schwer ist und starr wie eine Schaufensterpuppe, aber unmöglich ist es auch nicht, wenn es eben sein muss.
Ich zog mit aller Kraft, und kurz vor dem ersten Muskelfaserriss kippte ich endlich und krachte mit dem linken Schulterblatt auf die Bettkante, was wehtat, aber gut war, denn es bedeutete, dass ich günstig zu liegen gekommen war, um mit der freien Hand unter das Bett zu fassen.
Dort bewahre ich seit Jahren einen unterarmlangen Holzprügel auf, für Gelegenheiten wie diese. Bisher hatte es immer erstaunlich gut geholfen, mir einfach dieses zollstarke Vierkantholz mehrmals über den Schädel zu ziehen. Oder damit auf widerspenstige Gliedmaßen einzudreschen. Das ist bei mir nicht anders als bei einem alten Getränkeautomaten: Ab und zu braucht er ein paar kräftige Tritte, und schon läuft alles wieder wie eh und je.
Diesmal half es allerdings nicht. Ich hörte auf, mich zu verprügeln, ehe es Schlimmeres gab als blaue Flecken, und war immer noch gelähmt und blind.
Die Blindheit war besonders ärgerlich, weil es dafür keinen wirklichen Grund gab. Ich nehme an, dass es psychisch bedingt ist; jedenfalls, wenn mein künstliches Auge einen seiner Abstürze hat und plötzlich keine Signale mehr liefert, schließt sich ihm das andere bisweilen aus einer Art falsch verstandener Solidarität heraus an und versagt gleichfalls den Dienst. Ich kenne ein paar Leute, die sich brennend für dieses Phänomen interessieren würden, aber ich werde mich auch weiterhin hüten, ihnen davon zu erzählen.
Ich lag eine Weile unbequem da und überlegte. Das war alles ausgesprochen lästig. Ein Traum fiel mir ein, der ein paar Wochen zurücklag, und auf einmal fragte ich mich, ob das überhaupt ein Traum gewesen war: Ich hatte geträumt aufzuwachen, mitten in der Nacht, versteinert, zu Stahl geworden, doch dann hatte ich den geheimen Schalter gefunden, der meinen Körper verflüssigte, alles war gut gewesen, und ich war erleichtert wieder eingeschlafen. Seltsam. Ich tastete über den Bauch und befühlte einige der Kabelstränge, die sich da ab und zu wulstig unter der Bauchdecke abzeichnen wie Treibgut im Wogen der Gedärme, kleine harte Wülste, die schon die nächste Bewegung des Körpers zurück in die Tiefe zieht. Es musste ein Traum gewesen sein. Es gab keinen solchen Schalter.
Etwas anderes fiel mir ein, das einmal gegen diese Art Blindheit geholfen hatte. Ich ließ den Bauch und begann, das linke Auge bei geschlossenen Lidern sanft zu massieren, so lange, bis Sternchen kamen. Dann hielt ich inne, öffnete es, und siehe da, aus grauen Nebeln schälte sich ein Bild. Die Decke meines Schlafzimmers. Vergilbte, mindestens dreißig Jahre alte Tapete. Wenn man es recht bedenkt, hätte ich längst einmal neu tapezieren können. Zeit hatte ich ja wahrhaftig genug.
Nicht mehr völlig, sondern nur noch halb blind zu sein war zumindest ermutigend, wenn auch nicht richtig hilfreich. Ich betrachtete meinen rechten Arm, der verkrampft in die Höhe ragte wie ein abgebrochener Schiffsmast und sich anfühlte wie ein solider Block Metall, und fluchte erst mal erbittert vor mich hin. Der Harndrang schien nicht vorzuhaben, nachzulassen, also holte ich, in Ermangelung eines besseren Einfalls, noch einmal den Holzprügel herauf und schlug damit auf mich ein, wieder ohne Resultat.
So etwas wie Panik begann sich in mir auszubreiten. Wilde Visionen, wie ich hier liegen bleiben würde, tagelang, eingenässt und unfähig, um Hilfe zu rufen. Verdursten würde ich. Mein Mund war jetzt schon ganz trocken. Wie lange es wohl dauern würde, bis man mich fand? Ziemlich lange, vermutlich. Ich lebe allein, zurückgezogen – man könnte sagen, einsam.
Panik, wie gesagt. Und das Sedierungssystem war logischerweise auch nicht ansprechbar. Ich bemühte mich, langsam und tief zu atmen, konzentrierte mich auf den Druck in der Blase, und es wurde besser.
Nachdenken war angesagt. Nicht unbedingt meine Stärke, aber man bemüht sich. Das künstliche Auge ausgefallen, gleichzeitig der Bewegungsapparat blockiert: Das konnte fast keine andere Ursache haben als einen Stromausfall im gesamten System. Ein Defekt der Nuklearbatterie war so gut wie ausgeschlossen; die ist der wahrscheinlich zuverlässigste Bestandteil meiner Innereien und wird frühestens ausgetauscht werden müssen, wenn ich an meinem 45. Geburtstag noch am Leben sein sollte. Blieb die Stromverteilung. In den vergangenen Jahren hatten sich zwar tatsächlich einige der angeblich unlösbaren Steckverbindungen in den Tiefen meines Körpers gelöst, aber die dadurch verursachten Wackelkontakte oder Kurzschlüsse hatten stets nur begrenzte Ausfälle zur Folge gehabt. Bisher hatte ich immer geglaubt, das System sei so konstruiert, dass ein totaler Stromausfall überhaupt nicht vorkommen könne.
Allerdings habe ich in meinem Leben schon eine Menge Dinge geglaubt.
Ich würde Hilfe brauchen.
Es sind nur ein paar Schritte, sagte ich mir. Schritte. Schon allein das Wort klingt beruhigend. Nur drei, vier Schritte. Alles, was ich tun musste, war, mich aus dem Bett auf den Fußboden zu wälzen und mich dann Zoll um Zoll bis in den Flur zu zerren. Dort war das Telefon. Dort war Rettung. Nichts leichter als das.
Bloß dass mein Körper in seinem augenblicklichen Zustand mehr Ähnlichkeit mit einer tonnenschweren Metallplastik hatte als mit sonst etwas. Ich zerrte und zog mit meinem einen Arm und manövrierte umher und versuchte, den starren Rest von mir ins Schaukeln zu bekommen, und steigerte mich in einen wahren Rausch von Kraftmeierei hinein, doch alles, was ich schließlich erreichte, war, mit dem Oberkörper aus dem Bett zu fallen, den Nachttisch mit dem Kopf umzustoßen und mit meinem rechten Arm so ungeschickt aufzukommen, dass er sich unter dem Bettgestell verkantete.
Ich blieb eine ganze Weile keuchend so liegen. Mit meinem einen intakten Auge sah ich mich um und konnte nicht glauben, was passiert war. Ich lag da wie festbetoniert, den Körper so durchgebogen, dass mein Bauch spannte wie eine Trommel, meinen starren rechten Arm unter dem Bett festgehakt wie ein Schiffsanker. Mit der Linken tastete ich panisch umher auf der Suche nach einem Halt, einem Griff, irgendetwas, an dem ich mich aus dieser Lage zerren konnte, und fand nichts. Da waren nur alte Socken, ein rechter Turnschuh, ein paar Zeitungen und sonstige Zeugnisse meiner Abneigung gegen haushälterische Tätigkeiten und darunter glatter Linoleumboden. Es dauerte seine Zeit, aber allmählich begriff ich, dass ich es versiebt hatte.
Der Anflug von Panik kehrte zurück. Eigentlich war es schon fast mehr als nur ein Anflug. Wenn man einmal unbesiegbar gewesen ist, tut man sich schwer mit Niederlagen, erst recht mit dem drohenden Untergang.
Ich weiß nicht genau, was dann geschehen ist und warum. Ich weiß nur, dass ich mir mit der linken Hand über den Bauch strich, vielleicht, weil er so prall gespannt war, oder in dem Versuch, meine Blase zu beruhigen. Ich fühlte der Kontur eines Kabelstrangs nach und ertastete plötzlich etwas, eine Verdickung, die da nicht hätte sein dürfen, soweit ich mich an die Pläne erinnerte.
Nicht, dass die Pläne zum Schluss noch viel bedeutet hätten. Da hat sowieso jeder gemacht, was er wollte. Aber seltsam war es doch. Ich befühlte das Implantat und erlebte dabei plötzlich einen dieser überaus eigenartigen Momente, in denen man sich nicht mehr sicher ist, ob man wach ist und sich an einen Traum erinnert oder ob man träumt und sich daran erinnert, einmal wach gewesen zu sein. Das fühlte sich an wie der geheime Schalter in jenem Traum, der meinen Körper verflüssigt hatte!
Ich drückte. Und schrie auf, als ein Rucken durch mich ging, das System einen Herzschlag lang zum Leben erwachte. Nicht lang genug leider, um auch nur meinen rechten Arm frei zu bekommen; im Gegenteil, den hatte ich vor lauter Überraschung eher noch weiter verkantet.
Aber plötzlich ergab alles Sinn. Ich hatte einen Wackelkontakt im Hauptstromkreis, so einfach war das! Irgendwann musste jemand – vermutlich aus Versehen, oder besser gesagt, in sinnloser Hektik – eines der Kabel durchtrennt haben, die durchzutrennen nicht vorgesehen gewesen war, und um das zu reparieren, hatte er eine Steckverbindung eingesetzt. Die ja als unlöslich galt. Also zwei gute Gründe, mir nachher nichts davon zu sagen.
Genau diese Steckverbindung spürte ich gerade. Vermutlich hatte eine der Bewegungen innerer Organe, wie sie im menschlichen Bauchraum nun einmal unvermeidlich sind – selbst in meinem –, das betreffende Kabel in den Vordergrund gedrückt.
Das hieß, dass das damals überhaupt kein Traum gewesen war. Ich war wirklich mitten in der Nacht aufgewacht, hatte schlaftrunken registriert, erstarrt zu sein, und es hat noch genügt, ein wenig Druck auf die wackelnde Kabelverbindung auszuüben, um sie wieder einschnappen und alles schön weiter funktionieren zu lassen.
Ganz offensichtlich saßen die Stecker aber inzwischen deutlich lockerer. Mit jähem Schrecken begriff ich, dass meine letzte Chance darin bestand, sie wieder ineinander zu bekommen, und zwar hier und jetzt, ehe die beiden Enden des Kabels sich endgültig voneinander lösten und sich in die Tiefen meiner Eingeweide verabschiedeten.
Ich hörte auf, daran herumzudrücken. Ich konnte nicht wissen, ob ich damit nicht mehr Schaden als Nutzen anrichtete. Jeder ungeschickte Druck mochte die beiden Stecker genauso gut ineinander schieben wie voneinander trennen. Nein, ich musste wissen, was ich tat. Was ich brauchte, war das richtige Werkzeug.
Also verrenkte ich mir den Hals auf der Suche nach irgendeinem spitzen Gegenstand, den ich mir in den Bauch rammen konnte.
Bloß, wie viele spitze Gegenstände findet man für gewöhnlich im Radius einer Armlänge um ein Bett? Mein Taschenmesser fiel mir ein. Dessen Klingen schienen mir für Operationen nur bedingt geeignet, aber die Ahle war lang und so gut wie unbenutzt, und was zum Stechen von Löchern in Ledergürtel taugte, dem würde eine Bauchdecke schwerlich widerstehen. Und das Ding musste, wenn mich nicht alles trog, in der Schublade des Nachttisches liegen.
Des mittlerweile umgestürzten Nachttisches, der zudem zu meiner Rechten und damit weitgehend außer Reichweite lag. Ich streckte und wälzte mich, bekam den Griff der Nachttischschublade zu fassen und zog sie auf. Zwei Packungen Papiertaschentücher purzelten heraus, ein Hundert-Euro-Schein, den ich noch gar nicht vermisst hatte, und ein paar Münzen. Nichts sonst. Vor allem kein Taschenmesser.
Hastig befingerte ich wieder meinen Bauch. War der Stecker noch da? Ja. Ich hatte mich zwar bewegt, aber offenbar nicht stark genug, um das Kabel davonrutschen zu lassen. Vielleicht tat die volle Blase das ihre, im Bauch alles unter Druck und am Platz zu halten. Wo war das verdammte Taschenmesser?
Mein Blick streifte die Leselampe, ein dickes, in Jahrzehnten gelblich angelaufenes Glasungetüm, hoch über dem Bett an die Wand geschraubt, und da fiel es mir wieder ein. Vor ein paar Tagen hatte ich die Glühbirne ausgewechselt, und dazu hatte ich vier Schrauben daran lösen und wieder festdrehen müssen. Das hatte ich mit dem Taschenmesser gemacht, und danach hatte ich es einfach obenauf liegen lassen, anstatt es zurück in die Schublade zu tun.
Ich blickte mich noch einmal um. Genau. Mitten in meiner männlichen Unordnung lag es, neben dem Wecker, den es gleichfalls davongeschleudert hatte, als der Nachttisch umgefallen war. Rot, klein, unübersehbar. Und ungefähr zwei Fuß von meinen ausgestreckten Fingerspitzen entfernt.
Aber höhere Primaten zeichnen sich durch die Fähigkeit zur Verwendung von Werkzeug aus; zumindest liest man das immer wieder. Ich versuchte es zuerst mit dem Holzprügel, aber der war, wie ich übrigens von Anfang an vermutet hatte, zu kurz. Nicht zu kurz immerhin, um eine Jeanshose, die eine glückliche Fügung achtlos auf den Boden gelegt anstatt ordentlich in den Schrank gehängt hatte, so weit zu mir heranzuziehen, dass ich sie mit der Hand greifen konnte. Ich fuhrwerkte ein wenig herum, bis ich sie fest an beiden Hosenbeinen gepackt bekam, dann ging ich daran, sie wie eine Art Angel auszuwerfen, um das Messer damit einzufangen. Einäugig und einarmig ist das nicht ganz leicht, aber schließlich schaffte ich es. Mit unwilligem Rappeln kamen sowohl Zeitmesser als auch Taschenmesser nahe genug, dass ich Letzteres an mich bringen konnte.
Nächster Schritt. Die Ahle. Mit bloß einer Hand sind diese Taschenmesser verdammt schwer aufzubekommen, besonders, wenn man eines der kleinen, spitzen, wenig benutzten Instrumente herausklappen will und das Ding nicht mehr ganz neu ist, nicht mehr ganz so gut geschmiert wie in jungen Jahren, im Gegenteil eher hier und da schon etwas angerostet. Hier, so nahe am Meer, rosten Dinge unglaublich schnell. Aber ich schaffte es schließlich, um den Preis, dass meine Hand danach zitterte und bebte vor Anstrengung.
Jegliches Triumphgefühl verflog, als mir gleich darauf wieder einfiel, was ich damit vorhatte. Ach ja, richtig. Ich war anscheinend wirklich ein Weltmeister darin, unangenehme Dinge zu vergessen.
Ich ging noch einmal alles durch, um sicher zu sein, nichts übersehen zu haben. Zeitgewinn. Letzter Aufschub. Und ich hatte natürlich nichts übersehen. Ich würde von Glück sagen können, wenn mein Vorhaben auch nur irgendeine Veränderung brachte. Wenn nicht, blieb nur noch, mir die Lunge aus dem Hals zu schreien in der Hoffnung, dass mich jemand hören und mir zu Hilfe eilen würde – eine Alternative von bestürzender Aussichtslosigkeit.
Ich tastete nach dem knotigen Ding unter meiner Bauchdecke. Da regte sich nichts. Kein neuer Funke, der in die teflonummantelten Kabelsätze meines Systems floss. Keine Rettung vor dem Skalpell. Seufzend erfühlte ich eine Stelle, an der ich einen Stecker vermutete, setzte die Ahle auf, hielt die Luft an und stach zu.
Es tat verflucht weh. Ich glaube, dass ich geschrien habe; jedenfalls erinnere ich mich an ein gurgelndes Gefühl in der Kehle und daran, danach heiser gewesen zu sein. Ich stach zu, spürte, wie es feucht und heiß aus der Wunde kam, Blut natürlich, und nicht wenig, und stocherte mit dem scharfen Stahl herum auf der Suche nach dem Implantat. Endlich ein Widerstand. Ich starrte an die Decke, wunderte mich über die dunklen Wolken, die plötzlich darüber hinwegzogen, drückte und machte und rührte in meinem Fleisch, ohne dass sich etwas tat, außer dass alles immer nasser und klebriger wurde auf meinem Bauch. Plötzlich waren die winzigen Fliegen da, die sich für gewöhnlich nie ins Schlafzimmer verirren. Beim Müll in der Küche finden sie es sonst viel interessanter, aber nun schwirrten sie über mir herum und kamen mir vor wie mikroskopische Aasgeier. Und da, endlich, machte es Klick.
Von einem Moment zum anderen war die Starre verschwunden, gehorchten mir Arme und Beine, sah mein rechtes Auge etwas, kam mein Körper mit einem vielstimmigen, zischenden Geräusch in der Muskulatur in Bewegung. Wie herrlich, den Schmerz abschalten zu können! Wie gut, den Blutstrom drosseln zu können! Ich kam auf die Beine, schweißgebadet, blutüberströmt, und wankte hinüber ins Bad, wo ich, die Hand auf die Wunde gepresst, als Erstes meine Blase erleichterte, ein unbeschreibliches Wohlgefühl.
Dann hockte ich auf dem Badewannenrand, betrachtete meinen Bauch und die Ahle meines Taschenmessers darin und überlegte, ob ich es wagen konnte, sie wieder herauszuziehen. Vorsichtshalber setzte ich mich auf den Boden und in eine stabile Position, ehe ich es probierte. Und siehe da, die Lähmung kehrte nicht wieder. Auch nicht, als ich tollkühn auf meinem Bauch herummassierte. Ich hatte mich wieder einmal hinbekommen.
Trotzdem konnte das nicht so bleiben, sagte ich mir, während ich der Wunde reichliche Mengen wasserklaren Desinfektionsmittels und eine Mullkompresse angedeihen ließ. Es würde ein nächstes Mal geben. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht schon morgen früh. Und irgendwann würde ich mich nicht mehr hinbekommen. Nicht einmal, wenn ich künftig nur noch mit dem Werkzeugkasten im Arm schlief.
Ich konnte das Telefon ans Bett verlegen. Der Tag, an dem ich mich nicht mehr hinbekam, würde dann der Tag der Kapitulation werden. Der Tag, an dem sie mich zurückbekommen würden.
Die Vorschriften für ein Vorkommnis wie dieses waren nämlich eindeutig und unmissverständlich. Hätte ich vorschriftsmäßig handeln wollen, ich hätte mir gerade noch das Blut von den Händen waschen dürfen und dann aber sofort und ohne weitere Verzögerung Lieutenant Colonel Reilly anrufen müssen. Der mich umgehend zur Generalüberholung zurück in die Staaten beordert hätte, höchst luxuriös zweifellos, an Bord einer Maschine der Luftwaffe, die eigens und nur für mich fliegen würde. Aber eben nur in eine Richtung. Reilly würde mich unter direkte Kontrolle und Aufsicht stellen, und ob ich der jemals wieder entkommen würde, war mehr als fraglich. Deshalb hatte ich nicht vor, vorschriftsmäßig zu handeln. Reilly zu informieren hätte geheißen, meine wenigen, mühsam errungenen Freiheiten auf einen Schlag einzubüßen, und nichts wollte ich weniger als das. Deshalb wusch ich mir zwar das Blut von den Händen, aber Lieutenant Colonel Reilly rief ich nicht an.
Stattdessen klebte ich abschließend ein festes Pflaster auf den Verband, ging in den Flur und holte mein Mobiltelefon aus seinem Versteck. Über meinen normalen Telefonanschluss führe ich nur selten und wenn, dann belanglose Gespräche, weil ich davon ausgehen muss, dass man mich immer noch abhört, sicherheitshalber selbstverständlich nur. Mein Mobiltelefon dagegen habe ich mir auf höchst verschlungenen Wegen besorgt; es sollte nach menschlichem Ermessen unmöglich sein, es mir zuzuordnen. Das erlaubt dann schon ganz andere Dinge.
Vierkanthölzer und anonyme Telefone sind nämlich nicht die einzigen Hilfsmittel, die ich mir verschafft habe. Ich wählte die Nummer von Dr. O’Shea. »Duane hier«, sagte ich, als er sich meldete. »Ich brauche dringend Ihre Hilfe.«
»Verstehe«, sagte er. »Können Sie zu mir in die Praxis kommen?«
»Zum Glück ja.«
»Dann kommen Sie um elf.« Ohne ein weiteres Wort legte er auf.
Reilly würde einen ernsthaften Herzanfall bekommen, wenn er wüsste, dass ich einen hier im Ort ansässigen Allgemeinarzt – einen Zivilisten! – ins Vertrauen gezogen habe. Und es würde ihn ohne Zweifel auf der Stelle dahinraffen zu wissen, dass Dr. O’Shea Röntgenaufnahmen meines Körpers gemacht hat. Aufnahmen meines Eine-Milliarde-Dollar-Körpers, für die eine Menge Leute auf diesem Planeten eine Menge Geld zahlen würden. Aber, wie gesagt, Dr. O’Shea genießt mein Vertrauen.
Ich tappte zurück ins Bad, zog meinen blutigen Schlafanzug aus und warf ihn in die Wanne. Ich machte einen Lappen nass und wischte mir das Blut von den Füßen, dann ging ich hinüber ins Schlafzimmer, einer Spur dunkler Fußabdrücke und dicker roter Tropfen folgend. Das Bett sah aus, als habe ein wahnsinniger Serienmörder darin gerade sein jüngstes Opfer massakriert. Ich zog alles ab, warf Bettzeug und Laken auch in die Wanne und ließ kaltes Wasser einlaufen. Blut darf man nur mit kaltem Wasser auswaschen, habe ich gelernt.
Es war kurz vor neun, als ich mich daranmachte, die Blutflecken auf dem Boden wegzuwischen.
Unwillig klagst du und willst nicht einsehen, dass bei allem, was du beklagst, nur eines von Übel ist: dein Unwillen und deine Klagen. Nur ein Unglück gibt es für einen Mann, nämlich dass es Dinge in seinem Leben gibt, die er als Unglück ansieht.
Seneca, EPISTOLAE MORALES
2 Ich fühlte mich nicht gut, als ich in einen kühlen, sonnigen Samstagmorgen hinaustrat. Es gab keine Garantie dafür, dass sich das, was in meinen Eingeweiden passiert war, nicht mitten auf der Straße wiederholen würde. Zwar würde man mich in dem Fall finden und wahrscheinlich dorthin bringen, wo ich ohnedies hinwollte, zu Dr. O’Shea nämlich, aber ich würde Aufsehen erregen. Und wenn ich das gewollt hätte, hätte ich Reilly auch gleich anrufen können. So achtete ich mehr auf das steife Gefühl in meinen Beinen und das verhaltene Pochen der Bauchwunde als auf das Wetter. Ein kräftiger, salzig schmeckender Wind wehte und blähte die weite Jacke und das übergroße Hemd, unter denen ich meine auffallende Statur zu verbergen pflege. Mein künstliches Auge tränte. Das tut es manchmal.
Der Ort, in dem ich seit über zehn Jahren lebe, heißt Dingle; ein kleiner Fischereihafen, auf der gleichnamigen Halbinsel im Südwesten Irlands gelegen. Das Städtchen ist gerade groß genug, dass man als Einwohner hingenommen wird, ohne dass jeder wissen muss, wie man heißt und woher man kommt, und andererseits nicht groß genug, als dass es von alleine irgendjemandes Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Es findet ein wenig Tourismus statt, aber die meisten Leute leben tatsächlich noch vom Fischfang. Dass sonst nicht viel passiert, mag man daran erkennen, dass das große Ereignis in der jüngeren Geschichte Dingles nach wie vor ist, dass hier der Film Ryan’s Daughter gedreht wurde, immerhin mit Paul Newman in der Hauptrolle, allerdings vor über dreißig Jahren: Ein Film, den ich nie gesehen habe, aber nach meiner zugegebenermaßen eingeschränkten Kenntnis hiesiger Pubs dürfte schätzungsweise in jedem dritten davon das Filmplakat hängen und eine Hand voll Szenenfotos dazu. Und es gibt eine Unmenge Pubs in Dingle.
Ich ging langsam und hatte beim Gehen immer noch das Gefühl, dass meine Beinmuskulatur gegen einen inneren Widerstand arbeiten musste. Was wahrscheinlich auch der Fall war, wenn ich daran denke, was alles darin eingebaut ist und sich nicht selten so anfühlt, als roste es längst einfach nur noch vor sich hin. Als ich den Kreisverkehr erreichte, ließ meine Besorgtheit ein wenig nach, vielleicht weil mich auch nach über zehn Jahren in diesem Land der Anblick links fahrender Autos mit Lenkrädern auf der falschen Seite des Wagens immer noch irritiert. Ich überquerte die diversen Überwege und wählte den Weg die Mall hoch, deren auffallendste Einrichtung eine Kreuzigungsszene aus schreiend bunt bemalten, überlebensgroßen Figuren ist; ein riesiger Christus quält sich an einem riesigen Kreuz, betrauert von zwei Frauengestalten in Babyhellblau und Zitronengelb, die unter ihm stehen und die Hände ringen.
Die grundsätzliche Bereitschaft der Iren, Dinge knallbunt zu streichen, äußert sich in der Main Street in jenem malerischen Nebeneinander verschiedenfarbiger Häuserfassaden, das man in irischen Siedlungen häufig findet und das sich auf Abbildungen in Reiseführern und auf Postkarten so gut macht. Ein strohgelber Pub neben einer dunkelgrünen Bankfiliale, ein Wohnhaus, schneeweiß mit dunkelblauen Einfassungen und Türen – das sind Motive, bei denen Touristen die Kamera wie von selbst vor das Auge springt. Wenn man jedoch länger in diesem Land lebt, merkt man, dass diese Buntheit lebensnotwendig ist. Dass man sie braucht, um trübe Wintermonate und das oft wochenlang anhaltende Nieselwetter ohne seelische Schäden zu überstehen.
Weil es auf dem Weg lag und weil ich noch Zeit hatte und weil ich es mir ohnehin nicht erlauben durfte, die Öffnungszeiten zu verpassen, war meine erste Station die Post.
»Ah, Mister Fitzgerald«, begrüßte mich Billy Trant, ein eifriger, grobknochiger Junge mit buschigen, aschblonden Haaren und den kariösesten Zähnen, die ich je im Leben gesehen habe. »Ihr Paket ist da.« Er fuchtelte atemlos mit den Händen, als habe er den ganzen Morgen nur auf mich gewartet. »Ihre Lieferung geheimer biologischer Kampfstoffe.«
Das ist nur ein Spiel, das sich zwischen uns entwickelt hat. Einerseits würde Billy für sein Leben gern wissen, was in den Paketen ist, die ich alle vier Tage zugeschickt bekomme, und weil ich es ihm nicht verrate, ist er eines Tages darauf verfallen, einfach zu raten, in der Hoffnung, mich auf diese Weise aus der Reserve zu locken. Andererseits weiß er, dass es ihn als Postbediensteten überhaupt nichts angeht, was er befördert, und deswegen rät er nicht ernsthaft, sondern macht sich einen Spaß daraus, mit möglichst irrwitzigen Vermutungen aufzuwarten.
Doch manchmal liegt er verdammt nah an der Wahrheit damit.
»Daneben«, sagte ich trotzdem, wie immer.
Während er nach hinten ging, um das Paket zu holen, überflog ich die Schlagzeilen der lokalen Tageszeitungen, die neben dem Schalter aushängen. Mehrspaltiger Aufmacher war eine Debatte um wirtschaftspolitische Fragen im Dubliner Parlament, während weltpolitische Belanglosigkeiten wie Unruhen im Nahen Osten oder ein säbelrasselndes chinesisches Manöver vor der Küste Taiwans in wenigen Sätzen abgehandelt wurden. Das genügt mir, um in groben Zügen informiert zu bleiben, und mehr brauche ich nicht.
»Ich komm schon noch drauf«, meinte Billy, als er mir das Paket herausreichte.
»Na klar«, erwiderte ich. Es ist ein Ritual, wie gesagt.
Postlagernd, nicht zustellen steht auf dem Etikett unter meinem Namen und der Adresse des Postamts Dingle. Lieutenant Colonel Reilly widerspricht dem Vorwurf, das sei eine Schikane. Abgesehen von diversen praktischen Erwägungen mache er das, um mich am Leben und wohlauf zu wissen: Sollte ein Paket nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zurückgeschickt werden, käme er sofort angereist, um nach mir zu sehen. Wobei sofort in diesem Fall fast wörtlich zu verstehen ist: Reilly hat die Befugnis, sich von der US Air Force zu jedem beliebigen Zeitpunkt an jeden beliebigen Ort der Erde bringen zu lassen, wenn er es für nötig hält.
Mit anderen Worten, wenn das mit dem Taschenmesser schief gegangen wäre, hätte er morgen vor meiner Tür gestanden und hätte mich schreien gehört. Na also. Was hatte ich mir denn Sorgen gemacht?
Ich stopfte das Paket in die Umhängetasche und fühlte mich schon beinahe wieder wie immer, als ich die Post verließ.
Meine Pakete enthalten keine biologischen Kampfstoffe, aber etwas, das nicht weit weg davon ist. Da man mir, um Platz zu schaffen für zahlreiche angeblich hochwichtige Implantate, den größten Teil meines Darms entfernt hat, ist die Darmpassage heute zu kurz, um normalen Nahrungsmitteln die lebensnotwendigen Nährstoffe zu entziehen. Was bedeutet, dass ich mich nicht mehr auf die übliche Weise ernähren kann. Stattdessen erhalte ich ein biologisch hochaktives Nahrungskonzentrat, eine Art lebende Zellkultur, die derart angereichert ist, dass die Dosen, in denen man es mir schickt, nicht nur ein Verfallsdatum, sondern sogar eine Verfallsuhrzeit aufgedruckt haben, die ich peinlich genau einhalten muss, weil mich das Zeug sonst vergiften kann. Wenn ich eine Dose öffne, muss ich sie innerhalb von sechs Stunden leer essen und eventuelle Reste mit einer speziellen Dünnsäure auflösen, damit die Kanalisation nicht zuwuchert oder schäferhundgroße Monsterratten heranwachsen oder was weiß ich, was sonst passieren kann. Zusammensetzung und Herstellungsweise des Konzentrats sind streng geheim. Alle vier Tage erhalte ich einen Vorrat von acht Dosen, genau die richtige Menge bis zum nächsten Paket, und das funktioniert tatsächlich seit über einem Jahrzehnt reibungslos. Aber natürlich haben sie mich dadurch an der kurzen Leine, und ich kann nicht das Geringste dagegen machen.
Draußen kreuzte Mrs Brannigan meinen Weg, voll bepackt mit Einkäufen und fürchterlich in Eile, was an ihr, mit ihrem vollen weißen, wehenden Haar und ihrer walkürenhaften Statur, besonders beeindruckend aussah. Sie leitet die Ortsbücherei, was sie zu meiner wichtigsten Bezugsperson macht, und besagte Bücherei war, wie mir ein rascher Check der Uhrzeit verriet, seit zwanzig Minuten geöffnet und somit in den alleinigen Händen von Riona, der ebenso jungen wie unerfahrenen Praktikantin, was die Hast erklärte, die Mrs Brannigan an den Tag legte.
»Mister Fitzgerald!«, keuchte sie. »Gott sei gelobt, dass ich Sie treffe. Sie müssen mir helfen.«
Ein deutlich vernehmbares Pochen in meinem Oberbauch mahnte, dass ich zunächst einmal selber Hilfe brauchte, aber da sie ihre Körbe und Taschen umständlich abstellte, blieb ich eben stehen und fragte höflich, wie das zu verstehen sei.
»Ach, es ist wieder wegen Riona. Diese jungen Leute denken immer, sie können quasi dank ihres Geburtsjahrgangs mit Computern umgehen. Aber was macht dieses Mädchen gestern? Gibt einen Druckbefehl ein, der anfängt, den gesamten Katalog auszudrucken. Den gesamten Katalog, stellen Sie sich das einmal vor! Das wären ja Tausende von Seiten. Gott sei Dank waren nur dreißig Blatt im Drucker.«
»So einen Druckbefehl dürfte man aber nicht aus Versehen geben können«, sagte ich. Ich habe ihr kurz nach meiner Ankunft in Dingle einmal geholfen, ein Modem anzuschließen, und seither sieht sie in mir so etwas wie einen Computerexperten. Dabei besitze ich nicht mal einen.
Zumindest würde ein ahnungsloser Besucher, der sich bei mir im Haus umsieht, keinen entdecken.
»Ja, sicher, es ist kein besonders gutes Programm, aber wir müssen in Gottes Namen damit zurechtkommen«, nickte sie. »Und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe natürlich den Rechner runtergefahren, mehrmals sogar, aber immer wenn ich Papier nachlege und den Drucker einschalte, druckt der einfach weiter.«
»Dann steht der Druckauftrag noch in der Warteschlange. Dort müssen Sie ihn rauslöschen.« Damit waren meine Kenntnisse über handelsübliche Computer auch schon so gut wie ausgereizt. »Im Handbuch müsste stehen, wie man das macht.«
»Im Handbuch … Können Sie es nicht für mich machen, Mister Fitzgerald?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nicht heute, beim besten Willen. Ich habe in fünf Minuten einen Termin beim Arzt.«
»Verstehe.« Ein Schatten huschte über ihr Gesicht, der nichts mit meiner Ablehnung zu tun hatte und auch nichts mit dem Zug der Wolken. Mrs Brannigan hat einen schwer kranken, pflegebedürftigen Ehemann, der Tag und Nacht an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist. Die Brannigans wohnen in meiner Straße, im ersten Haus vorn beim Ring, einem alten, grauen Bau mit einem riesigen Schuppen dahinter und einer Sitzbank davor, auf der ich sie an warmen Sommertagen bisweilen sitzen gesehen habe. Am Giebel des Hauses prangt ein verwittertes gelbes Schild, das Bed and Breakfast anbietet, aber ich nehme an, das ist ein trauriges Überbleibsel besserer Zeiten.
»Es sollte sich doch ein junger Computerfreak auftreiben lassen, der das hinkriegt«, sagte ich matt.
»Wie wäre es, wenn Sie nächsten Dienstag danach schauen würden?«, schlug sie mit wohlwollender Strenge vor. »Das würde reichen. Da sind sowieso Ihre Bücher fällig.« Sie scheint ihren Computer nicht wirklich zu brauchen, sie hat alles im Kopf.
»Gut, dass Sie mich erinnern«, sagte ich. Es waren drei Romane, von denen ich zwei nur zwanzig Seiten weit gelesen hatte.
»Dann sehe ich Sie also Dienstag«, lächelte sie und nahm ihre Einkäufe wieder auf. »Schön. Aber jetzt muss ich weiter, ehe dieses Mädchen noch mehr Unsinn anstellt.«
Damit rauschte sie davon, und ich setzte meinen Aufstieg die Main Street hoch fort. Wo mir etwas begegnete, das unter anderen Umständen der Lichtblick des Tages gewesen wäre, die Rettung des Wochenendes, die Labsal, die alle Leiden vergessen ließ. Okay, es ist eine pubertäre Schwärmerei, die ich für die Managerin von Brennan’s Hotel pflege, aber ich genieße es, sie ahnt nichts davon, warum also nicht?
Brennan’s Hotel ist ein großer, altehrwürdiger Bau, älter als die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und dennoch so gut erhalten, dass es unbestritten als das beste Hotel im Ort gilt. Weswegen übrigens Reilly bei seinen Inspektionsbesuchen hier zu nächtigen pflegt. Die guten Zimmer liegen auf der der Straße abgewandten Seite, was bedeutet, dass sie Meerblick haben und ruhig sind, das Restaurant des Hotels ist weithin berühmt, und die Seele des Ganzen, die treibende Kraft, das Tüpfelchen auf dem i, der Glanz über allem ist seit einigen Jahren eine junge Frau namens Bridget. Bridget Keane, schlank wie eine Gerte und die personifizierte Lebenslust, mit wilden, fast nicht zu bändigenden kupferroten Haaren und milchweißer, mit goldenen Sommersprossen übersäter Haut ist, möchte ich mal behaupten, nicht nur in meinen Augen eine außergewöhnliche Erscheinung. Wenn man eine schöne Irin für einen Werbeprospekt bräuchte, wäre sie zweifellos erste Wahl. Ohne weitergehende Absichten zu verfolgen freue ich mich, wann immer ich sie zu Gesicht bekomme, genieße es, ihr nachzusehen, wenn sie wie ein Wirbelwind irgendwo entlangfegt, und mein Herz lacht, wenn mich ein Blick aus ihren smaragdgrünen Augen streift, selbst wenn er danach sofort weiterwandert, weil ich nicht gemeint bin. Wann immer ich in der Stadt unterwegs bin, richte ich es nach Möglichkeit so ein, dass ich an Brennan’s Hotel vorbeikomme; meistens vergebens, aber dann und wann kommt sie doch gerade im richtigen Moment heraus, etwa um die Blumen vor den blau eingefassten Butzenscheiben des Restaurants zu gießen, Hotelgästen den Weg zu einer der Sehenswürdigkeiten Dingles zu erklären oder energisch mit einem der Lieferanten zu reden, die die diversen Dinge abladen, die ein Hotel so braucht.
Zufällig – ich schwöre, dass ich ihr nicht nachspioniere – habe ich mitbekommen, dass sie ein kleines Häuschen bewohnt, das sich etwas oberhalb von Dr. O’Sheas Praxis in der Chapel Street hinter zwei größere Wohnhäuser zu ducken scheint. Und wie es aussieht, lebt sie dort allein, warum auch immer. Sie ist nicht nur schön, sie ist auch geheimnisvoll.
Heute stand ein alter Kleinbus direkt vor dem Hotel, über und über mit vierblättrigen Kleeblättern, Harfen und anderen irischen Symbolen bemalt, und ein verblassender Schriftzug verkündete an der Seite: Finnan’s Folk. Das Gefährt einer der zahllosen Bands, die durch die Lande ziehen und in Pubs traditionelle irische Musik aufführen. Der Fahrer des Busses, ein großer, hagerer Mann mit langen dunkelbraunen und ähnlich mühsam zusammengebundenen Haaren wie die Bridgets stand zusammen mit ihr vor der offenen Hoteltür und verhandelte, ein großes aufgerolltes Papier in der Hand, das nur ein Konzertplakat sein konnte. Vermutlich ging es darum, ob er das Plakat am Hotel anschlagen durfte. Genau bekam ich es nicht mit; ich passierte die beiden lediglich in einiger Entfernung, genoss Bridgets Ausstrahlung von Energie und Lebendigkeit und hörte, dass sie Gälisch miteinander sprachen, jene mir absolut unzugänglich scheinende irische Ursprache, die hier in der Gegend immer noch in Gebrauch ist, freilich mit vielfach beklagter rückläufiger Tendenz. Dingle liegt im An Gaeltacht, im gälischen Sprachgebiet. Am Ortseingang steht ein Schild mit dem eigentlichen Namen der Stadt, Daingean Uí Chúis, und es kann nicht schaden, diese Bezeichnung zumindest wiederzuerkennen, denn hier in der Gegend sind auf Wegweisern vor allem die gälischen Ortsbezeichnungen aufgeführt und dann erst, und nur, wenn man Glück hat, die englischen.
Als ich bei Dr. O’Shea ankam, war es fast elf Uhr, und ich fühlte mich auch schon fast wieder gesund. Trotzdem klopfte ich an die weiße Eingangstür mit der Mattglasscheibe, wartete, bis eine verschwommene Gestalt in weißem Kittel dahinter auftauchte und aufschloss, schüttelte dann Dr. O’Sheas Hand und ging, seiner einladenden Geste folgend, an ihm vorbei ins Behandlungszimmer.
Es ist ein kleines Haus, zugleich Wohnung und Praxis. Das Erdgeschoss ist durchgehend weiß tapeziert und gestrichen, eine schmale Treppe führt hinauf zu einer Tür mit der Aufschrift Privat. Der Flur und die Behandlungsräume sind hell, sauber und fürchterlich eng. Es riecht nach Desinfektionsmitteln, an den Wänden hängen Kalender mit Südseemotiven und Plakate mit medizinischen Hinweisen. Während der Sprechzeiten stehen in dem ohnehin engen Flur zusätzliche Stühle für Wartende, die um diese Zeit schon weggeräumt waren.
Dr. O’Shea ist Anfang vierzig und ungebunden. Man sagt ihm, sicher nicht zu Unrecht, zahlreiche Affären nach, bisweilen mit Frauen, die nicht ganz so unverheiratet sind, wie es für irische Moralbegriffe wünschenswert wäre. Es ist also kein Wunder, dass er mit Geheimhaltung so gut umgehen kann, als hätte er einen Intensivkurs bei der CIA absolviert. Seine Sprechstundenhilfen haben mich noch nie zu Gesicht bekommen. Nirgendwo ist mein Name oder meine Adresse notiert. Meine medizinischen Unterlagen lauten auf den Namen John Steel, und Dr. O’Shea verwahrt sie in einem Geheimfach seines Schreibtisches. Er hat mir die Nummer seines Privatanschlusses verraten, mit der er äußerst wählerisch umgeht, und ich hatte keine Bedenken, ihm als einzigem Menschen auf der Welt die meines Mobiltelefons anzuvertrauen.
»Sie sehen besser aus, als ich Ihrem Anruf nach erwartet hätte«, sagte er, nachdem er die Tür des Behandlungszimmers hinter sich geschlossen hatte. »Wobei das bei Ihnen ja meistens täuscht.«
Ich erklärte ihm, was vorgefallen war. Während ich erzählte, wechselte der Ausdruck in seinem Gesicht mehrmals zwischen Staunen, Faszination und Besorgnis. »Lassen Sie sehen«, sagte er, als ich fertig war, und wies auf die Behandlungsliege.
Ich zog mein Hemd aus und legte mich behutsam auf den Rücken. Eine steile, nachdenkliche Falte bildete sich auf seiner Stirn, während er die Wunde auf meinem Bauch betrachtete. »Tut das weh?«
»Nicht mehr besonders«, sagte ich.
Er betastete die Umgebung des verkrusteten Schnittes. »Und so?«
»Ein dumpfer Druck, weiter nichts«, meinte ich.
»Kann es sein«, fragte er, »dass Sie Ihre Sedierung noch eingeschaltet haben?«
Peinlich. Er hatte Recht. Ich vergesse das zu gern, schon immer. Erstaunlich, dass die Vorratstanks nicht längst leer sind; sie sind seit 1989 nicht mehr nachgefüllt worden.
Kaum hatte ich die Sedierung abgeschaltet, kehrten die Schmerzen zurück – ein heftiges Pochen im Bauch und ein scharfes, jähes Stechen bei jeder unbedachten Bewegung, als wolle es mich demnächst zerreißen.
Der Arzt nickte zufrieden. »Schon besser.« Er befühlte die Bauchdecke erneut und registrierte mein Zusammenzucken. »Schmerz ist ein lebenswichtiges Signal. Ich werde die Wunde säubern und nähen, und zwar unter lokaler Anästhesie, verstanden? Sie halten sich da raus.« Als ich mühsam nickte, setzte er hinzu: »Den Blutfluss drosseln dürfen Sie natürlich.«
»Es geht aber nicht nur um die Wunde, Doc«, erinnerte ich.
Er wiegte das Haupt. Er hat mittelblondes, leicht welliges Haar und muss, soweit ich das beurteilen kann, in den Augen einer heiratswilligen Frau geradezu unwiderstehlich aussehen. »Richtig, der Energieausfall. Das ist natürlich eine beunruhigende Sache. Ich denke, da sollten wir uns zuerst einmal die Röntgenbilder ansehen.«
Während er meine Akte zu Tage förderte, die Bilder durchsah und zwei davon an das Leuchtgerät klippste, kroch ich mühsam von der Liege und schleppte mich neben ihn. Ich fand eine Stuhllehne, an der ich mich festhalten konnte.
Das linke Bild war eine Gesamtaufnahme meines Bauches zwischen unteren Rippenbögen und Hüfte. In den wolkigen Konturen der Organe leuchteten zahllose grellweiße, scharf konturierte Flecken: Das Sammelsurium meiner Implantate; die reinste Gerümpelkammer. Computer. Navigationsgeräte. Speichereinheiten. Vorratstanks. Tollkühne Einrichtungen wie ein mechanisches Nebenherz mit Sauerstoffanreicherung und Turbofunktion, das sich über eine Parallelleitung in meine Bauchschlagader einklinken und mir kurzfristige Höchstleistungen erlauben sollte wie etwa die, tausend Meter in anderthalb Minuten zurückzulegen. Bloß hat es noch nie länger als eine Minute funktioniert, sodass es im Grunde nur ein nutzloser, an einem meiner Lendenwirbel festgeschraubter Klumpen Hightech ist.
Der flächenmäßig größte Fleck ist die Nuklearbatterie, die das gesamte System mit Strom versorgt. Sie schmiegt sich wie eine knotige Wurst in meinen Beckenboden, und sie ist das einzige Implantat, das ich deutlich spüren kann, weil sie so schwer ist. Auf dem rechten Röntgenbild war sie nur noch ausschnittweise zu sehen. Ein dünnes, anscheinend ummanteltes Kabel führte zu einem kleinen Gebilde, das aussah wie ein rund gelutschtes Bonbon, und von dort aus weiter nach oben.
»Das muss es sein«, meinte Dr. O’Shea und tippte mit dem hinteren Ende seines Kugelschreibers darauf. »Ein Implantat, ungefähr so groß wie ein Pflaumenkern. Es sitzt im Peritoneum. Im Bauchfell«, fügte er hinzu.
Ein Implantat. Er hatte Recht. Es war zu groß für eine Steckverbindung.
»Es ist gewandert, oder?«
»Sicher. Vermutlich ist es ins Bauchfell eingepflanzt, und das bewegt sich mit jedem Atemzug und jedem Schritt, den Sie tun.«
Ich betrachtete den deutlich abgegrenzten weißen Fleck. »An der Stelle dürfte eigentlich nichts sein außer einer simplen Stromleitung.« Man kennt schließlich seinen Bauplan. »Im Grunde nicht mal eine Steckverbindung. Wobei die dadurch zu erklären gewesen wäre, dass bei einer der Nachoperationen aus Versehen das Kabel durchtrennt wurde und es geflickt werden musste. Aber das da …« Ich besah mir den Störenfried aus nächster Nähe und schüttelte schließlich den Kopf. »Keine Ahnung, was das sein soll.«
»Als technischer Laie würde ich sagen, es sieht aus wie eine Art Verteiler.«
»Bloß verteilt es nichts. Ein Kabel geht hinein, ein anderes hinaus.«
Dr. O’Shea nahm eine Lupe zur Hand und studierte das Foto aus der Nähe. »Ja, stimmt. Und wie es aussieht, endet das untere in einem Stecker und das obere in einer Buchse. Womöglich könnte man sie direkt zusammenstecken und das Implantat herausnehmen.« Er sah mich an. »Könnte es eine Art Transformator sein?«
Die Vorstellung, zumindest eines der Implantate loszuwerden, hatte etwas berauschend Verführerisches. »Und wenn wir es einfach probieren?«, schlug ich vor. »Sie öffnen die Wunde so weit, dass Sie an die Kabelenden herankommen, und stecken Sie probehalber zusammen. Dann sehen wir ja, was passiert.«
»Und wenn in den Kabeln unterschiedliche Spannungen herrschen? Dann brennen womöglich Ihre ganzen anderen Aggregate durch.«
Ich schüttelte den Kopf. Ich will nicht behaupten, dass ich die technischen Spezifikationen bis in ihre letzten Feinheiten verstanden habe, aber in einigen Dingen sind sie zum Glück von beruhigender Eindeutigkeit. Das hier war eines davon. »Das ganze System arbeitet mit einheitlicher Spannung, genau 6,2 Volt. Was immer das ist, ein Transformator ist es nicht. Es gibt keine Notwendigkeit für einen Transformator.« Selbst wenn, hätte es keinen Sinn gemacht, ihn an dieser Stelle anzuordnen. Und was hätte an einem Transformator kaputtgehen sollen, das sich mit einer durch die Bauchdecke gestoßenen Ahle reparieren ließ? »Lassen Sie es uns probieren.«
»Das ist riskant«, meinte Dr. O’Shea.
»Was ist daran riskant?« Ich humpelte zurück zur Liege und ließ mich rücklings darauf sinken. »Sie ziehen die Kabelenden ab. Natürlich wird mich das lähmen, aber wenn Sie sie zusammenstecken und ich trotzdem nicht in Gang kommen sollte, stellen Sie einfach die ursprüngliche Situation wieder her.«
»Es gibt keine Garantie dafür, dass das Implantat dann wieder funktioniert.« Er sah auf mich herab, das Gesicht sorgenvoll, aber in den Augen ein begehrliches Funkeln. »Das ist eine Nummer größer als alles, was ich bis jetzt an Ihnen gemacht habe.«
O’Shea hat schon mehrmals locker gewordene Steckverbindungen miteinander vernäht, das erste Mal vor etwa fünf Jahren, als sich die ersten beiden Glieder meines rechten Ringfingers plötzlich nicht mehr bewegen ließen. Ihn dazu zu bringen, meinen Arm zu röntgen, war nicht weiter schwer gewesen, aber es hatte den gesamten restlichen Abend bis in die frühen Morgenstunden gedauert, bis er aufhören konnte, sich zu wundern über das, was die Bilder zeigten und was ich ihm dazu erklärte. Wir brauchten dann noch einmal einen Abend, bis wir den genauen Verlauf der Stromversorgung in Hand und Unterarm verstanden und den Wackelkontakt ausfindig gemacht hatten: ein Steckerpaar nahe des Ellbogens. Dann waren es nur noch ein Schnitt und ein paar Nähte gewesen, eine Sache von zehn Minuten, und der Ringfinger tat’s wieder.
»Gibt es überhaupt Garantien?« Ich rutschte auf der Liege umher, auf der Suche nach einer bequemen Position. Ich hatte nicht vor, ohne Operation wieder aufzustehen. »Ich habe keine Garantie, dass der Strom nicht mitten auf der Straße wegbleibt. Ich habe keine Garantie, dass nicht irgendein anderes Teil ausfällt oder verrückt spielt und mir den Rest gibt. Wenn jemand nicht glauben sollte, ewig zu leben, dann bin ich das.« In dem Moment, in dem ich das sagte, fiel es mir ein: Das war Seneca. Er meint – zumindest habe ich ihn so verstanden –, dass wir, wenn wir uns unserer Hinfälligkeit nicht bewusst bleiben, dazu neigen, unsere Tage zu verschwenden. Und damit letztlich unser Leben. »Wenn Sie wollen, unterschreibe ich Ihnen irgendwas, dass Sie an nichts schuld sind.«
Dr. O’Shea seufzte. »Also, wenn ich es recht bedenke, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein militärisches System übermäßig anfällig konstruiert sein wird. Von mir aus.« Er holte sterile Tücher, eine Spritze und eine Ampulle, deren Inhalt er sorgsam aufzog und mir rund um die Wunde injizierte. Während das Lokalanästhetikum zu wirken begann, desinfizierte er den Bauch mit einem stinkenden roten Zeug und ging dann, während es trocknete, das Operationsbesteck zusammensuchen.
Ich starrte derweil an die Decke und versuchte, nicht an früher zu denken. Vergebens natürlich. Und dann tauchte O’Shea auch noch in meinem Gesichtsfeld auf und fragte, während er sich die Handschuhe überstreifte: »Habe ich Sie schon mal gefragt, wie viele Operationen Sie eigentlich gehabt haben?«
»Bei fünfzig habe ich aufgehört zu zählen«, erwiderte ich, vermutlich mit etwas gepresster Stimme. Bilder huschten durch meinen Geist, himmelhohe grün gekachelte Wände, das Klirren von Metall wie das Klirren von Schwertern einer archaischen Schlacht, grelle kalte Lampen, Männer und Frauen mit Mundschutz, summende, piepsende und sirrende Maschinen, das tierhafte Keuchen der Beatmungsgeräte. »Und da ging es erst richtig los.«
»Unglaublich«, meinte er. »Dass Sie so wenig sichtbare Narben haben, meine ich.«
Ich sagte nichts. Man hat damals alle bekannten Verfahren der kosmetischen Chirurgie an uns ausprobiert und auch ein paar nicht so bekannte, neu erfundene, viel versprechende. Jede Menge Versprechungen hat man uns gemacht, und verglichen damit war das Ergebnis armselig. Es war müßig, das jetzt zu diskutieren. Jetzt wollte ich mich lieber auf das kalte Gefühl in meinem Bauch konzentrieren.
»Spüren Sie das?«, hörte ich Dr. O’Shea fragen.
»Was?«, erwiderte ich.
»Schon gut. Ich fange jetzt an. Ein winziger Schnitt wird genügen.«
»Sagen Sie Bescheid, ehe Sie …« Was hatte ich sagen wollen? Es waren nicht Schmerzen. Schmerzen spürte ich keine. Es war die Situation. Dass wieder jemand mit einem Messer auf meinen Körper losging, den viel geplagten.
Die Stimme das Arztes klang sonor, beruhigend, Vertrauen einflößend. »Keine Sorge. Ich halte Sie auf dem Laufenden.« Auch die Stimmen der Ärzte damals hatten sonor, beruhigend, Vertrauen einflößend geklungen. »Und denken Sie daran, die Blutzufuhr zu drosseln.«
»Alles klar.«
Wie so oft suchte ich meine Zuflucht bei Seneca. Nur ein Unglück gibt es für einen Menschen, nämlich dass es Dinge in seinem Leben gibt, die er als Unglück ansieht. Wie lange hallt dieser Satz schon in meinem Geist wider? Ich werde nie vergessen, wie ich einmal, trübsinnig und mit meinem Schicksal hadernd, durch die Straßen von Dingle geschlichen bin und unversehens, in einer Wühlkiste vor einer eigentlich auf gälische Literatur spezialisierten Buchhandlung in der Dyke Gate Lane, auf ein kleines, zerschlissenes Buch mit Texten des altrömischen Philosophen gestoßen bin. Seneca. Ich schlug es auf, und dieser Satz war das Erste, was ich las. Als spräche er zu mir.
Natürlich habe ich das Buch gekauft. Ein halbes irisches Pfund hat es damals gekostet, doch ich lese es, als wäre es die kostbarste Anschaffung meines Lebens.
»Ich habe das Implantat freigelegt«, sagte Dr. O’Shea. »Die Kabelenden sehen gut aus. Ich ziehe zuerst den Stecker. Drei, zwei, eins – jetzt.«
Ich spürte meinen Körper erstarren, mit Ausnahme des linken Arms. Auch das rechte Auge wurde dunkel, das linke, echte dagegen blieb diesmal unbeeindruckt.
»Ich ziehe die Buchse – jetzt. Auf den ersten Blick scheinen beide Enden tatsächlich zusammenzupassen; ich muss nur noch ein wenig säubern … So. Ich verbinde Stecker und Buchse.«
Es gab ein schnappendes Geräusch, oder zumindest glaubte ich eines zu hören, und übergangslos war ich wieder lebendig, als wäre nichts gewesen. »Es funktioniert«, brachte ich mühsam hervor.
»Gott sei gelobt.« Er klang etwas gestresst, und ich spürte ihn hektisch an meinem Bauch herumfuhrwerken. »Ähm, könnten Sie die Blutzufuhr wieder stoppen? Ich spreche im Interesse Ihrer Hose.«
Natürlich, durch den Stromausfall war die Drossel wieder aufgegangen. Ich habe überall im Körper solche Drosseln, kleine schlingennetzartige Gebilde, die sich um bestimmte Arterien herum zusammenziehen und die Blutzufuhr in bestimmte Körperregionen einschränken können. Es ist eine endlose Tortur gewesen, diese Apparate beherrschen zu lernen, aber wundersamerweise ist es heute das, was ich am besten kann. Ich stoppte die Blutung der Wunde; das war so einfach wie Luftanhalten.
»Danke.« O’Sheas Gesicht tauchte über mir auf. »Ich entferne jetzt das Implantat; ist das in Ihrem Sinne?«
»Absolut«, erwiderte ich.
»Und ich vernähe die Kabelverbindung mit unlöslichem Katgut, ehe ich die Wunde schließe. Die Enden scheinen zwar eingerastet zu sein, aber sicher ist sicher.«
»Genau.«
Endlich konnte ich entspannen. Ich starrte die Decke an, während O’Shea nähte und verschloss, wovon ich nicht mehr mitbekam als ein unklares Druckgefühl. Schließlich machte er mir einen prachtvollen Verband über den halben Bauch und bat mich, zu versuchen, mich aufzusetzen. Wenn man das Gefühl hat, ein Mann ohne Unterleib zu sein, ist das nicht so einfach, aber ich schaffte es schließlich. »Ich kann Sie nach Hause fahren, wenn Sie wollen«, sagte er.
»Kommt nicht infrage«, erwiderte ich. Jeder im Ort kennt den roten Sportwagen des Doktors. Der braucht bloß in eine Straße einzubiegen, damit sich alle Anwohner ihre Gedanken machen. Nicht immer die richtigen, allerdings, denn wenn es auf Vertraulichkeit ankommt, geht Dr. O’Shea selbstverständlich zu Fuß.
»Sie haben gerade eine Operation gehabt. Zumindest sollten Sie sich noch etwas ausruhen.«
»Ich werde«, sagte ich, »mein Hemd und meine Jacke anziehen, meine Umhängetasche nehmen, Ihnen dankbar die Hand schütteln und nach Hause gehen, als sei nichts gewesen.«
Er verzog das Gesicht zu einem halb bewundernden, halb sorgenvollen Grinsen. »Ach, richtig. Sie sind ja Superman.«
»Genau. Ich werde sogar noch ein paar Wochenendeinkäufe machen.«
»Nichts anderes habe ich erwartet.«
Das Implantat war kleiner, als ich es mir vorgestellt hatte, und von einer brüchigen weißen, plastikartigen Schicht umhüllt. Dr. O’Shea spülte es kurz ab und ließ es dann in ein kleines Schraubglas fallen, das er mir reichte. »Bitteschön. Es ist ja bestimmt eine Million Dollar wert.«
»Mindestens«, grinste ich.
»Und außerdem Eigentum der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika.«
»Wie mein halber Körper.« Das meiste von diesem Eigentum der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde ich nie wieder loswerden, das war klar. Trotzdem erfüllte mich der Anblick des kleinen, seltsam sinnlos scheinenden Geräts mit einer lange nicht mehr gefühlten Art von Befriedigung. Zumindest ein Schritt in die richtige Richtung war geglückt. Ich steckte das Glas in die Hosentasche und zog mein Hemd von der Stuhllehne. Der Verband ziepte ein wenig, als ich mich verrenken musste, um den Arm durch den ersten Ärmel zu stecken.
»Übrigens hat gestern jemand nach Ihnen gefragt«, erzählte Dr. O’Shea beiläufig, während er sich die Hände wusch.
Ich hielt in der Bewegung inne. Es durchrieselte mich kalt. »Nach mir gefragt?«
Dr. O’Shea griff nach dem Handtuch. »Ein Asiate. Sprach Englisch, allerdings mit einem merkwürdigen Akzent. Ein merkwürdiger Mensch auch. Aufdringlich. Unsympathisch. Er hatte ein Foto von ihnen dabei und wollte wissen, ob ich Sie kenne.«
»Und?«
»Natürlich habe ich gesagt, dass ich Sie noch nie im Leben gesehen habe.« Er hängte das Handtuch sorgfältig zurück. »Es war übrigens ein ziemlich altes Bild, auf dem man Sie nur mit viel Fantasie erkennt.«
Alles andere wäre auch mehr als alarmierend gewesen, denn das letzte Foto für nichtmedizinische Zwecke ist 1985 von mir gemacht worden, für den Ausweis, der mir Zugang zum allergeheimsten Bereich des ohnehin geheimen Stützpunkts gewähren sollte. »Hat er gesagt, wer er ist? Und warum er ausgerechnet zu Ihnen kommt?«
»Oh, ich hatte den Eindruck, er klappert die ganze Stadt ab, Haus für Haus.«
»Um mich zu finden?« Meine Finger hatten es plötzlich eilig, das Hemd zuzuknöpfen. »Das gefällt mir nicht.«
»Ich würde mir an Ihrer Stelle keine Sorgen machen. So wie er sich benimmt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihm irgendjemand irgendetwas sagen wird.«
Auch wenn Dr. O’Shea mit Geheimhaltung gut umgehen konnte – die ärztliche Schweigepflicht, fällt mir ein, ist ja auch etwas in dieser Richtung –, begriff er trotzdem ganz sicher nicht in vollem Umfang, wozu sie in meinem Fall notwendig war. Es war keine Situation vorstellbar, in der das Auftauchen eines Unbekannten, der nach mir suchte, eine gute Nachricht gewesen wäre, oder auch nur eine harmlose.
Damit du deinen Hunger und Durst zu stillen vermagst, erübrigt sich’s, die Meere zu befahren und auf Eroberungen auszuziehen. Was die Natur verlangt, ist leicht beschafft und schnell bereitet, das Überflüssige aber kostet deinen Schweiß.
Seneca, DE VITA BEATA
3 Ich verließ die Praxis höchst beunruhigt. Während ich die Goat Street hinunterstapfte, sah ich mich mehr und argwöhnischer um als gewöhnlich, und ich bildete mir ein, auch den dumpfschweren Druck der Nuklearbatterie in meinem Unterbauch stärker zu spüren als sonst. Der Himmel war bedrückend und regenschwer, ein Fließbild aus dunklen Grautönen, aber das ist er fast immer. An der irischen Küste treffen die Winde, die sich auf ihrem langen Weg über den Atlantik mit Feuchtigkeit voll gesogen haben, zum ersten Mal auf Festland, und das nutzen sie dann weidlich aus.
Auf dem Weg die Upper Main Street abwärts lachte mir immerhin das Glück eines weiteren lichten Moments: Als hätte sie auf mich gewartet, trat Bridget aus dem Hoteleingang, leichtfüßig tänzelnd und guter Laune, gefolgt von einem Paar, beide untersetzt, leicht fettleibig, auffallend blass und so träge dahinschlappend, als hätten sie Schlaftabletten genommen. Touristen zweifellos, Brennan’s Hotel verwaltet auch eine Reihe von Ferienapartments. Und sie kamen vom Kontinent, denn als der Mann an seinen Mietwagen trat, wollte er erst auf der falschen Seite einsteigen, winkte entnervt ab, als passiere ihm das heute zum mindestens zehnten Mal, und tappte grummelnd um das Fahrzeug herum. Dass sie um diese Zeit schon hier waren, hieß, dass sie unmenschlich früh aufgestanden und mit einer der ersten Maschinen nach Irland geflogen sein mussten, denn vom Shannon Airport bis Dingle sind es locker dreieinhalb Stunden Fahrt, eher mehr, wenn man das erste Mal auf der falschen Straßenseite fahren muss.
Wobei ich gestehen muss, dass ich diese Strecke nur als Beifahrer erlebt habe, damals, bei meiner Ankunft in Irland, und das hat mir die Idee ausgetrieben, mir hier ein Auto zuzulegen. Technisch möglich wäre es. Und ich habe mich schon an so vieles gewöhnt, ich würde auch mit dem Linksfahren zurechtkommen, wenn es sein müsste, bloß wozu? Ich wüsste nicht, wohin ich fahren sollte.
Ich blieb in unverdächtiger Entfernung stehen und sah zu, wie Bridget dem müden Paar den Weg beschrieb. Was sie sagte, war nicht zu hören, aber ich beobachtete fasziniert die Gesten, mit denen sie ihre Erklärungen begleitete, anmutig und zugleich entschieden, keinen Widerspruch duldend. Wie es aussah, waren die beiden in den neben der Fischfabrik gelegenen Marina Cottages untergebracht.
Schließlich stieg Bridget in ihren eigenen Wagen und fuhr los, die Neuankömmlinge hinter sich herlotsend, und in diesem Moment kam mir zu Bewusstsein, dass ich sie nicht wiedersehen würde, falls es ein Sicherheitsleck gegeben haben sollte und man mich deswegen in die USA zurückbeorderte.
Ein Asiate. Das konnte alles Mögliche bedeuten, aber wenn ich Reilly davon erzählte, würden er und die Leute hinter ihm nur eines denken: China! Und mich schneller nach Hause befördert haben, als man das Wort »Menschenrechtsverletzung« aussprechen kann.
Andererseits kenne ich Dr. O’Shea offiziell überhaupt nicht. Wäre alles so, wie es aussieht, wäre ich jetzt durch die Stadt spaziert ohne die geringste Ahnung, dass da ein Mann mit einem Foto in der Hand nach einem gewissen Duane Fitzgerald suchte.
Ich hatte also keinerlei Veranlassung, Lieutnant Colonel Reilly zu informieren.
Zumindest, solange der Unbekannte mich nicht fand.
Gestärkt durch diese tröstliche Erkenntnis schlenderte ich an Brennan’s Hotel vorbei und studierte, aus den Augenwinkeln nach Männern mit asiatischen Gesichtszügen Ausschau haltend, das Plakat, das nun doch an einem der Fenster prangte. Finnan’s Folk