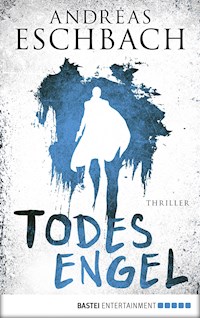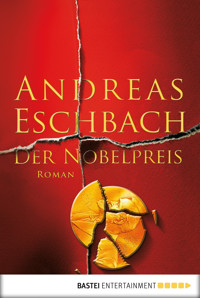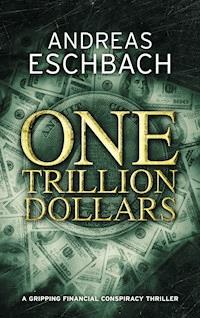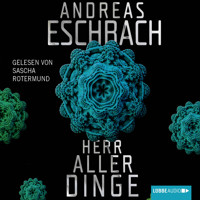
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn alle Menschen gleich reich wären?
Zwei Kinder aus zwei Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Charlotte, die Tochter des französischen Botschafters in Tokio, und Hiroshi, der Sohn der Wäscherin. Sie begegnen sich im Alter von zehn Jahren und freunden sich an, obwohl die Eltern den Kontakt missbilligen. Zu unüberwindbar seien die Unterschiede zwischen Arm und Reich, sagen sie - und bringen Hiroshi damit auf eine ebenso einfache wie geniale Idee. Die Wege der Freunde trennen sich, führen Jahre später wieder zusammen und trennen sich erneut. Die ganze Zeit über verfolgt Hiroshi nur ein Ziel: die Umsetzung seines Planes zur Überwindung aller sozialen Unterschiede. Denn nur so, glaubt er, kann er Charlottes Liebe gewinnen.
Mit "Herr aller Dinge" ist Bestsellerautor Andreas Eschbach ein spannender Scifi-Roman gelungen, der mit Utopien und surrealen Gesellschaftsentwürfen spielt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:23 Std. 36 min
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Prolog
Die Insel der Heiligen
1
2
3
4
5
Unterwegs
Die Insel der Seligen
1
2
3
4
5
6
Unterwegs
Hiroshis Insel
1
2
3
Unterwegs
Charlottes Insel
1
2
3
4
5
6
7
8
Sterneninsel
1
2
3
4
5
6
7
Einsame Insel
1
2
3
Epilog
Leseprobe – NSA – Nationales Sicherheits Amt
ANDREAS ESCHBACH
HERRALLERDINGE
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Redaktion: Stefan Bauer
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Motiven © Ozen Guney/shutterstock.com
Dieser Titel ist auch als Hörbuch bei Lübbe Audio lieferbar
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Copyright © 2011 by Andreas Eschbach und
Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Titelillustration: © Illustration Johannes Wiebel, punchdesign, München; © Shutterstock: gyn9037 | DmitriyRazinkov | Denis Burdin | Kurkul
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1013-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes „NSA – Nationales Sicherheits-Amt“ von Andreas Eschbach.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Redaktion: Stefan Bauer
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Motiven © Ozen Guney/shutterstock.com
PROLOG
Ich weiß jetzt, wie man es machen muss, damit alle Menschen reich sind«, sagte Hiroshi.
»Quatsch«, sagte Charlotte. »Das geht nicht.«
»Doch, das geht«, beharrte er.
»Schaukel lieber«, sagte Charlotte. Es ärgerte sie, dass Hiroshi nur auf dem Brett saß und knirschende Geräusche mit der Kette machte. Sie stieß sich ab, schaukelte. »Los! Wer am höchsten kommt!«
Der Himmel war heute Abend wie dunkelblaues Glas, unendlich weit und geheimnisvoll. Keine einzige Wolke war zu sehen, nur ein erster, winziger Stern, der aufgeregt zwinkerte und blinkte. Wie eine Einladung, ihn doch zu besuchen. Wenn man dort hinauffliegen könnte …! Und die Luft roch warm und nach Sommer, fremdartigen Gewürzen, nach frisch gemähtem Gras.
»Schaukel doch!«, rief sie. »Ich glaub dir eh nicht!«
»Du wirst schon sehen.«
»Ich weiß, was du dir ausgedacht hast. Du denkst, wenn man einfach nur genug Geldscheine druckt, dann sind alle Leute reich«, schrie Charlotte, während die Schaukelschwünge sie immer weiter und weiter hinauftrugen und der Wind ihr ganz herrlich ins Kleid fuhr. »Aber das funktioniert nicht. Mein Papa hat mir das genau erklärt. Davon wird einfach alles nur teurer, denn es gibt ja nicht mehr Sachen, nur weil es mehr Geldscheine gibt!«
Hiroshi warf ihr einen verächtlichen Blick zu. »Das weiß ich selber«, rief er.
»Na also. Dann schaukel endlich! Wer sich traut zu springen!« Charlotte jauchzte. Heute würde sie sich trauen! Sie würde sich ganz, ganz hoch hinaufschwingen und dann loslassen.
Und fliegen!
»Du wirst schon sehen«, rief Hiroshi noch einmal. Dann fing auch er an zu schaukeln, stieß sich mächtig ab, legte sich ins Zeug, um zu ihr aufzuholen. »Wenn ich groß bin, mach ich das!«
»Was denn?«
»Dass alle Leute reich sind. Aber echt reich! Dass jeder alles hat, was er will. Und so viel er will.«
Charlotte schwang mit aller Kraft weiter und überlegte, was sich Hiroshi wohl wirklich ausgedacht haben mochte. Die Schaukel quietschte jämmerlich, und sie begann, ein wenig zu schwanken, weil eines der Beine nicht mehr fest in dem Beton steckte, in dem es hätte verankert sein sollen. »Wie willst du das denn machen?«
»Verrat ich nicht.«
»Weil du’s nicht weißt. Weil du bloß angeben willst.«
Damit war Hiroshi nicht zu beeindrucken. Das hatte sie schon gewusst. Er war sich immer so unglaublich sicher in allem, was er sagte!
»Wart’s einfach ab«, schrie er, warf die Beine himmelwärts und hatte aufgeholt.
Charlotte keuchte vor Anstrengung. »Wenn das wahr ist, dann musst du springen!«
»Okay!« Hiroshi raste jetzt so wild hin und her, hin und her, vor und zurück, als wolle er sich mit der Kette um die Stange oben wickeln. »Aber weißt du, was ich mich frage?«
»Was?«
»Warum vor mir noch niemand draufgekommen ist, wie man das machen muss!«, schrie Hiroshi. »Es ist nämlich unglaublich einfach!«
Damit ließ er los und flog, flog durch die Luft wie aus einer Kanone geschossen. Eine Weile schien er zu schweben, dazu bestimmt, immer weiter und weiter zu fliegen, bis in den Himmel hinauf und in den Weltraum dahinter. Aber dann kam er doch auf dem Rasen auf, rollte sich jauchzend ab und lachte.
Charlotte beobachtete ihn neiderfüllt. Sie hatte aufgehört, sich ins Schaukeln hineinzusteigern, klammerte sich nur an die Ketten und wartete ab, bis sie ausgeschwungen hatte. Als es so weit gewesen wäre, loszulassen, hatte sie es doch nicht gekonnt. Wieso nicht? Wo sie es sich doch so sehr wünschte!
Charlotte Malroux kannte mehr Vergangenheit als irgendjemand sonst, doch die Zukunft kannte sie nicht.
Sie war erst zehn Jahre alt und wusste noch nicht, was für eine Gnade das war.
DIE INSEL DER HEILIGEN
1
Hiroshi und seine Mutter lebten im dritten Stock in einem der Häuser gegenüber der französischen Botschaft, wo sie als Wäscherin arbeitete. Sie hatten zwei Zimmer und ein Bad. Im kleineren der beiden Zimmer schlief Mutter. Das andere diente als Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Hinter einem Wandschirm standen Hiroshis Bett und das Regal, in dem er seine Sachen aufbewahrte. Über dem Bett hatte er ein schmales Fenster aus drei Glassegmenten, die man schräg stellen konnte, um frische Luft hereinzulassen.
Sofern es welche gab. Das war hier, nahe dem Zentrum von Tokio, nicht zu allen Jahreszeiten selbstverständlich. Im Sommer war es nachts oft so schwül und warm, dass Hiroshi nicht schlafen konnte, und manchmal half nicht einmal Regen.
So war es auch in der Nacht, in der er das Mädchen zum ersten Mal sah.
Es regnete. Leiser, silberner Regen fiel vom Himmel und schimmerte im Licht des Mondes und der Stadt wie ein magischer Vorhang. In der Wohnung roch es nach Misosuppe, die es am Abend gegeben hatte, und nach der Wäsche, die an einer Leine quer durchs Zimmer gespannt war und nicht trocknen wollte. Hiroshi konnte nicht schlafen.
Er stand auf und streckte die Hand aus dem Fenster, um zu fühlen, ob es wenigstens ein bisschen weiter draußen kühler zu werden begann. Tat es nicht. So blieb er eine Weile stehen, sah auf den großen, dunklen Garten der Botschaft hinunter und wusste nicht, ob er müde war oder wach. Schließlich legte er sich wieder hin, weil es sonst nichts zu tun gab.
Als er das dritte Mal aufstand, um hinauszuschauen, stand mitten im Garten ein Mädchen.
Sie stand einfach da, die Arme weit ausgebreitet, und schaute zum Himmel hinauf. Sie hatte langes schwarzes Haar, das ihr den Rücken hinabfiel. Sie trug nur ein Nachthemd, und das klebte ihr völlig durchweicht am Körper.
Hiroshi kniff die Augen zu, zählte bis zehn und machte sie wieder auf.
Das Mädchen stand immer noch da unten, mitten auf dem Rasen. Sie wiegte sich hin und her, ganz langsam und verträumt, während der warme Regen auf sie herabprasselte.
Hatte er einen Laut der Überraschung von sich gegeben? Hiroshi wusste es nicht, aber jedenfalls hörte er die Schiebetür gehen, und seine Mutter kam herein. »Was ist?«, fragte sie. »Du sollst schlafen.«
»Da ist ein Mädchen im Garten«, sagte Hiroshi.
Mutter schlurfte ans große Fenster, besah sich das Schauspiel eine Weile schweigend und meinte schließlich: »So fängt das also an. Dass reiche Leute irgendwann verrückt werden.«
»Wieso tut sie das?«, fragte Hiroshi.
»Es ist ein neuer Botschafter angekommen. Das ist vielleicht seine Tochter. Jemand hat so was gesagt, dass er eine Tochter hat.«
»Sie ist ganz nass.«
»Geh schlafen«, sagte Mutter.
»Ich kann nicht. Es ist so warm.«
»Du musst aber schlafen, sonst fallen dir morgen in der Schule die Augen zu. Leg dich wenigstens hin und ruh dich aus.«
Hiroshi rührte sich nicht von der Stelle, so wenig wie das Mädchen. Es sah aus, als bete es den Mond an. Oder als warte es, dass etwas vom Himmel fiel, das es umarmen konnte. »Was ist mit ihr? Sie muss doch auch in die Schule.«
»Was geht dich an, was sie macht?« Jetzt klang Mutter ungehalten. »Das sind reiche Leute. Mit denen haben Leute wie wir nichts zu schaffen.«
»Wieso sind die reich?«
»Sie sind es eben. Schlaf jetzt«, sagte Mutter und ging wieder.
Das schien das größte Problem der Welt zu sein: dass es Leute gab, die reich waren, und andere, die es nicht waren. Mutter sprach oft davon.
In diesem Moment ließ das Mädchen die Arme sinken. Sie blickte zum Haus zurück, und es sah aus, als würde sie von dort gerufen. Durch das Rauschen des Regens hörte Hiroshi nichts, aber er sah, wie sie sich in Bewegung setzte, widerwillig, und wie sie mit nackten Füßen durch das Gras auf eine offene Tür zuging.
Hiroshi wartete, bis sie verschwunden war, dann legte er sich hin. Diesmal schlief er endlich ein, und natürlich träumte er von ihr.
Von da an lag er auf der Lauer. Jeden Nachmittag beeilte er sich, von der Schule nach Hause zu kommen und seinen Beobachtungsplatz am Fenster einzunehmen. Er gewöhnte es sich an, hier seine Schularbeiten zu machen, und am liebsten hätte er auch am Fenster gegessen, aber das erlaubte seine Mutter nicht.
»Was soll das?«, schimpfte sie. »Was machst du da?«
»Nichts«, sagte Hiroshi, und in gewisser Weise stimmte das sogar: Die meiste Zeit schaute er nur in den Garten der Botschaft hinunter und wartete. Er hätte nicht einmal sagen können, worauf eigentlich. Auf das Mädchen, klar. Aber warum? Was erhoffte er sich davon, sie noch einmal zu sehen? Er wusste es nicht. Er wusste nur, dass er nicht anders konnte, als am Fenster auszuharren, obwohl er nicht mehr zu sehen bekam als ab und zu einen hellen Fleck hinter einer Scheibe, der ein Gesicht sein mochte oder auch nicht, und ab und zu einen Schatten, eine Bewegung.
Das Problem war, dass man von der Wohnung aus nur einen ganz kleinen Teil des Gartens einsehen konnte. Hiroshi wusste, dass der Garten sehr groß war, aber die Gebäude darum herum und die vielen Pflanzen versperrten einem die Sicht. Zum Beispiel wusste er, dass mitten in dem Garten der Botschaft ein Swimmingpool lag, doch durch die Bäume sah man nicht den kleinsten Schimmer davon.
Den Gärtner sah er oft. Das war Herr Takagi; Hiroshi kannte ihn nur aus der Ferne. Er mähte den Rasen, beschnitt die Büsche auf eine bestimmte Weise, wie sie in Frankreich üblich war: Das hatte er Mutter einmal erzählt.
Viel mehr passierte nicht. Hiroshi konnte den Vögeln zusehen, die sich ab und zu auf den Zweigen niederließen. Er verfolgte, wie die Schatten wanderten, und versuchte zu erraten, wie spät es war, ehe er auf die Uhr sah. Es war heiß, und es war unbequem am Fenster, aber jetzt hatte er es begonnen, da konnte er es nicht wieder lassen.
Als Hiroshi kurz vor den Sommerferien sein Zwischenzeugnis bekam, schimpfte Mutter über seine Noten. »Du könntest viel besser sein, wenn du dir nur Mühe geben würdest. Was du dir sonst immer alles merken kannst, da müsste die Schule für dich doch ein Kinderspiel sein. Aber es interessiert dich einfach nicht! Du denkst: Schule, Noten – muy! Aber das ist wichtig. Für später. Wenn du einmal einen guten Beruf haben willst, einen, bei dem du dazugehörst, bei einer guten Firma, dann musst du auf eine gute Oberschule gehen. Und die nehmen dich nur, wenn du gute Noten mitbringst.«
»Man muss nur die Aufnahmeprüfung schaffen«, wandte Hiroshi ein.
»Wenn deine Noten zu schlecht sind, darfst du die gar nicht erst machen«, erwiderte Mutter. »Das weißt du genau.«
»Ja«, gab er zu.
Es war immer dieselbe Leier. Es stimmte: Die Schule interessierte Hiroshi tatsächlich nicht. Aber war das seine Schuld? Warum lernten sie denn nichts Interessantes, zum Beispiel, wie Roboter funktionierten? Stattdessen langweilige Mathematik, langweiliges Japanisch, langweilige Erdkunde … Es würden noch Jahre vergehen, bis sie endlich mal etwas annähernd Interessantes wie zum Beispiel Physik bekamen.
Aber wenigstens hatte er nun Ferien. Das hieß, er konnte den ganzen Tag am Fenster auf der Lauer liegen.
Das gefiel seiner Mutter natürlich erst recht nicht. »Kannst du nicht etwas Vernünftiges mit deiner Zeit anfangen wie andere Kinder?«, rief sie jedes Mal, wenn sie von der Arbeit kam. »Wozu hab ich dir den Bastelkasten gekauft, den du unbedingt wolltest? Jetzt liegt er in der Ecke!«
»Ich werd schon noch was damit machen«, erwiderte Hiroshi. Es würde ohnehin lange dauern, ehe er wieder einmal ein so großes Geschenk bekam; das musste er sich gut einteilen. Und der Kasten lief ihm nicht weg.
»Andere Kinder gehen in ihre Schulklubs. Machen Sport. Spielen Fußball, zum Beispiel.«
»Keine Lust«, sagte Hiroshi.
Fußball spielen? Irgendwie schien seine Mutter nicht zu registrieren, dass er kleiner und schwächer war als alle anderen in seiner Klasse, was mit anderen Worten hieß: dass er keine Chance hatte. Im Sportunterricht war er immer der, der als Letzter in eine Mannschaft gewählt wurde, der die wenigsten Punkte machte, der zu nichts zu gebrauchen war.
Abgesehen davon, dass er bei den anderen Jungs ohnehin als Bastard galt, weil sein Vater Amerikaner war. Daken nannten sie ihn, wenn die Lehrer außer Hörweite waren; Promenadenmischung. Und er konnte sich nicht mal wehren.
»Oder geh schwimmen. Du könntest eine verbilligte Ferienkarte fürs Schwimmbad kriegen, wenn du nur mal ins Schulsekretariat gehen würdest. Das wäre doch besser, als hier den ganzen Tag in der Hitze herumzusitzen.«
»So heiß ist es gar nicht«, erwiderte Hiroshi. Aber natürlich war es das. Abends war ihm manchmal schlecht von der Hitze.
»Na schön«, meinte Mutter schließlich. »Spätestens, wenn wir nach Minamata fahren, wirst du von deinem Fenster wegmüssen.«
Hiroshi ließ den Kopf sinken. Schon wieder nach Minamata! »Wann?«, fragte er.
»Zum Bon-Fest natürlich. Wie immer.«
Er überschlug die Zeit bis dahin. O-Bon begann am 13. August. »Das ist ja noch eine Weile.«
»Ich sag’s dir nur schon mal.«
Ein paar Tage später musste er seine »guten« Hosen anprobieren, ob sie ihm noch passten. Taten sie natürlich nicht; sie waren inzwischen zu kurz geworden. Auch wenn er nach wie vor der Kleinste in der Klasse war, war er doch gewachsen.
»Die hier kann ich auslassen«, überlegte Mutter, während sie vor ihm kniete und an seinen Hosenbeinen herumzog. »Aber die andere ist dir zu eng. Wir werden eine neue kaufen müssen, bevor wir fliegen.«
»Wir fliegen?«
»Ja. Frau Nozomi hat mir die Tickets besorgt, sie kennt da jemanden. Wir werden früh aufstehen müssen, das Flugzeug geht um fünf Uhr fünfzig. Aber es ist billiger als die Strecke mit dem Zug, seit der Shinkansen aufgeschlagen hat.« Sie musterte Hiroshi. »Freust du dich nicht? Es hat dir doch gefallen zu fliegen.«
»Ja«, sagte Hiroshi. Vorletztes Jahr war das gewesen; das erste Mal in seinem Leben, dass er geflogen war.
Aber in Wahrheit gruselte Hiroshi sich vor den Familienbesuchen in Minamata. Nicht so sehr wegen seiner Großeltern, die zwar freundlich zu ihm waren, aber letztlich doch reserviert, weil er ein halber Gaijin war, nicht richtig dazugehörte … Nein, vor allem wegen Tante Kumiko, der älteren Schwester seiner Mutter. Sie hatte in ihrer Jugend eine Quecksilbervergiftung erlitten, wie viele Leute in der Gegend, und lag nur verkrümmt und reglos im Bett, die Arme verkrampft und mit verdrehten Augen. Die Ärzte sagten, es sei erstaunlich, dass sie noch lebe; die meisten mit ihrer Krankheit waren inzwischen gestorben.
Immerhin schrie sie nicht mehr, so wie früher. Und die grässlichen Zuckungen hatte sie auch nicht mehr.
Die Bon-Feste in Minamata liefen immer gleich ab. Sie würden alle so tun, als seien sie eine großartige Familie, in der sich alle liebten und in der alles in Ordnung war. Und wenn Mutter und er wieder zu Hause waren, würde sie wochenlang über die Umweltverschmutzung schimpfen und die Autoabgase und den Lärm. Sie würde sich wieder vor Gift im Wasser ängstigen und jede Menge Wasser in Flaschen kaufen, das Hiroshi dann in die Wohnung hochschleppen musste.
Er beschloss, nicht daran zu denken. Und blieb weiter am Fenster sitzen.
Bis schließlich etwas geschah, das seine Ausdauer belohnte.
Wieder einmal waren überall die Vorhänge zugezogen, war es in allen Zimmern so düster, als sei jemand gestorben. Charlotte bemühte sich, kein Geräusch zu machen, während sie auf der Suche nach ihrer Mutter durch die Wohnung schlich.
Sie fand sie schließlich im Wohnzimmer auf dem Kanapee liegend, einen Arm über dem Gesicht und allem Anschein nach schlafend. Halb zumindest.
»Maman?« Im Grunde wusste Charlotte schon, was los war: Mutter hatte wieder ihre Kopfschmerzen. Sie hatte immer Kopfschmerzen.
Ein entsagungsvolles Ächzen aus Richtung des Sofas. »Kind! Was ist denn?« Ein Stöhnen. »Ich habe Kopfschmerzen!«
»Wir wollten doch heute …«, begann Charlotte und brach mitten im Satz ab. Sie hatte keine Hoffnung, aber sie musste es doch wenigstens sagen, oder?
»Ach so.« Ein geräuschvoller Atemzug. Dann, nach einer Weile: »Ein andermal.«
»Warum darf ich nie raus?«
»Du darfst doch raus.«
»Ich meine nicht in den Garten. Auf die Straße!«
Maman knurrte unwillig. »Schlag dir das aus dem Kopf. Das ist viel zu gefährlich.«
Charlotte spürte Ärger in sich hochsteigen, Ärger und Enttäuschung, die schon eine ganze Weile in ihr gärten, und es wurde immer schwieriger, das alles in sich zu behalten. »In Delhi hat es mir besser gefallen«, erklärte sie fest. »Warum kann ich hier nicht auch auf eine internationale Schule gehen?«
»Ich will nicht, dass du die ganze Zeit auf Schulen gehst, in denen man nur Englisch spricht«, erwiderte ihre Mutter mit ersterbender Stimme.
»Was ist denn daran so schlimm?«
Ein abgrundtiefer Seufzer. »Ein Kind widerspricht seiner Mutter nicht. Geh und mach irgendwas und lass mich in Ruhe; ich habe Kopfschmerzen.«
Also schlich Charlotte weiter. Wie langweilig alles war! Sie ging auf die Terrasse hinaus, setzte sich in den Schatten der Hauswand und sah dem Gärtner zu, der drüben beim Pool die Blumen wässerte. Sie konnte schwimmen gehen. Aber das hatte sie in letzter Zeit so oft gemacht; sie hatte keine Lust mehr dazu.
Nach einer Weile schlich sie zurück zu ihrer Mutter, die immer noch reglos im Dunkeln lag.
»Yumiko könnte doch mit mir in das Museum gehen«, schlug sie behutsam vor.
Mutter fuhr erschrocken hoch. »Was? Mon dieu! Du immer mit deinen Museen! Was bist du bloß für ein Kind? Kein normales Kind geht gern in Museen!«
Das war immerhin kein Nein, erkannte Charlotte. Wenn es überhaupt eine Chance gab, den heutigen Tag noch zu retten, dann jetzt. »Aber Yumiko könnte das doch wirklich machen, oder? Sie kennt sich in Tokio aus. Und sie kann auf mich aufpassen.«
Schweigen. Jammervolles, leidendes Schweigen.
»Es war ein Fehler, ein japanisches Kindermädchen einzustellen«, murmelte Mutter dumpf.
»Yumiko ist sehr nett«, widersprach Charlotte. Das stimmte zwar nicht ganz, aber jedenfalls war mit ihr meistens gut auszukommen.
»Sie ist eine dumme Kuh!«, schrie Mutter unvermittelt los, richtete sich auf, warf ein Kissen quer durchs Zimmer und ein zweites gleich hinterher. »Siehst du nicht, dass es mir schlecht geht? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Musst du keine Schulaufgaben machen? Hast du nichts zu lernen, verdammt noch mal?«
Nein, da war nichts mehr zu retten. Charlotte flüchtete ohne ein weiteres Wort.
Nach einer weiteren Runde durch die riesige, dunkle Wohnung verkroch sie sich in ihrem Zimmer. Schulaufgaben? Sie hatte keine Schulaufgaben. Es waren Ferien, auch wenn man, wie sie, von einem Hauslehrer unterrichtet wurde. Das war ja das Problem.
Sie nahm eine Puppe vom Fußende ihres Bettes, wo sie alle Sachen aufbewahrte, von denen sie noch nicht wusste, wohin sie gehörten. Die Puppe hatte Papa ihr geschenkt, als sie von Delhi nach Tokio mussten. Charlotte wusste noch nicht einmal, wie sie heißen sollte. Auf dem Stoffband in den langen blonden Haaren hatte Denise gestanden, aber das war ein blöder Name für eine Puppe, fand Charlotte.
»Sag doch mal, was willst du denn machen?«, fragte Charlotte, sah die Puppe forschend an und drückte den Knopf an ihrem Rücken, der sie sprechen ließ.
»Ich will tanzen gehen«, erklärte die blonde Puppe.
»Tanzen gehen? Wir dürfen nicht mal aus dem Haus. Schlag dir das aus dem Kopf.«
»Komm, wir machen eine Party«, verlangte die Puppe daraufhin.
»Eine Party?« Charlotte schüttelte die Puppe ärgerlich. Überhaupt, was für eine blöde Pieps-Stimme sie hatte! »Du spinnst wohl? Wir müssen leise sein, weil meine Mutter Kopfschmerzen hat. Wir können nicht mal ins Museum gehen.«
»Ist das Leben nicht wundervoll?«
Das war der Moment, in dem die Blase aus Enttäuschung und Ärger in Charlotte aufplatzte. Mit einem wütenden Aufschrei schleuderte sie die Puppe von sich, quer durch den Raum. »Du bist eine dumme Kuh!«, schrie sie ihr hinterher. »Du begreifst überhaupt nichts!«
Im nächsten Augenblick tat es ihr leid, aber nun war es schon passiert: Der Kopf hing abgebrochen herunter, Drähte standen heraus, das Haarteil war abgefallen und einer der Arme auch.
»Das hast du jetzt davon«, erklärte Charlotte. »Ein Kind soll seiner Mutter eben nicht widersprechen.«
Da war nichts mehr zu machen. Die Puppe ohne richtigen Namen war kaputt. Charlotte sah sich ratlos um. Was sollte sie jetzt mit den Überresten anfangen? Sie irgendwo herumliegen lassen war nicht ratsam; ihre Mutter würde die Bescherung heute Abend beim Gutenachtkuss sehen und schimpfen.
Aber wenn die Puppe gar nicht da war! Das würde ihr nicht auffallen, so viele Puppen, wie Charlotte besaß. Sie holte eine Plastiktüte, verstaute die Trümmer darin und eilte damit aus dem Zimmer, die Treppe hinunter zur Seitentür, neben der, wie sie wusste, die Mülleimer der Hauswirtschaft standen.
Da war das Mädchen. Hiroshi hielt die Luft an.
Sie kam aus derselben Tür, in der sie damals, in jener Nacht, verschwunden war. Sie hielt etwas in der Hand, eine orangefarbene Dai-ei-Plastiktüte. Und sie schien ein schlechtes Gewissen zu haben, so, wie sie sich nach allen Seiten umsah, lauschte, lauerte.
In seine Richtung sah sie nicht.
Hiroshi starrte sie an. Wie hell ihre Haut war! Und wie ihr langes schwarzes Haar glänzte! Auch bei Tageslicht sah sie aus wie ein Engel. Wie sie wohl hieß? Und was mochte sie da drinnen die ganze Zeit gemacht haben?
Jetzt setzte sie sich in Bewegung. Wie der Blitz eilte sie zu den Mülleimern, die in der Ecke zwischen der Hauswand und einem Schiebetor standen, hob einen der Deckel an und warf die Plastiktüte hinein. Im nächsten Moment war sie schon wieder im Haus verschwunden.
Hiroshi sank enttäuscht in sich zusammen. Das war kurz gewesen. Er hatte nicht mal ihr Gesicht richtig gesehen, weil sie dauernd woanders hingeschaut hatte.
Was wohl in der Tüte gewesen war, dass sie sie so heimlich fortgeschafft hatte?
Das ließ sich herausfinden, wenn er sich nur traute.
Und so lange, wie er jetzt gewartet hatte, wäre es blöd gewesen, sich nicht zu trauen. Hiroshi sprang auf, schlüpfte in seine Schuhe und rannte los.
Selbstverständlich kannte er in der näheren Umgebung jeden Stein und jeden Winkel. Und es war gar nicht mehr zu zählen, wie oft er das Gelände der Botschaft schon umrundet hatte. Den Haupteingang versperrte ein großes grünes Rolltor mit Stacheln auf der Oberkante, hinter denen man die französische Fahne an einem Mast hängen sah. Ging man von dort aus nach rechts, kam man auf einen Weg, der zum Meguro Expressway hinunterführte und so schmal war, dass ihn ein Auto nur mit Mühe passieren konnte. Eigentlich war es ein Fußweg. Auf der einen Seite standen Wohnhäuser, manche mit kleinen Vorgärten, die andere Seite bildete die alte Mauer um das Botschaftsgelände, mit einem Stachelgitter auf der Oberkante, das man besser nicht versuchte zu überklettern.
An einer Stelle jedoch machte diese Mauer einen Bogen nach innen, um einem mächtigen Baum Platz zu lassen. Sich zwischen dem Baumstamm und der Mauer nach oben zu schieben war einfach, außerdem sah einen da niemand. Das Gitter oben auf der Mauer rostete an dieser stets feuchten Stelle, und aus einem der Stäbe war ein Stück herausgebrochen. Wenn man klein genug war, konnte man sich hindurchzwängen, und Hiroshi war klein genug.
Natürlich durfte man das nicht. Das wusste er. Man brauchte eine Erlaubnis, um das Gelände der Botschaft zu betreten, und musste einen Ausweis mit sich führen. Seine Mutter hatte einen solchen Ausweis, auf dem in Japanisch und Französisch genau stand, zu welchen Bereichen sie Zutritt hatte: zur Wäscherei und zur Hauswirtschaft.
Aber er würde das Gelände ja eigentlich nicht richtig betreten. Oder nur ein bisschen. Nur am Rand. Er würde bloß nachsehen, was das Mädchen weggeworfen hatte, und gleich wieder verschwinden.
Ja, zugegeben – er war schon öfter hier gewesen. Es hatte ihm keine Ruhe gelassen; nach und nach hatte er das gesamte Gelände erkundet. Das war gar nicht so schwierig, weil überall Bäume und Büsche wuchsen, zwischen denen man sich als Kind gut verstecken konnte. Man musste nur aufpassen, nicht vor eine der vielen Kameras zu geraten.
Seine Mutter wäre mächtig böse gewesen, wenn sie davon gewusst hätte.
Das Schwierigste war, auf der anderen Seite der Mauer auf den Boden hinabzukommen. Man brauchte ein Seil dazu, das man am Gitter hängen lassen musste, um später wieder hinaufzukommen.
Der Garten der Botschaft war wie eine fremde, verzauberte Welt. Seltsam, wenn man überlegte, dass es ja nur eine Mauer war, die ihn von der normalen Welt trennte. Doch heute hatte Hiroshi keine Zeit, sich diesem Zauber hinzugeben. Er musste sich beeilen – womöglich wurden die Mülleimer bald geleert!
Es war nicht weit. Er schlich zwischen der Außenmauer und einem kleinen, fensterlosen Bauwerk hindurch, das wohl irgendetwas mit der Heizung zu tun hatte, jedenfalls führten eine Menge weiß lackierter Rohre in alle Richtungen davon. Von dort robbte er unter einigen Büschen hindurch und gelangte schließlich an den Rand des Rasenstücks, auf dem das Mädchen im Regen gestanden hatte.
Er spähte zu den Fenstern hinauf. War da jemand? Zumindest sah er niemanden. Rasch überquerte er den Rasen und den schmalen, mit feinem weißen Kies bestreuten Platz vor dem Haus, hob den Deckel der zweiten Mülltonne von rechts und holte die Plastiktüte mit dem orangefarbenen Supermarktlogo heraus. Dann huschte er mit seiner Beute zurück in die Deckung der Büsche. Das Ganze hatte keine zwanzig Sekunden gedauert.
Neugierig öffnete er die Tüte. Eine Puppe? Trümmer einer Puppe, besser gesagt.
Seltsam. Er hatte immer geglaubt, dass Mädchen ihre Puppen liebten. Dass sie sie kaputt machten, war ihm neu.
Er betrachtete die Bruchstücke, hielt sie aneinander, überlegte. Der Kopf war abgebrochen, aber vielleicht konnte man ihn ankleben? Es handelte sich offenbar um eine Sprechpuppe, die nicht mehr funktionierte. Hiroshi dachte an seinen neuen Bastelkasten mit dem Werkzeug, das er sich so lange gewünscht hatte. Vielleicht ließ sich das damit reparieren?
Er würde die kaputte Puppe mitnehmen.
Es dauerte drei Tage, die Puppe zu reparieren.
Er tat es natürlich heimlich; tagsüber, wenn seine Mutter arbeiten war. Wenn sie nach Hause kam, registrierte sie mit sichtlichem Wohlwollen, dass er nicht mehr am Fenster saß, sondern stattdessen mit seinem Werkzeug hantierte, obwohl sie nicht sah, woran, denn er räumte die Puppe immer rechtzeitig fort.
Am dritten Tag, einem Freitag, gegen zehn Uhr war Hiroshi fertig. Die Reparatur war ihm gut gelungen, fand er; man sah fast nichts. Die Puppe sah aus wie neu. Und sie funktionierte wieder; wenn man auf den dicken Knopf zwischen ihren Schultern drückte, sagte sie verschiedene Sätze in einer fremden, melodiösen Sprache.
Was sollte er nun damit machen? Er musste sie dem Mädchen zurückgeben, und das, so dämmerte ihm, war ein viel größeres Problem, als die Schäden daran zu beseitigen. Denn das hieß, dass er mit einer Puppe in Händen aus dem Haus gehen musste!
Undenkbar die Schande, falls ihn jemand aus seiner Klasse damit sah. Ihm wurde ganz schlecht bei der bloßen Vorstellung.
Vielleicht war es doch besser, er warf sie einfach weg. Schließlich hatte das Mädchen sie auch weggeworfen; wahrscheinlich wollte sie sie überhaupt nicht zurückhaben. Bestimmt gefiel sie ihr gar nicht.
Hiroshi ging zurück ans Fenster, sah auf den Garten der Botschaft hinab, dachte an die lange Zeit, die er hier gewartet hatte und an die Nacht, in der sie da unten gestanden hatte, im Regen. Nein. Nein, er würde die Puppe nicht wegwerfen. Er würde sie einfach in derselben Tüte transportieren, in der er sie gefunden hatte.
Und er konnte sie ja am Haupttor abgeben! Das war nicht weit, und die Wachleute würden sich um alles Weitere kümmern.
So machte er sich auf den Weg. Dass ihm der Schweiß ausbrach, als er mit der Tüte in der Hand das Haus verließ, lag nur an der Gluthitze draußen, ganz bestimmt. Weit und breit war niemand zu sehen. Er hätte sich also gar nicht so beeilen müssen, wie er es tat, aber irgendwie war es ihm lieber, das Ding so schnell wie möglich loszuwerden. Vielleicht gab es ja einen Briefkasten, in den er es bloß hineinzuwerfen brauchte?
Gab es natürlich nicht. Eigentlich wusste er das auch, so oft, wie er an der Botschaft vorbeigegangen war. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als am Wachhäuschen zu klingeln.
Ein Mann trat an die dicke Glasscheibe. Es war kein Japaner. Er sagte etwas, von dem Hiroshi nur mit Mühe begriff, dass es der Versuch war, ihn auf Japanisch zu fragen, was er wolle.
Hiroshi verbeugte sich höflich, wie es sich gegenüber fremden Erwachsenen gehörte. »Guten Tag, mein Herr«, sagte er. Er hob die Tüte an. »Ich habe etwas gefunden, das der Tochter des Botschafters gehört. Ich würde es gerne bei Ihnen abgeben, damit sie es zurückbekommt, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
Der Mann starrte ihn unwillig an. Es war offensichtlich, dass er kein Wort verstanden hatte.
»Nan desu-ka?«, fragte er, oder zumindest etwas, das so ähnlich klang wie: »Wie bitte?«
Hiroshi wiederholte seinen Spruch, worauf der Mann mitten im Satz die Hand hob, sich abwandte und nach jemandem rief. Kurz darauf kam ein anderer Wachmann, ein Japaner diesmal, mit dem er den Platz hinter der Scheibe tauschte.
»Was ist? Was willst du hier?«, fragte der Mann unfreundlich. »Das ist kein Spielplatz. Geh weiter.«
Hiroshi hielt seinem finsteren Blick stand. Er war finstere Blicke gewöhnt; in der Schule hatte er reichlich Gelegenheit zu üben, wie man ihnen standhielt. »Es geht um die Tochter des Botschafters«, sagte er.
Der Blick wurde regelrecht misstrauisch. »Was redest du da?«
»Sie hat eine Puppe verloren, und ich habe sie gefunden.« Es blieb ihm nichts anderes übrig: Er öffnete die Tüte und holte die Puppe ein Stück weit heraus, sodass der Mann sah, wovon die Rede war. Dann ließ Hiroshi sie rasch wieder verschwinden. »Ich denke, sie würde sie gerne zurückhaben.«
Der Mann verzog das Gesicht voller schlecht verheilter Aknenarben. »Was soll das heißen? Woher hast du die Puppe?«
»Gefunden.« Hiroshi streckte die Hand aus, zeigte vage in Richtung ihres Hauses. »Dort vorne.«
»Und woher willst du wissen, wem sie gehört?«
»Ich hab vom Fenster aus gesehen, wie das Mädchen sie verloren hat, das in dem Haus da wohnt.« Hiroshi deutete in Richtung der Villa des Botschafters, von der vom Haupteingang aus nur ein Teil des Daches zu sehen war.
»Das kann nicht sein. Die Tochter des ehrenwerten Herrn Botschafters verlässt das Haus nur ganz selten, und wenn, dann nimmt sie keine … Puppen mit.« Er sprach das Wort mit unüberhörbarem Widerwillen aus.
Hiroshi begriff, dass ihm das Thema ebenfalls peinlich war! Er hätte beinahe gelacht.
»Es war ein Mädchen, das ungefähr so alt ist wie ich«, sagte er stattdessen. »Eine Yōroppajin mit langen schwarzen Haaren. Genau dasselbe Mädchen habe ich auf dem Rasen vor dem Haus gesehen.«
Der Wachmann überlegte. »Gut«, sagte er schließlich und drückte auf einen Knopf, der die eiserne Tür vor Hiroshi aufgehen ließ. »Komm herein.«
Hiroshi musste voller Unbehagen schlucken, als er durch die Tür trat. Eine Barriere teilte den Raum dahinter, und man gelangte nur durch einen Metalldetektor von dem einen in den anderen Bereich. Auch ein Durchleuchtungsgerät stand da, genau wie auf einem Flughafen.
Der Wachmann trat vor Hiroshi hin und streckte die Hand aus. »Also, zeig her.«
Hiroshi reichte ihm die Tüte mit der Puppe. Der Mann öffnete sie, griff hinein, hob die Puppe an, um zu sehen, ob etwas darunter war, aber er nahm sie nicht heraus. Man konnte sehen, wie wenig ihm das alles gefiel; er hantierte mit der Tüte, als enthalte sie etwas Ekliges.
»Ich muss das durchleuchten«, erklärte der Mann. Er sah Hiroshi streng an. »Du hast das wirklich gefunden? Es hat dir nicht jemand gegeben und gesagt, du sollst es hierher bringen?«
»Nein«, sagte Hiroshi. »Ich hab’s gefunden.« Stimmte in gewisser Weise ja.
»Wie ist dein Name?«
Mist. Daran hatte er nicht gedacht, dass man ihn das fragen würde. Aber es würde ihm nichts anderes übrig bleiben, als diese Frage zu beantworten.
»Kato Hiroshi«, gestand er also. »Meine Mutter arbeitet hier in der Botschaft. In der Wäscherei.« Das hätten sie wahrscheinlich sowieso herausgekriegt.
»Und wie heißt deine Mutter?«
»Kato Miyu.«
Der Mann sah in seinem Computer nach. »Naruhodo«, meinte er schließlich und nickte. »Frau Kato aus der Wäscherei. Ich kenne sie.« Trotzdem schrieb er sich den Namen auf, ehe er die Tüte mit der Puppe darin in das Durchleuchtungsgerät laufen ließ.
Hiroshi sah gespannt zu und fragte sich wieder einmal, wie so ein Gerät wohl funktionierte. In den Büchern, die er gelesen hatte, war nichts Verständliches dazu zu finden gewesen. Mit Röntgenstrahlen, so viel war klar – aber wie konnte man mit Röntgenstrahlen feststellen, ob ein Gegenstand Sprengstoff enthielt? Es wurde wirklich Zeit, dass sie in der Schule endlich Physikunterricht bekamen!
Der Wachmann fand keinen Sprengstoff in der Puppe und auch sonst nichts Verdächtiges. Er ging durch den Metalldetektor, nahm die Tüte vom Band und legte sie auf einen Tisch. »Ich werde das weiterleiten«, versprach er.
Es klang eher so, als würde er die Tüte in den Müll werfen, sobald Hiroshi wieder draußen war, aber das war jetzt auch egal.
»Charlotte!«
Die Stimme ihrer Mutter. Mit einem Unterton, der nichts Gutes verhieß.
Charlotte schaltete den Fernseher aus, blieb einen Moment sitzen. Konnte sie es sich leisten, so zu tun, als hätte sie das nicht gehört? Vermutlich nicht. Sie stand leise auf, folgte dem Ruf, wenn auch langsam und auf Zehenspitzen.
»Charlotte Malroux«, rief Mutter erneut. »Komm bitte sofort her.«
»Ich komm ja schon«, rief Charlotte und durchquerte die Tür zum benachbarten Raum, der Gelber Salon genannt wurde. Aber da war ihre Mutter gar nicht, sondern noch eine Tür weiter, in der Eingangshalle.
Sie erschrak. Mutter hielt ihre Puppe in der Hand, die blonde Puppe ohne Namen!
Bloß dass sie nicht mehr kaputt zu sein schien.
»Ich hab dir nicht erlaubt, auf die Straße hinauszugehen«, sagte Mutter scharf.
Charlotte blinzelte verdutzt. »Was? Ich war nicht auf der Straße!«
Mutter hob die Puppe hoch. »Ein Junge hat gesehen, wie du sie verloren hast. Er hat sie am Tor abgegeben.«
»Was?« Was hatte das alles zu bedeuten? Charlotte schüttelte den Kopf. »Aber ich war nicht draußen!«
»Lüg nicht. Das kann ich nicht leiden.«
»Ich lüg nicht.«
Mutter trat vor sie hin, sah streng auf sie herab und hielt ihr die Puppe vor das Gesicht. »Das ist doch deine Puppe, oder? Ich erinnere mich. Dein Vater hat sie dir mitgebracht, aus Paris.« Paris – das sagte sie so, als müsse die blöde Puppe deswegen was ganz Besonderes sein.
Charlotte streckte die Hand aus, um danach zu greifen, aber ihre Mutter zog die Puppe rasch wieder aus ihrer Reichweite. »Woher hat er sie, wenn du nicht draußen warst?«
»Das weiß ich doch nicht.« Zögernd räumte sie ein: »Die Puppe war kaputt.«
»Kaputt? Was heißt kaputt?«
»Sie ist mir runtergefallen.« Jetzt log sie. Nein. Sie sagte nicht ganz die Wahrheit; das war etwas anderes. »Ein Stück vom Kopf ist abgegangen. Und sie hat nicht mehr gesprochen. Ich hab sie draußen im Garten liegen lassen.« Das war zumindest nicht ganz falsch; schließlich standen die Mülleimer gewissermaßen im Garten.
Mutter studierte die Puppe. Wahrscheinlich dachte sie nun, der Gärtner hätte die Puppe gefunden und mit dem Müll hinausgebracht. Dass die Puppe auf diese Weise nach draußen auf die Straße gekommen war, wo der Junge sie hatte finden können.
»Hmm«, meinte Mutter und fuhr mit dem Zeigefinger am Hals der Puppe entlang. »Jemand muss sie repariert haben. Man sieht eine geklebte Bruchstelle.« Sie drückte auf den Knopf am Rücken, und die Puppe sagte: »Bin ich nicht schön?«
Charlotte streckte die Hand noch einmal aus, und diesmal bekam sie die Puppe ausgehändigt. Sie schloss sie in die Arme, machte die Augen für einen Moment zu. »Das war der Junge«, erklärte sie. »Er hat die Puppe repariert. Er hat mich von seinem Fenster aus beobachtet, die ganze Zeit.«
»Wie bitte?«, fragte Mutter entgeistert. »Wieso erzählst du mir das erst jetzt?«
Hiroshi und seine Mutter saßen gerade beim Abendessen, als es an der Tür klingelte. Hiroshi ging aufmachen. Es war Herr Inamoto, der Chef der Firma, bei der Mutter angestellt war. Die Firma erledigte allerlei Reinigungsarbeiten und arbeitete schon seit Langem für die französische Botschaft.
»Hallo, Hiroshi«, sagte er. »Ich muss deine Mutter sprechen.«
Hiroshi mochte Herrn Inamoto nicht, mit seinen Spinnenfingern und seinem feisten Gesicht. Vor allem schaute er Hiroshi immer an, als verdächtige er ihn, etwas angestellt zu haben. Es war unübersehbar, dass Herr Inamoto keine Kinder mochte.
Mutter kam. Hiroshi ging zurück ins Zimmer, setzte sich wieder an den Tisch und wartete. Er lauschte den Stimmen im Flur. Herr Inamoto klang verärgert, sprach aber so leise, dass Hiroshi fast nichts davon verstand.
»… sagt, sie hat die Puppe im Garten liegen lassen. Und der Gärtner weiß von nichts. Also, wie ist sie hinaus auf die Straße …?«
Mutter murmelte etwas.
»Ich habe Ihnen klipp und klar gesagt, dass der Junge nicht auf das Gelände der Botschaft darf. Dass Sie ihn nicht mitnehmen dürfen und dass Sie Ihre Schlüssel und Zugangskarte sicher verwahren müssen«, mahnte Herr Inamoto.
»Ja«, hörte Hiroshi seine Mutter sagen. »Das haben Sie gesagt. Ich habe es ihm auch gesagt. Er weiß es.«
»Verstehen Sie, das hat nichts mit Unfreundlichkeit zu tun, sondern das sind die Sicherheitsmaßnahmen einer Botschaft. Das ist ganz normal. Das wird überall so gehandhabt.«
»Ja, natürlich.«
Immer, wenn er seine Mutter in diesem unterwürfigen Tonfall reden hörte, wurde Hiroshi wütend. Wütend, dass es Leute wie Inamoto gab, die nur ans Geld dachten und denen man nur deswegen schöntun musste, weil sie reich waren.
»Er zahlt dir übrigens viel zu wenig«, sagte Hiroshi, als das Gespräch endlich, mit schrecklich vielen Höflichkeitsbezeugungen seiner Mutter, zu Ende war und sie zurück an den Tisch kam. »Er berechnet der Botschaft bestimmt das Doppelte von dem, was er dir zahlt.«
Mutter hörte gar nicht hin, wie immer, wenn er mit diesem Thema anfing. Stattdessen verhörte sie ihn wegen dieser Puppe.
»Ich hab sie eben gefunden«, erklärte Hiroshi trotzig. »Und ich hab sie zurückgebracht. Was ist daran verkehrt?«
»Wo hast du sie gefunden?«
Die Antwort auf diese Frage hatte sich Hiroshi schon zurechtgelegt, noch während sie mit Inamoto geredet hatte. Da er unmöglich zugeben konnte, im Garten gewesen zu sein, erklärte er: »Drüben bei dem kleinen Tor.«
Das war zumindest nicht ganz falsch, wenn es auch unterschlug, auf welcher Seite des Tores er die Puppe gefunden hatte. Aber wer wollte ihm das Gegenteil beweisen? Mutter wusste, welches Tor er meinte: das schmale, grau lackierte Eisentor in der Gasse schräg gegenüber, hinter dem die Mülleimer der Botschaft standen und durch das sie abgeholt wurden, in der Regel am Dienstagnachmittag. War doch möglich, dass dabei irgendwas herausfiel, oder?
»Vor dem kleinen Tor lag eine Puppe?« Sie musterte ihn skeptisch. »Ich habe nichts gesehen. Wann war das?«
»Am Dienstag. Und die Puppe war in einer Plastiktüte vom Dai-ei-Markt.«
»Und warum hast du sie erst heute in der Botschaft abgegeben?«
Hiroshi hob die Schultern. »So halt.«
»Wieso warst du überhaupt draußen? Du hast doch die ganze Zeit am Fenster gesessen.«
»Ich war eben draußen. Du hast doch immer gesagt, ich soll mal rausgehen.«
Mutter ließ sich das alles durch den Kopf gehen, die Essstäbchen reglos in der Hand. Das ganze Essen wurde kalt, bloß wegen dieser blöden Puppe! Er hätte sie doch wegwerfen sollen.
»Inamoto-san hat gesagt, jemand hätte die Puppe repariert«, fing Mutter noch einmal an. »Warst du das?«
Hiroshi zögerte, dann hob er die Schultern. »Der Kopf war ab. Ich hab ihn eben wieder aufgesteckt. Damit es nicht heißt, ich hätte sie kaputt gemacht.«
»Und du wusstest, dass sie dem Mädchen gehört?«
»Ich hab gesehen, wie sie damit gespielt hat.« Gespielt war vielleicht nicht genau das richtige Wort, denn das Spiel, das er gesehen hatte, hatte eigentlich nur darin bestanden, sie wegzuwerfen … Aber das waren letzten Endes unwichtige Feinheiten, oder?
Mutter schüttelte kummervoll den Kopf. »Warum tust du das? Sitzt den ganzen Tag am Fenster, um dieses Mädchen zu sehen? Das ist nicht gut. Dafür bist du noch viel zu jung.«
Hiroshi schwieg. Was ließ sich darauf schon sagen? Er hatte es eben tun müssen. Wenn sie das nicht verstand, konnte er auch nichts machen.
Mutter fischte ein Stück Daikon aus der Schüssel mit den Tsukemono und sagte, ehe sie es aß: »Ich möchte nicht meine Arbeit wegen etwas verlieren, das du anstellst. Es ist eine gute Arbeit. Wir haben genug Geld zum Leben und eine schöne Wohnung in einer guten Gegend. Das würden wir alles verlieren.«
Auch darauf wusste Hiroshi nichts zu sagen. Das durfte nicht passieren, das war klar. Schon weil sie im schlimmsten Fall nach Minamata würden ziehen müssen, zu den Großeltern und Tante Kumiko.
Aber wieso sollte Mutter ihre Arbeit verlieren, nur weil er eine Puppe repariert und zurückgebracht hatte?
»Auf jeden Fall«, fuhr Mutter kauend fort, »musst du morgen früh mitkommen. Die ehrwürdige Frau Botschafter will dich kennenlernen.«
2
Man hätte meinen können, sie gingen zu einer Audienz beim Kaiser, so, wie sich alle anstellten. Mutter musste wieder und wieder ihre Zugangskarte vorlegen, musste jedem Wachmann, den sie passierten, aufs Neue Rede und Antwort stehen. Zur ehrenwerten Frau Botschafter seien sie bestellt, jawohl. Heute. Jetzt. Das veranlasste jeden Wachmann, die Stirn zu runzeln und erst einmal zu telefonieren. Jedes Mal lauschte er dem, was ihm vom anderen Ende der Leitung aus mitgeteilt wurde, verbeugte sich zackig, legte auf und winkte sie weiter.
»Heute Abend gibt der ehrenwerte Herr Botschafter einen Empfang«, geruhte einer der Männer, sie wissen zu lassen. »Deshalb ist eine solche Vorladung ungewöhnlich.«
Sie passierten einen Metalldetektor, später noch einen, und dazwischen redete Hiroshis Mutter unaufhörlich auf ihn ein, sich gut zu benehmen. Nur zu reden, wenn er gefragt würde. Sich zu verneigen, wie es sich gehörte. »Am besten stellst du dir vor, du stündest vor dem Kaiser«, meinte sie.
Was hatte er da bloß angefangen! Hiroshi merkte, wie seine Handflächen mit jedem Meter, den sie zurücklegten, schwitziger wurden. Wahrscheinlich würde er kein Wort herausbekommen, egal ob ihn jemand etwas fragte oder nicht. Überhaupt, wozu wollte die Frau des Botschafters ihn sehen? Das hatte er sich die ganze Nacht lang gefragt. Alles war denkbar: Vielleicht wollte sie ihm einen Orden verleihen, weil er die wertvolle Puppe ihrer Tochter gerettet hatte? Oder wollte sie ihn anklagen, die Puppe gestohlen zu haben?
Irgendwann hörten die kahlen, grau gestrichenen Gänge auf, und man führte sie in einen kolossalen, überaus prachtvollen Saal. Es roch plötzlich intensiv nach Blumen und Parfüm. Vor den Fenstern reichten mächtige, gebauschte Vorhänge bis zum Boden, wie in alten amerikanischen Filmen. Überall an den Wänden prangten riesige Ölgemälde in wuchtigen Goldrahmen.
Hiroshi war sich auf einmal nicht mehr sicher, das alles nicht bloß zu träumen. Was hatte er da nur angefangen, bei den Geistern der Ahnen!
Und dann kam ihnen diese große, schlanke Frau entgegen, mit hellblonden hochtoupierten Haaren, in einem golden schimmernden Kleid. Eine wunderschöne Frau mit porzellanfarbener Haut und dunklen Augen – doch sie wirkte, als sei es ihr gar nicht recht, dass sie da waren! Das musste die Frau des Botschafters sein, oder? Die sie herbestellt hatte? Aber weder hatte Hiroshi den Eindruck, dass sie böse auf ihn war, noch, dass sie ihm wohlgesinnt war … Verwirrt wirkte sie, ja. Sie sah aus, als sei ihr gerade erst wieder eingefallen, dass sie kommen sollten.
»Verneigen!«, hörte Hiroshi seine Mutter wispern, was gut war, denn sonst hätte er sämtliche Ermahnungen wieder vergessen.
Also, jetzt aber! Wie es sich gehörte! Zeigen, dass er wohlerzogen war, und sei es nur, um seine Mutter zufriedenzustellen. Hiroshi verbeugte sich, tief, den Rücken gerade, die Hände akkurat auf den Oberschenkeln, und so wartete er, wie es sich geziemte, bis das Wort an ihn gerichtet wurde.
Die Frau sagte etwas. Hiroshi brauchte eine ganze Weile, bis ihm dämmerte, dass sie konnichi wa gesagt hatte, Guten Tag, oder dass sie zumindest versucht hatte, es zu sagen. Tatsächlich hatte es eher wie goninshiki geklungen, wie Missverständnis also, was ja irgendwie sogar witzig war.
Er richtete sich auf, hielt den Kopf aber noch gesenkt. Er erwiderte den Gruß mit der gebotenen Zurückhaltung. Dann wartete er ab, was geschehen würde.
Die Frau schien unzufrieden. Immer wieder rief sie etwas nach hinten, in ihrer eigenen Sprache, die sich wie Gesang anhörte. Ein Wort fiel immer wieder, das sich wie tara doko-têr anhörte, ein Wort, von dem Hiroshi keine Ahnung hatte, was es bedeuten mochte.
»Do you speak English?«, fragte die Frau schließlich.
Hiroshi neigte den Kopf noch ein Stück tiefer. »Yes, madam«, erwiderte er, obwohl ihm das in diesem Moment wie eine tollkühne Behauptung vorkam. Seine Mutter hatte seit jeher darauf bestanden, dass er sich im Englischunterricht besonders viel Mühe gab, weil es die Sprache seines Vaters war. Sie selber sprach sehr gut Englisch, hörte ihn regelmäßig ab und duldete keine schlechten Noten. Tatsächlich jedoch konnte Hiroshi Englisch zwar lesen – was zum Beispiel im Internet hilfreich war – und auch einigermaßen verstehen, aber was seine Aussprache anbelangte, hegte er den starken Verdacht, dass sie allenfalls dazu geeignet war, bei Ausländern Lachkrämpfe hervorzurufen.
Doch als die Frau des Botschafters weitersprach, merkte er, dass sie noch viel schlechter Englisch sprach als selbst Shigeru, einer seiner Klassenkameraden, der Herrn Matsuba, ihren Englischlehrer, regelmäßig zur Verzweiflung trieb: Hiroshi verstand kein Wort!
Hilflos sah er seine Mutter an, die seinen Blick jedoch nur entsetzt erwiderte. Also verstand sie auch nichts!
Was um alles in der Welt wollte diese Frau? Sie schien eine Antwort zu erwarten, aber was sollte er denn sagen? Er konnte ihr doch nicht erklären, dass er sie nicht verstand; das wäre unverzeihlich unhöflich gewesen!
Die Frau rief wieder nach dem ominösen tara doko-têr, und allmählich klang sie ziemlich ungehalten.
Hiroshi wusste sich nicht zu helfen. Er hielt den Blick starr auf den Boden gerichtet und hatte das Gefühl, dass jeden Moment Schweiß in dicken Tropfen von seinen Händen auf den Teppich herabfallen musste.
In diesem Augenblick bemerkte er in den Augenwinkeln eine Bewegung, jemanden, der ins Zimmer kam. Hiroshi drehte den Kopf eine Winzigkeit, um besser zu sehen.
Es war das Mädchen. Sie stand da, und obwohl er wusste, dass es sich nicht gehörte, konnte er nicht anders, als den Kopf zu heben und sie anzusehen.
Und dann sagte das Mädchen in tadellosem Japanisch: »Meine Mutter möchte dir danken, dass du meine Puppe gefunden und zurückgebracht hast, und sie möchte gerne wissen, wo du sie gefunden hast.«
Charlotte musste einfach lauschen, als sie mitbekam, dass ihre Mutter den Jungen erwartete, der die Puppe repariert und zurückgebracht hatte. Vor allem wollte sie wissen, wie er aussah. Was das für einer war, der so was machte.
Maman war heute guter Stimmung. Das war sie immer, wenn ein Empfang bevorstand. Dann lebte sie auf, und Kopfschmerzen hatte sie an solchen Tagen auch nie.
Aber natürlich kam sie mal wieder nicht zurecht. Sie hatte vergessen, dem Übersetzer Bescheid zu sagen, was ihr erst wieder einfiel, als schon die Nachricht vom Haupteingang kam, dass der Junge und seine Mutter unterwegs seien. Sie fegte durch die Räume, riss die Sekretärin, Madame Chadal, aus ihrer Arbeit und befahl ihr, sofort den Übersetzer herbeizuzitieren. Dass der das bei dem Verkehr an einem Samstagmorgen in Tokio nie im Leben schaffen konnte, davon wollte sie nichts hören.
Das Geräusch der sich öffnenden Wohnungstür ließ Maman zusammenfahren. »Sie sind schon da«, murmelte sie. »Quelle horreur!« Dann straffte sich ihre Gestalt, sie setzte ihr bestes Lächeln auf und schritt hinaus in die Eingangshalle.
Charlotte huschte durch den Gelben Salon, um, versteckt hinter den Vitrinen neben der anderen Tür, einen Blick auf die Besucher zu werfen.
Die Frau hatte sie oft gesehen, wie sie Wäschekörbe über den Hof trug. Sie wirkte nicht, als hätte sie diese Art Arbeit schon ihr Leben lang gemacht, sondern auf eine seltsame Weise so, als verstecke sie sich hier vor jemandem. Sie musste einmal schön gewesen sein. Sie hätte es wahrscheinlich immer noch sein können, wenn sie etwas anderes getragen hätte als diese grauen sackartigen Sachen, und sich ein wenig zurechtgemacht hätte.
Mutter begrüßte die beiden mit den paar Brocken Japanisch, die sie sich angeeignet hatte. Aber nicht nur, dass die beiden offensichtlich kein Wort verstanden, es hätte auch zu nichts geführt, weil Mutter die Unterhaltung ja nicht auf Japanisch hätte fortsetzen können.
»Où est le traducteur?«, rief sie ein ums andere Mal, aber auf der anderen Seite der Tür stand nur Madame Chadal, das Mobiltelefon in der Hand und hilflos die Schultern hebend, weil der Übersetzer nicht einmal zu erreichen war und seine Vertreterin auch nicht.
Den Jungen hatte Charlotte noch nie gesehen. Er konnte nicht älter sein als sie selber, und er war relativ klein, aber so, wie er da stand, und obwohl er lächerlich lange in dieser tiefen Verbeugung verharrte, spürte sie etwas Unbeugsames an ihm, etwas wie einen Kern aus Federstahl.
Mutter versuchte es mit Englisch. Das beherrschte sie zwar, sprach es aber mit einem so starken französischen Akzent, dass die beiden Gäste ebenfalls ratlos waren.
Charlotte rang mit sich. Wenn sie einsprang, dann würde Maman wissen, dass sie gelauscht hatte, was ihr ausdrücklich verboten war. Auf der anderen Seite konnte sie nicht mit ansehen, wie ihre Mutter sich blamierte, nur weil sie sich schrecklich ungeschickt mit fremden Sprachen anstellte!
Also gab sie ihr Versteck auf und ging hinaus in die Halle.
»Woher kannst du Japanisch?«, wunderte sich ihre Mutter, nachdem sie ihr die Antwort des Jungen – dass er die Puppe auf der Straße neben dem Tor gefunden habe, durch das die Mülleimer abtransportiert wurden – übersetzt hatte.
»Yumiko hat es mir beigebracht«, erklärte Charlotte, obwohl das übertrieben war, denn Yumiko hatte zwar ihre Vorzüge, aber die Fähigkeit, jemandem etwas beizubringen, zählte nicht dazu. Als Erklärung auf die Schnelle genügte es jedoch.
Mutter kam kaum aus dem Kopfschütteln heraus. »Also so was … Nicht zu fassen.« Sie räusperte sich. »Also gut. Sag ihnen, dass ich mich … nein, dass du dich … nein, dass wir uns über diese, hmm, Aufmerksamkeit sehr gefreut haben und … ähm, ja, wir sollten uns irgendwie erkenntlich zeigen. Ich weiß bloß gerade nicht recht, wie. Versuch doch mal von dem Jungen zu erfahren, wie wir ihm eine Freude machen könnten.«
»Okay«, sagte Charlotte, drehte sich um und fragte den Jungen: »Wieso hast du das gemacht?«
Er blinzelte. »Was meinst du?«
»Meine Puppe repariert.«
Er hob die Schultern. »Ich weiß nicht. Hätte ich es nicht sollen?«
Charlotte nagte an ihrer Unterlippe. Sie wusste nicht, was sie darauf sagen sollte. »Sie ist mir einfach kaputt gegangen«, behauptete sie schließlich.
Er nickte, als sei das das Selbstverständlichste der Welt. »Ach so.«
»Willst du mein Zimmer sehen?«
»Ja.«
»Gut, dann komm mit.« Sie wandte sich ihrer Mutter zu und erklärte: »C’est bon. Wir haben ausgemacht, dass wir miteinander spielen. Ich geh und zeige ihm mein Zimmer und meine Sachen und so.«
»Mais non!« Mutter riss die Augen auf. »Ich meinte ein kleines Geschenk oder so etwas …«
»Das will er nicht«, behauptete Charlotte und erschrak selber ein bisschen über ihre Kühnheit. Der Junge war allerdings irgendwie nett. Vielleicht konnten sie sich anfreunden.
»Aber doch nicht jetzt! Wo doch heute der Empfang ist …!«
»Der ist doch erst heute Abend. Bis dahin ist ja noch lang.« Sie durfte sich jetzt auf keine lange Diskussion einlassen, das wusste sie. Also bedeutete sie dem Jungen kurzerhand, mit ihr zu kommen, und setzte sich in Bewegung.
Der Junge folgte ihr, ohne zu zögern. Seine Mutter rief ihm nach, wohin er gehe. »Sie will mir ihr Zimmer zeigen«, rief er über die Schulter zurück, und das war alles.
Je weiter sie kamen, desto weniger mochte Hiroshi glauben, dass sie sich wirklich in einer Wohnung befanden. Wer hatte eine derart große Wohnung? Was wollte jemand mit so vielen, so riesigen Zimmern? Das sah eher aus wie eine Art Museum, so vollgestopft mit teuer und alt aussehenden Sachen, wie alle Räume waren.
»Wie heißt du?«, fragte das Mädchen.
»Hiroshi«, sagte er und überlegte, ob er ihr erzählen sollte, wie er sie das erste Mal gesehen hatte. Er hätte gern gewusst, warum sie sich im Nachthemd in den Regen gestellt hatte.
»Ich heiße Charlotte«, erklärte sie. »Mit r und l. Kannst du das sagen?«
Er probierte es, während sie eine breite Treppe emporstiegen. »Cha…rotte«, brachte er heraus. Sie lachte, worauf er es noch einmal versuchte. »Cha-re-rotte?«
Sie blieb stehen, öffnete den Mund und machte ihm vor, wie das l ging: »Zungenspitze hinter die Zähne oben. Siehst du?« Es war ein Mund, der aussah wie gezeichnet: ganz fein, mit schmalen Lippen und perlweißen, makellosen Zähnen.
»Ich weiß«, erwiderte er. Im Englischunterricht hatten sie das geübt. Seine Mutter konnte es, hatte es ihn ebenfalls üben lassen. »Char…lotte.« Es fühlte sich seltsam an im Mund, aber er schien es richtig gemacht zu haben, denn sie nickte lächelnd und setzte den Weg die Treppe hinauf fort.
»Yumiko hat mir das erklärt«, sagte sie dabei. »Dass für Japaner das r und das l gleich klingen.«
»Wer ist Yumiko?«, fragte er.
»Mein Kindermädchen«, lautete die Antwort. »Sie ist ganz nett. Sie geht manchmal mit mir raus, zeigt mir Sachen und so.«
»Was für Sachen?«
»Na, die Stadt. Tokio. Ich kann ja nicht alleine raus. Ich kann nämlich Japanisch nicht lesen, ehrlich gesagt.«
Sie hatten den obersten Treppenabsatz erreicht. Ein langer Flur erstreckte sich nach links und rechts, mit noch mehr gerahmten Bildern an den Wänden und dicken gemusterten Teppichen. Es sah wirklich aus wie ein Museum.
»Meiner Mutter ist das gar nicht recht«, fuhr Charlotte fort und wandte sich nach rechts. »Solche Ausflüge, meine ich. Wenn’s nach der ginge, müsste ich die ganze Zeit drinnen bleiben. Oder im Garten halt.«
»Das muss langweilig sein«, meinte Hiroshi.
»Ist es auch.« Charlotte öffnete eine Tür. »So, das ist mein Zimmer.«
Es war riesig, und es war vollgestopft mit lauter Spielsachen, ordentlich auf Regalen und in Schränken aufgestellt: Puppen, Stofftiere, aber auch Malstifte, Bücher und Modellautos. In einer Ecke stand ein enormes Himmelbett und unter dem Fenster ein Schreibtisch, auf dem Schulhefte und Schreibzeug lagen.
Hiroshi sah sofort, dass er richtig vermutet hatte: Dies war das Zimmer, hinter dessen Fenstern er ab und zu Bewegungen gesehen hatte. Er hatte es sich schon gedacht, während sie durch das Haus gegangen waren und er gemerkt hatte, dass sie sich in diese Richtung bewegten.
»Und das ist der Spielplatz.« Charlotte zog ihn zum Fenster. Auf einem Platz unter den Bäumen standen eine Schaukel und ein Klettergerüst. »Da war auch ein Sandkasten, als wir angekommen sind, aber den hat meine Mutter wegräumen lassen, weil ich schon zu groß dafür bin.«
Hiroshi kannte den Spielplatz, aber das ließ er sich nicht anmerken. Von ihrer Wohnung aus war er nicht zu sehen; er hatte ihn bei seinen heimlichen Streifzügen durch das Botschaftsgelände entdeckt. »Ihr habt einen großen Garten.«
»In Delhi hatten wir ein Haus mit einem noch größeren Garten«, behauptete sie. »Nicht so schön gepflegt wie der hier, aber es gab dort Affen, stell dir vor! Einmal ist einer durchs Fenster in mein Zimmer gekommen und hat mir ein Schulheft geklaut.«
»Affen?« Hiroshi staunte. Er wusste gerade nicht, wo dieses Delhi lag – in Indien oder so, konnte das sein? –, aber auf jeden Fall war das Mädchen schon ganz schön in der Welt herumgekommen. Das machte ihn beinahe neidisch. »Das kann dir hier nicht passieren.«
»Ach, eigentlich war es lustig. Außerdem war es mein Matheheft. Um das war es nicht schade«, gluckste sie. Es gefiel ihm, wenn sie lachte.
»In welche Schule gehst du eigentlich?«, fragte er. Wenn sie kein Japanisch lesen konnte, ging sie ja wohl kaum in eine normale Schule.
Das brachte das Lachen zum Verschwinden. Sie seufzte. »In gar keine. Ich habe einen Hauslehrer, der mich unterrichtet. Er kommt aus Paris. Meine Mutter sagt, das ist, damit ich dieselben Sachen lerne, die ich zu Hause lernen würde. Aber ich hätte lieber Klassenkameraden.«
Hiroshi wusste, dass sie aus einem Land kam, das Frankreich hieß und in Europa lag. Er hatte im Atlas nachgesehen, wo das lag, aber es fiel ihm schwer, sich vorzustellen, wie es dort aussah und wie es sein mochte, dort zu leben.
Er dachte an die Mitschüler in seiner Klasse und wie gern sie ihn piesackten, weil er der Kleinste war. »So toll ist das auch nicht immer«, meinte er.
»In Delhi bin ich auf die Internationale Schule gegangen«, erzählte Charlotte. »Da hatte ich eine beste Freundin, Brenda.« Sie hielt inne. Hiroshi merkte, dass es ihr wehtat, daran zu denken. »Wir haben ausgemacht, uns zu schreiben, aber sie hat mir nie geantwortet.«
»Das ist schade«, meinte er.
Sie nickte. »Ja. Das kommt daher, dass mein Vater Botschafter von Beruf ist. Deswegen muss er alle paar Jahre in ein anderes Land ziehen, und wir müssen natürlich mit. Ich war schon in Indien, davor im Kongo, und als ich ganz klein war, haben wir in San Francisco gelebt.« Charlotte musterte ihn. »Was ist dein Vater von Beruf?«
Hiroshi zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ich kenn ihn gar nicht. Ich weiß nur, dass er Amerikaner ist.«
»Hast du ihn noch nie gesehen?«
»Nein.«
»Hast du wenigstens ein Foto von ihm?«
Hiroshi nickte. »Zu Hause.«
»Das musst du mir mal zeigen.« Sie nahm ein gerahmtes Bild von ihrem Schreibtisch, das sie mit ihrer Familie zeigte. Ihr Vater hatte hellbraunes, leicht gewelltes Haar und lächelte amüsiert, beinahe spöttisch. »Das ist vor dem Haus, in dem wir in Delhi gewohnt haben.« Sie deutete auf den Hintergrund, in dem Palmen und graue Bäume mit seltsam ineinander verschlungenen Ästen zu sehen waren. »Das war der Garten. Leider sieht man auf dem Foto keine Affen.«
»In Delhi scheint es dir besser gefallen zu haben als hier«, meinte Hiroshi.
»Ich mag es bloß nicht, dass ich immer allein bin.« Sie huschte an ihr Regal und holte unter all den anderen die Puppe heraus, die Hiroshi repariert hatte. »Wie hast du das überhaupt gemacht? Die war doch total kaputt!«
Hiroshi zuckte mit den Schultern. »Ich hab eine Menge Werkzeug. Ich hab’s halt probiert.«
»Richtiges Werkzeug?«
»Ja. Wenn ich Geburtstag hab, wünsch ich mir immer Werkzeug. Zu Weihnachten auch. Ich bau lieber Sachen, als welche zu kaufen.« Dass er außerdem meistens nicht das Geld dafür hatte, wollte er irgendwie nicht erzählen.
Charlotte betrachtete die Puppe nachdenklich. »Komisch. Vorher mochte ich die Puppe gar nicht, aber jetzt ist sie was Besonderes. Ich glaube, ich nenn sie von nun an Valérie.« Sie wiederholte den Namen, als ließe sie sich etwas Zartes, Schmelzendes auf der Zunge zergehen. »Valérie. Ja, das ist ihr Name.«
Sie ging wieder an ihr Regal und setzte die Puppe sorgsam an genau den Platz zurück, an dem sie vorher gesessen hatte.
»Wir können heute leider nicht richtig spielen, weil meine Eltern heute Abend einen Empfang geben«, erklärte sie dann. »Da muss ich auch dabei sein. Ich muss noch duschen und mich frisieren und herrichten lassen und so. Das dauert immer ewig!«
»Aha«, sagte Hiroshi. Er wusste nicht genau, was er sich unter einem Empfang vorstellen sollte. Das war wohl eines von den Dingen, die reiche Leute so machten. »Schade.«
»Aber du kannst mich ja besuchen kommen«, schlug sie vor. »Wenn du magst. Dann könnten wir in aller Ruhe miteinander spielen. Auch draußen im Garten.«
Hiroshi nickte. »Ja, okay.«
»Morgen Nachmittag vielleicht? Um drei Uhr?«
»Okay«, sagte Hiroshi.