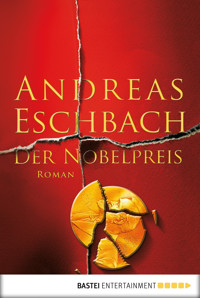Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Erich Sassbeck ist zur falschen Zeit am falschen Ort und gerät in eine brutale Schlägerei. Doch am Ende ist er es, der überlebt, während seine Angreifer tot sind - erschossen von unbekannter Hand. Sassbeck glaubt, dass ihn ein Wunder gerettet hat. Die Polizei dagegen fragt sich, ob nicht er geschossen hat. In Notwehr. Oder schlimmer: in Selbstjustiz. Der Journalist Ingo Praise findet bald Beweise, dass Sassbecks Geschichte stimmt. Ein Unbekannter streift durch die Stadt und beschützt Unschuldige. Praise macht den "Todesengel" zum Star - und löst damit eine Katastrophe aus ... Dieses E-Book von Andreas Eschbach enthält neben dem Roman "Todesengel" ein Interview mit dem bekannten deutschen Kriminologen Prof. Dr. Christian Pfeiffer.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:9 Std. 11 min
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Über den Autor
Andreas Eschbach, 1959 in Ulm geboren, studierte Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstellerisch hochbegabten Nachwuchs« schrieb er seinen ersten Roman DIE HAARTEPPICHKNÜPFER. Bekannt wurde er durch den Thriller DAS JESUS-VIDEO. Mit EINE BILLION DOLLAR (2001) stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Autoren auf. Es folgten u. a. Bestseller wie AUSGEBRANNT (2007), HERR ALLER DINGE (2010), TODESENGEL (2013) und DER JESUS-DEAL (2014). Andreas Eschbach lebt heute als freier Schriftsteller in der Bretagne.
Weitere Infos zum Autor unter www.andreaseschbach.com
ANDREAS ESCHBACH
Thriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Copyright © 2013 by Andreas Eschbach Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefan Bauer Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München Umschlagmotiv: shutterstock/Rivus Dea; shutterstock/shoeberl E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-4509-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
PROLOGWir Menschen sind sensibler, als die meisten von uns ahnen. Hätten wir keinen Filter im Hirn, die Flut der Sinneseindrücke würde uns überwältigen.
Man kann diesen Filter ausschalten. Ich kann es.
Man sollte es nur tun, wenn man mit der Flut umgehen kann. Auch das kann ich.
Deswegen durchquere ich die Nacht, als bewege ich mich durch einen ungeheuren, lebendigen Organismus. Ich höre die Dunkelheit. Ich fühle die Stimmen Tausender von Menschen. Ich spüre sie atmen, reden, lachen, seufzen. Ich sehe ihre Ängste. Ich rieche ihre Hoffnungen. Ich schmecke ihre Traurigkeit, ihre Verzweiflung, ihre Enttäuschungen.
Ich bin eins mit allem. Das sagt sich leicht, aber kaum einer von denen, die es gesagt haben, hat je gewusst, wovon er redet. Ich weiß es. Ich bin es.
Ich bin auf dem Pfad des Kriegers.
Symphonien flackernder Leuchtreklamen umspülen mich. Scharfkantige Hochhäuser stempeln ihre Silhouetten gegen den nachtfarbenen Himmel. Autos, Taxen, Busse flirren als hektische Interpunktionen, Motorräder sägen in der Ferne, und ich bin der einzige Mensch weit und breit, der zu Fuß geht.
Alles ist ruhig. Aber es ist die Art Ruhe, auf die Stürme folgen. Ich ahne es. Ich spüre es. Ich weiß es.
Ich mache mir keine Gedanken. Ich bin seit Stunden unterwegs, doch ich habe Geduld – nein, ich bin Geduld. Alles wird zur richtigen Zeit geschehen. Es gibt nichts zu beschleunigen, nichts zu bremsen, nichts zu verpassen.
Und es gibt nichts zu entscheiden.
Weil alles längst entschieden ist.
Es ist längst entschieden, dass ich den Abgang einer U-Bahn-Station in genau dem Augenblick erreiche, in dem Schmerz daraus zum Himmel flammt wie ein Fanal, schrecklicher Schmerz und Todesangst.
Auch, dass ich die Treppe hinabsteige, ist längst entschieden.
Ich bin im Zustand der Gnade. Ich werde im richtigen Moment am richtigen Ort sein.
Und das Richtige tun.
1Zivilcourage! Das Wort lag ihm quer, seit Evelyn es ihm ins Gesicht geschleudert hatte. Was verstand sie schon von diesen Dingen? Seine Schwiegertochter war ein Kind gewesen, als die Mauer gefallen war, und überdies im Westen aufgewachsen: Sie hatte die Zeit damals nicht erlebt.
Ein kalter Herbstwind fegte die Straße herab, schien nach einem Ausgang aus den Häuserschluchten zu suchen. Erich Sassbeck schlug den Mantelkragen hoch und bedauerte es, keinen Schal mitgenommen zu haben. In seinem Alter musste man Erkältungen fürchten.
Außerdem hatte er sich nichts vorzuwerfen. Er hatte nur seinen Dienst getan. Seine Pflicht erfüllt. Die Grenze hatte anti-imperialistischer Schutzwall geheißen, und so ganz falsch war diese Bezeichnung ja auch wieder nicht gewesen, oder?
Wenn man sich so ansah, wie das Leben heute war. Da hatten sie es früher in mancher Hinsicht schöner gehabt.
Aber das durfte man ja auch nicht sagen.
In Sachen Meinungsfreiheit hatte sich gar nicht so viel geändert. Es waren nur andere Dinge, die man sagen durfte oder eben nicht. Da sollte ihm keiner was anderes erzählen.
Es herrschte wenig Verkehr. Trotzdem blieb Erich Sassbeck an der Fußgängerampel stehen, wartete, dass sie grün wurde. Ein Taxi hielt; der Fahrer blickte ihn an, als erwarte er, in ihm einen Fahrgast zu finden.
Sassbeck schüttelte unwillkürlich den Kopf. Seine Rente reichte gerade so zum Leben. An Extravaganzen wie Taxifahrten durch die halbe Stadt war im Traum nicht zu denken.
Zum Glück war es nicht mehr weit bis zur U-Bahn-Station. Dort unten würde es wärmer sein.
»Aber hättest du es getan?«, hatte Evelyn insistiert. »Hättest du auf jemanden geschossen, der versucht zu fliehen?«
Er hatte geantwortet, dass er das nicht wusste. Dass man nicht wissen konnte, wie man in so einer Situation handeln würde, ehe es so weit war.
»Du redest dich raus«, hatte sie sich aufgeregt. »Du hast bloß Glück gehabt. Mit mehr Zivilcourage hättest du gesagt, ich mach das nicht, ich mach diesen Dienst nicht, weil ich nicht auf Leute schießen werde, die nichts Böses getan haben!«
Ihm wurde jetzt noch ganz heiß, wenn er an diesen Streit zurückdachte. Es stimmte; er war froh, nie in eine solche Lage gekommen zu sein. Er hatte ja mitgekriegt, wie es anderen ergangen war, nachdem sie auf Republikflüchtlinge geschossen hatten. Ein jüngerer Kollege, Rolf aus Karl-Marx-Stadt, hatte eine Frau getötet, die nach Westberlin fliehen wollte. Rolf hatte angefangen zu saufen, geradezu klassisch. Kurz darauf war er versetzt worden, und man hatte nie wieder etwas von ihm gehört.
Endlich, die U-Bahn. Erich Sassbeck seufzte, als er in den warmen Mief eintauchte, der die Treppe heraufkam. Die seltsamen Schmierereien, die auf den ersten Blick aussahen wie eine Inschrift, die man aber nicht lesen konnte, waren immer noch da. Die Stadt hatte es schon lange aufgegeben, der Sprayer Herr werden zu wollen, hatte kapituliert.
Das jedenfalls, dachte Sassbeck und spürte seine Knie wieder, während er die Stufen hinabstieg, hätte es früher nicht gegeben. Und sei es nur, weil niemand Farbe übrig gehabt hätte. Oder wenn, hätten die Leute etwas Besseres damit anzufangen gewusst.
Noch 12 Minuten, behauptete die Anzeigetafel. Komfortable Sache, das musste man zugeben. Sassbeck studierte trotzdem den Fahrplan im Schaukasten. Die vorletzte Bahn Richtung Stadtmitte. Hatte er sich also richtig erinnert. Beruhigend, dass er sich wenigstens auf seinen Kopf noch verlassen konnte.
Ein lautes Geräusch – ein dumpfer Schlag auf Metall – ließ ihn aufhorchen. Es kam vom Ende des Bahnsteigs, unterhalb der Treppe, die aus dem Mittelgeschoss herabführte. Sassbeck trat ein paar Schritte zur Seite, um zu sehen, was da los war.
Es waren zwei Jugendliche, von denen einer es aus irgendeinem Grund auf eine dort angebrachte Sitzbank abgesehen hatte. Jetzt wieder: Er ging rückwärts, um Anlauf zu nehmen, plusterte sich auf und sprang dann mit voller Wucht gegen die Plastikschalensitze. Diesmal knallte es nicht nur dumpf, man hörte auch etwas brechen.
Der andere Junge stand dabei und schien sich großartig zu amüsieren. Sassbeck verstand nicht, was er sagte, aber es klang, als feuere er seinen Kumpanen an.
Sassbeck wollte sich schon abwenden, als ihm Evelyn wieder einfiel und der Streit mit ihr.
Zivil wie in Zivilisation. Wie in Zivilist.
Courage – das französische Wort für Mut.
Zivilcourage. Der Mut des Bürgers.
Der andere Junge nahm jetzt ebenfalls Anlauf. Die beiden schienen entschlossen zu sein, die Sitzbank zu zertrümmern.
Noch 10 Minuten, stand auf der Anzeigetafel.
Erich Sassbeck gab sich einen Ruck, ging auf die Jugendlichen zu. »He«, rief er, als er nahe genug heran war. »Ihr da. Das tut man nicht.«
Die beiden hörten auf, schauten ihn an, grenzenlose Verwunderung im Blick. Offensichtlich war es lange her, dass ihnen jemand gesagt hatte, was sich gehörte.
»Diese Bank«, fuhr Sassbeck fort, »ist Gemeineigentum. Es ist nicht in Ordnung, das Eigentum aller zu beschädigen.«
Die Sachen, die sie trugen, sahen neu und teuer aus, aber sie passten ihnen nicht, und sie passten auch nicht zusammen. Als hätten sie viel Geld ausgegeben, um hässlich gekleidet zu sein.
»Ey«, sagte der eine, »bist du scheiße im Kopf oder was?« Es klang wie ein Akzent, aber zugleich so, als mache er diesen Akzent nur nach.
»Ich sage nur –«
»Willst du Streit, Mann?«
Sassbeck holte Luft. »Nein. Nein, ich suche keinen Streit. Ich möchte nur, dass ihr das lasst.«
Sie ließen es. Es war unübersehbar, dass die Bank sie nicht mehr interessierte.
Sie kamen auf ihn zu. Er war viel interessanter.
»Ey«, sagte der andere, »meins’ du, ich lass mir von alten Knackern was vorschreiben?«
Es klang unangenehm, wie er das sagte.
Es klang richtig gefährlich.
Erich Sassbeck sah sich um. Der Bahnsteig lag verlassen; außer ihm und den zwei Jugendlichen war niemand da. Und er war sechsundsiebzig – zu alt, um davonzurennen.
Sassbeck sah die beiden auf sich zukommen, wollte etwas sagen, etwas, das die Situation wieder entspannte, bis in
8 Minuten
die U-Bahn kam, aber er wusste nicht, was.
Das mit der Zivilcourage kam ihm auf einmal vor wie eine verdammt hinterhältige Falle.
Vielleicht würde er jetzt sterben. Das las man oft in der Zeitung, von Leuten, die in aller Öffentlichkeit zusammengeschlagen wurden und von denen es manche nicht überlebten.
Irmina Shahid sah auf die Uhr, während sie die Treppe zur U-Bahn hinabeilte. Doch, die Bahn würde sie noch kriegen. Gut. Es wäre auch zu peinlich gewesen, wenn sie ihre Freundin noch einmal herausklingeln und um Geld für ein Taxi nach Hause hätte bitten müssen.
Sonst nahm sie immer die Bahn eine halbe Stunde früher, nicht die letzte. Die hier würde nur bis zur Wendeschleife hinausfahren und dann noch einmal stadteinwärts ins Depot. Die Lumpensammler-Fahrt. Da hockten oft seltsame Gestalten in den Wagen, und man erlebte bisweilen unerfreuliche Dinge. Doch sie hatten sich seit Claires Operation nicht gesehen und einander viel zu erzählen gehabt.
Am unteren Ende der Treppe, in dem Gang, der vorne auf den Bahnsteig führte, hörte sie ungewöhnliche Geräusche. Sie blieb stehen, lauschte angespannt. Da schrie jemand. Zwei Leute, die Schreie ausstießen, deren Aggressivität einen erschaudern ließ. Dazu dumpfe Schläge, wieder und wieder.
Auch das noch. Eine Prügelei.
Irmina Shahid überlegte. Am liebsten hätte sie sich umgedreht und wäre wieder gegangen, letzte Bahn hin, letzte Bahn her. Sie zog es vor, derlei hässlichen Dingen aus dem Weg zu gehen.
Andererseits war das nicht richtig. Wenn alle so handelten, war es kein Wunder, dass solche Dinge immer öfter vorkamen.
Ihr Blick blieb wie von selbst auf einem uralten, schmierig aussehenden Notrufkasten hängen. Sie konnte die Polizei rufen. Ungern, weil sie aus Erfahrung wusste, was das für Unannehmlichkeiten nach sich zog, aber das war etwas, das sie tun konnte.
Jetzt hörte sie auch jemanden stöhnen.
Sie schlich an der Wand entlang, die von oben bis unten vollgeklebt war mit Konzertplakaten, Wohnungsgesuchen und Ankündigungen von Flohmärkten. Vorne angekommen, spähte sie behutsam um die Ecke.
Tatsächlich. Auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig traten zwei Jugendliche auf einen alten Mann ein, der am Boden lag, die Hände vor dem Kopf, und nur noch zuckte, wenn ihn die Stiefel trafen. Sie hörten nicht auf, schrien und traten, schrien und traten …
Irmina Shahid fuhr zurück, lehnte sich für einen Moment gegen die Wand. Ihr Herz schlug auf einmal wie wild. Gewiss, die Gleise lagen zwischen ihr und den beiden Schlägern, aber was hieß das schon?
Sie musste etwas tun. Sie griff in ihre Handtasche, kramte darin und zog ihr Handy heraus.
So also würde er sterben. Das war alles, was Erich Sassbeck denken konnte. Dass dies sein letztes Stündlein war, wie man so sagte.
Auch wenn er sich das freilich anders vorgestellt hatte.
Sie traten auf ihn ein, schrien ihn an, bespuckten ihn. Er schmeckte sein eigenes Blut, spürte seine Rippen unter ihren Tritten brechen. Sie waren außer sich, übten keinerlei Zurückhaltung. Dass er alt und gebrechlich war, schienen sie überhaupt nicht wahrzunehmen, geschweige denn, dass es sie gebremst hätte. Erich Sassbeck lag am Boden, sah ihre Fußtritte kommen und ihre wutverzerrten Gesichter und begriff nicht, wie so etwas möglich war. Sie tobten eine Wut an ihm aus, deren Ursache er unmöglich sein konnte, und sie taten es ohne jedes Mitgefühl und ohne einen Rest von Menschlichkeit. Er hatte aufgehört, um Hilfe zu schreien, und er winselte auch nicht mehr um Gnade. Er wartete nur noch darauf, dass es endlich vorbei war.
Doch da, genau in dem Moment, in dem er mit seinem Leben abgeschlossen hatte, geschah etwas. Etwas, mit dem Erich Sassbeck noch weniger gerechnet hätte als mit einem solchen Ende.
Er sah einen Engel.
Es war ein Wunder. Es war eine Erscheinung. Es konnte unmöglich wahr sein. Ein strahlend weißer Engel war lautlos hinter den beiden tobenden Jugendlichen erschienen, die ihn nicht bemerkten, sondern weiter schrien und zutraten, bloß dass ihre Tritte und Schreie auf einmal wie im Nebel zu verschwinden schienen.
Erich Sassbeck war zutiefst erschüttert von diesem Anblick. Er war im Geist des Marxismus-Leninismus erzogen worden, hatte Religion stets als Opium fürs Volk betrachtet und erwartet, mit dem Tod einfach zu verlöschen. Niemals hätte er geglaubt, am Ende seines Lebens ausgerechnet einem wahrhaftigen Engel zu begegnen.
Aber der Engel war da. Sassbeck sah ihn so deutlich vor sich wie die Pfeiler, die die Decke der U-Bahn-Station stützten, so deutlich wie die Anzeige, die gleichmütig verkündete: Noch 3 Minuten. Der Engel sah aus wie ein schlanker, schöner, ernster junger Mann. Sein Blick war kühl und, seltsamerweise, gnadenlos. Er trug ein weites, von innen heraus in strahlendem Weiß leuchtendes Gewand, und er hatte lange, weiße Haare, die ein Luftzug wehen ließ und die ebenfalls leuchteten wie illuminiert.
Erich Sassbeck spürte die Tritte seiner Peiniger kaum noch. Er hatte nur mehr Augen für die Erscheinung. War der Engel gekommen, um ihn abzuholen? Würde er sich nun zu ihm hinabbeugen, um seine Seele zu bergen und mitzunehmen in eine bessere Welt?
Der Engel tat nichts dergleichen. Stattdessen hob er die Arme, in jeder Hand eine Pistole, und schoss die beiden jugendlichen Angreifer in den Kopf.
2Ingo Praise ließ sich gegen die knirschende Lehne seines Schreibtischstuhls sinken und starrte den Text auf dem Monitor an wie einen Feind.
Er machte sich etwas vor, und er wusste es.
Heute Vormittag finden in den drei Sälen des Amtsgerichts drei Verhandlungen statt, hatte er geschrieben. In Saal 1 steht ein Kunstfälscher vor Gericht, der zwölf Jahre lang Gemälde von wenig bekannten Künstlern so überzeugend geschaffen hat, dass nicht einmal Experten den Schwindel durchschauten: Er wird zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. In Saal 2 wird gegen einen Importeur verhandelt, der mithilfe von Strohmännern fünf Millionen Euro Umsatzsteuer hinterzogen hat: Er wird zu vier Jahren und sechs Monaten Freiheitsentzug verurteilt, und für eine Steuerhinterziehung in dieser Höhe ist ein Aussetzen der Strafe auf Bewährung ausgeschlossen.
Ich aber sitze unter den Zuschauern im Saal 3. Es ist der letzte Verhandlungstag in einem Fall schwerer Körperverletzung, der sich vergangenen März zugetragen hat. Damals hat ein 19-Jähriger zusammen mit einem jüngeren Freund einen 38-jährigen Elektroinstallateur um einen Euro angebettelt, der ihnen noch für Zigaretten fehlte. Als der Mann sich weigerte, ihnen Geld zu geben, schlugen sie unvermittelt auf ihn ein. Im Lauf der Auseinandersetzung stürzte der Elektroinstallateur unglücklich gegen die Kante einer Schaufenstervitrine und erlitt dabei so schwere Schädelverletzungen, dass er heute geh- und sprechbehindert ist, vermutlich für immer. Seinen Beruf wird er nie wieder ausüben können.
Diese beiden Angeklagten erhalten dafür, dass sie das Leben eines Menschen zerstört haben, zwei Jahre Freiheitsstrafe.
Auf Bewährung.
Er hörte schon förmlich, wie Rado an dieser Stelle seufzen und sagen würde: »Ingo – begreif es doch endlich! Diese Art von Artikel passt nicht in die politische Großwetterlage.«
Im Grunde war es zwecklos, weiterzuschreiben. Er konnte es nur nicht lassen. Würde es nie können.
Ingo griff nach der Flasche, goss sich Wein nach, den billigen roten Fusel, den sein Budget hergab. Den hatte er nach Tagen wie diesem nötig.
Es hätte noch viel mehr über diesen Prozess zu schreiben gegeben. Über das Gerangel, ob die Öffentlichkeit vom Verfahren ausgeschlossen werden müsse, weil einer der beiden Täter zum Zeitpunkt der Tat erst 17 Jahre alt gewesen war. Darüber, wie die Ehefrau des Opfers nach der Urteilsverkündung zusammengebrochen war. Darüber, dass ein Zeuge ausgesagt hatte, die beiden hätten noch auf den Mann eingetreten, als dieser schon bewusstlos am Boden gelegen habe, und wie der Richter ihn mit dem Argument abgewürgt hatte, aus dem Gutachten des Sachverständigen gehe bereits hervor, dass es wesentlich der unbeabsichtigte Sturz des Mannes gegen die Vitrine gewesen sei, der zu dessen Behinderung geführt habe. Darüber, wie das Opfer das Gericht im Rollstuhl durch den Hinterausgang verlassen hatte, während die beiden Täter, zwei große, muskelbepackte Gestalten mit ausrasierten Nacken, vor dem Haupteingang von einer Schar Beifall klatschender Freunde erwartet worden waren.
Wie sie einander High Five gegeben hatten, ehe sie in das Auto gestiegen waren, das bereitstand, um sie abzuholen. Davon war Ingo sogar ein Foto geglückt.
Aber auch das konnte er vergessen. »Wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe«, pflegte Radoslav Törlich, Redakteur des Abendblatts und einer seiner wenigen verbliebenen Kontakte in die Medienwelt, gern salbungsvoll zu erklären. »Ein solches Bild abzudrucken würde nur ungute Stimmungen schüren. Dafür dürfen wir uns nicht hergeben.«
In Wirklichkeit war Rado so ungefähr der Letzte, der auf irgendwelche gesellschaftlichen Aufgaben Rücksicht nahm. Alles, was ihn interessierte, waren Quoten und Verkaufszahlen. Er fragte nicht nach dem Wahrheitsgehalt einer Nachricht, sondern nur nach ihrem Medienwert.
Und was das Thema anbelangte, dem Ingo mehr Zeit und Energie widmete als jedem anderen, vertrat Rado einen glasklaren Standpunkt: »Opfer interessieren niemanden. Opfer sind peinlich. Niemand will etwas über die Schicksale von Opfern lesen, weil er sich sonst sagen müsste, dass es ja auch ihn treffen könnte. Und das will niemand wissen.«
Das Dumme war, dass Ingo ihm da nicht einmal widersprechen konnte.
Er kippte das Glas hinab, hatte das Gefühl zu spüren, wie der Wein sich mit seinem Blut vermischte und es am Sieden hinderte. Verdammt noch mal!
Ein Blick auf die Uhr. Kurz vor Mitternacht. Außerdem wurde er in zwei Jahren dreißig, ohne dass sich so etwas wie eine Perspektive in seinem Leben aufgetan hätte.
Die Vorstellung, eines Tages einen ordentlichen Job zu haben, mit Anstellungsvertrag, Urlaubsanspruch und Krankengeld, hatte er längst aufgegeben. Wie viele fest angestellte Journalisten gab es überhaupt noch? Ingo las die Statistiken nicht mehr, wusste nur, dass es immer weniger wurden. Alle Redaktionen wurden ausgedünnt, immer mehr Seiten einfach mit umformulierten dpa-Meldungen gefüllt. Der Journalismus starb aus, zumindest die Art, die er machen wollte. Die Art Journalismus, die Missstände aufdeckte. Die Art, der es um die Wahrheit ging, nicht darum, was »die Leute« angeblich lesen wollten, was »angesagt« war oder welche Sau die Konkurrenz gerade durchs Dorf trieb.
Ingo griff nach der Tastatur, drückte die Tastenkombination, die seine Ideen-Sammel-Datei aufrief, und tippte: Ich bin ein Journalismosaurus. Konnte man vielleicht mal brauchen. Auf alle Fälle fühlte er sich im Moment wie einer.
Draußen war ein Martinshorn zu hören. Ingo sah zum Fenster. Blaulicht zuckte über die Fassaden der gegenüberliegenden Straßenseite. Bestimmt die Polizei. Er musste wieder an den Tag heute im Amtsgericht denken und wie frustriert die als Zeugen geladenen Polizisten gewirkt hatten.
Dann horchte er auf. Das Martinshorn war nicht, wie sonst, allmählich in der Ferne entschwunden, sondern ausgeschaltet worden. Und das Blaulicht zuckte noch immer.
Ingo ging zum Fenster, öffnete es und schaute hinab. Tatsächlich: ein Streifenwagen, der vor den Treppenabgängen zur U-Bahn-Station angehalten hatte. In der Ferne hörte er ein weiteres Martinshorn, aus Richtung des Ringhospitals. Was vermutlich hieß, dass es sich um einen Krankenwagen handelte.
Er fröstelte. Hier oben im fünften Stock blies ein scharfer Wind. Allmählich wurde es amtlich mit dem Herbst. Wieder einmal war ein Sommer verstrichen, ohne dass er Zeit gefunden hatte, ins Freibad zu gehen. Und in eine Straßenwirtschaft hatte er es auch kein einziges Mal geschafft.
Tatsächlich, ein Krankenwagen. Zwei Sanitäter in orangeroten Jacken holten eine Trage heraus, eilten damit die Treppe hinab.
Ein Unfall also. Ingo überlegte, ob er Rekorder und Kamera schnappen und hinuntergehen sollte. Wenn er schon mal einen Fall frei Haus geliefert bekam. Dann fiel ihm wieder ein, dass ihm Kollegen immer rieten, nicht so besessen zu sein. Was je nach Sachlage hieß, so zu schreiben, dass es den großen Anzeigenkunden gefiel, oder die Kunst zu verfeinern, Pressemitteilungen so umzuformulieren, dass sie sich wie richtige Artikel lasen, aber nur zehn Prozent der sonst dafür nötigen Arbeit machten.
Also: nein. Wenn er mit einem Fünfzeiler über einen Unfall in der U-Bahn ankam, würde er nur seinen eigenen Marktwert senken.
Obendrein war ihm zu kalt. Hing vielleicht mit dem Rotwein zusammen. Er schloss das Fenster wieder und leerte den Rest der Flasche in sein Glas. Während der Computer herunterfuhr, schaltete er die Stereoanlage ein. Er hatte ein paar neue Alben heruntergeladen, die es zum Aktionspreis gegeben hatte, aber nach kurzem Überlegen entschied er sich für eine alte CD von U2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For – das war jetzt genau das, was er brauchte.
Die Nachtschicht war ihr vorgekommen wie die ideale Gelegenheit, erst recht, wenn das Krankenhaus, wie heute, Notaufnahme hatte. Da gab es immer so viel zu tun, dass niemand mitkriegen würde, was sie tat. Leichtes Spiel also.
Zumindest hatte Theresa Diewers sich das so überlegt.
Und dann das.
Zuerst war es ein ganz normaler Notfall gewesen. So einer, bei dem diensthabende Ärzte rennen, Türen krachen, aufgeregte Stimmen durch die Flure hallen. Not-OP, hatte Theresa nur gedacht und sich weiter ihren Patienten gewidmet. Die Station war gut gefüllt, viele der Frischoperierten unruhig, sodass auch nach Mitternacht keine wirkliche Ruhe einkehrte.
Doch dann stand plötzlich dieser Polizist vor ihr und fragte nach einem Getränkeautomaten. Ein breitschultriger Mann, Mitte dreißig, mit Grübchen auf den Wangen, in Uniform und Lederjacke. Sie erklärte ihm den Weg. Als er endlich ging und sie seine Schritte über den lackierten Boden davonquietschen hörte, musste sie sich setzen, weil ihr am ganzen Körper der Schweiß ausgebrochen war.
Sie sagte sich etwa hundertmal, dass die Polizisten aufgrund des Notfalls da waren. Sie bewachten jemanden. So etwas kam vor. Nicht oft, aber sie hatte es schon erlebt. Die waren nicht wegen der kleinen weißen Pappschachtel in Theresas Rucksack hier, garantiert nicht. Davon ahnten die nicht einmal was.
Trotzdem schwitzte sie.
Dass das aber auch ausgerechnet heute passieren musste!
Es war eine so günstige Gelegenheit gewesen; eine, die sie sich unmöglich hatte entgehen lassen dürfen. Biene und Nessi hatten in der Spätschicht angefangen, den Arzneischrank auszumisten. Natürlich nicht, weil sie nichts Besseres zu tun gehabt hätten, sondern weil die Apothekerin die Station zum dritten Mal angemahnt hatte und diesmal in einem Ton, der klarmachte, dass keine Ausreden mehr akzeptiert wurden. Und natürlich waren Biene und Nessi nicht fertig geworden. Deswegen stand die Kiste mit den abgelaufenen Medikamenten zur Rückgabe an die Krankenhausapotheke immer noch im Stationszimmer.
Es war die einfachste Sache der Welt gewesen. In einem unbeobachteten Moment hatte Theresa den Betäubungsmittelschrank aufgeschlossen, eine Schachtel Morphiumtabletten herausgenommen, als abgelaufen in die Liste eingetragen und, anstatt sie in die Metallkiste mit dem Apothekenzeichen auf dem Deckel zu stecken, in ihrem Rucksack verschwinden lassen.
Es war ja für einen guten Zweck, sagte sie sich. Und es würde niemandem auffallen. Die Apotheke war genauso unterbesetzt wie die Stationen. Die würden das Zeug einfach in den Sondermüll kippen, die Liste abheften und nicht weiter drüber nachdenken. Selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass jemand kam, um nachzufragen, brauchte sie nur stur zu behaupten, nicht zu wissen, wie die Packung verschwunden sei. Bis die Arzneikiste zurück in der Apotheke war, würden Dutzende von Leuten darauf Zugriff gehabt haben, und bestimmt würde sie nicht die ganze Zeit abgeschlossen sein. Es gab hundert Möglichkeiten, wie so etwas passieren konnte, und keine, die nicht schon irgendwann mal passiert war.
So hatte sich Theresa das zurechtgelegt gehabt. So hatte sie es gemacht. Und nun war sie froh, dass gleich zwei Lampen auf einmal aufleuchteten und sie keine Zeit mehr hatte, sich Sorgen zu machen.
Später kam Dagmar von Chirurgie II herüber, der Nachbarstation. »Hat dich Doktor Schneider erreicht?«
»Nein, wieso?«
»Er braucht ein Einzelzimmer für einen Notfall. Ihr habt eins gemeldet.« Sie ächzte. »Wir sind mal wieder total voll, sogar im Bad liegt einer. Ich dreh bald durch.«
»Ich war auf Glocke«, sagte Theresa, während sie so tat, als studiere sie den Belegungsplan. »Was ist denn passiert?«
»Ein alter Mann, den sie in der U-Bahn-Station Dominikstraße zusammengeschlagen haben«, sprudelte Dagmar heraus. »Rippenfrakturen und mehr Hämatome als heile Haut, hat Doktor Schneider gesagt. Aber wohl nichts Lebensbedrohliches, jedenfalls soll er heute Nacht noch auf Station verlegt werden.«
Sie hatten zwei Einzelzimmer, und eins davon war tatsächlich frei; Theresa hatte es zu Beginn der Nachtschicht selber gemeldet.
Ein bisschen voreilig.
»Die Elf ist nicht mehr belegt«, gestand sie. »Bloß sieht es da drin aus wie Schwein. Der Patient ist erst gestern Nachmittag gestorben; seine ganzen Sachen sind noch da, Verbandsmaterial liegt rum, das Bett ist nicht frisch …«
»Ich helf dir aufräumen«, bot Dagmar an.
»Nein, du hast ja auch deine Patienten«, wehrte Theresa ab. »Ich krieg das schon irgendwie hin.«
»Auch gut«, erwiderte Dagmar.
Es verletzte Theresa ein bisschen, dass Dagmar ihr Angebot derart schnell annahm. Als sei es eine Selbstverständlichkeit. Dagmar, sagte sie sich, hatte noch nicht begriffen, dass es im Beruf der Krankenschwester vor allem darauf ankam, zu geben. Und sich selber und die eigenen kleinen Wünsche zurückzustellen.
Sie zögerte. »Da hält dann ein Polizist Wache, oder?«
»Ich denk schon. Der, der jetzt vor Intensiv sitzt.«
Später, als Theresa das Zimmer hergerichtet hatte, erschöpft im Stationszimmer saß und nur noch auf den Patienten warten musste, erwog sie, die Schachtel wieder zurück in den Schrank zu tun. Vielleicht war das Risiko doch zu groß.
Andererseits stand die Packung bereits als »abgelaufen und entsorgt« in der Liste. Den Eintrag konnte sie nicht streichen, ohne dass jemand Fragen stellen würde.
Außerdem brauchte sie die Tabletten.
Ach, es würde sie schon niemand durchsuchen. Die waren wegen des alten Mannes hier, Punkt. Sie würde ihren Dienst zu Ende machen und nach der Übergabe einfach gehen wie immer. Und so tun, als sei nichts.
Ulrich Blier parkte am äußersten Ende des vor der Zufahrt zur Kaserne gelegenen Parkplatzes, schaltete den Motor und die Scheinwerfer ab und blieb noch einen Moment hinter dem Steuer sitzen. Er war müde, nein, richtiggehend erschöpft.
Es war Wahnsinn, was er trieb. Völliger Wahnsinn.
Aber es half nichts, sich das zu sagen. Er konnte einfach nicht anders.
Er gab sich einen Ruck, stieß die Tür auf, stieg aus. Holte seinen langen, schwarzen Mantel vom Beifahrersitz, schlüpfte hinein. Drückte die Tür wieder zu, so leise wie möglich, wartete. Merkte, dass er den Atem anhielt.
Bewegung in der Dunkelheit hinter dem Maschendrahtzaun. Endlich.
»Ulrich!« Theos Stimme. Sie klang erleichtert. »Ich dachte schon …«
»Sorry, ist ein bisschen später geworden.« Ulrich Blier dachte daran, warum es später geworden war. »Hat jemand was gemerkt?«
»Natürlich nicht«, erwiderte Theo. »Was denkst du, was sonst los wäre?« Schlüsselklappern, dann öffnete sich die schmale Tür im Zaun.
Blier holte die Schachtel aus der Manteltasche, eingewickelt in Geschenkpapier, und reichte sie ihm. »Hier. Kleines Mitbringsel. Außerdem hast du jetzt was gut bei mir.«
Theo machte große Augen. »Ist das etwa –?«
»Na klar«, sagte Ulrich Blier.
Er spürte seine Müdigkeit wie eine schwere Last im ganzen Körper. Der Tag morgen würde eine Qual werden.
Aber das war die Sache wert gewesen.
Alles war weiß, und ein Frauengesicht schwebte über ihm, das ihn im ersten Moment an seine Hertha erinnerte. Aber es war nicht Hertha, es war eine Ärztin.
»Herr Sassbeck?«, sagte sie. »Verstehen Sie mich?«
Schade, dass es nicht Hertha war. Hertha hatte daran geglaubt, in den Himmel zu kommen. Sie hatte es für sich behalten, um ihm keine Schwierigkeiten zu machen, aber er wusste, dass sie daran geglaubt hatte.
»Herr Sassbeck?«
Ach so. Richtig. Die Frau wartete auf eine Antwort. Er bewegte seinen Unterkiefer, der sich seltsam taub anfühlte, und brachte etwas heraus, das wie »Ja. Ich verstehe Sie« klang.
»Wir verlegen Sie jetzt auf Station«, sagte die Frau übertrieben deutlich artikuliert. »Sie sind nur leicht verletzt, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wir behalten Sie zur Beobachtung da, aber wahrscheinlich können Sie schon übermorgen nach Hause. Was sagen Sie dazu?«
Der Unterkiefer fühlte sich wirklich seltsam an.
»Gut«, sagte Erich Sassbeck.
Dann schlief er ein und bekam überhaupt nichts mit, bis er wieder aufwachte und in einem Zimmer lag und es heller Tag war.
Ein junger Mann in einem dunkelblauen Parka stand am Fußende seines Bettes, sah ihn an und meinte: »Na, das trifft sich ja gut. Guten Morgen, Herr Sassbeck. Ich bin Kriminalhauptkommissar Justus Ambick. Wie geht es Ihnen?«
Sassbeck musste den Mund ein paar Mal auf und zu machen, ehe sich genügend Speichel angesammelt hatte, dass er antworten konnte. »Die haben mich angegriffen.«
Der Kommissar nickte. Erstaunlich jung für einen Kommissar.
»Ich hab denen nur gesagt …« Er hielt inne. Wie war das gewesen? Ach so, ja. »Die Bank. Die wollten die Sitzbank kaputt machen.«
»Verstehe.«
»Ich habe nur gesagt …« Hätte er es nur gelassen. Zivilcourage. Verdammt, alles nur wegen eines Wortes! »Gemeineigentum. Ich habe denen gesagt, dass sich das nicht gehört.«
Der Kommissar sah ihn an. Hatte freundliche braune Augen. Wirkte überhaupt sympathisch.
»Und dann?«, wollte er wissen.
Oh je. Sassbeck dachte ungern daran zurück. »Dann sind sie auf mich los. Einfach so.«
Er dachte wirklich sehr ungern daran zurück. Natürlich, es musste sein. Natürlich. Aber er konnte es nicht, ohne sich zu fragen, was er ihnen denn getan hatte? Er hatte ihnen nichts getan. Sie hatten ihn zusammengeschlagen, einfach so. Das tat man doch nicht. Doch nicht einen alten Mann. Wo hatte es das früher gegeben, dass zwei junge Männer einen Greis verprügelten? Das hatte es nicht gegeben. Als er so jung gewesen war, da hatte man sich mal geprügelt, aber nicht zwei gegen einen. Und erst recht nicht gegen einen alten Mann. Da war irgendwas kaputt in der Welt, dass heute so etwas passieren konnte.
Und sie hätten ihn totgeschlagen, wenn nicht …
Er dachte wirklich sehr ungern daran zurück. Doch der junge Kommissar fragte noch einmal: »Und dann?«
Also erzählte er ihm, was dann passiert war. Es fiel ihm nicht leicht, die passenden Worte zu finden, aber im Großen und Ganzen brachte er es am Ende so zusammen, wie es gewesen war. Es dauerte halt eine Weile. Und es strengte ihn an zu sprechen. Der Unterkiefer. Taub, irgendwie.
»Ein Engel«, wiederholte der junge Kommissar. Man merkte, dass er mit so etwas nicht gerechnet hatte.
»Na ja«, meinte Erich Sassbeck und hätte gerne gehustet. »Zumindest sah er so aus. Vielleicht war es nur das Licht.«
Der Kommissar furchte die Stirn. »So richtig mit Flügeln und so?«
Mit Flügeln? Daran erinnerte er sich nicht. »Ich weiß nicht. Ich glaube nicht.«
»Verstehe.« Der junge Kommissar zog einen Stuhl heran, setzte sich bedächtig. »Herr Sassbeck – ich bin gekommen, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Falls Sie sich schon fit genug dafür fühlen.«
»Ja, ja«, beeilte Sassbeck sich zu sagen. »Gern.« Das musste ja raus. Das musste geklärt werden. Es musste alles seine Richtigkeit haben.
»Danke.« Der Kommissar holte einen Notizblock hervor, blätterte darin, aber ein bisschen wirkte es, als wisse er längst, was er fragen wollte, und sammle nur seine Gedanken.
»Als wir Ihre Personalien ermittelt haben«, begann er endlich, »haben wir festgestellt, dass Sie vor Ihrer Pensionierung den Grenztruppen der DDR angehört haben. Ist das richtig?«
Sassbeck musste lachen, doch das geriet ihm nur zu einem schmerzhaften Husten. »Pensionierung!«, stieß er hervor. Guter Witz. Er spürte ein Stechen im Brustkorb. Bestimmt von den Tritten. »Die haben mich halt rausgeschmissen nach der Wende.«
»Aber Sie waren Grenzsoldat?«
»Ja. Zuletzt Grenzkreiskommando Wernigerode.«
Der Kommissar nickte, als wisse er das schon. »In Ihrem Dienst – besaßen Sie da eine persönliche Schusswaffe?«
»Eine Pistole.«
»Darf ich fragen, von welchem Typ?«
»Eine Makarow PM.«
»Besitzen Sie die noch?«
Erich Sassbeck runzelte die Stirn, spürte die Pflaster, die dort klebten. »Nein. Die habe ich bei Dienstende abgegeben. Das war Vorschrift.«
»Sie haben auch keine andere Waffe behalten?« Der Kommissar machte eine vage Handbewegung. »Ich meine, Vorschriften sind dehnbar, und in einer Umbruchszeit wie damals …«
»Nein. Ich habe meine Pistole abgegeben.« Sassbeck schluckte mühsam. »Wieso fragen Sie mich das alles?«
»Weil die beiden Jungen mit einer Makarow erschossen wurden«, erklärte der Kommissar. Er hob die Schultern. »Diese Waffe hat anscheinend ein unverkennbares Kaliber, 9,2 mal 18 Millimeter. Unser Ballistiker hat nur einen Blick auf die Kugeln geworfen und Bescheid gewusst.«
Erich Sassbeck verwünschte den Umstand, so hilflos ans Bett gefesselt zu sein. Er hätte sich zu gerne aufgesetzt, hätte zu gerne …
»Ich hab Ihnen doch gesagt«, stieß er hervor. »Das war der –«
»Der Engel. Ja. Das habe ich schon verstanden«, unterbrach ihn der Kommissar. Er schwieg einen Moment, kratzte sich mit einem Finger an der rechten Augenbraue und sagte dann: »Es ist so, Herr Sassbeck, dass ich mit der Geschichte, die Sie mir erzählt haben, ein Problem habe.«
»Was für ein Problem?«
»In der U-Bahn-Station Dominikstraße werden die Zugänge und ein Teil der Bahnsteige videoüberwacht.« Er räusperte sich. »Auf diesen Videos ist niemand zu sehen, auf den Ihre Beschreibung auch nur annähernd zutrifft. Da war kein Engel.«
Erich Sassbeck sah ihn fassungslos an.
»Aber wer hat dann geschossen?«
Der Kommissar nickte langsam. »Genau das fragen wir uns.«
3Ingo erwachte mit schwerem Kopf und verspanntem Rücken. Er blinzelte in das Sonnenlicht, das ihm durch das Fenster direkt ins Gesicht fiel, und begriff, dass er mal wieder auf dem Sofa eingeschlafen war.
Das wurde allmählich zur schlechten Gewohnheit.
Er stemmte sich hoch, drehte den Kopf hin und her, bis das Knirschen im Nacken nachließ. Dann brachte er die leeren Flaschen und Gläser in die Küche und ging duschen. Heiß und kalt, und besonders das kalte Wasser half.
Er blieb erst mal im Bademantel, befüllte seine alte Zwei-Tassen-Kaffeemaschine und schaltete sie ein. Wie so oft, während sie zischend und röchelnd in Gang kam, starrte Ingo die alte Weltkarte an, die an der Wand darüber hing. Er hatte sie damals nur mit Stecknadeln befestigt, vorläufig, bis er einen besseren Platz dafür fand, aber sie hing immer noch da, war im Lauf der Jahre vergilbt und speckig geworden.
Nach seinem Abschluss an der Journalistenschule hätte Ingo einen Job in Paris haben können, bei der dortigen Niederlassung einer Nachrichtenagentur. Einen Job, der nicht nur in vielerlei Hinsicht interessant gewesen wäre, sondern der ihn wahrscheinlich auch in die Laufbahn eines Auslandsjournalisten katapultiert hätte, wie es immer sein Traum gewesen war.
Doch damals war er gerade mit Melanie zusammengezogen und hochgradig verliebt gewesen. Als er ihr von dem Angebot erzählte, hatte sie nur mit diesem unnachahmlichen Melanie-Ton in der Stimme gesagt: »Das ist aber nicht dein Ernst?«, und damit war die Sache gestorben. Blutenden Herzens hatte Ingo den Tipp an einen Kommilitonen weitergegeben, Norbert Fiehr, der den Job an seiner Stelle angenommen hatte. Der nachher tatsächlich Auslandskorrespondent geworden war. Ingo hatte den Kontakt mit ihm aufrechterhalten, hatte die Stationen von Norberts Karriere akribisch auf der Weltkarte festgehalten, die nun an seiner Küchenwand hing. Rote Punkte für jeden Ort, an dem Norbert gewesen war.
Und ein schwarzes Kreuz in Somalia, wo er vor zwei Jahren in einer Schießerei ums Leben gekommen war. Mit gerade mal siebenundzwanzig.
Ingo wusste immer noch nicht, was er von dieser Geschichte halten sollte. Wenn er zu lange darüber nachdachte, verknotete sich irgendetwas in seinen Eingeweiden.
Das Brot war schon Tage alt und begann trocken zu werden; höchste Zeit, dass er es aufaß. Er schmierte sich zwei Marmeladenbrote, nahm den Teller und die erste Tasse Kaffee mit an den Schreibtisch und klappte seinen Rechner auf. Er las sich mampfend durch, was er am Vortag geschrieben hatte, und überlegte beim Kaffee, was sich daraus machen ließ, ohne sich zu sehr zu verbiegen. Dass seine Wut über Nacht verraucht war und die Resignation wieder eingesetzt hatte, die sein Leben überwucherte wie unsichtbarer Schimmelpilz, machte es zumindest technisch einfacher.
Er holte sich die zweite Tasse und ging an die Arbeit. Am Laptop klemmte mal wieder eine Taste, das R diesmal. Eigentlich brauchte er längst ein neues Gerät, aber das war im Moment indiskutabel. Kurz vor elf Uhr hatte er trotz allem einen Artikel der gewünschten Zeilenzahl, der nichts Unwahres sagte und an dem trotzdem niemand Anstoß nehmen konnte, kurz, der dazu beitragen würde, seine Miete zu bezahlen. Er las ihn ein letztes Mal durch und mailte ihn dann an die Redaktion.
Anschließend checkte er sein Blog, wo er sich manchmal Dinge von der Seele schrieb. Aber seine Seele interessierte niemanden; die Zugriffszahlen waren nach wie vor enttäuschend gering, und kommentiert hatte auch wieder keiner.
Das Telefon klingelte. Bestimmt Rado, dachte Ingo, ehe er abnahm, und natürlich war er es. »Bist du wach?«, rief der Redakteur, der an der Strippe immer klang, als sei er auf Speed.
»Hast du meinen Artikel nicht gekriegt?«, fragte Ingo zurück.
»Deswegen ruf ich an. Den muss ich erst mal auf Eis legen.«
Ingo spürte eine Ader in seinem Ohr so laut pochen, dass er sie hören konnte. Es war immer dasselbe: Erst wurde ein Artikel auf Eis gelegt, weil andere Themen wichtiger oder dringlicher waren oder beides, später hieß es dann mit Bedauern, er sei nicht mehr aktuell. Weswegen er nur das Ausfallhonorar bekam. Und das auch nur, wenn er Glück hatte.
»Und wieso?«
»Du hast die neueste Schlagzeile deiner Lieblingszeitung also noch nicht gesehen.«
»Hätte ich sollen?« Ingos Finger waren schon in Bewegung, riefen den Browser und die Website des Abendblatts auf.
»Ein Fall von Selbstjustiz, letzte Nacht«, erklärte Rado genüsslich. »So richtig Charles-Bronson-mäßig. Und wir waren die Ersten, die es gebracht haben. Nicht zuletzt dank meiner Genialität, wie üblich. Heute Abend dürfte die gedruckte Ausgabe weggehen wie geschnitten Brot.«
Jetzt sah Ingo, was Rado meinte. Der Aufmacher belegte den halben Bildschirm: SAH DIESER RENTNER ROT?, schrie die erste Zeile neben dem Foto eines älteren Mannes, und die zweite: 2 JUGENDLICHE ERSCHOSSEN.
»Sobald ich dazu komme, werde ich vor Bewunderung auf die Knie sinken«, erwiderte Ingo grimmig. »Falls du deswegen angerufen hast.«
»Quatsch. Ich ruf an, weil ich will, dass du das Amtsgericht und all den anderen Tüddelkram vergisst und dich vorrangig um diese Sache kümmerst.«
»Was gibt’s da noch zu kümmern?«
»Details. Neue Aspekte. Mein Job ist die große Linie, die Strategie. Und ab und zu ein Geniestreich, um mein exorbitantes Gehalt zu rechtfertigen.«
Ingo verdrehte die Augen. »Okay. Und wieso ich?«
»Na, zum Beispiel, weil es bei dir in der Nähe passiert ist. U-Bahn-Haltestelle Dominikstraße. Da wohnst du doch, oder?«
Ingo fiel das Blaulicht wieder ein, der Streifenwagen, der Krankenwagen. Mist! »Kann ich von meinem Fenster aus sehen.«
»Also. Ich denke, das müsste eine Story nach deinem Geschmack sein, oder?«
Da war sich Ingo noch nicht so sicher. Er starrte auf den Monitor, auf die Fotos der beiden Jugendlichen und des Rentners. Letzteres sah aus wie aus einem Pass kopiert. »Was ist überhaupt passiert?«
»Also – heute in aller Frühe kommt ein Polizeibericht per Mail an alle Medien. Ein gewisser Erich S., sechsundsiebzig, ist bewusstlos und mit Verletzungen, die möglicherweise von einer Schlägerei herrühren, auf dem U-Bahnsteig aufgefunden worden, zwischen zwei erschossenen Jugendlichen, beide neunzehn. Tathergang unklar, keine Zeugen, und die Videokameras haben in die falsche Richtung geguckt.«
»Wow«, sagte Ingo, die Schlagzeile vor sich. »Daraus so eine Meldung zu dichten ist aber verdammt riskant, wenn du mich fragst.«
»Warte, ich bin noch nicht fertig. Schlau, wie ich bin, hab ich mir nämlich die Mühe gemacht, auf die Internetseite der Polizei zu gehen. Dort stand dasselbe, aber unmittelbar davor ein Aufruf, dass nach einer Makarow-Pistole gefahndet wird, die eventuell in der Dominikstraße oder Umgebung weggeworfen wurde.«
Ingo hob die Augenbrauen. »Die Tatwaffe.«
»Bingo. Jetzt musst du wissen, dieser Pistolentyp – Makarow PM – war die Standard-Handfeuerwaffe der Streitkräfte der Ostblockstaaten. Die hat ein ungewöhnliches Kaliber; ein Fachmann erkennt das wohl auf den ersten Blick. Oha, denkt der Sohn meiner Mutter, angenommen, dieser Erich S. ist ein ehemaliger DDR-Grenzer, der noch so ein Ding zu Hause rumliegen hatte? Google verrät mir, dass es eine Ehemaligenorganisation gibt. Die haben eine Website und ein Verzeichnis. In dem finde ich mehrere Dutzend Namen, die man mit Erich S. abkürzen könnte, aber ich mach mir die Mühe, ein bisschen über Telefonbuch und Stadtplan zu brüten, und was finde ich schon beim zweiten Namen? Eine Evelyn Sassbeck, wohnhaft Brunnerstraße.«
Ingo stutzte. »Das ist auch hier in der Nähe.«
»Merkst du was?« Rado war in seinem Element. »Ich nicht faul, rufe bei der an und tue so von wegen, ich hätte das gehört mit Erich, und sie heult gleich los – da war klar: Treffer, versenkt. Der Mann war nach einem Besuch bei Schwiegertochter und Enkel auf dem Heimweg. Liegt jetzt im Ringkrankenhaus und wird abgeschirmt. Aber er hat sie frühmorgens angerufen und gesagt, er bräuchte einen Anwalt.«
»Einen Anwalt? Wozu das denn?«
»Na, was denkst du, wie sich die Polizei die Sache erklärt?«
»Dass er geschossen hat?« Das war ja noch unglaublicher als Rados infame Methoden. Über die nachzudenken Ingo sich abzutrainieren versuchte.
»Hundert Punkte. Der Mann hat ein Einzelzimmer und einen Polizisten vor der Tür. Ich hab Kleemann hingeschickt, aber der hat nichts erreicht. Kein Herankommen, meint er. Zutritt nur für medizinisches Personal, Anwalt und Familienangehörige.« Rado seufzte. »Na ja, du kennst ja Kleemann. Keine Fantasie, der Mann.« In verschwörerischem Ton fuhr er fort: »Deine Chance, es besser zu machen.«
Oha. »Ist das ein Auftrag?«, fragte Ingo.
»Doppelter Satz, wenn ich für die Printausgabe morgen Abend einen Artikel habe, in dem mehr steht als das, was alle anderen schreiben«, antwortete Radoslav. »Die konzentrieren sich auf die toten Jugendlichen, rennen den Angehörigen die Bude ein. Aber das interessiert mich nicht. Mich interessiert der Alte. Ich träume von einem Exklusivinterview, am besten eins mit dem Tenor: Seit 23 Uhr 30 wird zurückgeschossen.« Er lachte lauthals.
»Du bist wirklich völlig moralfrei«, stellte Ingo fest.
»Das Geheimnis meines Erfolges«, erwiderte Rado unbeeindruckt. »Also, du weißt Bescheid. Ich zähl auf dich.«
»Und mein Artikel über die Verhandlung gestern?«, fragte Ingo schnell, ehe Rado auflegen konnte.
»Ähm, ach so …?« Rados Stimme bekam diesen angeekelten Klang, wie immer, wenn ihm etwas lästig war. »Ist mir zu zahm, ehrlich gesagt. Ist mal wieder so ein Artikel, der mich denken lässt, du solltest statt zu schreiben besser was anderes –«
»Vergiss es«, sagte Ingo entschieden. »Kein Fernsehen.« Während seines Studiums an der Journalistenschule hatte Ingo eine nachmittägliche Spieleshow für Kinder moderiert, ein dämliches Format, das aber aus ihm unerfindlichen Gründen ziemlich populär gewesen war. Ingo war dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde – genau genommen hatte er auf der Suche nach einem Volontariat nur die falsche Tür aufgemacht –, und er hatte es gemacht, um die happigen Studiengebühren zahlen zu können. Seither verfolgte ihn das.
»Wir brauchen einen neuen Moderator für unsere ›Anwalt‹-Reihe«, nervte Rado unverdrossen weiter. »Thorsten Kunze will nämlich aufhören.«
»Kann ich gut verstehen«, erwiderte Ingo. »Die Reihe ist ja nur peinlich.«
»Ich dachte mal wieder an einen Titelwechsel. ›Anwalt der Jugend‹, wie klingt das?«
»Genauso bescheuert wie ›Anwalt der Bürger‹.«
»Hey, ich versuch nur, dir zu helfen.«
»Vergiss es. Fernsehen ist Schrott. Ich mach das nicht noch einmal. Wenn du mir helfen willst, dann druck meine Artikel.«
Rado seufzte abgrundtief. »Na schön. Ich schau mal, wo ich den hier verbuddle. Du kriegst dein Geld, keine Sorge. Kümmer dich um Sassbeck, und alles wird gut.« Zack, aufgelegt.
Ingo legte auch auf. Du kriegst dein Geld, keine Sorge. Das sagte Rado in solchen Fällen immer, aber meistens versandete die Sache dann doch irgendwie.
Er sah aus dem Fenster. Unten vor dem Abgang zur U-Bahn stand ein weißer Lieferwagen, völlig neutral, und ein Teil der Treppe war mit Absperrband gesichert, das schwarz-gelb im Wind flatterte. Die Spurensicherung war also noch zugange.
Er kehrte an seinen Computer zurück, las die Meldung hinter der Schlagzeile und dann rasch, was die anderen Zeitungen schrieben. Die hatten sich alle auf dieselbe Linie eingeschossen: Der Rentner Erich S., hieß es, sei belästigt, angepöbelt oder tätlich angegriffen worden. Ingo merkte förmlich, wie sein Blutdruck mit jedem der Artikel stieg. Wie konnte jemand, der sich Journalist nannte, in einem Satz das Wort belästigt verwenden und im nächsten ungerührt schreiben, dass man den Mann ins Krankenhaus hatte bringen müssen?
Immerhin: Rado hatte wenigstens von einem gewalttätigen Übergriff der Jugendlichen auf den alten Mann geschrieben.
Ansonsten kam Erich S. nicht gut weg. Einer von denen halt, die damals an der innerdeutschen Grenze nur darauf gelauert hatten, Republikflüchtlinge abzuknallen. Der nun auch noch Rente vom deutschen Staat kriegte.
Der größte Teil der Artikel war tatsächlich den zwei toten Jugendlichen gewidmet, die als Philipp F. und Dardan A. bezeichnet wurden. Beide hatten viele Geschwister gehabt, die nun von den guten Seiten ihrer dahingeschiedenen Brüder erzählten: dass sie Fußballfans gewesen seien, gern Musik gehört und darauf gehofft hätten, endlich eine Lehrstelle zu finden. Die reinsten Engel. Nur das Abendblatt erwähnte, dass der aus Albanien stammende Dardan A. schon einmal wegen Körperverletzung zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden war und dass gegen Philipp F. mehrfach Schulverbote verhängt worden waren, weil er Mitschüler attackiert hatte. Das hatte auch so im Polizeibericht gestanden, wie Ingo durch einen raschen Vergleich mit der Website der Polizei feststellte. Aber so, wie es Rado geschrieben hatte, klang es fast niedlich, so nach Wir haben alle unsere kleinen Fehler.
Genug, sagte er sich. Zeit, Hektik zu entfalten. Ingo rief das Telefonbuch auf, suchte und fand die Nummer von Evelyn Sassbeck, Brunnerstraße 50, griff nach dem Telefon und wählte.
Es klingelte lange, dann meldete sich eine dunkle Frauenstimme. »Sassbeck?«
»Guten Tag«, sagte Ingo rasch und in seinem verbindlichsten Tonfall, »mein Name ist Ingo Praise, ich bin Journalist und rufe –«
»Ihr seid alles Schweine!«, fauchte die Frau und knallte den Hörer auf.
Na super. Ingo legte das Telefon beiseite, lehnte sich zurück und rieb sich mit den Händen übers Gesicht. Das war unüberlegt gewesen. Klar, dass sie nach der Nummer, die Rado bei ihr durchgezogen hatte, nicht mehr gut auf Journalisten zu sprechen war.
Was im Umkehrschluss hieß, dass sie schon mitgekriegt haben musste, was die Onlineausgaben der Zeitungen schrieben. Ingo kehrte zurück zu den Meldungen, versuchte einen Hinweis zu finden, seit wann diese draußen waren. Allzu lange konnte das noch nicht her sein; das ging heutzutage viel schneller als früher. Gedruckt würde die Nachricht erstmals heute im Abendblatt erscheinen, und wenn den Tag über nicht mindestens ein Staatsstreich passierte, war die Geschichte garantiert morgen früh in allen übrigen Blättern der Aufmacher.
Und er startete erst jetzt ins Rennen. Da musste er sich echt was einfallen lassen.
Er sprang auf, schnappte seine Umhängetasche vom Haken und machte sich ausgehfertig: Laptop ausstöpseln und in das mittlere Fach. Handy und Fotoapparat in die beiden aufgesetzten Taschen vorne. Notizblock, mehrere Stifte, Netzteil (die Batterie des Laptops war natürlich längst hinüber), Kabel und sonstiger Kleinkram war immer drin. Er verließ das Haus selten ohne dieses lederne, abgewetzte, aber unkaputtbare Ungetüm.
Ah, halt. Er zog den Unterschrank mit den Hängemappen auf. Was er noch brauchte, war –
Das Telefon klingelte wieder. Die Sassbeck, die es sich anders überlegt hatte? Oder ihn wüst beschimpfen wollte?
Nichts dergleichen. Es war Melanie. Und alles, was sie sagte, war: »Macho!«
»Nein«, rief Ingo.
»Doch.«
Macho war Melanies Papagei. Ein mittlerweile vierzehn Jahre alter Kongo-Graupapagei mit, vorsichtig ausgedrückt, eigenwilligen Manieren, den Melanie von einer Freundin übernommen hatte. Angeblich litt der Mann, den besagte Freundin damals hatte heiraten wollen, an Allergien, die nicht zur Haltung dieser Art Tiere passten, aber Ingo hegte bis heute den Verdacht, dass ihr einfach die viele Arbeit damit lästig geworden war. Zumal aus der Heirat nichts geworden war.
Macho war schlau genug, den Verschluss seiner Voliere zu öffnen, wenn dieser nicht durch ein Schloss gesichert war. Und wenn er es schaffte, das Wohnzimmer zu verlassen, konnte es zur tagesfüllenden Aufgabe ausarten, ihn wieder einzufangen. Wäre Melanie in praktischen Dingen so penibel gewesen wie bei ihren literaturtheoretischen Arbeiten, bei denen sie jedes Wort mehrmals umdrehte, hätte das kein Problem dargestellt, aber so war es eben nicht.
»Ich hab keine Zeit«, erklärte Ingo und bemühte sich, unerbittlich zu klingen. »Null. Nada. Niente.«
»Aber du bist der Einzige, auf den er hört!« Es klang wie ein Vorwurf. So, als sei es seine Idee gewesen, das blöde Vieh anzuschaffen.
»Was ist mit deinem Matschi?«, fragte Ingo, die Hand über den Hängemappen. Was hatte er noch mal gesucht? »Wird Zeit, dass der’s auch mal lernt, oder?«
»Er heißt Markus«, erwiderte Melanie pikiert.
»Markus Matschi. Sag ich doch.«
»Du bist kindisch.«
Ingo ging die Hängemappen durch. »Nein, ich hab einfach ein schlechtes Gedächtnis. Dafür kann ich doch nichts.«
»Neci«, erklärte Melanie ernst. »Professor Neci.«
»Klingt wie Netti«, befand Ingo, zog ein Blatt heraus, überflog es und ließ es wieder zurück in die Mappe rutschen. »Ich glaube, so kann ich’s mir endlich merken.«
»Und? Wann kommst du?«, fragte Melanie inquisitorisch.
»Heute nicht.«
»Ingo!« Dem Panikgrad in ihrer Stimme nach zu urteilen, plagte sie sich schon mindestens zwei Stunden mit dem Papagei herum. »Macho ist raus in den Hausflur! Er sitzt oben auf dem Querbalken und quasselt ohne Pause!«
Das war Machos Lieblingsplatz. Vielleicht, weil es dort ein Fenster gab, durch das man eine gute Aussicht über die Stadt haben musste.
»Lass ihn doch.« Ingo nahm sich die nächste Mappe vor. Sein Ordnungssystem ließ wirklich zu wünschen übrig.
»Und wenn er da oben verdurstet? Ich hab gestern Abend vergessen, seinen Trinkautomat nachzufüllen. Das heißt, er hat vielleicht seit einem Tag nichts mehr getrunken!«
Kein Wunder, dass er abgehauen ist, dachte Ingo und schüttelte den Kopf. »Tiere verdursten nicht. Die können auf sich aufpassen.«
»Macho nicht. Der ist ein Opfer der Zivilisation. Das Leben in Gefangenschaft hat seine Instinkte verkümmern lassen.«
»Tja«, meinte Ingo, der endlich gefunden hatte, was er suchte. »Ich hab jedenfalls keine Zeit. Ein dringender Auftrag.«
Er hörte Melanie schnauben. »Das ist mal wieder typisch. Deine Arbeit war dir schon immer wichtiger als alles andere.«
»Entschuldige, dass ich keine reichen Eltern habe, die ich mal beerben werde.« Er klemmte den Hörer zwischen Ohr und Schulter, faltete das Blatt sorgsam zusammen und schob es in das vorderste Fach seiner Tasche.
»Das war schon immer das Problem mit uns«, lamentierte Melanie weiter.
»Was? Dass ich keine reichen Eltern habe?«
»Nein. Dass du dich der Diskussion entziehst, sobald es unangenehm wird.«
»Ich weiß nicht, was das Problem mit uns war, aber das war es jedenfalls nicht.«
»Du wirst es nie einsehen, oder?«
Ingo ließ den Verschluss der Tasche zuschnappen. »Muss ich auch nicht, stell dir vor. Deswegen haben wir uns ja getrennt, und du hast dir deinen Professor Matschi geangelt. Der steht dir sowieso besser, ehrlich. Ruf ihn an. Wenn er jetzt noch deinen Vogel in den Griff kriegt, ist er der ideale Mann für dich.«
»Du enttäuschst mich, Ingo!« In ihrer Stimme irrlichterte blanke Panik.
»Wie immer. Tschüss«, sagte Ingo und legte auf. Dann machte er, dass er loskam, und schaffte es, aus der Wohnungstür zu sein, ehe das Telefon wieder klingelte. Auf dem Weg die Treppe hinunter schaltete er sein Handy ab.
Die Leute von der Spurensicherung waren bereits am Einpacken, als Ingo ankam. »Sie sind spät dran«, lachte ihn eine Frau aus, die eine Stupsnase hatte und Rundungen, die auch der weiße Ganzkörperanzug nicht verbergen konnte. »Ihre Kollegen haben uns alle schon vor acht Uhr belästigt.«
Ingo nickte nur und machte, dass er die Treppe hinabkam. Unten auf dem Bahnsteig fand er einen Beamten, der eine Spur auskunftsfreudiger war. »Der Tatort wurde von der Schutzpolizei nach dem Auffinden der Tatbeteiligten bis zu unserem Eintreffen gesichert«, erklärte er steif, während er Absperrband aufwickelte. Es klang auswendig gelernt; die üblichen Sprüche im Polizeideutsch. »Bei der Bergung der noch lebenden Person standen gesundheitliche Aspekte im Vordergrund. Mit der erkennungsdienstlichen Tätigkeit wurde unmittelbar danach begonnen.«
»Und Sie sind erst jetzt fertig geworden?«, wunderte sich Ingo. Der Vorfall lag wie lange zurück? Zwölf Stunden?
Der grauhaarige Mann sah ihn tadelnd an. »Fertig waren die Kollegen von der Nachtschicht gegen ein Uhr zwanzig. Die weiträumige Absperrung des Tatortes wurde routinemäßig aufrechterhalten für den Fall, dass die Laboruntersuchungen weiteren Handlungsbedarf entstehen lassen. Heute früh ab etwa fünf Uhr konzentrierte sich eine zweite Aktion auf die Suche nach der Tatwaffe. Die Zeit bis zum Beginn des Linienverkehrs auf dieser Strecke wurde genutzt, um die Schienen abzusuchen.«
»Und? Haben Sie sie gefunden?«
»Dazu kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen«, erwiderte der Beamte. »Im Übrigen darf ich Sie für Fragen an den ermittelnden Staatsanwalt Dr. Ortheil verweisen.«
Ingo nickte. Der Name sagte ihm etwas. Vor seinem inneren Auge tauchte das Bild eines Mannes mit langen, blonden Locken auf: Lorenz Ortheil war ein Staatsanwalt von der Sorte, die Auftritte vor Kameras genossen.
»Wenn Sie sie gefunden hätten, stünde der Suchaufruf nach einer Pistole vom Typ Makarow PM bestimmt nicht mehr auf Ihrer Website, oder?«, hakte Ingo nach.
»Wie gesagt, dazu kann ich nichts sagen«, beharrte der Mann im weißen Overall.
»Und wenn die Waffe nicht hier irgendwo ist, dann muss eine Person geschossen haben, die den Bahnhof danach verlassen hat.«
»Wie gesagt, kein Kommentar.«
»Wer hat eigentlich die Polizei alarmiert? Der Fahrer der nächsten U-Bahn, nehme ich an?«
»Wie gesagt.«
Ingo seufzte. Der Mann war wirklich ein harter Brocken. »Darf ich noch ein paar Fotos machen?«, fragte er matt.
»Bitte«, sagte der Spurensicherer. »Sie wissen, dass Sie gehalten sind, ermittelnde Beamte nicht in einer Weise abzubilden, die deren Identifizierung erlaubt?«
»Ja, ja«, brummte Ingo, nestelte seine Kamera heraus und knipste ein Dutzend Bilder in dem Bewusstsein, dass er nichts damit anfangen würde.
Dann bedankte er sich und stieg wieder hinauf ans Tageslicht. Oben fand er einen PKW vor, der quer vor dem Treppenabgang stand; zwei Männer waren dabei, ringsum Wahlplakate aufzuhängen. Die Sonne, die ihn heute früh geweckt hatte, war derweil endgültig hinter einer Wolkendecke aus unentschlossenem Grau verschwunden.
Okay. Was nun? Es in der Klinik zu versuchen konnte er sich sparen. Wenn Radoslav sagte, dass dieser Erich Sassbeck abgeschirmt wurde, dann war das so. In derlei Dingen war auf ihn Verlass.
Andererseits hatte Rado ihm die Adresse dieser Schwiegertochter gegeben, Evelyn Sassbeck, und sicher nicht ohne Hintergedanken, weil Rado nie etwas ohne Hintergedanken tat. Wenn überhaupt, dann würde Ingo über sie an Informationen herankommen. Oder sogar an den alten Mann selber.
Immer, wenn Pfarrer Peter Donsbach von Hausbesuchen in seiner Gemeinde zurückkam, hielt er in dem Moment, in dem er seine Kirche wieder betrat, unwillkürlich den Atem an.
Er sah sich um, ließ seinen Augen die Zeit, sich auf das Halbdunkel einzustellen. Eine alte Frau, die eine Opferkerze aufstellte, ein grauhaariger Mann, der in einer Bank saß, ins Gebet versunken. Zumindest auf den ersten Blick war nichts beschädigt, nichts beschmiert oder gestohlen worden.
Er umrundete die Sitzreihen, spähte in die dunklen Ecken. Kein schlafender Penner irgendwo, auch kein Junkie.
Gut. Seine innere Anspannung ließ allmählich nach, wenngleich nie ganz.
Was hatte es ihn anfangs beeindruckt, als junger Priester unmittelbar nach der Weihe gleich eine Kirche wie diese zugeteilt zu bekommen: die Sankt-Jakob-Kirche am Niendorfer Platz – groß, geschichtsträchtig, altehrwürdig, ein Baudenkmal, das in keinem Reiseführer unerwähnt blieb! Einen allzu kurzen Moment der Ahnungslosigkeit lang war er so etwas wie glücklich gewesen, hatte sich aufgehoben gefühlt im Dasein und beinahe angefangen, doch an Gott zu glauben.
Dann aber hatte er feststellen müssen, dass diese Kirchengemeinde in einer Gegend lag, für die die Bezeichnung sozialer Brennpunkt noch geschmeichelt war. In diesem Teil der Stadt war die Krise der Normalzustand. Kein Monat verging, ohne dass sein Opferstock aufgebrochen oder etwas aus der Kirche gestohlen wurde. Keine Woche, ohne dass er irgendwelche Graffiti entfernen lassen musste. Und was er im Beichtstuhl zu hören bekam, raubte ihm nicht selten den Schlaf.
Der Pfarrer, der diese Gemeinde vor ihm gehabt hatte, war tablettensüchtig geworden. Inzwischen verstand Peter Donsbach, warum.
Zwei Frauen warteten beim Beichtstuhl, beide deutlich über fünfzig, ärmlich gekleidet und einander in auffallender Weise ignorierend. Peter sah auf seine Uhr. Er war spät dran.
Das immerhin gefiel ihm an dieser Kirche: dass sie noch einen richtigen alten Beichtstuhl besaß, aus dunklem Holz, handgeschnitzt und abgegriffen von Sündern mehrerer Jahrhunderte. Er nickte den beiden Frauen knapp zu. Es befremdete ihn nach wie vor, dass sich betagte, lebenserfahrene Menschen ausgerechnet ihm anvertrauten, der so wenig von der Welt gesehen hatte und so wenig vom Leben verstand. Dann betrat er das Abteil des Priesters, verriegelte die Tür und setzte sich auf der schmalen, unbequemen Bank zurecht.
Nach den beiden Frauen mit ihren ungemein langweiligen Sünden schlüpfte eine dritte Person in den Beichtstuhl, jemand, der sich flink und leicht bewegte. Peter hörte, wie die Person den Vorhang hinter sich zuzog, sich aber nicht hinkniete, wie es üblich war, sondern sich setzte.
Und sie begann auch nicht mit den vorgeschriebenen Worten Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, sondern mit: »Hallo, Peter.«
Peter Donsbach zuckte zusammen. Es war eine Stimme, die er jederzeit wiedererkannt hätte, unter Tausenden.
»Du?« Mehr brachte er nicht heraus.
»Ich«, flüsterte die Stimme von jenseits des Gitters.
»Seit wann bist du … Was willst … Was machst du hier?«
»Hast du das mit dem alten Mann gelesen? In der U-Bahn? Gestern Abend?«
»Ja, wieso?« Eines der Gemeindemitglieder, die er heute Vormittag besucht hatte, war ein pensionierter Gymnasiallehrer, der mehr oder weniger den ganzen Tag im Internet verbrachte. Der hatte ihm die Nachricht gezeigt.
»Die Polizei verdächtigt ihn, die beiden Jugendlichen selber erschossen zu haben«, fuhr die Stimme fort.
»Hab ich gelesen.«
»Die Polizei irrt sich«, sagte die Stimme. »Ich war es.«
»Was? Warum das?«
»Du weißt genau, warum.«
Peter hatte das Gefühl, keine Luft zu bekommen. »Rächt euch nicht selber, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes«, brachte er mühsam heraus, »denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der HERR.«
Leises, verächtliches Lachen auf der anderen Seite des holzgeschnitzten Gitters war die Antwort.
»Schön gesagt. Und wo war dein Gott, als du ihn gebraucht hättest?«, fragte die Stimme aus der Vergangenheit. »Hat er dich denn gerächt? Hat er dir geholfen? Hat dir irgendjemand geholfen?«
Peter wollte schlucken, konnte es nicht, weil seine Kehle wie zugeschnürt war. Er sah wieder Bilder, die er hatte vergessen wollen, spürte Gefühle, vor denen er geflohen war, all die Jahre.
»Nein«, flüsterte er. »Niemand.«
»Außerdem geht es nicht um Rache«, fuhr die Stimme nüchtern fort. »Da hätte ich ganz andere Leute erschießen müssen.«
»Was willst du? Die Beichte ablegen? Meine Absolution? Die kann ich dir nicht geben.«
»Ich brauche deine Absolution nicht.« Es klang, als schlucke der andere etwas hinunter. »Ich will, dass du Bescheid weißt. Wenigstens du.«
4Das Haus Brunnerstraße 50 war ein hässlicher, grauer Bau mit sechs Stockwerken. Hier und da bröckelte der Putz, vor dem Eingang drängelten sich die Mülleimer, von denen etliche mit Schlössern gesichert waren. Viele der Gardinen, die man sah, schienen seit Jahrzehnten nicht mehr gewaschen worden zu sein.
Ihr Name stand am Klingelbrett: E. Sassbeck. Aber würde es etwas bringen, wenn er klingelte? Ingo bezweifelte es.
Während er noch dastand und überlegte, wie er vorgehen sollte, kam eine alte Frau heraus, die mit Gehstock und Einkaufstasche hantieren musste und sich mit der Tür schwertat. Ingo stürzte hinzu und hielt sie ihr auf.
»Danke, junger Mann«, sagte sie, im Türrahmen stehend. »Wollten Sie gerade rein?«
»Ehrlich gesagt, ja.«
Sie musterte ihn prüfend, dann nickte sie und gab ihm den Weg frei. »Ist gut. Sie haben nichts Böses vor. Gehen Sie nur.«
Damit ließ sie ihn stehen und humpelte davon, in Richtung des kleinen türkischen Supermarkts an der Ecke.
Ingo zögerte einen Moment, fühlte sich ertappt. Ja, er hatte darauf gehofft, dass jemand aus der Tür kommen würde. Hatte einen Plan für diesen Fall. Aber er hatte es heimlich tun wollen, unbemerkt, war nicht darauf gefasst gewesen, nach der Lauterkeit seiner Absichten befragt zu werden.