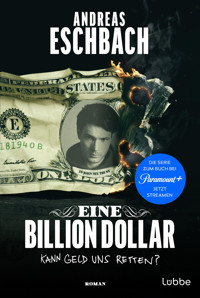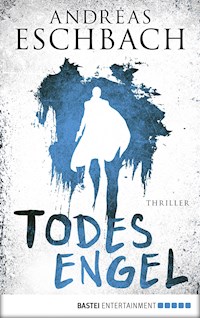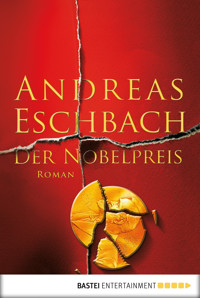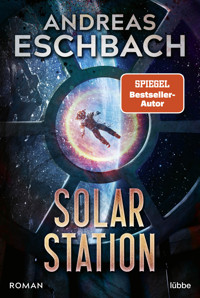9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gibt es ein Video von Jesus Christus?
Bei archäologischen Ausgrabungen in Israel findet der Student Stephen Foxx in einem 2000 Jahre alten Grab die Bedienungsanleitung einer Videokamera, die erst in einigen Jahren auf den Markt kommen soll. Es gibt nur eine Erklärung: Jemand muss versucht haben, Aufnahmen von Jesus Christus zu machen! Der Tote im Grab wäre demnach ein Mann aus der Zukunft, der in die Vergangenheit reiste - und irgendwo in Israel wartet das Jesus-Video darauf, gefunden zu werden.
Oder ist alles nur ein großangelegter Schwindel? Eine atemberaubende Jagd zwischen Archäologen, Vatikan, den Medien und Geheimdiensten beginnt ...
Der Kult-Bestseller Das Jesus-Video wurde 1999 mit dem Deutschen Science Fiction Preis ausgezeichnet und ist ein absolutes Muss für alle Fans von packenden Scifi-Thrillern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 897
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Leseprobe ›NSA – Nationales Sicherheits-Amt‹
Über den Autor
Andreas Eschbach, 1959 in Ulm geboren, studierte Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstellerisch hochbegabten Nachwuchs« schrieb er seinen ersten Roman DIE HAARTEPPICHKNÜPFER. Bekannt wurde er durch den Thriller DAS JESUS-VIDEO. Mit EINE BILLION DOLLAR (2001) stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Autoren auf. Es folgten u.a. Bestseller wie AUSGEBRANNT (2007), HERR ALLER DINGE (2010) und TODESENGEL (2013). Andreas Eschbach lebt heute als freier Schriftsteller in der Bretagne.
Andreas Eschbach
DASJESUS-VIDEO
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH; 30827 Garbsen
Copyright © 1998 by Andreas Eschbach
Diese Ausgabe © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: Kim Hoang, Guter Punkt, unter Verwendung von
Motiven von © shutterstock und thinkstock
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-5780-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes»NSA – Nationales Sicherheits-Amt«von Andreas Eschbach.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Redaktion: Stefan Bauer
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Motiven © Ozen Guney/shutterstock.com
1
Seit er wusste, dass er berühmt werden würde, wartete er auf sie. Dass sie so schnell kamen, erstaunte ihn, aber es überraschte ihn nicht.
Zuerst war da nur eine Staubwolke, in weiter Ferne. Er nahm sie gleichsam aus dem Augenwinkel wahr, sah dann hoch und überlegte, ob ihm seine erwartungsvoll gespannten Nerven einen Streich spielten. Wahrscheinlich. Fahrzeuge wirbelten solche Staubwolken auf, wenn sie über die steinige Piste fuhren, die etwa eine Meile südwestlich des Lagers verlief. Aber das war sicher nur wieder ein Lastwagen, der in das nahe gelegene Dorf wollte. Wahrscheinlich hatte es nichts zu bedeuten. Nicht das, was er erwartete.
Er wandte sich wieder den wenigen Quadratzentimetern Erde zu, die er seit einer Stunde mit einem Borstenpinsel bearbeitete. Es war heiß. Sie hatten Juni, und schon in den Morgenstunden stiegen die Temperaturen auf achtundzwanzig Grad und mehr. Danach vermied es jeder, auf ein Thermometer zu schauen. Es hatte seit Wochen nicht mehr geregnet, was für die Arbeit natürlich gut war, aber die oberste Schicht des Erdreichs verwandelte sich dadurch in feinen, widerlichen Staub, den der leiseste Windhauch mit sich forttrug, den sie atmeten, aßen, mit sich in ihre Zelte und Feldbetten trugen und bis zum Ende der Ausgrabungsarbeiten nicht mehr richtig loswerden würden. Zusammen mit Schweiß bildete er eine dünne, schmierige Schicht, gegen die die wasserarmen Tröpfelduschen, die sie hier im Lager verwendeten, keine Chance hatten.
Ja, er musste sich eingestehen, dass er wartete. Dass etwas in ihm bebte vor Ungeduld. Dass er nur arbeitete, um sich davon abzulenken. Die Münze, auf die er vorhin gestoßen war, als er an einer vielversprechenden Stelle behutsam mit bloßen Händen das Erdreich beiseite geräumt hatte, war ein Schekel aus dem Jüdischen Krieg, eine wertvolle geprägte Silbermünze, die eine Blume mit drei Blütenkelchen zeigte und entlang des Randes eine Aufschrift in der alten hebräischen Schrift aufwies. Mit seinem Pinsel hatte er sie so weit gereinigt, dass sie fotografiert und dann ins Grabungsbuch eingetragen werden konnte. Normalerweise hätte ihn ein solcher Fund in Hochstimmung versetzt. Nur während einer sehr kurzen Periode der römischen Besatzungszeit hatten die Juden Silbermünzen mit hohen Werten geprägt, nämlich in der Zeit des jüdischen Aufstands, der im Jahr 66 begonnen und im Jahr 70 von römischen Truppen niedergeschlagen worden war. Damals war der Große Tempel zerstört worden, und die jüdische Vertreibung hatte ihren Anfang genommen. Die Münze war ein weiterer Fund, der eine präzise Datierung der Gräber erlaubte, die sie freilegten.
Aber er war mit seinen Gedanken woanders. Bei dem Fund vom Vortag. Er hatte ihn nicht selber gemacht – einer der Ausgrabungshelfer, ein junger Student aus den Vereinigten Staaten, war darauf gestoßen –, aber er war der Einzige, dem seine Bedeutung klar war. Ihn schauderte, wenn er daran dachte. Noch nie zuvor waren Archäologen auf ein so brisantes Fundstück gestoßen, ein Artefakt, das buchstäblich die Grundfesten der Zivilisation erschüttern konnte.
Die Staubwolke kam näher, hatte jetzt die Abzweigung passiert und, anstatt zum Dorf weiterzufahren, die Richtung auf das Lager eingeschlagen. Charles Wilford-Smith legte den Pinsel auf das aufgeschlagene Grabungsbuch, zwischen dessen Seiten der Sand knisterte, und stand auf.
Die Landschaft ringsum irritierte ihn jedes Mal. Stumpfes, ödes Land erstreckte sich in kargen Wellen ringsumher, vegetationslos bis auf vereinzelte dürre Halme, die im Schatten größerer Steine wuchsen. Sie verliehen der Ebene zumindest einen grünen Schimmer, bis sie am Horizont in graue, alte Hügel überging, von deren ursprünglicher Höhe viel abgetragen worden war von einem Wind, der ungezählte Jahrtausende geweht hatte und immer noch wehte. Trotzdem hatte man kein Gefühl von Weite. Man fühlte sich im Gegenteil wie unter einem Brennglas. Als könne man es körperlich spüren, wie die Geschichte von mindestens drei großen Kulturen sich in diesem Land bündelte. Jeder Stein, jeder dürre Krüppelstrauch schien mit Erinnerungen an blutige Dramen und gnadenlose Verfolgungen getränkt zu sein, ferne Echos der Stimmen biblischer Propheten schienen noch von den Bergen widerzuhallen, und die Inbrunst zahlloser Gebete schien den Körper zu durchdringen wie radioaktive Strahlung.
Bedächtig nahm er den breitkrempigen Sonnenhut ab, den er stets bei der Arbeit trug. Er war so etwas wie sein Markenzeichen geworden, unfreiwillig, und die Jahre hatten ihre Spuren darauf hinterlassen. Er zog ein Taschentuch hervor, das einmal weiß gewesen war, wischte sich damit über die Stirn und dann über den Schädel, auf dem das altersgraue Haar seit Jahrzehnten auf dem Rückzug war.
»Shimon«, sagte er halblaut.
Aus dem benachbarten Erdloch kam der Kopf eines Mannes, der um die fünfzig sein mochte, ein rundes Vollmondgesicht mit krausem dunklem Haar und starkem Bartwuchs. Die Augen blinzelten geistesabwesend. Sie hatten bis gerade eben in eine zweitausend Jahre zurückliegende Zeit geblickt und stellten sich nur mühsam zurück auf die Gegenwart ein. »Was gibt’s?«
Er deutete auf die näherkommende Staubwolke. »Wir bekommen Besuch.« Mittlerweile erkannte man das Fahrzeug, eine lang gezogene dunkle Limousine, die eindeutig nicht für derartige Schotterpisten gebaut war. Die Sonne tanzte glitzernd auf den Chromleisten rund um die verdunkelten Scheiben, wenn der Wagen durch eines der zahllosen Schlaglöcher fuhr und dann schaukelte wie ein Küstenwachboot in schwerem Seegang.
»Besuch?« Shimon erhob sich schwerfällig und schaute zu dem Fahrzeug hinüber. »Wer kann das sein?«
»Hoher Besuch.«
»Jemand von der Regierung?«
»Noch höher vermutlich.« Er setzte den Sonnenhut wieder auf und stopfte das Tuch zurück in seine Hosentasche. »Unser Geldgeber.«
»Ah!« Shimon Bar-Lev sah ihn an. Sie arbeiteten seit fast zwanzig Jahren zusammen. »Areal 14, nicht wahr? Das will er sich ansehen. Und was ist mit uns? Willst du ewig ein Geheimnis daraus machen, was du und dieser – wie heißt er?«
»Foxx«, erwiderte Wilford-Smith geduldig. Shimons schlechtes Gedächtnis für die Namen lebender Personen war legendär. »Stephen Foxx.«
»Ja, genau. Was du und dieser Foxx gefunden habt?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Aber der Mann in der Limousine dort erfährt es vor mir?«
»Ja. Glaub mir, Shimon, wenn du es erst weißt, wirst du verstehen, warum ich mich so anstelle.«
Shimon knurrte etwas Unverständliches. Er wirkte dabei wie ein trotziges Kind.
Wilford-Smith sah sich um. Satellitenbilder hatten ihn auf die Spur dieser Siedlung gebracht, die um die Zeitenwende herumbewohnt gewesen war. Aufgrund dieser Bilder hatten sie neunzehn auszugrabende Areale bestimmt. Innerhalb jedes Areals waren sie nach einem Gittersystem vorgegangen, wobei Quadrate von fünf mal fünf Metern freigelegt wurden. Das auf der Oberfläche markierte Gitter blieb dabei stehen und bildete zwischen den ausgegrabenen Quadraten ein Schnittprofil von einem Meter Breite, das es dem Ausgräber erlaubte, alle Details einem festen Bezugssystem zuzuordnen. Das war die traditionelle Methode, die sich in aller Welt bewährt hatte. Und natürlich waren die Gitter – die »Katzenstege«, wie man sie nannte – die Zugangswege zu allen Grabungsstellen, manchmal wie ein System schmaler Brücken über Abgründe.
Von den neunzehn Arealen wurden vorerst nur die fünf vielversprechendsten bearbeitet. Das hieß, seit gestern sechs. Er hatte die Arbeiten am Areal 14 einstellen lassen und die Hilfskräfte stattdessen damit beginnen lassen, die obersten Schichten von Areal 3 abzutragen. Über dem Fundort stand jetzt ein großes weißes Zelt, das nachts von zwei grimmigen jungen Männern mit geladenen Maschinenpistolen bewacht wurde. Diese Männer gehörten einem in Tel Aviv angesiedelten Sicherheitsdienst an und waren keine anderthalb Stunden nach seinem Telefonat mit dem Mann aufgetaucht, der jetzt aller Voraussicht nach in der schwarzen Limousine saß.
Natürlich gab es Gerüchte. Er konnte es förmlich brummen hören, wenn er zwischen den Ausgräbern hindurchging. Die meisten waren Volontäre, freiwillige junge Hilfskräfte aus aller Welt, die ihnen die Israel Antiquities Authority in Jerusalem vermittelte. Für ein lächerliches Entgelt und das Gefühl von Abenteuer nahmen sie es auf sich, täglich früh aufzustehen und den ganzen Tag körbeweise Erde und Steine zu schleppen. Nun beobachteten sie ihn aus den Augenwinkeln und fragten sich, was hier eigentlich vorging.
»Vielleicht ist es am besten, wenn wir alle Arbeiten für heute einstellen«, überlegte er halblaut. »Die Leute sollen sich ausruhen.«
Shimon sah ihn entgeistert an. »Aufhören? Aber es ist noch nicht einmal drei Uhr!«
»Ich weiß.«
»Was soll das? Es gibt so viel zu tun. Sie haben gerade angefangen mit dem neuen Areal, und …«
Er spürte, wie seine Stimme einen unduldsamen Klang bekam. »Shimon – das sind lauter junge Leute, intelligent, strotzend vor Energie und so neugierig, dass sie fast platzen. Es ist mir egal, wie du es anstellst, aber keiner von denen kommt mir heute Abend in die Nähe von Areal 14, alright?«
Der andere sah ihn lange an, und wie immer stellte sich jenes gegenseitige Verstehen ein, das sie beide als magisch empfanden. »Alright«, sagte Shimon dann. Es klang wie ein Versprechen. Es war ein Versprechen.
Er seufzte, stieg mühsam aus der Grabungsstelle hinauf auf den schmalen Steg des ursprünglichen Bodens. Drüben an Areal 3 standen sie schon. Junge Männer hauptsächlich, nur einige wenige, heftig umworbene Frauen dazwischen. Sie beobachteten den schwarzen Wagen, der jetzt langsam, beinahe unschlüssig über den Parkplatz rollte, und dann wieder ihn. Er glaubte ihre Blicke auf der Haut zu spüren, während er gelassenen Schrittes auf das lose abgegrenzte Geviert zuging, in dem die Autos abgestellt waren. Zumindest hoffte er, dass es gelassen aussah und nicht einfach gebrechlich. Seit er die Siebzig überschritten hatte, fielen ihm die Klagen seines Vaters wieder ein, der siebenundachtzig geworden war und seine Familie die letzten siebzehn Jahre seines Lebens über den, wie er es zu nennen pflegte, fortschreitenden Zerfall seines Körpers keinen Tag im Unklaren gelassen hatte.
Der schwarze Wagen war zum Stehen gekommen. Gelbes Nummernschild, also ein israelischer Wagen. Wo um alles in der Welt bekam man in Israel so ein Auto? Er staunte immer wieder, was Geld auszurichten vermochte.
Offenbar warteten sie im vermutlich angenehm klimatisierten Inneren. Als er den Wagen erreicht hatte, stieg der Chauffeur aus, ein Koloss von einem Mann, breitschultrig, militärisch kurz geschnittene Haare, in eine ebenfalls beinahe militärisch aussehende Uniform gekleidet, einen Revolver unübersehbar im Schulterhalfter. Sicher war er hauptberuflich Bodyguard und nur nebenbei Chauffeur, denn die Art, wie er den Wagenschlag öffnete, wirkte linkisch und einstudiert.
Der Mann, der dem Fond der Limousine entstieg, war nicht nur reich und mächtig, er sah auch so aus. Er trug einen perfekt sitzenden dunkelblauen Anzug, der in dieser Umgebung völlig deplatziert gewirkt hätte, wäre er von jemand anderem getragen worden. John Kaun aber, jeder Zoll unumschränkter Herrscher über ein weltweites Firmenkonsortium, war es gewohnt, dass sich die Umgebung nach ihm richtete, nicht umgekehrt. Irgendwie schien das auch für Wüstenlandschaften, archäologische Grabungsstätten und hochsommerliche Temperaturen zu gelten.
Sie begrüßten einander mit der gebotenen Höflichkeit. Sie waren einander erst zweimal begegnet – das erste Mal, als es um die Frage der finanziellen Unterstützung der Ausgrabungen ging, dann noch einmal, als in New York eine Ausstellung von Funden aus der Zeit des Königs Salomo eröffnet worden war. Zu behaupten, dass sie einander leiden konnten, wäre übertrieben gewesen. Es war wohl eher so, dass jeder den anderen als notwendiges Übel betrachtete.
»Sie haben es also geschafft«, sagte John Kaun dann und ließ dabei seinen Blick über die Gegend schweifen. Es war faszinierend, ihm dabei zuzusehen – man hatte den Eindruck, dass diese Augen imstande waren, die zur Verfügung stehenden optischen Informationen buchstäblich anzusaugen, die Umgebung förmlich leer zu schauen. Man erwartete, dass die Berge sich diesen Augen entgegenwölbten oder dass die Farbe aus ihnen schwand, irgendetwas in der Art. »Sie haben etwas gefunden, das mehr sein wird als eine Fußnote in einem archäologischen Lexikon.«
»So sieht es aus«, nickte Charles Wilford-Smith.
»Heinrich Schliemann hat Troja gefunden. John Carter das Grab des Tut-Ench-Amun. Und Charles Wilford-Smith …« Zum ersten Mal schimmerten hinter der Maske des Mächtigen menschliche Regungen hindurch. »Ich muss gestehen, dass ich es kaum erwarten kann«, erklärte er. »Den ganzen Flug über habe ich an nichts anderes gedacht.«
Charles Wilford-Smith wies einladend in Richtung Zelt, das einmal ein Ausrüstungsgegenstand der britischen Armee gewesen war. »Was immer Sie sich vorgestellt haben«, sagte er dabei, »die Wirklichkeit übertrifft es.«
2
Die erste Grabungskampagne war für einen Zeitraum von fünf Monaten geplant, beginnend im Mai. Die Leitung lag in den Händen des Verfassers, während Dr. SHIMON BAR-LEV für die Dokumentation verantwortlich zeichnete. Vorarbeiter war RAFI BANYAMANI. Wegen der Ausdehnung des Grabungsfeldes wurden zeitweise bis zu einhundertneunzehn freiwillige Grabungshelfer beschäftigt.
Prof. Charles Wilford-SmithBericht über die Ausgrabungen bei Bet Hamesh
Das Telefon klingelte kurz vor dem Abendessen.
Lydia Eisenhardt kam beim zweiten Läuten aus der Küche und wischte sich die Hände an der Küchenschürze ab, ehe sie abnahm. Es war noch ein Telefon mit einer altmodischen Wählscheibe und einem schweren, massiven Hörer, das im dunklen Hausflur an der Wand hing und einen zwang, alle Telefonate zwischen den an der Garderobe aufgehängten Mänteln und dem mit den bunten Gummistiefeln der Kinder vollgestopften Schuhregal zu führen. Sie hatten es vom Vorbesitzer des Hauses übernommen, der vierzig Jahre hier gelebt hatte, und beschlossen, es zu behalten.
»Eisenhardt?«
Eine glockenklare Stimme war am anderen Ende, die mit einem deutlichen amerikanischen Akzent ein fließendes Deutsch sprach. »Hier ist das Büro von John Kaun, Susan Miller am Apparat. Kann ich bitte Herrn Peter Eisenhardt sprechen?«
»Einen Moment, ich hole ihn. Sie rufen sicher aus dem Ausland an?«
»Aus New York, ja.«
Lydia nickte sich im Garderobenspiegel beeindruckt zu. Ihr Mann erhielt viele Anrufe, aber das war neu. »Ich beeile mich.«
Sie legte den Hörer beiseite, eilte zur Treppe, die in den ersten Stock hinaufführte, und stieg rasch einige Stufen hoch. »Peter?«
»Ja!?«, kam es hinter der Tür des Arbeitszimmers hervor.
»Telefon für dich!« Und, betonter: »New York!«
Manchen Worten scheint ein Zauber innezuwohnen. New York gehörte zu diesen Worten. Für einen Schriftsteller war New York das, was für einen Schauspieler Hollywood war – der Mittelpunkt der Welt, der künstlerische Olymp, der begehrte, bewunderte, gefürchtete, verachtete Ort, an dem und nur an dem eine Karriere ihren Höhepunkt finden konnte.
New York! Das konnte nur heißen: Doubleday. Oder Random House. Oder Simon & Schuster. Oder Alfred Knopf. Oder Time Warner … Das konnte nur heißen, dass es geklappt hatte mit dem lang ersehnten Verkauf der Übersetzungsrechte seiner Bücher in die Vereinigten Staaten …
Jetzt nur nicht durchdrehen. Peter Eisenhardt schaute auf dem großen Bogen Packpapier umher, der vor ihm an der Wand hinter dem Schreibtisch hing, übersät mit dicken und dünnen Pfeilen, seltsamen Symbolen, Namen, wild durcheinander gekritzelten Notizen, aufgeklebten Zetteln und Zeitschriftenfotos. Der Entwurf seines neuen Romans, an dem er gerade arbeitete. Zumindest dieser Entwurf, drei Mal anderthalb Meter groß, war ein Kunstwerk, dachte er manchmal. Jetzt dachte er nur: New York!
»Ich komme!«
Er war außer Atem, als er das Telefon erreichte, und hatte keine Ahnung, ob das nun gut war oder schlecht. Lydia stand gespannt lauschend in der Tür zur Küche, aus der es nach Essig und Basilikum und frisch geraspelten Gurken roch.
»Peter Eisenhardt«, meldete er sich und betrachtete sich dabei im Spiegel. Er war immer noch ziemlich schlank, trotz seiner vorwiegend sitzenden Lebensweise, nur sein Haar begann sich bedenklich zu lichten. Wie würde sich das machen auf dem Umschlag eines amerikanischen Taschenbuches?
»Guten Tag, Herr Eisenhardt«, hörte er tatsächlich die Stimme einer Amerikanerin, die erstaunlich gut Deutsch sprach. »Mein Name ist Susan Miller, ich bin die Sekretärin von John Kaun. Ist Ihnen dieser Name ein Begriff?«
Kaun? John Kaun? Er stutzte. Hoffentlich war das niemand, den nicht zu kennen ein K.-o.-Kriterium war. »Ehrlich gesagt, nein. Sollte er mir denn ein Begriff sein?«
»Mister Kaun ist der Vorstandsvorsitzende von Kaun Enterprises, einer Holdinggesellschaft, der unter anderem die Fernsehgesellschaft N. E.W., News and Entertainment Worldwide, gehört …«
»Der Konkurrent von CNN?« Im nächsten Augenblick hätte er sich die Zunge abbeißen können für diesen Einwurf.
»Mmmh, ja. Wir arbeiten daran, Nummer eins zu werden.«
Wirklich blöd. »Schön«, meinte Eisenhardt lahm.
»Unter anderem«, fuhr die Stimme fort, »gehört zu Kaun Enterprises auch der deutsche Verlag, der Ihre Romane veröffentlicht …«
»Ah«, machte Eisenhardt. Das hatte er nicht gewusst. Erstaunlich.
»Mister Kaun lässt Ihnen ausrichten, dass er sehr stolz ist, Ihre Werke zu veröffentlichen. Er lässt Sie fragen, ob er Sie für einige Tage engagieren kann.«
»Engagieren?«, echote Peter Eisenhardt. »Sie meinen, für einige Lesungen? Eine Lesereise?« Das war fast so gut wie ein Rechteverkauf. Dazu hätte er jetzt unbändige Lust: ein paar Tage in die USA reisen, um ein umworbener Gast auf dem Anwesen eines Multimillionärs zu sein, Mittelpunkt eines literarischen Abends in einem dieser sagenumwobenen exklusiven New Yorker Clubs, umringt von Angehörigen des alten Geldadels, die stolz darauf waren, noch ein wenig Deutsch zu verstehen …
»Nicht direkt eine Lesereise«, korrigierte ihn die Stimme am anderen Ende der Leitung behutsam. »Mister Kaun möchte Ihren Science-Fiction-Verstand engagieren. Ihre schriftstellerische Fantasie.«
»Meine schriftstellerische Fantasie? Und wozu braucht er die?«
»Das weiß ich nicht. Ich bin ermächtigt, Ihnen ein Honorar von zweitausend Dollar pro Tag anzubieten, zuzüglich aller Spesen selbstverständlich.«
Peter Eisenhardt sah seine Frau mit großen Augen an, sie schaute mit großen Augen zurück. »Zweitausend Dollar pro Tag?« Wie stand eigentlich der Dollar gerade? »Und an wie viele Tage dachte Mister Kaun?«
»Mindestens eine Woche, wahrscheinlich mehr. Und Sie müssten morgen anreisen.«
»Morgen schon?«
»Ja. Das ist Bedingung.«
Lydia hatte erst geschluckt, aber jetzt machte sie mit beiden Händen das Daumen-Hoch-Zeichen. Sie konnten das Geld gerade gut gebrauchen. Ein längst fälliger Vorschuss kam und kam nicht, und eine der Zeitschriften, für die Eisenhardt ab und zu des Geldes wegen schrieb, hatte einen Artikel abgelehnt, in den er verdammt viel Zeit investiert hatte.
»Und Sie wissen nicht, was ich dafür tun soll, für diese zweitausend Dollar pro Tag?«, vergewisserte sich Peter Eisenhardt noch einmal misstrauisch.
»Nein, leider nicht. Aber die Vereinbarung, die ich Ihnen zufaxen soll für den Fall, dass Sie zusagen, ist unser Formvertrag für Berater. Ich nehme also an, dass er möchte, dass Sie ihn in irgendeiner Angelegenheit beraten.«
Peter Eisenhardt atmete tief durch, tauschte noch einen Blick mit seiner Frau, die ihm ermutigend zunickte. Und, jawohl, er verspürte Abenteuerlust. Warum nicht? Wieder einmal in die Welt hinausziehen, Frau und Kinder für eine Weile zurücklassen … »Also gut«, sagte er.
»Okay«, sagte die Frau und klang erleichtert. Wahrscheinlich, überlegte Eisenhardt grimmig, hat sie schon eine ganze Liste von Autoren durchtelefoniert, die alle keine Zeit oder keine Lust haben, weil sie mit Schreiben mehr verdienen als das, was sie als Beraterhonorar anzubieten hatte.
»Ich werde für Sie ein Ticket am Flughafen Frankfurt hinterlegen lassen«, fuhr die Stimme geschäftig fort. »Sie brauchen nur Ihren Reisepass. Sie müssen morgen früh bis spätestens acht Uhr dreißig dort sein. Direkt am Schalter der El Al. Es ist wichtig, dass Sie pünktlich sind.«
»El Al?«
»Wegen der Sicherheitskontrollen. Die Maschine fliegt um zehn Uhr, und wenn Sie später als acht Uhr dreißig am Schalter sind, können Sie nicht mitfliegen.«
Eisenhardt wunderte sich immer noch. »Sagten Sie eben El Al?«
»Oh!«, machte sie. Diesmal schien sie wirklich verlegen zu sein. »I’m very sorry. Ich vergaß zu sagen, dass Mister Kaun gegenwärtig in Israel ist. Er möchte, dass Sie nach Israel kommen.«
3
Vgl. zum Folgenden den Plan der Ausgrabungsfelder, Abb. I.3, und den Plan der Schnitte, Abb. I.4a–s, sowie den Plan der Baureste (Abb. I.5).
Insgesamt wurden aufgrund der in Kap. I.2 erwähnten Satellitenfotos (siehe Anhang C.3) neunzehn Ausgrabungsareale bestimmt, von denen die fünf vielversprechendsten, nämlich die Areale 14, 9, 2, 7 und 16 (genannt in der vorgesehenen Reihenfolge), für die erste Ausgrabungskampagne ausgewählt wurden. Wie schon erwähnt, wurden die Arbeiten an Areal 14 vorzeitig eingestellt zugunsten von Areal 3 (hierzu: Kap. II.1).
Prof. Charles Wilford-SmithBericht über die Ausgrabungen bei Bet Hamesh
Das sah aus wie eine ziemlich große Sache. Eher wie ein Einmarsch als wie ein Besuch. Der Sattelschlepper setzte gerade den Dritten von insgesamt fünf lang gezogenen, silberglänzenden Wohnwagen auf dem Gelände neben Areal 14 ab, und die Zahl der einheitlich gekleideten, beinahe uniformierten Helfer nahm stündlich zu. Ein paar von ihnen waren damit beschäftigt, eine Art Zaun zu errichten rund um das Gelände, auf dem die Wohnwagen standen. Etwas abseits hatten sie ein Stromaggregat aufgestellt, einen dunklen, kantigen Kasten, den man weithin wummern hörte und von dem dicke Stromkabel quer über das Gelände zu den Wohnwagen liefen und zu dem großen Zelt, das über der Fundstelle auf Areal 14 errichtet worden war.
»Eine ganze Menge von denen tragen Waffen«, sagte Judith, die das Treiben mit zusammengekniffenen Augen verfolgte.
»Mmh«, machte Stephen Foxx kauend. Die belegten Brote, die sie zu den Pausen erhielten, wurden mit jedem Tag schlechter. Es wurde Zeit, dass er mal mit den beiden Jungs sprach, die für die Verpflegung zuständig waren. Oder sich etwas ausdachte, wie er sich selbst verpflegen konnte. Vielleicht gab es in dem Dorf, von dem immer die Rede war, Möglichkeiten. Dort musste es ja Läden geben, womöglich so etwas wie einen Supermarkt.
»Ich frage mich, was das alles soll. Die richten sich ein. Das sind doch Wohnwagen, oder?«
Foxx nickte. »Klar. Wer sich in so einem Wagen kutschieren lässt, übernachtet nicht in einem simplen Zelt.«
»Mich wundert, dass so einer überhaupt hier übernachtet.«
»Mich auch.« Er griff nach seiner Wasserflasche, spülte den faden Geschmack des Brotes mit lauwarmem, abgestandenem Wasser hinab. Ein zweifelhafter Tausch. »Wegen heute Abend übrigens – das wird nicht zufällig eine religiöse Familienfeier oder so etwas in der Art?«
Judith schüttelte kurz den Kopf, ohne den Blick von den Bauarbeiten zu wenden. »Ach was.«
»Ich muss also kein Käppchen tragen oder meine Schuhe ausziehen?«
»Da du kein Jude bist, musst du sowieso kein Käppchen tragen.«
»Wie steht’s mit Gebeten?«
»Hör auf. Wir bummeln einfach ein bisschen durch Tel Aviv und gehen dann essen. Yehoshuah kennt den Wirt, und wir kriegen den besten Tisch, das ist alles. – Ich frage mich, wer der Typ in dem Anzug ist!«
»Er heißt John Kaun.«
»Was?« Jetzt sah sie ihn an. Nicht schlecht. Stephen Foxx mochte es, wenn sie ihn ansah mit ihren glutvollen schwarzen Augen. Judith Menez war die Schwester von Yehoshuah Menez, einem archäologischen Assistenten am Rockefeller Museum von Jerusalem, den er über das Internet kennengelernt und der ihm die Volontärsstelle bei dieser Ausgrabung verschafft hatte. Vor allem aber war sie gertenschlank, mit Ausnahme der Körperregionen, bei denen das von Nachteil gewesen wäre, hatte lange schwarze Locken, eine atemberaubende Hakennase und ein beeindruckendes Temperament, und es war wirklich höchste Zeit, dass er sie mal ins Bett kriegte. Bis jetzt allerdings schien sie noch nicht einmal bemerkt zu haben, dass er sie unaufhörlich anbaggerte, oder wenn, dann verstand sie es jedenfalls hervorragend, das zu ignorieren.
»John Kaun«, wiederholte Stephen. »Der Besitzer und Vorstandsvorsitzende von Kaun Enterprises. Das Wichtigste, was ihm gehört, ist der Fernsehsender N. E.W., mit dem er seit Jahren versucht, CNN den Platz auf dem Nachrichtenmarkt streitig zu machen.«
Sie schien beeindruckt. »Das klingt nach ziemlich viel Geld.«
»Kaun hat seine erste Million gemacht, als er zweiundzwanzig war. Manche nennen ihn auch Johngis Khan, wegen seiner, hmm, rabiaten Geschäftsmethoden. Er ist zweiundvierzig und einer der reichsten Männer der Vereinigten Staaten.« Foxx überlegte einen Moment, ob es an dieser Stelle taktisch klug war, zu erwähnen, dass er seine erste Million bereits mit knapp neunzehn gemacht hatte. Besser nicht. Das hätte geklungen, als wolle er angeben. Natürlich wollte er das, aber wenn man richtig angeben wollte, durfte es nicht angeberisch klingen. »Und er finanziert diese Ausgrabung hier.«
Ihre Augen wurden noch größer. »Wirklich? Woher weißt du das?«
»Ich lese die richtigen Zeitungen.«
»Du liest die richtigen Zeitungen, na klar.«
Stephen Cornelius Foxx, zweiundzwanzig, stammte aus Maine im Nordosten der USA. Er war schlank, beinahe drahtig, etwas zu klein, verglichen mit dem Durchschnitt, was er jedoch durch eine gerade Haltung und selbstsicheres Auftreten zu kompensieren wusste, und trug eine dünnrandige, sehr intellektuell aussehende Brille. An wissenschaftlichen Forschungsprojekten in aller Welt teilzunehmen war sein Hobby. Er hatte schon auf Island Vögel beringt, in Brasilien Ameisenarten gezählt, in Afrika vergleichende Studien über die Wirksamkeit verschiedener Bewässerungssysteme am Rand der Sahelzone betrieben und in Montana mitgeholfen, Saurierknochen auszugraben. Stephen Foxx war das jüngste Mitglied, das die altehrwürdige New Yorker Explorer’s Society, die seit jeher Ausgrabungen, Urwaldexpeditionen und andere Forschungsvorhaben in aller Welt mit Geld und Hilfspersonal unterstützte, jemals in ihre Reihen aufgenommen hatte. Und zwar als zahlendes Mitglied wie alle anderen auch. Nur deshalb nahm man ihn für voll, und so wollte er es.
Noch nie war er vor etwas zurückgeschreckt, das er sich zu tun vorgenommen hatte, nur weil er nach landläufiger Meinung nicht das richtige Alter dafür gehabt hätte. Er hatte recht früh begriffen, welche Rolle Geld im Leben spielte: Geld war das Hilfsmittel, das einem erlaubte, das Leben zu führen, das man führen wollte. Wer Geld hatte, konnte tun, was er wollte – wer kein Geld hatte, musste das tun, was andere wollten. Also war es besser, Geld zu haben.
So hatte er früh begonnen, sich mit Computern zu beschäftigen, aber nicht aus einem Spieltrieb wie die meisten Computerfreaks, sondern weil er spürte, dass damit am leichtesten das Geld zu verdienen war, das es ihm erlauben würde, das Leben zu führen, das er führen wollte: vor allem ein interessantes Leben.
Mit sechzehn hatte er das Kunststück fertig gebracht, ein Unternehmen seiner Heimatstadt, das mit Autozubehörteilen handelte, davon zu überzeugen, dass er imstande war, ihnen ein maßgeschneidertes EDV-Verwaltungssystem zu erstellen, das besser funktionieren würde als das, das sie bisher hatten, und das auf den Computern laufen würde, die sie bereits besaßen – und ein Jahr später nahm er tatsächlich einen Scheck in Empfang über eine Summe, deren Höhe sogar seinem Vater, der Rechtsanwalt war und gewohnt, schmerzhaft hohe Rechnungen zu stellen und bezahlt zu bekommen, Respekt abnötigte.
Der Kniff bei diesem Mammutunternehmen war gewesen, dass Stephen Foxx tatsächlich nur die präzisen Spezifikationen für das EDV-System geschrieben hatte, programmiert hatten die einzelnen Bestandteile dagegen Programmierer in Indien, allesamt Studenten der Informatik, die er per Internet angeworben und von denen er keinen Einzigen je zu Gesicht bekommen hatte. Alles war über die Datennetze abgewickelt worden, zu der Zeit noch eine komplizierte Angelegenheit für Insider: Er hatte die detaillierte Beschreibung eines Funktionsbausteins nach Indien übermittelt, der betreffende Partner hatte danach das entsprechende Programm entwickelt und den Programmcode auf demselben Weg zurückgeschickt. Stephen hatte lediglich die einzelnen Komponenten zu einem Gesamtsystem zusammensetzen und, nach eingehenden Funktionstests, bei seinem Auftraggeber auf dessen – zum Glück schon fix und fertig vorhandenen – Computern installieren müssen.
Das hatte wunderbar funktioniert, vor allem deshalb, weil die Qualität der Programme, die er von seinen indischen Partnern erhalten hatte, alles übertroffen hatte, was er in seinem Umfeld gewohnt war. Fehlerfrei, sozusagen. Der komplizierteste Teil des ganzen Unternehmens war am Ende gewesen, das ihnen zustehende Geld von amerikanischen auf indische Banken zu transferieren – eine Prozedur, die Stephen noch fünfmal wiederholte, weil er das Programm danach noch an fünf weitere Firmen verkaufte. Nicht nur er, auch seine indischen Subunternehmer waren auf diese Weise zu reichen Leuten geworden, und heute hatten die meisten von ihnen eigene Software-Unternehmen, die für Auftraggeber aus aller Welt tätig waren. In Indien programmieren zu lassen war für viele westliche Firmen inzwischen gang und gäbe.
Stephen verspürte nicht den Drang, nach der Million nun nach der Milliarde zu streben. Was in jemandem wie John Kaun vorging, konnte er wohl versuchen sich vorzustellen, nachvollziehen konnte er es nicht. Er hatte ganz normal die High School abgeschlossen, studierte Volkswirtschaft an einer relativ unbekannten, gemütlichen kleinen Universität, fuhr mit einem knallroten Porsche umher und schleppte nach Kräften die heißesten Mädchen ab. Auf seinem Geld ruhte er sich mehr oder weniger aus. Er hatte es so investiert, dass die Erträge daraus seinen Lebensstil zum größten Teil finanzierten, und wie es aussah, würde er Zeit seines Lebens nicht mehr gezwungen sein, zu arbeiten. Dafür, fand er, hatten sich die stressigen anderthalb Jahre gelohnt.
Und mindestens einmal im Jahr verschwand er in die weite Welt. Normale Reisen hatte er, seit er denken konnte, verabscheut: Irgendwohin zu fahren, um sich »die Gegend« oder »die Sehenswürdigkeiten« anzuschauen, war ihm immer ausgesprochen sinnlos vorgekommen. Die Leute, die das taten, gaben für gewöhnlich damit an, nette Restaurants auf Sri Lanka zu kennen oder schon einmal um die Pyramiden herumgeritten zu sein, aber wenn man dann hartnäckig blieb und weiterfragte, dann stellte sich heraus, dass sie in ihrer Heimatstadt nur ihre Stammkneipe kannten und nicht einmal wussten, wegen welcher Sehenswürdigkeiten eine Menge Leute, die genau dem gleichen Snobismus frönten, aus aller Welt angereist kamen, womöglich sogar aus Sri Lanka. Nein, so nicht. Stephen Foxx interessierte sich für die Welt, aber wenn er irgendwohin reiste, dann wollte er dort etwas Sinnvolles zu tun haben. Und dafür konnte er sich nichts Faszinierenderes vorstellen, als an Ausgrabungen teilzunehmen, an zoologischen Beobachtungscamps oder botanischen Expeditionen in den Regenwald. Seit er von der Explorer’s Society erfahren hatte und davon, dass es möglich war, als Laie an derartigen Unternehmungen teilzunehmen, war ihm klar gewesen, was er wollte.
Natürlich war das fast immer mit harter körperlicher Arbeit, unkomfortablen Lebensbedingungen und stupiden Tätigkeiten verbunden. Da waren Tausende von Larven zu zählen, waren dutzendweise Körbe voller Erde, Schutt und Steine zu schleppen, wurde man von Moskitos gestochen und musste in durchnässten, stinkenden Zelten schlafen. Aber das war Teil des Abenteuers. Er hätte nicht mit den Wissenschaftlern tauschen mögen, die natürlich die anspruchsvolleren Dinge taten, die die Theorien entwickelten und Aufsätze verfassten und den Hilfskräften die Anweisungen gaben, denn das hätte in der Konsequenz bedeutet, dass er ein naturwissenschaftliches Fach studieren und sein ganzes Leben lang dieselbe Art von Arbeit hätte tun müssen. Und das klang alles andere als interessant. Das klang ausgesprochen langweilig.
»Meinst du, sie wollen einen Film drehen über unsere Ausgrabungen?«, fragte Judith. Von weitem winkte ihnen Rafi zu, der die Arbeiten an Areal 3 leitete. Die Frühstückspause war vorbei.
»Ich weiß nicht«, erwiderte Stephen. »Ich glaub’s eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass der Vorstandsvorsitzende kommt, um einen Film zu drehen.«
»Aber es hat etwas mit dem Fund zu tun. Über den du nicht reden willst.«
»Davon kann man, glaube ich, ausgehen.«
»Und was glaubst du, was los ist?«
»Ich glaube«, sagte Stephen Foxx, nahm die Brille ab und wischte mit dem Handrücken über die Augenbrauen, die nass waren von Schweiß, »ich glaube, dass ein Mord passiert ist.«
4
Es folgt nun die eingehende Auswertung der Stratigrafie. Stratigrafische Elemente, wie Schichten und Grubenwände, sind mit Nummern (Ziffern), Baureste mit Buchstaben versehen und an den entsprechenden Stellen in die stratigrafische Darstellung eingefügt. Zur stratigrafischen Einordnung der Keramikfunde in Kap. III–9, siehe Kap. XII.
Die Nummerierung und Schematisierung der Stratigrafie basiert auf der von HARRIS publizierten Methode (HARRIS 1979, 81–91, vgl. auch FRANKEN 1984, 86–90). An einigen Stellen deckt der Vereinfachung wegen eine einzige Nummer eine ganze Anhäufung von Ablagerungen ab.
Prof. Charles Wilford-SmithBericht über die Ausgrabungen bei Bet Hamesh
Der Schalter der El Al ist aus Sicherheitsgründen abseits der Haupthalle in einem separaten Gang untergebracht. Peter Eisenhardt hatte ihn fast in letzter Minute erreicht und stand jetzt mit einem ziemlich unbehaglichen Gefühl unter lauter Menschen, wie er sie bisher nur in den Abendnachrichten gesehen hatte. Orthodoxe Juden mit langen Schläfenlocken und ganz in Schwarz gekleidet standen neben gleichmütig dreinschauenden Palästinensern, die das unverkennbare Kopftuch trugen, das Jassir Arafat populär gemacht hatte. Sie ignorierten sich gegenseitig nach Kräften. Züchtig in lange Gewänder und Kopftücher gehüllte Frauen warteten in einer Reihe mit ganz ähnlich gekleideten Franziskanermönchen. Dazwischen, nicht ganz so auffällig, geduldeten sich ganz normale Männer und Frauen jeden Alters und Standes, großmütterliche Damen und vornehme ältere Herren, die erwartungsvoll einen weißen Sommerhut aufhatten, obwohl es früh am Morgen und der Himmel in Frankfurt bedeckt war; blasse, stämmige Männer in speckig glänzenden Anzügen, die schwere Plastiktaschen schleppten und sich leise in einer Sprache unterhielten, die für Eisenhardts Ohren wie Russisch klang. Und es ging sehr langsam voran.
»Warum reisen Sie nach Israel?«, wollte die Dame der israelischen Sicherheitsbehörde wissen, ein hünenhaftes Weib, das ihn dabei so argwöhnisch musterte, als verdächtige sie ihn krimineller Absichten.
»Aus, ähm, beruflichen Gründen.« Warum machte ihn diese Frage eigentlich so nervös? Er fingerte das Fax aus New York aus der Tasche. »Ich habe einen Beraterauftrag.«
Sie studierte das Fax eingehend. Das war hier keine Formsache, das war richtig ernst. So hatte er das noch nie bei einer Flugreise erlebt. Die würden eher den Flug verspätet starten lassen, als bei den Kontrollen großzügig über unklare Punkte hinwegzugehen, und das hatte sicher einen guten Grund. Eisenhardt musste an die Flugzeugentführungen denken, die er, meist eher nebenbei, mitbekommen hatte. Viele gute Gründe.
Da hatte er sich ja auf was eingelassen, meine Güte. Sie las das Fax ein zweites Mal, den ganzen vierseitigen Vertrag in überaus juristischem Englisch, und nahm nebenbei den Hörer ihres Telefons ab, wählte eine Nummer, ohne hinzusehen, und sprach mit jemandem in einer kehligen Sprache, die wohl Hebräisch sein musste. Schließlich gab sie ihm das Papier zurück und nickte, kringelte eine Unterschrift auf ein Formular und gab den Weg frei. »In Ordnung«, sagte sie und richtete ihr geballtes Misstrauen auf den nächsten in der Reihe, den sie bis zum Beweis des Gegenteils ebenfalls wie einen mutmaßlichen Terroristen behandeln würde.
Warum reisen Sie nach Israel? Eine verdammt gute Frage. Er, ein mäßig erfolgreicher Schriftsteller! Als Berater eines millionenschweren Mediengiganten! Verrückt. Äußerst dubios. Der wahre Grund, erkannte er plötzlich, war, dass er mit den Ratenzahlungen für das Haus im Rückstand war. Weil der Verlag nicht zahlte, der um zwei Ecken herum eben dem Mann gehörte, der ihn engagiert hatte.
Sie saß da, wo er sie hinhaben wollte: auf dem Rand seines Feldbetts. Dummerweise war sie jedoch angezogen und er halb nackt.
Stephen hatte geduscht. Wobei die Duschen diese Bezeichnung kaum verdienten - aus ehrfurchtsgebietend aussehenden Duschköpfen sonderten sie nur einen schwach tröpfelnden Strahl ab. Jeder im Lager beklagte sich ständig darüber, dass die Duschen nicht imstande seien, den allgegenwärtigen Staub abzuspülen. Jeder wusste auch, dass es keinen Zweck hatte, sich zu beklagen, weil sich die Duschen bis zum Ende der Grabungszeit nicht verändern würden. Stephen schaffte es mit einem simplen Trick, den er bei den Bewässerungsexperten in Afrika gelernt hatte, sich den Staub trotzdem praktisch vollständig abzuwaschen: indem er einen Schwamm benutzte. Er hatte mit diesem Tipp auch nicht hinter dem Berg gehalten, aber soweit er mitbekam, zogen es die meisten immer noch vor, sich zu beklagen.
»Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der in einem archäologischen Ausgrabungslager ein Jackett dabei hat«, meinte Judith.
»Ich habe auch noch jede Menge andere außergewöhnliche Eigenschaften«, erwiderte Stephen, der noch dabei war, sich die Haare trocken zu rubbeln und mit einem groben Kamm in Form zu bringen. Es tat gut, den Tag hinter sich und einen angenehmen Abend vor sich zu wissen. Auch die körperliche Anstrengung tat gut, brachte ihn in Form und ließ ihn seinen Körper besser spüren.
Die Ausgrabungshelfer wohnten in einigermaßen geräumigen Zelten aus schwerem weißem Segeltuch, die so wirkten, als seien sie von einem Afrikafeldzug der britischen Armee übrig geblieben. Vielleicht waren sie das sogar. Die meisten Zelte waren doppelt belegt; Stephen hatte es jedoch arrangieren können, ein Zelt für sich allein bewohnen zu dürfen, indem er das Gerücht in die Welt setzte, er schnarche nachts fürchterlich und neige überdies dazu, zu schlafwandeln und sich bei der Rückkehr öfter im Bett zu irren – das wollte dann doch keiner riskieren. Infolgedessen hatte er genug Platz, neben Tisch und Stuhl eine übersichtliche Kleiderstange und einen großen Spiegel aufzustellen.
»Irgendwann erfahr ich es ja doch«, wiederholte sie mindestens zum fünften Mal. Es ging immer noch um den Fund, den er gemacht hatte und der, wie es schien, die ganze Unruhe ausgelöst hatte.
»Du erfährst es heute Abend«, sagte Stephen und stieg in seine Hosen. Judith sah ihm ungerührt zu. Sie war vorhin einfach ins Zelt gekommen, während er in der Unterhose dagestanden war, hatte sich auf sein Bett gesetzt und angefangen, ihn wegen des Fundes zu löchern. »Das ist eine lange Geschichte. Wenn ich sie dir erzähle, muss ich sie Yehoshuah noch einmal erzählen, und das ist mir zu viel.«
»Du willst es nur spannend machen.«
»Klar. Das auch. Wann kommt dein Bruder?«
»In einer halben Stunde.«
Sie hatte etwas Raues an sich. Was daran liegen mochte, dass sie mit ihren zwanzig Jahren bereits ihre zwei Jahre Wehrdienst in der israelischen Armee hinter sich hatte. Mit einem gewissen Schaudern hatte Stephen zur Kenntnis genommen, dass dieses langbeinige, rassige Geschöpf imstande war, einen Panzer zu fahren, in Feuergefechte mit Intifada-Leuten verwickelt gewesen war und ein zerlegtes Maschinengewehr mit verbundenen Augen in weniger als einer Minute zusammenbauen konnte. Während er die Armee nur aus Filmen kannte.
»Sollen wir nicht doch mit meinem Auto fahren? Und ihn in Tel Aviv treffen?« Er deutete mit einer Kopfbewegung auf sein Mobiltelefon, das auf dem Tisch lag.
»Den erreichst du jetzt nicht mehr. Der steht schon im Jerusalemer Berufsverkehr.«
»Also gut.« Er zog sein Hemd zurecht, sein Lieblingshemd aus einer raffinierten Mischung von Leinen, Baumwolle und verschiedenen Kunstfasern, das ihn auf alle seine Expeditionen begleitete. Für sich getragen sah es leger aus, zusammen mit dem Jackett elegant, und es ließ sich zur Not auch mit kaltem Wasser und Seife reinigen und wirkte trotzdem immer, als sei es weiß. Es stammte aus einem exklusiven kleinen Laden in New York, auf den ihn jemand aus der Explorer’s Society hingewiesen hatte, ein Mann, der inzwischen auf die achtzig zuging und bei jeder Gelegenheit erzählte, wie er in seiner Jugend die Welt per Fahrrad umradelt hatte.
Dann schlüpfte er in das Jackett. Noch so ein Stück, nach dem er lange hatte suchen müssen. Es war leicht, kühlte in heißen Gegenden und wärmte in kalten, ließ sich im Gepäck eng zusammenrollen, ohne zu knittern, und passte farblich praktisch zu allem. Ganz billig war es natürlich nicht gewesen. Aber er hatte es sich zur Regel gemacht, niemals irgendwohin zu reisen, ohne die Möglichkeit zu haben, sich geschmackvoll und businesslike zu kleiden. Er hatte sogar ein paar Krawatten in seinem rustikal aussehenden Seesack; die hatte Judith nur noch nicht gesehen, sonst hätte sie sich darüber sicher auch lustig gemacht. Aber seiner Erfahrung nach war nichts so hilfreich für ein selbstsicheres Auftreten wie das Wissen, korrekt gekleidet zu sein. Wenn man es mit Menschen zu tun hatte, konnte eine Krawatte genauso entscheidend sein wie ein Revolver in einer Konfrontation mit einem Tiger.
Judith war aufgestanden und an den Zelteingang getreten. Die tief stehende Sonne warf einen breiten, warmen Lichtstrahl quer durch das Zelt, über das Feldbett und den staubigen Boden aus festgetrampelter Erde, als sie die Plane beiseite schob. »Da kommt ein Taxi, glaube ich.«
»Mmmh«, machte Stephen, während er sich die Schuhe band. Die bekam man natürlich nie sauber in einer solchen Umgebung. Und aufräumen musste er auch mal wieder; aus den Augenwinkeln sah er, dass unter dem Bett immer noch der Fundkasten lag, den er gestern benutzt hatte, ein flacher, rechteckiger Kasten aus stumpfem Eisenblech mit einem teilbaren Klappdeckel, in den man bei der Arbeit an Fundstellen die beiseite geräumte Erde tat, um sie später sorgfältig zu sieben. Manchmal wurden kleine, aber wichtige Fundstücke – einzelne Zähne, kleine Knochen, Teile von Schmuck – am Ausgrabungsort übersehen und erst beim Sieben gefunden.
Aber all das hatte Zeit bis morgen. Er steckte Brieftasche und Mobiltelefon ein und überprüfte, ob er genug Bargeld in der Tasche trug.
»Die scheinen doch einen Film drehen zu wollen«, meinte Judith. »Das da ist doch eine Filmkamera, oder?«
»Was?« Stephen trat hinter sie, schaute über ihre Schulter und genoss es, die Wärme ihrer Wange zu fühlen, die kaum einen Zentimeter von der seinen entfernt war. Sie roch aufregend, ohne dass er hätte sagen können, wonach.
»Das Ding da auf dem dreibeinigen Gestell. Vor dem Zelt.«
Stephen starrte das Ding an, das tatsächlich eine Kamera war, wie man sie für Kinoproduktionen verwendete. Zwei von Kauns Leuten waren damit beschäftigt, sie auf einem stabilen Stativ festzuschrauben. »Merkwürdig«, sagte er.
»Die wollen einen Film drehen, ich sag es doch.«
Stephen schüttelte langsam den Kopf. »Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Johngis Khan anreist, wenn es nur darum geht, einen Film über eine archäologische Ausgrabung zu drehen.«
Allmählich bezweifelte er selber, ob er wirklich verstand, was da eigentlich vorging. Wenn er hinübersah auf das Areal 14, die fünf loderrot in der Abendsonne glänzenden Wohnwagen und die seltsam gesichtslos durcheinander wuselnden Männer in ihren N.E.W.-Overalls, dann fühlte er sich ausgeschlossen, an den Rand der Ereignisse gedrängt. Das da drüben sah fast so aus wie in diesen Filmen, wenn jemand etwas Epochales entdeckte – einen Außerirdischen, einen Urzeitmenschen – und dann »Wissenschaftler« einfielen wie die Heuschrecken, alles abriegelten, Schutzzäune und Abdeckungen errichteten und überall ihre Messinstrumente aufstellten.
Er ließ die Ereignisse noch einmal vor seinem inneren Auge vorbeiziehen. Den gestrigen Tag. Den Fund. Seine Theorie darüber. Wenn er jetzt darüber nachdachte, kam sie ihm nicht mehr so einleuchtend vor. Irgendetwas daran war falsch. Das, was geschah, passte nicht dazu. Vielleicht ganz gut, wenn er das Ganze heute Abend mit Judith und ihrem Bruder noch einmal durchgehen konnte.
Sein Sitznachbar im Flugzeug erkannte ihn, als unten gerade die Alpen vorbeizogen. »Entschuldigen Sie, aber sind Sie nicht der Schriftsteller Peter Eisenhardt?«, sprach er jenen wonnevollen Satz aus, den alle nicht übermäßig bekannten Schriftsteller lieben wie die Namen ihrer Kinder.
Ja, gab Peter Eisenhardt zu, der sei er.
»Ich habe ein paar Ihrer Bücher gelesen«, sagte der Mann und nannte die Titel von zwei Romanen, die leider beide von anderen Autoren stammten. »Haben mir sehr gut gefallen, wirklich.«
Eisenhardt lächelte gequält. »Freut mich zu hören.«
Er stellte sich vor als Uri Liebermann, Journalist und als Auslandskorrespondent mehrerer israelischer Zeitungen in Deutschland tätig. Er lebe in Bonn, reise aber einmal im Monat nach Hause zu Frau und Kindern, die für einen Auslandsaufenthalt nicht zu gewinnen seien. »Und warum reisen Sie nach Israel?«, wollte er wissen. »Machen Sie eine Lesereise? Oder Urlaub?«
Peter Eisenhardt verneinte die Lesereise, und einen Urlaub würde er gleichfalls nicht ohne Familie unternehmen wollen.
»Ah«, schlussfolgerte der lebhafte Auslandskorrespondent, der knapp über vierzig sein mochte und seine hohe Stirn durch einen ausgeprägten, geradezu preußischen Oberlippenbart auszugleichen suchte, »dann betreiben Sie Recherchen?«
»So ungefähr«, räumte Eisenhardt ein.
»Heißt das, Ihr nächster Roman spielt womöglich in Israel?«
»Möglicherweise.« Ein dickes Notizbuch war natürlich, wie immer, wenn er verreiste, das Erste gewesen, was er eingepackt hatte. Es gab einen Teil seines Hirns, der sich längst verselbstständigt zu haben schien und permanent Ausschau hielt nach ungewöhnlichen Schauplätzen, unbekannten Redewendungen, interessanten Personen und Begebenheiten, und diese Beobachtungen wollten zu Papier gebracht und später in Romanen verwertet werden. Von daher konnte man diese Möglichkeit nicht ausschließen.
»Großartig, großartig«, freute sich der Journalist und begann, in seinem Handgepäck zu wühlen. »Sagen Sie, darf ich ein Foto von Ihnen machen? Ich würde gerne eine kleine Meldung bringen in einer der Zeitungen, für die ich arbeite; irgendwas in der Art, ›der bekannte deutsche Schriftsteller Peter Eisenhardt bereist zurzeit Israel‹, ich meine, das ist schließlich auch in Ihrem Interesse?«
»Gern.«
Und so ließ Peter Eisenhardt sich fotografieren, lächelte so gewinnend wie möglich, und nach dem dritten Blitz war Uri Liebermann zufrieden. Stolz demonstrierte er danach seine Kamera, ein brandneues Modell mit einem flachen Monitor auf der Rückwand, auf dem man das geschossene Bild in beinahe Originalgröße begutachten konnte, ehe man es auf der kleinen Optical Disc im Inneren abspeicherte. »Voll digital«, erklärte er. »Und sehen Sie, hier an der Seite? Hier kann ich ein serielles Kabel einstecken und die Bilder direkt in jeden handelsüblichen PC übertragen. Schon fantastisch, was heutzutage möglich ist, was? Aber es kommt noch besser.«
Er zog ein flaches Gerät hervor, das aussah wie ein Mobiltelefon, klappte es jedoch zu Eisenhardts Verblüffung der Länge nach auf und hielt einen winzigen Computer in der Hand, komplett mit einer zierlichen Tastatur und einem schmalen LCD-Bildschirm. »Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen klein und unauffällig machen, denn die haben das nicht so gern, wenn man in einem Flugzeug mit diesen Dingern hantiert. Aber ich muss Ihnen das jetzt einfach demonstrieren. Ich schreibe hier also meine Meldung, mühsam zwar, aber es geht ganz gut – meine Finger scheinen irgendwie schmaler zu werden, seit ich dieses Teil habe, bemerkenswert, was? Also, was schreiben wir – ›Bekannter deutscher Schriftsteller besucht Israel‹. Das ist die Überschrift. Dann ein bisschen Blabla; ich schätze, ich kriege nicht mehr als zehn, zwölf Zeilen, aber zusammen mit dem Bild …« In Gedanken schien er schon sein Honorar auszurechnen. Konzentriert tippte er einen kurzen Text; Eisenhardt schaute ihm über die Schulter, aber der Journalist arbeitete mit einer hebräischen Textverarbeitung, sodass Eisenhardt nicht erkennen konnte, was er schrieb. Den Zusammenhang zwischen den lateinisch beschrifteten Tasten und dem hebräischen Alphabet schien Liebermann auswendig zu beherrschen, und es war faszinierend, die Textzeilen von rechts nach links wandern zu sehen anstatt umgekehrt, wie der Schriftsteller es gewohnt war.
»So«, machte er schließlich. »Nun laden wir das Bild dazu …« Er zog ein kleines Kabel aus seiner anscheinend universell ausgestatteten Umhängetasche hervor, stöpselte es in die Kamera, drückte hier ein paar Knöpfe und ein paar Tasten auf seinem Mobiltelefon-PC, wartete ein paar Augenblicke und zog das Kabel zufrieden wieder ab. »Fertig. Normalerweise könnte ich das jetzt komplett aus der Hand versenden, direkt in den Hauptcomputer meiner Redaktion, aber hier an Bord geht das natürlich nicht; wahrscheinlich würden wir abstürzen oder, noch schlimmer, versehentlich in Libyen landen, haha! Aber ich frage die Stewardess, ob ich die Telefonanlage des Flugzeugs verwenden kann, normalerweise ist das kein Problem. Moment …«
Eisenhardt sah ihm verblüfft nach, wie er mit einem anderen Kabel und seinem PC in der Hand nach vorn marschierte und hinter dem Vorhang zur Bordküche begann, auf eine der Stewardessen einzureden. Dann verschwanden beide, und eine Weile geschah nichts.
Eisenhardt sah aus dem Fenster. Wolkenfetzen zogen vorbei. Das da unten, war das die Toscana? Oder erst die Po-Ebene? Ein grünbraunes Mosaik von Feldern, dazwischen spinnendünn Straßen und Wege. Und dunkel schimmernd das Meer.
Uri Liebermann kehrte grinsend zurück. »Na, wer sagt’s denn. Es hat geklappt. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie sich schon in der Zeitung, wenn wir landen … Nein, das ist übertrieben. Es kommt in der Abendausgabe. Wenn Sie in Ihr Hotel kommen, schauen Sie mal die hebräischen Zeitungen dort durch.«
»Sie machen Witze.«
»Nein, ehrlich! Gut, normalerweise hätte ich es mit dieser Meldung nicht so eilig gehabt. Klar. Aber wenn etwas Dramatisches passiert, in Bonn sich ein Minister negativ über Israel äußert – ich tippe seine Worte direkt hier in meine kleine Wunderbox, drücke auf den Knopf, und wenn es optimal läuft, liegt die Zeitung mit meinem Bericht vier Stunden später in Israel an den Kiosken.«
»Vier Stunden?«
»Vier Stunden. Und wir reden von einer ganz normalen Nachricht, wohlgemerkt. Wenn etwas wirklich Wichtiges passiert, geht es noch schneller.«
»Unvorstellbar.« Eisenhardt war ehrlich beeindruckt.
»Prüfen Sie’s nach.«
»Ganz bestimmt. Auch wenn ich den Aufwand, ehrlich gesagt, ziemlich verrückt finde.«
Liebermann lachte. »Willkommen in Israel! Glauben Sie mir, die Israelis sind völlig meshuga, was Nachrichten anbelangt. Sie hören ständig Radio, schauen jeden Abend die Nachrichten im Fernsehen, meistens auch noch die im Jordanischen, im Ägyptischen und im Syrischen, und lesen dreimal am Tag Zeitung. Und nicht nur die Juden, die Palästinenser genauso. Und man redet ständig über die schlechten Nachrichten, regt sich auf, jede Menge Leute kriegen Herzanfälle davon. Es ist eine Manie; das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das ist Israel!«
Das war also Israel. Der Flughafen David Ben Gurion sah auf den ersten Blick aus wie jeder x-beliebige Flughafen in irgendeinem Mittelmeerland: groß, lichtdurchflutet, heiß und voller Menschen. Auf den zweiten Blick fielen Eisenhardt die Beschriftungen auf, die durchgehend dreisprachig gehalten 52 waren, in Hebräisch, Englisch und Arabisch, die Soldaten überall, die wachsam eine Hand auf der umgehängten Maschinenpistole hatten. Irgendwann war Liebermann verschwunden, und Eisenhardt ließ sich im Menschenstrom mittreiben, durch die Nerven aufreibend gründlichen Kontrollen, die in seinem Koffer absolutes Chaos hinterließen, und schließlich hinaus aus dem Flughafengebäude unter den wolkenlosen Himmel Tel Avivs. Hinter Absperrgittern drängten sich Menschen, die jedes Gesicht mit spannungsvoller Erwartung studierten. Ab und zu gab es Aufschreie, und dann lagen sich Wartende und Neuankömmlinge über das Gitter hinweg in den Armen, hörte man Shalom oder Salam alaikum, Lachen und Weinen. Eisenhardt kam sich etwas verloren vor.
Dann entdeckte er ein Pappschild, das jemand hinter den Reihen der Wartenden über die Köpfe hielt, mit seinem Namen darauf, wenn auch ohne das d-t am Schluss: nur Eisenhart. Er ging darauf zu. Der Mann, der das Schild hielt, war ein verschrumpelter alter Mann, der eine schäbige graue Hose von der Art trug, wie sie in den 60er Jahren einmal modern gewesen sein musste, und dazu ein unaussprechlich scheußliches buntes Hemd mit ausgeprägten Schweißflecken unter den Achseln.
Als Eisenhardt sich zu erkennen gab, nickte der Mann ohne besondere Begeisterung, nuschelte seinen Namen, den Eisenhardt nicht verstand, und erklärte, er sei beauftragt, ihn zu Mister Kaun zu bringen. Er sprach Deutsch mit einem harten, osteuropäisch klingenden Akzent, und aus der Nähe sah er noch älter aus als vorhin.
Eisenhardt folgte ihm über den Parkplatz des Flughafens zu einem Taxi. Auf dem Armaturenbrett klebte ein Aufkleber, der die polnische Flagge zeigte.
»Sie kommen aus Polen?«, fragte Eisenhardt, als sie über breite Straßen durch eine wüstenartige Landschaft kurvten und der Flughafen hinter ihnen zurückblieb.
»Ja. Aus Krakau. Aber das ist lange her.«
»Sie sprechen gut Deutsch.«
Das Gesicht des Fahrers blieb unbewegt. »Das habe ich im KZ gelernt.«
Eisenhardt schluckte unbehaglich, und es fiel ihm nichts ein, was er darauf hätte sagen können. Er sah aus dem Fenster. Das war also Israel.
5
Nach dem Abtragen der soeben erwähnten, 2 m starken oberen Schicht erreichte man die Höhe +/– 0.00 m. Auf diesem Niveau wurde das Ausgrabungsgelände in ein 5 × 5-m-Gitter mit 1-m-Schnitten eingeteilt, wobei die Gitterlinien der Nord-Süd-Achse folgten (siehe Abb. II.29).
Im nördlichen Teil erfolgte die Grabung zwischen F.20 und F.13 (Feld GL; Abb. II.30 – siehe hierzu Fotos im Anhang H) in einem ersten Arbeitsgang. Im Schnitt zwischen F.20 und F.19 zeigte sich eine in ostwestlicher Richtung verlaufende Mauerflucht aus behauenen Steinen, die eine Begrenzung der Friedhofsanlage darzustellen scheint (w).
Prof. Charles Wilford-SmithBericht über die Ausgrabungen bei Bet Hamesh
Stephen und Judith schlenderten zwischen den Zelten der Grabungshelfer zum Parkplatz hinunter. Das Taxi war inzwischen vor den Wohnwagen zum Stehen gekommen, und der kleine weiße Mitsubishi von Judiths Bruder rumpelte eben von der erbarmungswürdigen Schotterstraße herunter. Yehoshuah winkte ihnen schon durch die Windschutzscheibe zu.
»Pünktlich, dass man die Uhr nach ihm stellen könnte«, meinte Judith. »Ich frage mich, wie er das immer schafft.«
»Hmm«, machte Stephen. Zwei Männer stiegen aus dem Taxi aus, ein blasser Mann Ende dreißig mit leichtem Bauchansatz und schütter werdendem Haar, der sich ratlos umsah, als wisse er nicht so recht, wie er hierher geraten sei, und der Fahrer, ein gebückter alter Mann, der derweil einen Koffer und eine Umhängetasche aus dem Kofferraum wuchtete. Und der Neuankömmling schien etwas Besonderes zu sein, denn sowohl Professor Wilford-Smith als auch John Kaun ließen sich blicken und kamen ihm entgegen, um ihn zu begrüßen.
Yehoshuah bremste knirschend unmittelbar vor ihnen, sprang aus dem Auto und reichte Stephen quer über das staubige Autodach hinweg die Hand. Er war ein großer, schlaksiger Mann mit dem krausen dunklen Haar der Sabras, der in Israel geborenen Juden. »Schön, dich mal wieder zu sehen. Na, gut eingelebt hier? Wie ich höre, hast du ja schon die ersten Aufsehen erregenden Funde gemacht.«
»Ja«, meinte Stephen geistesabwesend und deutete mit einem Kopfnicken zum Taxi hinüber. »Sag mal, weißt du, wer das ist?«
Yehoshuah starrte mit geradezu peinlicher Direktheit in die angegebene Richtung. Als Detektiv wäre er eine Pleite gewesen. »Nein, keine Ahnung. Wieso fragst du?«
»Ich kenne das Gesicht irgendwoher. Ich komme bloß nicht darauf, woher.«
Judith warf ihm einen forschenden Blick zu, sagte aber nichts.
»Okay«, sagte Stephen. »Vielleicht komm ich noch drauf. Lasst uns fahren.«
Sie stiegen ein, Judith auf den Rücksitz. Yehoshuah ließ den Motor an und schaltete das Radio ein, in dem ein Sprecher auf Hebräisch etwas verlas, was dem Klang nach Nachrichten sein mochten. Stephen sah noch einmal zu dem Mann hinüber, der einen bemerkenswert schlecht sitzenden Anzug trug und gerade aufmerksam nickend zuhörte, während Professor Wilford-Smith ihm mit seiner typisch britisch anmutenden sparsamen Gestik etwas zu erklären schien. Er kannte diesen Mann, hatte sein Gesicht schon einmal irgendwo gesehen, aber wo? Normalerweise konnte er sich auf sein Personengedächtnis verlassen, und es irritierte ihn, dass es ihn diesmal im Stich zu lassen schien. Begegnet war er ihm noch nie, daran hätte er sich erinnert. Er hatte dieses Gesicht irgendwo abgebildet gesehen. Egal, dachte er, als der Wagen anfuhr. Es würde ihm irgendwann einfallen, wenn es wichtig war.
Peter Eisenhardt nickte zu allem, was ihm der Professor in jenem behäbigen, unweigerlich blasiert und hochnäsig wirkenden Englisch der britischen Oberklasse erklärte. Manche Ausdrücke verstand er nicht so recht, sein Englisch war reichlich eingerostet inzwischen! Eine Ausgrabungsstätte war das hier also. Darum sah wohl alles so vorläufig und unordentlich aus. Eisenhardt hatte zuerst an ein Trainingscamp irgendwelcher Rebellenmilizen gedacht, dann an Außendreharbeiten eines Spielfilms.
Die Fahrt war enorm irritierend gewesen. Sie waren auf der Straße von Tel Aviv nach Jerusalem unterwegs gewesen, als der Fahrer urplötzlich, an einer völlig unscheinbaren Einmündung, während hinten ein Sportwagen drängelte und hupte und ihnen auf der Gegenfahrbahn ein Tanklastzug entgegengedonnert kam, abbog auf eine Katastrophe von Schotterpiste, die über Kilometer hinweg ins Niemandsland zu führen schien. Und während sie so dahinrüttelten und der alte Mann leise auf Polnisch etwas vor sich hinmurmelte, das wie Flüche und Verwünschungen klang, wuchsen in Eisenhardts Vorstellung die wildesten Fantasien. Von Räubern und Wegelagerern und Strauchdieben, von einem üblen Komplott, und ihm fiel siedendheiß ein, dass er keinerlei Adresse hatte zurücklassen können, weil niemand gewusst hatte, wohin in Israel ihn dieser sagenhafte John Kaun eigentlich bestellt hatte. Er sah sich schon elend im Straßengraben liegen, ermordet und ausgeraubt, womöglich die Schreibhand abgehackt, weil er in einem seiner Bücher versehentlich etwas geschrieben hatte, das ihm irgendeine fanatische Religionsgemeinschaft als böswillige Gotteslästerung ankreidete. Und Uri Liebermann würde herbeieilen, seine handliche Mobiltelefon-PCR-Kombination zücken und die nächste Schlagzeile, den nächsten Bericht eintippen. Der dann vermutlich schon in der Morgenausgabe erscheinen würde.
Irgendwann, als die Straße schon weit zurücklag und ringsum nur noch flache, steinübersäte Berge zu sehen waren, fügte er sich schließlich in sein Schicksal, wagte es, wieder zu atmen und die angespannten Schultern sinken zu lassen. Der alte Mann sah eigentlich nicht aus wie ein Fanatiker, wenn er es recht bedachte. Er schien sich hauptsächlich darüber Sorgen zu machen, wie sein Taxi die Fahrt über die schlaglochreiche Strecke überstehen würde.
Dann waren sie noch einmal abgebogen und auf das Lager zugefahren, dessen Zelte und Fahrzeuge in der sinkenden Sonne lange, wunderliche Schatten warfen.
Gerade als der Professor von den freiwilligen Ausgrabungshelfern sprach und der Rolle, die sie für die Archäologie in Israel spielten, stiegen zwei davon, ein Junge und ein Mädchen, in das weiße Auto, das irgendwann hinter ihnen aufgetaucht und immer näher herangekommen war. Was die Fantasie des Schriftstellers natürlich noch einmal angeheizt hatte. Der junge Mann schaute neugierig zu ihnen herüber, als sie losfuhren.
»Bei aller wissenschaftlichen Neugier und allem Engagement«, kommentierte der weißhaarige Archäologe, »bleiben es natürlich junge Leute. Ich nehme an, sie fahren nach Tel Aviv in eine der Diskotheken.«
Eisenhardt nickte verstehend. Obwohl er auf die vierzig zuging, kam es ihm noch immer befremdlich vor, von anderen als »jungen Leuten« zu sprechen in einem Ton, als gehöre er selber nicht mehr dazu.
John Kaun, der sich nach der ersten Begrüßung kurz zurückgezogen hatte, um einem Mitarbeiter sotto voce eine Reihe von Anweisungen zu erteilen, stieß wieder zu ihnen, seine Selbstsicherheit wie eine Bugwelle vor sich herschiebend. Er war nicht der Mann, irgendwo danebenzustehen und zuzuhören, das war unmissverständlich. Wem immer er sich zuwandte, musste ihn als den Mittelpunkt des Gesprächs akzeptieren, oder er machte sich einen Feind. Einen mächtigen, gefährlichen Feind. Das Auftreten des Medienmagnaten war mehr als selbstsicher, es war auf eine Weise aggressiv, die klarmachte, dass dieser Mann die Welt erobern wollte, mehr noch, erobern würde. Eisenhardt begriff plötzlich mit unvermuteter Klarheit, was der Begriff des »Killerinstinktes« bedeutete, von dem er bisweilen gelesen hatte. Dieser Mann hatte einen Killerinstinkt. Selbst die zuvorkommende Art, die er Eisenhardt gegenüber an den Tag legte, wirkte wohlberechnet; sie signalisierte auf eine subtile Weise gleichzeitig, dass er besser bereitwilliges Wohlverhalten an den Tag legte, denn mit genau der gleichen Berechnung würde Kaun ihn zerquetschen, wenn es notwendig oder seinen Zwecken dienlicher sein würde.
»Ich hoffe, Sie vergeben mir, dass ich noch nichts von Ihnen gelesen habe«, meinte er mit einem Lächeln, an dem seine Augen nicht beteiligt waren. »Leider verstehe ich kein Deutsch. Aber ich habe mir den Inhalt Ihrer Romane erzählen lassen. Und es klang sehr interessant.«
Und zu Eisenhardts Verblüffung gab der Vorstandsvorsitzende eine kurze, prägnante Zusammenfassung jedes einzelnen Romans wieder, besser, als er das selber gekonnt hätte. »Wirklich schade, dass ich sie nicht lesen kann«, schloss er. »Wenn wir dieses Abenteuer hier – erfolgreich, hoffentlich – abgeschlossen haben, werde ich dem Verlag vorschlagen, eine englische Lizenzausgabe herauszubringen, was halten Sie davon?«
»Oh«, konnte Eisenhardt nur nach Luft schnappen. »Ich denke … das wäre großartig.« Das waren ja überaus interessante Perspektiven! Dumpf begriff er zwar, dass der Mann das womöglich nur gesagt hatte, um ihn zu ködern, um ihn zu motivieren, seine bestmögliche Leistung zu erbringen, bei was auch immer er hier tun sollte … Aber bei Gott, das hatte er geschafft!
»Ich könnte mir vorstellen«, fuhr Kaun fort, »dass Sie sich seit dem Anruf meiner Sekretärin fragen, wozu Sie hier sind und was ich von Ihnen will.«
Eisenhardt nickte. »Ja. Richtig.«
»Ich will Sie nicht mehr lange auf die Folter spannen. Dass ich es bis jetzt musste, hatte seinen Grund darin, dass wir es hier mit einer Angelegenheit zu tun haben, die vorläufig strengste Geheimhaltung erfordert. Meine Sekretärin weiß also wirklich nicht, worum es geht.« Ein Haifischlächeln zuckte über seinen schmallippigen Mund.
»Ich verstehe.« Ewigkeiten, seit er eine Unterhaltung auf Englisch bestritten hatte. Zum Glück verstand er den Amerikaner ziemlich gut, und große Redebeiträge schien man ja vorläufig nicht von ihm zu erwarten.
»Was ich brauchte, um es geradeheraus zu sagen, war ein Science-Fiction-Schriftsteller. Ein Science-Fiction-Mind, um genau zu sein. Und da Sie einer der Besten auf Ihrem Gebiet sind, war unsere Wahl klar. Ich freue mich aufrichtig, dass Sie es einrichten konnten.«
Peter Eisenhardt verzog das Gesicht zu einem schmerzhaften Grinsen. Das war jetzt doch etwas deftig, und es zeigte, dass Kaun von Science-Fiction absolut keine Ahnung haben konnte.