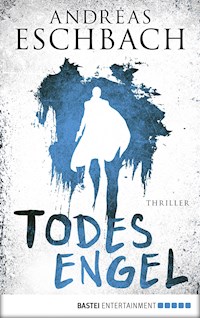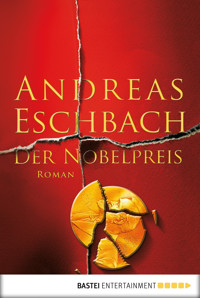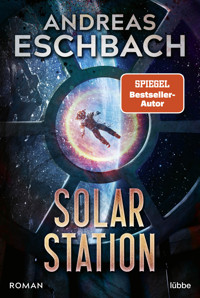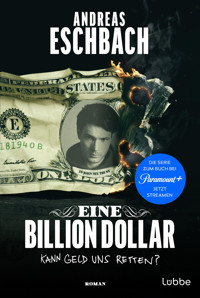
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor, du wirst über Nacht zum reichsten Menschen der Welt...
John Salvatore Fontanelli ist ein armer Schlucker, bis er eine unglaubliche Erbschaft macht: ein Vermögen, das ein entfernter Vorfahr im 16. Jahrhundert hinterlassen hat und das durch Zins und Zinseszins in fast 500 Jahren auf über eine Billion Dollar angewachsen ist. Der Erbe dieses Vermögens, so heißt es im Testament, werde einst der Menschheit die verlorene Zukunft wiedergeben. John tritt das Erbe an. Er legt sich Leibwächter zu, verhandelt mit Ministern und Kardinälen. Die schönsten Frauen liegen ihm zu Füßen. Aber kann er noch jemandem trauen? Und dann erhält er einen Anruf von einem geheimnisvollen Fremden, der zu wissen behauptet, was es mit dem Erbe auf sich hat ...
Mit "Eine Billion Dollar" hat Bestsellerautor Andreas Eschbach einen spannenden Thriller über Moral und Habgier geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1196
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Zitat
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Danksagungen und Anmerkungen
Über den Autor
Andreas Eschbach, 1959 in Ulm geboren, studierte Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstellerisch hochbegabten Nachwuchs« schrieb er seinen ersten Roman DIE HAARTEPPICHKNÜPFER. Bekannt wurde er durch den Thriller DAS JESUS-VIDEO. Mit EINE BILLION DOLLAR (2001) stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Autoren auf. Es folgten u.a. Bestseller wie AUSGEBRANNT (2007), HERR ALLER DINGE (2010) und TODESENGEL (2013). Andreas Eschbach lebt heute als freier Schriftsteller in der Bretagne.
Weitere Infos zum Autor unter www.andreaseschbach.com
Andreas Eschbach
Eine BillionDollar
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2001 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München nach einer Vorlage von © 2023 Viacom International Inc. All Rights Reserved.
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0057-1
luebbe.de
lesejury.de
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Redaktion: Stefan Bauer
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Motiven © Oz Guney/shutterstock.com
Demokratie ist die schlechteste Regierungsform –mit Ausnahme aller anderen,die wir bis jetzt ausprobiert haben.
Winston Churchill
PROLOG
ENDLICH ÖFFNETEN SICH zwei Türflügel vor ihnen, und sie betraten einen von geradezu überirdischem Licht erfüllten Raum. Ein großer, ovaler Tisch aus dunklem Holz beherrschte seine Mitte, davor standen zwei Männer und sahen ihnen erwartungsvoll entgegen.
»Mister Fontanelli, ich darf Ihnen meine Partner vorstellen«, meinte der junge Anwalt, nachdem er die Türen hinter ihnen geschlossen hatte. »Zunächst meinen Vater, Gregorio Vacchi.«
John schüttelte die Hand eines streng dreinblickenden, etwa fünfundfünfzigjährigen Mannes, der einen grauen, einreihigen Anzug trug und eine Brille mit schmalem Goldrand und der mit seinem dünn werdenden Haar etwas von einem Buchhalter an sich hatte. Man konnte ihn sich als Anwalt für Steuerfragen vorstellen, vor den Schranken eines Verwaltungsgerichts mit dünnlippigem Mund trockene Paragrafen aus dem Handelsrecht zitierend. Sein Händedruck fühlte sich kühl an, geschäftsmäßig, und er murmelte etwas von »erfreut, Sie kennen zu lernen«, wobei man nicht den Eindruck hatte, dass er wusste, was das hieß: sich zu freuen.
Der andere Mann war wohl noch etwas älter, wirkte aber mit seinem vollen, lockigen Haar und seinen buschigen Augenbrauen, die seinem Gesichtsausdruck etwas Düsteres verliehen, wesentlich vitaler. Er trug einen Zweireiher, dunkelblau, mit einer streng konventionellen Klubkrawatte und einem formvollendet gesteckten Kavalierstuch. Ihn konnte man sich vorstellen, wie er, ein Glas Champagner in der Hand, in einer Edelkneipe den Sieg in einem aufsehenerregenden Mordprozess feierte und zu vorgerückter Stunde Kellnerinnen lachend in den Hintern zwickte. Sein Händedruck war fest, und er sah John fast unangenehm tief in die Augen, als er sich mit dunkler Stimme vorstellte: »Alberto Vacchi. Ich bin Eduardos Onkel.«
Erst jetzt bemerkte John, dass in einem ausladenden Ohrensessel vor einem der Fenster noch jemand saß – ein alter Mann, der die Augen geschlossen hielt, aber nicht so wirkte, als schlafe er wirklich. Eher, als sei er zu erschöpft, um sich allen Sinnen aussetzen zu können. Sein faltiger Hals ragte mager aus dem weichen Kragen eines Hemdes, über dem er eine graue Strickweste trug. Auf dem Schoß hatte er ein kleines Samtkissen liegen, auf dem wiederum seine gefalteten Hände ruhten.
»Der Padrone«, sagte Eduardo Vacchi leise, der Johns Blick bemerkt hatte. »Mein Großvater. Wie Sie sehen, sind wir ein Familienunternehmen.«
John nickte nur, wusste nicht, was er sagen sollte. Er ließ sich zu einem Stuhl dirigieren, der einsam an der einen Breitseite des Konferenztisches stand, und folgte der Einladung einer Hand, sich zu setzen. Auf der gegenüberliegenden Tischseite standen vier Stühle nebeneinander, die Lehnen ordentlich an die Tischkante gerückt, und auf den Plätzen vor diesen Lehnen lagen dünne Aktenmappen aus schwarzem Leder, in das ein Wappen geprägt war.
»Wollen Sie etwas trinken?«, wurde er gefragt. »Kaffee? Mineralwasser?«
»Kaffee, bitte«, hörte John sich sagen. In seinem Brustkorb rührte sich wieder jenes flatternde Gefühl, das aufgetaucht war, als er die Halle des Waldorf-Astoria-Hotels betreten hatte.
Eduardo verteilte Kaffeetassen, die auf einem kleinen fahrbaren Beistelltisch ordentlich aufgestellt bereitstanden, stellte Sahnekännchen und Zuckerstreuer aus getriebenem Silber dazu, schenkte überall ein und stellte die Kanne neben Johns Tasse ab. Die drei Vacchis nahmen Platz, Eduardo auf der Seite, die von John aus gesehen rechts lag, Gregorio, der Vater, neben ihm, und Alberto, der Onkel, wiederum neben diesem. Der vierte Platz, ganz links, blieb leer.
Ein allgemeines Sahneeingießen, Zuckerstreuen und Kaffeeumrühren setzte ein. John starrte auf die wunderbare, mahagonirote Maserung der Tischplatte. Das musste Wurzelholz sein. Während er seinen Kaffee umrührte, mit einem schweren, silbernen Kaffeelöffel, versuchte er, sich unauffällig umzusehen.
Durch die Fenster hinter den drei Anwälten ging der Blick weit hinaus über ein helles, flirrendes New York, in dessen Schluchten das Sonnenlicht tanzte, und auf einen East River, der in tiefem, hellgesprenkeltem Blau glänzte. Rechts und links der Fenster fielen duftige, lachsfarbene Vorhänge herab, die einen vollendeten Kontrast zu dem schweren, makellos dunkelroten Teppichboden und den schneeweißen Wänden bildeten. Unglaublich. John nippte an seinem Kaffee, der stark und aromatisch schmeckte, eher wie der Espresso, den ihm seine Mutter manchmal machte.
Eduardo Vacchi öffnete die Mappe, die vor ihm lag, und das verhaltene Geräusch, das das Leder des Einbands auf der Tischplatte machte, klang wie ein Signal. John stellte seine Tasse zurück und holte noch einmal Luft. Es ging los.
»Mister Fontanelli«, begann der junge Anwalt und beugte sich dabei leicht vor, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, die Hände gefaltet. Sein Tonfall war jetzt nicht mehr verbindlich, sondern sozusagen amtlich. »Ich hatte Sie gebeten, einen Identitätsnachweis zu diesem Gespräch mitzubringen – Führerschein, Reisepass oder dergleichen –, nur der Form halber, versteht sich.«
John nickte. »Mein Führerschein. Moment.« Er griff hastig in seine Gesäßtasche, erschrak, als er nichts fand, bis ihm einfiel, dass er den Führerschein in die Innentasche seines Jacketts gesteckt hatte. Mit heißen, beinahe bebenden Fingern reichte er das Papier über den Tisch. Der Anwalt nahm den Führerschein entgegen, musterte ihn flüchtig und reichte ihn dann mit einem Kopfnicken an seinen Vater weiter, der ihn im Gegensatz dazu so eingehend studierte, als sei er überzeugt, es mit einer Fälschung zu tun zu haben.
Eduardo lächelte leicht. »Auch wir haben einen Identitätsnachweis dabei.« Er zog zwei große, äußerst amtlich aussehende Papiere hervor. »Die Familie Vacchi ist seit mehreren Jahrhunderten in Florenz ansässig, und fast alle männlichen Mitglieder dieser Familie sind seit Generationen als Rechtsanwälte und Vermögensverwalter tätig. Das erste Dokument bestätigt dies; das zweite ist eine englische Übersetzung des ersten Dokuments, beglaubigt vom Staate New York.« Er reichte John die beiden Papiere, der sie ratlos musterte. Das eine, eingelegt in eine Klarsichthülle, schien ziemlich alt zu sein. Ein italienischer Text, von dem John nur jedes zehnte Wort verstand, war mit Schreibmaschine auf ergrautes, wappengeprägtes Papier getippt, und zahllose ausgeblichene Stempel und Unterschriften drängten sich darunter. Die englische Übersetzung, ein sauberer Laser-Ausdruck, versehen mit einer Gebührenmarke und einem notariellen Stempel, klang verwirrend und ziemlich juristisch, und soweit John sie verstand, bestätigte sie, was der junge Vacchi gesagt hatte.
Er legte beide Urkunden vor sich hin, verschränkte die Arme. Einer seiner Nasenflügel zuckte; hoffentlich sah man das nicht.
Wieder faltete Eduardo die Hände. Johns Führerschein war inzwischen bei Alberto angelangt, der ihn wohlwollend nickend betrachtete und dann bedächtig in die Mitte des Tisches schob.
»Mister Fontanelli, Sie sind Erbe eines beträchtlichen Vermögens«, begann Eduardo erneut, wieder in förmlichem Ton. »Wir sind hier, um Ihnen die Höhe der betreffenden Summe und die Randbedingungen des Erbes mitzuteilen und, falls Sie sich bereit erklären, das Erbe anzutreten, mit Ihnen die Schritte zu besprechen, die für die Eigentumsübertragung notwendig sind.«
John nickte ungeduldig. »Ähm, ja – könnten Sie mir zuerst mal sagen, wer überhaupt gestorben ist?«
»Wenn Sie gestatten, möchte ich die Antwort auf diese Frage noch einen Moment zurückstellen. Es ist eine längere Geschichte. Jedenfalls ist es niemand aus Ihrer unmittelbaren Verwandtschaft.«
»Und wieso erbe ich dann etwas?«
»Das lässt sich, wie gesagt, nicht in ein oder zwei Sätzen erklären. Deswegen bitte ich Sie, sich noch zu gedulden. Im Moment ist die Frage: Sie sollen eine beträchtliche Menge Geld erhalten – wollen Sie es haben?«
John musste unwillkürlich auflachen. »Okay. Wie viel?«
»Über achtzigtausend Dollar.«
»Sagten Sie achtzigtausend?«
»Ja. Achtzigtausend.«
Mann! John lehnte sich zurück, atmete pfeifend aus. Puh. Mann, o Mann. Acht-zig-tau-send! Kein Wunder, dass sie vier Mann hoch angereist waren. Achtzigtausend Dollar, das war eine ordentliche Summe. Wie viel war denn das? Auf einen Schlag! Mann, Mann! Auf einen Schlag, das musste man erst einmal verdauen. Das hieß … Mann, das hieß, er konnte aufs College gehen, locker konnte er das, ohne auch nur noch eine blöde Stunde bei irgendeinem blöden Pizzaservice oder sonst wo jobben zu müssen. Achtzigtausend … Mann, auf einen Schlag! Einfach so! Unglaublich. Wenn er … Okay, er musste aufpassen, dass ihn nicht der Größenwahn befiel. Er konnte in der Wohngemeinschaft bleiben, die war okay, nicht luxuriös, aber wenn er sparsam lebte – Mann, es würde noch für einen Gebrauchtwagen reichen! Dazu ein paar gute Klamotten. Dies und das. Ha! Und keine Sorgen mehr.
»Nicht schlecht«, brachte er schließlich heraus. »Und was wollen Sie jetzt von mir wissen? Ob ich das Geld nehme oder nicht?«
»Ja.«
»Mal ’ne ganz dumme Frage: Ist denn ein Haken bei der Sache? Erbe ich irgendwelche Schulden mit oder so was?«
»Nein. Sie erben Geld. Wenn Sie zustimmen, erhalten Sie das Geld und können damit machen, was Sie wollen.«
John schüttelte fassungslos den Kopf. »Können Sie sich vorstellen, dass ich dazu Nein sage? Können Sie sich vorstellen, dass irgendjemand dazu Nein sagt?«
Der junge Anwalt hob die Hände. »Es ist eine Formvorschrift. Wir müssen fragen.«
»Ah. Okay. Sie haben gefragt. Und ich sage Ja.«
»Schön. Meinen Glückwunsch.«
John zuckte mit den Schultern. »Wissen Sie, ich glaub’s sowieso erst, wenn ich die Scheine in den Händen halte.«
»Das ist Ihr gutes Recht.«
Aber es stimmte nicht: Er glaubte es jetzt schon. Obwohl es so absolut verrückt war, mehr als wahnwitzig – vier Anwälte kamen von Italien nach New York gejettet, um ihm, dem mittellosen, unbegabten Pizza-Ausfahrer, achtzigtausend Dollar zu schenken – einfach so, mir nichts, dir nichts –, glaubte er es. Es war etwas in diesem Raum, das ihn sicher machte. Sicher, an einem Wendepunkt in seinem Leben zu stehen. Es war, als habe er sein Leben lang darauf gewartet, hierher zu kommen. Verrückt. Er spürte eine wohltuende Wärme, die sich in seinem Bauch ausbreitete.
Eduardo Vacchi schloss seine Aktenmappe wieder, und als habe er darauf gewartet, schlug neben ihm sein Vater – wie hieß der noch mal? Gregorio? – die seine auf. John spürte ein Kribbeln im Nacken und hinter den Augenbrauen. Das sah jetzt zu einstudiert aus. Jetzt kam es, das dicke Ende, die große Abzockmasche. Jetzt hieß es aufpassen.
»Aus Gründen, die noch zu erklären sein werden«, begann Eduardos Vater, und seine Stimme klang so teilnahmslos, dass man fast meinte, Staub aus seinem Mund kommen zu sehen, »ist Ihr Fall, Mister Fontanelli, einzigartig in der Geschichte unserer Kanzlei. Obwohl die Vacchis sich seit Generationen mit Vermögensverwaltung befassen, haben wir noch nie ein Gespräch wie das heutige geführt und werden es wohl auch nie wieder führen. In Anbetracht dessen hielten wir es für das Beste, im Zweifelsfall lieber zu vorsichtig als zu sorglos zu sein.« Er nahm seine Brille ab und behielt sie pendelnd in der Hand. »Ein befreundeter Kollege hatte vor einigen Jahren das betrübliche Erlebnis, anlässlich einer Testamentseröffnung einen der Anwesenden einem plötzlichen Herztod erliegen zu sehen, ausgelöst aller Wahrscheinlichkeit nach durch den Schock der freudigen Überraschung, plötzlich Erbe eines bedeutenden Vermögens zu sein. Es hatte sich, das muss hinzugefügt werden, zwar um eine etwas größere Summe gehandelt, als mein Sohn Sie Ihnen eben genannt hat, aber die betreffende Person war nicht wesentlich älter gewesen, als Sie es sind, und bis zu diesem Zeitpunkt hatte man von einer Gefährdung seines Herzens nichts gewusst.« Er setzte die Brille wieder auf, rückte sie sorgsam zurecht und fasste John dann wieder ins Auge. »Sie verstehen, was ich damit sagen will?«
John, der seinem Vortrag nur mit Mühe gefolgt war, nickte automatisch, schüttelte dann aber den Kopf. »Nein. Nein, ich verstehe nichts. Erbe ich jetzt, oder erbe ich nicht?«
»Sie erben, keine Sorge.« Gregorio spähte an seiner Nase entlang auf seine Mappe hinunter, schob mit den Händen Papiere darauf umher. »Alles, was Eduardo Ihnen gesagt hat, stimmt.« Er sah wieder hoch. »Bis auf den Betrag.«
»Bis auf den Betrag?«
»Sie erben nicht achtzigtausend, sondern über vier Millionen Dollar.«
John starrte ihn an, starrte ihn an und hatte das Gefühl, dass die Zeit stehen blieb dabei, starrte ihn an, und das Einzige, das sich bewegte, war sein eigener Unterkiefer, der sich abwärts bewegte, unaufhaltsam, unbeeinflussbar.
Vier!
Millionen!
Dollar!
»Wow!«, entfuhr es ihm. Er griff sich mit den Händen ins Haar, hob den Blick zur Decke hoch und sagte noch mal: »Wow!« Dann fing er an zu lachen. Zerwühlte sich das Haar und lachte wie irrsinnig geworden. Vier Millionen Dollar! Er konnte sich gar nicht beruhigen, lachte, dass die wahrscheinlich schon darüber nachdachten, einen Krankenwagen zu rufen. Vier Millionen! Vier Millionen!
Er sah ihn wieder an, den Anwalt aus dem fernen Florenz. Das Licht des Frühlings ließ sein schütteres Haar aussehen wie einen Heiligenschein. Er hätte ihn küssen können. Er hätte sie alle küssen können. Kamen daher und legten ihm vier Millionen Dollar in den Schoß! Er lachte wieder, lachte und lachte.
»Wow!«, sagte er noch einmal, als er wieder zu Atem kam. »Ich verstehe. Sie hatten Angst, dass mich der Schlag trifft, wenn Sie mir aus dem Stand heraus sagen, dass ich vier Millionen geerbt habe, richtig?«
»So könnte man es ausdrücken«, nickte Gregorio Vacchi mit der Andeutung eines Lächelns um die Mundwinkel.
»Und wissen Sie was? Sie haben Recht. Mich hätte der Schlag getroffen. Oh, Mann …« Er schlug die Hand vor den Mund, wusste gar nicht, wohin mit seinem Blick. »Wissen Sie, dass ich vorgestern die schrecklichste Nacht meines Lebens hatte – und nur, weil mir das Geld für die U-Bahn fehlte? Ein lausiger Dollar, lausige fünfundzwanzig Cent? Und jetzt kommen Sie und reden von vier Millionen …«
Puh. Puh, puh, puh. Weiß Gott, das war nicht gelogen mit dem Herzschlag. Sein Herz raste. Die bloße Vorstellung von Geld ließ seinen Kreislauf toben, als habe er Sex.
Vier Millionen Dollar. Das war … Das war mehr als nur Geld. Das war ein anderes Leben. Mit vier Millionen Dollar konnte er machen, was er wollte. Mit vier Millionen Dollar brauchte er keinen Tag seines Lebens mehr zu arbeiten. Ob er studierte oder nicht, ob er der beschissenste Maler der Welt war oder nicht, es spielte keine Rolle.
»Und das ist wirklich wahr?«, musste er plötzlich fragen. »Ich meine, es taucht nicht plötzlich jemand auf und sagt: ›Ätsch, Sie sind in der Versteckten Kamera!‹, oder so was? Wir reden von richtigem Geld, von einer richtigen Erbschaft?«
Der Anwalt hob seine Augenbrauen, als sei diese Vorstellung für ihn der Inbegriff des Absurden. »Wir reden von richtigem Geld. Keine Sorge.«
»Ich meine, wenn Sie mich hier verarschen, werde ich jemanden erwürgen. Und ich weiß nicht, ob das den Zuschauern der ›Versteckten Kamera‹ gefällt.«
»Ich kann Ihnen versichern, wir sind ausschließlich zu dem Zweck hier, Sie zu einem reichen Mann zu machen.«
»Schön.« Es war nicht so, dass er sich tatsächlich Sorgen gemacht hätte. Aber das war ein Gedanke gewesen, den er hatte loswerden müssen, gerade so, als könne durch das bloße Aussprechen die Gefahr gebannt werden. Irgendetwas ließ ihn wissen, dass er nicht belogen wurde.
Es war heiß hier drinnen. Merkwürdig – als sie hereingekommen waren, hatte er den Raum als kühl empfunden, als zu niedrig klimatisiert. Jetzt war ihm, als müsse das Blut in seinen Adern jeden Moment anfangen zu kochen. Ob er Fieber hatte? Vielleicht eine Nachwirkung eben jener vorletzten Nacht, als er zu Fuß über die Brooklyn Bridge nach Hause marschiert war, durch einen feuchten, kalten Wind vom Meer her, der ihn zum Eiszapfen hatte werden lassen.
Er sah an sich herab. Seine Jeans schienen plötzlich schäbig geworden zu sein, sein Jackett – die Enden der Ärmel waren abgewetzt; das war ihm bisher nie aufgefallen. Der Stoff begann fadenscheinig zu werden. Und sein Hemd war ärmlich, ein billiger Lumpen aus dem Trödelladen. Nicht einmal als es neu gewesen war, hatte es richtig gut ausgesehen. Ramsch. Tand. Er fing einen Blick Eduardos auf, der leise lächelte, als errate er seine Gedanken.
Die Skyline draußen glitzerte noch immer wie ein Traum aus Glas und Kristall. Er war jetzt also ein gemachter Mann. John Salvatore Fontanelli, Schuhmachersohn aus New Jersey, hatte es geschafft – ohne eigene Leistung, ohne eigenes Dazutun, einfach durch eine Laune des Schicksals. Vielleicht hatte er so etwas immer geahnt und sich deshalb nie groß angestrengt, nie besondere Mühe gegeben? Weil ihm eine Fee an der Wiege geflüstert hatte, dass er das alles nicht nötig haben würde?
»Okay«, rief er und klatschte in die Hände. »Wie geht es weiter?«
»Sie nehmen das Erbe also an?«
»Yes, Sir!«
Der Anwalt nickte zufrieden und klappte seine Aktenmappe wieder zu. John lehnte sich zurück und atmete tief aus. Was für ein Tag! Er fühlte sich wie mit Champagner gefüllt, voller kleiner, lustig blubbernder Bläschen, die aufstiegen und aufstiegen und sich zu einem albernen Kichern im oberen Teil seines Brustkorbs sammelten.
Er war gespannt, wie so eine Erbschaft in der Praxis vor sich ging. Wie er das Geld bekommen würde. Wohl kaum in bar. Per Überweisung würde nicht gehen, da er kein Konto mehr hatte. Vielleicht würde er einen Scheck kriegen. Genau. Und es würde ihm ein Hochgenuss werden, in die Schalterhalle genau der Bank zu spazieren, die ihm sein Konto gekündigt hatte, seinem ehemaligen Kundenbetreuer einen Scheck über vier Millionen Dollar unter die Nase zu halten und abzuwarten, was für ein Gesicht er machen würde. Es würde ein Hochgenuss werden, sich aufzuführen wie ein Schwein, wie das letzte reiche Arschloch …
Jemand räusperte sich. John sah auf, kehrte aus seinen Tagträumen zurück in die Realität des Konferenzraumes. Es war Alberto Vacchi gewesen, der sich geräuspert hatte.
Und er hatte dabei die Aktenmappe aufgeklappt, die vor ihm gelegen hatte.
John sah Eduardo an. Sah Gregorio an, seinen Vater. Sah Alberto an, seinen Onkel. »Sagen Sie jetzt bloß nicht, es ist noch mehr.«
Alberto lachte leise. Es klang wie das Gurren von Tauben. »Doch«, sagte er.
»Mehr als vier Millionen Dollar?«
»Wesentlich mehr.«
Das Wummern seines Herzens fing wieder an. Seine Lunge bildete sich wieder ein, ein Blasebalg zu sein. John hob abwehrend eine Hand. »Warten Sie. Langsam. Vier Millionen war eine ganz gute Zahl. Warum übertreiben? Vier Millionen, das kann einen Mann schon glücklich machen. Mehr wäre … na ja, vielleicht zu viel …«
Der Italiener sah ihn unter seinen buschigen Augenbrauen an. In seinen Augen funkelte ein eigenartiges Licht. »Das ist die einzige Bedingung, die mit dem Erbe verknüpft ist, John. Entweder Sie nehmen alles – oder nichts …«
John schluckte. »Ist es mehr als das Doppelte?«, fragte er hastig, als gelte es einen Fluch zu bannen, indem er dem anderen zuvorkam.
»Wesentlich mehr.«
»Mehr als das Zehnfache? Mehr als vierzig Millionen?«
»John, Sie müssen lernen, in großen Dimensionen zu denken. Das ist nicht leicht, und ich beneide Sie weiß Gott nicht.« Alberto nickte ihm aufmunternd zu, beinahe verschwörerisch, als wolle er ihn ermuntern, ihn in ein verrufenes Haus zu begleiten. »Denken Sie groß, John!«
»Mehr als …?« John hielt inne. In einer Zeitschrift hatte er einmal etwas über das Vermögen der großen Musikstars gelesen. Madonna, so hatte es geheißen, sei an die sechzig Millionen Dollar schwer, Michael Jackson leicht das Doppelte. Die Rangliste angeführt hatte der Ex-Beatle Paul McCartney, dessen Vermögen auf fünfhundert Millionen Dollar geschätzt wurde. Ihm schwindelte. »Mehr als das Zwanzigfache?« Er hatte ›das Hundertfache‹ sagen wollen, es aber nicht gewagt. Anzunehmen, er könne – einfach so, ohne Mühe, ohne Talent – in Besitz eines Vermögens kommen, das an dasjenige einer solchen Legende auch nur heranreichte, hatte etwas von Gotteslästerung an sich.
Einen Moment war Stille. Der Anwalt sah ihn an, kaute dabei auf seiner Lippe und sagte nichts.
»Befreunden Sie sich«, riet er schließlich, »mit der Zahl zwei Milliarden.« Und er fügte hinzu: »Dollar.«
John starrte ihn an, und etwas Schweres, Bleiernes schien sich auf ihn herabzusenken, auf alle Anwesenden. Das war jetzt kein Spaß mehr. Das Sonnenlicht, das durch die Fenster hereinbrach, blendete ihn, schmerzte wie das Licht einer Verhörlampe. Wirklich kein Spaß.
»Das ist Ihr Ernst, nicht wahr?«, fragte er.
Alberto Vacchi nickte.
John sah sich um, fahrig, als suche er einen Ausweg. Milliarden! Die Zahl lastete auf ihm wie ein tonnenschweres Gewicht, drückte seine Schultern herab, presste auf seine Schädeldecke. Milliarden, das waren Dimensionen, in denen er sich noch nicht einmal in seiner Vorstellung je bewegt hatte. Milliarden, das hieß, sich in der Ebene der Rockefellers und Rothschilds, der saudiarabischen Ölscheichs und der japanischen Immobiliengiganten zu befinden. Milliarden, das war mehr als Wohlstand. Das war … Irrsinn.
Sein Herz wummerte immer noch. An seinem rechten Unterschenkel hatte ein Muskel angefangen zu zucken und wollte überhaupt nicht mehr aufhören. Vor allem musste er erst einmal zur Ruhe finden. Das war doch hier ein ganz seltsames Spiel. So was gab es doch nicht, nicht in der Welt, die er kannte! Dass einfach vier Männer auftauchten, von denen er noch nie im Leben gehört hatte, und behaupteten, er habe zwei Milliarden Dollar geerbt? Nein. So funktionierte das nicht. Hier lief irgendein krummes Spiel. Er hatte keine Ahnung, wie eine solche Erbzeremonie normalerweise ablaufen musste, aber das war jedenfalls seltsam.
Er versuchte, sich an Filme zu erinnern, die er gesehen hatte. Verdammt, er hatte doch so viele Filme gesehen, mehr oder weniger seine Jugend vor dem Fernseher und im Kino verbracht – wie war denn das gewesen? Eine Testamentseröffnung, jawohl. Wenn jemand gestorben war, dann gab es eine Testamentseröffnung, zu der alle infrage kommenden Erben zusammenkamen, um dann aus dem Mund eines Notars zu erfahren, wer wie viel erbte. Und sich anschließend zu zanken.
Genau! Wie ging denn das überhaupt vor sich, wenn jemand starb und etwas zu vererben hatte? Die ersten Erben waren doch Ehegatten und Kinder, oder? Wie konnte es angehen, dass er etwas erben sollte und seine Brüder nicht? Und wieso erbte er überhaupt etwas, wenn sein Vater noch lebte?
Irgendetwas stimmte hier nicht.
Sein Herz und seine Atmung schalteten einen Gang zurück. Nur nicht zu früh freuen. Erst mal einen auf misstrauisch machen war angesagt.
John räusperte sich. »Ich muss noch mal ganz dumm fragen«, begann er. »Wieso soll ausgerechnet ich etwas erben? Wie kommen Sie auf mich?«
Der Anwalt nickte ruhig. »Wir haben sehr ausführliche und sehr gründliche Recherchen angestellt. Wir hätten Sie nicht um eine Unterredung gebeten, wenn wir uns unserer Sache nicht hundertprozentig sicher wären.«
»Schön, Sie sind sich sicher. Aber ich nicht. Wissen Sie zum Beispiel, dass ich zwei Brüder habe? Muss ich ein Erbe nicht mit denen teilen?«
»In diesem Fall nicht.«
»Warum nicht?«
»Sie sind als Alleinerbe bezeichnet.«
»Alleinerbe? Wer zum Teufel kommt auf die Idee, ausgerechnet mich als Alleinerben von zwei Milliarden Dollar einzusetzen? Ich meine, mein Vater ist Schuhmacher. Und ich weiß von unserer Verwandtschaft zwar nicht viel, aber ich bin mir sicher, dass sich kein Milliardär darunter befindet. Der reichste Mann dürfte mein Onkel Giuseppe sein, der ein Taxiunternehmen in Neapel besitzt, mit zehn oder zwölf Fahrzeugen.«
»Richtig.« Alberto Vacchi lächelte. »Und der lebt noch und erfreut sich, soweit wir wissen, bester Gesundheit.«
»Also. Wie soll dann so ein Erbe zu Stande kommen?«
»Das klingt, als seien Sie nicht sehr daran interessiert.«
John spürte, dass er allmählich wütend wurde. Er wurde selten wütend, noch seltener richtig wütend, aber hier und heute konnte es gut sein, dass es so weit kam. »Warum weichen Sie mir dauernd aus? Warum machen Sie so ein Geheimnis darum? Warum sagen Sie mir nicht einfach, der und der ist gestorben?«
Der Anwalt blätterte in seinen Papieren, und es sah verdammt noch mal nach einem Ablenkungsmanöver aus. So wie wenn jemand in einem leeren Terminkalender blättert und so tut, als hätte er Mühe, einen freien Termin zu finden.
»Es handelt sich hier«, gab er schließlich zu, »nicht um einen normalen Erbfall. Normalerweise gibt es ein Testament, einen Testamentsvollstrecker und eine Testamentseröffnung. Das Geld, um das es hier geht, ist Eigentum einer Stiftung – in gewisser Weise könnte man sagen, es gehört im Augenblick sich selbst. Wir verwalten es lediglich, seit der Stifter gestorben ist – was schon vor sehr langer Zeit war. Er hat eine Verfügung erlassen, derzufolge das Vermögen der Stiftung auf den jüngsten männlichen Nachfahren übergehen soll, der am 23. April des Jahres 1995 am Leben ist. Und das sind Sie.«
»Der 23. April …« John kniff misstrauisch die Augen zusammen. »Das war vorgestern. Warum ausgerechnet dieser Tag?«
Alberto zuckte mit den Schultern. »Das ist so festgelegt.«
»Und ich soll der jüngste Fontanelli sein? Sind Sie sicher?«
»Ihr Onkel Giuseppe hat eine fünfzehnjährige Tochter. Aber eben eine Tochter. Ein Cousin Ihres Vaters, Romano Fontanelli, hatte einen sechzehnjährigen Sohn, Lorenzo. Der ist jedoch, wie Sie wahrscheinlich wissen, vor zwei Wochen überraschend verstorben.«
John starrte die spiegelnde Wurzelholztischplatte an wie ein Orakel. Es konnte tatsächlich sein. Sein Bruder Cesare und dessen Frau nervten einen bei jedem Weihnachtsfest mit stundenlangen Diskussionen darüber, wie sinnlos, geradezu verbrecherisch es sei, Kinder in diese Welt zu setzen. Und Lino – na ja, der hatte bloß Flugzeuge im Kopf. Und seine Mutter hatte neulich von einem Lorenzo erzählt am Telefon, der gestorben war, an irgendetwas entsetzlich Banalem, einem Bienenstich oder so etwas. Ja, wann immer die Sprache auf die italienische Verwandtschaft gekommen war, war von Hochzeiten und Scheidungen und Krankheiten und Todesfällen die Rede gewesen, nie von Kindern. Es konnte tatsächlich sein.
»Worin bestehen diese zwei Milliarden Dollar eigentlich?«, fragte er schließlich. »Ich nehme an, in irgendwelchen Firmenanteilen, Aktien, Ölquellen und solchem Zeug?«
»Geld«, erwiderte Alberto. »Einfach nur Geld. Unzählige Sparkonten bei unzähligen Banken überall auf der Welt.«
John sah ihn an und hatte ein saures Gefühl im Magen. »Und ich soll das erben, nur weil ich zufällig vor zwei Tagen der jüngste Fontanelli war? Was macht das für einen Sinn?«
Der Anwalt erwiderte seinen Blick, lange und geradezu versonnen. »Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht«, gestand er. »Es ist eben so. Wie vieles im Leben.«
John fühlte sich schwindlig. Schwindlig und schmutzig, zerlumpt, ein Mann in billigen Fetzen, die die Bezeichnung Kleidungsstücke kaum verdienten. Immer noch plapperte eine Stimme in seinem Kopf, die der festen Überzeugung war, dass er hier gelinkt, betrogen, auf irgendeine nicht fassbare Weise übers Ohr gehauen werden sollte. Und immer noch war darunter ein tief in seinem Inneren wurzelndes Gefühl, massiv wie das Granitfundament von Manhattan, dass diese Stimme sich irrte, dass sie nichts weiter war als das Produkt unzähliger Stunden vor dem Fernsehschirm, wo es nie vorkommt, dass den Leuten einfach etwas Gutes widerfährt. Die Dramaturgie des Films lässt so etwas nicht zu. So etwas konnte nur in der Wirklichkeit passieren.
Das Gefühl, das sich eingestellt hatte, als er diesen Raum betreten hatte – das Gefühl, an einem Wendepunkt seines Lebens angekommen zu sein –, war immer noch da, stärker als zuvor.
Nur war jetzt die Angst hinzugetreten, von dieser Wende zermalmt zu werden.
Zwei Milliarden Dollar.
Er konnte sich Geld geben lassen. Wenn sie gekommen waren, um ihm zwei Milliarden Dollar zu vermachen, dann konnten sie ihm vorab ein paar Tausender geben, ohne dass es jemandem wehtat. Dann konnte er sich einen eigenen Anwalt nehmen, der alles genau überprüfen würde. Sein alter Freund Paul Siegel fiel ihm ein. Paul kannte Anwälte. Kannte bestimmt die besten Anwälte der Stadt. Genau. John atmete tief durch.
»Die Frage«, sagte Alberto Vacchi, Anwalt und Vermögensverwalter aus Florenz, Italien, sanft, »ist immer noch dieselbe. Nehmen Sie die Erbschaft an?«
War es gut, reich zu sein? Bisher hatte er sich immer nur angestrengt, nicht allzu arm zu sein. Hatte diejenigen, die dem Geld hinterher waren, verachtet. Andererseits – das Leben war so viel einfacher und angenehmer, wenn man Geld hatte. Kein Geld zu haben hieß, immer in Zugzwang zu sein. Keine Wahl zu haben. Dinge tun zu müssen, egal ob sie einem gefielen oder nicht. Wahrscheinlich war das einzige ewig gültige Gesetz: dass es einem mit Geld besser ging als ohne.
Er atmete aus. »Die Antwort«, sagte er dann, und er fand, das klang cool, »ist auch noch dieselbe. Ja.«
Alberto Vacchi lächelte. Bei ihm wirkte es warm und echt gemeint. »Meinen herzlichen Glückwunsch«, sagte er und klappte seine Mappe zu.
Eine ungeheure Spannung wich von John, und er ließ sich zurücksinken, gegen die gepolsterte Lehne seines Stuhls. War er eben Milliardär. Und wenn schon; es gab wirklich Schlimmeres, was einem passieren konnte. Er sah die drei Anwälte an, die ihm im Halbkreis gegenübersaßen wie ein Musterungsausschuss, und musste beinahe grinsen.
In diesem Augenblick erhob sich der alte Mann aus seinem Lehnstuhl am Fenster.
1
JOHNS KINDHEIT WAR bevölkert gewesen von geheimnisvollen Männern. Allein waren sie gekommen oder in Gruppen, zu zweit, zu dritt, hatten ihn vom Rand des Spielplatzes beobachtet, ihm auf dem Schulweg zugelächelt und über ihn gesprochen, wenn sie glaubten, dass er sie nicht verstand oder hörte.
»Das ist er«, hatten sie gesagt, auf Italienisch. Und: »Wir müssen noch warten.« Und sie hatten einander erklärt, wie schwer es ihnen fiel, das Warten.
Seine Mutter erschrak zu Tode, als er zu Hause davon erzählte. Eine endlose Zeit lang durfte er nicht allein aus dem Haus, musste den anderen Kindern vom Fenster aus beim Spielen zusehen. Danach behielt er es für sich, wenn die Männer auftauchten. Irgendwann aber sah er sie nicht mehr, und ihre Gestalten sanken hinab auf den Grund seiner Erinnerungen.
Dann wurde John zwölf Jahre alt und entdeckte, dass Mister Angelo, der vornehmste Kunde in der Werkstatt seines Vaters, ein Geheimnis hatte. Mister Angelo war ihm schon immer wie ein himmlischer Sendbote vorgekommen, nicht nur, weil er so elegant aussah: Wenn er in seinem weißen Anzug auf dem Hocker vor der Werkbank saß und in gemächlichem Italienisch mit Vater plauschte, die bestrumpften Füße auf der Metallstange – dann hieß das, der Sommer begann, herrliche endlose Wochen voller Eistüten, verplanschter Nachmittage in aufblasbaren Becken, Ausflüge nach Coney Island und durchschwitzter Nächte. Erst wenn Mister Angelo zum zweiten Mal im Jahr auftauchte, in einem hellgrauen Anzug dann, wenn er Vater seine Schuhe reichte und wissen wollte, wie es der Familie ging, war der Sommer wieder zu Ende und Zeit für den Herbst.
»Sind gute italienische Schuhe«, hörte John Vater einmal zu Mutter sagen. »Herrlich weich, für italienisches Wetter gemacht. Ziemlich alt, aber hervorragend gepflegt, muss man sagen. Ich wette, solche Schuhe kann man heutzutage nirgends mehr kaufen.«
Dass himmlische Sendboten besondere Schuhe trugen, war für John selbstverständlich.
An jenem bewussten Tag, als der Sommer des Jahres 1979 endete – und mehr als ein Sommer, nur ahnte das damals niemand –, durfte John seinen besten Freund Paul Siegel und dessen Mutter zum John-F.-Kennedy-Flughafen begleiten. Jimmy Carter war noch Präsident, das Geiseldrama von Teheran hatte noch nicht begonnen, den Sommer über hatte Art Garfunkel Bright Eyes besungen und die Tanzgruppe Village People den Y. M. C. A., und Pauls Vater sollte von einer Geschäftsreise aus Europa zurückkommen. Pauls Eltern besaßen ein Uhrengeschäft in der dreizehnten Straße, und Mister Siegel konnte unglaublich aufregende Geschichten von den Überfällen erzählen, die er schon erlebt hatte. An der hinteren Wand des Ladens gab es, verborgen unter einem gerahmten Foto von Paul als Baby, sogar ein echtes Einschussloch! Und John war zum ersten Mal im Leben auf dem berühmten JFK-Flughafen und drückte sich gemeinsam mit Paul die Nase platt an einer riesigen Glasscheibe, durch die man die ankommenden Passagiere beobachten konnte.
»Die kommen alle aus Rom«, erklärte Paul. Paul war unglaublich klug. Auf der Fahrt hatte er ihnen die Geschichte New Yorks bis bestimmt zurück in die Steinzeit erzählt, alles über die Wallstreet und wer die Brooklyn Bridge erbaut hatte und wann sie eingeweiht worden war und so weiter. »Dad kommt mit der Maschine aus Kopenhagen. Die hat mindestens eine halbe Stunde Verspätung.«
»Klasse«, meinte John. Er hatte es nicht eilig, wieder nach Hause zu kommen.
»Komm, wir zählen Männer mit Bärten!«, schlug Paul vor. Das war auch typisch. Paul hatte immer Ideen, was man unternehmen konnte. »Es gelten nur Vollbärte, und wer zuerst bei zehn ist, hat gewonnen. Okay? Ich seh schon einen, dort vorne, der mit der roten Aktentasche!«
John kniff die Augen zusammen wie ein Indianerscout. Es war aussichtslos, Paul in einem solchen Wettbewerb schlagen zu wollen, aber versuchen musste er es zumindest.
Da entdeckte er Mister Angelo.
Er war es, ohne Zweifel. Der hellgraue Anzug, die Art, wie er sich bewegte. Das Gesicht. John blinzelte, erwartete die Gestalt wieder verschwinden zu sehen wie ein Trugbild, aber Mister Angelo verschwand nicht, sondern marschierte wie ein ganz normaler Mensch im Strom der anderen Passagiere des Fluges aus Rom mit, ohne hochzusehen, in der Hand nichts als eine Plastiktüte.
»Der Mann in dem braunen Mantel«, rief Paul. »Zwei.«
Ein Uniformierter hielt Mister Angelo an, deutete auf die Tüte und sagte etwas. Mister Angelo öffnete die Plastiktüte und hob zwei Paar Schuhe heraus, ein braunes und ein schwarzes.
»He«, beschwerte sich Paul in dem Moment. »Du spielst gar nicht richtig mit!«
»Ich find’s langweilig«, entgegnete John, ohne die Augen von dem Geschehen zu wenden. Der Sicherheitsbeamte war sichtlich verwundert, fragte etwas. Mister Angelo antwortete, die Schuhe in der Hand. Schließlich bedeutete der Uniformierte ihm, dass er weitergehen könne, worauf Mister Angelo seine Schuhe in den Beutel zurück tat und durch eine automatische Tür verschwand.
»Du hast bloß Angst, dass du verlierst«, meinte Paul.
»Ich verlier doch sowieso immer«, sagte John.
Am Abend erfuhr er, dass wahrhaftig Mister Angelo an diesem Tag in Vaters Werkstatt gewesen war. Er hatte Geschenke für die Kinder dagelassen, eine große Tafel Schokolade für jeden und für John außerdem einen Zehndollarschein. Als John die Schokolade und den Geldschein in die Hand nahm, beschlich ihn ein eigenartiges Gefühl. Als habe er etwas entdeckt, das ein Geheimnis hätte bleiben sollen.
»Ich habe Mister Angelo heute auf dem Flughafen gesehen«, erzählte er trotzdem. »Er ist mit dem Flugzeug aus Rom gekommen, und er hatte nichts dabei als seine Schuhe.«
Vater lachte.
Mutter langte nach ihm, zog ihn an sich und seufzte. »Ach, du mein kleiner Träumer.« So nannte sie ihn immer. Sie hatte auch gerade von Rom erzählt, von einem Cousin, der bei irgendwelchen Verwandten zur Welt gekommen war. John fand es merkwürdig, dass er Verwandte in Italien haben sollte, die er noch nie im Leben gesehen hatte.
»Mister Angelo wohnt in Brooklyn«, erklärte Vater. »Er kommt manchmal hierher, weil er den Mann kannte, der den Laden vor mir hatte.«
John schüttelte den Kopf, sagte aber nichts mehr. Es gab nichts mehr zu sagen. Das Geheimnis war gelüftet. Er wusste, dass Mister Angelo nicht mehr wiederkommen würde, und so war es auch.
Im Jahr darauf heiratete sein neun Jahre älterer Bruder Cesare und zog nach Chicago. Sein Bruder Lino, sechs Jahre älter als John, heiratete nicht, ging aber zur Luftwaffe, um Pilot zu werden. Von einem Monat zum anderen war John plötzlich das einzige Kind zu Hause.
Er durchlief die Schule, seine Noten waren weder gut noch schlecht, und seine Mitschüler kannten ihn als unauffälligen, ruhigen Jungen, der in eine eigene Welt eingesponnen war und wenig Kontakt zu anderen suchte. Er zeigte ein gewisses Interesse an Geschichte und englischer Literatur, aber niemand hätte ihm zum Beispiel die Organisation eines Schulfestes anvertraut. Die Mädchen fanden ihn nett, was so viel hieß, dass sie keine Angst hatten, mit ihm bei Dunkelheit die Straße entlangzugehen. Aber der einzige Kuss, den er in seiner High-School-Zeit abbekam, fand auf einer Silvesterparty statt, zu der ihn jemand mitschleppte und auf der er nur unbehaglich herumstand. Wenn die anderen Jungs von ihren sexuellen Abenteuern berichteten, schwieg er einfach, und niemand fragte nach.
Nach der High School gewann Paul Siegel ein hoch dotiertes Begabtenstipendium und entschwand nach Harvard. John wechselte auf das nahe gelegene Hopkins Junior College, hauptsächlich, weil es erschwinglich war und er zu Hause wohnen bleiben konnte, ohne rechte Vorstellung davon, wie es weitergehen solle.
Im Sommer 1988 fand im Londoner Wembley-Stadion das Concert for Nelson Mandela statt, das in alle Welt übertragen wurde. John ging mit ein paar anderen aus seiner Klasse in den Central Park, wo jemand eine Videowand und Lautsprecherboxen aufgestellt hatte, sodass man dem globalen musikalischen Ereignis bei Sonnenschein und Alkohol beiwohnen konnte.
»Wer ist eigentlich dieser Nelson Mandela?«, fragte sich John nach dem ersten Schluck Bier aus einem weißen Plastikbecher.
Obwohl die Frage an niemand bestimmten gerichtet war, erklärte ihm eine etwas pummelige Schwarzhaarige, die neben ihm stand, dass Nelson Mandela der Anführer des südafrikanischen Widerstands gegen die Apartheid sei und seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren unschuldig in Haft. Was sie nicht wenig aufzuregen schien.
So fand er sich unversehens in ein Gespräch verwickelt, und da seine Gesprächspartnerin viel zu erzählen hatte, lief es ganz gut. Während sie redeten, brannte die Sonne eines strahlenden Junitages herab, durchglühte ihre Körper und trieb ihnen den Schweiß aus allen Poren. Die Musik dröhnte, unterbrochen von Ansagen, Erklärungen und Appellen an die südafrikanische Regierung, Nelson Mandela freizulassen, und je weiter es in den Nachmittag hineinging, desto weniger war auf der Videowand zu erkennen. Sarah Brickman hatte energisch funkelnde Augen und geradezu alabasterhaft weiße Haut und schlug irgendwann vor, sich wie die anderen Zuhörer auch in den kargen Schatten eines Busches oder Baumes zurückzuziehen. Dort küssten sie sich, und die Küsse schmeckten salzig vom Schweiß. Während ein vielstimmiges »Free-ee … Nelson Mandela!« über den Rasen dröhnte, hakte John Sarahs Büstenhalter auf, und in Anbetracht dessen, dass er so etwas noch nie im Leben gemacht und zudem mehr Alkohol als jemals zuvor intus hatte, meisterte er diese Hürde geradezu elegant. Als er am nächsten Morgen mit schmerzendem Kopf in einem fremden Bett aufwachte und eine schwarze, lockige Mähne neben sich auf den Kissen entdeckte, erinnerte er sich zwar nicht mehr an alle Einzelheiten, aber er schien die Prüfung bestanden zu haben. So zog er unter den Tränen seiner Mutter zu Hause aus und bei Sarah ein, die westlich des Central Parks eine kleine, zugige Wohnung von ihren Eltern geerbt hatte.
Sarah Brickman war Künstlerin. Sie malte große, wilde Bilder in düsteren Farben, die niemand haben wollte. Ungefähr einmal im Jahr stellte sie ein oder zwei Wochen lang in einer der Galerien aus, die dafür von den Künstlern Geld nehmen, verkaufte jedes Mal nichts oder nicht genug, um wenigstens die Galerie zu bezahlen, und war danach tagelang nicht ansprechbar.
John fand einen Abendjob in einer nahe gelegenen Wäscherei, lernte Hemden für die Dampfmangel zusammenzulegen und verbrühte sich in der ersten Woche beide Hände, aber es reichte, um die Stromrechnung zu zahlen und das Essen. Eine Weile versuchte er im College mitzuhalten, doch der Weg bis dahin war jetzt weit und dauerte lange, zudem wusste er immer noch nicht, wozu das alles gut sein sollte, und so gab er es irgendwann auf, ohne seinen Eltern etwas davon zu sagen. Sie erfuhren es ein paar Monate später, was zu einem heftigen Krach führte, in dessen Verlauf mehrmals der Begriff »Hure« in Zusammenhang mit Sarah fiel. Daraufhin meldete John sich lange Zeit nicht mehr bei seiner Familie.
Es beeindruckte ihn, Sarah in farbbeschmiertem Kittel und mit verkniffenem Gesicht an der Staffelei hantieren zu sehen. Abends schleppte sie ihn in verrauchte Kneipen in Greenwich Village, wo sie mit anderen Künstlern über Kunst und Kommerz diskutierte und er kein Wort verstand, was ihn ebenfalls beeindruckte und das Gefühl in ihm erregte, endlich den Anschluss an das wahre Leben gefunden zu haben. Sarahs Freunde allerdings waren nicht so ohne weiteres bereit, ihren Anschluss an das wahre Leben mit einem dahergelaufenen Grünschnabel zu teilen. Sie lachten abfällig, wenn er etwas sagte, überhörten ihn oder verdrehten die Augen, wenn er eine Frage stellte: Für sie war er nichts weiter als Sarahs Liebhaber, ihr Anhängsel und Kuscheltier.
Der Einzige, mit dem er in dieser Clique reden konnte, war ein Leidensgefährte, Marvin Copeland, der mit einer anderen Malerin namens Brenda Carrington zusammen war. Marvin lebte in einer Wohngemeinschaft in Brooklyn, schlug sich als Bassgitarrist in verschiedenen erfolglosen Bands durch, feilte an eigenen Songs, die niemand spielen wollte, verbrachte viel Zeit damit, aus dem Fenster zu schauen oder Marihuana zu rauchen, und es gab keine verrückte Idee, an die er nicht glaubte. Dass die Roswell-Aliens von der Regierung in der AREA 51 versteckt gehalten wurden, war für ihn ebenso ausgemachte Sache wie die Heilkräfte von Pyramiden und Edelsteinen. Dass Elvis noch lebte, das war so ungefähr das Einzige, was er ernsthaft bezweifelte. Es war zumindest immer kurzweilig, sich mit ihm zu unterhalten.
Es kam regelmäßig zu Streits, wenn John eines von Sarahs Bildern, das in ihren Augen misslungen war, gut fand oder gar umgekehrt. Schließlich beschloss er herauszufinden, nach welchen Kriterien man Gemälde eigentlich als gut oder schlecht einstufte. Da er bisher kein Wort verstanden hatte von dem, wovon Sarah und ihre Freunde überhaupt sprachen, begann er, Bücher über Kunst zu lesen und ganze Tage im Museum of Modern Arts zu verbringen, wo er sich in Führungen schmuggelte, bis man ihn wieder erkannte und anfing, peinliche Fragen zu stellen. Während er den Erklärungen zu den Bildern ebenso hingebungsvoll wie verständnislos lauschte, keimte der Gedanke in ihm, die Malerei könne die Richtung in seinem Leben sein, die er immer gesucht hatte. Wie hätte er sie auch früher finden sollen, als Sohn eines Schuhmachermeisters, mit Brüdern, die Finanzbeamte und Kampfjetpiloten waren? Er begann zu malen.
Das war, wie er später erkennen sollte, keine gute Idee. Er hatte erwartet, dass Sarah sich freuen würde, doch sie kritisierte auf schmerzhafte Weise alles, was er zuwege brachte, und spottete vor ihren Freunden über seine Bemühungen. John zweifelte nicht daran, dass jedes Wort gerechtfertigt war, steckte alle Kritik demütig ein und nahm sie zum Anlass, noch härter zu arbeiten. Er hätte gern Unterricht genommen, doch das konnte er sich weder finanziell noch zeitlich leisten.
Eine Zeit lang kam, nachts um vier Uhr und von Werbepausen zerhackstückt, ein Malkurs im Fernsehen, von dem er keine Folge versäumte. Es wurde gezeigt, wie man fichtenumsäumte Waldseen malte oder Windmühlen, die sich als Schattenrisse vor prächtigen Sonnenuntergängen abhoben. Ohne eines von beiden je mit eigenen Augen gesehen zu haben, fand er, dass es ihm durchaus gelang, die Anleitungen umzusetzen, wenngleich Sarah ihn bei diesen Sujets nicht einmal mehr kritisierte, sondern nur noch mit den Augen rollte.
Eines Tages erschien in einem Szeneblatt ein kurzer Bericht über die Künstlerin Sarah Brickman und ihre Arbeiten, den sie ausschnitt, rahmte und sich stolz übers Bett hängte. Kurz darauf tauchte ein Kaufinteressent auf, ein Wall-Street-Jüngling mit pomadisierten Haaren, breit gestreiftem Hemd und Hosenträgern, der mehrmals erklärte, für ihn sei Kunst eine Investition und er wolle sich von Künstlern, die möglicherweise demnächst bedeutend würden, rechtzeitig Werke sichern. Er hielt das offensichtlich für eine geniale Idee. Sarah führte ihn durch das Atelier und zeigte ihm ihre Gemälde, mit denen er aber wenig anzufangen wusste. Erst als sein Blick auf eines von Johns frühen Bildern fiel, eine wilde, bunte Stadtsilhouette, über die Sarah nur angewidert die Nase gerümpft hatte, war er vom Fleck weg begeistert. Er bot zehntausend Dollar, und John nickte einfach nur.
Sarah schloss sich lautstark im Bad ein, kaum dass die Tür hinter Käufer und Bild ins Schloss gefallen war. John, das Geldbündel noch in der Hand, klopfte und wollte wissen, was los sei. »Ist dir klar, dass du mit einem einzigen vermurksten Bild mehr Geld verdient hast als ich in meinem ganzen Leben?«, schrie sie schließlich.
Danach war ihre Beziehung nie wieder so wie vorher und endete kurz darauf, im Februar 1990 – wie der Zufall es wollte, just an dem Tag, als die Nachricht von der Freilassung Nelson Mandelas die Medien beherrschte. Sarah erklärte John, dass es aus sei, und genau das war es dann auch. Er kam bei Marvin unter, in dessen Wohngemeinschaft gerade ein ungemütliches, schlauchartiges Zimmer frei geworden war, und dort saß er ein paar Tage später zwischen seinen paar Habseligkeiten auf dem Boden und verstand immer noch nicht, was geschehen war.
Der Verkauf der Stadtsilhouette blieb sein einziger künstlerischer Erfolg, und das Geld war schneller aufgebraucht, als er sich vorgestellt hatte. Nach dem erzwungenen Umzug hatte er den Job in der Wäscherei natürlich aufgeben müssen, und nach ein paar Wochen Herumgerenne, in denen sein Konto endgültig auf null ging, fand er endlich einen neuen Job bei einem von Indern betriebenen Pizzaservice, die als Ausfahrer vorzugsweise junge Männer italienischer Herkunft beschäftigten. Im südlichen Manhattan hieß das, sich mit dem Fahrrad durch den stets mehr oder weniger stehenden Verkehr zu schlängeln und jeden schmalen Schleichweg zwischen den Blocks zu kennen. Es war ein Job, der John straffe Beinmuskeln und durchtrainierte Lungen verschaffte und eine Art Raucherhusten von den Abgasen, die er dabei einatmen musste, aber fast nicht genug Geld zum Überleben. Nicht nur, dass er in dem Zimmer nur mit Mühe genug Platz hatte, um zu malen, und selbst an sonnigen Tagen nicht das nötige Licht, es blieb ihm auch kaum die Zeit dazu. Die Arbeit endete spät in der Nacht und erschöpfte ihn nicht selten so, dass er am nächsten Morgen schlief wie tot, bis ihn ein ausdauernd rasselnder Wecker aufs Neue nach Manhattan schickte. Jedes Mal, wenn er freinahm, um sich bei einem anderen Job vorzustellen, rutschte er durch den Verdienstausfall weiter ins Minus.
Um diese Zeit herum kam Paul Siegel zurück nach New York, mit einem ehrfurchtgebietend guten Harvard-Diplom in der Tasche und einer lukrativen Anstellung bei einer Unternehmensberatungsfirma, die quasi alle bedeutenden Firmen der Welt zu ihren Klienten zählte und ein paar Regierungen mit dazu. John besuchte ihn einmal in seiner geschmackvoll eingerichteten kleinen Wohnung in West Village und bestaunte den Ausblick über den Hudson River, während Paul ihm so gnadenlos, wie nur ein guter Freund das kann, aufzählte, was er alles falsch machte in seinem Leben.
»Zuerst musst du deine Schulden loswerden. Solange du Schulden hast, bist du nicht frei«, zählte er an den Fingern ab. »Dann musst du dir die Freiräume schaffen, neue Richtungen einschlagen zu können. Aber vor allem musst du wissen, was du willst im Leben.«
»Ja«, sagte John. »Da hast du Recht.«
Aber er wurde seine Schulden nicht los, von allem anderen ganz zu schweigen. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, verfiel Murali, der Besitzer des Pizzadienstes, zudem auf die Idee, jedem Kunden südlich des Empire State Buildings die Lieferung seiner Pizza innerhalb von dreißig Minuten ab Bestellung zu garantieren. Wer länger warten musste, brauchte nichts zu bezahlen. Diese Idee stammte aus irgendeinem Buch, das er nicht mal selber gelesen, sondern von dem ihm nur jemand erzählt hatte, und die Folgen waren verheerend. Jeder Ausfahrer hatte vier Verspätungen pro Woche frei, was darüber hinausging, bekam man vom Lohn abgezogen. In Stoßzeiten, wenn die Pizzen schon mit Verspätung aus der Küche kamen und der Kunde womöglich tatsächlich in der dreißigsten Straße wartete, war es schlechterdings nicht zu schaffen. John wurde das Bankkonto gekündigt, er bekam Streit mit Marvin wegen der Miete, und es waren kaum noch irgendwelche Sachen übrig, für die er beim Pfandleiher Geld bekam. Zuletzt versetzte er die Armbanduhr, die ihm sein Vater zur Kommunion geschenkt hatte; eine schlechte Idee, denn danach traute er sich nicht mehr zu seinen Eltern, wo er wenigstens ab und zu verköstigt worden war. An manchen Tagen war ihm regelrecht schlecht vor Hunger, während er die nach Käse und Hefe duftenden Styropacks durch die Straßen radelte.
So brach das Jahr 1995 an. In Johns Träumen tauchten ab und zu die märchenhaften Männer seiner Kindheit wieder auf, winkten ihm lächelnd zu und riefen etwas, das er nicht verstand. Die Londoner Baring Bank ging nach fehlgeschlagenen Devisenspekulationen ihres Angestellten Nick Leeson pleite, die japanische Sekte Aum Shiri Kyo tötete mit Giftgasanschlägen auf die Tokioter U-Bahn zwölf Menschen und verletzte fünftausend weitere, und bei einem Bombenanschlag in Oklahoma City kamen 168 Menschen ums Leben. Bill Clinton war immer noch Präsident der Vereinigten Staaten, hatte aber eine schwere Zeit, weil seine Partei in beiden Häusern des Kongresses ihre Mehrheit verloren hatte. John stellte fest, dass er seit über einem Jahr kein Bild gemalt hatte, dass nur die Zeit irgendwie vergangen war, und hatte das Gefühl, auf irgendetwas zu warten, nur dass er nicht hätte sagen können, worauf.
Der 23. April war nicht gerade ein Glückstag. Zunächst mal ein Sonntag, und er musste arbeiten. In der Pizzabäckerei wartete mal wieder eine Nachricht seiner Mutter auf ihn, er solle anrufen – das Telefon in Marvins WG war chronisch abgemeldet, zum Glück. John warf den Zettel weg und widmete sich den Fahrten, von denen es, wie immer an Sonntagen, wenig gab, was hieß, wenig Geld, und meistens ging es zu den verrücktesten Adressen. Da er sein Limit an Verspätungen für diese Woche schon aufgebraucht hatte, legte er sich mächtig ins Zeug, und wahrscheinlich weil er sich so ins Zeug legte, passierte es: Er schoss aus einer Abkürzung zwischen zwei Blocks hinaus auf die Straße, bremste einen Moment zu spät und rammte einen Wagen, eine schwarze, lange Limousine, die aussah, als säße der Typ aus dem Film Wall Street darin, den Michael Douglas spielte.
Das Rad war eiernder Schrott, die Pizzen Abfall, während der Wagen davonglitt, als sei nichts gewesen. John rieb sich die Knie unter den zerrissenen Jeans, sah den dunkelroten Rücklichtern nach und begriff, dass alles noch weit übler für ihn hätte ausgehen können. Murali tobte, als John wieder angehumpelt kam, ein Wort gab das andere, und schließlich war John den Job los, und den fälligen Wochenlohn gab es auch nicht, weil Murali das Geld für die Reparatur des Fahrrads einbehielt. So marschierte John zu Fuß nach Hause, mit ganzen zehn Cent in der Tasche und einer Stinkwut im Bauch, durch eine Nacht, die immer kälter wurde, je länger sie dauerte. Auf den letzten Meilen durch Brooklyn fiel ein ekliger Nieselregen, und als John endlich ankam, wusste er nicht mehr, ob er im Himmel oder in der Hölle war oder noch auf Erden.
Es roch nach Spiegeleiern und Zigaretten, als er die Tür aufschloss, und es war herrlich warm. Marvin hockte, wie er das oft machte, mit untergeschlagenen Beinen in der Küche, seinen Fender Jazz Bass in den Verstärker eingestöpselt, so leise gedreht, wie es noch Sinn machte, aber anstatt wie sonst wild über die Saiten zu fuhrwerken, machte er bloß dumpfe Töne, die sich anhörten wie der Herzschlag eines kranken Riesen. Du-dumm. Du-dumm. Du-dumm.
»Da hat jemand nach dir gefragt«, sagte er, als John auf das Badezimmer zusteuerte.
»Was?« John blieb stehen. Nur pinkeln und ins Bett und keinen Schritt weiter, das hatte er sich die ganze letzte Stunde wieder und wieder versprochen. »Nach mir?«
»Zwei Männer.«
»Was für Männer?«
»Keine Ahnung. Männer eben.« Du-dumm. Du-dumm. »Zwei Männer in stinkfeinen Anzügen, mit Krawatten und Krawattennadeln und so weiter, und sie wollten wissen, ob hier ein gewisser John Salvatore Fontanelli wohnt.«
Jetzt opferte John doch noch ein paar Schritte extra, in die Küche. Marvin machte unbeirrbar weiter mit der Herzmassage für den kranken Riesen. Du-dumm. Du-dumm. »John Salvatore«, sagte Marvin und schüttelte tadelnd den Kopf. »Ich wusste nicht mal, dass du einen mittleren Namen hast. Übrigens, du siehst beschissen aus.«
»Danke. Murali hat mich gefeuert.«
»Kein schöner Zug von ihm. Wo wir doch nächste Woche schon wieder Miete zahlen sollen.« Du-dumm. Du-dumm. Ohne aus dem Takt zu kommen, langte Marvin neben sich auf den Küchentisch und reichte John eine Visitenkarte. »Da, soll ich dir geben.«
Es war eine teuer aussehende, vierfarbig bedruckte Karte, die ein verschnörkeltes Wappen zeigte. Darunter stand:
Eduardo Vacchi
Rechtsanwalt, Florenz, Italien
z. Zt. The Waldorf Astoria
301 Park Avenue, New York, N. Y.
Tel. 212-355-3000
John glotzte auf die Karte. Alles an ihm wurde schwer von der Wärme in der Küche. »Eduardo Vacchi … Ich schwöre, ich habe diesen Namen noch nie gehört. Hat er gesagt, was er von mir will?«
»Du sollst ihn anrufen. Er hat gesagt, wenn du kommst, soll ich dir die Karte geben und sagen, dass du ihn anrufen sollst, es sei wichtig.« Du-dumm. »Eine Erbschaftsangelegenheit.« Du-dumm. »Klingt in meinen Ohren so ähnlich wie das Wort ›Geld‹. Gut, oder?«
2
DER ALTE MANN – der Padrone, wie ihn Eduardo genannt hatte – legte das Kissen beiseite, das er auf seinem Schoß liegen gehabt hatte, legte es auf ein kleines Tischchen, das neben ihm stand. Dann stemmte er sich mit einiger Mühe aus dem Sessel hoch, zog mit gichtigen Fingern die Strickjacke zurecht und lächelte sanft in die Runde.
John saß erstarrt, wie vom Donner gerührt. Sein Gehirn hatte völlig ausgesetzt.
Mit leisen, irgendwie sehr relaxten Schritten ging der Mann, den Eduardo Vacchi als seinen Großvater bezeichnet hatte, um den Tisch herum, gerade so, als habe er alle Zeit der Welt. Als er hinter John vorbeiging, tätschelte er ihm wohlwollend die Schulter, ganz leicht und beiläufig, und doch war es John, als nehme der Padrone ihn damit gewissermaßen in seine Familie auf. Ebenso entspannt und gelassen vollendete er seinen Gang um den Tisch, nahm ruhig auf dem letzten freien Stuhl Platz und schlug die letzte Mappe auf, die noch nicht aufgeschlagen worden war.
Johns Verstand weigerte sich zu begreifen, was hier zu geschehen im Begriff war. Dabei war das doch wie bei den Intelligenztests. Wir haben die Reihe 2 – 4 – 6 – 8, wie lautet die logisch nächste Zahl? Richtig, 10. Wir haben die Reihe 2 – 4 – 8 – 16, wie lautet die logisch nächste Zahl? 32, richtig. Wir haben die Reihe achtzigtausend – vier Millionen – zwei Milliarden, wie lautet die logisch nächste Zahl?
Aber hier endete alle Logik. Vielleicht waren das doch keine Anwälte. Vielleicht waren das Verrückte, die ein verrücktes Spiel spielten. Vielleicht war er das Opfer eines psychologischen Versuchs. Vielleicht war doch alles bloß »Versteckte Kamera«.
»Mein Name ist Cristoforo Vacchi«, sagte der alte Mann mit einer sanften, unerwartet volltönenden Stimme, »und ich bin Anwalt aus Florenz, Italien.«
Dabei sah er John an, und die Intensität dieses Blicks ließ John alle Gedanken an psychologische Versuche und versteckte Kameras vergessen. Dies hier war echt, war real, war so unleugbar wirklich, dass man beinahe Stücke davon abschneiden konnte.
Eine Pause entstand. John hatte das Gefühl, dass von ihm erwartet wurde, etwas zu sagen. Zu fragen. Sich irgendwie zu äußern mit seinem ausgetrockneten Rachen, seiner Lähmung im Unterkiefer, seiner auf Fußballgröße angeschwollenen Zunge und seinem absoluten Verlust aller Sprache. Doch alles, was er fertig brachte, war eine Art keuchendes Flüstern: »Noch mehr Geld?«
Der Padrone nickte mitfühlend. »Ja, John. Noch mehr Geld.«
Es war schwer zu sagen, wie alt Cristoforo Vacchi sein mochte, aber sicher war er eher achtzig als siebzig. Von seinem schlohweiß gewordenen Haar war wenig übrig, seine Haut war schlaff und fleckig und von zahllosen Falten durchfurcht. Trotzdem wirkte er, wie er, mit graziös ineinander gelegten Händen, dasaß und auf seine Unterlagen hinabsah, absolut kompetent und völlig Herr der Lage. Niemand wäre auch nur auf die Idee gekommen, angesichts dieses durchaus gebrechlichen Mannes den Begriff Senilität ins Spiel zu bringen. Und sei es nur, weil er damit riskiert hätte, sich selbst lächerlich zu machen.
»Ich will Ihnen jetzt die ganze Geschichte erzählen«, sagte er. »Sie beginnt im Jahre 1480 in Florenz. In diesem Jahr wird Ihr Vorfahre Giacomo Fontanelli geboren, als uneheliches Kind seiner Mutter und eines unbekannten Vaters. Die Mutter findet den Schutz eines Klosters und seines barmherzigen Abtes, und der Junge wächst unter Mönchen heran. Mit fünfzehn Jahren, nach heutiger Zeitrechnung am 23. April des Jahres 1495, hat Giacomo einen Traum – den man vielleicht eher eine Vision nennen muss, obwohl er selbst immer nur von einem Traum schreibt –, einen Traum so hell und intensiv, dass sein ganzes weiteres Leben davon bestimmt wird. Bei den Mönchen hat er schreiben, lesen und rechnen gelernt, und kurz nach dem Traum zieht er hinaus, um Kaufmann und Händler zu werden. Er ist in Rom und vor allem in Venedig tätig, dem damaligen Zentrum der südeuropäischen Wirtschaft, heiratet und setzt insgesamt sechs Kinder in die Welt – allesamt Söhne –, die später zumeist ebenfalls kaufmännische Laufbahnen einschlagen. Giacomo jedoch kehrt im Jahre 1525 in das Kloster zurück, um auch den Rest seines Traumes zur realisieren.«
John schüttelte wie betäubt den Kopf. »Ich höre immer Traum. Was für ein Traum?«
»Einen Traum, in dem Giacomo Fontanelli sozusagen sein eigenes Leben vorweggenommen gesehen hat – seinen beruflichen Weg, seine künftige Frau, und, unter anderem, welche gewinnbringenden Geschäfte er machen würde. Doch viel wichtiger als das: Er sah in diesem Traum auch eine Zeit, die fünfhundert Jahre in der Zukunft lag und die er beschreibt als ein Zeitalter schreienden Elends und erbärmlicher Angst, eine Zeit, in der keiner mehr eine Zukunft sieht. Und er sah, dass es der Wille der Vorsehung war – der Wille Gottes sozusagen –, dass er sein Vermögen demjenigen vermachen sollte, der am fünfhundertsten Jahrestag seines Traumes der jüngste seiner männlichen Nachkommen sein würde. Dieser Mann war auserkoren, den Menschen die verloren gegangene Zukunft zurückzugeben, und er würde dies tun mit dem Vermögen Giacomo Fontanellis.«
»Ich?«, rief John entsetzt aus.
»Sie«, nickte der Padrone.
»Ich soll was sein? Auserkoren? Seh ich vielleicht aus wie jemand, der auserkoren ist für irgendetwas?«
»Wir sprechen nur von geschichtlichen Tatsachen«, erwiderte Cristoforo Vacchi sanft. »Was ich Ihnen hier erzähle, werden Sie in Bälde im Testament Ihres Urahns nachlesen können. Ich erkläre Ihnen nur, was seine Motive waren.«
»Ach so. Also, Gott war ihm erschienen. Und deshalb sitze ich heute hier?«
»So ist es.«
»Das ist doch verrückt, oder?«
Der alte Mann hob andeutungsweise die Hände. »Das zu entscheiden, überlasse ich Ihnen.«
»Den Menschen die Zukunft zurückgeben. Ausgerechnet ich?« John seufzte. Da sah man wieder mal, was Visionen und heilige Träume wert waren. Genau nichts nämlich. Klar, niemand sah heutzutage mehr eine Zukunft. Jeder wartete bloß noch auf die Entscheidung, an welcher ihrer vielen Plagen die Menschheit untergehen würde. Dass sie untergehen würde, war klar und ausgemachte Sache. Die Alternativen beschränkten sich auf die Wahl der Waffen – die Angst vor dem Atomkrieg war in den letzten Jahren ein bisschen aus der Mode gekommen, wahrscheinlich ganz zu Unrecht, hoch gehandelt wurden dagegen Seuchen neuer Epidemien – AIDS, Ebola, Rinderwahnsinn, irgendetwas in dieser Preisklasse –, nicht zu vergessen das Ozonloch und die Ausbreitung der Wüsten, und wie man hörte, würde auch das Trinkwasser demnächst knapp werden. Nein, es gab wirklich keinen Grund, heutzutage noch eine Zukunft zu sehen. Nur dass er, John Salvatore Fontanelli, da keine Ausnahme bildete. Eher im Gegenteil: Während seine Altersgenossen es immerhin geschafft hatten, zumindest für ihre eigene unmittelbare Zukunft zu sorgen, indem sie sich Haus und Familie und stabiles Einkommen sicherten, hatte er nur dumpf in den Tag hineingelebt und es sogar fertig gebracht, verhältnismäßig nah in der Zukunft liegende Ereignisse wie fällige Mieten zu verdrängen. Wirklich, wenn es jemanden gab, der weniger prädestiniert war für die Suche nach der verloren gegangenen Zukunft der Menschheit als er, dann war er dringend daran interessiert, diesen Typen kennen zu lernen.
Der alte Mann sah wieder in seine Aktenmappe. »Im Jahre 1525, wie gesagt, kehrte Giacomo Fontanelli in das Kloster zurück, in dem er seine Kindheit verbracht hatte, und berichtete dem Abt von seiner Vision. Sie gelangten zu der Überzeugung, dass dieser Traum von Gott gesandt war, ein Traum vergleichbar dem biblischen Traum des Pharaos, aus dem Joseph die sieben fetten und die sieben mageren Jahre vorhersagte, und sie beschlossen, entsprechend zu handeln. Das gesamte Vermögen Giacomo Fontanellis wurde einem mit dem Abt befreundeten Rechtsgelehrten zur Betreuung anvertraut – einem Mann namens Michelangelo Vacchi …«
»Ach«, sagte John.
»Ja. Mein Vorfahr.«
»Sie wollen sagen,