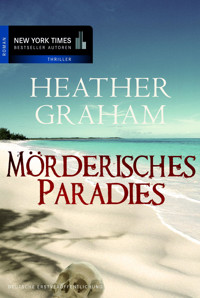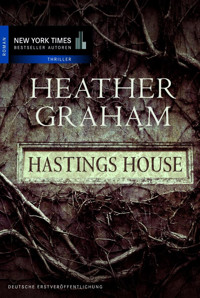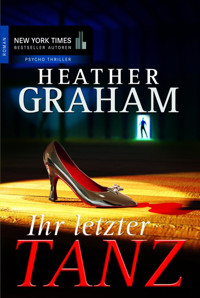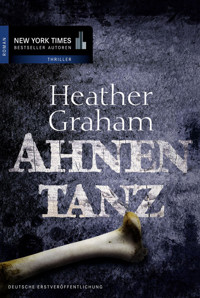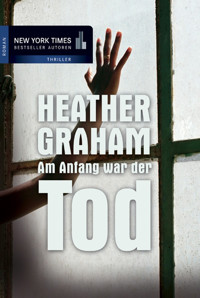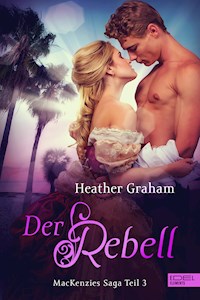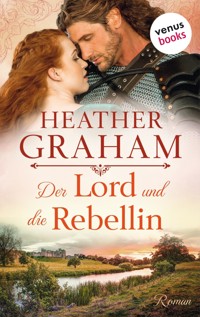
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Herzen, zwei Geheimnisse, eine wahre Liebe: Der historische Liebesroman »Der Lord und die Rebellin« von Bestseller-Autorin Heather Graham als eBook bei venusbooks. England, 1190: Die schöne Lady Katherine de Montrain ist gezwungen aus politischen Gründen eine Heirat mit Lord Damian Monticy einzugehen. Dem erfahrenen Ritter, gerade glorreich aus dem Heiligen Land zurückgekehrt, steht nun seine schwerste Eroberung bevor: das Herz der stolzen Lady. Damian verfällt ihr bei der ersten Begegnung, dennoch ist er nicht blind vor Liebe. Er weiß, dass sie ein Geheimnis hütet – denn Lady Katherine unterstützt heimlich Robin Hood und seine Gefährten. Und auch Damian verbirgt etwas vor ihr – so beginnen die beiden einander in einem ebenso leidenschaftlichen wie gefährlichen Tanz zu umkreisen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das sinnliche Historical-Romance-Highlight »Der Lord und die Rebellin« von New-York-Times-Bestsellerautorin Heather Graham. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England, 1190: Die schöne Lady Katherine de Montrain ist gezwungen aus politischen Gründen eine Heirat mit Lord Damian Monticy einzugehen. Dem erfahrenen Ritter, gerade glorreich aus dem Heiligen Land zurückgekehrt, steht nun seine schwerste Eroberung bevor: das Herz der stolzen Lady. Damian verfällt ihr bei der ersten Begegnung, dennoch ist er nicht blind vor Liebe. Er weiß, dass sie ein Geheimnis hütet – denn Lady Katherine unterstützt heimlich Robin Hood und seine Gefährten. Und auch Damian verbirgt etwas vor ihr – so beginnen die beiden einander in einem ebenso leidenschaftlichen wie gefährlichen Tanz zu umkreisen …
Über die Autorin:
Heather Graham wurde 1953 geboren. Die New-York-Times-Bestseller-Autorin hat über zweihundert Romane und Novellen verfasst, die in über dreißig Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Heather Graham lebt mit ihrer Familie in Florida.
Von Heather Graham erscheinen bei venusbooks:
In den Händen des Highlanders
Fieber der Leidenschaft
Der Lord und die Rebellin
Die Leidenschaft des Earls
Das Begehren des Ritters
Die Gefangene des Freibeuters
Das Erbe der Liebenden
Die Highland-Kiss-Saga:
In den Armen des Schotten
Der Highlander und die schöne Feindin
Gefangen von einem Highlander
Die Braut des Viscounts
Die Wild-Passion-Saga:
Der Ungezähmte und die Schöne
Der Laird und die Schöne
Der Krieger und die Schöne
Die Cameron-Saga:
Der Lord und die ungezähmte Schöne
Die Geliebte des Freibeuters
Unter dem Autorennamen Shannon Drake veröffentlichte sie bei venusbooks außerdem:
Blutrote Nacht
Bei Anbruch der Dunkelheit
Verlockende Finsternis
Das Reich der Schatten
Der Kuss der Dunkelheit
***
eBook-Neuausgabe Juli 2019
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Dieses Buch erschien bereits 1995 unter dem Titel Kreuzzug des Herzens bei Heyne
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 Heather Graham
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel Damsel in Distress bei Avon Books.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Lizenzausgabe 2019 venusbooks GmbH, München
Copyright © der aktuellen eBook-Neuausgabe 2020 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstockDave Head, Phagalley und Mary Chronis Period Images & Dunraven Productions
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-95885-692-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Lord und die Rebellin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Heather Graham
Der Lord und die Rebellin
Roman
Aus dem Amerikanischen von Eva Malsch
venusbooks
PROLOG
Legenden
Sommer 1180, während der Regentschaft. von König Henry II., im Wald.
Sie liebte den Wald. Nirgendwo anders leuchtete die Welt in so wundervollen Farben. Die satten Braun- und Schwarztöne der Erde; dann die verschiedenen Grünschattierungen, die dunklen des Grases, das im fruchtbaren Torfboden sproß, die helleren der Blätter an den Büschen, die kühlen, geheimnisvollen in den Tiefen zwischen den Baumstämmen, wo hohe Äste die Sonne verdeckten und ein fantastisches Zauberreich schufen ...
Und wo sich die Zweige nicht verdichteten, strahlte der Himmel, manchmal ein blauer Fleck, schimmernd im Sonnenlicht oder verdüstert von eisgrauen Sturmwolken. An solchen Tagen heulte und stöhnte der Wind, und die Äste sanken herab, als würden sie sich jener größeren, göttergleichen Macht beugen.
Und es gab auch Tage, wo wallender Nebel in sanftem Hellgrau heranrollte und den Zauber noch verstärkte. Wie gern kam sie hierher ... Vielleicht hatte sie ihren Sinn für die Magie vom Vater geerbt. Ihm verdankte sie gewisse Vorrechte, und wenn er heimkam, um sich von seinen Lehnspflichten gegenüber dem König auszuruhen, führte er sie in den Wald.
Anfangs hatte sie nicht erkannt, daß sie wegen ihrer Privilegien hierherkommen durfte. Nur eins wußte sie – wie wunderbar und gut ihr Vater war. Er besaß meergrüne Augen, platinblondes Haar und eine hochgewachsene Gestalt. Auch der König schien ihn zu schätzen, denn er rief ihn oft zu sich. Aber wann immer der Vater zurückkehrte, ging er mit ihr in den königlichen Wald.
Heute ritt sie ein Pferd, kein Pony, sondern eine große Stute. Das erlaubte ihr Vater, weil sie mittlerweile ausgezeichnet reiten konnte. An diesem besonderen Tag glich sie in ihrer äußeren Erscheinung einer erwachsenen Frau. Ihr Haar, sorgsam geflochten, bildete zu beiden Seiten des Kopfs anmutige Schlingen. Über dem dunkelgrünen Unterkleid, das mit den Farben des Waldes wetteiferte und weite, elegante, an den Handgelenken enganliegende Ärmel hatte, trug sie eine elfenbeinweiße Tunika.
Am Rücken hing ein Pfeilköcher, der Bogen war um eine Schulter geschlungen. Nie hatte sie ihrem Vater erzählt, es widerstrebe ihr, auf das schöne Wild zu zielen, denn sie begleitete ihn viel zu gern auf der Jagd. Außerdem wußte sie, daß jedes erlegte Reh die Nahrungsvorräte für die langen Wintermonate ergänzte.
Ja, dieser Tag begann wundervoll. Keine anderen Pairs hatten sich dem kleinen Jagdtrupp angeschlossen, der aus dem Vater, ihr selbst und ihrem Vetter Rob bestand. Nur zwei Pagen waren mitgekommen, um die Beute nach Hause zu befördern.
Rob war dreizehn, fünf Jahre älter als sie, und er genoß es immer noch, sie zu hänseln. Spöttisch verneigte er sich und nannte sie ›Lady Grünärmel‹. Sie klagte, er würde sich wie ein kleiner Teufel aufführen. Trotzdem hielt er nicht den Mund, aber das störte sie nicht.
Stets fiel ihr eine passende Antwort ein, und während sie durch den Wald ritten, sah sie ihren Vater oft über das mutwillige Geschwätz lächeln. Natürlich verscheuchten sie dadurch das Wild, doch das ärgerte ihn nicht. Der halbe Tag lag noch vor ihnen. Es war angenehm kühl. Eine leichte Brise wehte, die Bäume rauschten, die Vögel sangen. Unter dem grünen Baldachin des Laubs spürte man die Sonnenhitze kaum.
Seltsamerweise ahnte sie lange vorher, daß etwas geschehen würde. Ein seltsames atemloses Schweigen lag in der Luft, eine plötzliche Stille, die sie warnte – als wäre sie eine Prinzessin, der die Waldgötter zu Gebote standen. Magisch und betörend ... Nein, nichts davon. Das Gefühl, das sie erfaßte, war Angst. Etwas Schreckliches kam auf sie zu, und sie wollte nicht tiefer in die Schatten zwischen den Baumen hineinreiten.
Ehe sie schreien und die Aufmerksamkeit der anderen erregen konnte, erblickten sie die tragische Szene. Sie befanden sich nicht allein im Wald. Vor ihnen, auf stattlichen Pferden, saßen drei Barone, in feinste Wolle und Leinen gekleidet, mit pelzbesetzten Umhängen. Auch die Pferde waren kostbar herausstaffiert. Die Farben des einen Mannes, Gelb und Dunkelblau, leuchteten auf seiner Satteldecke. Mehrere Knappen begleiteten die edlen Herren, weniger kostbar ausgestattet. Alle umringten einen Baum, an dessen Wurzeln eine Hirschkuh lag, dem Tode nah, die braunen Augen weit aufgerissen. Blut quoll aus der Brust, in der ein Pfeil steckte, gezielt abgeschossen.
Nicht der Anblick des erlegten Wilds beunruhigte sie, obwohl es sie bedrückte, ein so schönes Tier sterben zu sehen. Viel bedrohlicher fand sie die Art und Weise, wie die Barone zwei Männer umzingelten, die bei der Hirschkuh standen. Die beiden, die völlig verängstigt wirkten, entstammten gewiß keinen vornehmen Familien, denn ihre Tuniken waren aus grobem braunem Stoff, und einer besaß nicht einmal Beinkleider, die seine dünnen Waden geschützt hätten. Schmutzige Gesichter verrieten, daß sie auf dem Erdboden zu schlafen pflegten – oder möglichst nah bei der Asche eines Lagerfeuers. Nach sächsischer Sitte trugen sie die braunen Haare ziemlich lang. Der ältere hatte einen Vollbart, auf der Oberlippe des jüngeren zeigte sich nur zarter Flaum.
»Was geht hier vor?« fragte ihr Vater. Als er weiterritt und in den Kreis der Reiter einzudringen versuchte, sah sie eine kleine Jagdaxt im Sonnenlicht blitzen und hörte einen Schrei – einen grauenhaften Schrei. Die Adeligen und ihr Gefolge entfernten sich ein wenig voneinander. Sie beobachtete, wie der jüngere der beiden Männer einen Armstumpf hob. Seine Hand lag auf einem Felsbrocken, nutzlos wie ein Stein. Blut sprudelte hervor.
»Sei froh, daß ich dir nichts Schlimmeres antat und Gnade walten ließ!« rief der Herr in den Farben Blau und Gelb, offenbar der Anführer. »Und du ...« Nun wandte er sich zu dem älteren, der auf den Felsen gezerrt wurde. Eine Schlinge glitt über seinen Kopf. »Du wirst wegen Diebstahl hängen!« Er hatte ein bösartiges Gesicht – ebenso wie sein Gefährte, dessen Pferd neben dem verstümmelten Burschen stand. Offenbar waren sie Vater und Sohn, wie die beiden unglücklichen Sachsen.
Der Bärtige rechtfertigte sich nicht, starrte nur entsetzt und in hilfloser Resignation auf seinen Jungen, der blutend am Boden lag.
Beim Anblick der grausigen Wunde stieg Übelkeit in ihr auf. Der Anführer befahl seinen Leuten, den Strick über einen Ast zu werfen. Doch dann hörte sie die durchdringende Stimme ihres Vaters. »Nein! Das werdet Ihr nicht tun ...«
»Diese Sachsenschweine haben in den Wäldern des Königs gewildert«, erklärte der Herr, der ihren Vater zu kennen schien.
»Niemals würde der König eine solche Strafe billigen!« Ihr Vater zog sein Schwert. »Bei Gott, laßt die beiden gehen! Seht Ihr denn nicht? Sie sind fast verhungert. Was bedeutet schon eine Hirschkuh?«
»Um Himmels willen, Vater!« schrie sie. Zu viele Männer standen gegen ihn. Aber hinter ihm riß nun auch Rob sein kleines Schwert aus der Scheide.
»Graf de Montrain«, entgegnete der Anführer, »wollt Ihr wegen dieses Abschaums sterben? Ja, dazu seid Ihr wohl bereit, denn dieser Sachsenwelpe folgt Euch wieder auf den Fersen. Dann soll es so sein!« Auch er zückte die Waffe und befahl seinen Begleitern, diesem Beispiel zu folgen. Wilde Grausamkeit funkelte in den Augen seines Sohnes, der sich offensichtlich auf ein Gemetzel freute.
»Reitet weg!« Der Vater wandte sich rasch um.
Doch Rob wollte nicht fliehen – und sie selbst ebensowenig. Wenn der Graf an dieser Stelle sterben mußte, würden sie mit ihm in den Tod gehen.
Dazu kam es nicht. Während die Gegner heransprengten, stieß der Anführer plötzlich einen Schrei aus. Sein Pferd bäumte sich auf, und er stürzte beinahe aus dem Sattel. Ein Pfeil steckte in seinem Schenkel.
Ein zweites Geschoß flog durch die Luft, dann noch eines. Zwei weitere Männer wurden getroffen, und die anderen brachen den Angriff ab, als die Pferde verängstigt umhertänzelten. »Wo zum Teufel ...«, brüllte der Herr in Blaugelb.
»Da muß sich irgendwo eine Banditentruppe herumtreiben!« rief sein Sohn.
»Jesus, ich will hier nicht sterben!« klagte ein Dritter.
»Dafür werdet Ihr büßen, de Montrain!« drohte der Anführer und hob sein Schwert.
»O nein, de la Ville, denn der König wird sich gewiß auf meine Seite stellen!«
Im nächsten Augenblick stoben die Reiter davon, flüchteten vor den Pfeilen, die auf sie herabregneten. Immer noch die Schlinge um den Hals, stand der ältere Sachse zitternd auf dem Felsen. Der jüngere lag im Gras, umklammerte seinen Armstumpf und stöhnte gequält.
»Die Pfeile!« warnte sie ihren Vater erschrocken, als sie ihn zu den armen Bauern galoppieren sah.
»Uns droht keine Gefahr, das weiß ich«, entgegnete er mit ruhiger Stimme. Er stieg ab und entfernte die Schlinge vom Hals des älteren Mannes, der auf die Knie sank und ihm die Stiefel zu küssen versuchte. »Nein, nein, mein Guter«, wehrte der Graf ihn ab und drehte sich fast hilflos zu seiner Tochter um. »Reiß ein Stück von deinem Ärmel ab, Liebes, sonst verblutet der Bursche.«
Erst jetzt merkte sie, daß sie die ganze Zeit reglos im Sattel gesessen hatte, starr vor Schreck, den Tränen nahe, mit klappernden Zähnen. Doch nun kam wieder Leben in sie. Hastig zerfetzte sie einen ihrer Ärmel sprang vom Pferd und rannte zu dem jungen Mann. Sein Blut bespritzte ihr Kleid, und sie fürchtete, in Ohnmacht zu fallen.
Aber sie nahm ihren ganzen Mut zusammen, und es gelang ihr, seinen Arm zu verbinden. Sein Blut färbte ihr schönes grünes Kleid rostrot. »Danke, Mylady«, flüsterte er, als sie seinen verzweifelten Blick erwiderte.
Sein Vater versuchte, ihm auf die Beine zu helfen, und der Graf befahl den Pagen: »Bringt die Hirschkuh ins Haus dieser Leute! Der Junge braucht kräftige Nahrung, wenn er am Leben bleiben soll. Kann irgend jemand die Wunde verätzen?« fragte er den älteren Bauer in der Sachsensprache, die er von seiner Frau gelernt hatte.
»Ja, seine Mutter.«
»Gut.«
»Aber Mylord«, wandte ein Page ein, »es ist gegen das Gesetz ...«
»Diesen Menschen droht der Hungertod. Und König Henry, unser Gesetzgeber, pflegt Gerechtigkeit zu üben. Er würde mich nicht verdammen. Die Hirschkuh ist tot, und wir sind hier allein.«
»Abgesehen von dem Bogenschützen«, erinnerte Rob seinen Onkel.
»Wir sind nicht gefährdet. Verschwindet jetzt!«
Rasch entfernte sich die kleine Gruppe. Rob hatte darauf bestanden, die beiden Bauern und die Pagen zu begleiten, damit der geschwächte Verwundete das Pferd benutzen konnte, und sie blieb mit ihrem Vater zurück. Schluchzend warf sie sich in seine Arme. »Wie konnten diese bösen Männer nur so etwas tun?«
Tief seufzte er auf und drückte sie an sich. »Nun, es gibt tatsächlich Gesetze, die das Wildern in diesem Wald untersagen.«
»Dann sind das schreckliche Gesetze!«
»Nein, mein Liebes. Die meisten Gesetze sind gut und schützen die Menschen. Die Bauern und Hintersassen arbeiten für uns. Jeder bestellt auch sein eigenes kleines Stück Land. Innerhalb unserer Schloßmauern sorgen wir für ihre Sicherheit, schlichten ihre Streitigkeiten, halten Gericht über unsere Leibeigenen und unsere Freien. Sie dienen uns, und wir ...«
»Wir dienen dem König«, wisperte sie. »Vater, sie haben diese Bauern ›Sachsenschweine‹ genannt – und Rob einen ›Sachsenwelpen‹, in so verächtlichem Ton ...« Ein Schauer rann ihr über den Rücken.
Wieder seufzte er. »Mein Liebes, über hundert Jahre ist es her, seit Herzog Wilhelm aus der Normandie hierherkam, um England zu erobern, und unser König William wurde. Er verdiente seine Krone. Aber sein Volk betrachtet sich immer noch als normannisch, die Engländer sind und bleiben Sachsen. Einerseits hat William gesiegt, andererseits nicht. Nie hörten seine Leute auf, die Sachsen zu fürchten und zu hassen. Aber einige Sachsen konnten ihrerseits die Normannen erobern – so wie deine Mutter mich, als sie mein Herz stahl.« Zärtlich berührte er ihre Wange, und sie erwiderte sein Lächeln. »Die Gesetze sind nicht schlecht, mein Liebling. Henry hat versucht, sie so zu gestalten, daß sie allen Menschen nützen. Er ist ein guter, starker Regent.«
Sie kannte den König, einen gutaussehenden Mann voll unerschöpflicher Energie. Unentwegt zankte er sich mit seiner Frau und seinen Söhnen. Er war rechthaberisch und arrogant, und er verstand es, anderen seinen Willen aufzuzwingen. Aber niemals hatte sie ihn grausam gesehen. Nein, er würde sich nicht so verhalten wie jener Adelsherr in Blaugelb. Sie schaute ihren Vater an. »Die Gesetze sind also gut, solange wir einen guten König haben.«
»Und gute Adelsherren, die gegen die schlechten kämpfen.«
»Aber was geschieht, wenn wir keinen guten König mehr haben und mehr verwerfliche als rechtschaffene Adelige?«
Plötzlich schien er zu erschauern, und er preßte sie noch fester an sich. »Dann wird das Böse dieses Land regieren. Aber eins darfst du nicht vergessen, mein Kind. Ein guter, starker König hält alle seine Kronvasallen eisern im Zaum. Den Lehnsherren von der Sorte, die du heute beobachten konntest, wird nicht gestattet, allzu große Macht auszuüben. Und es wird immer gute Männer geben. Es spielt keine Rolle, welche Sprache sie sprechen, wie sie sich kleiden, woher sie kommen.« Er blickte sich um und dachte wieder an den verborgenen Bogenschützen, der sie alle gerettet hatte.
Die Pagen kehrten mit Rob zurück, der sich rasch aus dem Sattel schwang und zu seiner Kusine eilte, denn sie standen sich sehr nahe. Er nahm sie in die Arme. »Alles wird gut, meine schöne Lady Grünärmel«, beteuerte er ernsthaft. Sie versuchte zu lächeln, und er wandte sich zu seinem Onkel. »So möchte ich auch mit Pfeil und Bogen umgehen können ...«
»Sicher wirst du das noch lernen, Rob. Jetzt mußt du meine Tochter nach Hause geleiten. Roc, Reginald – ihr beschützt die beiden. Ich hole euch später ein.« Gehorsam stiegen die Kinder auf ihre Pferde und ritten davon, gefolgt von den Pagen. Der Graf stand im Wald und lauschte. Ringsum war es still, nur der Wind raschelte in den Bäumen. Trotzdem bezweifelte er nicht, daß er beobachtet wurde. »Danke, mein Freund, wer immer Ihr seid!« rief er leise.
Plötzlich erklangen Hufschläge. Einer von de la Villes Männern galoppierte heran, das Schwert auf de Montrains Hals gerichtet. Sein eigenes konnte der Graf nicht zücken und nicht einmal mit dem Schicksal hadern. Dazu fehlte die Zeit. Es ging alles zu schnell. Wehrlos stand er da und wartete auf den Tod. Doch da hörte er einen Befehl. »Tretet beiseite, Mylord!« Wie aus dem Nichts war ein Mann aufgetaucht. Er gab ihm einen Stoß, als der Graf selbst außerstande war, aus der Bahn des Streitrosses zu springen, das auf ihn zusprengte.
Der Fremde hob sein Schwert, das im schimmernden Grün des Waldes gefährlich funkelte. Unter den Hufen zitterte der Boden. Der Reiter lächelte, seine Waffe hoch erhoben. Sonderbarerweise lächelte er immer noch, als er starb. Blitzschnell wurde sein Schwertstreich pariert, die Klinge des Verteidigers bohrte sich in seine Brust. Nur seine Augen zeigten Staunen und Entsetzen, ehe er leblos vom Pferd fiel. De Montrain starrte auf den Mann hinab, der ihn beinahe getötet hätte. Dann wandte er sich zu seinem Retter, einem jungen Burschen, noch nicht ganz zum Mann gereift, groß, stolz und attraktiv, mit ebenholzschwarzem Haar.
Irgend etwas weckte die Erinnerung des Grafen, und nach einer kleinen Weile lächelte er überrascht. »Ihr seid es!«
Das Blut stieg in die Wangen des Jungen, der offenbar lieber unerkannt geblieben wäre. »Ich kenne das Gesetz«, versicherte er hastig. »Aber ich konnte ihnen einfach nicht gestatten, den alten Mann zu hängen. Die beiden litten schrecklichen Hunger, das sah man ihren Augen an. Und es war doch nur eine Hirschkuh ...«
»Mir braucht Ihr wirklich nichts zu erklären, mein Junge.«
»Und dann konnte ich diesem Schurken natürlich nicht erlauben, Euch niederzumetzeln.«
»Und dafür schulde ich Euch Dank. Ihr braucht nichts zu fürchten. Ich werde Henry die Wahrheit erzählen ...«
»Nein, bitte, sagt nichts!«
De Montrain zögerte kurz, dann stimmte er zu. »Also gut, bei mir ist Euer Geheimnis bestens aufgehoben. Das schwöre ich. Aber wenn Ihr durch den Wald lauft, solltet Ihr Euch besser verkleiden.«
Lächelnd verneigte sich der hübsche Junge. »Über diesen Vorschlag will ich nachdenken ...« Es raschelte im Gebüsch, und er sprang zurück – bereit, sein Schwert erneut zu schwingen. Doch dann atmete er auf. »Da kommt Eure Familie. Gott mit Euch, Mylord!«
»Und mit Euch!« rief de Montrain rasch, doch der Bursche war bereits im Wald verschwunden. Der Graf entfernte sich von de la Villes gefallenem Gefolgsmann, denn die Kinder sollten die Leiche nicht sehen, nicht wissen, daß neue Gefahr gedroht hatte. So eilte er den beiden entgegen.
Im Schatten der Bäume sah er die schönen Augen seiner Tochter glänzen. Diesen Tag würde sie nicht so leicht vergessen. Er versuchte zu lächeln und verneigte sich.
»Ah, meine schöne Lady Grünärmel – Master Robin ...«
Sie erwiderten das Lächeln, aber alle drei wurden sofort wieder ernst. »Reiten wir nach Hause«, fügte er hinzu und stieg auf sein Pferd. »Heute werden wir nicht mehr jagen.«
Unsicher blickte Rob über die Schulter. »Wir kamen zurück, weil ich dachte, ich hätte dich mit jemandem gesehen.«
»So?«
»Und ich glaubte ...«
»Was?«
»Nichts.« Unverhohlene Neugier lag in Robs braunen Augen, und plötzlich leuchteten sie in grimmiger Entschlossenheit. »Eines Tages werde ich meine Pfeile genausogut abschießen können, sogar noch besser!«
»Ich auch!« gelobte de Montrains Tochter.
Unbehaglich musterte der Graf die beiden ernsthaften jungen Gesichter, vor allem die Miene seines Neffen. Der Junge wußte genau, was geschehen war, und er kannte auch den heimlichen Retter. »Der Tag ist vorbei«, erklärte de Montrain energisch. »Reden wir nicht mehr davon.«
Schweigend ritten sie durch den Wald. Langsam brach die Dunkelheit herein. Der Tag war tatsächlich vorbei. Doch die Legenden hatten eben erst begonnen.
1
Sommer 1190, während der Regentschaft von König Richard Löwenherz, im Wald.
Der Anführer des kleinen Banditentrupps duckte sich angespannt hinter einer schmalen Eiche und beobachtete, wie die Adelsherren näher kamen. Seine Augen verengten sich, während er ihre Kampfkraft abschätzte, und sein Herz begann, schneller zu schlagen.
Auf der Tunika des Mannes, der vor seinem kostbar gekleideten Gefolge ritt, prangten die Farben des Hauses Montjoy. Die Plantagenet-Löwen auf goldgelbem Grund bezeugten die Verwandtschaft des Normannen mit dem König. Und mehrere breite Schwerter in der rechten unteren Ecke sollten die Montjoys vielleicht als Ritter und Krieger ausweisen, die ihren Reichtum durch Kampf erworben hatten und auf die gleiche Weise zu bewahren gedachten.
Unbehagen erfaßte den Banditenführer. Was für formidable Gegner ... Aber wie er gehört hatte, waren die Reisenden nur leicht bewaffnet, und Montjoy trug keine Rüstung, nur die Tunika mit dem Familienwappen, eine silbergraue Hose und Lederstiefel, und an der Schulter wurde ein wehender grauer Umhang von einer juwelenbesetzten Brosche zusammengehalten. Der Kopf war unbedeckt, und das rabenschwarze Haar glänzte im Sonnenlicht. Durch diese Farbe wirkte seine furchteinflößende Erscheinung noch bedrohlicher, obwohl er auf einen Panzer verzichtete. Er ritt ein großes, kräftiges schwarzes Schlachtroß, auf dem er wie ein Kriegsgott aussah.
Montjoy ... Nicht er dürfte diesen Wald durchqueren. Man hatte gemunkelt, nur eine kleine Wachtruppe würde diese Wagenladung Weizen, Schafwolle und Münzen begleiten, den armen Bewohnern eines nahen Dorfes abgenommen, als Steuern, die für den Lebensunterhalt von Prinz Johns ›Schutz‹-Heer verwendet wurden. Gewiß, ein guter König trug die Krone. Das Volk liebte und bewunderte ihn. Aber derzeit unternahm er einen Kreuzzug in ferne Länder. Und die starke Kontrolle, die König Henry II. seinen Pairs und der Regierung überantwortet hatte, begann bereits zu zerbröckeln.
Herzöge und Grafen entwickelten sich selber zu kleinen Königen. Vor allem der Bruder des Königs, Prinz John, dürstete nach Macht – insbesondere, seit Richard das Land verlassen hatte.
Das Gesetz blieb den Gesetzlosen überlassen. Aber Montjoy ... Seine kämpferischen Fähigkeiten waren legendär, und der Bandenführer überlegte, ob er sich mit seinen Leuten in die Tiefe des Waldes zurückziehen sollte. Nein. Der beängstigende Anblick des Mannes durfte ihn nicht einschüchtern. Auch Damian Montjoy, Graf von Clifford, war letzten Endes nur ein Sterblicher, so groß und stark er auch erscheinen mochte.
Keine Rüstungspolster ließen die Schultern so breit wirken, keine Stahlplatten verstärkten die harten Muskeln, die unter dem Stoff seiner Kleidung vibrierten. Auch die markanten, klaren Gesichtszüge strahlten eiserne Härte aus. Er besaß hohe Wangenknochen und ein eigenwilliges glattrasiertes Kinn, eine gerade Nase und einen überraschend sinnlichen Mund. Die weit auseinanderstehenden Augen sahen dunkel aus, aber der Bandenführer konnte sie im Licht der Sonne, die jetzt hinter den Reisenden aufging, nicht genau ausmachen.
Dafür zeigte der Sonnenschein etwas anderes um so deutlicher – Montjoys funkelndes Schwert. Vielleicht wäre es ein Fehler, ihn anzugreifen ...
»Jetzt?« fragte der Mann zur Rechten des Banditenführers.
»Noch nicht. Wartet, bis sie nahe genug herangekommen sind, so saß wir sie schwitzen sehen. Wir dürfen ihnen keine Chance geben, sich zu verteidigen.« Wenig später rief der Anführer: »Jetzt!«
Sie sprangen zwischen den Bäumen hervor, fünf Männer in schlichten Wolltuniken und Hosen, in den Farben des Waldes, Grün und Braun. Nur die Schwerter leuchteten hell auf. Sie verstanden ihr Handwerk. Während der letzten Monate hatten sie gelernt, reichen Leuten ihr Eigentum abzunehmen, und mit ihren wilden Drohungen erzielten sie viel größere Erfolge als durch nackte Gewalt.
»Halt, Sir!« Der Banditenführer, der einen grünen Umhang mit Kapuze trug, trat Montjoy entgegen – entschlossen, keine Furcht zu zeigen. »übergebt uns alles, was Ihr dem Volk entwendet habt, und zieht in Frieden weiter!«
Rasch musterte Montjoy die fünf Männer, die seinen Trupp umzingelten, dann lächelte er herausfordernd. »Ich werde nichts herausrücken, was mir gehört.«
»Gebt ihnen, was sie verlangen, Mylord!« rief der dickere der beiden Mönche, die ihn begleiteten.
Montjoy warf ihm einen verächtlichen Blick zu, und der Banditenführer beschloß, die Angst des guten Klosterbruders zu nutzen. »Überlaßt uns die Reichtümer, die Ihr dem Volk geraubt habt, und Ihr könnt in Frieden weiterreiten.«
»Als Mann des Friedens bin ich nicht bekannt«, erwiderte Montjoy, »und ich habe niemanden beraubt.«
»Dann wird Blut an Euren Händen kleben, Sir!«
»Wie du willst!« Blitzschnell riß der Graf sein Schwert aus der Scheide. Zur Verblüffung des Banditenführers schlug er es gegen die Hinterbacken der Pferde, auf denen die Mönche saßen. Beide Tiere bäumten sich auf und rasten die Straße hinab. »Spring auf den Wagen, mein Junge!« befahl Montjoy seinem bleichen, strohblonden jungen Knappen, der sofort gehorchte und die Zügel ergriff.
»Nein!« schrie der Bandenführer – zu spät, denn Montjoy hatte die flache Klinge bereits gegen die Hinterbacke des Wagenpferdes gedroschen, das ebenfalls davonsprengte und alle Reichtümer aus dem Wald beförderte. »Verdammt!« fluchte der Räuber und wandte sich enttäuscht zu seinen Leuten. »Lem, Martin! Versucht den Wagen einzuholen!« Dann drehte er sich wieder um, in der festen Überzeugung, der Graf würde dem Fahrzeug folgen. Doch das war ein Irrtum.
»Nun wirst du dich ergeben, Bursche«, sagte Montjoy, »oder dein eigenes Blut wird an deinen Händen kleben.«
»Großer Gott!« kreischte einer der restlichen zwei Banditen und umklammerte den Griff seiner Waffe. Seine Finger zitterten, aber er war entschlossen, seinen Anführer zu verteidigen. »Stellt Euch meinem Schwert, Mylord!« •
Das tat Montjoy. Ohne dem Jungen Schaden zuzufügen, schlug er ihm mit seiner breiten Schneide das Schwert aus der Hand, das in hohem Bogen zwischen die Büsche flog.
Dann richtete er seinen kühlen, abschätzenden Blick wieder auf den Anführer, der seine Klinge zückte. Trotz des hinderlichen Kapuzenumhangs bewegte er sich geschmeidig im Kreis und versuchte, den Ritter aus dem Sattel zu werfen. Aber Montjoy genoß den Vorteil seiner erhöhten Position und seiner größeren Kraft. Zudem besaß er ein unerschütterliches Selbstvertrauen. Er brach in Gelächter aus und schwang sein Schwert. Klirrend prallten die Schneiden aufeinander, und der Bandit stemmte sich verbissen gegen die überlegene Stärke des Grafen, der ihm zulächelte. »Ein würdiger Kontrahent, wie ich sehe. Aber zu jung, um zu wissen, daß Kampfgeist und Geschick die Unerfahrenheit nicht immer wettmachen können.« Wieder holte er aus, traf die feindliche Klinge mit einem aufwärts gerichteten Streich, und sie landete im grünen Nichts.
Man konnte sich auch in edler Gelassenheit zurückziehen. Das hatte der Anführer schon vor langer Zeit gelernt, und jetzt fand er es ratsam, diese Kenntnisse anzuwenden. Die Räuber wußten, wie man mit dem Wald verschmolz. »Trennt euch!« rief er ihnen zu und stürmte westlich von der Straße in dichtes Gestrüpp. Wenn sie in verschiedene Richtungen flohen, würde der große Lord Montjoy nicht allen folgen können.
Doch daß sie sich zerstreuten, verwirrte ihn nicht im mindesten. Er hatte es nur auf die Gestalt im grünen Umhang abgesehen. Nur für eine kleine Weile war der Bandenführer einem überwucherten, fast vergessenen Pfad gefolgt, als er auch schon Hufschläge hinter sich hörte. Er begann im Zickzack zu laufen, sicheren Fußes und mit diesem Teil des Waldes vertraut, aber ohne Erfolg.
Bald glaubte er, den heißen Atem des Streitrosses im Nacken zu spüren, sogar durch die Kapuze hindurch. Es bäumte sich auf, und um den mörderischen Hufen zu entrinnen, warf er sich seitwärts zu Boden und rollte blitzschnell davon. Keuchend wollte er aufstehen, aber da wurde er erneut angegriffen und niedergestreckt. Montjoy war aus dem Sattel gesprungen. Hastig ergriff der Bandit eine Handvoll Erde und schleuderte sie ins Gesicht seines Gegners.
»Du Narr!« rief Montjoy. »Und ein nichtswürdiger Kämpfer, der mit Schmutz um sich schmeißt.«
Der Bandenführer tastete nach neuen Waffen, um sie gegen den Grafen einzusetzen, der ihn offensichtlich erneut attackieren wollte. »Ein Kämpfer gegen elende Ungeheuer, die dieses Land zu zerstören suchen.« Da er weder Steine noch Zweige fand, krallte er die Finger wieder um einen Erdklumpen. Doch er bekam keine Gelegenheit, ihn auf seinen Feind zu werfen.
Montjoy, vom ersten Geschoß keineswegs geblendet und auch nicht von heller Wut erfaßt, bewegte sich erstaunlich flink und behende für einen so großen, muskulösen Mann. Er sprang vor und stürzte sich auf sein Opfer. Seine harten Oberschenkel klemmten die Hüften des Banditen ein, der die Zähne zusammenbiß, sich verzweifelt wehrte und ihm das Gesicht zu zerkratzen versuchte.
Der Puls des Grafen beschleunigte sich, während er den Räuber festhielt. Verblüfft über seine Erkenntnis, lockerte er die Muskeln seiner Schenkel, was den Gegner veranlaßte, noch entschlossener um seine Freiheit zu kämpfen.
Aber Montjoy war schnell und gnadenlos. Seine behandschuhten Finger umklammerten die Handgelenke seines Gegners und preßten sie zusammen. Gequält schrie der Bandit auf, leistete aber immer noch erbitterten Widerstand.
»So, du kleiner Strolch ...«, begann der Graf und hielt ihn nicht mehr so schmerzhaft fest. Sofort nutzte der Räuber seinen Vorteil, bäumte sich auf und versuchte, nach seinem Peiniger zu treten. »Tod und Teufel!« fluchte Montjoy. »Du willst wohl mit einem Eichenzweig verprügelt werden, was?«
»Gebt mir eine Chance mit einem Schwert oder einem Pfeil ...«
»Du hast deine Chancen verspielt. Ja, ein Eichenzweig wäre genau das Richtige.« Entsetzt zuckte der junge Räuber zusammen, als der Ritter sich herabneigte und lächelnd fortfuhr: »Man sollte dich splitternackt ausziehen und züchtigen, von Kopf bis Fuß.«
Der Bandenführer riß die Augen auf. Splitternackt?
»Was meinst du dazu?« Montjoys Daumen strich über das Kinn des Gefangenen – eine sinnliche Geste, und der Bandit spürte erschrocken, wie sich sein Blut erhitzte. Das wird er doch nicht tun, dachte er. Oder doch? Weiß er, daß er mit einer Frau kämpft?
Ja, so wie er sie berührte – und nach den Gefühlen zu urteilen, die er in ihr weckte ...
Heißer Zorn durchströmte sie – gegen sich selbst gerichtet, aber vor allem gegen ihn. Dann erschauerte sie und schloß die Augen. Erinnerungen kehrten zurück, schienen die Jahre wegzuwischen, so viele Jahre. Doch der Wald war gleichgeblieben, grün und dunkel. Ein junger Mann lag am Boden, Blut quoll aus seinem Armstumpf. Er war bestraft worden, weil er eine Hirschkuh erlegt hatte, um ein paar Bissen für den harten Winter zu erringen. Entschlossen hob sie die Lider und erwiderte Montjoys Blick. »Ich werde Euch töten! Laßt mich aufstehen!«
»Lieber nicht.« Fest umspannten seine Schenkel ihre Hüften. Viel zu intim ... Ja, er wußte es! Mit leiser, aufreizender Stimme sprach er weiter: »Du bist nichts weiter als ein kleiner Dieb hier draußen in den Wäldern, und du mischst dich in Dinge ein, die du gar nicht verstehst. Deshalb solltest du lernen, daheim zu bleiben und – deine Felder zu bestellen. Oder was immer du normalerweise tust.«
»Laßt mich los ...«
»Diebe werden gehängt, weißt du das?«
»Ich werde Euch töten oder Ihr bringt mich um! So oder so, nehmt endlich Eure Hände weg!«
»Hm ...« Offensichtlich genoß er die dominierende Position, die er gerade einnahm. »Früher gab es wirklich harte Normannengesetze gegen Wilderer und Diebe.« Während er sich noch näher herabbeugte, fügte er hinzu: »Für ein Vergehen, wie du es soeben verübt hast, wurden die Leute damals geblendet und kastriert. Lieg still! Oder möchtest du, daß ich deine Männlichkeit abschneide?« Herausfordernd glitzerten seine Augen. Von heißer Wut erfaßt, wollte sie ihm eine passende Antwort geben, aber ihre Stimme versagte. »Mal sehen – wo soll ich anfangen?« überlegte er laut. »Am besten ziehe ich dich erst mal nackt aus. Dann kann ich mir anschauen, was es abzuschneiden gibt.«
Da fand sie die Sprache wieder. »Hängt mich und seid verdammt ...«
»Das Leben ist kostbar, mein kleiner Dieb. Also sollten wir nicht versuchen, einander umzubringen.«
»Dann laßt mich gehen!«
»Kommt gar nicht in Frage ...« Erbost spuckte sie ihm ins Gesicht, und er fluchte. »Ein Dieb und zudem ein schlechterzogenes Balg. Dir werde ich schon noch Manieren beibringen!«
Außer sich vor Zorn griff sie blitzschnell nach dem kleinen Messer, das in Montjoys Stiefelschaft steckte. Die Klinge funkelte direkt vor seiner Nase. »Nun werde ich Eure Kehle durchbohren!« rief sie triumphierend. »Tretet zurück, teurer Mylord! Verschwindet und sucht Euch selber ein Feld, das Ihr pflügen könnt! Ah, wartet! Vielleicht müßte ich Euch nackt ausziehen und Eure Männlichkeit abschneiden.« Die Messerspitze kitzelte die Haut unter seinem Kinn. »Auf die Beine!« befahl der Bandit.
»Oder?«
Spöttisch lächelte sie. Nun hatte sie den Spieß umgedreht. »Oder ich bestrafe Euch, so wie Ihr es mit mir vorhattet, Mylord. Steht auf! Ich will Euch Manieren beibringen, vielleicht mit Hilfe eines Eichenzweigs.«
Seine Augen verengten sich gefährlich, aber er begann, sich aufzurichten.
»Braver Junge!« höhnte sie. »Nun, wo finde ich einen schönen, dicken Eichenzweig? Ich glaube, die Arroganz des großen, starken Ritters würde bald verfliegen, wenn er eine tüchtige Tracht Prügel bekommt. Ah! Aber dafür müßte er gewisse Körperteile entblößen.«
»Nimm dich in acht – oder du wirst kriegen, was du mir androhst!« warnte er.
»Ihr seid es doch, der mit Vergnügen solche Drohungen ausstößt.«
»Bringt mich nicht in Versuchung.«
»Ich – Euch? Aber Mylord, ich bin es, die das Messer in der Hand hält. Ja, ein Eichenzweig auf nackter Haut. Es ist sogar sehr gütig von mir Euch eine Lektion in Demut zu erteilen. Und was wäre erniedrigender als nackt durch einen Wald zu laufen?« hänselte sie ihn. Oh, welch ein süßer Sieg!
Doch sie freute sich zu früh, denn als er aufstand und sie sich ebenfalls erhob, das Messer an seiner Kehle, packte er plötzlich ihre Hand, die den Griff der Waffe festhielt.
»Nein!« kreischte sie. Aber seine Finger glichen stählernen Schraubstöcken, die beinahe ihre Knochen zerquetschten. Mit einem zweiten Schrei ließ sie das Messer los und stöhnte vor Schmerzen.
»Siehst du?« rief Montjoy. »Jetzt gehört das Messer wieder mir.«
Verdammt! Ich muß fliehen, dachte sie. Doch das war unmöglich. Ehe sie sich abwenden konnte, packte er sie am Hemdkragen.
»Ja, jetzt brauche ich noch einen dicken Eichenzweig«, spottete er. »Aber bevor ich einen suche, ziehe ich dich aus.«
Der Bandit versuchte, sich zu befreien, und das Hemd zerriß. Unter seinen Fingern spürte Montjoy weiches Fleisch, und er sah es elfenbeinweiß schimmern. Nicht nur irgendein Mädchen, dachte er, sondern ein außergewöhnliches. Und ein tollkühnes, wütendes. Das erkannte er, als er seinen Griff unwillkürlich lockerte, was ein Fehler war. Er durfte keine Barmherzigkeit zeigen, denn sie würde ihn töten, sobald sich eine Gelegenheit bot.
Ehe sie sich vollends losreißen konnte, umklammerte er ihren Arm, schleuderte sie zu Boden und setzte sich erneut rittlings auf ihre Hüften. Mit Hohn und Spott hatte er sie zur Unterwerfung zwingen wollen. Nun verwirrte ihn die sinnliche Anziehungskraft, die sie auf ihn ausübte. Würde eine erotische Drohung seine Gefangene gefügig machen?
Sie mußte begreifen, in welcher Lage sie sich befand – in welcher Gefahr sie schwebte. Und so hielt er das Messer an ihre Wange. »Zücke niemals eine Waffe, die du nicht gebrauchen willst!« warnte er in eisigem Ton.
Plötzlich begann der Bandit unter ihm zu zittern, gab aber noch lange nicht klein bei und stieß zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor: »Droht mir nicht, Mylord! Bringen wir's hinter uns! Durchschneidet meine Kehle!«
Montjoy berührte das Kinn des Banditen und wischte den winzigen Blutstropfen weg, der hervorgequollen war. Als sie in seine Augen sah, wuchs ihr Grauen. Blut war geflossen. Auf welche Weise wollte er sich rächen? Er würde weder vergeben noch vergessen.
»Worauf wartet Ihr!« fauchte sie. »Tötet mich! Dann ist es endlich überstanden!« Tapfer verbarg sie ihre Angst.
Die Klinge glitzerte im Sonnenlicht, das durch den Baldachin der Blätter drang, dann verschwand sie in ihrer Scheide. »Nein. Ich lege zu großen Wert auf jedes Menschenleben, um es so leichtfertig zu beenden. Aber ich möchte dir ein bißchen Disziplin einbleuen – auf die Art und Weise wie es ein mutwilliges Kind verdient, dem man den Hintern gründlich versohlen muß. Ah, ich habe noch immer keinen Eichenzweig gefunden. Nun muß ihn eben die Hand eines Ritters ersetzen.«
»Das wagt Ihr nicht!« rief der Bandit. »Oh! Laßt mich gehen! Das sind doch nur eitle Drohungen ...«
»Ich spreche niemals eitle Drohungen aus«, entgegnete Montjoy. »Vielleicht wird dich dein verletzter Stolz warnen, denn den kannst du zurückgewinnen, dein Leben nicht.«
»Ich beiße Euch!« warnte der Bandit.
Dieses Mädchen brauchte tatsächlich eine Lektion. Und Montjoy zögerte nicht, seine Drohung wahr zu machen. Ehe seine Gefangene wußte, wie ihr geschah, hatte er sich auf ein Knie niedergelassen, das andere Bein angewinkelt und sie bäuchlings über den Schenkel gelegt. Immer wieder landete seine kraftvolle Hand auf ihrem Hinterteil.
Fluchend und schreiend wehrte sie sich und schließlich gelang es ihr, aufzuspringen. Beinahe verlor sie das Gleichgewicht, als sie zurücktaumelte. Endlich frei ...
Nein, nicht frei. Montjoy war zu schnell. Er erhob sich, packte sie an einem grünen Ärmel und zerrte sie zu sich heran. »Wer bist du? Und was treibst du hier draußen im Wald? Warum greifst du friedfertige Reisende an?«
»Ich bin niemand! Sucht Euch einen anderen Burschen, den ...«
»Einen Burschen!« Laut lachte er auf. Und zu ihrem Entsetzten umklammerte er mit einer Hand ihre beiden Unterarme, während er mit der anderen ihre Brust berührte. Brennend stieg ihr das Blut in die Wangen. »Du bist kein Bursche«, flüsterte er, und seine Finger gruben sich sanft ins weiche Fleisch.
Wieder biß sie die Zähne zusammen, um die köstlichen Gefühle zu bekämpfen, die er in ihr entfachte. Am liebsten hätte sie ihre Faust auf seine höhnisch grinsenden Lippen geschlagen. »Also gut! Ich bin kein Bursche! Und nachdem ich meine Lektion bekommen habe, laßt mich gehen!«
Entschieden schüttelte er den Kopf. »Ich will wissen, wer du bist«, erwiderte er und streifte ihre Kapuze vom Kopf, die ihr Gesicht bisher überschattet hatte. Seidiges goldenes Haar streifte seine Finger und nahm ihm fast den Atem. Sein Herzschlag beschleunigte sich, als er in aquamarinblaue Augen starrte – so schön, wie er sie nie zuvor gesehen hatte.
Oder doch? Einmal ...
»Das ist Wahnsinn«, flüsterte er. »Ich muß wissen, was du tust, wer du bist. Wenn du nicht antwortest, bringe ich dich in mein Schloß ...«
Abrupt verstummte er. Doch das merkte sie nicht sofort. Ihre Gedanken überschlugen sich. In sein Schloß? Wollte er sie dort hängen – dieser Mann, der sie so mühelos überwältigt hatte, der ihren ganzen Körper erhitzte und ihr das Blut in die Wangen trieb? Würde er sich erst mit ihr amüsieren und sie dann aufknüpfen? Nein, niemals. Er wußte nicht, worauf er sich einließ ...
Jetzt erkannte sie, daß er schwieg und über ihre Schulter blickte. Rasch drehte sie sich um und schöpfte neue Hoffnung. Der wahre Fürst des Waldes näherte sich, Robin, jagdgrün gekleidet so wie sie selbst. Er war zu einem attraktiven wohlgestalteten Mann herangewachsen, nicht so groß und kräftig wie Montjoy, aber an Mut mangelte es ihm nicht. Furchtlos ging er auf den Ritter zu, und es überraschte sie, daß er sich unvorbereitet heranwagte. Sein Bogen und der Pfeilköcher hingen an seinem Rücken.
Er schaute nicht seine Kusine an, sondern Montjoy. »Mylord!« rief er rasch und schien zu fürchten, der Graf könnte wieder Gewalt anwenden, um seine Gefangene zu bändigen.
Plötzlich hatte sie Angst um Robin. Sie durfte nicht zulassen, daß ihm ein Leid geschah. Als Lady Grünärmel tat sie viel Gutes, aber es war der Name ihres Vetters, den die Barone fürchteten. Robin war es, der die Armen schützte, und sich nun den Launen des Grafen auslieferte. »Gib acht!« rief sie.
Ich soll mich in acht nehmen, dachte er und starrte sie wütend an. Sofort erkannte sie den Grund seines Zorns. Er wünschte nicht, daß sie sich in Gefahr begab, obwohl sie ihm immer wieder erklärte, sie habe die gräßliche Szene an jenem Tag miterlebt, das Blut mit eigenen Augen gesehen. Doch darauf kam es jetzt nicht an. Er mußte sich vor Montjoy hüten.
»Mylord!« wiederholte Robin. »Ich flehe Sie an. Lassen Sie dieses verängstigte Kind los!«
»Kind!« protestierte sie. Hatte er den Verstand verloren? Erwartete er von diesem hartgesottenen normannischen Ritter tatsächlich auch nur einen Funken Barmherzigkeit?
Montjoy beobachtete, wie sie hastig den Kopf senkte, um die Angst und den Zorn in ihren Augen zu verbergen, wie sie versuchte, die Kapuze wieder über ihr Haar zu ziehen. Wäre er nicht so verwirrt und wütend gewesen, hätte er gelächelt.
Wie gern hätte er sie noch einmal verhauen! Was bildete sie sich eigentlich ein? Glaubte sie, er würde vergessen, daß sie eine Frau war? Inzwischen hatte er sie erkannt, doch das schien sie nicht zu ahnen.
Zögernd ließ er ihren Ärmel los, und Robin befahl ihr: »Geh!«
Sie starrte ihn an, dann wandte sie sich zu Montjoy und erwartete, er würde erneut nach ihr greifen. Doch das tat er nicht.
»Robin, ich kann dich nicht mit ihm allein lassen ...«
»Geh!« herrschte er sie noch einmal an. »Er wird dich nicht aufhalten, also verschwinde, ehe er sich andres besinnt. Graf Clifford und ich werden uns sicher einigen.«
Wieder schaute Montjoy in ihre Augen, so schön, so leidenschaftlich und herausfordernd. Augen, die ihn verachteten, die ihn zu verbrennen drohten ... Endlich gehorchte sie und lief flink wie ein Reh davon.
Der Mann in Jagdgrün und Lord Montjoy standen sich gegenüber. Zunächst wartete Robin, um sicherzugehen, daß seine Kusine außer Hörweite war. Sie durfte nicht wissen, was er mit diesem Ritter besprach. Schließlich brach er das Schweigen und ließ seufzend die Schultern hängen. »O Gott, Damian, es tut mir leid.«
Ärgerlich schüttelte Montjoy den Kopf und musterte den Mann in Grün, den Gesetzlosen, der eigentlich sein Feind sein müßte. »Um Himmels willen, was treibst du hier, Robin? Wäre sie mir nicht zu jung erschienen, hätte ich ihr womöglich die Kehle durchgeschnitten.«
»Du weißt, wer sie ist?«
»Vielleicht. Sag es mir, dann kann ich mich vergewissern.«
»Das darf ich nicht. So wie dieser Wald hüte auch ich die Geheimnisse, die mir anvertraut wurden. In meinem Herzen bewahre ich die Namen vieler, die nicht erkannt werden wollen. Ich gebe sie nicht preis und genausowenig werde ich verraten, was wir beide miteinander reden.«
»Ah, aber diesmal geht es möglicherweise um den König.«
»Ich schwöre dir, Damian, ich werde herausfinden, was hier vorgefallen ist.«
»Du hast ihr also nicht befohlen, mich anzugreifen?«
»Natürlich nicht! Es war ihr eigener Entschluß, und es wird nie wieder geschehen.«
»Sorge dafür!« warnte Damian leise. »Offensichtlich gibt es gewisse Probleme mit deiner Autorität.«
»Nicht, was meine Männer betrifft«, entgegnete Robin kühl. Dann lächelte er schwach. »Aber mit meiner Kusine schon, das gebe ich zu.«
»Falls sie dir weiterhin zusetzt – die Lady ist nicht meine Kusine, also müßte ich keine Rücksichten nehmen. Nur zu gern würde ich sie in ihre Schranken weisen.«
»Du verstehst nicht ... An jenem Tag im Wald schlossen wir ein Bündnis. Sie war dabei ...«
»Und darauf beruft sie sich!« stieß Montjoy erbost hervor. »Aber das ist ein gefährliches Spiel, daran darf sie nicht teilnehmen.«
»Ich glaube, vorerst wird sie sich deutlich genug an die Begegnung mit dir erinnern.«
»Besser eine Begegnung mit mir als mit dem Schwert eines anderen! In Zukunft mußt du verhindern, daß sie den Banditenführer spielt!«
»Selbstverständlich hast du recht. Sie pflegt mir Neuigkeiten mitzuteilen, das ist alles, was ich ihr gestatte. Nie wieder wird sie sich so leichtsinnig verhalten, das verspreche ich.« Eindringlich fügte Robin hinzu: »Aber nun hat sie uns zusammen gesehen. Kann ich ihr alles erzählen, was ich von dir weiß? Von Rechts wegen müßten wir einander ermorden. Wie sollen wir auseinandergehen, nachdem wir uns vor ihren Augen getroffen haben, mein Freund?«
»Weiß sie Bescheid über unsere Beziehung?«
Robin lächelte. »Du meinst unsere Blutsverwandtschaft? Oder die Freundschaft zwischen zwei Waldbewohnern?«
»Beides.«
»Kein Mensch würde glauben, daß der große Graf Clifford mit einem Banditen verwandt ist.« Nach einer kurzen Pause fuhr Robin fort: »Und es käme niemandem in den Sinn, das Volk könnte dein Mitleid erregen. Nun, mit welcher Begründung sollen wir beide friedlich unserer Wege gehen?«
Damian dachte eine Weile nach. »Ah, jetzt hab ich's! Das wird den Legenden neue Nahrung geben und den Klatschmäulern Gesprächsstoff liefern. Wir fochten gegeneinander, aber in einem so ausgeglichenen Kampf, daß wir die Entscheidung vertagten. Nun, wie klingt das?« Noch während er sprach, ging er zu seinem großen Hengst, der fügsam zwischen den Bäumen gewartet und das üppige grüne Gras genossen hatte.
Lächelnd verneigte, sich Robin, als Montjoy aufstieg. »Du wärst jedem König oder Prinzen gewachsen.«
»Das hoffe ich«, entgegnete Damian leise und hob die Zügel. »Bald folge ich Richard ins Heilige Land. Gib während meiner Abwesenheit gut acht. Ich flehe dich an.«
»Wie immer. Und du, mein Freund, hüte dich vor den Schwertern der Sarazenen«
»Oh, ich komme schon zurecht. Möge es England genauso gut ergehen wie mir.«
Robin schlenderte zu dem Rappen und strich über die weiche Nase. »Mußt du gehen? Gerade jetzt, wo es so aussieht, als könnten wir da und dort unsere Position stärken? Man behauptet, ein gewisser Robin Hood richte großen Schaden in den Wäldern an. Und jene, die gegen die Gesetze des verstorbenen Henry II. verstoßen und die Armen mißhandeln, besonders unsere sächsischen Bauern, würden erbittert von jenem sonderbaren Ritter bekämpft, der Silberschwert heißt.«
»Also hat der Kerl mittlerweile einen Namen?«
Damian schnitt eine Grimasse, und Robin fuhr fort, die Pferdenase zu streicheln.
»Du kennst die Leute. Sie lieben es, Geheimnisse zu benennen.«
»Tatsächlich?« Montjoy neigte sich herab, und seine Augen wurden schmal. »Und der Bandit, dem ich soeben begegnet bin und der keinen Fuß in diese Wälder setzen dürfte?«
Unglücklich zuckte Robin die Achseln. »Man munkelt, sie würde Lady Grünärmel genannt, wie sonst?« Gequälter Humor schwang in seiner Stimme mit, dann seufzte er wieder. »Aber sie war nicht so gefährdet, wie du glaubst.«
»Obwohl sie mir gegenübertrat?«
»Sie versteht es ausgezeichnet, das Schwert ihres Vaters zu schwingen.«
»Trotzdem hätte ich sie töten können. Und was meinst
du, was andere Männer mit ihr tun würden?« •
Das wußte Robin nur zu gut. Er hatte gesehen, wie sich gewisse Männer im Wald aufführten. »Du kennst sie nicht«, entgegnete er leise.
»Und du solltest beten, daß ich sie nicht kennenlerne! Doch du irrst dich. Hin und wieder werden sich wieder unsere Wege kreuzen. Und dieses Feuer glüht stets in ihren Augen. Glücklicherweise bist du für sie verantwortlich.«
Robin lachte. »Ihre Mutter war die Schwester meines Vaters. Während meine Mutter die Kusine deiner Mutter war. Und meine liebsten Verwandten können keine Freunde sein. Wie schade!«
»Nach meiner Meinung müßte man sie in einen Turm sperren, um sie zu schützen. Ihr Vater ...«
»Er ist tot«, erinnerte Robin den Grafen. »Er starb am selben Fieber, das ...« Er unterbrach sich, dann fügte er mit sanfter Stimme hinzu: »An jenem Fieber, daß auch Alyssa hinwegraffte. Es tut mir so leid, Damian.«
»Ja, mir auch.« Energisch bekämpfte Montjoy den Schmerz, der ihn immer noch zu überwältigen drohte, wenn er an das Mädchen dachte. »Und ich bedauere zutiefst, daß deine Kusine ihren Vater verloren hat. Einen so guten, anständigen Mann trifft man heute nur selten. Aber was seine Tochter betrifft – sie muß gebändigt werden und braucht einen Ehemann.« Er zuckte die Schultern. »Bald wird Richard dafür sorgen.«
»Aber sie will nicht heiraten. Sie schätzt ihre Unabhängigkeit, ihr Leben in den Wäldern, ihre Freiheit.«
»Dieser Freiheitsdrang wird sie eines Tages um Kopf und Kragen bringen. Aber wie gesagt, du bist es, der die Verantwortung für sie trägt. Paß gut auf, mein Vetter.«
Lächelnd lüftete Robin seinen Hut. »Gesegnet sei unser guter König Richard und möge er so schnell wie möglich zurückkehren!«
»Amen!«
Mit diesen letzten Worten trennten sich die beiden Männer, und der Wald hütete ihre Geheimnisse.
2
Sommer 1192, der Kreuzzug des Königs. Marsch nach Jerusalem.
»Faßt euer Ziel ins Auge, Bogenschützen – Feuer!« rief Damian und schwenkte sein Schwert, um die wackeren Engländer zu dirigieren, die Richards Karawane angehörten.
Niemand – auch kein gekröntes Haupt in Europa – bestritt, daß Richard Löwenherz ein außergewöhnlicher Ritter und brillanter militärischer Taktiker war.
1189 hatte Friedrich I., Kaiser von Deutschland, den Kreuzzug begonnen. Im nächsten Jahr waren ihm Richard von England und Philipp von Frankreich gefolgt und zunächst nach Sizilien geritten, wo sie den Winter im heftigen Streit verbracht hatten. Dann zogen sie weiter nach Zypern, das sie eroberten.
Inzwischen hatte sich Damian zu seinem König gesellt. Als sie Akka im Heiligen Land erreichten, befahl der Monarch seinen Truppen, Stellung zu beziehen, um die Stadt zu belagern. Stillschweigend wurde sein Kommando von allen Kreuzfahrern anerkannt, und er feierte einen überwältigenden Sieg.
Damian hatte seine Ritter in den Kampf gegen die Männer geführt, die in der Garnison abgelöst worden waren. Da weder neue Krieger noch Proviant eintrafen, beugte sich die Garnison schließlich der zweijährigen Belagerung. Richard hatte die Kapitulation erzwungen.
Darüber freute sich Damian von ganzem Herzen. An den Kampf in der Wüste ebensowenig gewöhnt wie seine Männer, litt er Tag für Tag unter der drückenden Hitze, wenn die sengende, blendende Sonne aufging, und Nacht für Nacht unter der plötzlichen Eiseskälte. Und überall war Sand, in seiner Kleidung, in seinen Stiefeln. Sie schienen im Sand zu ersticken. Sogar wenn er schlief, spürte er Sand im Mund. Außerdem lebten hier fremdartige Schlangen und Insekten, und seine Leute lernten nur mühsam, vor welchen sie sich während ihrer Nachtruhe in acht nehmen mußten.
Trotzdem genoß er seinen Aufenthalt im Heiligen Land, und er bewunderte die Fähigkeiten seines Königs. Nun marschierten sie die Küste hinab, um als letzte Festung Jerusalem zu erobern, fast fünfzigtausend disziplinierte Männer. Auf dem Meer folgte ihnen Richards Flotte. Pro Tag legten sie nur kurze Strecken zurück und scharten sich dicht zusammen.
Saladin, der große Sultan und muslimische Kommandant, griff die Flanke der Kreuzfahrer immer wieder vom Land her an und versuchte, das Heer auseinanderzusprengen. Aber Richard durchschaute die Strategie und verbot seinen Rittern, sich auf Kämpfe einzulassen. Und so blieben seine Reihen ungebrochen.
Aber als Saladins Türken ein Nachhutgefecht anstrebten, gab der König seinen Befehlshabern endlich das Zeichen zur Gegenwehr. Damian war bereit, sobald der verabredete Trompetenruf erklang. Englische Bogenschützen hatten sich während des Marsches im gesamten Heer verteilt und mit ihren Pfeilen die Feinde auf Distanz gehalten. Nun leiteten sie einen machtvollen Angriff ein.
Ihre Pfeile flogen durch die Luft, und das gut organisierte Kreuzfahrerheer stürmte den Türken in geballter Formation entgegen. Damian stieß einen Kriegsruf aus, drückte die Fersen in die Flanken seines Schlachtrosses und genoß den Kampf gegen die Heiden. Unter den donnernden Hufen flogen Erde und Sand empor. Mit seiner leichten Kavallerie galoppierte er einer berittenen Türkentruppe entgegen. Seine Feinde waren ausgezeichnete Schwertfechter. Das wußte er genausogut wie seine Ritter.
Die Pferde prallten gegeneinander und wieherten schrill vor Schmerz, wenn sie ein Schwertstreich traf, der für einen Mann bestimmt war. Doch das Geschrei der Kämpfer ging beinahe im Schlachtenlärm unter – Stahl klirrte, krachend stürzten Rosse und Reiter in schweren Rüstungen zu Boden.
Immer wieder tauchten dunkle Gesichter vor Damian auf. Eng umzingelt, stand er in den Steigbügeln und schlug mit seinem Schwert auf die Gegner ein. Einer nach dem anderen wich zurück oder starb. Aus einer Schnittwunde an der Stirn rann Blut in seine Augen. Rasch wischte er es weg. Nicht einmal für kurze Frist durfte er geblendet sein.
»Ihnen nach!« schrie ein Kreuzritter.
»Nein!« befahl Damian. »Wir zerstreuen uns nicht! Eine Order des Königs! Wenn wir uns trennen, wird uns der Feind besiegen.« Für einen Augenblick glaubte er, die Kontrolle zu verlieren. Doch dann erlosch die wilde Kampflust seiner Männer, und er wußte, daß seine beruhigenden Worte die gewünschte Wirkung ausgeübt hatten. Er blinzelte, denn die Wunde an seinem Kopf begann zu schmerzen. Doch er hatte von Richard gelernt, niemals Schwäche zu zeigen. Und das würde er auch jetzt nicht tun. »Kümmern wir uns um unsere Sterbenden und Toten. Für die gefallenen Feinde wird Allah sorgen.«
Am späten Abend nach dem Kampf traf Damian in einem großen Kriegszelt, das in der Wüste aufgeschlagen war, mit dem König und den anderen Kommandanten zusammen. Es war ein erstaunlicher Sieg gewesen. Die Kreuzritter hatten etwa siebenhundert Mann verloren, die Türken an die siebentausend. Man beglückwünschte Richard, und dann wurde ausgiebig gefeiert.
Zahlreiche Frauen waren Saladins Heer gefolgt und schlugen sich nun auf die Seite der Sieger. In dieser Nacht gab es reichen Lohn für die müden Krieger – Lamm- und Ziegenbraten, süße Datteln und Trauben. Üppig floß der Wein in die Kelche der Kreuzritter. Musiker spielten eine seltsame Mischung aus europäischen Klängen und fremdartigen, melancholischen Wüstenmelodien. Gaukler traten auf, dressierte Tiere führten ihre Kunststücke vor.
Und die Frauen – ah, Allahs Frauen ... Dunkelhäutige Schönheiten wiegten die Hüften, schienen im Tanz ihre Seelen zu entblößen. Ihre Mandelaugen lockten und betörten, versprachen ungewöhnliche, exotische Sinnenlust.
Damian lehnte in einem violetten Kissen, schloß die Lider und lauschte dem pulsierenden Fest. Plötzlich erlosch seine Siegesfreude. Er war ein christlicher Ritter, und er würde sterben, so wie die Templer und die Mitglieder anderer heiliger Orden, für seinen König, für seinen Gott. Aber er hegte keinen Groll gegen die Menschen, die dem Islam huldigten. Im Heiligen Land hatte er faszinierende, gebildete Muslims getroffen. Sie sprachen mit sanften Stimmen, sorgten gut für ihre Kinder. Wie der König hatte er ihre Architektur studiert und neue Erkenntnisse aus den ummauerten Städten und Festungen, den kunstvollen Fliesenböden und Mosaiken gewonnen.
Manchmal gewann er den Eindruck, diese ›Ungläubigen‹ wären viel zivilisierter als die Bewohner des Landes, das er verlassen hatte. In England bekämpften sich die Sachsen und Normannen immer noch, so viele Jahrzehnte nach der Eroberung. Bei Hof wurde Französisch gesprochen, sogar der König nahm nur selten ein englisches Wort in den Mund. Und die Adelsherren fochten um jedes kleine Stück Land. Sicher, Grundbesitz bedeutete Macht, und dies waren turbulente Zeiten. Richard mochte ein gerechter König sein, doch sein Herz gehörte seinen Angevin-Ländereien, Aquitaine und Tours, nicht England. Er war der König von England, doch er regierte ein viel größeres Reich.
»Damian!« Eine Flüsterstimme riß ihn aus seinen Gedanken, und er öffnete die Augen. Affa kniete neben ihm, eine der Tänzerinnen. Ein Sultan, der in der Nähe Akkas lebte, hatte sie dem König geschenkt, nachdem die Stadt eingenommen worden war.
Das schien die junge Frau nicht zu stören. Sie tanzte leidenschaftlich gern, die Wangen erhitzt, lächelnd und verführerisch. Mit ihrem langen pechschwarzen Haar und den großen Augen, eingehüllt in zahlreiche purpurne und lila Schleier, sah sie wunderschön aus.
»Nun, Affa?«
Ihre Finger glitten über Damians Arm, zart wie Schmetterlingsflügel und doch aufreizend. »Soll ich heute nacht auf Euch warten?«
Warum nicht? Affa und andere Mädchen pflegten ihn in ungeahnte Geheimnisse einzuweihen. »Komm doch jetzt zu mir«, neckte er sie leise, doch sie schüttelte den Kopf.
»Der goldene König wird Euch rufen. Das habe ich gehört. Er hat das Fest bereits verlassen und hält Rat mit seinen Männern. Irgend etwas ist geschehen. Jemand ist mit einem Schiff gekommen, und man behauptet, der König sei traurig und wütend. Und man hat mir erzählt, er würde oft Buße tun und den Christengott bitten, ihm zu verzeihen, was er im Zorn anrichtet.«
»Mir grollt er nicht«, versicherte Damian. Aber seine Neugier war erwacht, und er erhob sich. Wenn jemand übers Meer gesegelt war, brachte er vielleicht eine Nachricht aus England mit. Plötzlich wurde Damian von heftigem Heimweh erfaßt. Jerusalem lag nicht mehr allzuweit entfernt. Würde er es ertragen, sich so lange zu gedulden, bis sie die Stadt erobert hatten?
Affa schaute zu ihm auf. »Soll ich später kommen?«
»Ja ...«, begann er, dann unterbrach er sich und überlegte, wie die Besprechung mit Richard verlaufen mochte. Die Nacht konnte lang werden. Und in seinem Kopf pochte es immer noch schmerzhaft. Trotz der beträchtlichen Talente, die Affa besaß, wollte er diesmal allein schlafen. Er streichelte ihre Wange. »Nein, ruh dich aus, meine Kleine. Irgend etwas stimmt da nicht. Die Unterredung wird wahrscheinlich sehr lange dauern.«
Er verließ das große Festzelt, ging in die Nacht hinaus und blickte zum samtschwarzen Himmel auf, gerade rechtzeitig, um eine Sternschnuppe zu sehen. Sie schien nach England zu rasen. »Ein Omen, Lord Montjoy«, sagte eine sanfte Stimme. Verwirrt drehte er sich um. Seine stets geschärften Sinne nahmen jede noch so geringfügige Bewegung wahr, sogar die leisesten Schritte im Wüstensand. Aber er hatte Ani Abdul nicht kommen hören.
So wie Affa war auch Ari nach dem Fall von Akka ein Geschenk an den König gewesen. Die ortsansässigen Scheichs hatten um des Königs Gunst gebuhlt und sich bemüht, ihr Leben, ihre Würde und zumindest einen Teil ihrer Schätze zu retten.
Ari war ein sonderbarer Mann und nach Damians Meinung schon ziemlich alt, obwohl seine olivfarbene Haut kaum Falten aufwies und sein Rücken nicht gebeugt war. Aber nicht nur die bläulichen Schatten um die großen dunklen Augen wiesen auf sein Alter hin, sondern auch seine Schicksalsverbundenheit und eine Weisheit, die nur im Lauf vieler Jahre entstehen konnte. Der faszinierende Muslim pflegte weiße Roben zu tragen, die trotz der Hitze und des Staubs immer makellos sauber blieben.
»Guten Abend, Ari«, erwiderte Damian, fest entschlossen, sich nicht in das seltsame magische Netz ziehen zu lassen, das dieser Mann zu weben verstand.
»Eine schöne Nacht ...« Ari schaute in die Richtung, wo die Sternschnuppe herabgefallen war. »Ich glaube, Ihr werdet die Wüste vermissen.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Bald werdet Ihr heimkehren, Lord Montjoy.«
»Da irrst du dich, Ari. Ich werde dem König auch weiterhin zur Seite stehen. Jerusalem muß erobert werden.«
»Das wird geschehen, aber ohne Eure Hilfe.«
Eigentlich wollte Damian über diese Behauptung lachen, aber er verspürte ein leichtes Unbehagen. »Und wo werde ich sein?« fragte er, ärgerlich über sich selbst.
Warum machte er bei diesem Spiel mit? Weil so vieles eingetroffen ist, was Ari prophezeit hat, sagte er sich. Der Mann steckte voller Widersprüche – ein Muslim, den die christliche Religion sehr interessierte. Er war unglaublich klug. In seinem Kopf konnte er blitzschnell fantastische Summen addieren. Die Sterne kannte er ebensogut wie das Land ringsum und die Wirkungskraft sämtlicher Kräuter. Damian hatte ihn Wunden heilen sehen, an denen so manche Kreuzfahrer ohne diese fast magische Hilfe gestorben wären.
Lächelnd verneigte sich Ari. »Ich werde bei Euch sein.«
Damian seufzte. »Und wo werde ich sein?«