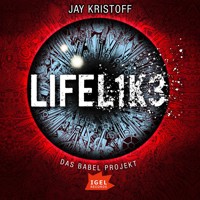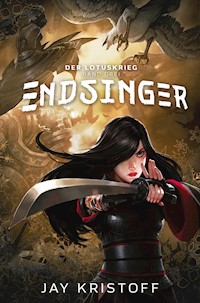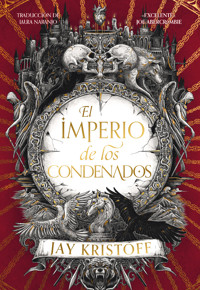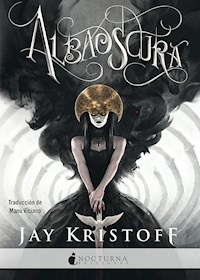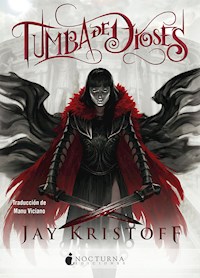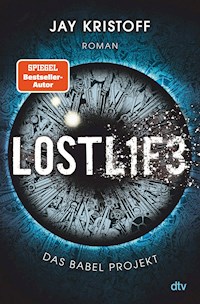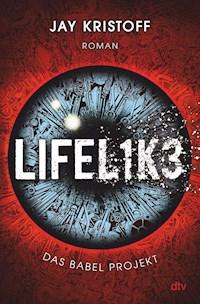Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Vorgeschichte der epischen neuen Fantasy-Reihe DER LOTUSKRIEG von Bestsellerautor JAY KRISTOFF, angesiedelt im feudalen Japan! Eine Steampunk-Welt am Rande des Untergangs: Dem Inselreich Shima droht ein ökologischer Kollaps. Einst war es reich an Sagen, reich an Traditionen, doch hat die Lotusgilde unerbittlich die Industrialisierung vorangetrieben. Nun ist der Himmel rot wie Blut, die Erde ist vergiftet und die großen Naturgeister, die in alter Zeit durch die Wildnis Shimas streiften, sind verschwunden. Die Novelle "Last Stormdancer" spielt 100 Jahre vor der Lotuskrieg-Trilogie und dem Aufstieg der einzigartigen Heldin und Sturmtänzerin Yukiko. Meisterhaft erzählt Erfolgsautor Jay Kristoff von der Entstehung der Gilde und der Flucht der Donnertiger aus Shima. Die Novelle beleuchtet die geschichtlichen Ereignisse, die den Hintergrund für Yukikos und Buruus Heldenreise bilden. Erzählt aus der Perspektive einer Donnertigerin, ist diese Novelle eine faszinierende neue Facette der Lotuskrieg-Saga! Zusätzlich enthalten ist die poetische und herzzerreißende Kurzgeschichte "Wollte es doch regnen", die 2013 den Aurealis Award for Best Fantasy Short Fiction gewann (einen jährlich vergebenen Literaturpreis für australische Science-Fiction-, Fantasy- und Horrorliteratur). Miho, die mit Tieren sprechen kann, verliebt sich in einen jungen Raffineriearbeiter. Außerdem malt die Kurzgeschichte ein eindrucksvolles Bild der sterbenden Stadt Kigen, die der Leserschaft bereits aus der Lotuskrieg-Trilogie vertraut ist …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER LOTUSKRIEGLASTSTORMDANCER
VON
JAY KRISTOFF
Ins Deutsche übersetzt von
AIMÉE DE BRUYN OUBOTER
Die deutsche Ausgabe von DER LOTUSKRIEG: LAST STORMDANCER wird herausgegeben von Cross Cult / Inh. Andreas Mergenthaler, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg. Verlagsleitung: Luciana Bawidamann; Programmleitung Romane/Sachbücher: Markus Rohde; Übersetzung: Aimée de Bruyn Ouboter; Lektorat: Bernd Sambale, Kerstin Feuersänger; Korrektorat: Peter Schild; Satz: Rowan Rüster; Leitung Vertrieb: Peter Sowade; Marketing: Jana Rahders;
Printausgabe gedruckt von CPI books GmbH. Printed in Germany.
Copyright © 2012 by Jay Kristoff
Translated from the English language: PRAYING FOR RAIN
Copyright © 2012 by Jay Kristoff
Translated from the English language: LAST STORMDANCER
Umschlag-Illustration: Luisa J. Preissler | www.luisapreissler.de
Clan-Logo-Design: James Orr
German translation copyright © 2023 by Cross Cult.
ISBN Paperback-Ausgabe: 978-3-96658-977-2 (Februar 2023)
ISBN limitierte Hardcoverausgabe 978-3-96658-979-6 (Februar 2023)
E-Book ISBN: 978-3-96658-978-9 (Februar 2023)
WWW.CROSS-CULT.DE
INHALT
Wollte es doch regnen
Last Stormdancer
WOLLTE ES DOCH REGNEN
Die Möwen rufen über der Bucht.
Ich sitze mit untergeschlagenen Beinen am Ende der achten Landungsbrücke und lausche ihnen. Zu viert ziehen sie ziellose Kreise am teerfleckigen Himmel – ich kann mich nicht daran erinnern, je so viele auf einmal gesehen zu haben. Ölige Wellen schwappen gegen die verrottenden Holzpfähle unter mir. Motorengeheul, Propellergeknatter und Lotusfliegengesumm lassen die blutrote Luft erzittern; ringsumher lärmen Zahnradgetriebe, scheppert Metall, schnattern Menschen. Doch ich habe mich in die Stille meines eigenen Kopfes zurückgezogen und höre zu, was die Möwen sagen.
Manchmal rede ich mit ihnen.
»Hallo«, sagt jemand hinter mir.
Ein Junge. Er spricht leise, und es klingt, als hätte er gerade erst aufgehört zu lachen und würde noch immer lächeln. Ich wende mich um und werfe ihm durch die dunklen Gläser meiner polarisierten Schutzbrille einen Blick zu. Hinter ihm am Himmel hängt wie ein glühendes Stück Kohle die untergehende Sonne und taucht alles in grelles Licht. Der Junge ist kaum mehr als eine Silhouette.
Dass er zu dünn ist, sehe ich trotzdem. Seine schmutzigen, zerlumpten Kleider stinken nach dem blauschwarzen Smog, der wie eine Glocke über der Stadt hängt und die brennende Hitze zwischen den Häusern gefangen hält. Er schiebt sich die Schutzbrille auf die Stirn hoch und reibt sich die Augen. Das Weiße darin ist so rot wie bei einem Lotusjunkie. Unter seinen abgebrochenen Fingernägeln klebt schwarzes Schmierfett. Und doch hat er irgendetwas an sich … Ich weiß nicht recht, wieso, aber in meinem Bauch flattern lauter Schmetterlinge durcheinander. Mir wird klar, dass ich ihn anstarre: die Linie seines Unterkiefers, die hohen Wangenknochen, die starken Hände. Also versuche ich, etwas zu sagen.
Wenn es mir bloß nicht die Stimme verschlagen hätte.
»Hallo«, bringe ich endlich heraus.
»Darf ich?« Der Junge deutet neben mich auf den Steg. Die Sonne hat das Holz ausgebleicht, der schwarze Winterregen hat es blassgrau gefärbt. Der Junge setzt sich die Schutzbrille wieder richtig auf, aber ich sehe noch, dass seine schwerlidrigen Augen haselnussbraun und wie die Spitzen von Naginata-Klingen geformt sind.
»Wenn du möchtest.« Ich zucke mit den Schultern und schaue wieder den Möwen zu.
Wäre ich eine Hofdame im Palast des Shōguns, würde ich jetzt meine geröteten Wangen hinter meinem flatternden Fächer verbergen. Ich würde ihn über die Kante hinweg anblicken, die Augen mit schwarzem Kajal umrandet und blau gepudert, und etwas Geheimnisvolles zu ihm sagen. Vom Palast aus kann man die ganze Stadt überblicken und die Nase so hoch in die Luft recken, dass man den Gestank der Abgase nicht riecht, die aus den Auspuffen der Stromgeneratoren und motorisierten Rikschas quellen. Doch wir sind nicht im Palast – der erhebt sich weit hinter uns auf dem Hügel –, und meine Augen sind nicht mit Kajal und blauem Puder geschminkt, sondern mit Schweiß, Staub und Asche.
Und etwas Geheimnisvolles will mir partout nicht einfallen.
Der Junge setzt sich neben mich auf den Steg, lässt die Beine über den Rand baumeln und hebt das Tuch, das er sich vor Mund und Nase gebunden hat, um ins teerschwarze Wasser zu spucken. Ich erhasche einen Blick auf seine Lippen, seinen Hals und die Drosselgrube zwischen seinen Schlüsselbeinen. Hinter uns laufen Maschinen an: Zuerst stottern und husten sie, dann grollen sie wie Donner. Wir drehen beide die Köpfe und beobachten, wie ein Himmelsschiff ablegt und von den hohen Ankertürmen fortsteuert, die um die Bucht herum aufragen wie verrostende Metallzähne.
Das Schiff ist groß und behäbig, der Rumpf schwer gepanzert. Die Propeller schneiden durch die dicke, verpestete Luft. Auf den zigarrenförmigen Ballon ist der Kami des Tora-Clans gemalt: ein prächtiger Tiger auf der Pirsch. Seine Zähne und Krallen sind so scharf wie die Klingen der Daishō, die die eisernen Samurai an Deck in ihren Obi tragen. Zweifellos wollen sie nach Osten, nach Morcheba. Weitere Soldaten auf dem Weg in den ruhmreichen Eroberungskrieg gegen die widerspenstigen Gaijin-Barbaren. Zwischen den Halbmasken der Samurai sehe ich die ernsten Gesichter der jungen Bushimänner: neues Mahlgut für die Mühle. Rekrutiert aus den Armenvierteln und Barackensiedlungen: Man hat ihnen drei Münzen am Tag und Zugehörigkeit zum mächtigen Tora-Zaibatsu versprochen. Und natürlich einen so ehrenvollen Grund, in die Schlacht zu ziehen, dass man dafür zu sterben bereit ist.
Das oder etwas Ähnliches muss mein Vater wohl geglaubt haben.
Ich wende mich ab.
Das Schlachtschiff fliegt über uns hinweg und verdunkelt die Sonne. Der Junge schaut noch zu ihm hoch, und ich betrachte unauffällig die einfache Tiger-Tätowierung auf seinem Bizeps. Seine kräftigen Muskeln zeichnen sich deutlich unter seiner Haut ab. Schnell gucke ich wieder weg: Er soll nicht denken, dass ich ihn anstarre. Wir gehören zum selben Clan. Dem Clan, der das Inselreich regiert. Tigerblut fließt durch unsere Adern.
Unter dem ganzen Dreck ist seine Haut so blass, dass ich erst dachte, er käme vielleicht aus dem Norden: aus Phönix-, Drachen- oder vielleicht sogar Fuchs-Gebiet. Kigen ist die Hauptstadt des mächtigen Reiches Shima, das Herz seiner Macht, und Clansleute aller vier Zaibatsu hocken in den Rauchhöhlen und Teehäusern und wimmeln durch Straßen und Gassen. Mein Vater hat immer gesagt, früher oder später würde jeder Mann seine Schritte nach Kigen wenden … Doch dann hat der Krieg ihn verschlungen und meine Mutter gleich mit. Tagein, tagaus sitzt sie am Fenster unseres Anwesens und starrt mit leerem Blick nach draußen.
Sprechen tut sie gar nicht mehr. Aber nachts höre ich sie manchmal noch weinen.
»Darf ich nach deinem Namen fragen?«
Mein Blick ist auf die Bucht gerichtet, aber aus den Augenwinkeln sehe ich, dass der Junge mich anschaut.
»Tora Miho«, sage ich – zuerst kommt der Name meines Clans, dann meiner. So ist es Brauch. So ist es schicklich. Wieder beobachte ich die Möwen, höre aber ihren Stimmen in meinem Kopf nicht länger zu.
»Miho-chan.« Er bedeckt die Faust mit der flachen Hand und verneigt sich ein wenig. Chan. Er will mich wissen lassen, dass er mich bezaubernd findet. Mein Mund ist plötzlich so trocken, dass ich nicht mehr richtig schlucken kann.
»Ich bin Tora Rei«, sagt er.
Auch er nennt zuerst seinen Clan, obwohl die Tätowierung auf seinem nackten Oberarm verrät, welcher Abstammung er ist. Wären wir bei Hofe, würde ich mich jetzt tief verneigen, wieder den Fächer flattern lassen und sagen …
… aber wir sind nicht bei Hofe.
Rei greift in seinen Obi und zieht ein Tuch aus grobem Stoff hervor. Zwei Reiskuchen sind darin eingeschlagen. Sein Blick wandert über mein aufwendiges Tiger-Irezumi: Es ist sehr schön und spricht von Wohlstand. An meinem dreizehnten Geburtstag vor nicht einmal einem Jahr hat es mir ein stadtbekannter Künstler mit glitzernden Nadeln in die Haut gestochen. Mein Vater war von adliger Geburt, ein vermögender Mann von Rang. Manchmal wünschte ich, er hätte nicht so viel ausgegeben und das Irezumi wäre einfacher. In Kigen schaut man sehr genau auf die Tätowierungen anderer Leute.
Immer ziehen alle die falschen Schlüsse, wenn sie mich sehen.
Zwar kann ich seine Gedanken nicht hören, aber ich weiß trotzdem, was dem Jungen durch den Kopf geht. Armes kleines reiches Mädchen. So gelangweilt, dass es sich ein wenig im Hafenviertel herumtreibt – doch nur allzu bald wird es wieder den Hügel hinauf verschwinden, zu seiner Dienerschaft zurücklaufen, dem sauberen Wasser, den frischen Laken. Es gehört nicht hierher. Ich gehöre nicht …
Der Junge hält mir einen der beiden Reiskuchen hin. Ich starre auf seine Hand hinab, dann in sein Gesicht. Er nickt und wedelt mit dem Kuchen in der Luft herum.
»Nimm schon.«
Wieder streift mein Blick seine Tätowierung: Sie ist das Werk eines Hinterhof-Tätowierers, mit einem rostigen Messer und verdünnter Tintenfischtinte gestochen. »Kannst du denn wirklich darauf verzichten?«
»Heute reicht mir einer«, sagt er lächelnd.
Also nehme ich den Reiskuchen. Kurz streifen sich unsere Finger.
»Was machst du hier?«, fragt der Junge mit vollem Mund und schaut wieder über die Bucht.
»Ich … höre zu.«
»Wem?«
Den Möwen. Ihren Gedanken in meinem Kopf. Ich berühre die Geister der Tiere, die es in der Stadt noch gibt – obwohl zäh und blauschwarz Gift in der Luft wabert und am Himmel erbarmungslos die rote Sonne brennt.
Es sind nur noch so wenige. Keine Katzen oder Hunde. Keine Schafe, Kühe, Schlangen oder Mäuse. Nur ein paar Möwen mit brüchigen Federn, die klagend über die Bucht gleiten. Aasratten, die über das zersprungene Kopfsteinpflaster der Gassen und Durchschlupfe wimmeln und inmitten von Knochen zischend miteinander kämpfen. Verzweifelte, elende Spatzen in den Gärten des Shōguns, die nicht fliehen können, weil ihnen die Flügel gestutzt worden sind.
Das sind die Stimmen, denen ich zuhöre, obwohl ich sie nicht hören sollte. Aber das kann ich ihm nicht erzählen: Zwischen den Brandsteinen auf dem Marktplatz ist die Asche derjenigen verstreut, die dumm genug waren, von der Gabe des Gespürs zu erzählen. So wird es genannt, wenn überhaupt jemand wagt, darüber zu sprechen.
Die Gilde sagt, wir seien mit einem Makel behaftet. Unrein.
Also lüge ich. »Ich höre dem Wasser zu. Dem Lied des Ozeans.«
»Es ist schön hier«, sagt er.
Aber das stimmt nicht. Die Bucht gleicht einem schwarzen Geschwür, an dessen Rändern schlickiger Kraftstoff klebt. Gestern haben die Gildenmänner die trägen Wogen angezündet, um die Rückstände abzubrennen, so gut es geht. Noch immer steigen Rauchschwaden auf. Auf meiner Haut klebt Asche. Kurz frage ich mich, ob der Junge blind ist – oder verrückt. Dann begreife ich, dass er versucht, höflich zu sein.
»Schätze schon«, sage ich.
Er beobachtet, wie das Himmelsschiff eine Schleife über der Stadt zieht und Kurs auf die Fronten in Morcheba nimmt. Hand über Faust verneigt er sich vor den entschwindenden Soldaten.
»Izanagi möge sie beschützen«, sagt er.
»Und was machst du hier?« Ich hebe eine Augenbraue, obwohl er das durch die Gläser meiner Schutzbrille nicht sehen kann.
Er zuckt mit den Schultern und murmelt mit vollem Mund: »Meine Schicht ist gerade vorbei.«
Ich deute auf die Chi-Raffinerie am Rande der Bucht: ein Gewirr aus verrosteten Rohren und riesigen Schornsteinen, die unaufhörlich Qualm in den Himmel speien. Über der Raffinerie ist er dunkler als über dem Rest der Stadt.
»Da arbeitest du?«
»Hai.« Er nickt. »Zumindest bis ich siebzehn werde.«
»Und dann?«
Er beißt wieder von seinem Reiskuchen ab und zeigt auf das Schlachtschiff, das eine breite Abgasspur hinter sich herzieht.
»Oh«, sage ich, und das Herz wird mir schwer.
Schweigend sitzen wir nebeneinander und schauen zu, wie die Sonne tiefer sinkt. Auf der Himmelsturmreihe hinter uns tummeln sich die Leute: Gossenkinder, Bettler, Geishas mit Papierschirmen, eiserne Samurai in ihren scheppernden, zischenden Rüstungen. Kaufleute feilschen mit Lotusmännern, fahrende Händler ruhen sich im Schatten billiger Sake-Schenken aus. Alle tragen Schutzbrillen, um ihre Augen vor der Sonne zu schützen, und Tücher vor Mund und Nase, um die Abgase nicht direkt einzuatmen, die überall schwer in der Luft hängen. Doch all das kommt mir weit entfernt vor. Verstohlen schaue ich den Jungen an, und die Schmetterlinge in meinem Bauch flattern heftig mit kupfernen Flügelchen. Hier am Ende des Landungsstegs scheint es, als seien wir die einzigen Menschen auf der Welt.
Unsere Schatten werden länger und strecken sich über das splittrige Holz nach den windschiefen Lagerhäusern mit ihren leeren, blinden Fenstern. Die Sonnengöttin beugt sich herab, um die Wellen zu küssen, und ich frage mich, wie es wohl wäre, sie zu sein – und der Junge neben mir wäre der Ozean.
Am Himmel rufen die Möwen.
Nur ich weiß, was sie sagen.
Der Sommer ist mit aller Gewalt über Kigen hereingebrochen. Von der Bucht zieht der Gestank heran wie Morgennebel. Ich sitze im Schatten und warte auf meinen Rei.
Seit zwei Monaten treffen wir uns jeden Tag hier auf dem Landungssteg. Nie habe ich auch nur seine Hand gehalten, aber dennoch sitze ich nun hier, unterhalte mich mit den Möwen (drei sind noch übrig) und horche auf die Dampfpfeife der Raffinerie – das Signal, dass die Tagschicht vorbei ist und er bald hier sein wird.
Der Sonnenuntergang rückt näher. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern …
Da!
Unwillkürlich muss ich lächeln: Ich bin jung, lebendig – und verliebt, glaube ich.
Kurz darauf sehe ich ihn auch schon, wie er sich seinen Weg durch die Menge bahnt. Die Gläser seiner Schutzbrille sind mit Asche verschmiert, der Lumpen, den er sich vor Mund und Nase gebunden hat, ist beinahe schwarz. Endlich steht er vor mir, und an den Fältchen in seinen Augenwinkeln erkenne ich, dass er lächelt. Hand über Faust verneigt er sich so tief, als seien wir bei Hofe – er ein adeliger Herr und ich eine hochwohlgeborene Dame – und die ganze Welt liege uns zu Füßen.
Die Gilde gibt den Raffineriearbeitern keine Atemmasken, und Rei verdient nicht genug, um sich selbst eine kaufen zu können. Seine Augen sind blutrot, seine Haut ist grau. Ich bin nur zwei Jahre jünger als er, aber niemand, der uns zusammen sähe, würde das erraten: Rei ist sechzehn, keucht jedoch wie ein alter Mann, wenn er sich anstrengt. Die Raffinerie verschlingt ihn bei lebendigem Leib.
Das Geld, das mein Vater meiner Mutter und mir hinterlassen hat, bewahrt mich vor diesem Schicksal: Ich werde nie achtzehn Stunden am Tag für einen Bettellohn schuften und zusehen, wie meine Haut grau und immer grauer wird. Aber Reis Schwester ist erst zehn, seine Mutter hat Rußlunge, und die Raffinerie heuert immer Leute an. Ich habe versucht, Rei Geld zu geben, aber er nimmt es nicht. Ich mache mir Sorgen um ihn. Was wird sein Stolz ihn kosten? Was tut die Arbeit in der Raffinerie ihm an?
Er vertreibt das Gefühl, dass ich nicht richtig da bin. Er bringt mich zum Lachen. Wenn ich in seiner Nähe bin, hebt sich das Gewicht von meiner Brust, und ich bin so fröhlich und furchtlos wie früher, als die Welt geheimnisvoll und ich noch ein Kind war.
Noch ein Kind?
Götter, was bin ich denn jetzt?
Er setzt sich zu mir auf den Steg, lässt die Beine baumeln und hebt das dreckige Tuch an, um ins schwarze Wasser zu spucken. Wie immer. Und wie immer lächele ich hinter meinem eigenen Tuch.
Dummes Mädchen, rufen die Möwen. Bald ist er fort.
Bald ist alles fort.
Ich runzele die Stirn und merke, dass ich heute nicht wissen will, was sie erzählen. Sie reden immer nur vom Sterben. Von dem verseuchten Land und der verpesteten Luft. Den endlosen Feldern, auf denen nichts als blutroter Lotus wächst: Die Wurzeln vergiften die Erde; die Blüten werden geerntet und zu jenem Kraftstoff verarbeitet, der alle Motoren und die Kriegsmaschinerie des Shōguns antreibt. Das ganze Reich, in dem ich lebe.
Aber ich gehöre nicht dazu. Habe nie dazugehört. Dass ich die Stimmen der Möwen überhaupt hören kann, sollte Beweis genug dafür sein.
Still. Ich flüstere in ihre Köpfe, ohne dass meine Lippen sich bewegen. Nicht jetzt.
Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass sie der Falschen ihr Leid klagen. Ich habe keinen Einfluss. Ich kann nichts bewegen. Ich bin bloß ein Mädchen, so einsam wie sie, und dieser Junge ist meine einzige Freude. Also verschließe ich mich vor ihnen – es ist, als würde ich in meinem Geist eine Tür zumachen. Heute will ich kein Sonderling sein, anders als alle anderen. Bloß hier will ich sein. Auf dem Steg. Bei ihm.
Rei zieht zwei eingeschlagene Reiskuchen aus seinem Obi. Wie immer bietet er mir einen an, obwohl er weiß, dass ich keinen Hunger leide. Er dagegen bekommt heute sonst nichts mehr zu essen. Lächelnd schiebe ich seine Hand beiseite, und unsere Finger berühren sich, nur für die Dauer eines halben Atemzugs – in dieser Welt, in der ein ganzer einen umbringen kann. Ich fühle mich leicht, beinahe schwerelos. Spränge ich in die Luft, ich würde vielleicht einfach in den roten Himmel schweben …
»Hast du heut schon ein Nachrichtenblatt in die Finger bekommen?«, fragt Rei. Er spricht immer mit vollem Mund.
Ich schüttele den Kopf. Ich lese die Nachrichten nie. Immer geht es nur um den Krieg, um Ruhm, Reinheit, Kinder mit dem Makel, die auf dem Richtplatz verbrannt worden sind, und um die Anzahl gefallener Rundaugen. Wer würde so etwas wissen wollen?
»Die Streitkräfte der Tiger haben den Widerstand der Gaijin am Gelben Pass beinahe gebrochen.« Rei blickt nach Osten über das Wasser, die Augen hinter dunklem, polarisiertem Glas verborgen. »Das Ende des Krieges ist in Sicht.«
»So heißt es seit Jahren.«
»Aber dieses Mal scheint es zu stimmen.« Er ballt die Fäuste. »Das haben sie im Rekrutierungsbüro gesagt. Götter, wenn ich keine Gelegenheit mehr habe zu kämpfen …«
Zwar würde ich ihm das nie sagen, aber ich bete jeden Abend zum großen Schöpfer Izanagi, dass es so kommt.
»Dann erringst du eben auf andere Weise Ruhm.«
»Ach ja?« Leiser Ärger klingt in seiner Stimme mit. »Und wie? Indem ich weiter in dieser verfluchten Raffinerie schufte? Was ist daran ehrenvoll?«
»Du findest schon eine Möglichkeit, dich zu beweisen.« Ich lächele hinter meinem Tuch. »Ich glaube an dich.«
Er schüttelt den Kopf. »Im Inselreich macht ein Mann sich einen Namen, indem er dem Weg des Kriegers folgt. Treue, Ehre, Opferbereitschaft. Der Shōgun und die Gilde haben recht: Die Rundaugen müssen besiegt werden. Das Reich muss bestehen bleiben. Der Lotus muss blühen!«
Er hört diese Sätze im Rekrutierungsbüro. Mittlerweile kann er sie Wort für Wort nachsagen. Die Bushimänner in ihren sauberen Uniformen sind seine neuen Freunde. Sie tragen glänzende Schwerter am Obi, die noch nie eine andere Klinge gesehen haben, und sprechen nie von den Söhnen, die verstümmelt oder zutiefst verstört aus Morcheba zurückkommen. Oder von den Vätern, die gar nicht mehr heimkehren.
Kaum merklich rücke ich näher.
»Man kann auch auf andere Art und Weise kämpfen«, sage ich. »Und um andere Dinge.«
Da schaut er mich an, und ich will ihm die Schutzbrille abnehmen und ihm in die haselnussbraunen Augen blicken – bis auf den Grund seiner Seele will ich sehen. Vielleicht könnte ich so herausfinden, wie ich zu ihm durchdringen kann … Aber die Sonnengöttin strahlt so hell, dass sie einen blind machen könnte. Es ist, als hätten wir ihr einen Schleier nach dem anderen vom Gesicht gezogen, und nun müssen wir uns blass und furchtsam vor ihrem Antlitz verbergen. Ich glaube, sie ist wütend auf uns.
»Außerdem«, sage ich und versuche, ungezwungen zu klingen, »würde ich dich vermissen, wenn du fortgingst.«
Die Lachfältchen in seinen Augenwinkeln sind zurück. »Ich würde dich auch vermissen.«
Er nimmt meine Hand, und da kann ich meine Füße nicht mehr spüren. Wir sitzen nebeneinander und schauen zu, wie die Sonnengöttin sich zur Ruhe bettet. Als sie den Horizont berührt, rutscht Rei noch ein bisschen näher und legt einen Arm um mich – und wenigstens vorläufig ist alles vollkommen, ist alles gut. Das rote Sonnenlicht bricht sich auf der Oberfläche des Meeres, und es scheint, als stünde die ganze Welt in Flammen.
Die Möwen rufen wieder.
Aber ich höre nicht hin.
Hand in Hand gehen wir über den Marktplatz.
Riesig ist er, und zwischen den unzähligen Ständen herrscht ein großes Gewimmel. Ich sehe Gewürzhändler und Kräuterkundige, Schlachter und Bäcker, Kleiderverkäufer und Tuchhändler. Um den Platz herum drängen sich Tempel, Rauchhöhlen und Geisha-Häuser. Gaukler buhlen um die Aufmerksamkeit der Menge, während Beutelschneider unauffällig ihrem eigenen Geschäft nachgehen. Überall bieten Männer mit Bauchläden Schutzbrillen feil, und in den Gossen hocken Bettler dicht an dicht. Die Gesichter der Menschen verschwinden hinter schmutzigen Tüchern und ascheverkrusteten Räderwerk-Atemmasken. Stadtwächter in roten Wappenröcken und eiserne Samurai in ihren zischenden Ōyoroi schieben sich zwischen den Leuten hindurch, die Hände auf den Griffen ihrer Schwerter. Das schlagende Herz Kigens. Und Rei und ich mittendrin, und die Menge wogt um uns herum.
Wir stehen an einem Imbiss und schauen zu, wie gebratener Tintenfisch und Nudeln in Reiscrackerschalen gefüllt werden, da fangen die Leute an zu rufen. Ein Tumult entsteht auf dem belebten Platz. Sofort verkrampft sich mein Magen, und mir schnürt sich die Kehle zusammen. Ich weiß, was das zu bedeuten hat.
Rei stellt sich auf die Zehenspitzen und schaut über die Köpfe der Menschen hinweg. »Die Gilde muss wieder wen erwischt haben …«
Ich will den Kloß in meiner Kehle hinunterschlucken, aber es gelingt mir nicht.
»Komm, wir gucken zu!«, sagt er und zieht mich mit sich. Meine Füße sind schwer wie Blei, meine Augen voller Sand. Getuschel und Gemurmel ringsumher, aber ich höre nur ein einzelnes Wort. Sie zischen es, raunen es, stoßen es hervor – eine Kakofonie, die mir lähmende Furcht einflößt. Denn Rei hat recht, sie haben jemanden erwischt. Und als Nächstes erwischen sie vielleicht mich.
Jetzt sehe ich sie: Vier Gildenmänner zerren einen schwarz gekleideten Jungen zwischen sich her. Ihre Atmos-Panzer sind aus poliertem Messing und dunklem Gummi, die Helme gleichen Insektenköpfen. Gottesanbeterinnen. Ihre Augen sind vorgewölbt und leuchten so rot wie der Himmel über uns. Kolben, Kugelgelenke und Panzerhandschuhe. Räderwerk, Schwaden blauschwarzer Abgase und schwere Stiefel, die im Rhythmus eines Trauermarsches über gesprungenes Kopfsteinpflaster stampfen. Und der Junge in ihrer Mitte bettelt und schreit, aber was er sagt, kann ich nicht verstehen – die Menge brüllt jetzt wie im Fiebertaumel. Manche anklagend – das sind die Fanatiker –, andere unbehaglich.
»Unrein!«, schreien sie.
Immer weiter zieht Rei mich auf den Richtplatz zu. Er liegt einen halben Meter tiefer als der Markt. Vier rußgeschwärzte Säulen erheben sich daraus, eine für jede Himmelsrichtung. An ihren Basen sind Reisighaufen aufgeschichtet. Die verkohlten Eisenfesseln an den Säulen schwingen im Wind und klirren gegen den Stein. Asche wirbelt in der Luft. Mir ist so schlecht, dass ich dagegen ankämpfen muss, mich zu übergeben.
»Unrein!«
Die Gildenmänner schleppen den Jungen die Stufen hinunter, drängen ihn mit dem Rücken gegen die Nordsäule und schließen die schwarzen Eisenschellen um seine Handgelenke. Und er weint und fleht und sucht mit Blicken in der Menge nach jemandem, der ihm hilft. Einem einzigen wohlwollenden Gesicht.
Umsonst.
»Verbrennt den Unreinen!«, schreit der Mann neben mir und schaut mich an, um zu sehen, ob ich seine Begeisterung teile. Rei steht wieder auf den Zehenspitzen. Die Gildenmänner zitieren ihre heilige Schrift, ihre Stimmen summen und krächzen metallisch aus den Lautsprechern ihrer Helme. Sie predigen vom »Weg der Reinheit«. Davon, den Makel des Gespürs mit heiliger Flamme auszubrennen. Vom Bad des Schöpfergottes Izanagi, der rituellen Reinigung, aus der Sonne, Mond und Stürme hervorgegangen sind.
Wie oft habe ich das alles schon gehört? Ich weiß es nicht, doch von Mal zu Mal leuchtet es mir weniger ein. Ja, ich besitze die Gabe, aber wie füge ich dem Reich Schaden zu? Nie sage ich etwas gegen den Shōgun oder die Gilde; ich habe so viel Angst, dass ich überhaupt kaum je den Mund aufmache. Und trotzdem zieht dieses furchtbare Schauspiel die Leute an wie ein frischer Leichnam die Lotusfliegen – manche sind neugierig, andere abgestoßen, wieder andere glauben wahrhaftig daran, dass die Gilde das Richtige tut. Und mittendrin mein Rei.
»Ich will das nicht sehen«, sage ich.
Er wendet sich zu mir um, die Augen hinter den dunklen Gläsern seiner Brille verborgen, das Gesicht hinter seinem Tuch. Wir alle verbergen etwas.
»Warum nicht?«
»Weil ich nicht will. Bitte lass uns gehen.«