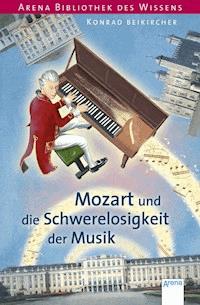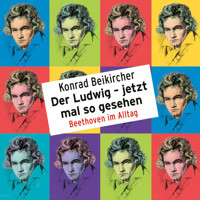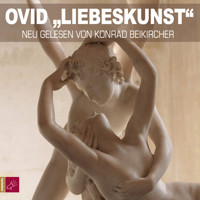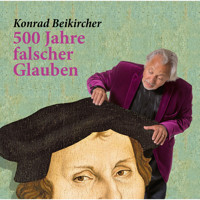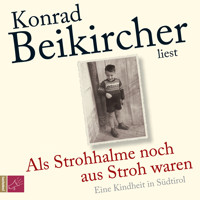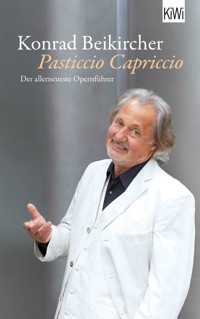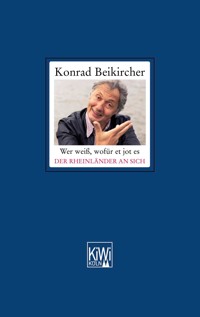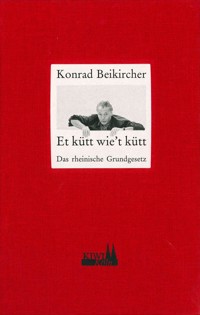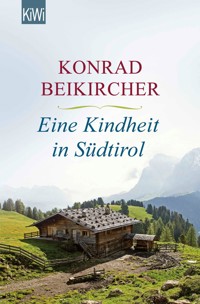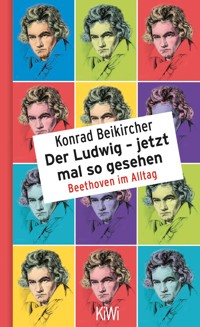
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Auch Genies haben Alltagssorgen und -freuden – die besondere Beethoven-Biografie. Ludwig van Beethoven – alle kennen ihn und viele kennen seine Werke. Aber wie hat er gelebt? Dank Konrad Beikirchers etwas anderer Biografie erfahren wir nun alles über den Alltag des berühmten Rheinländers im Wiener Exil.Koch, Familientier, erfolgloser Frauenheld, Helikopter-Onkel, liebenswürdiger Griesgram, Trinker, Patient, raffinierter Geschäftsmann, verpeilter Dandy, Mietnomade – all das und noch viel mehr war Ludwig van Beethoven. In seinem neuen Buch hat Kabarettist, Autor und Musik-Kenner Konrad Beikircher Kurioses, Bewegendes und Komisches aus dem Alltagsleben des großen Komponisten zusammengetragen. Mit Humor und Empathie erzählt er über Beethovens Liebe zur Natur, über den Kampf mit seinen zahlreichen Vermietern, seine Raffinesse beim »Erpressen« von Geldzuweisungen durch die Wiener Fürsten – kurzum: über sein ganz normales Leben als einem der ersten freischaffenden Komponisten, der darauf achten musste, wie er an sein Geld kam, um zu überleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Konrad Beikircher
Der Ludwig – jetzt mal so gesehen
Beethoven im Alltag
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Konrad Beikircher
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Konrad Beikircher
Konrad Beikircher, Jahrgang 1945, Diplom-Psychologe und Musikwissenschaftler, hat sich nach 15 Jahren im öffentlichen Dienst ganz dem »freien« Leben als Kabarettist und Autor verschrieben. Seine mittlerweile 14 Programme über rheinische Sprache und Mentalität sind legendär, genauso die beiden Konzertführer und drei Opernführer bei Kiepenheuer & Witsch (KiWi 780, KiWi 1073 und KiWi 1530). Die fachliche Kompetenz und die kabarettistische Leichtigkeit sind die Grundlage für seine Musikbücher, die Wahlheimat Bonn und damit die Nähe zu Beethoven die Basis für dieses Buch.
Konrad Beikircher ist in dritter Ehe verheiratet, hat fünf Kinder und hat sich mit seiner Frau Anne auf dem Katharinenhof in Bonn ganz den Künsten verschrieben. Näheres ist unter www.TheRhineArt.de zu erfahren.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ludwig van Beethoven – alle kennen ihn und viele kennen seine Werke. Aber wie hat er gelebt? Dank Konrad Beikirchers etwas anderer Biographie erfahren wir nun alles über den Alltag des berühmten Rheinländers im Wiener Exil. Koch, Familientier, erfolgloser Frauenheld, Helikopter-Onkel, liebenswürdiger Griesgram, Trinker, Patient, raffinierter Geschäftsmann, verpeilter Dandy, Mietnomade – all das und noch viel mehr war Ludwig van Beethoven.
In seinem neuen Buch hat Kabarettist, Autor und Musik-Kenner Konrad Beikircher Kurioses, Bewegendes und Komisches aus dem Alltagsleben des großen Komponisten zusammengetragen. Mit Humor und Empathie erzählt er über Beethovens Liebe zu seiner Familie, über den Kampf mit seinen zahlreichen Vermietern, seine Raffinesse beim »Erpressen« von Geldzuweisungen durch die Wiener Fürsten – kurzum: über sein ganz normales Leben als einem der ersten freischaffenden Komponisten, der darauf achten musste, wie er an sein Geld kam, um zu überleben.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Vorwort
I. Beethovens Leben im Rheinland – und wie trotzdem etwas aus ihm geworden ist
II. Die Ausbildung und der Sprung nach Wien
III. Beethoven und das liebe Geld
IV. Beethoven zu Tisch
V. Der Mietnomade
VI. Ludwig und die Frauen
VII. Der Helikopter-Onkel
Anhang
1. Das Orchester
2. Der Kampf um die Vormundschaft
3. Die Neunte
4. Richard Wagner
Literaturverzeichnis
Dank
»B. war von Charakter etwas rauh und düster, doch graden Sinnes und trefflichen Herzens, und Feind aller Heuchelei. Seine ökonomischen Angelegenheiten mussten andere verwalten, sowie er überhaupt, auch in Beziehung auf sein Äußeres, sich nicht an Ordnung gewöhnen konnte. Seinen Geist beschäftigte das Reich der Töne und die Natur; doch schätzte er auch wissenschaftliche Leistungen und gab sich vor Allem gern dem Studium der Geschichte hin. Er war gedrungenen Körperbaus, mittler Statur, starkknochig, ein wahres Bild der Kraft. Krankheit lernte er erst in der letzten Zeit seines Lebens kennen. Seinen Neffen, den er väterlich liebte und selbst in der Musik unterrichtete, setzte er zu seinem Universalerben ein. B. eröffnete der Tonkunst ein ganz neues Gebiet in der Instrumentalcomposition. Seine reichen Tongemälde, die er in seinen größten Werken, den Symphonien, aufgestellt hat, schildern mit ergreifender Macht und Tiefe das Leben eines freien Geistes in der Natur, der bald mit tiefem Ernste in ihre Stürme blickt und sie in harmonische Ruhe zurückkehren läßt, bald mit leichtem Humor und munterm Scherz ihren Spielen lauscht, bald mit der Inbrunst eines Geliebten sich in ihr Anschauen vertieft. In ihm vereinigten sich Haydn’s Humor und Mozart’s Schwermuth; im Charakteristischen zeigte er sich Cherubini geistesverwandt. Aber er hatte, auf dem Wege seiner Vorgänger einherschreitend, kühnere Bahnen gebrochen, und die Musik scheint durch ihn das Äußerste gewagt zu haben. ›Haydn‹, sagt Reichardt in seinen ›Briefen aus Wien‹, ›erschuf das Quartett aus der reinen Quelle seiner lieblichen originellen Natur. An Naivetät und heiterer Laune bleibt er daher auch immer der Einzige. Mozart’s kräftigere Natur und reichere Phantasiegriff weiter um sich und sprach in manchem Satz das Höchste und Tiefste seines inneren Wesens aus; er war selbst nicht mehr executierender Virtuos, setzte auch mehr Wert in künstlich durchgeführte Arbeit und baute so auf Haydn’s lieblich phantastisches Gartenhaus seinen Palast. B. hatte sich früh schon in diesem Palaste eingewohnt, und so blieb ihm nur, um seine eigne Natur auch in eignen Formen auszudrücken, der kühne, trotzige Turmbau, auf den so leicht Keiner weiter etwas setzen soll, ohne den Hals zu brechen.‹«
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände – Brockhaus, Leipzig 1833
I.Beethovens Leben im Rheinland – und wie trotzdem etwas aus ihm geworden ist
Ich möchte mit einer Geschichte anfangen, die wahr ist und die exemplarisch zeigt, wie viel Verwirrung um das deutsche Kulturgut Beethoven im kollektiven Bewusstsein herrscht.
Ein deutscher Bundespräsident – der Name tut nichts zur Sache … – äußerte kurz nach Amtsantritt den Wunsch, mit seiner Frau das Beethovenhaus exklusiv zu besichtigen, also ohne störende Zuschauer links und rechts. Natürlich wurde dem Wunsch entsprochen und das Paar durch das Haus geleitet. Kurz bevor man zum Geburtszimmer Beethovens kam, sagte der Bundespräsident zu seiner Frau: »Und jetzt, liebe …, kommen wir in das Zimmer, in dem Ludwig van Beethoven gestorben ist, nachdem er, blind geworden, von Wien nach Bonn gekommen war.«
Mehr ist zu dieser kleinen Begebenheit nicht zu sagen, oder?!
Versuchen wir also das, was wirklich war, ein bisschen zu sortieren.
Wahrscheinlich ist unser Ludwig am 16. Dezember 1770 geboren, einem Sonntag. Weil man damals bei jeder Geburt befürchtete, ein Neugeborenes könnte schnell sterben, taufte man es so flott wie möglich, damit es zumindest in den Himmel kommt. Ich meine: So ein Leben im Himmel mit Flügelchen auf den Schultern und dann ein bisschen über den Bilderrahmen auf die Erde gucken, ist ja auch nicht verkehrt, oder? Wissen wir ja von Raffael. Ungefähr jedes vierte Baby starb damals jedenfalls im ersten Lebensjahr, jedes zweite Kind erreichte das 14. Lebensjahr nicht.
Papa van Beethoven hatte einen besonders guten Grund zur eiligen Taufe: Ludwigs älteres Brüderchen Ludwig Maria ist ein Jahr vorher gerade einmal sechs Tage alt geworden und auch die drei Nachzügler, Anna Maria Franziska, Franz Georg und Maria Margarete Josepha, hat es zwischen 1779 und 1787 im zartesten Kindesalter dahingerafft. Na gut, neben der allgemein hohen Kindersterblichkeit kamen da vielleicht die Alkohol-Gene von Papa Johann dazu – und die von der Oma väterlicherseits.
Am Montag, dem 17. Dezember, ist unser Ludwig jedenfalls getauft worden, und das war wahrscheinlich der erste Tag nach der Geburt. Hebammen konnten damals noch nicht schreiben, sonst hätten wir sicher eine genauere Notiz über den Zeitpunkt der Geburt Beethovens.
Apropos Taufe – da muss ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen: Kurt Masur, der große Dirigent, war im Jahr 2008 zu Besuch in Bonn und fragte an der Rezeption seines Hotels, wo denn Beethoven getauft worden sei, er wolle sich gerne das Taufbecken ansehen. Die Dame an der Rezeption bat um ein paar Augenblicke Geduld, sie wolle im Beethovenhaus nachfragen. Kurz darauf teilte sie Masur mit: »Beethoven ist in der Kreuzkirche getauft worden.« Dazu sollte man wissen, dass die Kreuzkirche eine evangelische Kirche ist und dass sie von 1866 bis 1871 gebaut wurde …
Beethovens wahre Taufstätte, die alte Remigiuskirche, die 1800 vom Blitz zerstört wurde und abgetragen werden musste, stand am heutigen Blumenmarkt und war damals natürlich unbeheizt. Johann van Beethoven, der frischgebackene Papa, hat am Sonntagabend mit seinen Freunden (alles Musiker, und wie die zulangen können, ist ja hinlänglich bekannt) die Geburt begossen. Jetzt, am Montagmorgen, gibt er dem Pfarrer Bescheid, er hätte da wen zum Taufen, und läuft mit dem Kleinen rüber in die Kirche. Er nimmt die beiden Taufpaten mit, Ludwig van Beethoven, der Opa, und die Frau des Nachbarn, Gertrud Müller, genannt Baums Jechtrud! Es ist der 17. Dezember und eiskalt! Das Taufbecken ist zugefroren, der Pfarrer muss erst mal mit dem Eispickelchen etwas Eis crushen, damit man überhaupt taufen kann. Und da steht nun der Papa und hält den kleinen Ludwig in den Armen. Er macht dem Baby den Oberkörper frei, Ludwig läuft vor Kälte sofort blau an, und dann setzt er den Kleinen in den ersten Windeln seines Lebens auf das Eis. Der Pfarrer holt das Taufschäufelchen (so was gab’s damals für die Winterzeit in den ungeheizten Kirchen und es hatte natürlich auch einen Namen: trulla lavacri, im 20. Jahrhundert dann zu einem abwertenden Spitznamen für ein bisschen umständliche, schwerfällige Frauen degeneriert: du Trulla!), schüttet ein Schäufelchen voll gecrushten Eises über das Baby – und im Kälteschock kräht der Kleine vor sich hin: »A…a…a…aaaaaaaaah«.
Woran sich das Unterbewusstsein unseres Ludwigs Jahrzehnte später vielleicht wieder erinnert, als er im Februar 1804 die ersten Skizzen zu seiner fünften Sinfonie niederschrieb. Ihm fehlte noch die zündende Idee, so sehr er sich auch bemühte, es fiel ihm einfach nichts ein. 1804 war ein schweinekalter Winter, Beethoven lebte auf der Mölkerbastei Nr. 8 im »Pasqualatischen Haus« im 4. Stock, brachte im Unterhemd gerade das Leergut runter, bevor er weitermachen wollte. So nach dem Motto: Ein bisschen Kälte erfrischt und pustet das Hirn durch. Er fluchte über die erbärmliche Kälte, da fiel ihm seine Taufe ein und die Geschichte über sein vor Kälte stotterndes Schreien. Fertig war das Hauptmotiv der fünften Sinfonie. Heute wissen wir ja, dass solche Traumata, wie bei der Taufe mit nacktem Oberkörper auf Eis zu liegen, uns ein Leben lang begleiten können …
Jetzt möchte ich ein bisschen springen (das werde ich noch öfter tun, am besten gewöhnen Sie sich schon mal dran, denn eine Biographie nach dem Motto: »Das war im Dezember 1770 und jetzt kommt der Januar 1771. Über den gibt es allerdings nix zu berichten, sodass wir gleich zum Februar 1771 übergehen können …« und so weiter bis zum März 1827 – so eine Lebensbeschreibung werden Sie von mir nicht lesen.).
Nun ist unser Ludwig also getauft und das Leben kann losgehen. Da muss ich aber einen Moment einhaken, denn Beethoven ist es nicht anders gegangen als allen Promis. Nix interessiert die Leut mehr als das private und privateste Leben bekannter Menschen, ich sage nur Lady Di, da wird gewühlt und geschnüffelt, dass es selbst einer Trüffelsau schlecht wird, und die verstehen ja wirklich was von Wühlen und Schnüffeln. Gerüchte gelten als Nachrichten, üble Nachrede als Recherche und Häme als Würdigung. Und wenn dann doch mal einer genauer hinschaut und sieht, dass alles halb so wild war, ist die Enttäuschung groß. Das allerdings ist kein Alleinstellungsmerkmal unserer heutigen Zeit, über die Konservative klagen, sie sei moralisch verwahrlost, nein, Herrschaften, das hat es immer schon gegeben. Wie zum Beispiel Aristophanes in seinen Komödien über Sokrates herzog, das hatte absolut »Daily Mirror«- oder »Bild«-Niveau. Sei’s drum. Bei unserem Ludwig war das ähnlich wie bei Mozart: Rankten sich bei diesem die Gerüchte um seinen Tod (Verschwörungstheorien ohne Ende, von »Der is vom Salieri aus Neid vergiftet worden« bis hin zu »Der hat sich die Syphilis g’fangen und hat sich viel zu viel Quecksilbersalben draufg’schmiert bis er tot umg’fall’n is«), so bildeten sich bei Beethoven Legenden um seine Abstammung.
Im »Dictionnaire historique des Musiciens«, das in Paris 181o erschien und von den Herren Alexandre Choron und Francois Fayolle verfasst worden war, taucht zum ersten Mal eine Behauptung auf, die in der Folge immer wieder kolportiert wurde. Die Behauptung nämlich, Beethoven sei der uneheliche Sohn des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm II. gewesen (das war der, der das Brandenburger Tor gebaut hat, auch nicht gerade eine Leistung, für die man gern verewigt sein möchte!). Woher die Wurzel dieses Gerüchts rührt, wissen wir nicht. Und wie das gegangen sein soll, dass die ehrenwerte Maria Magdalena van Beethoven, verwitwete Leym, geborene Keverich, aus Ehrenbreitstein bei Koblenz, zwischen Trauer und Wiederverheiratung mal eben nach Berlin gedüst und da ausgerechnet dem König in die Arme gelaufen sei, steht eh auf einem anderen Blatt. Tatsache ist, dass dieses Gerücht die Freunde Beethovens aufgeregt hat, insbesondere diejenigen, denen die Mutter Beethovens noch im Gedächtnis war.
Der Bonner Freund Beethovens aus alten Tagen, Franz Gerhard Wegeler, will diesen Schmutz aus der Welt schaffen und schreibt am 28. Dezember 1825 aus Koblenz an Ludwig van Beethoven einen Brief, in dem er einen großen Bogen über die Jahrzehnte schlägt:
»Wenn du binnen den 28 Jahren, daß ich Wien verließ, nicht alle zwei Monate einen langen Brief erhalten hast, so magst du dein Stillschweigen auf meine ersten als Ursache betrachten. Recht ist es keineswegs und jetzt um so weniger, da wir Alten doch so gern in der Vergangenheit leben, und uns an Bildern aus unserer Jugend am meisten ergötzen. Mir wenigstens ist die Bekanntschaft und die enge, durch deine gute Mutter gesegnete, Jugendfreundschaft mit dir ein sehr heller Punkt meines Lebens, auf den ich mit Vergnügen hinblicke … Gottlob, daß ich mit meiner Frau, und nun später mit meinen Kindern von dir sprechen darf; war doch das Haus meiner Schwiegermutter mehr dein Wohnhaus als das deinige, besonders nachdem du die edle Mutter verloren hattest … Warum hast du deiner Mutter Ehre nicht gerächt, als man dich im Conversations-Lexikon [gemeint ist der Brockhaus, KB], und in Frankreich zu einem Kind der Liebe machte? … Nur deine angebohrne Scheu etwas anderes als Musik von dir drucken zu lassen, ist wohl schuld an dieser sträflichen Indolenz.
Willst du, so will ich die Welt hierüber des Richtigen belehren. Das ist doch wenigstens ein Punkt, auf den du antworten wirst.«
Fast ein Jahr später, am 10. Dezember 1826 antwortet Beethoven und entschuldigt sein Säumen:
»Freylich hätte pfeilschnell eine Antwort … erfolgen sollen; ich bin aber im Schreiben überhaupt etwas nachlässig, weil ich denke, daß die bessern Menschen mich ohnehin kennen. Im Kopf mache ich öfter die Antwort, doch wenn ich sie niederschreiben will, werfe ich meistens die Feder weg, weil ich nicht so zu Schreiben im Stande bin, wie ich fühle … Du schreibst, daß ich irgendwo als natürlicher Sohn des verstorbnen Königs von Preußen angeführt bin; man hat mir davon schon vor langer Zeit ebenfalls gesprochen. Ich habe mir aber zum Grundsatze gemacht, nie weder etwas über mich selbst zu schreiben, noch irgendetwas zu beantworten, was über mich geschrieben worden. Ich überlasse dir daher gerne, die Rechtschaffenheit meiner Altern, u. meiner Mutter insbesondere, der Welt bekannt zu machen.«
Was Freund Wegeler dann in seinen »Biographischen Notizen über Ludwig van Beethoven« auch getan hat. Mit Erfolg. Denn hatte Brockhaus in der 1830er-Ausgabe dieses Gerücht noch kolportiert – in der 1833er-Ausgabe war es bereits verschwunden.
Dennoch geistert dieses Gerücht immer wieder bis heute durch die Beethoven-Biographien – so wadenbeißerisch-hartnäckig ist offenbar nach wie vor das Interesse daran, die Großen auf das unerträgliche Niveau des privaten Luder-Fernsehens herabzuziehen.
Bleiben wir bei den nicht minder amüsanten Fakten: Beethoven wurde in eine Familie hineingeboren, die etwas Besonderes war. Der Opa väterlicherseits stammte aus Mechelen in Belgien, war ein braver Musiker in kurfürstlichen Diensten am Hof in Bonn, Bass und Dirigent, und besserte sein Einkommen durch einen Weinhandel auf. Er selbst war wohl einigermaßen ausgeglichen, seine Frau allerdings hatte die rheinische Krankheit: Schabau. Das heißt Schnaps und war damals das Volksgetränk für die einfachen Leute. Die konnten sich keinen Wein leisten, außerdem lehnten sie ihn ab, weil die Wirkung zu lange auf sich warten ließ. Schnaps war billig und zielführend, also vom Preis-Wirkungs-Verhältnis wesentlich effektiver als der teure Wein. Selbst Heinrich Böll schrieb noch, dass man bis Bad Godesberg, von Süden kommend, Wein trinke, ab Bonn aber Schnaps, also Schabau.
Übrigens hat man in der Zeit Säuglingen einen schnapsgetränkten Schnuller in den Schnabel gesteckt, damit sie ruhig blieben. Eine bewährte Methode auch in meiner Heimat: In Südtirol behauptete man noch in den 1950er Jahren, die »Unterlandler« (das ist die Gegend südlich von Bozen, wo der wunderbare Wein herkommt) seien deshalb so dumm, weil sie in Leps getränkte Schnuller zuzeln mussten, während die Eltern beim Wimmen waren, also bei der Weinlese. Leps ist kein Most, sondern ein eigens hergestellter »Wein«, der aus dem gemacht wurde, was von den Trauben nach dem Einstampfen und Entsaften im Bottich übrig geblieben ist. Er schmeckt grauenhaft, hat weniger Alkohol als richtiger Wein und dient deshalb als erfrischender Quasi-Wein bei der Feldarbeit zur Stärkung – und um die Monotonie dieser Arbeit etwas geschmeidiger zu machen. Und genau da durften die Babys nicht stören, also hat man ihren Schnuller in Leps getunkt und Ruhe war!
Maria Josepha van Beethoven, geborene Poll, Ludwigs Oma, war jedenfalls – und das sollte man würdigen – eine der ersten großen bekennenden Alkoholikerinnen des Rheinlandes. Gottfried Fischer (Bäckermeister und Kindheitsfreund vom Ludwig – wir kommen noch auf ihn zu sprechen) schreibt über sie:
»… eine stille gute Frau, die aber dem Trunck so stark ergeben war, womit er [der Opa vom Ludwig] so vill heimliche Leiden ertragen hat, dass er nachher zuletzt auf den Gedanken gekommen war, dass er sie nach Köln in Pangsion gethan.« Beethovens Großmutter ist also im Schabau-Stübchen der Geschlossenen in Köln gestorben, für damals ein eher seltenes Familienereignis. Gerüchten zufolge soll sie die Urheberin der Hymne »Einer geht noch, einer geht noch rein« gewesen sein, aber mündliche Überlieferungen aus diesem Dunstkreis stehen immer auf unsicheren Beinen. 1775 ist sie jedenfalls »im Glas geblieben« (eine südtirolerische Redensart, wenn einer, der kein Weinverächter war, gestorben ist). Unser Ludwig hat sie kaum oder gar nicht gekannt, als sie starb, war er gerade mal fünf Jahre alt. Den Opa, der 1773 gestorben war, hat er zwar auch kaum gekannt, aber hoch geehrt: Sein Porträt in Öl hat der Enkel bis zum Schluss immer mitgenommen und in seinen Wohnungen prominent ausgestellt. Es ist bis heute gut erhalten – klar, Öl konserviert – und hängt im historischen Museum der Stadt Wien. Kann man hingehen und gucken, aber wirklich lohnen tut sich’s nicht. Er hält ein Notenblatt in der Hand, der Porträtist hatte aber ein Schärfeproblem: Sein Pinsel war so unscharf eingestellt, dass man nicht erkennen kann, was das denn für Noten sind, die der Porträtierte da in der Hand hält. Ludwig hätte es vielleicht gewusst, hat uns aber nix darüber überlassen. Vielleicht sind es ein, zwei Zeilen aus einem Karnevalsschlager, wir wissen nämlich, dass der alte Ludwig auch dazu verpflichtet war, die Sitzungen vom Festausschuss Bonner Karneval und die Prunksitzungen der Bonner Karnevalsgesellschaft »Mures Albae e.V. – Wieß Müüs e.V.« musikalisch zu untermalen. Vielleicht hat daher auch unser Ludwig das Karnevals-Gen abbekommen: vom Opa und von der Oma. Einige Kompositionen legen jedenfalls nahe, dass er sein Leben lang an Karnevalsliedern hing. Den Wienern konnte er damit nicht kommen, die mögen den Rhein heute noch nicht, sie haben ja die Donau. Also versteckte er immer wieder geliebte rheinische Themen in seinen Kompositionen. Der Beginn der Sonate für Violine und Klavier op. 24 Nr. 5 in F-Dur, der Frühlingssonate, ist so ein Fall. Singen Sie ab dem ersten Takt parallel dazu: »Einmal am Rhein, und dann zu zweit alleine sein«. Sie werden hören: Ich habe recht! Was muss dieser Mann für ein Heimweh gehabt haben!
Der Dirigent und Weinhändler Ludwig van Beethoven (der Opa), der beste Verbindungen zum niederländischen und belgischen Markt unterhielt, hatte sich also in Bonn niedergelassen und war ein geschätzter Mann.