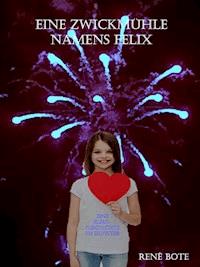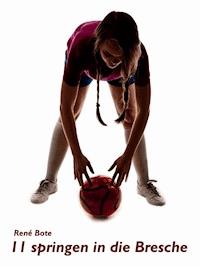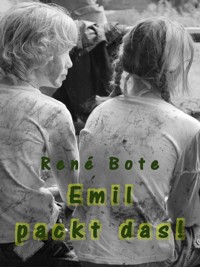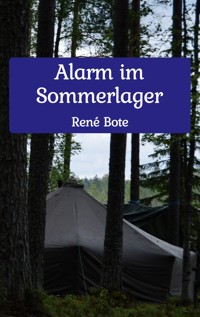Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als der Winter kein Ende nehmen will, befiehlt Barn, der Oberste des Dorfes, dass nur noch die zu essen bekommen sollen, die arbeiten können. Es ist das Todesurteil für die Alten und Kranken, und auch für seinen eigenen Sohn, denn Jore ist blind. Zum Glück hält Meira zu Jore, seine einzige Freundin, und teilt ihre kargen Rationen mit ihm, aber das wenige Essen, das Meira zugeteilt wird, reicht nicht für zwei. Meira wird selbst immer schwächer, bald wird sie nicht mehr arbeiten können und selbst keine Rationen mehr bekommen, und dann wären sie beide verloren. Jetzt gibt es nur noch einen, der die Macht hat, ihnen zu helfen, doch von diesem einen wusste noch nie jemand etwas Freundliches zu berichten...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nur ein Mensch kann auf die Idee kommen, mich HERR DES BERGES zu nennen. Der Berg ist Stein, und Stein hat keinen
Inhalt
Kapitel
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
I
Das Dorf am Rand des Waldes kannte außer den Menschen, die dort lebten, fast niemand. Es brauchte nicht einmal einen Namen, war einfach nur das Dorf, denn kaum ein Fremder verirrte sich je in diesen abgelegenen Landstrich. Selbst für reisende Händler, die fast überall herumkamen, wo Menschen lebten, lohnten die wenigen Geschäfte, die sie hier machen konnten, kaum den langen Weg. In manchen Jahren waren die Abgesandten des Königs, die im Herbst, wenn die oft magere Ernte aus Obst, Gemüse und Getreide eingebracht war, kamen, um den Zehnten einzufordern, die einzigen Besucher.
Barn, dem der größte Hof gehörte, war der unangefochtene Anführer, lenkte die Geschicke des Dorfs und hielt Gericht, selbst bei schweren Verbrechen, über die zu urteilen einem vom König eingesetzten Richter vorbehalten gewesen wäre. Die Stadt des Königs war weit, es waren etliche gefährliche Tagesreisen dorthin, und das Dorf war viel zu unwichtig für den König, um jemanden dorthin zu entsenden außer den Eintreibern, die ihm den Zehnten brachten.
Wer krank war oder einen Unfall erlitten hatte, ging zu Chorm, dem Heiler, wer Werkzeug oder eine Waffe brauchte, wandte sich an Bere, den wuchtigen Schmied, dem auch die kleine Mine gehörte, aus der das Erz kam. Sjorne, der Wirt, vergor Honig zu Met, der in seinem Gasthaus ausgeschenkt wurde. Er hatte auch zwei Schlafgemächer für Gäste, aber niemand konnte sich an den letzten Gast entsinnen, der dort übernachtet hatte.
Die meisten Menschen im Dorf lebten von Ackerbau und hielten Schafe, Ziegen und Geflügel. Wenn die Ernte gut war, dann hatten die Familien ihr Auskommen, aber wenn der Sommer zu nass oder aber zu trocken gewesen war, was nicht zu selten vorkam, dann wurde im Winter die Nahrung knapp. Oft mussten Rinde und Wurzeln den kargen Speiseplan ergänzen.
Jeder musste seinen Teil zum Auskommen der Familie beitragen, das fing bei den Kindern an, sobald sie alt genug waren für einfache Tätigkeiten, und ging bis hin zu den Alten, solange sie noch dazu in der Lage waren. Schon mit drei oder vier Jahren halfen die Kleinen ihren Großmüttern beim Spinnen und hielten die Wolle auseinander, kräftige Kinder begannen mit fünf oder sechs Jahren, in Beres Mine zu arbeiten und Erz und Abraum auf einfach Holzschlitten aus den engen Gängen zu ziehen. Spätestens mit dreizehn oder vierzehn Jahren, wenn sie zu groß waren für die niedrigen Stollen, wechselten sie zur Feldarbeit oder ließen sich in ein Handwerk einweisen.
Barn wachte gestreng darüber, dass niemand, der in der Lage war, zu arbeiten, sich der Arbeit entzog, und teilte die Tagelöhner zu, die keinen eigenen Hof hatten oder einen, der so klein war, dass er sie und ihre Familien nicht zu ernähren vermochte. Sein Wort war Gesetz, und niemand zog seine Entscheidungen in Zweifel.
Er war der letzte, der sich Sorgen machen musste, ob das Essen über den Winter reichte, und hätte ein glücklicher Mann sein können, aber noch fehlte ihm etwas dazu: Ein Stammhalter. Seine Frau Vemara hatte ihm sechs Kinder geboren, doch der erste Sohn, Jore geheißen und mit Stolz gehütet, war in seinem ersten Winter am Fieber gestorben, und der zweite, geboren nach und vor zwei Schwestern, war blind. Barn hätte den Jungen im Gebirge ausgesetzt, damit er verhungerte, doch Vemara hatte ihn bekniet, es nicht zu tun, und so duldete Barn widerwillig den Sohn, der den Namen bekommen hatte, den auch sein verstorbener Bruder getragen hatte.
Weil er weder in der Mine, noch auf dem Feld arbeiten, noch Vieh hüten oder ein Handwerk erlernen konnte, musste Jore jene Arbeiten verrichten, die sonst den Alten, Hochschwangeren und Stillenden überlassen blieben. Im Hinterzimmer des Bauernhauses saß er neben seiner Großmutter und spann Wolle zu Garn, mahlte Getreide zu Mehl und flickte, nur auf das Gespür der Finger angewiesen, die Kleidung der Familie. Über die Jahre war er immer geschickter dabei geworden, und selbst sein Vater musste widerwillig zugeben, dass Jore die Wolle genauso schnell spann, das Mehl genauso fein mahlte und die Kleidung genauso sauber flickte wie seine Großmutter. Trotzdem verachtete er seinen einzigen Sohn und vermied es, mit ihm zu sprechen. Obwohl ihm Mädchen nicht viel galten, zog er die Töchter vor, Belia, Marje und Sisja, vor allem aber Stene, die älteste, die einmal eine schöne und begehrenswerte Frau zu werden versprach. Sie hatte etliche Verehrer unter den jungen Männern im Dorf, die voller Neid Fledjor, beobachteten, den Sohn des Bauern Goam, der es geschafft hatte, ihre Gunst zu gewinnen. Nur die einzige Tochter des Schmieds, die ebenfalls hübsch und klug war, war ähnlich begehrt.
Sooft er konnte, entfloh Jore seinem unfreundlichen Zuhause, dessen Kälte die Mutter nur unzureichend lindern konnte. Zusammen mit seiner einzigen Freundin durchstreifte er dann die Wälder, die das Dorf umgaben. Meira, seine ständige Begleiterin, war im gleichen Winter geboren wie Jore und im Dorf nicht besser gelitten als er. Zwar war sie völlig gesund, arbeitete so hart in der Mine und auf den Feldern wie alle anderen Kinder auch und hatte sich nie etwas zuschulden kommen lassen, aber ihr feuerrotes Haar und ihre funkelnden grünen Augen in einem Gesicht voller Sommersprossen machten den Menschen Angst. Obwohl Meira sanft und hilfsbereit war, glaubten die Leute, dass etwas Böses in ihr wohnen müsste, etwas, das auf sie übergreifen würde, wenn sie ihr zu nahe kamen. Die Eltern verboten ihren Kindern, mit ihr zu spielen, und niemand half ihr, Steine vom Feld zu schleppen oder Rüben auszugraben, aus Angst, Meira könnte es ihnen mit Unglück vergelten.
Jore wusste, was über Meira gesprochen wurde, und er wusste, dass sie anders aussah als die anderen, auch wenn er sich weder vorstellen konnte, wie sie, noch wie die anderen aussahen. Doch er sah mit dem Herzen, und er spürte mit untrüglicher Sicherheit, dass Meira ein guter Mensch war, eine treue Gefährtin, auf die er sich zu jeder Zeit verlassen konnte. Ihr konnte er Geheimnisse anvertrauen, die er mit niemand anderem teilen konnte, bei ihr fand er Trost, wenn die Verachtung des Vaters ihn traf, und auf ihre Führung konnte er sich im unwegsamen Wald verlassen.
Vieles, was er konnte, verdankte er nur ihr. Mit unendlich viel Geduld und voller Glauben daran, dass er es konnte, auch ohne zu sehen, übte Meira mit ihm und führte seine Hand, bis er die Griffe beherrschen gelernt hatte. Dank ihrer Hilfe konnte Jore schwimmen, im Fluss angeln und einen Bogen bauen, und sie hatte ihm auch beigebracht, eine Flöte zu schnitzen und Melodien darauf zu spielen. Wann immer sie konnte, lauschte sie dem Klang der Flöte, und Jore erdachte neue Melodien nur für sie, die kein anderer je zu hören bekam.
II
Der Winter, in dem Jore und Meira zwölf Jahre alt wurden, war der kälteste und stürmischste seit ewigen Zeiten. Selbst die Alten konnten sich nur an wenige Winter erinnern, die ähnlich hart gewesen waren, und die Not im Dorf war groß.
Schon im vergangenen Frühjahr hatte das Wetter sich unbarmherzig gezeigt, zu wenige sonnige Tage hatten die Saat spärlich aufgehen, der zu nasse Sommer nur wenig Korn reifen lassen. Obwohl Barn an den wenigen heißen Tagen alle, Männer und Frauen, Junge und Alte, auf die Felder geschickt hatte, war ein Teil der Ernte verloren gewesen, und einen Mond nach der Wintersonnenwende waren die Vorratskammern fast schon leer. Die Menschen mussten in die Wälder gehen, um essbare Rinde und Wurzeln zu sammeln, die über dem Feuer mühsam weichgekocht wurden, denn es würde noch zwei Monde dauern, bis mit dem Frühling hoffentlich wieder frisches Grün sprießen würde. Barn ordnete an, Schafe und Ziegen zu schlachten, nicht alle, aber doch so viele, dass die, die man über den Winter bringen konnte, nur gerade eben genug waren, um im Frühjahr die Herden wieder so weit anwachsen zu lassen, dass die Menschen genug Milch und Wolle haben würden. Die Kinder mussten mehr Erz aus der Mine holen, aus dem Bere Waffen und Werkzeuge schmieden sollte, damit es etwas gab, das man gegen Vieh, Kleidung und andere nötige Dinge eintauschen konnte, sobald das Wetter es wieder erlaubte, jemanden auf den beschwerlichen Marsch zum nächsten Markt zu schicken, eine Reise von mehr als drei Tagen, ohne dass es unterwegs einen verlässlichen Unterschlupf gegeben hätte.
***
Die Tage vergingen, und der Winter wollte und wollte dem Frühling nicht weichen. Längst waren nur noch magere Reste in den Vorratskammern, und das, was die Natur unter der Schneedecke anbot, war weit weniger, als der knurrende Magen verlangte. Nichts deutete darauf hin, dass sich das Wetter bessern würde, der Frühling sandte nicht das kleinste Zeichen, und als fast drei Monde vergangen waren seit der Wintersonnenwende, verfügte Barn, dass die wenige Nahrung denen zugehen sollte, die kräftig waren und arbeiteten. Wenn Menschen Hungers sterben mussten, dann sollte es die alten und kranken treffen, nicht die, die gebraucht wurden, um die Felder im Frühling, wenn er endlich kam, neu zu bestellen. Alle anderen würden darauf angewiesen sein, dass mitleidige Seelen ihnen etwas von ihren kargen Rationen abgaben, und über die, die niemanden hatten, der mit ihnen teilte, hatte Barn schon das Todesurteil gesprochen, ohne es in Worte zu kleiden.
Auch Jores Schicksal schien damit besiegelt, denn Barn hatte entschieden, dass auch er nichts mehr zugeteilt bekommen sollte, und er verbot Vemara rundheraus, Jore etwas abzugeben. Vemaras Arbeitskraft würde gebraucht werden, sie sollte sich nicht durch Verzicht unnötig schwächen, und Jore zweifelte nicht daran, dass Barn die Gelegenheit, sich des ungeliebten Sohnes zu entledigen, sehr willkommen war.
Auch Meira, die in der Mine schuften musste, damit Bere immer genug Erz für neue Tauschgüter hatte, war gewarnt worden, zu essen, was sie bekommen konnte, und nichts abzugeben, denn sonst würde sie den Winter und die harte Arbeit nicht überleben. Doch Meira ließ sich nicht beirren, sie wollte nicht, dass Jore starb, und wann immer sie konnte, legte sie etwas zu essen zur Seite und brachte es ihrem Freund. Wenn sie merkte, dass er besonders schwach war, dann gab sie ihm alles, was sie hatte, und versuchte, das eigene Hungergefühl mit nichts als Wasser zu lindern.
Abends, wenn Bere sie gehen ließ, machte sie sich mit Jore auf den Weg in die Wälder, um etwas, irgendetwas, zu essen zu finden. Was sie fanden, teilten sie, und es kam einem Festmahl gleich, wenn sie ein Eichhörnchen beobachten und ein paar der Eicheln und Nüsse aufstöbern konnten, die es als Wintervorrat versteckt hatte.
III
Meiras und Jores Suche nach Essbarem war meistens von Erfolg gekrönt. Es war nie viel, was sie fanden, immer nur ein paar Bissen, und ihre mit Abstand beste Ausbeute war eine alte und geschwächte Ratte, die sich in einer ihrer simplen Fallen verfangen hatte, aber an kaum einem Tag kehrten sie zurück, ohne nicht wenigstens eine Winzigkeit in den Magen bekommen zu haben.
Trotzdem spürte Jore nicht nur sich selbst, sondern auch Meira schwächer werden, denn was sie im Wald fanden, war nie genug und konnte eine richtige Mahlzeit mit Getreide, Gemüse und vielleicht etwas Fleisch oder Fett nicht aufwiegen. Bei Meira kam die harte Arbeit in der Mine dazu, und was Barn, der sich nicht darauf verlassen wollte, dass der Winter jetzt bald vorüber sein würde, den Menschen zugestand, deren Überleben ihm wichtig schien, war gerade eben genug, um sie so weit bei Kräften zu halten, dass sie ihre Arbeit tun konnten. Indem sie auf einen viel zu großen Teil dieser Nahrung verzichtete, gleichzeitig aber neben der Arbeit auch noch große Anstrengungen unternahm, um sich mit Jore durch den Schnee zu kämpfen und Nüsse, Eicheln, essbare Rinde und Wurzeln zu suchen, wurde sie immer schwächer, und es würde nicht mehr lange dauern, bis Barn sie als so schwach einschätzte, dass sie dem Dorf nicht mehr von Nutzen war, und ihre ohnehin kläglichen Rationen auf die anderen verteilen würde.
Jore wollte nicht sterben, aber er wollte auch nicht, dass Meira in einem wohl aussichtslosen Kampf um sein Leben ihr eigenes opferte. „Ich werde allein in die Wälder gehen.“ entschied er deshalb, als sie sich abends am Eingang der Mine trafen. „Wenn ich etwas finde, dann bringe ich es mit, und wir teilen es, aber du musst deine Rationen essen.“ „Wir stehen das gemeinsam durch!“ widersprach Meira fest. „Und wir werden es schaffen.“
Jore sah, dass sie selbst Mühe hatte, daran zu glauben, aber sie ließ sich nicht davon abbringen, ihre Ration mit ihm zu teilen.
Obwohl Meira alles versuchte, um es ihm auszureden, machte er seine Ankündigung wahr und ging am nächsten Morgen, als Meira ihre Arbeit in der Mine begonnen hatte, in die Wälder. Ohne Meiras Führung fiel es ihm schwerer, und er stürzte oft, aber es gelang ihm, ein paar Bäume zu ertasten, deren Rinde essbar war. Es war weniger, als wenn Meira dabei gewesen wäre, als er schließlich ins Dorf zurückkehrte, und selbst wenn er Meira nichts davon abgeben würde, würde es nicht zum Überleben reichen, aber er war fest entschlossen, nichts mehr von seiner Freundin anzunehmen.
„Ich will nicht, dass du stirbst!“ sagte Meira fest. „Und wenn wir nicht genug zu essen finden, dann bleibt uns nur noch ein Weg: Wir müssen zu Ser-Aloi.“
Jore erschrak. Ser-Aloi, der Herr des Berges! Niemand wusste genaueres über ihn, nur dass er mächtig war, mächtig genug, um das Dorf auf einen Schlag zu vernichten. „Wir müssen es versuchen!“ beschwor Meira ihren Freund, als sie sah, dass er zögerte. „Es heißt, er würde keinem Menschen helfen.“ gab Jore zu bedenken. Außerdem munkelte man, dass Ser-Aloi leicht zu erzürnen war, manchmal genügte ein falsches Wort, und seinen Zorn hatte noch niemand überlebt.
„Ich weiß.“ gab Meira zu. „Aber was sollen wir sonst tun?“ Genau das war es – so sehr es Jore auch widerstrebte, es einzusehen, sie hatten keine Wahl. Auch wenn die Aussicht, Ser-Aloi zu finden, geschweige denn bei ihm Hilfe, nicht der Rede wert war, die Aussichten, den Winter im Dorf zu überstehen, waren es inzwischen auch nicht mehr. Jore wusste, dass sein Tod für seinen Vater beschlossene Sache war, allein dass Barn Vemara streng verboten hatte, ihm etwas zu essen zu geben, bewies es, und Meira hatte sich, indem sie trotz der harten Arbeit, die sie verrichten musste, und trotz Barns Warnung, sich nicht für die Alten und Schwachen aufzuopfern, ihre kargen Rationen mit ihm geteilt hatte, so sehr geschwächt, dass sie bald nicht mehr in der Lage sein würde, in der Mine zu arbeiten. Höchstens noch ein paar Tage, dann würde Barn sie als Belastung für das Dorf einstufen, und sie würde ebenfalls nichts mehr zu essen bekommen.
Zwei Greise waren bereits gestorben, und Tapar, ein junger Mann, der nur noch mühsam an zwei Krücken kurze Strecken laufen und mit einem steifen Schultergelenk auch keine nennenswerte handwerkliche Arbeit mehr verrichten konnte, seit er bei der Jagd von einem wütenden Hirsch niedergetrampelt worden war, würde ihnen in die kalte Erde folgen, wenn nicht in allernächster Zeit ein Wunder geschah. Sich an die Hoffnung zu klammern, dass bald endlich der Frühling kommen würde, wäre töricht gewesen, und wenn sie Ser-Aloi um seine Hilfe bitten wollten, dann mussten sie es jetzt tun, solange sie noch die Kraft hatten, in die Berge zu gehen.
IV
So kam es, dass Jore und Meira in der nächsten Nacht heimlich aus dem Dorf schlichen. Beide hatten große Angst, beide versuchten, es dem jeweils anderen nicht zu zeigen, und beide wussten, dass der andere es doch merkte. Sie kannten einander von klein auf, waren einander vertraut, sie konnten einander ihre Gefühle nicht verheimlichen.
Ihre Vorbereitung war kaum der Rede wert, ihre Ausrüstung enthielt kaum das Nötigste. Beide hatten ihre wärmste Kleidung angelegt, in ihren Rucksäcken steckten Decken, etwas Kleinkram und ein paar Stücke Brot, die Meira vor dem Aufbruch an sich genommen hatte.
Wie so oft ergänzten sie sich mit ihren Fähigkeiten gegenseitig, Meira ließ den Blick schweifen, und Jore lauschte in die Dunkelheit, während sie zwischen den Häusern entlang schlichen. Ob man sie wohl aufzuhalten versucht hätte, wenn sie erwischt worden wären? Jore nahm an, dass Barn sogar froh gewesen wäre wenn er freiwillig in die Wälder gegangen wäre, um dort den Tod zu finden, der ihn auch im Dorf erwartete, aber vielleicht hätte man ihn trotzdem nicht gehen lassen, aus Angst, es könnte ihm tatsächlich gelingen, in Ser-Alois Revier einzudringen, und er könnte so den Zorn Ser-Alois über das Dorf bringen.
Doch niemand sah sie, niemand fragte, was sie in der Nacht draußen zu suchen hatten. Zwar gab es Wachen, die Barn sogar verstärkt hatte aus Angst vor Überfällen anderer Dörfer, die unter dem harten Winter ebenso litten, aber die Männer hatten genauso mit der kräftezehrenden Arbeit bei viel zu wenig Brot zu kämpfen wie alle anderen und schliefen oft genug ein, sobald sie sich für einen Moment ins Haus setzten, um sich aufzuwärmen. Durch ein Fenster, dessen Laden spaltweit geöffnet war, konnte Meira Falan sehen, der auf einem Stuhl am Kamin saß, den Speer in der Hand, und nur deshalb noch nicht vom Stuhl gerutscht war, weil der Speer sich an der Wand verkantet hatte und ihm so als Stütze diente.
***
Jore und Meira hatte nur eine ungefähre Vorstellung davon, wohin sie gehen mussten. Alles, was sie über Ser-Aloi wussten, stammte aus den Erzählungen der Alten, und die hatten sich nicht die Mühe gemacht, den Weg zu ihm zu beschreiben. In einem unterirdischen Bauwerk hoch oben im Gebirge sollte er wohnen, der Zugang sollte kurz unterhalb des höchsten Gipfels zwischen Fels und Eis verborgen liegen. Wie sie den Gipfel erreichen sollten, wussten Jore und Meira nicht; sie waren in ihrem bisherigen Leben nicht einmal in die Nähe gekommen, obwohl sie schon im Gebirge gewesen waren. Sie würden unter den Pfaden, die sie kannten, denjenigen nehmen, der sie am weitesten in die Berge hineinführte, und danach würden sie sich ihren Weg selbst suchen müssen.
Zunächst führte der Weg über freies Feld, und nachdem sie die unmittelbare Nähe der Häuser hinter sich gelassen hatten, wurde das Laufen im fast knietiefen Schnee beschwerlich. Jore und Meira versuchten, Trampelpfaden und Tierspuren zu folgen, wo der Schnee schon zusammengetreten war und die Füße nicht so tief einsanken, aber davon gab es nur wenige, und kaum einer führte über mehr als ein paar Schritte in die richtige Richtung. Wer nicht unbedingt musste, verließ das Dorf nicht, und die Menschen, die sich allein oder in Gruppen auf die Suche nach Rinde und essbaren Wurzeln machten, hielten sich mehr in Richtung der Mittagssonne, wo der Wald näher und ausgedehnter war und reichere Beute versprach.
Im Wald wurde es etwas besser, das Laufen zumindest weniger anstrengend, denn das dichte Geäst ließ den Schnee nicht bis zum Boden kommen. Ab und an war eine Handvoll Flocken durchgerieselt und puderte jetzt den Boden, aber das reichte gerade, um der Erde einen Hauch von Weiß zu verleihen. Sobald die Kinder den Waldrand mit seinem dichten, oft dornigen Gestrüpp hinter sich gelassen hatten, konnten sie die Stellen mit hohem Unterholz gut umgehen und kamen schneller vorwärts. Meira leuchtete mit einer kleinen Fettleuchte, die sie sonst für ihre Arbeit in der Mine gebraucht hatte, und warnte Jore vor Stolperfallen. Der Boden war zwar nicht glatt, aber knüppelhart gefroren, und Kanten und Huckel, die sonst dem Fuß nachgegeben hätten, konnten einen unvorsichtigen Wanderer so leicht zu Fall bringen.