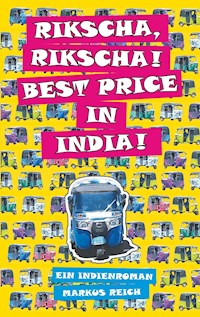Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beginnen wir damit, das allerpersönlichste Märchenwesen in uns zu entdecken, um zu verstehen, wer wir wirklich sind. Bin ich denn nun ein listiges Fabelwesen, ein kluger Elf, eine ratlose Heldin vor ihrer Feuerprobe, eine gütige Fee oder ein Seeadler, der durch die Weite des Himmels gleitet? Lassen wir zunächst jenes vor uns selbst verborgene Geheimnis aufleuchten! Seien wir endlich jene Märchenfigur, die wir uns bisher nur im kostbar gehüteten Traum erlaubt haben zu sein! Die Substanz all dessen ist seit Jahrtausenden dieselbe, sie bleibt unvermindert des Menschen größtes Mysterium, es ist nach wie vor die Magie. Eine heitere, sentimentale Reise voller Irrtümer und Glück. Vom Zauber, die eigene Gabe zu finden und zu entfalten, um sie dann zu verschenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit Träumen.
Steven Spielberg
Arbeite, als würdest du das Geld nicht brauchen. Liebe, als hätte dich nie jemand verletzt. Tanze, als würde niemand zusehen. Singe, als würde niemand zuhören. Lebe, als wäre der Himmel auf Erden.
Mark Twain
Inhalt
Das Hemd des Musketiers
Das Märchen kommt zu uns
Luise
Die andere Welt
Die Torwächterin
Im mystischen Wald
In der Wasserpension
Mit einer Fee im Labyrinth
Der verlorene König
Eine ungewöhnliche Übereinkunft
Die Liebe einer Fee
Die Verlobung
Morganas Netz
Feenwunsch
Begegnung mit der Gegenwart
Im Bann der Schneekönigin
Das Liebeselixier
Gesuch um Mitternacht
Der Nebenbuhler
Morganas Drohung
Morganas Rache
Gold spinnen
Misstrauen
Die wunderbare Welt des Sommers
Die Märchenwelt ist die wirkliche Welt
Die Konferenz der Märchenwesen
Der Märchenphilosoph
Das Tagebuch des Hamsters
Die zweite Geschichte
Ein neuer Mythos
Freiheit
Die Schneekönigin in Paris
Am Tag der Mondlandung
Abschied
Traum einer Reise
Das Hemd des Musketiers
Das Märchen kommt zu uns
Manchmal hören wir Geschichten, die ringsum für reine Erfindung gehalten werden. Dabei entdeckt jede Generation ihre eigenen Märchen, deren Existenz keinesfalls auf die Vergangenheit beschränkt ist, sie finden vielmehr in diesem Augenblick statt. Natürlich ereignen sich Märchen immer auf eine besondere Art, die ihrer jeweiligen Epoche entspricht. Sie verlaufen heute nicht mehr so wie zu Zeiten der Gebrüder Grimm, ähneln weder den ehrfürchtigen Spukgeschichten des Mittelalters, noch gleichen sie den Mythen der Antike. Dennoch vereint sie alle etwas, denn das Wunderbare entfaltet sich stets auf ungewöhnliche und wertvolle Weise.
Mag unsere gegenwärtige Umgebung auch immer weniger Märchenhaftes aufweisen und die Ausstattung der Welt sich scheinbar unaufhaltsam zum glattgebügelten und phantasielosen entwickeln, so sind dagegen die Grundlagen der Heldenreise stets die gleichen. Sie wirken sogar noch genauso wie in frühster, uns längst unwahr erscheinender Vergangenheit. Nicht nur Heldin und Held sind in ihren mannigfaltigen Ausprägungen weiterhin dieselben, sondern auch die sie Umgebenden und Beeinflussenden. All die offenkundig Unterstützenden sowie die unheimlichen Feinde, die Hinterlistigen und die Gütigen, jene legendenhaften Figuren unterschiedlichster Couleur: Wesen, die man früher Feen, Elfen, Zwerge, Kobolde, Dämonen, Engel, Geister, Riesen, Zaubrerinnen … nannte. Sie sind weiterhin um uns versammelt. Jeden Tag. Jeden Moment. Genau jetzt!
Es liegt an uns, ihr Dasein zu erkennen. Damit wir in diesem Bereich sehend werden, beginnen wir damit, das allerpersönlichste Märchenwesen in uns zu entdecken, um zu verstehen, wer wir wirklich sind. Bin ich denn nun ein listiges Fabelwesen, ein kluger Elf, eine ratlose Heldin vor ihrer Feuerprobe, eine gütige Fee oder ein Seeadler, der durch die Weite des Himmels gleitet? Lassen wir zunächst jenes vor uns selbst verborgene Geheimnis aufleuchten! Seien wir endlich jene Märchenfigur, die wir uns bisher nur im kostbar gehüteten Traum erlaubt haben zu sein! Die Substanz all dessen ist seit Jahrtausenden dieselbe, sie bleibt unvermindert des Menschen größtes Mysterium, es ist nach wie vor die Magie.
Es war einmal der Sohn eines Schäfers namens Daniel, der in ein Abenteuer gestoßen wurde, welches kein alltägliches war, sondern ein unvergleichliches, denn es gestaltete sich derart, dass unser zunächst etwas unbedeutend anmutender Protagonist zu einer faszinierenden Figur inmitten abenteuerlicher Ereignisse wurde. Unser Held wusste jedoch zu Anfang nichts von all diesen mystischen Zusammenhängen. Er ahnte im Verlauf unserer Geschichte zwar, dass es durchaus ungewöhnlich sei, was er erlebe, hatte dafür aber keine Erklärung.
Woher hätte er auch wissen sollen, dass neben, unter und über uns noch etwas anderes existiert: Ein richtiggehender Märchenkosmos, der sich manchmal mit unserer Welt überschneidet, meist jedoch nur für kurze Zeit. Und so kommt es, dass wir eines schönen Morgens völlig unerwartet von Magie umgeben sind. Lassen wir uns darauf ein, werden wir zu einer Figur inmitten eines Zauberreichs und schon bald phantastischen Wesen begegnen. Wenn auch äußerlich weiterhin die bisher bekannte Szenerie um uns bestehen bleibt, weil wir weder in eine außergewöhnliche Welt plumpsen wie Alice durch ein Loch ins Wunderland noch wie Gulliver Liliputanern begegnen. Es ist vielmehr genau andersherum: Die Märchenwelt kommt zu uns, dringt in unsere Sphäre ein und erfüllt unser bisher gewöhnliches Dasein mit ihrem Zauber, was mit sich bringt, dass Menschen nicht länger dieselben sind, sondern zu den schillerndsten Wesen überhaupt werden. Zudem sind wir gleichzeitig Märchenwesen und Alltagsmensch, die zwei Persönlichkeiten sind nicht voneinander geschieden, sondern vermischen sich unentwegt. Manchmal gewinnt der Märchencharakter in uns die Überhand, dann spüren wir ganz deutlich das Besondere – die dem Leben zugrundeliegende Leidenschaft.
Daniel war zu Beginn unserer Geschichte sehr fleißig. Denn er war in furchtbarer Eile. Warum er dabei oft so unruhig war, wusste er selbst nicht. Vielleicht lag es an der merkwürdigen Zeit, in die er hineingeboren wurde und an dem zwiespältigen und lästigen Gefühl, dass zahlreiche Erwartungen an ihn gestellt würden. Er tat, wie ihm geheißen wurde, weil er es nicht anders kannte und studierte überaus erfolgreich. Dass es noch weitaus mehr in diesem Universum gab, davon sprach niemand. Wahrscheinlich hätte Daniel solche Unterhaltungen mit einem Achselzucken abgetan und gesagt: „Also mir genügt diese Welt, die beschäftigt mich überaus. Erzähl mir nichts von seltsamen Welten. Das interessiert mich nicht im Geringsten. Wer braucht etwas anderes als das, was wir haben? Sowieso habe ich keine Zeit dafür.“
Hätte Daniel nicht selbst Einblicke in die grundlegende Wesensart des Lebens erhalten, würde er bis heute nicht ahnen, dass solcherlei existiert. Verwirrt von der überraschenden Einsicht in eine fremde und gleichzeitig auf unerfindliche Weise merkwürdig vertraute Daseinsform, berichtete er seinen Freunden davon. Natürlich glaubte ihm niemand auch nur ein Wort.
Nachdem er die so unverkennbar andersgeartete Welt mit eigenen Augen gesehen hatte, konnte er diese nicht einfach wieder vergessen. Der Rückweg zu seinem alten Leben war somit unweigerlich versperrt. Wer das Phantastische einmal gesehen hat, vergisst es nie wieder. Es bedeutet eine drastische Veränderung. Ob die davon Erfassten dies bevorzugen oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Erschwerend kam hinzu, dass das Wundersame, einmal erblickt, sich rasch wieder zurückzog. Somit musste Daniel danach suchen, um es in der Dringlichkeit der ersten Erfahrung wiederzufinden.
Es war aber nicht nur eine unterschiedliche Lebensform, die Daniel gesehen hatte, so wie wir sie aus Filmen oder Büchern kennen, mit zahllosen phantastischen Wesen, sondern es hatte sich dort auch alles anders angefühlt: Als wären alle Wesen und sogar die Gegenstände ungeheuer kostbar und auf vibrierende Weise lebendig. Daniel stand ohne Vorwarnung innerhalb einer Sekunde mit allem und allen in der intensivsten Verbindung, die man sich nur vorstellen kann. Als fühle er das bunte Abenteuerland namens Erde mit jedem Schlag seines Herzens erzittern. Dieser erste Aufenthalt dauerte vielleicht eine halbe Minute, aber das genügte, um Daniels Sein und Streben eine neue Richtung zu geben und ihn aus der gewohnten Bahn zu werfen.
Ein paar Worte vor dem Lesen des vorliegenden Romans über das Phänomen der Zeitblase erscheinen angebracht. Wir leben zeitlich gesehen nach und nach, gewöhnlich folgt ein Ereignis auf etwas, das davor geschehen ist. Daran orientieren wir uns. So ist diese Welt angeordnet. Solche Gesetze werden selten in Frage gestellt, denn ein Abweichen davon erscheint uns chaotisch. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht davon abweichen kann. Nichts blockiert unseren Blick für das Wesentliche und Mögliche so sehr wie die Gewöhnung. Um diese zu überwinden, bedarf es besonderer Anstrengungen. Dabei hilfreich sind machtvolle Hilfsmittel. Wie diese ausgestaltet sind, ist ein gut gehütetes Geheimnis. In unserer Geschichte ist es ein Musketierhemd, welches eine Zeitblase, oder die Illusion einer solchen, erzeugt. Eine Zeitblase ist wie ein Zimmer, das man betritt, und auf dessen Tür ein Datum steht, das Tage und Jahre in der Vergangenheit oder Zukunft liegt. Vielen von uns ist dieses Phänomen längst bekannt. Wer hat noch nicht von der Vergangenheit oder Zukunft geträumt und zugleich gespürt, dass solch ein Traum wahr ist, wahrer als die sogenannte Realität …
Erwarten wir nicht alle mehr vom Leben? Da muss doch etwas Besonderes sein. Es kann mit dem Tod nicht einfach alles vorbei sein, und wir von einem Tag auf den anderen verschwinden, als wären wir nie dagewesen? Warum sollten wir uns sonst tagtäglich trotz unseres Wissens über die Endlichkeit so sehr abmühen? Wäre es nicht verrückt, an einem von vornherein zum Scheitern verurteilten Unterfangen ernsthaft festzuhalten, wenn am Ende nichts als der Tod stünde? Zu allen Zeiten erschienen den Menschen belanglose Aspekte des Daseins dennoch äußerst wichtig. Geschichten hingegen waren mal mehr, mal weniger wertvoll. Gegenwärtig dienen diese meist nur der Zerstreuung. Kaum jemand nimmt sie mehr ernst. Dabei sind sie doch oft wahrer als das, womit wir uns beschäftigen. Wenn wir ein Brett auseinandersägen, ist es danach eben entzwei und das war es. Aber Pinocchios lange Nase wird, solange es Menschen gibt, die Erzählungen lauschen, in Abertausenden persönlichen Phantasiewelten existieren. Aber jetzt gehen wir erst einmal dorthin, wo alles anfing. Zunächst halten wir uns ein wenig in der gewohnten Alltagswelt auf. Unsere Geschichte beginnt natürlich kurz vor dem entscheidenden Ereignis …
Luise
Der Autor erzählt von nun an seine eigene Geschichte und gibt deshalb die Geheimniskrämerei mit der dritten Person auf. Haben Sie auch schon einmal davon gehört, dass sich ein Leben innerhalb eines Momentes für immer entscheidend verändert? Das ist genau das, wovon ich erzählen werde, wie von einem Moment auf den anderen alles anders wurde. Bisweilen vermisse ich den alten, langweiligen Kerl in mir und der neue ist mir selbst noch nicht geheuer. Er ist manchmal sogar ein richtiger Narr, der mich in ziemliche Schwierigkeit bringt.
Sieben Jahre vor Beginn des neuen Jahrtausends geschah etwas, das mein Leben umkrempelte, indem es mich von innen nach außen stülpte, meinem Dasein eine völlig andere Orientierung gab und mir einen solch dringlichen Auftrag verpasste, dass ich diesen einfach nicht ablehnen konnte. Dabei war ich damals erst fünfundzwanzig Jahre alt, ein glattgesichtiger, unerfahrener Jüngling, der sich zwar neugierig und erwartungsvoll umschaute, aber dem Kommenden ein wenig unbeteiligt entgegensah, als ginge ihn das meiste nicht allzu viel an.
Meine Schwester Luise stand an einem äußerst gewöhnlichen Donnerstag in einer Telefonzelle, deren panzerartig schwere Tür ich aufhielt, weil es darin muffig roch.
„Ich habe tolle Möbel für unser Restaurant gefunden. – Keine Angst. Ich werde rechtzeitig da sein.“
Nachdem sie ihrem Mann August die neuesten Entwicklungen geschildert hatte, fuhren wir weiter. Luise war ausgelassen und glücklich. Ich hatte schon immer an ihr gemocht, dass sie sich fallenlassen konnte, als gäbe es keine Sorgen und Gefahren auf dieser Welt. Wobei gerade Luise und August oft in schwierige Situationen gerieten. Leider war bei ihren euphorisch begonnenen Unternehmungen meist einiges gründlich schief gegangen. Wenn sie die Anfangsschwierigkeiten gemeistert hatten, trieb Augusts Spielsucht früher oder später die aussichtsreichsten Projekte in den Ruin. Dennoch konnte Luise in den Zeiten zwischen diesen problematischen Phasen belanglose Begebenheiten freudig genießen, als sei unser Dasein nur ein harmloser, sonniger Nachmittag, den wir wie in Kindheitstagen quietschvergnügt mit phantasievollen Spielen verbrachten.
„Die Familienfeier war total schön. Endlich mal wieder alle zu sehen. Und dass du mich zurückfährst, rechne ich dir ganz hoch an.“
Mein in die Jahre gekommenes Talbot Samba Cabriolet schnurrte wie eine Katze auf der sonnigen Fensterbank, während ich Luise vom Schwarzwald nach Berlin kutschierte.
„Dadurch können wir noch ein wenig mehr Zeit zusammen verbringen.“
„Aber es ist doch Prüfungszeit. Wird das nicht zeitlich etwas knapp?“, fragte Luise.
Das war typisch für meine geliebte Schwester. Erst mitten in der Aktion wird ihr das Problem bewusst.
„Ich fahre gleich heute Nacht zurück, dann bin ich am Freitagmorgen in Konstanz. Die Prüfung ist erst am Dienstag.“
„Du musst nicht die ganze Strecke fahren. Setz mich doch an einem Bahnhof ab.“
„Ich kann mein Schwesterherz doch jetzt nicht allein lassen.“
„Traust du es uns nicht zu?“
„Doch! Natürlich. Ihr habt ja alles organisiert.“
„Stimmt! Das haben wir.“
Luise drehte sich im Sitz um und lachte: „Und das Auto ist ziemlich vollgepackt. Ich weiß gar nicht, ob ich alles im Zug mitnehmen könnte.“
Natürlich hätte Luise auch mit dem Zug fahren können, aber sie hatte kurz vor der Abfahrt bei einem spontanen Flohmarktbesuch in unserem Heimatstädtchen zahlreiche Gegenstände erworben und dabei betont: „Die richtige Atmosphäre ist für das Wohlgefühl der Gäste entscheidend.“
Da konnte ich ihr nur zustimmen, aber dass sie diese Sachen am Tag vor der Eröffnung ihres Restaurants zufällig entdeckte, war für sie natürlich ein Glücksfall, stimmte mich jedoch ein wenig nachdenklich und die Idee, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn ich Luise begleiten würde, ließ mich daraufhin nicht mehr los. Luise und August wollten seit Jahren unbedingt selbstständig sein und sich aus der „elenden Lohnsklaverei“ befreien. Diesmal würden sie es also mit einem Restaurant versuchen. Das war zwar eine nachvollziehbare Idee, denn August kochte leidenschaftlich gern, doch jenes Wissen, dass sie beide nicht besonders gut mit Geld umgehen konnten, drängte sich mir wider Willen auf.
„Stell dir das nur mal vor. August und ich werden tatsächlich Restaurantbesitzer. Darauf bin ich besonders stolz. Das hat uns niemand zugetraut.“
Ich versuchte meine Besorgnis zu verbergen: „Ach, es gehört euch?“
„Ja, wir haben es gekauft.“
„Das Restaurant?“
„Nein, den Mond“, lachte Luise. „Natürlich das Restaurant!“
„Das wusste ich noch gar nicht!“
„Es war ein Schnäppchen. Wir haben es für zweihundertfünfzigtausend bekommen.“
„Eine Viertelmillion! Woher habt ihr so viel Geld?“
„Hundertfünfzigtausend haben wir bereits, den Rest bekommen wir von der Bank.“
„Wie ist euch das gelungen?“
Luise streckte mir ihre Hände entgegen. Mir war aufgefallen, dass diese etwas rau wirkten. Sowieso war ich das ganze Wochenende den Eindruck nicht losgeworden, dass meine Schwester trotz ihrer quirligen Energie erschöpft wirkte.
„Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, jeden Job neben unseren Vollzeitstellen angenommen und etwas von Freunden geliehen. Außerdem hat mir Mutter meinen Anteil am Erbe vorab ausgezahlt.“
Das hörte sich an wie ein Geständnis.
„Sie macht sich jedoch große Sorgen, dass etwas schiefgehen könnte“, fügte meine Schwester nachdenklich hinzu.
„Und die fehlenden hunderttausend bekommt ihr von der Bank?“
„Ja“, rief Luise fröhlich. „Morgen früh ist der Termin mit dem Berater. Wir unterschreiben den Kreditvertrag, die überweisen das Geld und schon gehört das Restaurant uns.“
„Das geht ja alles ziemlich schnell.“
„Mir wird ganz schwindlig, wenn ich nur daran denke“, lachte Luise.
„Mich würden Schulden nervös machen. Falls der Kredit platzt, ist das Restaurant und vielleicht auch der Eigenanteil weg.“
„Wieso soll der Kredit platzen?“
„Ich weiß nicht. Aber habt ihr Rücklagen, um die Kreditraten abzupuffern, falls es mal nicht so läuft?“
„Nein, wir haben so viel für die Ausstattung ausgegeben. Außerdem haben wir einen tollen Weinvorrat angelegt.“
„Ich will dich nicht beunruhigen, aber …“
„Lass uns das Thema wechseln. Ich hasse es, über Geld zu reden.“
„Kann ich verstehen“, stimmte ich zu, war aber keinesfalls beruhigt. Ich musste daran denken, dass meine geliebte Schwester vor zwei Jahren einen Zusammenbruch erlitten hatte, als der Stress in ihrem Angestelltenjob zu groß wurde. Es war schrecklich gewesen, das mit anzusehen und ihr nicht wirklich helfen zu können. Immerhin hatte sie während der darauffolgenden Kur August kennengelernt. Seitdem waren die beiden unzertrennlich. Es war schon außergewöhnlich, dass sie ein paar Tage ohneeinander verbrachten und August nicht mit zur Familienfeier gekommen war. Luise betonte, dass es das erste Mal sei, seit sie sich kennen würden, dass sie länger als einen Tag voneinander getrennt seien.
„Und wie geht es August?“
„Wunderbar. Er freut sich, dass es bald losgeht.“
„Hat er die Therapie gegen seine Spielsucht abgeschlossen?“
„Nein, die musste er verschieben. Wir hatten so viel zu tun. Aber seit dem letzten Desaster hat er keinen Fuß mehr in eine Spielhölle gesetzt. Er weiß, dass mit der Eröffnung unseres Restaurants alles anders wird. Jetzt bin ich aber ziemlich müde. Ist es in Ordnung, wenn ich etwas schlafe? Ich muss morgen schließlich fit sein.“
„Klapp doch den Sitz zurück. Hinten liegt noch eine Decke.“
Während Luise den Sitz zurückstellte, die Decke über sich zog und die Augen schloss, dachte ich daran, wie sie auf dem Flohmarkt enthusiastisch gefeilscht und jedem erzählt hatte, dass dies oder das für ihr Restaurant sei. Sie hatte allen lächelnd eine Visitenkarte überreicht und dabei betont: „Ein Unikat. Handgemalt.“
„Wie lange brauchst du für so eine Visitenkarte?“, hatte ich Luise gefragt.
„So eine halbe Stunde. Aber das mache ich abends.“
Mir gingen Begriffe wie Kosten-Nutzen-Analyse durch den Kopf und ich fragte mich, ob jemand, der auf einem Flohmarkt im Schwarzwald eine Visitenkarte von ihr erhielt, jemals ihr Restaurant in Berlin betreten würde. Luise hatte die Augen geschlossen, ich fuhr durch die Nacht und spürte, wie sehr ich meine Schwester liebte. Sie war mir in so vielen Dingen überlegen, aber sie hatte schon immer Zahlen und Geldangelegenheiten gehasst, was mir nicht wenig Sorgen bereitete, je länger ich darüber nachdachte.
„Denkst du noch manchmal daran?“, drang irgendwann unvermittelt Luises Stimme unter der Decke hervor.
„Woran soll ich denken?“
„Als ob du das nicht wüsstest“, sagte Luise vorwurfsvoll unter der Decke.
„Du meinst an früher?“
„Natürlich. An deine Zeit als Schäferjunge. Ich vergesse nie, wie du, als du dreizehn warst, vor unserer Tür standest. Die Polizei lieferte dich bei uns ab. Nachdem Vater die Schafherde abgegeben hatte, bist du mit dem Hirtenhund abgehauen.“
„Stimmt, aber das ist so lange her.“
„In den Sommerferien wollte ich immer bei euch und den Schafen bleiben. Aber Mama hat es nie erlaubt. Ich war so neidisch auf dich, weil du den ganzen Frühling und Sommer mit Vater draußen warst. Abends musste ich zuhause sein und in meinem langweiligen Bett schlafen, während ihr ein Lagerfeuer angezündet und euch mit den Sternen zugedeckt habt.“
„Das war eine besondere Zeit.“
„Aber manchmal hattest du Schwierigkeiten deswegen. Du hast auch Prügel bezogen.“
„Stimmt, ab und zu gab es Ärger.“
„Einmal sahst du ziemlich übel aus“, rief Luise, während sich die Decke bewegte und ihr Kopf auftauchte.
„Damals haben sie mich richtig durchgebläut. Es war ein Junge, der mindestens einen Kopf größer war und zehn Kilo mehr wog als ich. Er hatte es auf mich abgesehen, weil ich nach Schafen roch.“
„Mutter wollte dich danach da wegholen.“
„Aber ich habe mich geweigert. Was war ich nur für ein trotziger Junge! Ich wollte nicht von diesem freien Leben weg. Im Sommerhalbjahr besuchte ich alle möglichen Schulen, je nachdem, wo die Herde weidete und im Winter waren wir alle im alten Haus versammelt.“
„Dort ist noch immer alles so einfach, so rudimentär. Es ähnelte schon immer mehr einer Burg als einem Haus“, meinte Luise schwärmerisch und fragte: „Mutter ist inzwischen fast immer bei Friedhelm und das ehrwürdige Gemäuer steht leer. Bist du noch ab und zu dort?“
„Ich halte es in den Semesterferien instand. Ein paar Reparaturen hier und da. Wäre schade, wenn es verfällt.“
„Die Gegend ist so verträumt, als ob dort seit Jahren die Zeit stillsteht“, schwärmte Luise.
„Es ist ein besonderer Ort.“
„Das Haus gehört doch Vater. Wollte er es nicht verkaufen?“
„Eigentlich ja“, sagte ich zögerlich, „aber er wartet darauf, ob einer von uns es eines Tages übernehmen will, damit es im Familienbesitz bleibt.“
„Das alte Gemäuer?! Du weißt, dass ich kein Interesse daran habe.“
„Sie haben noch nicht einmal die Scheidung eingereicht.“
„Verstehe das wer will. Aber ich hüte mich nachzufragen.“
Luise wechselte das Thema, was typisch für sie war, fuhr mir dabei durch die Haare und zerzauste diese: „Ich hätte nie gedacht, dass gerade du Ingenieur wirst.“
„Wieso?“
„Weil du seitdem nicht mehr dem kleinen, glücklichen und wilden Jungen mit ungewaschenen Haaren ähnelst, der nach Schafen, Wald und Wiese roch. Stellst du dein Bett immer noch unters geöffnete Fenster, um die Sterne zu sehen?“
„Ja.“
„Denkst du manchmal noch daran, wie du von klein auf mit Vater durchs Land gezogen bist?“
„Selten. Ich weiß noch, dass es eine sonderbare und schöne Zeit war. Fast, als wäre es gar nicht wahr gewesen. Es war alles so anders.“
„Hätte Vater nicht von einem Tag auf den anderen die Herde abgegeben, wärst du vielleicht Schäfer geworden und würdest heute mit den Tieren frei durch die Gegend streifen.“
„Meinst du?“, fragte ich erstaunt und es war einen Moment lang so, als riefe jemand nach mir, den ich vor langer Zeit kannte. „Ein sonderbarer Gedanke.“
„Weißt du noch, was Tante Simone einmal gefragt hat, als du bei uns gelebt hast?“
„Nein.“
„Sie hat gefragt, was du einmal werden willst. Mich hat sie nicht gefragt, ich war schließlich nur ein Mädchen. Ich war ziemlich beleidigt deswegen, vielleicht weiß ich es deshalb noch so genau.“
„Tante Simone war schon immer etwas schräg drauf.“
„Du hast ohne zu zögern geantwortet und dabei über das ganze Gesicht gestrahlt.“
„Und was wollte ich damals werden?“
„Landstreicher.“
„Habe ich das wirklich gesagt?“
„Ja, hast du!“
„Verrückt! Und wie haben sie reagiert?“
„Sie waren entsetzt und haben versucht, es dir auszureden. Was ihnen, wie man sieht, bestens gelungen ist.“
„Interessant. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran.“
„Was ist eigentlich mit dir, Brüderchen?“
„Was meinst du?“, fragte ich, obwohl ich genau wusste, worauf sie hinauswollte.
„Ich habe August. Aber du? Wo ist die Frau an deiner Seite?“
„Da ist niemand, aber es geht mir gut.“
„Das sagst du immer, aber da bin ich mir nicht so sicher. Ist da keine, die dich interessiert?“
„Gerade nicht.“
„Auch das sagst du immer.“
„Ich habe die Richtige einfach noch nicht getroffen.“
„Dann lauf bloß nicht an ihr vorbei, wenn sie vor dir steht“, lachte Luise.
Ein wenig später schlief Luise wieder ein, diesmal so tief und fest, dass sie erst wach wurde, als wir vor dem Restaurant hielten. Hinter den großen Glasscheiben herrschte eine umfassende Dunkelheit, obwohl am nächsten Tag eröffnet werden sollte. August musste also längst alles vorbereitet haben. Meine Bedenken waren unnötig gewesen. Luise war, nachdem wir das Lokal betreten und Licht gemacht hatten, jedoch überhaupt nicht der Meinung, dass alles vorbereitet sei. August fanden wir zwei Stunden später in einer Spielhalle. Nach einigem Hin und Her stellte sich heraus, dass er das gesamte Startkapital verspielt hatte. Luise fragte verzweifelt, wie sie die fehlenden Lebensmittel und Getränke für die Eröffnung bezahlen sollten. Ich erkundigte mich vorsichtig, ob sie nicht per Bankkarte einkaufen könnten. Natürlich hatte August ganze Arbeit geleistet und den Dispokredit restlos ausgequetscht. Sie waren die liebenswertesten Menschen, aber einfach keine Unternehmer und dazu kam noch Augusts überwunden geglaubte Spielsucht. Es war hoffnungslos.
„Ich hätte nicht wegfahren dürfen“, warf sich Luise vor, als wir den reumütigen August ins dunkle Restaurant geführt hatten.
„Ein paar Hunderter, die ihr für die Eröffnung braucht, kann ich vorstrecken.“
„Aber der Lohn für die Bedienung“, warf August folgerichtig ein, der nun, nachdem er alles verspielt hatte, geradezu übervernünftig argumentierte.
„Wir wollen morgen Abend eröffnen. Die Werbung ist geschaltet, und wir haben unsere Freunde eingeladen. Das Restaurant ist von Freitag- bis Sonntagabend ausgebucht“, fasste Luise verzweifelt zusammen.
„Also kellnern wollte ich schon immer, ich kann das übernehmen, dann spart ihr euch den Lohn, und mit den Einnahmen aus den ersten Tagen finanziert ihr alles Weitere.“
„Kannst du das überhaupt?“, fragte mich Luise kritisch.
Führte sie jetzt etwa ein Vorstellungsgespräch als toughe Unternehmerin, die etliche Bewerber zur Auswahl hatte? Das war dann doch etwas unheimlich.
„Klar. Darin habe ich Erfahrung“, log ich. Immerhin hatte ich bei der letzten Wohnheimparty an der Kellerbar Dienst geschoben.
„Aber du musst doch aufbrechen. Deine Prüfung.“
„Die ist erst am Dienstag. Am Montagnachmittag ist eine Labor-Pflichtveranstaltung. Also kann ich am Sonntagabend nach Restaurantschluss zurückfahren, Montag früh zu meiner Lerngruppe stoßen, nachmittags gehe ich ins Labor, danach schlafe ich mich aus und schreibe am Dienstag die letzte Prüfung des Semesters.“
Luise lächelte einige Momente nachdenklich-verhalten, dann ging ein Strahlen über ihr Gesicht, und sie fiel mir um den Hals. August tat mir leid, er grinste schief und fühlte sich sicherlich schrecklich.
An einem eisigen Freitagmorgen fuhren Luise, August und ich zur Bank. Herr Kleinschmidt war eine seltsame Person. Er schien sprichwörtlich nur aus Zahlen zu bestehen. Als ob diese seinen Charakter ausmachten und ihm sein Beruf alles bedeutete. Er rasselte die Inhalte und Bedingungen des Vertrages herunter. Wir konnten nach der anstrengenden Nacht kaum mehr die Augen offenhalten, obwohl uns Kaffee in Tassen, auf denen das Emblem der Bank aufgedruckt war, vorgesetzt wurde. Es war eine bizarre Veranstaltung in diesem Hinterzimmer eines prächtigen Finanzhauses. Auch wenn es die allerbesten Konditionen seien, wie uns Herr Kleinschmidt immer wieder versicherte, mussten doch sein Gehalt und die Miete dieses neuzeitlichen Tempels bezahlt werden. Wovon? Von den allerbesten Konditionen? Es hörte sich fast so an, als ob die Bank mit diesem Kredit einen Verlust machen würde. Das war schwer zu glauben. Außer sie nahmen andere Kunden aus und waren großzügig mit Luise und August. Aber warum sollten sie das sein? Gerade mit meiner Schwester und ihrem Mann, die in geschäftlichen Dingen sehr unerfahren waren. Wurden sie hier zur Schlachtbank geführt, ohne es zu ahnen? Wir saßen steif da, trauten uns nicht, irgendetwas zu fragen und nippten am lauwarmen Kaffee. Endlich durften Luise und August an mehreren Stellen den Kontrakt unterschreiben, was sie taten, ohne diesen durchzulesen. Wir waren irgendwann nur noch froh, dass die Veranstaltung auf ein Ende zusteuerte.
„Sie haben Glück“, meinte Herr Kleinschmidt abschließend. „Gerade noch rechtzeitig. Bald treten neue Richtlinien in Kraft, dann könnte ich Ihnen einen solch vorteilhaften Kredit nicht mehr anbieten.“
„Da haben wir wirklich einmal Glück gehabt“, meinte Luise und sah August freudestrahlend an, der ihr erleichtert zunickte.
Nachdem der Kreditvertrag unterschrieben war, hatten wir mit einem Mal unendlich viel zu tun, aber die Eröffnung lief richtig gut und kleine Fehler sahen uns die Gäste milde lächelnd nach. Drei Tage lang kamen wir kaum dazu, einen Schluck Wasser zu trinken. Wir rannten hin und her und hatten tausend Dinge gleichzeitig zu tun. Nachdem am Sonntagabend die letzten Besucher verschwunden waren, saß ich auf den Steinstufen vor dem Restaurant. Luise kauerte neben mir, lehnte ihren Kopf an meine Schulter, während August einen Reiseimbiss zurechtmachte. Das erste Wochenende war überstanden. Während ich daran dachte, was alles nötig war, um ein Restaurant erfolgreich zu führen, empfand ich höllischen Respekt vor der Aufgabe, die meiner geliebten Schwester und August bevorstand.
Am Montag fuhr ich bei Sonnenaufgang über die Alte Rheinbrücke in Konstanz, ließ wenig später die Reisetasche in meinem Zimmer fallen, schnappte zwei Ordner, eilte in den Raum auf dem Dach des Thomas-Blarer-Wohnheims und stieß dort zu meiner Lerngruppe.
Sechs Stunden später lehnten wir uns erschöpft zurück und Zinnober meinte: „So, das reicht. Wir sind jetzt perfekt für die morgige Prüfung vorbereitet.“
„Also meine Hirnwindungen haben bereits Muskelkater“, klagte Enak, der mit seinen über zwei Metern Körpergröße, ein wenig kleiner als Zinnober war. Sie waren beide einen Kopf größer als ich. Wir lernten zusammen, seit wir vor zweieinhalb Jahren das Studium begonnen hatten.
„Was haltet ihr davon, wenn wir noch etwas mit Jakob lernen?“, schlug ich vor und konnte ein Gähnen nicht unterdrücken.
„Was willst du denn schon wieder bei dem?“, maulte Zinnober. „Der passt doch gar nicht zu dir. Dass der noch nicht exmatrikuliert wurde, grenzt sowieso an ein Wunder. Hahaha.“
„Der hat mehr drauf, als ihr denkt.“
„Er schreibt ja auch jede Prüfung zweimal“, lästerte Enak.
„Lasst uns ihm einfach helfen, schließlich ist er ein Freund.“
„Und was für einer“, lachte Enak.
„Aber deiner, nicht unserer. Ist doch gut, wenn er durchfällt. Schon wieder einer, der die Durchfallquote erfüllt.“ Zinnober stieß ein ziegenähnlich-meckerndes Lachen aus.
„Sind wir jetzt eine Lerngruppe oder nicht?! Alle für einen, einer für alle. Ich helfe euch auch mal wieder. Und dass du froh bist, wenn es andere und nicht dich trifft, darüber solltest du nochmals in Ruhe nachdenken.“
„Ganz ruhig. Du hast ja gewonnen“, lenkte Enak ein: „Wir kommen mit. Aber zwei Sachen sind bei dir seltsam. Dass du so oft mit diesem Jakob abhängst und deine Schullektüre. Normale Ingenieurstudenten lesen keine verstaubten Klassiker der Weltliteratur.“
Als wir Jakobs vollgestopftes Zimmer betraten, saß eine Frau mit großen und außergewöhnlich ausdrucksvollen Augen im Schneidersitz auf seinem Bett, musterte uns aufmerksam und strich ihre langen braunen Haare hinter die Ohren.
„Wir dachten, dass wir vielleicht gemeinsam für die morgige Prüfung lernen sollten.“
„Gute Idee“, nickte Jakob zu dem Vorschlag. Ich entdeckte jedoch nichts, das auf Lernaktivitäten hinwies. Eine geöffnete Stereoanlage nahm den Großteil des Schreibtischs ein, und Jakobs Lötkolben sandte eine dünne Rauchspur in die Luft.
„Das ist Anne“, murmelte Jakob.
Wir drängelten nacheinander ins schmale Zimmer und stellten uns Anne vor.
„Da ist doch überhaupt kein Platz“, reklamierte Zinnober.
„Das haben wir gleich“, rief Jakob. Er zog eine Nähmaschine unter dem Schreibtisch hervor, setzte sich darauf und rief: „Geht doch! Bitte!“ Jakob zeigte auf seinen frei gewordenen Stuhl. Enak ließ sich umgehend darauf fallen.
„Einer kann zu mir aufs Bett“, bot Anne an und zwinkerte mir verschwörerisch zu.
Jakob zog aus den unerfindlichen Tiefen der Regale, die sämtliche Wände verdeckten, ein Brett hervor und legte es über das Waschbecken, das sich in der Ecke neben der Eingangstür befand und stellte einen dreibeinigen Schemel davor.
Er deutete einladend darauf, woraufhin ihn Zinnober so verwirrt ansah, dass ich lachen musste, während ich mich neben Anne aufs Bett fallen ließ.
Als wir endlich alle saßen, meinte Jakob: „Wo habe ich nur den Ordner?“
„Wenn du überhaupt einen Ordner hast“, zweifelte Zinnober. „Hast du denn schon angefangen zu lernen?“
Jakob ignorierte die Frage, woraufhin Zinnober ironisch meinte: „Immerhin ist die Prüfung ja erst morgen.“
Wir nahmen uns eine Aufgabe vor, die der gutmütige Enak Jakob Schritt für Schritt erklärte, während Zinnober seine Formelsammlung ergänzte und Anne sich ungefragt an mir zu schaffen machte. Sie hatte ein Schneidermaßband herausgeholt und angefangen, mich zu vermessen.
„Was machst du da?“, flüsterte ich, weil mir das Ganze etwas peinlich war. Gleichzeitig war es sehr angenehm, wie sie mit zarten Fingern ihr Maßband um meine Brust schlang. Sie stellte sogar meine Nasenlänge und den Abstand zwischen meinen Augen fest.
„Ich schneidere dir ein Musketierhemd.“
Zinnober kicherte. Er beobachtete uns belustigt.
„Ein was?“, flüsterte ich.
„Wie sie die Musketiere tragen. Unterstützt bei der Verwandlung.“
„Welcher Verwandlung?“
„Muss ich jetzt das mystische Rätsel lösen oder du?“
„Sprichst du von der morgigen Prüfung?“
„Die ist äußerst unwichtig. Jedenfalls steht dir einiges bevor – gemäß deinem ausdrücklichen Bedürfnis.“
„Sein ausdrückliches Bedürfnis“, lachte Zinnober, „ist, die Prüfung hinter sich zu bringen und sich danach gründlich mit uns zu betrinken.“
„Nein, ist es nicht!“, meinte Anne streng.
Das hörte sich so endgültig an, dass Zinnober die Schultern zuckte und sich wieder seinen Formeln über dem Waschbecken widmete. Er murrte noch, dass es das erste Mal wäre, wenn wir nach der letzten Prüfung des Semesters nicht saufen würden, während Anne mir mit dem Ellbogen einen freundschaftlichen Stoß versetzte und mir vertraulich zublinzelte, als teilten wir ein Geheimnis.
Wenig später verließen wir Jakobs Zimmer, ließen ihn mit Anne zurück und unterhielten uns im dunklen Flur.
„Der wusste gar nichts“, meinte Enak und schien sich Sorgen um Jakobs Prüfungsergebnisse zu machen.
„Immerhin gab es Tee“, meinte ich.
„Von wegen Tee. Du hast die ganze Zeit mit Anne getuschelt“, meckerte Zinnober. „Obwohl sie uns ausgelacht hat. Was für kryptische Formeln wir da zu verstehen versuchten. Zauberer wären wir deshalb noch lange nicht.“
„Ist auch abgefahren, was wir berechnen“, meinte Enak.
„Alles irgendwie nicht von dieser Welt“, fügte ich nachdenklich hinzu.
Enak wandte sich zum Gehen: „Dann bis nachher.“
„Nachher?“, gähnte ich und war auf einmal todmüde.
„Labor“, mahnte Zinnober.
„Wann?“
„In genau einer Stunde. Aber du siehst völlig erledigt aus.“
Ich erwähnte, dass ich die ganze Nacht gefahren sei, und wenn ich mich jetzt hinlegen, nicht mehr hochkommen würde. Daraufhin sagte ich unwillkürlich: „Also sollte ich vielleicht kurz in den Seerhein springen, um wach zu werden.“
„Es ist Februar, Daniel. Die Wassertemperatur beträgt drei Grad.“
Zinnober und Enak zogen kopfschüttelnd ab, die Schatten zweier Riesen tanzten verzerrt und skurril, lustig und lebendig die Wände des Flurs auf und ab.
Hinter mir verließ Anne Jakobs Zimmer.
„Gehst du schon?“, fragte ich sie.
„Ja, dein Musketierhemd muss schließlich rechtzeitig fertig werden.“
„Natürlich“, nickte ich und war jetzt ganz sicher, dass sie ein ungewöhnlicher Mensch war.
„Du kannst es morgen abholen.“
Nachdem sie ihre Adresse in großen Buchstaben auf meine Hand gemalt hatte, wandte sie sich zum Gehen. Im nächsten Moment war auch sie im Halbdunkel des Gangs verschwunden.
„Bis bald, mein tapferer Musketier“, hörte ich ihre Stimme, die weit entfernt klang. Ihre Worte hallten den Gang entlang, als seien wir in einem tiefen Gewölbe und nicht in einem ordinären Wohnheimflur.
Da Jakob jetzt allein sein musste, hielt ich es für eine gute Idee, nochmals sein Zimmer zu betreten.
„Was gelernt?“
„Ja“, sagte Jakob nebenbei, als wäre das nicht so wichtig. Er beugte sich mit dem Lötkolben über die Stereoanlage, die wieder ihren angestammten Platz auf dem Schreibtisch eingenommen hatte. Schließlich zog er ein Relais aus der Platine. „Das Ding zieht nicht mehr an.“
Ich lehnte auf dem Bett und schloss probeweise die Lider.
„Müde?“
„Ja, und gleich noch das Labor“, murmelte ich mit geschlossenen Augen.
„Dummerweise eine Pflichtveranstaltung mit Anwesenheitsliste“, stöhnte Jakob und ich hörte heraus, dass er nicht hingehen würde, gäbe es keine Anwesenheitsliste.
„Da müssen wir wohl oder übel durch“, versuchte ich uns zu motivieren.
Jakob überlegte laut, dass er gar nicht wisse, wie ich das anstellen würde. Ich sei immer voll auf Kurs, hätte sechs Semester mit Bestnoten durchgezogen, täte eigentlich nichts anderes als Vorlesungen und Laborveranstaltungen zu besuchen und zu lernen, und wäre total angepasst und ehrgeizig. Am Ende warf er mir einen schiefen Seitenblick zu und meinte, dass das doch eigentlich gar nicht zu mir passen würde.
„Das ist eben während des Studiums so. Und das ist absehbar und irgendwann vorbei.“
„Das sagst du immer. Aber was ist, wenn du das Diplom hast? Dann musst du dich erst einmal im Job beweisen. Das ist bestimmt kein Zuckerschlecken. Und danach kommt die nächste Herausforderung. Ich glaube, das geht dann immer so weiter.“
„Meinst du wirklich? Irgendetwas, eine Belohnung, also so was in der Art, muss doch irgendwann kommen.“
„Da wäre ich mir nicht so sicher“, zweifelte Jakob. „Das Leben auf später aufzuschieben ist ein Fehler, wenn du mich fragst.“
Schläfrig murmelte ich, dass er damit womöglich recht habe, aber ich erst einmal kurz in den Seerhein springen müsse, um wach zu werden.
„Gute Idee“, rief Jakob begeistert aus. „Endlich mal ein vernünftiger Vorschlag. Genau das meine ich: Da steckt doch noch was ganz anderes in dir als der übermotivierte Streber.“
Eigentlich hatte ich das nicht ernst gemeint und fragte mich, wie ich überhaupt auf die verrückte Idee kam. Aber nachdem Jakob Feuer und Flamme war, er liebte ungewöhnliche Vorhaben, gab es kein Zurück.
Die andere Welt
Jakob stieß ein nervöses Lachen aus, als ich die Augen aufschlug.
„Du schaust so komisch“, sagte ich.
„Du – bist – wieder – da!“
„Ist alles gut bei dir?“
„Bei mir?“, fragte Jakob entgeistert.
„Wieso schaust du mich so blöd an? Und wieso liege ich hier?“
Jakob fing an zu lachen, wollte was sagen, aber kicherte einfach weiter. Er war völlig hysterisch.
„Habe ich etwas verpasst?“
„Ja! Und ob! Du warst weg! Ganz flacher Puls! Wenn überhaupt! Ich weiß nicht mal, ob du noch geatmet hast! Da war irgendwie fast gar nichts mehr!“
„Oh!“
„Ich dachte, du wärst tot oder stirbst gleich!“
Jakob war ziemlich aufgelöst. Es musste ihn ganz schön mitgenommen haben, dass ich bewusstlos gewesen war, und er hatte tatsächlich Angst gehabt, dass ich sterben könnte. Er berichtete, dass er mehrfach um Hilfe gerufen habe, aber keine Reaktion erfolgt sei. Ausnahmsweise waren keine Passanten unterwegs gewesen. Es dauerte eine Weile, bis Jakob sich halbwegs beruhigt hatte, während ich verwundert die Welt um mich herum betrachtete.
„Wie lange war ich weg?“, fragte ich schließlich.
„Ich weiß nicht! Eine halbe Minute, vielleicht waren es auch zwei Minuten! Ich habe nicht auf die Uhr geschaut.“
„Natürlich nicht.“
„Ich habe dich bestimmt zwanzig Mal geohrfeigt. Wenn du jetzt nicht die Augen aufgemacht hättest, hätte ich mit einer Herzdruckmassage begonnen.“
„Tatsächlich?!“
„Erinnerst du dich nicht?“
„Woran?“
„Wir waren schwimmen.“
„Stimmt.“
„Danach haben wir etwas Gymnastik gemacht, du bist in die Hocke, hoch – und wie ein Sack umgefallen. Ich habe es nur aus den Augenwinkeln gesehen, also mehr gehört als gesehen.“
„Daran erinnere ich mich nicht, nur …“
„Nur was?“
„Ich hatte so einen seltsamen Traum.“
„So einen seltsamen – was? Sprich doch mal langsamer, verdammt!“
„Traum. Spreche ich wirklich so schnell?“
„Absolut. Ich verstehe dich kaum. Und der Traum? Erzähl doch, aber langsam.“
„Ich träumte, dieses eine Leben bis in alle Ewigkeit zu wiederholen. Immer und immer wieder. Jeden einzelnen Tag, jede Stunde, jeden Augenblick. Nichts wird ausgelassen. Ich erlebte alles stets aufs Neue, nicht unbedingt in der gleichen Abfolge, aber schon ging es von vorne los …“
„Das muss eine Nahtoderfahrung sein“, folgerte Jakob.
„Meinst du?“
„Hast du ein Licht am Ende eines Tunnels gesehen?“
„Nein.“
„Oder so etwas in der Art?“
„Nein.“
„Ist ja auch egal. Hauptsache du lebst.“
„Aber es fühlte sich sehr echt an. Und alles vibrierte, war so intensiv, so real, nein, eigentlich viel realer als das hier – so bunt, so lebendig. Die Welt war unablässig in harmonischer Bewegung und ich hatte das deutliche Gefühl, ganz dagewesen zu sein, irgendwie war es ziemlich außergewöhnlich, eine geradezu phantastische Wirklichkeit.“
„Tatsächlich?!“, murmelte Jakob ungläubig.
„Da waren Elfen, Feen, ein verzweifelt-trauriger König und eine wunderschöne Frau. Vielleicht eine Magierin?“, überlegte ich.
Jakob starrte mich fassungslos an: „So, so. Wir brechen jetzt besser auf. Das Labor hat schon angefangen. Meinst du, das geht?“
„Natürlich. Aber wieso gehen wir da hin?“
„Schon vergessen? Anwesenheitspflicht! Du bist wohl noch etwas abwesend.“
„Ich solle danach trachten, von nun an bei allem, was ich tue, etwas zu fühlen. Ich glaube, das hat eine Fee zu mir gesagt.“
„Wer hat was gesagt? Du redest schon wieder so schnell.“
„Die Fee sagte, ich solle von nun an etwas fühlen, bei allem ...“
„Du bist jedenfalls ziemlich hinüber. Das legt sich bestimmt wieder. Es muss ein ganz schöner Schock sein, so gut wie tot zu sein.“
„Jedenfalls hat sich das Ganze großartig angefühlt.“
„Bist du dir sicher? Ich glaube, du kannst das im Moment gar nicht beurteilen. Komm erst mal wieder zu dir.“
„Bin ich doch.“
„Du fühlst dich also wie zuvor?“
„Nein, völlig anders.“
„Aber dann …“
„Als ob etwas in mir zurückgedreht wurde.“
„Was meinst du damit?“
„Das hat mit der ewigen Wiederkehr zu tun.“
„Womit?“
„Bis in alle Ewigkeit werden wir unser Erdenleben wiederholen. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Moment für Moment.“
„Aha“, murmelte Jakob ungläubig, als höre er einem kleinen Kind zu.
„Die ewige Wiederkehr steht uns allen bevor.“
„Daniel, du warst schon immer etwas seltsam. Du liest vielleicht wirklich zu viele alte Bücher. Jedenfalls müssen wir dringend los. Und das mit der ewigen Wiederkehr und so behältst du besser erst einmal für dich.“
„An guten, erfüllten Tagen erfreuen wir uns in tausend Jahren noch, aber auch die vergeudeten Tage werden uns begleiten – bis in alle Ewigkeit. Schau auf dein Leben, auf jeden einzelnen Tag, auf jede Stunde, sogar auf jeden Moment.“
„Jetzt mal langsam, Daniel. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir die auf der Erde gelebten Tage bis in alle Ewigkeit wiederholen werden?“
„Natürlich. Wir sind nur hier, um Momente einzusammeln. Und diese wirst auch du nach deinem Tod wiederholen.“
„In der gleichen Reihenfolge?“
„Nein. Die Fee meinte, dass du heute als Siebenjähriger weinst und lachst – und dich morgen als Fünfunddreißigjähriger langweilst – übermorgen bist du zweiundzwanzig und verliebt – und restlos glücklich fühlst du dich vielleicht mit zweiundsiebzig.“
„Und was ist mit all denen, die kein gutes Leben haben, die nichts an ihrer benachteiligten Rolle ändern können?“
„Es geht nicht um Gerechtigkeit. Aber die Wiedergeburt erlöst uns alle.“
Jakob war fassungslos: „Die Wiedergeburt! Hilfe! Für was muss die noch alles herhalten? Jedenfalls müssen wir ins Labor. Kannst du überhaupt aufstehen? Es ist eiskalt. Du bist geradezu blau gefroren. Sag nachher lieber nichts! Und wenn, dann redest du am besten so schnell wie gerade eben, dann versteht dich wenigstens keiner.“
„Vielen Dank.“
„Wofür?“
„Na ja, ohne dich wäre es das wohl gewesen, ohne dich hätte mein Leben am Konstanzer Seerhein ein frühzeitiges Ende genommen.“
„Komm doch“, sagte Jakob erneut. Es war zwar Winter, aber ich hielt zum wiederholten Male inne und schaute mich behutsam um. Es kam mir wie ein Wunder vor, am Leben zu sein. Nur merkwürdig, dass gerade diese seltsame Welt um mich herum Bestand hatte – und vor allem, dass sie so aussah, wie sie aussah.
„Bleib doch nicht immer stehen.“
Irgendwie schafften wir es ins Labor. Auf den Umweg übers Wohnheim hatten wir verzichtet, weil wir sowieso schon spät dran waren. Alle schauten uns entgeistert an. Es war Februar und wir waren mit unseren Köpfen untergetaucht, die Temperaturen lagen deutlich im Minusbereich, unsere Haare waren gefroren und schlohweiß. Sie schauten uns an, als wären wir Amundsen oder Scott auf verzweifelter Südpolexpedition und würden nur mal kurz zwischendurch hier reinschauen.
„Wo habt ihr denn eure Schlittenhunde?“, rief ein Witzbold, der ganz offensichtlich einen ähnlichen Gedanken hatte.
„Die haben wir draußen angebunden, die dürfen hier doch nicht rein“, kalauerte Jakob.
Das war es dann aber auch. Jakob ging zu seiner Laborgruppe und ich zu Zinnober und Enak. Zuvor flüsterte Jakob mir zu: „Einfach – ganz – normal – verhalten.“
Ich nickte abwesend, setzte mich auf einen abgeschabten Holzhocker und schaute erstaunt auf die blinkenden Messgeräte und bunten Kabel, die eine verworrene Ansammlung bildeten und zahlreich den Versuchsaufbau schmückten.
„Alles okay?“, fragte Zinnober und schaute mich interessiert und höchst misstrauisch an.
„Wunderbar.“
„Du siehst irgendwie komisch aus“, sagte Enak.
„War wohl ganz schön kalt im Seerhein?! Ihr seid aber auch total verrückt, im Februar schwimmen zu gehen“, meinte Zinnober und schüttelte vorwurfsvoll den Kopf. Es war klar, dass er das sagte. Riesen gehen nicht gerne unnötige Risiken ein, dachte ich und fragte mich vergeblich, woher ich dieses Wissen bezog.
Nachdem sie erfolglos auf eine Erklärung gewartet hatten, ich hielt mich an Jakobs Rat und schwieg, schlug Zinnober vor: „Dann machen wir mal weiter.“
Sie schauten mich ab und zu verstohlen an und betrachteten meine gefrorenen Haare.
„Habt ihr was geraucht?“, flüsterte Zinnober.
„Nein.“
„Jakob sieht aber so aus, als ob er jeden Tag was durchziehen würde und du – du wirkst so seltsam abwesend.“
„Jakob raucht nicht“, widersprach ich wahrheitsgemäß.
Soweit ich mich erinnere, setzten Zinnober und Enak die Messungen fort, trugen Ergebnisse in ein Protokoll ein, während ich mich in dem uralten Laborsaal umschaute, der eine brauchbare Kulisse für einen Frankensteinfilm abgegeben hätte. So ehrwürdig wirkte der hohe Raum, aber auch seine Einrichtung, die altmodischen Instrumente und blinkenden und summenden Geräte, war aus der Zeit gefallen. Es war ein ebenerdiger Saal, der wenige Meter vom Seerhein entfernt lag und dessen leider undurchsichtigen Glasscheiben in Richtung des Wassers wiesen. Mit einem Mal hatte ich das beunruhigende Gefühl, dies alles schon zu oft gesehen zu haben, um es noch wirklich wahrzunehmen. Zudem ereignete sich gerade an diesem Abend einer der sehr seltenen, fulminanten Sonnenuntergänge. Es war eine farbenprächtige Dämmerung, von der Filmemacher träumen. Als sich die hohen Glasscheiben rot und immer röter färbten, bedrängte mich ein einengendes, klaustrophobisches Gefühl, es auf dem Hocker nicht mehr auszuhalten, nach draußen zu müssen, um ein Teil dieses phantastischen Sonnenuntergangs zu sein. Mir wurde klar: Dies war eine wunderbare Gelegenheit, gegenwartsechte Momente für die Ewigkeit zu sammeln. Ich saß wie auf glühenden Kohlen.
„Wie lange dauert das hier denn noch?“, fragte ich ungeduldig.
Zinnober schaute mich ärgerlich, Enak eher verwundert an.
„Na, wir sind mittendrin. Insgesamt drei Stunden.“
Also war ich im Labor eingesperrt und fühlte mich zwangsläufig wie ein Gefangener. Verzweifelt sah ich mich um. Wir waren offensichtlich alle Häftlinge und sollten einen gemeinsamen Ausbruch versuchen. Ich traute mich jedoch nicht, dies jemandem mitzuteilen. Zu oft gab es Verräter in den eigenen Reihen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, vor Ungeduld und Unruhe zu zittern und unbedingt endlich den Raum verlassen zu müssen. Während alle beflissen an Knöpfen von Messgeräten drehten, Kabel umsteckten, Protokolle ausfüllten, färbten sich die Glasplatten, die uns von der Außenwelt abschotteten, orange, dann hellrot; es steigerte sich sogar noch und wurde zu einem immer intensiveren karminrot. Die Welt dort draußen glühte und brannte. Es fand in diesen Augenblicken ein gigantisch herrlicher Ausnahmesonnenuntergang statt. Natürlich sehnte ich mich danach, diesem Schauspiel beizuwohnen, statt innerhalb dicker Mauern zwischen summenden Apparaten und gleichgültigen Studenten zu sein, um auf etwas zu warten, das sich nie ereignen würde, wenn ich jetzt sitzen blieb. Alle taten weiterhin so, als seien sie ausschließlich auf ihre Arbeit konzentriert. Keiner starrte die tiefrot glühende Glaswand an. Sie schienen unberührt von all dem, was sich um uns herum abspielte.
„Ist dir nicht gut?“, fragte Enak. „Fehlt dir was?“
„Was starrst du denn immer da rüber? Da ist doch nichts“, meckerte Zinnober.
„Doch“, sagte ich, stand auf und ging auf die schwere Eisentür zu.
Bevor ich das Labor verließ, sagte Enak zu dem Laborassistenten: „Es geht ihm nicht gut.“
„Ja, ja, seine Haare …“
Was der verunsicherte Assistent zu meinen Haaren zu sagen hatte, hörte ich nicht mehr, weil die schwere Tür hinter mir ins Schloss fiel, schon rannte ich am Ufer des Seerheins entlang, eilte in Richtung meines bevorzugten Sonnenuntergangsplatzes, um die herrlichen Momente eines tiefroten Ewigkeitshimmels einzufangen. Als ich ankam, war es bereits zu spät, die Farben begannen zu verblassen, der Horizont färbte sich rasch ins Gräuliche um und verlor an Strahlkraft. Die Dämmerung setzte ein, die blaue Stunde umfing mich tröstend und ich nahm mir vor, nie wieder solche Momente zu verpassen. Das war ich dem Leben der ewigen Wiederkehr schuldig. Aber wo waren eigentlich die Elfen und die Feen, die schöne Magierin und der traurige König? Ergebnislos fragte ich mich, was in Gang gesetzt worden war.
Die letzte Prüfung des Semesters war geschrieben. Die Studierenden standen unter der Neuen Rheinbrücke, jemand hatte Bier organisiert und Brothers in Arms dudelte aus dem geöffneten Kofferraum eines kanariengelben Ford Capri, während ich das Geschehen um mich herum registrierte, wie ein ungläubig staunender Zeitreisender, der in der falschen Epoche gelandet war.
„Wie konntest du nur nach einer halben Stunde abgeben?“, fragte Zinnober entgeistert. Seine Frage war nichts als ein sinnloser Versuch, mich in ihre Art zu denken zurückzuholen.
Warum ist diese Welt so? Sie müsste doch ganz anders sein, überlegte ich ergebnislos. Natürlich: Zinnober, Enak, Jakob und ich bildeten einen Kreis. Und da drüben strömte das Wasser des Seerheins in Richtung Untersee.
„Ich hatte genügend Punkte.“
„Vier gewinnt! Bist du verrückt? Das zieht doch deinen Schnitt total runter“, regte sich Zinnober auf.
„Und wenn es eine 4.1 wird?“, fragte Enak vorsichtig.
„Kann ich mir bei Daniel nicht vorstellen“, kommentierte Jakob. „Du hättest auch mich unterstützen und mir einen Zettel mit den Lösungen rüberschieben können. Ich befürchte, ich bin durchgefallen.“
„Schreibst die Prüfung ja auch zum ersten Mal“, feixte Zinnober hämisch.
„Wer will noch eins?“, rief ein Kommilitone, der mit einem Bierkasten die Runde machte. „Übrigens, hier ist die Kasse für den Unkostenbeitrag!“ Er setzte den Kasten auf dem Oberschenkel ab, hielt eine Elektro-Abzweigdose hoch, die als Spendengefäß diente, und lachte lauthals.
Enak nahm ungefragt vier Flaschen heraus, verteilte diese und ließ ein Fünf-Mark-Stück in die Abzweigdose plumpsen.
„Was hast du gemacht, nachdem du so früh abgegeben hast?“, fragte Zinnober.
„Ich habe am Seerhein über den verpassten Sonnenuntergang nachgedacht.“
„Du hast früher abgegeben, um über so etwas nachzudenken?! Und was kam dabei heraus?“
„Man kann ungenutzte Gelegenheiten nicht nachholen.“
Während Zinnober mich sprachlos ansah, überging Enak, was ich sagte und meinte: „Wir haben jedenfalls wieder alles richtig gemacht. Wir haben mit ziemlicher Sicherheit bestanden. Und darauf kommt es doch letztlich an.“
Jakobs Mutmaßung, dass er durchgefallen sei, ignorierte Enak beflissentlich. Zinnober hob rasch seine Bierflasche, und wir prosteten uns zu. So wurden jegliche Zweifel und mögliche Unstimmigkeiten ausgeräumt: durch gemeinsames Trinken. Irgendwie erschien mir das zu einfach. Mit einem Mal hatte ich erhebliche Zweifel, an vielem, auch an Enaks Aussage. Vielleicht war es gar nicht gut, Prüfungen zu bestehen. Vorankommen musste nicht immer positiv sein. Vor allem, wenn man den falschen Weg eingeschlagen hatte.
„Wann beginnt euer Praxissemester?“, wechselte Zinnober das Thema. Er redete eigentlich immer nur über das Studium.
„Am ersten“, antwortete Enak.
„Bei mir noch gar nicht“, gab Jakob freimütig zu. Er war einfach anders, was ich sehr an ihm schätzte.
„Noch gar nicht?!“, meinte Zinnober skeptisch. „Hatte ich von dir eigentlich auch nicht anders erwartet. Was machst du stattdessen? Am Motorrad herumschrauben und Tee trinken?“
„Gute Idee“, grinste Jakob.
„Und du?“, frage Zinnober und wendete sich mir zu.
„Bei mir? Auch am ersten“, sagte ich ungläubig, weil ich gar nicht mehr daran gedacht hatte.
„Was hast du für ein Thema?“, hakte Zinnober nach.
Als er das fragte, war innerhalb eines Momentes klar, dass ich das Praxissemester nicht antreten konnte. Jenes Gefühl, welches ich im Labor empfunden hatte, eingesperrt zu sein, überflutete mich geradezu.
„Ich schaue sechs Monate lang acht Stunden am Tag auf einen Bildschirm“, stöhnte ich.
„Natürlich arbeitest du am PC. Aber was für ein Thema hast du?“
Statt zu antworten, drehte ich mich um und entfernte mich von der Gruppe. Etwas in mir mahnte, nicht zu tun, was ich vorhatte. Gerade deshalb beschleunigte ich meine Schritte.
Eine halbe Stunde später stieß ich wieder zu den dreien, die nahezu unverändert dastanden.
„Wo warst du?“, fragte Enak.
„In einer Telefonzelle.“
„Hast du Mami angerufen?“, lachte Zinnober.
„Nein.“
„Wen um alles in der Welt musstest du denn so dringend anrufen?“, fragte Zinnober wissbegierig.
„Eine Frau?“, erkundigte sich Jakob.
„Ich habe in der Firma angerufen und das Praxissemester abgesagt.“
Die drei schauten mich fassungslos an.
„Wieso denn das? Hast du eine bessere Stelle gefunden?“
„Nein.“
„Aber das kann nicht sein, du bist doch bei ... Da wollen doch alle hin.“
„Sag jetzt nicht, du hast keine andere Stelle und sagst ab?“
Sie starrten mich an. Wäre in diesem Moment E. T. aufgetaucht, hätten sie nicht fassungsloser dreinschauen können. Im Gegenteil: E. T. war ihnen vertraut, aber das Verhalten, welches ich neuerdings an den Tag legte, erschien ihnen unverständlich, geradezu unheimlich.
„Aber warum nur?“, fragte Zinnober entgeistert.
„Nein?!“, rief Jakob, der etwas ahnte und mich fassungslos ansah.
„Doch“, nickte ich, grinste dämlich und selbstgefällig, weil ich endlich wieder mit mir zufrieden war.