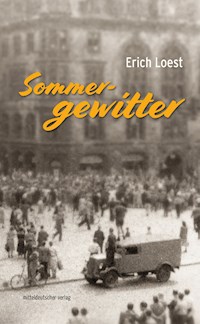3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In London wird ein Bankraub begangen, brutal und ohne Rücksicht auf Menschenleben. Kurz darauf geschieht ein Überfall auf ein großes Kaufhaus; die Tatmerkmale lassen die gleichen Verbrecher vermuten. Als Scotland Yard endlich einen Mittäter verhaftet, wird dieser auf rätselhafte Weise aus dem Zuchthaus befreit. Jetzt beginnt Inspektor Varney nervös zu werden: Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür, und es ist abzusehen, daß sich bei dem zu erwartenden Massentourismus die Verbrechen der Bande wiederholen. Wird Varney, dem Scotland Yard ungeschminkt mitteilt, daß von der Aufklärung dieser Verbrechen seine Stellung abhängt, die Überfälle verhindern können? (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Ähnliche
Erich Loest
Der Mörder saß im Wembley-Stadion
Kriminalroman
FISCHER E-Books
Inhalt
1 Der Raub in der Celtic-Bank
Der Hintereingang der Celtic-Bank lag in einer Gasse; George Varney besann sich nicht, jemals hier gewesen zu sein. Die Menschen drängten sich wie immer in solch einem Fall, und es gab Ärger mit Leuten, die behaupteten, sie wohnten hier und müßten sofort nach Hause, weil sonst die Milch überkoche. Varney zeigte seine Marke und durfte passieren.
Ein älterer Mann stand neben den beiden ineinander verkeilten Fahrzeugen, sein Gesicht war hager und blaß, und seine Hände zitterten. »Der Fahrer«, sagte einer der Polizisten. Varney fragte: »Haben Sie schon alles erzählt?«
»Zweimal.«
»Ich muß Sie bitten, mir alles noch einmal vorzukauen.«
Der Fahrer seufzte. »Ich saß also am Steuer und wartete auf Abboth, den Kassenboten. Er kam aus der Tür und bog hinten um das Auto herum, wie immer. Aber er stieg nicht ein, und als mir das auffiel, bekam mein Wagen einen Stoß, daß ich in die Ecke flog, und dann knallte es. Wahrscheinlich hat sich Abboth gewehrt. Da bin ich natürlich ’raus.«
»Hatten Sie keine Angst?«
»Dazu war keine Zeit. Ich sah Abboth am Boden liegen, und die beiden Kerle rannten durch die Gasse. Ich brüllte und lief ihnen nach, aber sie hatten mindestens dreißig Meter Vorsprung. Dann sind sie um die Ecke, dort stand ein grauer Austin mit laufendem Motor. Weg.«
»Wie sahen die beiden aus?«
»Einer war groß und kräftig. Mir schien, als könnte er nicht so schnell rennen wie der andere.« Der Fahrer dachte nach. Dann lächelte er unfroh. »Bißchen wenig, was? Vielleicht fällt mir noch etwas ein.« Er rieb sich das Gesicht, und Varney fürchtete für einen Augenblick, der Mann könnte zusammenbrechen. »Kommen Sie mit«, sagte er und faßte ihn am Arm. Er zog ihn zum Eingang der Bank, wobei er begütigend auf ihn einsprach, er hätte sich tapfer gehalten und mehr getan, als man von ihm verlangen könnte. »Wenn ich bloß wüßte«, sagte der Fahrer, »was mit Abboth ist.«
»Ihr Freund?«
»Ein guter Kollege. Und er hat zwei Kinder.«
»Wahrscheinlich Lungendurchschuß«, sagte einer der Polizisten.
»Diese verdammten Hunde!« Der Fahrer wiederholte es, und als er es zum viertenmal hervorgestoßen hatte, sank sein Kinn auf die Brust, und er sackte mit einem kurzen Röcheln zusammen. Das ging so schnell, daß Varney nicht zugreifen konnte, obwohl er mit etwas Derartigem gerechnet hatte. Ein baumlanger Polizist zog den Fahrer hoch und trug ihn in den Flur.
Varneys Leute erledigten die Routinearbeit. Varney ging ein Stück zurück und versuchte, sich den Überfall vorzustellen. Ein Auto war also in die Gasse hineingeprescht, hatte den Wagen der Bank gerammt und die Gasse blockiert. Ein Mann, der vermutlich nicht in diesem Wagen gesessen hatte, hatte den Kassenboten niedergeschossen und ihm, zusammen mit dem Fahrer des Rammautos, die Tasche weggerissen. Dann waren die beiden die kurze Strecke bis zur Querstraße gerannt und in einem bereitstehenden Wagen getürmt. Das war alles andere als ein Gentleman-Verbrechen wie das der nun schon legendären Posträuber. Hier war eine brutale, schmutzige Tat verübt worden, die für die Verbrecher mit erheblichem Risiko verbunden war. Sie konnten niemals einkalkulieren, wer ihnen auf ihrer Flucht in den Weg treten würde. Wahrscheinlich hatten die Burschen beabsichtigt, sich notfalls diesen Weg freizuschießen.
Eine Viertelstunde später saß Varney dem Direktor der Celtic-Bank gegenüber. »Ich bin tief erschüttert«, rief der Direktor. »Abboth, ein biederer, rechtschaffener Beamter! Seit sechzehn Jahren in unserer Firma. Ein ruhiger Mensch, zuverlässig bis zur Selbstaufgabe. Ich bin sicher, er hat sich gewehrt, bis zum Äußersten.«
Der letzte Satz erschien Varney ein wenig theatralisch. »Und das Geld?«
Der Direktor winkte ab. »Sechstausend Pfund. Wir sind bis zu einer weit höheren Summe versichert.«
»Für wen war das Geld bestimmt?«
»Für eine Spinnerei und eine Großgarage in Chricklewood. Lohngelder. Haben Sie schon etwas aus der Klinik gehört? Wird Abboth durchkommen?«
»Es besteht keine direkte Gefahr. Ein Lungendurchschuß ist heute kein Problem, wenn der Betroffene eine gewisse Widerstandskraft aufbringt. Wir werden Sie sofort unterrichten.« Danach befragte Varney den Direktor, ob es üblich wäre, den Wagen für den Kassenboten am hinteren Eingang parken zu lassen, und erfuhr, man hätte bisweilen nicht anders handeln können, weil an der Vorderfront während der Hauptgeschäftszeit alles mit parkenden Autos verstopft wäre. Natürlich, jetzt sah das alles leichtsinnig aus. Aber wer hatte mit einer solchen Frechheit rechnen können?
Varney gab noch einige Anweisungen, dann ließ er den Wagen, mit dem die Räuber das Bankauto gerammt hatten, abschleppen. Die Gasse wurde freigegeben, und Varney sah gedankenverloren zu, wie Neugierige hineinströmten, als gäbe es jetzt noch irgend etwas Sensationelles zu sehen. Dabei festigte sich in ihm die Vermutung, die ihm schon beim ersten Augenschein gekommen war: Hier hatten Amateure einen wilden Streich verübt. Man würde sich bei der Ermittlung darauf einstellen müssen.
Im Polizeikrankenhaus erfuhr Varney, daß Abboth gerade operiert worden war. Noch war er nicht bei Bewußtsein und würde wohl vor dem Nachmittag nicht vernehmungsfähig sein. Eines war sicher: Abboth befand sich außerhalb jeder Gefahr. Varney warf einen Blick auf das schweißnasse Gesicht des Verletzten, auf den Mund, der halb offen stand, und auf die Augen, die in tiefen Höhlen lagen und deren Lider von schwärzlichen Adern überzogen waren. Der Arzt zeigte ihm die Kugel, die in Abboths Schulterblatt steckengeblieben war. Dann wurde sie in ein Kästchen gelegt; Fachleute würden sich mit ihr zu beschäftigen haben.
Varney überlegte während der Rückfahrt zum Scotland Yard, ob er jetzt etwas tun könnte, das über das gewöhnliche Maß hinausging. Der Überfall hatte einen Routineapparat in Gang gesetzt, der auch dann funktionierte, wenn er selbst die Hände in den Schoß legte. Irgendwann einmal, vielleicht heute noch, würde dabei etwas gefunden werden, was eine Kombination ermöglichte; aber bis dahin mußte man warten und kleine, unscheinbare, ermüdende Pflichten erfüllen.
Im Yard teilten ihm seine Leute das Ergebnis mit. Der Wagen, mit dem einer der Räuber das Bankauto gerammt hatte, war zwei Stunden vorher von einem Parkplatz gestohlen worden. Der Besitzer, ein Lehrer, hatte inzwischen die Identität festgestellt. Wie flüchtige Ermittlungen ergeben hatten, stand der Lehrer außerhalb jeden Verdachts einer Mittäterschaft. »Fingerabdrücke?«
»Die Burschen haben Handschuhe getragen.«
Am Nachmittag erhielt Varney die Nachricht, daß die Kugel, die Abboth getroffen hatte, aus einer belgischen FN abgeschossen worden war. Wenig später saß Varney wieder neben Abboths Bett. Abboth hatte die Augen halb geöffnet. Offenbar machte es ihm Mühe zu sprechen; der Arzt hatte Varney nur zehn Minuten zugebilligt. »Alles halb so schlimm«, sagte Varney, »in zwei Wochen sitzen Sie wieder in der Sonne, und in vier Wochen ist alles vergessen. Wie sahen die beiden Kerle aus?«
Abboth antwortete mühselig. »Einer war sehr groß. Bißchen krauses Haar.«
»War das der, der geschossen hat?«
»Der andere. Der aus dem Wagen. Ich dachte erst, er will mich über den Haufen fahren.«
»Und dann?«
»Ich bin zurückgesprungen.« Abboth schloß die Augen, leckte mühselig über die Lippen und machte ein paar flache Atemzüge.
»Wie alt war der Große?«
»Vielleicht dreißig?«
»Kein ganz junger Bursche?«
»Auf keinen Fall.«
Das war nicht das, was Varney vermutet hatte. Er warf sich vor, viel zu zeitig mit zu wenig Anhaltspunkten den Bau eines Gedankengebäudes versucht zu haben; das passierte ihm immer wieder trotz zwanzigjähriger Praxis, einer Reihe von Pannen und dem ständig wiederholten Vorsatz, seiner Phantasie Zügel anzulegen. »Der Pistolenheld war also kleiner, wenn ich Sie recht verstanden habe? Wie sah er aus?«
»Ich habe ihn nur einen Augenblick gesehen«, sagte Abboth. »Ich wollte wegrennen, aber der Wagen versperrte mir den Weg. Da drehte ich mich um, und gleich schoß er. Ich glaube, er trug einen dunklen Anzug. Und ein helles Hemd, ja, aber keinen Schlips. Keinen Hut, nein, keinen Mantel.«
»Wie alt?«
Abboth antwortete nicht; Varney war nicht sicher, ob er verstanden worden war.
»Kommen Sie bitte zum Schluß«, sagte der Arzt.
Draußen auf dem Gang schärfte Varney dem Arzt ein, niemand zu Abboth zu lassen außer dessen Frau, auf keinen Fall einen Journalisten. Er selbst werde am nächsten Morgen wiederkommen.
An diesem Abend versammelte Varney seine Mitarbeiter um sich. »Wir haben nicht viel«, sagte er, »aber immerhin einiges. Heute morgen vermutete ich, wir hätten es mit Amateuren zu tun, die ihren ersten wüsten Streich riskierten. Inzwischen bin ich davon abgekommen. Ich sehe die Sache jetzt so: Diese beiden Burschen haben schon einiges auf dem Kerbholz. Sie sind rabiat und nicht besonders intelligent. Schlägereien, vielleicht ein paar Einbrüche, einige kleine Vorstrafen – irgendwie sind sie höchstwahrscheinlich schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Aber bei einem bin ich sicher: Einen solchen Überfall haben sie zum erstenmal gemacht. Er war zuwenig durchdacht und ungewöhnlich brutal. Wenn die Kugel den armen Abboth zehn Zentimeter weiter links getroffen hätte, wäre er tot. Wir suchen also nach einem Burschen von etwa dreißig Jahren, groß und kräftig, der nicht schnell rennen kann. Er fährt Auto. Und hat krauses Haar.«
»Eines noch«, sagte einer seiner Leute. »Die beiden haben ein Auto gestohlen. Sie haben dabei das Schloß nicht beschädigt.«
»Wahrscheinlich haben die Brüder nicht nur den Wagen des Lehrers aufgebrochen«, sagte Varney, »sondern auch den Austin, in dem sie geflüchtet sind. Einer ist ein versierter Automarder; vielleicht der, der den Fluchtwagen gesteuert hat. Der dritte Mann. Von ihm und dem Pistolenschützen wissen wir überhaupt nichts. Dunkler Anzug, weißes Hemd – was besagt das? Und ob es stimmt?«
Varney verteilte die Aufgaben für den nächsten Morgen, dann fuhr er nach Hause. Seine Frau machte ihm schnell etwas zu essen zurecht, und während er aß, erzählte sie ihm, was es tagsüber mit den Kindern gegeben hatte. Er konnte ausruhen dabei und fast vergessen, was ihn einen Tag lang unablässig beschäftigt hatte. Die Kinder hatten leidliche Zensuren nach Hause gebracht, am Nachmittag hatten sie Federball gespielt und die Kindersendung des Fernsehens angeschaut, jetzt lagen sie im Bett. Frau Varney kannte ihren Mann gut genug, um zu merken, daß er angestrengt gearbeitet hatte, wahrscheinlich an einem neuen Fall. Er würde, wenn er das Schlimmste hinter sich hatte, von allein erzählen, und bis dahin gönnte sie es ihm, wenigstens in den knappen Stunden zu Hause an etwas anderes denken zu können.
»Ich muß noch mal weg«, sagte er nach dem letzten Bissen.
»Vielleicht bin ich noch wach, wenn du kommst.«
Varney war nicht sicher, ob das, was er jetzt tat, richtig war. Er überlegte während der Fahrt die Vor- und Nachteile, und noch als er vor dem Haus parkte, in dem Privatdetektiv Pat Oakins wohnte, plagten ihn Zweifel. Er ging hinauf und klingelte, und er wäre nicht enttäuscht gewesen, hätte er Oakins nicht angetroffen. Aber Oakins öffnete und sagte: »Kommen Sie rasch ’rein.« Varney kannte Oakins gut genug, um zu wissen, daß dieser jetzt stolz war, nicht die mindeste Überraschung gezeigt zu haben; sie hatten immerhin einen erheblichen Krach hinter sich. »Whisky«, sagte Oakins, »finden Sie im Schrank wie immer. Sie wissen, ich kann mir das Trinken nicht leisten, wenn ich im Training bin.« Damit setzte sich Oakins wieder in den Schaukelstuhl vor dem Fernsehapparat und verfiel in Schweigen.
Varney nahm hinter ihm Platz. Die Lehne des Schaukelstuhls verdeckte Oakins fast ganz, obwohl dieser, so war Varney sicher, wie stets kerzengerade saß. Varney hatte an diesem Abend nicht die geringste Veranlassung, Oakins zu ärgern, sonst hätte sich die Bemerkung, ein hochlehniger Schaukelstuhl wäre nicht sonderlich passend für einen Mann von 1,51 m lichter Höhe, geradezu angeboten. So sagte Varney nur: »Wichtiges Spiel?«
»Portugal gegen die Tschechoslowakei. Weltmeisterschaftsqualifikation in Gruppe 4. Ich nehme an, Sie sind im Bilde.«
»Ein wenig«, sagte Varney. »Aber seit wann interessiert sich ein Rugby-Spieler wie Sie für Fußball?«
»Neuerdings von Berufs wegen«, sagte Oakins. »Sehen Sie, das ist Eusebio, zwei Mann läßt er stehen. Ich hoffe, der Name sagt Ihnen was.«
»Schon. Aber wie wär’s, wenn wir von Geschäften sprächen?«
»Ich habe Ihnen die Tür geöffnet«, sagte Oakins mit aller Würde, zu der er fähig war, »ich habe Ihnen meinen Whisky angeboten, von dem Sie wissen, daß er nicht schlecht ist. Ich bin bereit, mit Ihnen zu wetten, wer dieses Spiel gewinnt. Aber von Geschäften wollen wir doch schweigen, nicht wahr?«
»Oakins«, sagte Varney, »ich bin in Ihrer Schuld. Aber ich habe Vorgesetzte, und Sie wissen genau, wie schwierig es für mich ist, einen Auftrag für einen Privatdetektiv wie Sie herauszuschinden. Das geht in vereinzelten Fällen, gewöhnlich dann, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Aber mein großer Chef Sheperdson meinte damals, es reichte uns kaum an die Waden. Ich hatte Ihnen Hoffnungen gemacht, mehr doch nicht! Das müssen Sie zugeben, Oakins.«
»Ich gebe es zu«, sagte Oakins gelassen. »Trotzdem: Ich hatte mich eingerichtet und einige andere Gelegenheiten verpaßt. Das da im Tor ist Perreira. Beachten Sie bitte, wie hervorragend portugiesisch ich diesen und die übrigen Namen ausspreche. Selbst wenn ich wollte, könnte ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid, Sir.«
Das war schon beinahe unverschämt, aber Varney schluckte es. Dieser Dreikäsehoch da schlug sich recht und schlecht mit kleinen und kleinsten Aufträgen durch, hatte immer wieder dem Yard mehr oder weniger nutzlose Tips angeboten und war zwei- oder dreimal unter der Hand mit bescheidenen Aufträgen bedacht worden, die er freilich nicht schlecht ausgeführt hatte. »Lassen Sie mich mit Ihrem Fußball in Ruhe«, sagte Varney. »Wollen Sie nun, oder wollen Sie nicht?«
»Ich habe zur Zeit feste Aufträge.«
Varney zweifelte keine Sekunde daran, daß das gelogen war. Aber es gab zwei Dinge, die Oakins auszeichneten: seine durch die geringe Körpergröße hervorgerufene Geltungssucht und die ungewöhnliche Halsstarrigkeit, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte. »Lassen Sie sich nicht stören«, sagte Varney, »und reichen Torsegen allerseits.«
Oakins begleitete ihn hinaus und bedankte sich für die Viertelstunde, die wirklich reizend gewesen wäre. Varney entschloß sich, noch einen zweiten Besuch zu machen, von dem er hoffte, daß er erfolgreicher verlaufen werde. Er stellte seinen Wagen auf einem Parkplatz ab und ging durch ein paar Seitenstraßen. Still war es hier, die Ladenbesitzer hatten ihre Reklame schon ausgeschaltet, die meisten Schaufenster lagen dunkel. Varney wartete in einem Hauseingang, bis er sicher war, daß niemand ihn beobachtete; dann betrat er rasch einen Hof und suchte zwischen Mülltonnen und Lieferwagen hindurch den Weg zum Hintereingang einer Gaststätte.
Wenige Minuten später saß Varney in einem Zimmer neben der Küche seinem alten Vertrauten Mario Sientrino gegenüber. Dieser, ein Neapolitaner, war als junger Kellner nach London gekommen, hatte sich mühevoll und listig hochgearbeitet und die Sprache des Landes nahezu perfekt erlernt. Jetzt war er Besitzer einer Nachtbar, in der allerlei kabarettistische Vorführungen von bescheidenem Niveau gezeigt wurden und die ein Stammpublikum von zweifelhaftem Ruf besaß. »Ich bin in einer schwierigen Lage«, sagte Varney. »Sie sollten die Ohren aufmachen. Hat man bei Ihnen schon über den Raub an der Celtic-Bank gesprochen?«
»Ein wenig«, antwortete Sientrino. »Freche Sache, sagen die meisten.«
»Und eine Andeutung, wer mit drinsteckt?«
»Ich habe nicht die beste Kundschaft«, sagte Sientrino, »aber schon gar nicht die dümmste. So schnell quatscht da keiner. Man müßte mal horchen, ob einer viel Geld ausgibt. Drei Mann? Vielleicht bekommen sie Krach untereinander.«
»Wenn was ist«, sagte Varney, »rufen Sie die übliche Telefonnummer an. Ich möchte nicht noch einmal hierher kommen, wenn es nicht unbedingt sein muß.«
»Gut. Was zu trinken?«
»Heute nicht, ich muß ins Bett.«
Während Varney nach Hause zurückfuhr, spürte er nicht die geringste Müdigkeit. Er konnte lange nicht einschlafen, weil die Erlebnisse des vergangenen Tages immer wieder in kurzen Bildern durch sein Gehirn zuckten, und als seine Frau ihn weckte, fühlte er sich zerschlagen wie nach einer durchzechten Nacht. Er aß ohne Appetit und überflog dabei die »Times«. Der Raubüberfall auf den Boten der Celtic-Bank war in einem zweispaltigen Artikel beschrieben, der sich exakt an die Wahrheit hielt.
»Wann kommst du zurück?«
»Ich weiß nicht«, sagte Varney, »auf alle Fälle rufe ich gegen Abend einmal an.«
Zunächst parkte Varney in der Nähe der Celtic-Bank. Es war ungefähr die Zeit, in der am Vortag Abboth niedergeschossen worden war. Jetzt, da Varney sah, wie wenig Verkehr in dieser Gasse herrschte, erschien ihm das Verbrechen nicht mehr so dreist wie bisher. Zwei Frauen standen im Gespräch, ein paar Schulkinder rannten vorbei, dann lag die Gasse leer. Der Hintereingang der Bank war mit einem hohen Gitter verschlossen. Zwei Männer blieben davor stehen, zeigten hierhin und dorthin; offenbar rekonstruierten sie, wie sich der Überfall abgespielt hatte. Dann gingen sie weiter und an Varney vorbei. Wieder war niemand in der Gasse.
Am Nachmittag nach dem Verbrechen hatten zwei von Varneys Mitarbeitern die Geschäfte in der angrenzenden Straße abgegrast, ohne einen nennenswerten Erfolg zu erzielen. Niemand hatte auf den parkenden Austin geachtet, niemand den Schuß gehört, niemand die flüchtenden Verbrecher gesehen. Varneys Hoffnung, noch etwas zu erfahren, war gering, als er einen Tabakladen betrat. Hier wurden auch Toto- und Rennwetten entgegengenommen, Zeitungen lagen aus, Männer standen im Gespräch. Varney kaufte Zigaretten, nahm eine Fußballzeitung und setzte sich. Ungarn gegen Österreich – Varney sah nur die Überschriften. Der Besitzer hatte, als er ihn bediente, ein Gespräch unterbrochen; nun nahm er es wieder auf. »Briggs«, sagte er, »nun schön, wir alle kennen ihn. Und warum ist er damit nicht zur Polizei gegangen?«
»Weil er nicht weiß, ob es was geworden ist.«
»Das werden sie ihm dort schon sagen.«
»Aber Briggs ist nicht einer, der etwas an die große Glocke hängt.«
Drei Männer und der Händler unterhielten sich, sie alle kannten Briggs und waren sich einig, daß Briggs bescheiden war, zurückhaltend, in gewisser Weise sogar schüchtern. Sie schätzten ihn, daran war kein Zweifel, aber sie mißbilligten auch, was er getan hatte. »Mit so einer Sache«, betonte der Händler, »muß man sofort zur Polizei gehen. Und dort entwickeln sie dir einen Film in Windeseile.«
»Briggs entwickelt selbst, das ist sein ganzer Stolz. Wenn er überhaupt zur Polizei geht, dann nur mit einem fertigen Foto. Und wahrscheinlich nur dann, wenn es erstklassig ist.«
In den ersten Jahren seiner Laufbahn als Kriminalist hatte sich Varney bisweilen gegrämt, daß er so gar nicht wie einer der harten Burschen aussah, die in den Filmen die Gangster jagten. Inzwischen hatte er die Vierzig überschritten, und jeder, der ihn nicht kannte, hielt ihn für einen durchschnittlichen Beamten oder Geschäftsmann. Auch diese Männer, die sich über einen gewissen Briggs unterhielten, kamen nicht auf die Idee, daß ihnen ein Kriminalist von Scotland Yard zuhörte, und Varney war froh darüber. »Heute abend wird er es wohl schaffen«, sagte der Händler. »Und mir wird er einen Abzug machen. Den hänge ich hierher.«
»Raffiniert warst du schon immer. Hast du Reklame nötig? Dein Laden läuft doch wie geschmiert.« Die übrigen Männer lachten, dann glitt das Gespräch ab. Varney wartete noch einige Minuten, bis die Kunden gegangen waren, dann zeigte er dem Händler seine Marke und fragte, ob er ihn ungestört sprechen könnte. »Sofort«, sagte der Händler, ohne überrascht zu sein, und rief seine Frau. »Kommen Sie nach hinten.«
Das Gespräch war kurz und bestätigte, was Varney vermutet hatte. Ein Mann namens Briggs, der drei Häuser weiter wohnte, hatte die flüchtenden Verbrecher fotografiert. »Ich denk mir«, mutmaßte der Händler, »er will eine Belohnung ’rausschinden. Jetzt ist er zur Arbeit, am Abend wird er wahrscheinlich bei Ihnen sein.«
Varney verspürte eine unbändige Lust, jemanden anzuschreien, aber der Tabakhändler war dazu nicht das richtige Objekt. Varney ließ sich Wohnung und Arbeitsstelle von Briggs nennen, dann rief er von der nächsten Telefonzelle aus Scotland Yard an. »Ich versuche, den Mann so schnell wie möglich aufzutreiben. Gibt’s bei euch was Neues?«
»Der Fluchtwagen ist gefunden«, hörte Varney, »am Rande eines Parks von Beckenham. Die Geldtasche lag noch drin, mit einem Messer aufgeschnitten.«
»Wunderbar«, sagte Varney, »wir sind auf dem Vormarsch. Noch zwei, drei solcher Sachen, und wir können zupacken. Sobald ich Briggs habe, rufe ich wieder an.«
Briggs arbeitete als Lagerist in einer Maschinenfabrik in Brixton. Er war ein kleiner, drahtiger Mann mit klugen Augen und fast weißem Haar, obwohl er kaum die Fünfzig überschritten haben konnte.
Varney fragte: »Sie wissen, warum ich komme?«
»Keine Ahnung.«
»Ich war eben in einem Tabakladen in der Nähe der Celtic-Bank.« Varney wartete, aber Briggs biß nicht an. »Dort erzählten die Leute, Sie hätten gestern ein sensationelles Foto gemacht. Darf man mal sehen?«
»Es wird viel geredet«, sagte Briggs und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich bin noch nicht zum Entwickeln gekommen.«
Varney preßte die Handflächen fest zusammen; das war für ihn das wirksamste Mittel, sich zur Ruhe zu zwingen. »Verehrter Herr«, sagte er dann, »haben Sie sich nicht eine Sekunde lang vorstellen können, was es für uns bedeutet, dieses Bild zu sehen? Daß dann vielleicht diese Gangster schon im Loch säßen?«
»Na«, sagte Briggs, »so schnell geht es wohl doch nicht.«
»Sie sind ein Fuchs«, sagte Varney. »Spielen wir mit offenen Karten. Ich bin sicher, daß Sie das Bild schon entwickelt haben, und wenn Sie sich die ganze Nacht um die Ohren schlagen mußten. Denn Sie sind neugierig. Wollen Sie es der Celtic-Bank anbieten? Oder wollen Sie eine Belohnung von uns?«
Briggs zögerte einen Augenblick, dann sagte er: »Wirklich, das Bild ist nicht fertig.«
»Dann geben Sie uns den Film, und wir entwickeln ihn.«
»Ich habe ihn nicht hier.«
»Dann fahren wir sofort zu Ihnen und holen ihn.«
»Ich weiß nicht, was mein Chef dazu sagt.«
»Ich habe bereits mit ihm gesprochen. Er ist einverstanden.«
Briggs war am Ende seines Lateins. Plötzlich spielte Varney seinen stärksten Trumpf aus: »Oder wollen Sie auf eigene Faust ermitteln und aus den verdammten Pistolenhelden einen Anteil herausholen?«
Briggs öffnete den Mund, schwieg aber. Seine Augen huschten hin und her, als könnten sie irgendwo eine Hilfe finden. Dann sagte er: »So etwas sollten Sie mir nicht zutrauen. Es ist etwas ganz anderes geschehen: Ich habe mich gestern im Tabakladen groß getan, ich hätte die Burschen auf dem Zelluloid. Natürlich habe ich abends das Bild entwickelt. Aber es ist nichts geworden. Damit ich meine Ruhe vor Ihnen habe. Hier ist es.« Er zog die Brieftasche heraus und hielt Varney ein Foto hin. »Der Rücken«, sagte er, »und auch der ist noch unscharf. Ich hatte keine Zeit, die Blende richtig einzustellen. Ich habe einfach drauflos geknipst. Dann habe ich in dem Zigarettenladen den Mund ziemlich weit aufgemacht. Nicht gerade schön in meinem Alter. Anschließend bin ich nach Hause und habe den Film entwickelt.«
»Sie haben nur das eine Bild?«
»Nur das eine.«
Varney bat darum, es behalten zu dürfen, obwohl er sich im klaren war, daß man mit ihm nicht weiterkam. Man sah lediglich den verschwommenen, gebeugten Rücken eines rennenden Mannes. Man konnte nicht erkennen, von welchem Stoff die Jacke war, und selbst dessen Helligkeitswert blieb ungewiß. Eine Frau starrte diesen Mann an, dahinter waren alle Buchstaben eines Reklameschildes zu lesen, und drüben auf der anderen Straßenseite stand ein junges Mädchen neben einem Fahrrad. Das war alles, und alles war scharf, nur nicht der flüchtende Mann. Varney sagte: »Ich werde Sie in dem Tabakladen nicht bloßstellen, Ehrensache. Nur eines noch: Erzählen Sie bitte alles ganz genau, was Sie gestern gesehen haben.«
Briggs war vor seiner Schicht ein wenig spazierengegangen. Er hatte seinen Fotoapparat mitgenommen, um in einem nahegelegenen Park Eichhörnchen oder Schwäne zu fotografieren, wie er es gelegentlich tat. Da hatte er, als er ein paar Meter von der Gasse entfernt gewesen war, einen Schuß gehört. Gleich darauf waren zwei Männer herausgerannt, und er hatte seinen Apparat hochgerissen. »Einer lief schwerfällig«, sagte Briggs, »als ob er verletzt wäre. Beide sprangen ins Auto und fuhren sofort los. Ich wollte noch ein Bild machen, aber plötzlich waren Leute vor mir, und dann war es zu spät.«
Varney sagte: »Geben Sie mir bitte auch das Negativ. Vielleicht kann man doch noch etwas herausholen. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen der Leute in dem Tabakgeschäft. Erzählen Sie, Scotland Yard hätte das Bild mit Kußhand genommen. Und mehr dürften Sie aus Gründen der Geheimhaltung nicht sagen. Einverstanden?«
Nach diesem Gespräch fuhr Varney zum Yard. In einem der Höfe stand der Austin, in dem die Gangster geflohen waren. Auch er war gestohlen worden, das stand schon fest; der Besitzer war ein Rechtsberater aus Chelsea. Auf dem Tisch in Varneys Zimmer lag Abboths lederne Geldtasche, sie war der Breite nach aufgeschnitten und natürlich leer. »Nichts mit dem Bild«, sagte Varney. »Ein braver Mann, der für einen Augenblick glaubte, er stünde im Mittelpunkt des Weltgeschehens, dann platzte die Seifenblase, und er schämte sich so, daß er sich totstellte. Trotzdem: Unsere Fotofritzen sollen so stark vergrößern, wie es nur möglich ist.«
An diesem Nachmittag besuchte Varney noch einmal Abboth. Der Kassenbote begrüßte ihn weit munterer als am Vortag, das Sprechen strengte ihn aber immer noch an, und wieder hatte der Arzt die Redezeit auf zehn Minuten beschränkt. »Wir sind den Verbrechern auf der Spur«, behauptete Varney, weil er hoffte, Abboth damit aufmuntern zu können. Er stellte noch einige Fragen, aber Abboth konnte zu dem, was er schon gesagt hatte, nichts hinzufügen. Varney war nicht ärgerlich, als die zehn Minuten verstrichen waren; er hätte nichts mehr erfragen können.
Als Varney danach wieder in seinem Wagen saß, legte er die Arme auf das Steuer und stützte den Kopf in die Hände. Er überlegte, was er jetzt tun könnte, besser, was er jetzt tun müßte. Es war nichts so dringend, daß er es nicht auch in zwei Stunden oder am nächsten Tag erledigen konnte, und daran merkte er, daß er sich auf einem toten Punkt befand. Er hatte sein Netz ausgelegt, er konnte es hier und da verdichten, aber er konnte sein Wild nicht hineintreiben, solange er es nicht kannte. Seine Leute waren dabei, die Aktenberge nach einem großen, etwa dreißigjährigen Mann mit krausem Haar durchzuwühlen, der sich schon einmal eines Roheitsdeliktes schuldig gemacht hatte, und sie würden Dutzende davon finden. Dann mußte man einen nach dem anderen unter die Lupe nehmen und hoffen, daß sich der Schuldige eine Blöße gab. Zwischendurch konnte man einen Zufall ersehnen.
An diesem Tag ging Varney zeitiger als sonst nach Hause. Er schlief eine Stunde, duschte und aß, und als er gegen neunzehn Uhr wieder in seinem Büro auftauchte, fühlte er sich frisch und tatendurstig. »Die zweite Schicht beginnt«, sagte er. »Wollen wir hoffen, daß sie erfolgreicher verläuft als die erste.«
Einige Fotos von Männern lagen bereit, die zu dem großen Kreis der Verdächtigen gehörten; man wollte sie am nächsten Tag Abboth und dessen Fahrer zeigen. Die Aufnahme von Briggs war nach allen Regeln der Entwicklungskunst ausgewertet worden; ein paar großformatige Abzüge lagen vor, aber aus ihnen war nichts Neues zu ersehen. »Wir machen weiter Kleinklein«, ordnete Varney an, dann fuhr er nach Dullwich zu Sientrinos Nachtbar.
Diesmal war die Straße belebter als am Abend vorher, und Varney mußte eine Weile warten, ehe er ungesehen über den Hinterhof schleichen konnte. Er öffnete die Tür zur Küche. Sientrino war dabei, Käse zu schneiden und auf Platten zu verteilen. Er lotste Varney rasch in das kleine Zimmer neben der Küche, ging noch einmal zurück und kam mit einer Whiskyflasche und mit Gläsern zurück. »Sie brauchen Trost«, sagte Sientrino und lächelte, daß seine Goldzähne blitzten.
»Also haben Sie nichts erfahren.«
»So schnell geht es nicht. Natürlich wird von dem Fall gesprochen. Ein paar meinten, es sei eine Bande aus Liverpool.«
Varney packte einen Abzug des Fotos von Briggs aus. »Nahezu das einzige, was wir bis jetzt haben«, sagte er. »Können Sie etwas damit anfangen?«
Sientrino hielt den Abzug unter die Lampe, schob ihn hin und her, schüttelte den Kopf. »Nach diesem Schatten da würde ich nicht einmal meinen Bruder erkennen.« Dann fügte er schnell hinzu: »Moment! Das ist doch …« Er hob rasch den Kopf, dann starrte er wieder auf das Foto und sagte mit einer Stimme, die heiser vor Überraschung klang: »Das Mädchen neben dem Fahrrad ist die Freundin von Grebb.«
»Sie meinen den Messerstecher?«
»Er war ein paarmal mit diesem blonden Gift hier.«
»Wie heißt sie?«
»Das weiß ich nicht.«
»Haben Sie Grebb gestern oder heute gesehen?«
»Ich glaube nicht, aber das will nichts besagen. Er ist nicht oft hier.«
»Das wäre eine tolle Sache«, sagte Varney. »Grebb hat seine Flamme mitgenommen, damit sie Schmiere steht und sieht, was er für ein toller Hecht ist. Aber Grebb ist nicht der Große mit dem krausen Haar. Grebb ist der, der geschossen hat. Könnte es zumindest sein. Ihren Whiksy brauchen wir jetzt nicht mehr.« Er steckte das Foto ein und verabschiedete sich schnell. Von der nächsten Telefonzelle aus rief er im Yard an und gab die Anweisung, alle verfügbaren Leute aus den Betten zu trommeln; dann jagte er zweimal bei Rot über Kreuzungen, bremste so hart, daß die Reifen quietschten, rannte die Treppen zu seinem Büro hinauf und riß die Tür auf. Einer seiner Mitarbeiter stand bleich hinter dem Schreibtisch und sagte: »Ein neuer Überfall. Im Mercy-Kaufhaus. Vielleicht dieselben Leute.«
In den nächsten zehn Minuten verbrauchte Varney so viel Nervenkraft wie sonst in zwei Wochen. Er schickte Leute zu Grebbs Wohnung und beauftragte andere, Namen und Adresse von dessen Freundin festzustellen. Er ließ Grebbs Akte heraussuchen und hörte sich am Telefon an, was im Mercy-Kaufhaus geschehen war. Er stellte eine Gruppe zusammen, die dort die Spuren sichern sollte, dann beriet er am Telefon mit seinem Chef, Inspektor Sheperdson, ob es schon zu verantworten war, eine Großfahndung nach Grebb einzuleiten, und ließ sich dazu bewegen, einige weitere Ergebnisse abzuwarten. Schließlich fuhr er auf schnellstem Wege zum Mercy-Kaufhaus.
Der Überfall war mit der gleichen Brutalität verübt worden wie der an der Celtic-Bank. Als der Hauptkassierer das längst geschlossene Kaufhaus durch einen Nebeneingang verlassen wollte, war er von zwei maskierten Männern angefallen und zurückgedrängt worden. Einer hatte dem Kassierer die Pistole gegen die Rippen gedrückt, dann hatten sie ihn hastig durchsucht, ihm Brieftasche und Uhr entrissen und ihn immer wieder gefragt, wo die Schlüssel zum Safe wären. Die Räuber hatten mit Fäusten auf ihn eingeschlagen, und als der Kassierer beteuert hatte, diese Schlüssel würden beim Hausdetektiv aufbewahrt, war er mit dem Tode bedroht und schließlich zusammengeschlagen worden. Noch jetzt, fast eine Stunde nach dem Überfall, war er nur mühsam in der Lage, zu sprechen und sich auf Zusammenhänge zu besinnen. »Einer war sehr groß«, sagte er. »Er hat mich am brutalsten geschlagen. Der andere war höchstens mittelgroß und schlanker.«
»Wie sprachen sie?« fragte Varney.
»Londoner Dialekt.«
»Wer schien der Anführer zu sein?«
»Der Kleinere, der mit der Pistole.«
Varney zeigte ihm ein Foto von Grebb. Der Kassierer schaute es längere Zeit an. »Er trug eine Maske«, sagte er dann, »aber das Kinn, der Mund – beschwören möchte ich es nicht, doch möglich ist es.«
»Ich hoffe«, sagte Varney, »daß ich Ihnen diesen Mann bald gegenüberstellen kann.«
In dieser Nacht wurde Grebbs Wohnung durchsucht: sie sah nicht so aus, als ob er in den letzten Tagen zu Hause gewesen wäre. Die Kriminalbeamten fanden keinen Ausweis, kein Bild, keinen Brief, kein Geld. Sie sicherten eine Menge von Grebbs Fingerabdrücken und die Fingerabdrücke einer noch unbekannten Person, dann versiegelten sie die Wohnung und ließen einen Posten in der Nähe der Haustür zurück. In dieser Nacht erfuhr Scotland Yard, daß die Freundin von Grebb ein abgetakeltes drittklassiges Mannequin war und Jane Hetshop hieß. Sie hatte ein möbliertes Zimmer in der Nähe des Waterloo-Bahnhofs gemietet. Die Wirtin gab an, die Hetshop wäre seit zwei Tagen nicht mehr zu Hause gewesen. Die Kriminalpolizisten fanden zahlreiche Bilder, die die Hetshop in allen denkbaren Posen zeigten, und es gab genügend Vergleichsmöglichkeiten, um den Verdacht zu erhärten, daß das Mädchen neben dem Fahrrad auf dem Foto von Briggs niemand anders als die Hetshop war. In einem Brief, den ihr eine Tante aus dem nordenglischen Städtchen Blyth geschrieben hatte, stand zu lesen: »Willst Du nicht endlich klüger werden? Ich werde Dir demnächst ein paar Krimis schicken, aus denen Du schwarz auf weiß ersehen kannst, daß es mit Dir ein schlimmes Ende nehmen muß. In ›Blonde Mädchen sterben früher‹ begann es genauso. Und erst in ›Keine Angst vor großen Colts‹! Wenn das alles meine arme Schwester, Deine Mutter, noch hätte erleben müssen!«
Gegen Morgen war klar, daß die Fingerabdrücke in Grebbs Wohnung von Jane Hetshop stammten. Als Varney, der inzwischen in sein Büro zurückgekehrt war, dies erfahren hatte, erwirkte er Großfahndung nach Grebb und Jane Hetshop.
Grebb hätte nicht geglaubt, daß seine Nerven in den letzten Tagen so gelitten hatten, aber er zuckte zusammen, als er sein Bild und das von Jane in der Zeitung sah. »Verdammt«, sagte er, »sieh dir das an!«
Sie saßen an Deck einer Fähre, die Kraftwagen und Personen von Birkenhead nach Dublin transportierte. Grebb fügte hinzu: »Ich glaube, wir haben großes Glück gehabt, daß wir unbemerkt auf diesen Kahn gekommen sind.«
Jane besah die Bilder und las den Artikel darunter. »Keine Schmeichelei für euch«, sagte sie. »Ungewöhnlich brutal, rücksichtslos, das gemeinste Verbrechen dieses Jahres.«
»Alles Unsinn«, sagte Grebb. »Der Kassierer aus dem Warenhaus bündelt jetzt schon wieder Geldscheine, der andere wird es in der nächsten Woche tun. Mit solchem Quatsch wollen sie bloß die Leute aufhetzen.«
Es war windig auf der Irischen See, dichte Wolkenfelder trieben vom Atlantik herüber, nur selten drang die Sonne durch. Grebb hatte es für das beste gehalten, sich mit seiner Freundin in der Nähe des Bugs an die Reling zu setzen; hierher kam selten jemand. »Vielleicht«, sagte er, »ist es am besten, wenn wir uns nicht mehr zusammen sehen lassen.«
»Aber deine Perücke ist doch großartig.«
»Schon. Aber deine blonde Mähne sieht man hundert Seemeilen weit.«
»Ich möchte wissen, wie die Brüder so schnell dahintergekommen sind, daß du die beiden Sachen gedreht hast! Du hast bisher noch nie mit einer Pistole gearbeitet. Auch Jesse ist Neuling auf diesem Gebiet.«
»Vielleicht war der zweite Überfall schon ein Fehler.«
»Es war Jesses Idee«, sagte sie sanft.
Grebb ließ sich nicht reizen. »Ich weiß, daß du Jesse nicht leiden kannst, aber er ist mein Freund. Er hat seine dreißig Prozent von der Beute bekommen, wie es ausgemacht war, und du kannst sticheln, solange du willst, es war nicht zuviel. Und nun sieh zu, daß du irgendwo ein Plätzchen findest, wo du nicht auffällst. Meinetwegen kannst du dich in der Toilette einriegeln.«
Jane Hetshop ließ Grebb während der restlichen Fahrt allein. Nichts geschah, was Grebb beunruhigt hätte, niemand hielt sich auffällig lange in seiner Nähe auf, und niemand sprach ihn an. Grebb überlegte, ob er seine Pistole über Bord werfen sollte, sie nutzte ihm hier nichts und belastete ihn nur, falls er doch geschnappt werden sollte. Aber wenn er von diesem Schiff herunter war, konnte ihm allerhand in die Quere kommen; er durfte sich noch längst nicht in Sicherheit fühlen. Grebb aß die Schinkenbrötchen, die er sich in Birkenhead gekauft hatte, und nahm hin und wieder einen Schluck Gin aus einer Taschenflasche. Er freute sich auf die Stunde, in der er zum ersten Mal wieder damit beginnen konnte, sich planmäßig vollaufen zu lassen, in der er keine Furcht zu haben brauchte, er könnte dummes Zeug reden oder eine Hand könnte sich auf seine Schulter legen. Aber bevor Jane und er Spanien erreicht hatten, war daran nicht zu denken.
Als sie in Dublin von Bord gingen, war es längst dunkel. Jane Hetshop trug einer älteren Dame die Tasche und unterhielt sich dabei so angelegentlich mit ihr, daß jeder annehmen mußte, die beiden gehörten zusammen. Nachdem Jane das Zollbüro passiert hatte, folgte Grebb über das Fallreep. Sein Paß war falsch, aber gut genug für eine oberflächliche Prüfung. Grebb war jetzt froh, daß er die Pistole nicht weggeworfen hatte; sollte er erkannt werden, wollte er einen Warnschuß abgeben und versuchen, im Hafengelände unterzutauchen. Aber der Zöllner reichte seinen Paß nach einem kurzen Blick zurück.
An der nächsten Straßenecke wartete Jane auf ihn, hakte ihn unter und drückte sich an ihn. »Wir können uns gratulieren«, sagte sie. »Das Schlimmste liegt hinter uns.«
»Ich bin nicht so sicher. Das Schlimmste kommt in einem Jahr, wenn das Geld alle ist.«
Sie lachte. »Bis dahin wirst du dir doch etwas Neues einfallen lassen.«
Sie quartierten sich in einem größeren, nicht sehr vornehmen Hotel ein. Sie ließen sich sofort hinauffahren und bestellten das Essen aufs Zimmer. Jane bestand auf einer Flasche Wein, obwohl weder sie noch er gern Wein tranken, aber sie hielt es für vornehm und glaubte, es passe zu ihrer Rolle. Aus dem Fenster hatten sie einen Blick über nasse Dächer, und bis gegen Mitternacht hörten sie Musik aus einem Tanzlokal, das nicht weit entfernt schräg unter ihnen lag. Sie schliefen schlecht, obwohl sie seit Tagen in keinem Bett mehr gelegen hatten. Grebb versuchte auszurechnen, wieviel Geld er und Jane pro Tag ausgeben durften, wenn sie ein Jahr lang von der Beute leben wollten. Er kam damit nicht zu Rande, knipste das Licht an und versuchte, dem Problem auf der Rückseite eines Reklamezettels, der auf dem Nachtschränkchen lag, schriftlich beizukommen. Zunächst zog er die Summe ab, die seine beiden Helfer erhalten hatten, dann dividierte er mühselig seinen Anteil durch 365. Das Ergebnis erschütterte ihn.
Am Morgen brachen sie zeitig auf. Grebb gab den Zimmerschlüssel ab und bat um die Rechnung; der Portier schrieb sie aus und schob sie ihm hin. Inzwischen trat Jane schon auf die Straße. Die Halle lag ziemlich leer; eine Frau war damit beschäftigt, eines der großen Fenster zu polieren, ein Mann saß in einem Ledersessel und las die Zeitung, der Liftboy stand mit übernächtigtem Gesicht neben dem Fahrstuhl.
»Bitte schön«, sagte der Portier. »Fünfhundert Pfund.«
Grebb lächelte. »Schon am frühen Morgen zu Späßen aufgelegt?«
»Keineswegs«, sagte der Portier und lächelte zurück. »Keineswegs, Mister Grebb.«
»Was soll der Unsinn!« sagte Grebb leise. Später, als alles vorbei war, machte er sich noch lange Zeit deswegen Vorwürfe: Durch einige Monate hindurch, bis er schließlich kaum mehr an diesen Zwischenfall dachte, glaubte er, es wäre alles anders gekommen, wenn er diesen Satz so laut gesagt hätte, daß der Liftboy und der Herr im Sessel und die Fensterputzerin ihn verstanden hätten; denn so vollkommen sicher konnte der Portier seiner Sache unmöglich sein.
»Das ist kein Unsinn, Mister Grebb«, sagte der Portier ebenso leise. »Ich habe drei Kinder und eine Hypothek auf meinem Häuschen. Das Leben ist teuer. Sie wissen es selbst. Unter meinem linken Fuß ist eine Taste. Wenn ich darauf trete, schließen sich die Türen, und die Polizei ist in einer halben Minute da. Außerdem ist Ihre Perücke zweite Wahl. Fünfhundert Pfund, bitte schön.«
Grebb dachte flüchtig an die Pistole in seiner Tasche, doch er sagte: »Ich gebe Ihnen hundert. Mehr habe ich nicht bei mir.« Aber er zählte dann doch mehr auf den Tisch, rasch und in großen Scheinen, und der Portier achtete stärker darauf, daß der Liftboy nicht zuschaute, als daß er nachzählte.
Bei zweihundertvierzig Pfund steckte Grebb die Hände demonstrativ in die Taschen, der Portier strich die Scheine vom Tisch und sagte: »Verbindlichsten Dank, mein Herr, und gute Reise. Eine Empfehlung an die Frau Gemahlin!« Steif ging Grebb durch die Tür.
Nachdem der Portier verstohlen das Geld gezählt hatte, steckte er es in seine Aktentasche. Minutenlang überlegte er angestrengt, wobei er auf den Tisch trommelte und leise, abgerissene Töne vor sich hin pfiff. Nachdem er sich entschlossen hatte, gab er telefonisch die Anweisung, ein bestimmtes Zimmer im vierten Stock vorerst nicht zu säubern. Dann rief der die Polizei an. Eine Viertelstunde später teilte er zwei Beamten mit, er hätte immer und immer wieder nachgedacht, warum ihm das Gesicht eines bestimmten Gastes bekannt vorgekommen wäre. Noch jetzt wäre er keineswegs sicher, ob es nur eine merkwürdige Ähnlichkeit mit dem Räuber Grebb wäre, die ihn nasführte. Oder – und das schien keineswegs ausgeschlossen – hatten tatsächlich Grebb und seine Geliebte, deren Bilder in allen Zeitungen waren, in diesem Hotel genächtigt?
Eilig liefen die Beamten in den vierten Stock hinauf.
»Dieser Zettel«, sagte Varney, »bringt uns einen Schritt weiter. Grebb ist nicht sehr klug, wir wußten es immer. Kopfrechnen gehört nicht zu seinen starken Seiten. Sehen Sie sich seine Kalkulation genau an.«
Varneys Mitarbeiter traten an seinen Tisch. Jedem von ihnen war die Erschöpfung anzusehen. Sie waren seit drei Tagen nicht aus den Kleidern gekommen, hatten kaum Zeit gefunden, sich zu waschen und zu rasieren. Jetzt belebten sich ihre Mienen ein wenig. »Die Sache erscheint mir eindeutig«, sagte Varney. »Oben steht die Zahl 6305. Das ist die Beute aus dem Überfall an der Celtic-Bank. Dann kommt diese Zeile: B 1261. 1261 sind zwanzig Prozent von 6305. Ich schließe daraus, daß ein gewisser B mit zwanzig Prozent an der Beute beteiligt war. Die nächste Zeile: 1892. Das sind dreißig Prozent von der Beute, und J bedeutet den Vornamen oder den Namen des anderen Komplicen. Dann folgt eine umständliche und nicht ganz fehlerfreie Rechnerei, mit der Grebb versucht hat, seinen Beuteanteil durch 365 zu teilen, vermutlich, um zu sehen, wieviel er ein Jahr lang täglich ausgeben kann. Sollte Grebb tatsächlich entkommen und sich irgendwo versteckt halten, können wir damit rechnen, daß wir ihn in spätestens einem Jahr erneut auf dem Hals haben. Uns interessieren zunächst die Buchstaben B und J. Vermutlich hat der Schläger mit dem krausen Haar dreißig, der Fahrer zwanzig Prozent der Beute bekommen. Name oder Vorname des Fahrers beginnt also mit B, der des Schlägers mit J.«
»Warum nicht der Spitzname?« fragte einer.
Einen Augenblick lang war Varney überrascht. »Ich muß sehr müde sein«, sagte er dann, »daß mir das nicht selbst eingefallen ist. Dank für den Hinweis. So erschöpft wir auch alle sind, die Arbeit geht weiter.«