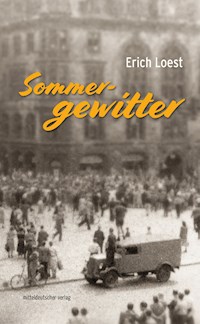3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Klar gezeichnete Figuren, bunt wechselnde Schauplätze auf zwei Kontinenten und ein scharfer Blick für die Hintergründe des schmutzigen Waffengeschäfts zeichnen diesen Kriminalroman aus, mit dem Erich Loest den Freunden deutschsprachiger Kriminalliteratur spannenden Lesestoff liefert. Selbstverständlich ist Inspektor George Varney wieder mit von der Partie. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Ähnliche
Erich Loest
Waffenkarussell
Kriminalroman
FISCHER E-Books
Inhalt
1 Toter Mann und toter Hund
George Varney glaubte, einen ruhigen Abend inmitten seiner Familie vor sich zu haben. Seine Frau hatte den Abendbrottisch gerichtet mit appetitlichen Dingen, die ihr Mann und die Kinder liebten, Krebssuppe, Geflügelsalat, Eier in Kaperntunke, Schinken. Neben ihr stand der elektrische Toaster, Scheibe auf Scheibe hüpfte geröstet heraus. Das Abendbrot zog sich angenehm in die Länge: Von der Schule war die Rede, vom Geschichtsunterricht der Tochter, Griechen gegen Perser; Wanderer, kommst du nach Sparta; dann werden wir im Schatten kämpfen; Darius, Miltiades – Varney hatte seit fünfundzwanzig Jahren nicht mehr daran gedacht; jetzt machte es ihm Spaß, wie Namen und sogar Jahreszahlen allmählich aus dem Gedächtnis aufstiegen. Marathon – 490 vor? Stimmte das?
Eine neue Scheibe Toast für den Vater, er belegte sie noch einmal mit Geflügelsalat, obwohl er schon Schinken und Käse gegessen hatte, begann also wieder von vorn. Man würde dann den Kindern die Freude gönnen, noch eine Stunde vor dem Fernsehapparat zu sitzen, es war Sonnabend, morgen konnten sie ausschlafen. Eine Schlagersendung, nun ja, auch die würde vorübergehen; Varney wollte zusammen mit seiner Frau eine Flasche Wein trinken, sich unterhalten, und alles Weitere würde sich finden.
Dann wurde abgeräumt, der Apparat eingeschaltet. Nachrichten zunächst: Nachwahlen in zwei Grafschaften, ein Sieg für Labour und einer für die Konservativen. Unwetterkatastrophe in Italien, neue amerikanische Bombenangriffe auf Öllager bei Haiphong. Die blonde Ansagerin, eine Beat-Gruppe, dann Sandy Shaw, und in ihren Gesang hinein klingelte in der Bibliothek das Telefon, ärgerlich stand Varney auf und ging hinüber.
Inspektor Sheperdson, sein Chef, entschuldigte sich für die Störung. Nur unter außergewöhnlichen Umständen würde er es wagen, zu dieser Stunde in eine Familie einzudringen, aber auf einem Polizeirevier in Westham hätte sich vor einer Stunde ein Kellner namens Benfield gemeldet und angegeben, auf dem Dampfer »Brisbane Star«, der in drei Tagen von Southampton auslaufen würde, solle ein Mord begangen werden. Benfield wollte ein Gespräch darüber in seiner Gaststätte durch eine Wand gehört haben. Eine unklare Geschichte, aber er, Sheperdson, werde das Gefühl nicht los, es wäre besser, der Sache beizeiten nachzugehen. »Ich habe im Augenblick niemanden hier, den ich beauftragen könnte.«
»Ich fahre sofort los.« Varney ließ sich die Nummer des Polizeireviers wiederholen, hörte Sheperdsons erneute Entschuldigung, versprach, eine Empfehlung an die verehrte Gattin auszurichten. Dann hängte er auf, rang den Ärger nieder, daß sein so überaus höflicher Chef gerade ihn angerufen hatte. Diese Sache schien vom ersten Augenblick an unerquicklich zu sein, er würde sich wahrscheinlich die Nacht um die Ohren schlagen und dann doch nicht mehr zutage fördern als Redereien von Betrunkenen oder Halbbetrunkenen, die geäußert hatten, sie würden dem und jenem bei nächster Gelegenheit den Schädel einschlagen, und doch keine Sekunde im Ernst daran dachten, das auch wirklich zu tun.
»Sheperdson«, sagte er zu seiner Frau, »der reizende alte Herr, der dir stets die Hand küßt und einen überwältigenden Eindruck auf dich macht, schickt mich nach Westham. Nein«, sagte er, als er ihr rasches Aufblicken bemerkte, »man hat niemanden umgebracht. Aber augenscheinlich hat man vor, es demnächst zu tun.« Er sah die Enttäuschung in den Augen seiner Frau über den verdorbenen Abend und lächelte unfroh. »Ich komme so schnell wie möglich zurück. Trotzdem, warte nicht zu lange.«
Die Sicht war klar an diesem Novemberabend; wenn man den Wetterfröschen glauben könnte, sollte erst in den frühen Morgenstunden Nebel aufkommen. Verlassen lagen die Straßen, an vielen Kreuzungen waren die Ampeln ausgeschaltet, so daß Varney schnell vorankam. Während der Fahrt legte sich sein Ärger, Neugier erwachte, was dieser Benfield für ein Mann war. Kellner gab es in allen Schattierungen, vom bulligen Rausschmeißer bis zum abgewrackten Nervenbündel, es ließ sich vorher nichts sagen.
Auf dem Polizeirevier in Westham zeigte man sich erfreut, daß so schnell jemand von Scotland Yard eintraf. Ein Wachtmeister mit borstigem Schnurrbart und kahlem Kopf bat Varney in das Zimmer hinter dem Wachraum, in dem tagsüber der diensthabende Offizier seinen Platz hatte. Dort berichtete er, daß der Kellner Benfield, beschäftigt in Milfords Speisehaus, nach Arbeitsschluß – dieses Restaurant hatte nur bis acht Uhr abends geöffnet – zu dieser Polizeiwache gekommen war und folgendes vorgebracht hatte: Er hätte gegen sechs sein Abendessen an einem Tisch in dem Gang zur Küche eingenommen, der vom Gastraum nur durch eine Sperrholzwand getrennt sei. Dabei hätte er das Gespräch von zwei Männern belauscht, die sich darüber unterhalten hätten, ein Mann, den sie nicht näher bezeichnet hätten, würde sich in drei Tagen in Southampton auf der »Brisbane Star« einschiffen. Dort wäre die beste Gelegenheit, ihm unzubringen, abzustechen, über Bord zu schmeißen. »Was nun kommt, ist für uns nicht sehr erfreulich. Benfield will das Gespräch so lange belauscht haben, bis die beiden Männer das Thema wechselten und sich vom Pferderennen unterhielten.« Dann habe er in den Gastraum gehen wollen, aber sein Chef habe etwas über die Abrechnung des Vortages wissen wollen und ihn dadurch einige Minuten aufgehalten. Als er an den betreffenden Tisch gekommen sei, habe niemand mehr an ihm gesessen. Der Kellner dieses Reviers habe ihm gesagt, die beiden Gäste seien eben gegangen.
»Sie wissen, wie dieser Kellner heißt?«
»Woothing.«
»Was ist Benfield für ein Mensch?«
Der Wachtmeister war offenbar nicht geübt, Personen zu beschreiben. Nach etlichen Rückfragen bekam Varney heraus, daß Benfield ein Mann von etwa fünfundvierzig Jahren war, nicht sehr groß, kräftig gebaut, mit starken Händen und einem breiten, glatten Gesicht und einer ruhigen, sachlichen Sprechweise. Benfield hätte nicht den Eindruck eines Mannes gemacht, der sich Märchen ausdachte oder aus Geltungssucht halbverstandene Brocken zu einer Räuberstory aufbauschte. Varney fragte: »Und wo ist er jetzt?«
»Er wollte nach Hause gehen.«
»Jetzt kann ich ihn natürlich nicht aus dem Bett klingeln. War es nicht möglich, ihn hierzubehalten, bis jemand vom Yard kam?«
»Ich habe Benfield darum gebeten, aber er sagte, er wäre müde. Und eine Handhabe hatte ich nicht gegen ihn.«
»Natürlich nicht. Sie haben alles ganz ordentlich gemacht.« Varney ließ sich Benfields Adresse geben und nahm sich vor, dort am nächsten Morgen nachzufragen – es war unmöglich, einen Bürger nur wegen einer Rückfrage jetzt noch aus dem Bett zu klingeln. Nun tat es ihm wieder leid, daß dieser Abend, auf den er und seine Frau sich gefreut hatten, einer so undurchsichtigen Sache wegen verpfuscht war. Varney blickte auf die Uhr. Vielleicht war es doch nicht zu spät. Er fuhr so schnell wie möglich nach Hause und ließ den Wagen vor der Haustür stehen. Er traf seine Frau lesend im Sessel an, schon zur Nacht zurechtgemacht, in einem gesteppten Umhang, die Beine hochgezogen. Er fragte: »Ich komme nicht zu spät?«
Sie legte das Buch weg. »Gar nicht.«
Zwei Stunden später erzählte er ihr in kurzen Umrissen, weswegen Sheperdson ihn durch die Nacht gejagt hatte; dann schlief er ein. Am nächsten Morgen frühstückte er mit seiner Familie, dann fuhr er wieder hinaus nach Westham. Es war tatsächlich neblig geworden, so daß er das Standlicht einschalten und langsam fahren mußte. Er überlegte, ob er den Wagen stehenlassen und mit der U-Bahn weiterfahren sollte, aber nördlich der Themse ließ der Nebel nach.
Die Häuser in der Straße, in der Benfield wohnte, waren von dem soliden Stil, der um die Jahrhundertwende für weite Stadtviertel überall auf der Insel und in den festländischen Großstädten bevorzugt worden war. Hier draußen sah alles noch so aus wie vor sechzig Jahren, hier waren keine Bomben gefallen; nur die Straßenlaternen und die Reklamen der wenigen Geschäfte waren modernisiert. Varney trat in einen hohen, kalten Hausflur und stieg eine breite Treppe hinauf, klingelte dreimal an einer Tür, an der drei Namensschilder befestigt waren: Einmal klingeln S. Williams, zweimal Robert Crow, dreimal Charles Benfield. Als sich nichts rührte, klingelte er erneut, lauschte, dann hörte er eine Tür gehen; ein Fensterchen wurde geöffnet, die Umrisse eines Gesichts zeigten sich, und Varney sagte, er möchte gern Herrn Benfield sprechen, ob der nicht zu Hause wäre.
Das wüßte sie nicht, antwortete eine Frau, sie wolle nachsehen. Als sie zurückkam, sagte sie, sie hätte an Herrn Benfields Tür geklopft, aber es hätte sich nichts gerührt, und dabei wäre Herr Benfield doch ein Frühaufsteher. Da hielt Varney seine Marke hoch, sagte, er käme von der Kriminalpolizei, sie möchte bitte öffnen. Licht wurde im Flur gemacht, Varney durfte eintreten und sah sich einer jungen Frau in einem Morgenrock gegenüber, die offenbar noch nicht dazu gekommen war, ihr Haar zu ordnen. Sie wies auf eine Tür am Ende des Korridors; dort klopfte Varney, lauschte, und als sich noch immer nichts rührte, drückte er die Klinke nieder. Die Tür gab nach.
Das Zimmer, in das er trat, hatte zwei Fenster, die Vorhänge waren zugezogen und ließen nur spärliches Licht einfließen. Varney fingerte nach dem Schalter, knipste, sah Füße in gestopften Socken vor sich, sagte: »Hallo, Herr Benfield.« Diese Füße waren groß und mit den Sohlen zu Varney gerichtet, die Zehen standen nach oben in einem Winkel von fast fünfundvierzig Grad – Varney entsann sich dunkel, bei der Armee gelernt zu haben, daß Füße so zu stehen hatten. Aber dieser Mann lag rücklings auf den Dielen, den Kopf zur Seite geneigt. Es sah aus, als hätte er einen Buckel, die linke Schulter war merkwürdig angehoben, und unter ihr breitete sich eine schwärzliche Lache aus, Blut, das in die Dielen gesickert und von einem flauschigen Läufer eingesogen worden war. Der Mund stand halb offen, und Varney fand, daß der schnurrbärtige Wachtmeister den Kellner Benfield recht treffend geschildert hatte: Dessen Gesicht war breit mit einem eckigen Kinn und kräftiger, straffer Muskulatur, fast ohne Falten; man konnte sich vorstellen, daß dieser Mann ruhig und sachlich gesprochen hatte. Varney hob die linke Schulter ein Stück an und sah den Griff eines Bajonetts, das fast bis zum Heft in den Rücken gerammt worden war. Er ekelte sich nicht und spürte kein Grauen; das geschah ihm schon seit Jahren nicht mehr. Zu den vielen Gedanken, die gleichzeitig sein Hirn kreuzten, gehörte auch der: In diesen Sekunden begann für ihn die Aufklärung seines achtundzwanzigsten Mordfalls. In Varney wuchs der Haß auf den Mörder, den er brauchte, um die Anstrengungen der nächsten Tage und Wochen durchzustehen. Bis zum Vortag hatte er sich mit der Absicht getragen, bei erster Gelegenheit ein Gesuch einzureichen: Er wollte um eine Position bitten, bei der er seinen geregelten Arbeitstag hatte mit garantiert freiem Wochenende. Er hatte kürzlich seinen dreiundvierzigsten Geburtstag gefeiert und dabei seiner Frau versprochen, sich allmählich aus der operativen Linie zurückzuziehen. Hatte er nicht das Seine getan? Gab es nicht junge Leute, wie zum Beispiel seinen Assistenten Boston, die auf eine Chance warteten? Konnte er seine Erfahrungen nicht anderweitig nutzen, beispielsweise als Dozent an einer Polizeischule? Aber diese Gedanken waren jetzt wie weggeblasen.
Er erhob sich, schaltete das Licht aus und zog die Vorhänge auf. Dann trat er hinaus. Auf dem Gang stand die Frau, die ihm geöffnet hatte. Inzwischen hatte sich sich gekämmt; sie sah ihn erwartungsvoll an. Er fragte: »Wo kann ich telefonieren?«
»Bei uns, bitte.«
Von einem mit modernen Typenmöbeln eingerichteten Zimmer aus sprach Varney mit seinem Büro. »Mord. Schicken Sie sofort alles, was gebraucht wird. Vielleicht können Sie jemanden auftreiben, der etwas von Militärwaffen versteht.«
Die Frau stand neben ihm, blaß jetzt und mit geweiteten Augen. Varney sagte: »Ich möchte Sie einiges fragen, bevor meine Leute kommen.« Sie wies auf einen Sessel, setzte sich sofort, griff hastig nach einer Zigarettendose. Varney fragte: »Wer wohnt alles in dieser Wohnung?«
»Wir«, sagte sie, »mein Mann und ich und unser Junge. Ich bin Ruth Crow, mein Mann heißt Robert. Außerdem meine Mutter, Frau Williams. Seit ein paar Jahren haben wir an Herrn Benfield vermietet. Wir brauchen das Zimmer nicht, die Wohnung ist groß, sechs Zimmer, und damals wurde die Miete heraufgesetzt.«
»Wann kam Benfield gestern nach Hause?«
Sie schien zu überlegen. »Wie immer, denke ich. Oder etwas später. Wir saßen noch vor dem Fernsehapparat. Vielleicht war es auch schon gegen zehn.«
»Kam er allein?«
»Ich denke, ja.«
Die Tür ging auf, ein Mann stand im Rahmen, die Hosenträger über dem Hemd. »Mein Mann«, sagte Ruth Crow. »Der Herr ist von Scotland Yard. Ich wollte dich gerade wecken.«
Varney erklärte in kurzen Sätzen, was geschehen war. Crow kratzte sich den Kopf, war eine Sekunde lang verstört, lachte dann. »Mit mir nicht«, sagte er und drehte sich rasch um. »Versteckte Kamera, was? Wieder so ’n Trick, damit die Leute was zu lachen haben.«
Varney zeigte seine Marke. »Ich versichere …«
»Mit mir nicht«, wiederholte Crow, »das kennen wir nun so langsam. Wieder so ’ne Fernsehmasche: versteckte Kamera, und einer erzählt den Leuten, es wäre ein Mord geschehen, und dann die dummen Gesichter.«
»Kommen Sie mit«, sagte Varney. Vor der Leiche Benfields erstarb Crows Lachen. Jetzt erst sah Varney einen Schatten unter dem Bett. Sie bückten sich beide, Crow sagte: »Benfields Hund.«
»Rühren Sie nichts an«, sagte Varney, »und kommen Sie wieder mit hinüber.«
Bis die Mordkommission eintraf, erkundigte sich Varney bei dem Ehepaar Crow. Benfield war ein stiller Mensch gewesen, der seine Miete pünktlich gezahlt und sein Zimmer selbst in Ordnung gehalten hatte. Seine Wäsche war in der Wäscherei gewaschen worden, gegessen hatte er in der Wirtschaft, in der er arbeitete. Besuch hatte er hin und wieder gehabt, ausschließlich Männer.
»Und gestern?«
»Ich bin sicher«, sagte Crow, »daß er erst nach zehn kam, denn da hatte der Krimi im Fernsehen gerade begonnen.«
»Haben Sie etwas Auffälliges wahrgenommen? Streit, Geschrei, einen Fall?«
»Nichts.«
»Haben Sie einen Besucher gesehen oder gehört?«
»Auch nicht.«
»Was trieb Benfield sonst?«
Die Frau sagte: »Er war in einem Angelklub.«
»Turnierangeln«, ergänzte ihr Mann. »Sie wissen, was das ist? Dabei werden keineswegs Fische gefangen. Weitwurf, Zielwurf mit der Angelrute, alles auf dem Trockenen.«
»Wissen Sie, in welchem Klub?«
»Danach haben wir nie gefragt.«
Einen Augenblick lang mußte sich Varney dazu zwingen, in Crow den zur Zeit einzigen Verdächtigen zu sehen. Crow schien kräftig genug zu sein für diesen Stich mit dem Bajonett, kein anderer Mann war in der vergangenen Nacht mit dem Ermordeten in der gleichen Wohnung gewesen. Aber: Wenn Crow wirklich Grund gehabt hätte, einen Verdacht von sich abzuwälzen, hätte er eine Story parat gehabt, etwa so: Ein Mann hatte Benfield gestern besucht, dazu eine einigermaßen genaue Beschreibung des großen Unbekannten, Streit, dem er aber keine Bedeutung beigemessen hatte – es gab dafür ziemlich einschichtige Rezepte. »Herr Crow, was sind Sie von Beruf?«
»Schiffsbauingenieur.«
Es klingelte. »Wir unterhalten uns später weiter«, sagte Varney. Er öffnete selbst, es waren seine Leute. Sie fotografierten die Leiche des Kellners von allen Seiten, sicherten Fingerabdrücke, zogen den toten Hund unter dem Bett hervor. An seinem Hals klaffte eine tiefe Wunde. Über das Bajonett sagte der Waffenspezialist: »Gehört zum deutschen Karabiner 98 K.« Schrank und Kommode wurden geöffnet, und was aus ihnen herausgenommen und auf den Tisch gelegt wurde, ließ Varney, der manches gewohnt war, erstaunen: eine belgische FN-Pistole, ein spanisches Cetme-Schnellfeuergewehr, eine tschechoslowakische Fallschirmjäger-MPi, zwei alte deutsche Maschinenpistolen, Munition aller möglichen Kaliber, die Trommel einer sowjetischen MPi aus dem Zweiten Weltkrieg. »Ein hübsches Arsenal«, erklärte der Waffenspezialist. »Für einen Kellner ziemlich reichlich.«
Varney wußte: Seine Männer würden auch ohne ihn jede Stecknadel finden und registieren, es war nicht nötig, daß er ihnen im Wege stand. So ging er wieder ins Zimmer des Ehepaars Crow zurück. Ein etwa zehnjähriger Junge stolperte dort im Schlafanzug umher, höchst erregt über das Treiben in der Wohnung, offenbar informiert, daß Scotland Yard dabei war, den Mord an Onkel Benfield aufzuklären. Sein Gesicht war das eines wütenden kleinen Mannes; er begann erst zu weinen, als er hörte, daß auch der Hund tot war.
»Er war ganz vernarrt in Benny«, erklärte seine Mutter. »Herr Benfield hatte ihn erst vor einer Woche mitgebracht. Ein junger Schäferhund. Es tat mir leid, daß er den ganzen Tag über im Zimmer eingesperrt sein sollte, deshalb habe ich Herrn Benfield gefragt, ob mein Junge ihn mal ausführen darf. Einmal ist es geschehen. Darüber waren beide sehr glücklich, der Hund und auch der Junge.«
Varney fragte: »Was wissen Sie von den Waffen in Benfields Zimmer?«
Weder Herr noch Frau Crow hatten jemals das geringste davon gesehen oder gehört. Gewehre? Maschinenpistolen? »Unvorstellbar«, sagte Crow.
Die Leichen von Benfield und dessen Hund wurden abtransportiert. Varney blieb zwischen Crows Typenmöbeln hocken und trank den Tee, den Crows Schwiegermutter gebrüht hatte. »Wir kamen gut mit ihm aus«, berichtete Crow, »ohne daß wir uns viel um ihn gekümmert hätten. Zu unserem Jungen war er recht nett. Vielleicht wäre das Verhältnis enger geworden, da der Hund da war.«
Seine Frau erinnerte ihn: »Unser Sommerhaus …«
»Ach ja«, ergänzte Crow, »wir haben in Somerset ein Grundstück mit einem Haus, in der Nähe von Blagdon. Ein paarmal haben wir es Benfield zur Verfügung gestellt.«
Varney fragte: »Und woher hatte er den Hund?«
»Das wissen wir nicht.«
Mehr konnte Varney nicht erfahren, vor allem nicht über die Leute, die Benfield manchmal in den Abendstunden besucht hatten. Keiner war so oft gekommen, daß er ihnen im Gedächtnis geblieben wäre. »Ich werde Sie vermutlich noch einmal stören müssen«, sagte Varney beim Abschied. »Das Zimmer muß noch einige Tage versiegelt bleiben. Und wenn Ihnen noch etwas einfällt oder auffällt, rufen Sie mich bitte im Yard an.«
Er setzte sich in seinen Wagen. Von einer Telefonzelle aus rief er zu Hause an und bat, man solle mit dem Mittagessen nicht auf ihn warten. »Ein neuer Fall.«
»So«, sagte seine Frau. Eine Pause entstand, in der Varney sicher war, daß sie dachte: Er hatte wieder kein Versetzungsgesuch eingereicht, würde tagelang nicht nach Hause kommen, und womöglich mußte sie ihm die Wäsche zum Wechseln ins Büro bringen. Sie fragte: »Wer?«
»Ich erzähle es dir heute abend. Wenn ich nicht zum Abendessen kommen kann, rufe ich noch mal an.«
»Viel Glück«, wünschte seine Frau. »Und hoffentlich geht’s diesmal schnell.«
Varney hängte auf. Noch einmal steckte er Münzen in den Apparat, Scotland Yard meldete sich; er gab Bescheid, daß er in der nächsten Stunde in Milfords Speisehaus zu erreichen wäre. Als er dort eintrat, war es noch nicht zwölf, aber fast alle Tische waren besetzt. Kellner eilten mit Suppentellern, ein befrackter Herr, der Geschäftsführer vielleicht, verbeugte sich vor Varney und fragte, wie viele Plätze gewünscht würden – einer nur, bitte sehr, wenn der Herr in der Nische da Platz nehmen wolle. Varney fragte: »Wo bedient Herr Benfield?«
»Er sollte die Tische vier bis acht versorgen, da vorn am linken Fenster, ist aber leider nicht erschienen. Ich glaube, das ist in den fünf Jahren, seit er hier arbeitet, noch nicht vorgekommen. Ich habe umdisponiert.«
»Wenn er kommt, sagen Sie mir bitte Bescheid.«
»Bitte sehr, der Herr.« Das klang genauso höflich wie alles bisher, aber Varney schien es, als hätte er einen ärgerlichen Unterton herausgehört. »Die Karte bitte!«
Die Liste der Speisen war lang; es waren keine Sensationen dabei, und die Preise blieben in Grenzen. Varney verspürte nicht den geringsten Appetit, also wählte er Fisch, Seezunge in Dill mit in Butter geschwenkten Kartoffeln; das lag wenigstens nicht schwer im Magen. Während er wartete, beobachtete er die Kellner auf ihrem Weg an der Kasse vorbei zu den Tischen und zurück in einen Gang hinein; dort hatte Benfield offenbar gesessen, als hinter der Sperrholzwand von dem geplanten Mord auf der »Brisbane Star« gesprochen worden war.
Das Essen wurde serviert, und während Varney lustlos ein wenig aß, ordnete er seine Gedanken. Danach winkte er wieder den Befrackten an seinen Tisch. »Herr Benfield ist noch nicht gekommen?«
»Leider nein. Sind Sie mit ihm verabredet?«
»So halb und halb. Können Sie mir sagen, wo er wohnt?«
»Ich müßte nachschauen.« Das alles klang nicht sehr freundlich; Varney fürchtete, er würde nicht viel erfahren, wenn er nicht die Karten auf den Tisch legte. So zog er seine Marke heraus und zeigte sie einen Augenblick lang in der hohlen Hand. »Kriminalpolizei. Wo kann ich Sie ungestört sprechen?«
Der Befrackte schien nicht überrascht zu sein. »Gehen Sie bitte in zwei Minuten den Gang zu den Toiletten entlang. An der letzten Tür ganz hinten links steht: ›Kein Durchgang. Privat.‹ Ich werde Sie dort erwarten.«
Varney zahlte. Auf die Sekunde pünktlich trat er durch die bezeichnete Tür. »Mein Name ist Keats«, hörte er, »ich bin der Pächter des Restaurants.« Ehe Varney seine erste Frage stellen konnte, fuhr Keats fort: »Ich wundere mich nicht, daß Sie kommen. Ich habe schon vor einem Jahr unter der Hand gehört, daß Benfield noch ein zweites Gewerbe betreibt, einen kleinen Waffenhandel. Beweise hatte ich nicht, ein Gerücht nur – ich habe ihn trotzdem ernsthaft gewarnt. Mit meinem Lokal hat das nicht das geringste zu tun, hier hat sich nichts abgespielt. Benfield ist ein ausgezeichneter Kellner, auf ihn ist unbedingter Verlaß. Alles andere ist seine Privatsache, nicht wahr?«
»Woher wußten Sie von dem Waffenhandel?«
»Gerüchte, Getuschel unter den Kollegen, nichts weiter.«
»Und an wen verkauft er? Von wo bezieht er die Waffen?« Als keine Antwort kam: »Und warum waren Sie eine Sekunde lang ärgerlich, als ich zum ersten Mal nach Benfield fragte?«
»Ich glaubte, Sie wären einer seiner Kunden. Und ich will auf keinen Fall, daß derartige Geschäfte in meinen Räumen besprochen werden.«
»Verstehe«, sagte Varney. »Sie lassen die Sache laufen. Hauptsache, Sie selbst haben nichts damit zu tun.«
»Ich habe mich jedenfalls«, sagte Keats rasch und versuchte ein Lächeln, »in keiner Weise strafbar gemacht.«
»Das nicht. Können Sie mir sagen, wo Benfield gestern sein Abendbrot eingenommen hat?«
»Ich nehme an, an dem üblichen Platz neben der Küche.«
»Und dieser Platz ist nur durch eine Sperrholzwand vom Gastraum getrennt?«
»Na«, sagte Keats leicht gekränkt, »Sperrholz ist wohl ein wenig untertrieben.«
»Ich möchte mir die Stelle ansehen.«
Das war Keats nicht recht. Dort wäre jetzt Betrieb, er möchte jedes Aufsehen vermeiden – ließ sich die Besichtigung nicht bis zum Abend verschieben? Aber Varney bat noch einmal darum, und eine Minute später saß er auf dem Stuhl, von dem aus Benfield, wenn seine Angaben richtig waren, das Gespräch über den geplanten Mord auf der »Brisbane Star« belauscht hatte. Die Wand zum Gastraum war aus Holz, aus Sperrholz allerdings nicht. Varney hörte Gemurmel hindurch, aber sosehr er sich anstrengte, er konnte kein Wort verstehen. Er fragte: »Ist es abends ruhiger hier?«
»Ein wenig vielleicht. Aber Betrieb herrscht bei uns immer.«
»Und welcher Kellner hat gestern abend an dem Tisch bedient, der auf der anderen Seite dieser Wand steht?«
Keats überlegte einen Augenblick, dann sagte er: »Woothing. Wollen Sie ihn sprechen?«
»Wenn es möglich ist, in Ihrem Zimmer. Ich werde ihn nicht lange aufhalten.«
Woothing bestätigte zu Varneys Überraschung Benfields Angaben, soweit sie ihn betrafen, Wort für Wort. Benfield hatte ihn gefragt, wer an diesem Tisch gesessen hatte; tatsächlich waren die beiden Männer eine Minute vorher gegangen. Wie sahen sie aus? Woothing konnte nur höchst unvollkommene Angaben machen. Nicht mehr jung, einer war sehr groß gewesen. Seeleute? Wohl kaum. Wie gekleidet? Dem Kellner war nichts in Erinnerung. Sie hatten Steaks gegessen und Porter getrunken, einer hatte sich Zigaretten bringen lassen. Mehr brachte Varney nicht heraus. »Und«, fragte er, indem er sich an Keats wendete, »Sie haben Benfield gestern abend nach der Abrechnung des Vortags gefragt?«
Keats dachte nach. »Stimmt«, sagte er dann.
»War Benfield aufgeregt?«
Woothing lachte. »Da kennen Sie Mussolini schlecht. Den bringt nicht gleich etwas aus der Ruhe.«
»Mussolini?«
»Wir nennen Benfield alle so. Er sieht doch so aus, nicht wahr?«
Bevor Varney ging, fragte ihn Keats: »Wenn Sie erlauben: Ist Benfield verhaftet? Konnte er deshalb nicht kommen?«
»Ich darf es Ihnen nicht sagen«, antwortete Varney. »Aber er wird auch morgen und übermorgen nicht arbeiten können. Bitte richten Sie sich darauf ein.«
Eine Stunde später machte sich Varney im Scotland Yard mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen vertraut. Eine Frau schied als Mörder nahezu aus; nur ein kräftiger Mann konnte diesen Stich mit dem Bajonett geführt haben. Wahrscheinlich hatte Benfield am Tisch gesessen, war sich offenbar keiner Gefahr bewußt gewesen. Der Hund hatte vermutlich nach dem Stich den Mörder angegriffen und ihm eine Wunde beigebracht; es waren geringe Spuren von Blut der Gruppe AB gefunden worden, Benfield aber hatte die Blutgruppe 0 gehabt. »Ein gewisser Glücksumstand« erklärte Boston, Varneys Assistent. »Nur fünf Prozent aller Menschen in England haben die Blutgruppe AB. Das schränkt den Täterkreis erheblich ein.«
»Was sonst?«
»Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Benfield gestern abend zwischen zehn und zwölf erstochen worden. Der Mörder hat Fingerabdrücke am Griff des Bajonetts hinterlassen, aber nirgendwo sonst. Es ist merkwürdig, daß er sie an der Türklinke und anderswo abgewischt hat und ausgerechnet an der Mordwaffe nicht.«
»Gibt es sonst Fingerabdrücke?«
»An einer deutschen Maschinenpistole fanden wir einen wunderbaren Daumenabdruck einer dritten Person. Falls diese registiert ist, wissen wir in einer halben Stunde, wem der Daumen gehört.«
Waffenhandel – dieses Gebiet war für Varney neu. Wer kaufte alte Waffen, für die man nur mit Mühe, wenn überhaupt, Munition auftreiben konnte? Gangster wohl kaum. Sammler gab es für alles und jedes, warum nicht auch für Kriegsschrott?
Gegen fünf Uhr nachmittags rief Varney noch einmal seine Frau an. Er versicherte, gut und reichlich zu Mittag gegessen zu haben, und versprach, er würde sich für das Abendessen etwas aus der Kantine heraufbringen lassen. »So bald solltest du mich noch nicht erwarten. Die übliche Mühle, wie immer zum Anfang. Aber ein paar Stunden zum Schlafen komme ich auf alle Fälle.«
Die Tür wurde aufgerissen, Boston schwang einen Zettel: »Wir haben den Daumen!«
Varney las: Lawrence Patricks, dazu Straße und Hausnummer in Tottenham. Antiquitätenhändler. Vorbestraft wegen unverzollter Einfuhr von Orientteppichen. Sofort sagte Varney: »Ich fahre selbst hin. Und die Abdrücke auf dem Bajonett?«
»Bisher wurde nichts gefunden. Unsere Daktyloskopen suchen noch.«
Eine Stunde später fuhr Varney durch die bezeichnete Straße. Sie war erst vor kurzer Zeit angelegt, die Villen und Einfamilienhäuser an ihrem Rand waren neu. Varney stellte seinen Wagen hundert Yards vom Haus des Lawrence Patricks ab und schlenderte zurück. Wer hier wohnte, verdiente Geld, das sah man auf den ersten Blick: Flachbauten, breite Fenster nach dem Süden, tadelloser Rasen, hier und da ein Schwimmbecken. Von dieser Art war auch das Haus des Antiquitätenhändlers, höchstens zwei oder drei Jahre alt. An der Gartentür klingelte Varney, hörte ein Stummen und drückte sie auf. Die Haustür wurde von einem etwa fünfzigjährigen Mann geöffnet, der mit höflichem Gesicht Varneys Bitte anhörte, ihn in einer geschäftlichen Angelegenheit sprechen zu dürfen, die leider keinen Aufschub duldete. Mit einer Handbewegung, wie sie der besterzogene Butler nicht hätte verbindlicher ausführen können, lud Patricks zum Eintreten ein. »Kommen Sie auf Grund einer Empfehlung?«
»Charles Benfield nannte Ihren Namen.«
Patricks rückte an seiner goldgefaßten Brille, wiederholte den Namen, lächelte unsicher.
»Er ist Kellner in Milfords Speisehaus.«
»Mir muß der Name entfallen sein.«
»Lassen wir das Versteckspiel«, sagte Varney. »Sie haben eine alte deutsche Maschinenpistole an Benfield verkauft. Ich bin Kommissar Varney von Scotland Yard.«
Patricks war offenbar nicht der Mann, der sich leicht ins Bockshorn jagen ließ. Aus dem schmalen Vorraum, in dem sie bisher gestanden hatten, führte er Varney durch eine Flügeltür in die Diele. Das Parkett war mit einem Teppich bedeckt, der selbst Varney, der nichts davon verstand, durch seine Stärke und Größe beeindruckte. An einer Ritterrüstung vorbei watete Varney auf eine Sesselgruppe zu. Die Borde an den Wänden waren beladen mit Zinngeschirr, ein ölgemalter Auerhahn balzte über eine halbe Wand hinweg. Vor dem Kamin lag bronzenes Feuergerät, eine arg beschädigte Vase stand auf einem Sockel, sie war offenbar das Glanzstück dieser Sammlung. Varney fragte, wobei er sich auf schwankendem Boden fühlte: »Eine Amphore?«
»Erstes nachchristliches Jahrhundert.« Patricks wies auf einen Sessel, setzte sich in den anderen. »Ich bin zu jeder Auskunft bereit.«
Varney nahm ein Bild Benfields, das Boston aus dessen Zimmer mitgenommen hatte, aus der Brieftasche und hielt es Patricks hin. »Kennen Sie ihn?«
»Natürlich, ein guter Kunde. Mir hat er sich allerdings als Aldings vorgestellt. An ihn habe ich in der Tat vor einigen Tagen eine alte deutsche MPi verkauft.«
»Und wo waren Sie gestern abend?«
»Die Kirchgemeinde, der ich angehöre, veranstaltete eine Orgelvesper. Ich war mit meiner Frau dort.«
»Wie lange?«
»Bis gehen zehn.«
»Und dann?«
»Bin ich mit meiner Frau nach Hause gegangen. Und anschließend ins Bett.«
»Welche Blutgruppe haben Sie?«
Nach dieser Frage zeigte Patricks doch ein wenig Erstaunen und Unruhe. Er zuckte die Schultern.
»Herr Patricks«, sagte Varney, »es ist gestern abend ein Verbrechen geschehen. Sie würden sehr zur Aufklärung beitragen, wenn Sie mir gestatten würden, Ihre Blutgruppe festzustellen. Ich darf Ihr Einverständnis voraussetzen?«
»Selbstverständlich«, sagte Patricks. »Wie macht man das?«
»Ich werde einen meiner Mitarbeiter hierher bitten. Darf ich telefonieren?« Nachdem das geschehen war, fragte Varney: »Wie lange kennen Sie Benfield?«
Patricks konnte sich nicht festlegen. Fünf Jahre? Sieben? Zuerst hatte Benfield alias Aldings ihm allerhand Ramsch aus südamerikanischen Arsenalen angeboten. Das war die Zeit, in der Argentinien und Brasilien umrüsteten und sich mit billiger Ware aus dem Zweiten Weltkrieg eindeckten. »Damals nahm Englands größter privater Waffenhändler, Arthur Cecil Jackson, einen beachtlichen Posten romantisch aussehender Pistolen und Gewehre in Zahlung. Ich weiß nicht, ob der Mann, dessen Bild Sie mir zeigten, ein Handlanger von Jackson war, ich vermute es nur.« Patricks berichtete in einer sachlichen, durchdachten Art, fast ohne Gesten. Nur manchmal, wenn er nachdachte, rückte er die Brille zurecht. »Wie nennen Sie ihn? Benfield, gut. Ich halte ihn für einen der vielen Waffennarren, die uns der Krieg hinterlassen hat, es gibt da diesen maskulinen Trieb, sich Karabiner und Helm und Pistole an die Wand zu hängen. Beispielsweise diese deutsche MPi: Ich bin sicher, daß Benfield sie mit gutem Gewinn einem Mann weiterverkauft, der dann behauptet, er hätte sie bei Monte Cassino einem der grünen Teufel eigenhändig in blutigem Nahkampf entrissen.« Patricks hob eine Hand und ließ sie fallen. »Ich sollte nicht darüber spotten, schließlich verdiene ich dabei.«
»Und dieser Handel ist gestattet?«
»Wenn die Waffe ein gewisses Alter erreicht hat, technisch überholt ist und die Annahme berechtigt erscheint, daß sie nirgends in der Welt einen militärischen Wert besitzt, interessiert sich der Staat nicht mehr dafür. Bis dahin ist jede Waffe registriert, ihre Ausfuhr wird vom Staat nur in solche Länder gestattet, die von der NATO nicht als Unruheherd bezeichnet werden.«
»Und die Gemeinde der Waffensammler ist groß?«
»Bei uns nicht sonderlich. In den USA allerdings geht sie in die Millionen. Cummings, der zur Zeit größte Waffenhändler der Welt, unterhält in Virginia acht Lagerhäuser mit eigenem Schiffsliegeplatz und Gleisanschlüssen. Man sagt, daß darin beispielsweise so viele Waffen lagern, daß man je eine deutsche und eine russische Infanteriedivision nach dem Muster des Zweiten Weltkrieges ausrüsten könne. Von dort werden die süd- und mittelamerikanischen Staaten beliefert; im Augenblick ist die Bewaffnung der Farmer in Angola das größte Geschäft. Und alles, was nicht mehr zu brauchen ist, gibt Cummings an die Sammler ab. Wollen Sie einen Katalog der Interarmco sehen?« Er ging ins Nebenzimmer, kam gleich darauf mit einem Heft zurück. Varney blätterte, las:
»Das phantastischste Angebot ausgewählter Waffen, die schönsten Sammlerperlen des Dezenniums: echte russische halbautomatische Tokarew-Gewehre (Modell 1938), der Schrecken des Ostens, gebändigt für den Gebrauch des Westens. – Der Stolz der Hitlerwehrmacht von Narvik bis Tobruk, von Calais bis Stalingrad, unverfälschtes Modell 98 Mauser, komplett und zum attraktivsten Preis, der je verlangt wurde: 27,95 Dollar.«
»Und«, fragte Varney, »welche Rolle spielte Benfield in diesem Geschäft?«
»Eine geringe, soweit ich das beurteilen kann. Er sagte mir einmal, er wäre im Kriege Waffenmeister bei den Fallschirmjägern gewesen und hätte dabei auch viel mit Beutewaffen zu tun gehabt. Daher seine Kenntnisse und seine Vorliebe. Ich habe Anlaß zu der Vermutung, daß Benfield einer der Mittelsmänner von Pistolen-Frantje ist. So nennen wir den Waffenantiquar Haagins aus Amsterdam. Nur was Benfield nicht von dort bekommen kann, bezieht er von mir, und manchmal setzt er auch etwas bei mir ab. Aber das kommt selten vor. Und immer nur Einzelstücke.«
»Auf welche Weise transportiert er die Waffen?«
»Er maskiert sie als Angelgerät. Er besitzt ein langes Futteral, meist läßt er zur Tarnung ein Stück Rute oben herausschauen.«
»Wissen Sie, ob er Feinde hat?«
»Ich kenne keine, aber in dieser Branche wird nicht immer mit Glacéhandschuhen gearbeitet. Mir wird niemand an den Wagen fahren, ich betreibe dieses Geschäft ja nur nebenbei und in ganz bescheidenem Rahmen.«
»Sie handeln meist mit Teppichen, nicht wahr?«
Ein ärgerlicher Seitenblick traf Varney. »Auch mit Möbeln, Geschirr, Zinn. In der letzten Zeit waren Petroleumlampen der Schlager. Aber wer im Großen mit Waffen handelt, ist seines Lebens nicht sicher. Georg Puchert beispielsweise, einer der Hauptlieferanten der Algerier, wurde in Frankfurt am Main durch eine Bombe getötet, vermutlich durch Agenten der ›Roten Hand‹.«
Es wurde geläutet, einer von Varneys Leuten kam für einige Minuten herein, zapfte dem Antiquar einige Blutströpfchen aus dem Ohr. »Und«, fragte Varney, »Sie wissen nicht, mit wem Benfield noch in Geschäftsbeziehungen steht?«
»Wenn Sie wollen, kann ich die Ohren offenhalten. Leichter wäre das allerdings für mich, wenn Sie mir sagen wollten, welcher Art das gestern begangene Verbrechen ist.«
»Sie werden es morgen in der Zeitung lesen.« Varney verabschiedete sich und fuhr zurück in sein Büro. Noch an diesem Abend wurde ihm mitgeteilt, daß Patricks die Blutgruppe B besaß, als Täter also nicht in Frage kam. Varney gab einige Anweisungen für den nächsten Tag: Die Vermögensverhältnisse von Benfield sollten untersucht werden, man mußte feststellen, welche Blutgruppe Crow besaß. Nachfragen in den Turnierangelklubs von London, Vernehmung aller Kollegen von Benfield, der übrigen Hausbewohner – es war nicht allzuviel, was man jetzt tun konnte. Alles Weitere würde er mit Sheperdson, seinem Chef, besprechen müssen.
Es war spät, als Varney nach Hause kam. Während er unter der Brause stand, fiel ihm ein, daß noch nichts unternommen worden war, um herauszufinden, woher der Hund stammte. Als er ins Schlafzimmer schlich, knipste seine Frau das Licht an. »Sie haben einen Kellner umgebracht«, sagte er. »Weck mich bitte zeitig. Sechs Uhr?«
»Gut. Und nun schlaf schnell.«
Varney schlief nach wenigen Minuten ein, wurde wach, als er die Hand seiner Frau an der Schulter spürte. Er wußte augenblicklich, was ihm an diesem Tag bevorstand, und wünschte, er hätte endlich einmal einen Schritt unternommen, um aus der Mühle des Morddezernats herauszukommen. Seine Frau hatte das Frühstück in der Küche gerichtet, er trank Tee mit Sahne, wie er es am Morgen liebte, aß Weißbrot und Ei und Honig. »Ein Kellner mit einem Bajonett im Rücken«, sagte er, »ein toter Hund unter dem Bett, ein bißchen Blut und ein paar Fingerabdrücke.«
»Am ersten Tag«, sagte sie, »darfst du nicht zuviel verlangen. Soll ich dir etwas zu essen mitgeben?«
»Du solltest unsere Kantine nicht unterschätzen. Sie liefert mir, wenn ich will, Filetsteak mit Pommes frites und Champignons auf den Schreibtisch.«
»Hoffentlich denkst du im Laufe des Tages noch einmal daran.«
In Varneys Büro lag eine enttäuschende Meldung: Die Daktyloskopie-Kartei teilte mit, daß die Fingerspuren auf dem Bajonettgriff im Moment nicht weiterhalfen; ihr Träger war nicht registriert, und von Crow stammten sie nicht. Um eine Hoffnung ärmer begab sich Varney zur Berichterstattung zu seinem Chef. Inspektor Sheperdson stand am Fenster und schaute hinaus auf das Dächergewirr und den sich langsam erhellenden Himmel; er drehte sich rasch um, als Varney hereintrat, und setzte ein so freudig-überraschtes Lächeln auf, als hätte er nicht im mindesten mit gerade diesem Besucher gerechnet und erhoffte sich von ihm ein besonderes Vergnügen. Über die Munterkeit seines Chefs ärgerte sich Varney ein wenig: Es war nicht notwendig, ihm vorzuspielen, ein wie geruhsames Wochenende hinter Sheperdson lag und mit welch frischen Nerven er die neue Arbeitswoche begann. Aber so war Sheperdson immer: Er sah aus, als käme er gerade vom Friseur, eine Puderspur schimmerte noch auf seinen Wangen, alles an ihm war korrekt: der dunkle Anzug, das weiße Hemd, die silbergraue Krawatte. Mit leiser, artikulierender Stimme wünschte er einen guten Morgen, bat um Aufklärung über den Fall Benfield. Niemals nahm sich Varney so zusammen, als wenn er seinem Chef berichtete. Im Inneren und seiner Frau gegenüber spottete er gern über Sheperdson, den Schauspieler, den alten Galan, aber er war doch von großem Respekt gegenüber dessen Wissen und Kombinationsfähigkeit erfüllt. Varney breitete aus, was bisher bekannt war, bemühte sich, Wiederholungen zu vermeiden, Möglichkeiten anzudeuten, erste Kettenglieder ineinanderzufügen. Varney hatte von Sheperdson gelernt, daß die Darstellung eines in der Schwebe befindlichen Ermittlungsergebnisses ein Kunstwerk sein konnte, und bemühte sich, es seinem Lehrmeister in etwa gleichzutun. »Vielleicht«, sagte er zum Abschluß, »stammen die Fingerabdrücke auf dem Bajonettgriff und die Blutspuren von demselben Mann, vielleicht auch nicht. Wir müssen mit beidem rechnen.«
Sheperdson spielte mit seinem goldenen Kugelschreiber, hielt die Augen unter den glatten weißen Brauen unverwandt auf Varney gerichtet. Seine erste Frage war: »Was ist die ›Brisbane Star‹ für ein Schiff? Gibt es sie überhaupt?«
»Nach unseren ersten Erkundigungen ist sie ein knapp siebentausend Tonnen großer kombinierter Fracht- und Passagierdampfer. Er befördert Stückgut nach den kleineren und mittleren Häfen der Guineaküste und nimmt sechzehn Passagiere mit, die das Geld und vor allem die Zeit haben, sich eine derartig gemächliche Reise zu leisten. In der Tat: Das Schiff fährt morgen von Southampton ab.«
»Kennen Sie die Passagierliste?«
»Ich bekomme sie noch heute morgen.«
»Was kombinieren Sie nach den bisherigen Ergebnissen?«
Varney zögerte einen Augenblick. Er wußte, daß besonders in diesem Punkt von Sheperdson hohe Ansprüche gestellt wurden, und er war sich trotz langjähriger Zusammenarbeit bis zur Stunde noch nicht klar, wo nach Sheperdsons Auffassung der anzustrebende Mittelweg zwischen Fakten und Phantasie lag. Ohne Phantasie kam nach Sheperdsons Ansicht kein Kriminalist aus, aber wo schlug sie in Phantasterei um? »Es gibt folgende Möglichkeit: Benfield ist Mitwisser eines geplanten Verbrechens geworden und wurde deshalb aus dem Wege geräumt. Allerdings: Woher wußten die Männer, die sich über den Mord unterhielten, daß Benfield ihr Gespräch gehört hatte? Noch ein Einwand: Ich bezweifle, daß Benfield durch diese Bretterwand überhaupt etwas verstanden haben kann, Also: Benfield wußte von anderer Seite her, daß ein Verbrechen auf der ›Brisbane Star‹ beabsichtigt ist, und wollte zu dessen Verhinderung beitragen. Er fürchtete aber, der Polizei mitzuteilen, woher seine Kenntnisse stammten. Also hat er sie aus unsauberen Quellen. Aus dem Waffengeschäft? Es könnte sein. Alles, was wir bisher ermittelten, ist anzweifelbar. Aber auf eine kritische Frage finde ich keine Antwort: Warum sollte Benfield unser Augenmerk auf die ›Brisbane Star‹ lenken, wenn dort nicht wirklich etwas geschehen soll? Eines ist jedenfalls sicher: Ein Mann, dessen Schrank voller Gewehre steckt, geht nicht ohne triftigen Grund zur Polizei.«
»Das läßt sich hören«, sagte Sheperdson. »Wir können in die Irre gehen, aber wir können auch die einzig richtige Spur finden, wenn wir auf der ›Brisbane Star‹ weitersuchen. Ein Mann von Scotland Yard muß mitfahren. An wen haben Sie gedacht?«
»Das möchte ich erst heute mittag vorschlagen.«
»Ich bin jederzeit für Sie zu sprechen.«
Als Varney in sein Zimmer zurückkam, teilte ihm seine Sekretärin mit, der Privatdetektiv Pat Oakins säße im Vorzimer und bäte um eine Unterredung. »Ich habe keine Zeit«, entschied Varney, »ich habe auch in den nächsten Tagen keine Zeit. Schicken Sie ihn weg.« Das fehlte noch, daß er sich jetzt mit diesem Dreikäsehoch abgab, der höchstwahrscheinlich wieder auf dem trockenen saß und einen Auftrag erbetteln wollte!
Boston wartete mit einer Neuigkeit auf. »Ich habe noch einmal die Fingerabdrücke auf dem Bajonettgriff betrachtet.« Er nahm ein Lineal und demonstrierte: »Hier liegt der Daumen in der ganzen Länge an, hier haben die oberen Glieder des Zeige- und des Mittelfingers den Griff berührt, hier der Ringfinger mit der Kuppe. Vom kleinen Finger fehlt jede Spur.«
»Schließen Sie daraus, daß der Mörder keinen kleinen Finger hat?«
»Ganz und gar nicht. Mir scheint vielmehr, daß man kein Bajonett so anpackt, wenn man mit ganzer Kraft zustechen will. So faßt man vielleicht einen Kugelschreiber an oder einen Tischtennisschläger. Vom Stich selbst stammen diese Abdrücke jedenfalls nicht.«
Varney ließ sich das Lineal geben und probierte selbst. »Sie haben recht«, sagte er dann. »Wir müssen also berücksichtigen: Die Fingerabdrücke brauchen nicht vom Mörder zu stammen. Die richtigen Abdrücke sind vielleicht abgewischt worden, danach hat noch einmal jemand das Bajonett angefaßt. Aber welcher Unglücksrabe sollte das sein, welcher Dummkopf riskiert so was? Die Geschichte wird immer vertrackter.«
»Noch eine Enttäuschung«, sagte Boston, »niemand in der Familie Crow hat die Blutgruppe AB