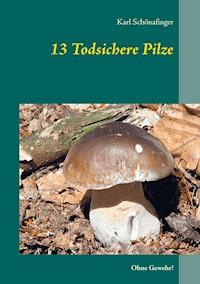Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor ist das neunte von zwölf Kindern und beschreibt hier seine Kindheit, die er in einer armen Familie in einem südtiroler Bergdorf erlebt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich
meiner Frau,
der ich für wertvolle Hinweise danke,
meinen Kindern,
denen ich meine Kinderzeit etwas näher bringen möchte,
meinen Eltern und Geschwistern,
die manche Begebenheit in einem anderen Licht sehen
oder anders empfunden haben mögen
und
all den Menschen,
die sich in schwierigen Zeiten mit Idealismus
für den Erhalt unserer schönen Tiroler Heimat
eingesetzt haben.
Inhaltsverzeichnis:
Vor der Volksschulzeit
Volksschulzeit
Beim Remp
Nachbarn und Verwandte
Auf dem Winterlehof
Schülerheim und Gymnasium
Schlussbemerkung
1. Vor der Volksschulzeit
Am 19. Februar 1949, um 5 Uhr morgens, wurde ich daheim im Bett meiner Mutter geboren, wo ich unter der Mithilfe einer Hebamme als schwerer Brocken von 4,5 kg das Licht der Welt erblickte. Es war nun ein interessanter Zufall, dass, nur ein Stockwerk höher, am selben Tag und im selben Haus, noch ein Junge zur Welt kam: Angelo, der Sohn unserer Untermieter aus Bozen. Dieser Familie standen damals bei uns ein Zimmer, die Küche und die Toilette des 2. OG im obersten Stockwerk unseres Hauses zur Verfügung. Zwei weitere kleine Zimmer auf diesem Stockwerk wurden für unsere eigene Familie benötigt, die eine Etage tiefer ihren Hauptsitz hatte und mit mir nun immerhin schon auf die stattliche Zahl von 11 Personen angewachsen war. Drei weitere Geschwister sollten noch folgen. Damit wurde die Schar der Kinder auf die Zahl der Jünger Jesu, nämlich auf 12, angehoben. Mit ihrem Kinderreichtum befand sich unsere Mutter in guter Gesellschaft mit ihren beiden Schwestern. Von diesen hatte die Älteste ebenfalls 12 und die Mittlere sogar 13 Kinder. Mein Onkel, der ältere Bruder unseres Vaters, brachte es hingegen „nur“ auf 10 Nachkommen.
Mein Vater hatte in jenen Jahren nach dem Ende des 2. Weltkriegs wohl recht gut mit dem Holzhandel verdienen können und es fertig gebracht, auf dem von meiner Mutter geerbten, kleinen Hanggrundstück neben der Ernährung des bereits siebenköpfigen Nachwuchses ein für die damaligen Verhältnisse relativ stattliches Wohnhaus zu erbauen. Es wurde fast gleichzeitig mit der Geburt meiner um zwei Jahre älteren Schwester Lina im Jahre 1947 fertig gestellt und bezogen. Stolz ließ mein Vater vom Maler „Villa Waldrast“ in schönen Lettern unter die in der Mauer eingelassene Jesusstatue gut sichtbar auf die vordere Hausseite schreiben.
Vorher hatte meine Familie in einem Haus am westlichen Ortsrand Jenesiens zur Miete gewohnt. Es stand damals direkt am Rand der „Wiedenäcker“ (Widumsäcker), auf denen in den achtziger Jahren die erste Volkswohnbausiedlung errichtet und später, westlich anschließend daran, die meines Erachtens optisch nicht gut gelungene Neubausiedlung des Dorfes entstand, die heute Jenesien ein wenig wie einen Vorort Bozens aussehen lässt. Gegen Ende des Krieges, als alliierte Bomber häufiger den Bozner Bahnhof mit Bomben zerstören und damit der deutschen Wehrmacht den Rückzug aus der Apenninenhalbinsel abschneiden wollten, wurde die Familie des Öfteren vom heulenden Sirenenalarm aufgefordert, den Luftschutzkeller im „Lindnerloch“ aufzusuchen. Das war für meine Mutter ein beschwerlicher Weg. Die Kinder mit den Geburtsjahren 1936 (Alois), 1937 (Filomena), 1938 (Maria), 1940 (Eduard), 1941 (Anna), 1943 (Johann) und 1944 (Friedrich) waren noch nicht alle kräftig genug, den beschwerlichen Ab- und Aufstieg in die tiefe Schlucht zu meistern und, zumindest die kleineren, mussten getragen werden. Sie versuchte deshalb, wenn möglich, diese Mühsal zu vermeiden und den Alarm zu ignorieren. Der strenge Ortsgruppenleiter aber und vor allem mein Vater, der vor den Kampfflugzeugen und Bombern einen übergroßen Respekt hatte, bestanden darauf, dass sie den tief unter dem Dorf im Wald, im „Mühlleitbach“, befindlichen Luftschutz aufsuchten.
Eine Abkürzung ging mitten durch den Lindneracker hinter dem Dorfschmied. Einmal war dort gerade frischer Stallmist ausgebracht worden, als die Mutter mit den Kindern, eines davon im Arm, wieder zum Luftschutzkeller rannte. Sie musste sich von Zeit zu Zeit umdrehen, um sicher zu sein, dass die Kleinen nachkommen. Dabei stolperte sie über einen der Haufen und fiel samt Kind in den frischen Mist. Zur Hebung der Moral hat dieser Vorfall, wie man sich denken kann, auch nicht beigetragen.
Auf Jenesien fiel jedoch keine einzige Bombe im Kriegsverlauf. Warum auch? Dafür hatten gegen Ende des Krieges umso mehr den Bozner Bahnhof zum Ziel. Offensichtlich aber war er im tiefen Talkessel am Zusammenfluss von Talfer und Eisack nur schwer zu treffen. Die Bozner Altstadt sollte wohl geschont werden und so schlugen die Bomben meist auf den dicht dahinter gelegenen, Jenesien gegenüberliegenden, Berghang, dem Fuß des Kohlernbergs auf. Die Feuererscheinung bei der Explosion und der deutlich verzögert in Jenesien oben ankommende, laute Knall waren ein Schauspiel, das meine zwei ältesten Brüder gerne vom Balkon aus beobachteten, wenn es der Mutter mal gelungen war, den Gang zum Luftschutzkeller zu schwänzen. Ein besonders interessanter Anblick waren wohl auch die nach jedem Abwurf aufflackernden Waldbrände an diesen von Jenesien aus gut einzusehenden Waldhängen.
Gegen diese Bombeneinsätze kamen die rings um Bozen herum, auf den Bergen stationierten Flakgeschütze zum Einsatz. Wie mir mein ältester Bruder Luis erzählte, trafen sie aber wohl nur einmal einen Bomber, dessen Pilot sich dann mit einem Fallschirmsprung aus dem taumelnden Flugzeug retten konnte. Er landete schließlich im Lindnerloch, etwas nördlich des Luftschutzkellers, und sein Schirm blieb in den Bäumen hängen. Suchtrupps fanden ihn wenig später unter der Holzbrücke sitzend, die über den Mühlleitbach zum östlichen Teil Jenesiens führte, den man Enderbach nennt. Er wartete förmlich darauf, dass man ihn abführte.
Ein Flugzeug allerdings wäre meiner Familie beinahe zum Verhängnis geworden. Es ist nicht ganz klar, ob es sich dabei um ein von den unweit von Jenesien auf dem Altenberg und auf dem Salten stationierten Flaks angeschossenes, feindliches oder ein deutsches Flugzeug handelte, das einen Motorschaden hatte. Jedenfalls zog es am Himmel eine Rauchwolke hinter sich her und war offensichtlich manövrierunfähig, als es bedrohlich erst über dem Kreuzweger Weiher eine Kurve drehte und dann schräg am Kirchturm vorbei auf das Dach des Hauses zu trudelte, in dem meine Familie wohnte. Glücklicher Weise flog es dann aber knapp über das Dach hinweg und schlug nur etwa gute fünfzig Meter dahinter auf dem „Wiedenacker“ auf und zerschellte. Sofort brannte das Wrack und der über den Hang herunterfließende Treibstoff speiste eine lange, lodernde Flamme bedrohlich knapp hinter dem Haus. Mein Vater und mein ältester Bruder Luis mussten dieses schaurige Ereignis vom gegenüberliegenden Waldhang am Altenberg unterhalb der Flak aus beobachten, wo sie gerade bei der Holzarbeit waren. Schnell versteckte der Vater Säge, Axt und Beil unter abgeschlagenen Baumzweigen und sie eilten heim. Die Ungewissheit und Sorge um das Befinden ihrer Lieben beflügelten ihre Schritte. Als sie endlich ankamen, war der Löschvorgang der Feuerwehr bereits beendet. Da die wackeren Freiwilligen die Flammen, die der auslaufende Treibstoffs genährt hatte, nicht zu löschen imstande gewesen waren, hatten sie sich darauf beschränkt, ein Übergreifen des Feuers auf das Haus und den im Garten stehenden Schuppen zu verhindern. Dem Vater blieb nur noch, dem Herrgott für das Glück im Unglück und den durstigen Löschern zu danken und sie zu einem Glas aus seinem im kühlen Keller stehenden Rotweinfass einzuladen.
Jahre später haben wir Buben die noch gut erkennbare, etwas vertiefte und nicht vollends wieder mit Gras zugewachsene Stelle in der Wiese aufgesucht, an der das Flugzeug aufgeprallt war. Wir suchten und fanden auch kleine, rundgeschmolzene Metallteile des Wracks, die wir als wertvolle Funde sammelten und malten uns aus, was in dieser, selbst Metalle schmelzenden Hitze wohl von der Leiche des armen Piloten übriggeblieben sein mag.
Der Keller des neu erbauten Hauses, der „Villa Waldrast“, bestand aus vier Räumen, von denen einer der Aufbewahrung von Speck, Sauerkraut, Kartoffeln und des Weinfasses diente. Ein weiterer Kellerraum wurde vom Vater zum Viehstall umfunktioniert, im dritten stand das Werkzeugregal und Gartengeräte. Er wurde beim Schweineschlachten zum Aufhängen der toten Tiere und deren Zerteilung genutzt. Der Vierte war als Waschküche gedacht, diente aber auch als Heulager und Durchgang zu den anderen Räumen. An der Südostseite des Hauses befand sich eine mit einem Bretterverschlag abgedeckte Jauchegrube, in der sich die Fallrohre der drei Toiletten trafen, die damals aus einem mit einem Holzdeckel verschlossenen Loch in einem Sitzbrett bestanden und natürlich noch keine Wasserspülung besaßen. Den wertvollen Dünger humanen Ursprungs wollte mein Vater auf keinem Fall an eine Klärgrube und anschließend an den Dorfbach vergeuden, sondern im Winter als Dünger auf dem Gemüsegarten ausbringen, ein Unternehmen, das aber später aufgegeben wurde. Vermutlich war die Geruchsbelästigung doch zu unerträglich. Als ich später als Studierender in München zum ersten Mal das Lied vom Hintertupfer Bene hörte, der beim Fensterln vom eifersüchtigen Girgl von der Leiter in die Jauchegrube gestoßen wird, habe ich mir stets das Bild der eigenen, grausigen, übel riechenden Odelgrube als unfreiwilliges Bad des armen Bene ausgemalt.
Aus dem steilen, unfruchtbaren Hang machte der Vater mit dem Bau einer mir riesig erschienenen Natursteinmauer zur unterhalb verlaufenden Straße hin und dem Heranschaffen von Mutterboden aus einem etwa fünfhundert Meter entfernten Waldstück, dem „Haflingerwaldele“, einen großen, relativ flachen Gemüsegarten. Bei diesen Erdbewegungen wurde, was in meinem Heimatdorf Jenesien damals eine Sensation war, ein motorisiertes Dreiradvehikel eingesetzt, das der Taler Peppi, ein Bruder des damals bereits verstorbenen alten Wirtes vom Gasthof Schönblick, auf irgend eine Art und Weise über den engen und steilen, sonst nur mühevoll von Pferde- und Ochsenkarren nutzbaren Weg von Bozen in unser Bergdorf gebracht hatte. Die Erde wurde vom Dreirad aus auf einen Haufen gekippt, von dem aus zwei Männer sie mit Schaufeln durch ein schräg stehendes, auf einen Holzrahmen gespanntes Metallgitter warfen, wobei die Steine ab einer bestimmten Größe nicht mehr durch passten, nach vorne herunter fielen und abgetrennt wurden. Sie wurden als grober Schotter zum Hinterfüllen der Natursteinmauern verwendet und waren somit nicht mehr bei den späteren Arbeiten im Gemüsegartens hinderlich.
Die „Villa“ Waldrast etwa um 1962. Im Vordergrund ein Pferdefuhrwerk auf dem Weg, der von Jenesien nach Bozen führt, die Stützmauern und der Gemüsegarten mit dem bereits etwas ramponierten Zaun, im Hintergrund der Latemar, ein südlicher Gipfel der Dolomiten.
Kurz darauf wurden weitere, etwas kleinere Stützmauern vom Huberseppl errichtet, um das Gelände oberhalb des Gartens, zum Hang hin zu befestigen. Seine Arbeiten interessierten mich immer sehr, wie er die Natursteine ansah, drehte, mal eine Ecke mit einem Steinschlegel weg schlug, mal schimpfend einen Stein nicht verwendete und schließlich einen passenden Felsbrocken wie ein Puzzleteil in die anwachsende Mauer setzte. Bei diesen Beobachtungen saß ich, meiner Erinnerung nach, häufig auf einem Stein unweit vom Geschehen, aber weit genug entfernt, um nicht von Steinsplittern, die manchmal beim Behauen der Natursteine wegspritzten, getroffen zu werden. Und, während ich so dem Huberseppl zusah, begann ich mit dem autodidaktischen Erlernen des Pfeifens. Das tat ich offensichtlich mit großer Hingabe und Ausdauer, denn meine Übungen gingen dem Seppl schon nach kurzer Anlernphase auf den Geist und er rief erzürnt: „Jetzt här a mal au!“ Doch nach einiger Zeit vergaß ich wohl, wie meine Übungen beim Seppl angekommen waren oder das Vorankommen bei den Pfeiffertigkeiten war mir doch zu wichtig, denn alle großen Buben konnten pfeifen, und so begann das Spiel von vorne. „Jetz här a mal au!“ oder „Härsche net ball au!“ (Hörst du nicht bald auf!) Meinen Geschwistern und meiner Mutter blieben diese Szenen nicht verborgen und sie amüsierten sich über die geduldigen, eintönigen Aufhörbefehle unseres Maurers.
Dieser war ohnedies ein etwas sonderlicher Kauz, geistig etwas einfacher gestrickt und von den Dorfbewohnern nicht ganz ernst genommen. So mischte er sich, wenn wir Kinder im Winter zum Rodeln loszogen, unter unsere Schar, und stürzte mit uns die Hänge hinunter und später, als man von den Italienern gelernt hatte, wie man sich in der Sommerhitze mit einem Eis Kühlung in den oberen Verdauungswegen verschaffen konnte, fand man ihn häufig an einem Speiseeis schleckend auf Gasthausterrassen sitzen. Andere Erwachsene hätten sich dabei noch geschämt. Auch hatte er, wenn er bei anderen Leuten Maurerarbeiten durchführte oder den Gemüsegarten umstach, ganz feste Vorstellungen von dem, was für ihn zu den Mahlzeiten aufgetischt werden sollte: Kaffee mit harten Bauernbrotbrocken zum Einweichen als Frühstück und zur Halbmittag, um 9:00 Uhr, sollten es gekochte Kartoffeln mit Südtiroler Speck, ruhig ein bisschen fett, sein, und nicht Käse, wie er sagte, den sollte man sich lieber für den Freitag aufheben. Zum Mittagessen, um 12:00 Uhr, mussten es Speckknödel in nicht geringer Zahl mit Salat, nachmittags, zur Marende, um 16:00 Uhr, wieder Kaffee mit harten Bauernbrotbrocken sein und abends nach der obligatorischen Gerstensuppe, die geschmacklich meistens mit noch verwertbaren Überbleibseln vom Speck, wie Schwarten oder besonders fetten, manchmal aber auch schon ranzigen Teilen, aufgebessert wurde, erwartete er Bratkartoffel. Wurden ihm alternative Gerichte angeboten, dann drohte er, am nächsten Tag nicht mehr wieder zu kommen. „Morgen kimm i nimmer! Bei dehm (diesem) Essen, semm (dann) kann von mir aus ein anderer weitermauern!“ waren seine beleidigten Worte.
In der Waschküche unseres Hauses wurden damals hin und wieder Hühner geschlachtet. Meine Mutter liebt Hühner über alles und so bestand sie darauf, dass ihr an der Ostseite unseres Hauses ein Hühnerstall mit eingezäuntem Auslauf für das Federvieh gebaut wurde. Zu wertvoll waren für uns die Eier, die wir täglich aus den Nestern holen konnten und die für viele leckere Speisen benötigt und so nicht erst gekauft werden mussten. Aus der Schar der Hühner landete dann so manche Henne, wenn sie, in die Jahre gekommen, nicht mehr genügend Eier legte, auf dem Hackklotz in dieser Waschküche, wo sie mit einem Beil enthauptet wurde, um anschließend als Suppenhuhn die letzte Verwertung zu finden. Das war natürlich ein Schauspiel, das nicht ohne Aufsehen und Lärm abging und das ich mir nicht entgehen lassen wollte. Manchmal verhielt sich das Huhn ganz ruhig, wenn es, an den Beinen festgehalten, mit dem Hals auf den Hackklotz gelegt wurde. Eines meiner älteren Geschwister konnte dann die Henkersaufgabe in Ruhe durchführen. Manchmal aber kam es zu verzweifelten Fluchtversuchen der Tiere, die sich, wild mit den Flügeln schlagend, befreiten und in der Waschküche dann nicht mehr so leicht und ohne viel Lärm und Aufwand eingefangen werden konnten. Auch wenn aber der Kopf bereits abgetrennt war, gaben die Hühner noch lange keine Ruhe. Sie wurden im Gegenteil erst richtig munter, schlugen mit den Flügeln, sprangen wild schlagend in der Waschküche herum, und das Blut aus ihrem Hals spritzte nur so durch die Luft, während der abgetrennte Kopf, am Boden liegend, den Eindruck erweckte, als sehe er dem Treiben seines eigenen Körpers teilnahmslos zu. Als das geköpfte Tier dann endlich nach ein paar Minuten kraftlos da lag, wurde es gleich der Federn entledigt, weil das Rupfen bei noch warmem Körper wesentlich leichter durchzuführen ist. Der Anblick einer dieser teilentfederten Hennen zwang mir damals die Frage auf: „Kannt men net die Hi-ehner beizeiten, beizeiten, nacket menander lafn lassn?“ (Könnte man nicht die Hühner hin und wieder nackig herumlaufen lassen?) Diese Frage war von mir damals ernst gemeint. Sie drängte sich mir wohl auch irgendwie im Zusammenhang mit den Badevorgängen auf, die meine Mutter mit den kleinen Schwestern in der warmen Küche veranstaltete, bei der diese, nachdem sie aus der Badeschüssel gehoben und mit dem Handtuch trocken gerieben worden waren, kurz pudelnackig herumlaufen durften, was sie jedes Mal mit einer gewissen Freude wahrnahmen. Aber diese Idee mit den nackten Hühnern und vor allem wohl die von mir gewählte Formulierung klangen für meine älteren Geschwister und die Eltern recht lustig. So wurde meine „Idee“ des Öfteren am gemeinsamen Essenstisch mit viel Gelächter zitiert.
Die Küche war der zentrale Punkt allen Geschehens im Haus, gleichzeitig Kinderzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Waschraum und Arbeitszimmer. Sie hatte eine stattliche Größe und war vor allem der einzige Raum, der durch den Betrieb des Holzherdes beheizt war. Nach Eintritt durch die Tür ging man am etwa zweieinhalb Meter langen Holztisch vorbei direkt auf das Waschbecken zu, in dem nicht nur das Geschirr gewaschen sondern an dem, da es neben dem Wasserhahn in der Waschküche im Keller die einzige Möglichkeit darstellte, an Wasser zu gelangen, auch sämtliche Körperreinigungen vorgenommen wurden, die man damals für nötig erachtete. Links davon stand unter dem Fenster die Holztruhe, in der sich neben dem Brennholz auch einige Kienspäne zum Feuermachen befanden. Daraus wurde der große Holzherd, der die ganze linke, hintere Ecke der Küche ausfüllte, befeuert. Auf ihm konnten die verschiedensten Größen an Töpfen und Pfannen zum Kochen verwendet werden, indem die passende Anzahl an gusseisernen Ringen mit dem „Kochhakel“, einer vorne krumm gebogenen Eisenstange, herausgehoben wurde. Dabei entstand ein Loch in der Herdplatte, in das das Kochgefäß gestellt und so dem direkt darunter lodernden Feuer ausgesetzt wurde. Die heißen Abgasleitungen wurden um ein kupfernes, etwa 10 Liter großes Wasserbehältnis, das „Wandel“, geführt, sodass daraus das warme Wasser für das Waschen der Hände, des Gesichts, vor allem aber der abends erschöpften Füße entnommen werden konnte. Wenn man sich dann im Gegenuhrzeigersinn weiterdrehte, sah man ein in der Wand eingebautes Regal, das der Aufbewahrung des Essgeschirrs und des Bestecks diente. In diese Wand war außerdem noch eine mit einer Stahltür verschlossene Öffnung in Bodennähe eingelassen, die zum Befeuern des in der gegenüberliegenden, selten genutzten Stube stehenden Lehmofens diente. Dann folgte die Eckbank und oben in der Ecke hinterm Tisch das Kreuz, zu dem wir bei jedem Tischgebet vor und nach dem Essen aufschauten und beteten. Hinter der Eingangstür hing auf der linken Seite an der Wand ein kleines Weihwasserkrüglein, in das wir nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen mit dem Zeigefinger eintauchten, anschließend mit dem so benetzten Finger drei Kreuze auf Stirn, Mund und Brust machten und „Gelobt sei Jesus Christus!“ sagten, wie es uns die Mutter nachhaltig beigebracht hatte. Das Weihwasser für das Krüglein wurde aus dem Taufbecken in der Kirche entnommen.
Wie damals üblich und, da es zumindest bei uns noch keine Kühlschränke gab, schloss sich an der Nordseite der Küche die Speisekammer an, an deren Fenster ein feines Fliegengitter angebracht war und in der neben Mehl, Milch, Kartoffeln und weiteren Lebensmitteln auch die großen Teile des Kochgeschirrs aufbewahrt wurden. Das größte davon war unzweifelhaft die große, flache Muspfanne mit dem langen Stiel, die links hinter der Speisetür an der Wand hing. In ihr kochte uns die Mutter abends sehr häufig ein Mus, das sie aus Mehl, etwas Milch und Wasser fertigte. Bei diesem Kochvorgang blubberte es an der Oberfläche des Muses, wenn Mamma mit dem Umrühren absetzte. Ein Vorgang, dem ich gerne zusah und den ich viel später in der Natur an den heißen Schlammquellen im Yellowstone Nationalpark wiedergesehen habe. Beim Musessen saßen wir alle, einen Löffel in der Hand, am großen Küchentisch. Die große Muspfanne stellte die Mutter auf ein Holzbrett in die Mitte des Tisches und goss auf die Haut, die sich an der Oberfläche des Muses beim Abkühlen gebildet hatte, heißes Butterschmalz, um es anschließend dort vorsichtig mit einem Holzlöffel zu verteilen. Nach dem Tischgebet zögerten wir nicht lange und stürzten uns hungrig auf die Mahlzeit. Jeder musste auf seiner Seite bleiben, wenn wir mit dem Löffel uns vom Rand der Pfanne aus vorarbeiteten. Dabei achtete Mamma peinlich darauf, dass das noch flüssige, herrlich duftende Butterschmalz nicht einseitig auf eine Seite hinlief und wenn ja, verteilte sie es wieder. Das Beste am Mus war für uns aber der am Pfannenboden gebildete, deutlich festere, leicht gebräunte Belag, die „Musscharren“, wie wir sie nannten. Diese musste man mit der Löffelkante scharrend abziehen, wobei er sich zu wohlschmeckenden Schnecken krümmte. Dabei kam es nicht selten zu Grenzstreitigkeiten zwischen den Tischnachbarn und die Mutter musste des Öfteren ermahnend eingreifen, wenn beim "Nachbargrundstück" gewildert wurde. Wenn Ermahnungen allein nicht halfen, lag meistens noch der abgeschleckte, hölzerne Kochlöffel für sie griffbereit am Tisch und es war in Anbetracht der sonstigen Geduld meiner Mutter erstaunlich, wie schnell man ihn bei unfairem Benehmen auf den Fingern zu spüren bekam.
Die Schlafzimmer in unserem Haus, und davon standen uns je nach dem Status der Untervermietung drei bis vier zur Verfügung, waren ausgestattet mit jeweils zwei Betten und einem kleinem Kleiderschrank. Im Elternschlafzimmer standen neben dem Ehebett kleine Nachtschränkchen und zusätzlich zum Kleiderschrank eine kleine Kommode. Über dem Ehebett war an der Wand ein großes Bild der Familie Jesu angebracht, auf dem mir Maria wegen ihres gütigen, mitleidigen Blickes auffiel. Vor allem aber ist mir Josef in Erinnerung geblieben, der als guter, braver Mann dargestellt war, mir aber mit seiner, über der Schulter getragenen Zimmermannsaxt etwas Angst einflößte. Die Betten in unseren Schlafzimmern bestanden aus einem Holzgestell mit Kopf-, Fuß- und Seitenteilen. Auf Querbrettern lag der so genannte Strohsack, ein aus Leintüchern (Bettlaken) von meiner Mutter zusammengenähter Sack in Bettgröße, der einmal jährlich, in der Regel nach dem Dreschvorgang beim Nachbarn, dem Traindler-Bauer, mit frischem Stroh gestopft wurde. So frisch bereitet, war diese Schlafvorrichtung in Verbindung mit dem Federbett recht angenehm, wenn man mal von den Stichen absah, die einem das frische, harte Roggenstroh selbst durch das Gewebe noch deutlich spüren ließ. Aber nach einer Weile wurde die isolierende Schicht Stroh immer dünner und ihre Verteilung trotz gelegentlichem Aufschütteln ungleichmäßig, so dass wir im Winter froh waren, das Bett mit einem Geschwister teilen zu dürfen und uns so, nachdem die kupferne Wärmflasche abgekühlt war, gegenseitig wärmen konnten. Auch kam es in solchen kalten Winternächten zu unwillkürlichem Zerren um genügend Bettdecke, ein Wettstreit, den immer derjenige von beiden gewann, der gerade mehr fror und mehr wach war als der andere. Am Morgen nach bitterkalten Nächten wurden wir mit wunderschönen Eisblumen am Fenster begrüßt, durch die sich die Strahlen der aufgehenden Sonne einen Weg an die weiße Wand über dem Bett bahnten.
Als kleiner Knirps durfte ich bei meiner ältesten Schwester Mena im Bett schlafen. Das empfand ich als sehr komfortabel, weil sie, um 12 Jahre älter, auf meinen kleinen Körper wohltuende Wärme abstrahlte. Doch dieser Zustand konnte natürlich nicht lange andauern und ich sollte dann das Bett von meinem 5 Jahre älteren Bruder erhalten, der gerade ausgezogen und bei einem Bauern als kleiner Helfer untergebracht worden war. Das führte zu heftigen Protesten meinerseits und, da mir keine anderen Argumente einfielen, beklagte ich mich flehentlich bei meiner Mutter und behauptete, dass dieses stinkende Bett des Bruders für mich nicht in Frage komme. „Des stinkete Bett tu-et net!“ soll ich geklagt haben, was in unserer Kindersprache so viel heißen sollte wie: „In dem stinkenden Bett kann man nicht schlafen!“ und die älteren Geschwister hatten wieder einmal ihren Spaß an meiner Formulierung einer widrigen Veränderung. Ja solche Episoden, die die Aufmerksamkeit bei den Älteren erweckten und die meine Person, wenn auch in etwas belächelnder Weise, in den Mittelpunkt stellten, habe ich mir gut merken können.
Von der Geburt meiner zwei Jahre jüngeren Schwester Elsa weiß ich verständlicherweise nichts mehr. Aber die Entbindung der nächsten, dreieinhalb Jahre jüngeren Schwester blieb mir nicht im Verborgenen. Da es anscheinend etwas war, was vor uns Kindern geheim gehalten werden sollte, war es etwas Besonderes und blieb mir so im Gedächtnis. Der ungewöhnliche Aufenthalt meiner Mutter im Ehebett wurde uns als Krankheit ausgegeben – sie war sonst nie krank – und als die Wehen vermutlich bereits heftig einsetzten, sagte die Hebamme zu Mena, sie möge doch mit uns Kleinen zum Pilze Suchen in den Wald gehen. Vermutlich war die Unruhe im Haus mit uns während der Geburt doch zu groß oder die Gefahr hätte gar bestanden, dass wir zufällig in das Schlafzimmer zur mit Wehen geplagten Mutter gerannt und mitbekommen hätten, wie die Geburt eines Kindes abläuft. Unterwegs zum Wald fragte uns Mena möglichst beiläufig, ob wir, wenn wir noch ein Kind dazu bekämen, uns ein Brüderlein oder Schwesterlein wünschen würden. Da kam in mir eine leise Vorahnung auf, dass da ein Zusammenhang mit dem seltsamen Verhalten im Hause vorher bestehen könnte. Ich hätte mir selbstverständlich ein Brüderchen gewünscht, mit dem man besser spielen konnte als mit den albernen und weinerlichen Mädchen. Lina, die um zwei Jahre ältere Schwester, hatte eine andere Meinung. Und so kamen wir, ob mit oder ohne Pilze im Körbchen, weiß ich nicht mehr, wieder nach Hause und fanden ein kleines Schwesterchen im kuscheligen Stubenwagen vor, der neben unserer Mamma, die im Bett lag, im Elternschlafzimmer stand. Es sollte auf den Namen Hildegard, also Hilde, getauft werden.
Von Kindergartenerlebnissen kann ich leider nichts berichten, weil es in Jenesien damals und auch etliche Jahre später noch keine Einrichtung dieser Art gab. Deshalb hatte ich viel Zeit, spielte mal im Garten oder mit den Nachbarkindern auf der Straße, oder besser gesagt, dem Fuhrweg, der an unserem Grundstück vorbei talabwärts nach Bozen führt und an dem entlang der Dorfbach floss. Dieser war besonders interessant nach starken Regenfällen, weil da die geführte Wassermenge und die Strömung deutlich zunahmen und wir mit dem Bau von kleinen Staudämmen, die wir mit Rasenstücken, Steinen und Ästen der Strömung entgegen bauten, und dem plötzlichen Öffnen derselben unseren Spaß hatten und voll Freude und Vergnügen mit der Flut nach unten rannten, bis sie allmählich verebbte. In diesem Dorfbach, der damals auch als Abwasserkanal diente, – an den Schlachttagen des Dorfmetzgers führte er häufig mit Blut rot gefärbtes Wasser – haben wir uns vermutlich immer wieder die lästigen kleinen, dünnen Würmer geholt, die uns nicht nur ständig am Hintern juckten, sondern auch noch von unserer Mutter als Futterkonkurrenten angesehen wurden, die unsere ohnehin kargen Mahlzeiten dezimierten. Erst versuchte sie dieser Plage mit bewährten Hausmitteln Herr zu werden, als da waren: eine lauwarme, entsetzlich riechende und noch schlimmer schmeckende Knoblauchmilch, die durch Aufkochen zerkleinerter Knoblauchzehen bereitet wurde, oder, nachdem sich herausgestellt hatte, dass dieses Heilmittel anscheinend den Würmern besser bekam als es uns schmeckte, ein aus dem heimischen Wermutkraut gekochter, an Bitterkeit nicht zu überbietender Tee, den wir Kinder noch mehr hassten und kaum schlucken konnten. Als sich herausstellte, dass auch er nicht die gewünschte Wirkung zeigte, kaufte Mamma, als sie das nächste Mal mit der Seilbahn in die Stadt fuhr, in der Apotheke einen rötlichen, künstlich süß schmeckenden Sirup, dessen Einnahme wir eher akzeptieren konnten und uns von den ekelhaften, juckenden Parasiten im späten Verdauungstrakt aber auch von den nicht weniger gefürchteten, bitteren oder übel riechenden eigenen Rezepten befreite.
In einem Kellerraum hatte der Vater zeitweise – er wäre halt so gerne Bauer gewesen! – seine Freude mit einer Kuh, die für uns Milchlieferant war. Das für sie benötigte Heu wurde im Raum davor, also in der Waschküche gelagert. Die Kuh war an einem vom Vater gefertigten Holztrog mit einer Kette angebunden und, wie bei Rindern üblich, verschaffte sie sich häufig Juckreizlinderung, indem sie mit dem Hals am Futtertrog scharrte, ein Vorgang, der nicht ohne Kettenklirren und Gepolter ablief und der zu manchem Ärger mit den im Stockwerk darüber lebenden Untermietern führte. Diese waren ein kinderloses Ehepaar, er ein kleiner, kaum deutsch sprechender Italiener mit für uns Kindern etwas furchterregenden dunklen Augenbrauen und einem strengen Blick, sie eine ehemalige Klassenkameradin und Nachbarin meiner Mutter. Da es zu jener Zeit aber eine große Wohnungsnot in Südtirol gab, blieb den beiden nichts anderes übrig, als dieses geliebte Hobby meines Vaters mit den, besonders nachts, störenden Geräuschen aus dem Kuhkeller mit Groll und unter Protest zu ertragen.
Wir Kinder hatten ein sehr natürliches Verhältnis auch zu diesem großen Haustier und trauten uns sehr nahe an die Kuh heran, durften manchmal beim Striegeln etwas helfen oder beim Melken, Ausmisten und Einstreuen zuschauen. Dabei lernten wir relativ schnell, dass wir die hinteren Partien des Rindviehs besser meiden sollten, wollten wir nicht von den schmerzhaften Schlägen des Schwanzes erwischt werden, der zur Vertreibung der lästigen Stallfliegen fast ständig hin und her geschwungen wurde. Einmal kam es zu einem Zwischenfall. Meine um zwei Jahre ältere Schwester wurde von der Kuh mit den Hörnern am Röckchen erwischt und in die Luft geschleudert. Meine Mutter war in der Nähe, griff sofort ein, konnte das Mädchen aus der Gefahrenzone zerren und somit dem Schrecken ein Ende bereiten. Als das aber unser abends von der Holzarbeit aus dem Wald heimkehrender Vater erfuhr, packte ihn ein gewaltiger Zorn, der ihn sofort in den Kuhkeller führte, wo er mit dem Melkstuhl, einer einbeinigen, hölzernen Sitzvorrichtung für das Melken, schimpfend auf das Tier einschlug, bis die Mutter endlich um Gnade flehte und rief: „Jetzt här a mal au! Des arme Viech woaß ja net, warum du’s a sou schlagsch! Es hat ja koan Verstand!“ Hm, dachte ich mir, vielleicht doch. Es kann irgendwie denken, denn manchmal frisst die Kuh ein Kraut nicht, weil sie am Geruch oder dem Aussehen erkennen kann, dass es für sie schlecht verträglich oder gar giftig ist. Nur die jungen Kälber sind noch unvorsichtig dumm und fressen Kräuter, die sie nicht vertragen und von denen sie manchmal ganz fürchterlich die „Scheiß“ (Durchfall) kriegen.