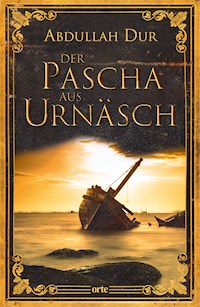
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Orte Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine abenteuerliche Reise ans Schwarze Meer Ueli Kurt, ein junger, begabter Schreiner, lebt Mitte des 19. Jahrhunderts in Urnäsch. Seine Schnitzereien an der neuen Kirchentür machen ihn weit über das Ausserrhoder Dorf hinaus bekannt. Als talentierter Handwerker wird er nach Frankreich vermittelt, wo es beim Unterhalt von Schloss Chambord im Loiretal viel zu tun gibt. Er nimmt Abschied von seinem behinderten Kind und seiner Frau, die er nie geliebt hat, und hofft, der Armut und Perspektivenlosigkeit der Heimat entfliehen zu können. Eine abenteuerliche Reise beginnt, die ihn bis ins Osmanische Reich führt, wo sich sein Schicksal zum Guten wendet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abdullah Dur Der Pascha aus Urnäsch
Abdullah Dur
Der Pascha aus Urnäsch
Aus dem Türkischen von Eva Lacour und Wolfgang Riemann
orte Verlag
Unterstützt durch:
Jakob und Rosmarie Frischknecht-Stiftung, Urnäsch
Kulturförderung des Kantons St. Gallen
Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden
Stadt St. Gallen
Ortsbürgergemeinde St. Gallen
© 2019 by orte Verlag, CH-9103 Schwellbrunn
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Radio und Fernsehen,
fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger
und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Janine Durot
Umschlagbilder: istock, belterz und shutterstock, Ake13bk
Herstellung: Verlagshaus Schwellbrunn
E-Book-Herstellung und Auslieferung: HEROLD Auslieferung Service GmbH, www.herold-va.de
ISBN Buch 978-3-85830-253-3
ISBN eBook 978-3-85830-258-8
www.orteverlag.ch
Ueli Kurt aus Urnäsch
In den Wintermonaten lag in Urnäsch, einem kleinen Dorf in der Ostschweiz am Fuss des Säntis, alles unter einer dicken Schneedecke begraben. Mitte des 19. Jahrhunderts floss das Leben ohnehin etwas gemächlicher dahin als heute, doch in der kalten Jahreszeit versank das Dorf noch mehr in Ruhe und Verschlafenheit. Die Frauen widmeten sich der Handarbeit, strickten und spannen Wolle, die sie im Sommer gewaschen und gekämmt hatten, und wenn den Männern neben ihren ausgiebigen Plaudereien im Wirtshaus noch unausgefüllte Stunden blieben, gingen sie auf die Jagd oder tauschten an Haus und Stallungen Bretter aus, die es nötig hatten. Endlich hatte man die Musse, durchgesessene Polster und abgewetzte Kissen auszubessern und zerrissene Kleidung zu flicken, damit man sie zukünftig wieder tragen konnte. Die Tiere im Stall wurden mit dem in den Scheuern aufgetürmten Heu gefüttert und warteten geduldig auf die Schneeschmelze.
Es war auch die Jahreszeit, in der die Männer ihre Kostüme und Masken für das Silvesterklausen richteten, ein traditionelles Fest, das man jeweils am 13. Januar beging. Diese Kostüme und Masken wurden hauptsächlich aus Dingen gefertigt, die man im Wald fand, von Baumrinde über Tannenzapfen bis hin zu dürren Halmen, Moos und Flechten. Man wetteiferte darum, das beste, das prächtigste Kostüm herzustellen und liess dabei seiner Fantasie freien Lauf. Mit den Masken verjagte man die bösen Geister – so erklärten es die Alten – oder man nutzte die Gunst der Stunde, um jemandem unerkannt seine Liebe zu gestehen oder umgekehrt seine Abneigung ins Gesicht zu schleudern oder Dinge zu sagen, die einem sonst die Schamröte ins Gesicht getrieben hätten.
Ein guter Teil der Männer versammelte sich regelmässig um den Ofen der Dorfwirtschaft, um über alles und jeden zu reden. In ihren Gesichtern las man die Zufriedenheit mit ihrem Leben. Ein freundlicher Zug lag ihnen um den Mund, mochte es in manchen Haushalten auch am Mehl für die Suppe fehlen. Die meisten hatten kein Geld in der Tasche, um ihre Zeche zu bezahlen, doch der Wirt Jörg Müller zog einfach sein dickes, zerknittertes Heft hervor und notierte die Schuld. Während er das tat, pflegte er dem Gast tief in die Augen zu blicken und zu murmeln: «Oh du lieber Jesus, warum kommen Leute ohne Grips und Geld ausgerechnet in mein Gasthaus!» Man wusste nicht recht, ob er sich mit diesem Spruch über seine Gäste lustig machen oder zu Gott klagen wollte. Hatte einer seinen Kreditrahmen wirklich überschritten, ermahnte er denjenigen höflich und riet ihm, gegen den Durst besser Schnee zu schlecken. In solchen Momenten wandte sich einer der Dorfbewohner an den zahlungsunfähigen Gast und meinte, wenn er keinen Geschmack an Schnee fände, solle er eben Jörg Müller den Hintern ablecken, was regelmässig lautes Lachen und Grölen hervorrief. Trotz alledem fand sich immer jemand, der dem Betroffenen ein Gläschen spendierte.
Am stillsten war es in der Wirtschaft, wenn einer, der lesen und schreiben konnte, den anderen die Appenzeller Zeitung vom Anfang bis zum Ende laut vorlas. Der Vorleser trug den gesamten Inhalt der Zeitung vor, ohne dessen müde zu werden, und die übrigen Gäste lauschten ihm aufmerksam wie dem Pfarrer.
In den Wintermonaten rauchten alle Schornsteine, und der Geruch nach Holzfeuer erfüllte das ganze Dorf. Die Kinder versammelten sich um die knisternden Tannenscheite, um den Geschichten der Ältesten zu lauschen und auf eine lange, geheimnisvolle Reise zu gehen. Diese Geschichten begleiteten sie ein Leben lang, und wenn sie selbst alt wurden, gaben sie die Erzählungen an die nächste junge Generation weiter.
Ueli Kurt hatte diese Nacht sehr schlecht geschlafen. Im Traum hatte er sogar gemerkt, dass er schlief. Es waren so schreckliche Träume gewesen, dass er nicht wusste, ob er besser weiterschlafen oder aufwachen solle, um sie abzuschütteln. Er wurde von Ungeheuern verfolgt, kletterte andauernd auf die höchsten Gipfel, um ihnen zu entkommen, sprang dann ins Leere und begann zu fliegen, um seine Verfolger abzuhängen. Bisweilen verlor er das Gleichgewicht und drohte abzustürzen, wedelte dann wie ein Vogel mit den Armen und flog noch höher hinauf. Wenn er sich umdrehte und seine Verfolger nicht mehr sah, erfüllte ihn grosse Erleichterung und Stolz. Aber plötzlich tauchten die Ungeheuer wieder auf und zwangen Ueli, in noch grössere Höhen aufzusteigen und schneller zu fliegen. Diese Verfolgungsjagd ging immer so weiter.
Diese Alpträume hatte er seit seiner Hochzeit im Jahr 1842. Hätte er diese Träume schon früher gehabt, hätte er ganz sicher in seinem Tagebuch davon erzählt, das er seit seinem zwölften Lebensjahr führte. In dem Tagebuch ging nichts verloren, im Gegenteil, manches wurde mit der Zeit mehr, erlangte tiefere Bedeutung und nahm eine Gestalt an, die Ueli selbst kaum noch begriff. Sein Tagebuch war sein engster Freund und Gefährte. Die darin festgehaltenen Erinnerungen waren wie ein Lebewesen, das zu ihm sprach und ihm sein Herz ausschüttete.
Als Ueli seiner Frau Rösli von den schrecklichen Alpträumen erzählte, interessierte sie sich vor allem für die Ungeheuer: Wer waren sie, wem glichen sie? Ueli konnte sich nicht entscheiden, ob er die Ungeheuer mit Mensch oder Tier vergleichen oder wie er sie bezeichnen sollte. Ihm kam es so vor, als müsste er sonst lügen.
Als Rösli seine Unentschlossenheit merkte, fing sie sofort an, den Traum zu deuten: «Gott erhöht den Menschen, den er liebt. Dass du in die Höhe fliegst, ist ein Zeichen für den Wert, den Gott dir beimisst. Die dreckigen Ungeheuer, die dich verfolgen, sind deine Sünden. Aber sie erwischen dich nicht, denn du stehst unter Gottes Schutz und bist sein geliebter Knecht. Du musst öfter zu Pfarrer Johannes in die Kirche gehen.»
Die Kommentare des Pfarrers deckten sich praktisch mit denen seiner Frau. War das nicht der Beweis für die Richtigkeit dieser Deutung? Ueli versuchte herauszufinden, welche schmutzigen Sünden ihn in Gestalt von Ungeheuern verfolgten, und überlegte, ob es die Flüche sein konnten, die er ausstiess, wenn Ziegen und Schafe ihm nicht gehorchen wollten.
Doch was ihn an diesem Morgen aus dem Schlaf riss, waren nicht die Alpträume, an deren Auftreten er bereits gewöhnt war, sondern das Weinen seines Töchterchens Maria im Zimmer nebenan. Es war der 13. Januar, und er musste noch im Dunkel der Nacht aufstehen, sein Groscht, den mit Tannenzweigen geschmückten Mantel, anziehen, seine Maske aufsetzen und sich die Schellen über die Schulter hängen, um sich dann mit den Kameraden zu treffen. Es war der Tag des Silvesterklausens. In den frühen Morgenstunden gingen er und seine Freunde in ihren selbstgemachten Groscht von Haus zu Haus und liessen dabei die schweren Schellen erklingen, die sie über der Schulter trugen. Seit seiner Kindheit erwartete er den 13. Januar stets mit grosser Vorfreude. Das ganze Dorf im Morgengrauen mit dem Läuten der Schellen aus den Federn zu holen und bei Geplauder und Scherzen den gereichten Schnaps zu trinken, war ein unvergleichliches Vergnügen.
Sofort sprang er auf und stürzte in Marias Zimmer. Sie sass im Bett und schluchzte mit erstickter Stimme.
«Was hast du denn, mein lieber Schatz? Warum weinst du so?»
«Ich hab versucht, keinen Lärm zu machen, aber mein Knie tut so arg weh. Ich wollte dich nicht aufwecken.»
In der Dunkelheit nahm Ueli das Gesicht des Kindes in seine Hände und küsste es auf die Stirn. Als er das nasse Gesicht spürte, krampfte sich etwas in ihm zusammen. Mit den Lippen ganz nah an ihrem Ohr flüsterte er: «Weisst du, du bist ein sehr kluges und besonnenes Kind. Weinen ist doch kein Lärm! Wenn du nicht geweint hättest, hätte ich dich nicht gehört, und dann hätte ich dir auch nicht helfen können. Warte mal, jetzt überlege ich, was ich gegen deine Schmerzen tun kann. Ausserdem ist heute das Silvesterklausen, da wollte ich sowieso früh aufstehen. Gut, dass du mich aufgeweckt hast.»
In der Dunkelheit tastete er nach der Öllampe. Erst spät fiel ihm ein, dass fast kein Öl mehr da war. Insgeheim stiess er einen derben Fluch aus. Deswegen nämlich sass die Familie seit drei Wochen abends noch eine Weile vor der leuchtenden Glut des Ofens, bevor man zeitig zu Bett ging. Noch nicht einmal Geld für Kerzen war da. Er löste den Riegel am Fenster, um die Läden zu öffnen. Draussen schneite es dicke Flocken. Ein trübes Licht, eiskalte Luft und einige Schneeflocken drangen in den Raum. Eine Weile schaute er dem Treiben der Schneeflocken zu.
«Vater, lass das Fenster auf! Die kalte Luft hat geholfen. Auf einmal tut es weniger weh!»
«Aber das geht doch nicht, mein Blüemli, im Zimmer ist es ja schon eiskalt.»
Ueli hob die Decke und machte sich daran, das Knie des Mädchens zu massieren, wie er es jeden Abend tat. Der Umschlag, den seine Frau Rösli jeden Abend mit Maismehl machte, war im Bett aufgegangen. Er versuchte, ihn wieder anzulegen, aber die Maispaste war zu trocken. Und die Beine des Kindes waren heiss wie Feuer.
«Im Zimmer ist es bitterkalt, aber deine Beine sind glühend heiss. So heiss haben sie sich noch nie angefühlt.»
Maria fragte flüsternd: «Vater, kannst du meine Beine in den Schnee stecken?»
Auf die Idee war er nicht gekommen. Er nahm das Mädchen auf den Arm und ging zur Tür. Draussen rollte er ihr das Nachthemd nach oben, um die verkrüppelten Beine in den Schnee zu stecken. Es war mitten in der Nacht. Maria hatte den Blick an den Vater geheftet. Dann steckte sie auch noch ihre keineswegs verkrüppelten Arme und die geschickten Hände in den Schnee.
«Ah, das tut gut! Wie schön wäre es, hier im Schnee zu schlafen!»
Ueli brachte sein Töchterchen wieder zurück ins Bett. Gleich weichte er die eingetrockneten Maismehlumschläge mit etwas Wasser auf, knetete sie durch und legte sie dem Kind wieder ums Knie. Ihre Beine waren nun recht kalt. Er deckte sie gut zu. Dann beobachtete er noch einmal die Schneeflocken, die vor dem Fenster munter tanzten. Draussen war im Mondlicht alles in ein russiges Weiss getaucht. Wenn im Winter das Spitzli hinter den Häusern so völlig weiss war, hatte er seit seiner Kindheit einen riesigen Schneemann in ihm gesehen. Der Berg direkt hinter den Häusern war der dicke Bauch dieses riesigen Mannes. Nun drückte er die Nase gegen die Fensterscheibe, um auf der Bergkette den Schneemann zu suchen, der lang ausgestreckt am Fuss des Säntis dalag, als sei er müde vom Laufen. Im Mondlicht konnte er den Bauch und die Arme des Schneemanns sehen, aber sein Kopf war hinter den dicken Schneeflocken verschwunden. Maria war inzwischen eingeschlafen. Ueli hörte die ruhigen Atemzüge des Mädchens. Offenbar hatte ihr die Kälte tatsächlich gut getan.
Seit Maria auf der Welt war, mochte sie den Winter sehr. Sie war ja auch in einem Februar im Wald am Kleinberg geboren. Ueli Kurt war in den Wintermonaten, wenn kaum jemand einen Zimmermann brauchte, mit Arbeiten an seinem eigenen Haus beschäftigt. Das Haus, in das er mit seiner Frau frisch eingezogen war, hatten sein Vater und sein Schwiegervater, der zugleich sein Onkel war, für das junge Paar gebaut. Es war klein, aber sehr gemütlich geworden. Zusammen mit seinem Grossvater hatte Ueli sämtliche Zimmermannsarbeiten selbst verrichtet. Und da es sein eigenes Haus war und er Schnitzwerk sehr liebte, hatte er an vielen Stellen des Hauses Verzierungen angebracht. Von den Türzargen bis hin zu den Fensterumrandungen war alles mit geschnitzten und bemalten Rosenmustern verziert. Das Holzhaus stand auf einem gemauerten Sockel von einem halben Meter Höhe, den sein Vater, ein Maurermeister, errichtet hatte. Auch die hölzerne Aussenfassade war mit Bildern von Rosen und Vögeln geschmückt.
Marias Geburt
An jenem Tag war das Wetter sehr schön. Nur der Gipfel des Säntis steckte in den Wolken. Alles strahlte weiss. Ueli holte den Schlitten hervor und machte sich bereit, im Wald nach frischen Kratzbeerblättern für die Lämmer zu suchen. Rösli meinte beharrlich: «Ich habe im Haus nichts weiter zu tun, ich komme mit.» Ihre Hochzeit war gerade neun Monate her, doch nach ihren Berechnungen war es noch etwa einen Monat Zeit bis zur Geburt. Sie war vergleichsweise klein und mit ihrem dicken Bauch nun fast so hoch wie breit – fast so rund wie die Heuballen, die man von den Bergen nach unten rollte. Trotz ihres Zustandes verrichtete sie unermüdlich alle Hausarbeit der gesamten Familie Kurt und noch dazu die des Pfarrers, ohne dass etwas liegen blieb. Und obendrein war heute ihr Geburtstag. Sie wurde siebzehn. Als Einziger hatte Pfarrer Johannes an ihren Geburtstag gedacht. Zeitig früh hatte er Ueli eine Karte gegeben, auf die er ein Gebet und Glückwünsche geschrieben hatte und die Ueli seiner Frau vorlesen sollte. Dadurch wurde Ueli an den Geburtstag seiner Frau erinnert.
«Du bist hochschwanger. Bleib bei dieser Kälte doch lieber zu Hause. Leg dich ein bisschen hin, ruh dich aus. Heute ist ja schliesslich dein Geburtstag!», protestierte Ueli zwar, aber Rösli liess sich nichts sagen. Sie meinte, ein bisschen Bewegung täte ihr gut, und blieb stur. Gemächlichen Schritts machten sie sich in Richtung Wald auf. Teils ging Rösli selbst, auf ebenen Strecken zog Ueli sie mit dem Schlitten. Im Wald lag weniger Schnee. Rösli setzte sich und beobachtete eine Zeit lang ihren Mann dabei, wie er unter dem Schnee die Kratzbeerblätter abschnitt. Dann türmte er das frische Grün auf den Schlitten. Auf einmal bemerkte Rösli Feuchtigkeit zwischen ihren Beinen und spürte einen heftigen Schmerz. Ueli hörte sie schreien und rannte gleich hin. Rat- und sprachlos stand er da.
«Ueli, ich glaube, unser Kind kommt! Ich hab schreckliches Bauchweh. Jetzt hilft nur, zu Gott zu beten. Lieber Gott im Himmel! Allmächtiger, steh mir bei! Mach, dass unser Kind gesund geboren wird. Nur mit Deiner Hilfe kann ich es hier im kalten Wald zur Welt bringen. Deine Allmacht und Deine Kraft lässt alles nach Deinem Willen geschehen. Hilf mir, dass mein Kind gesund auf die Welt kommt! Lieber Gott, steh mir bei!»
Anfangs flüsterte Rösli ihr Gebet noch, dann schrie sie es plötzlich laut heraus. Das versetzte Ueli noch mehr in Angst und Schrecken. Er schaute sich eilig um und stiess insgeheim einen Fluch aus. Doch dann schämte er sich geflucht zu haben, während seine Frau betete, und bat Gott um Verzeihung. Ueli Kurt war gerade siebzehn Jahre alt geworden. Bisher hatte er bloss miterlebt, wie im Stall Schafe und Ziegen geboren wurden. Und dabei hatte er nur verschämt mit vors Gesicht gehaltenen Händen zugeschaut. Wie verhielt sich eine Frau, wenn sie gebar? Wie konnte man ihr beistehen? Er war da völlig ahnungslos. Einige Zeit stapfte er hilflos im Schnee hin und her wie ein nervöses Pferd. Dann schlug er Rösli vor, sie auf dem Rücken nach Hause zu tragen oder auf dem Schlitten zu ziehen.
Aber Rösli meinte: «Ich kann nirgendwo hingehen, ich bringe mein Kind hier zur Welt. Geh du und hol die Hebamme!» Ihre Stimme zitterte, und ihr Gesicht war knallrot angelaufen. Vor Schmerzen presste sie sich beide Hände fest gegen den Bauch.
«Mein Gott, wie kann ich dich denn hier allein lassen? Lieber Gott, ich fleh dich an, steh mir bei!»
Zwischen den Bäumen hindurch kämpfte er sich durch den Schnee. Als die Bäume aufhörten, wurde der Schnee tiefer. Er kam nur noch mit Mühe voran, aber als er es bis zu einer Stelle geschafft hatte, von der aus man das Dorf sehen konnte, holte er so tief Luft, wie er konnte, und stiess einen schrillen, langen Pfiff aus. Nach kurzer Zeit wurde aus dem Dorf mit einem Pfiff geantwortet. Das war sein Grossvater. Ueli war sich sicher, dass er die Nachricht verstanden hatte. Aus der Ferne konnte er sehen, dass im Dorf plötzlich ein hektisches Gerenne ausgebrochen war. Bald schon machten sich einige Dorfbewohner zum Kleinberg auf. Ueli rannte zu Rösli zurück.
«Alles in Ordnung. Sie kommen. Grossvater hat mich gehört. Er hat ganz bestimmt verstanden, was los ist.»
Er zog Jacke und Pullover aus und breitete beides über den frisch geschnittenen Kratzbeerblättern aus, um ein Lager zu richten. Verzweifelt sah er Rösli an, wenn er ihre Schmerzensschreie hörte. Er zitterte. Rösli betete weiter und rieb sich gleichzeitig Gesicht und Brust mit Schnee ein. Blut quoll ihr zwischen den Beinen hervor und färbte den Schnee rot. Ratlos stand Ueli da und betete leise.
Endlich tauchten ein paar Frauen aus dem Dorf auf, unter ihnen die Hebamme, seine und Röslis Mutter. Sie brachten Krüge voll Wasser, Tücher und runde Holzschüsseln mit.
Die Hebamme zischte Ueli an: «Seid ihr denn übergeschnappt? Was hat eine hochschwangere Frau bloss im Wald verloren? Grosser Gott, vergib ihnen ihren Leichtsinn und ihre Dummheit! Geh du jetzt zu den Männern. Wenn ich dich rufe, kannst du kommen.»
Die Ältesten der Familie Kurt und einige Dorfleute warteten mit einer hölzernen Trage. Uelis Grossvater streckte ihm die Flasche mit dem Schnaps entgegen: «Junge, du kannst jetzt einen kräftigen Schluck gebrauchen. Gott sei Dank habt ihr mir gesagt, dass Rösli mit dir in den Wald geht. Als ich deinen aufgeregten, schrillen Pfiff gehört habe, wusste ich gleich, dass ihr die Hebamme braucht. Gott ist voller Gnade und hilft den Bedürftigen.»
Ueli trank den Schnaps in grossen Schlucken, bis es ihn im Hals brannte und ihm überall heiss wurde. Der Grossvater nahm einen Gulden aus der Tasche und sagte ihm, den solle er der Hebamme geben.
Nach einer Weile rief die Frau: «Bringt die Trage her!» Sie rannten hin. Mit energischer Stimme sprach die Hebamme: «Ihr habt eine Tochter bekommen. Gott hat ein Licht in euer Leben gebracht.» Ueli wusste nicht, was er sagen sollte, griff nach der Hand der Hebamme und wollte ihr den Gulden hineindrücken, aber die Frau flüsterte: «Behalt dein Geld. Du bist jetzt Vater und wirst es brauchen. Komm mal bei mir vorbei. Ich brauche ein, zwei Bretter in meinen Schrank. Die machst du mir, dann sind wir quitt.»
Der Säugling war regelrecht zum Paket gewickelt und lag zwischen Röslis Brüsten. Die Hebamme meinte: «Tragt die beiden ganz geschwind ans warme Feuer, sonst wird keins von beiden überleben.» Dann wandte sie sich zu Uelis Mutter Anna Maria und sagte: «Geh du schnell voraus und schür kräftig das Feuer. Koch eine Milchsuppe mit Reis und mach viel Wasser warm.»
Anna Maria verschwand wie der Blitz.
Vier Männer schulterten die Trage. Behutsam, aber doch so schnell wie möglich gingen sie uf dem verschneiten, gewundenen Pfad zum Dorf. Einer der vier Träger rief: «Meine Herren, wir tragen doch keinen Toten! Heute ist ein schöner Tag, denn wieder wurde im Wald auf dem Kleinberg ein Kind geboren. Singen wir ein Lied!» Dann machte er gleich selbst den Anfang:
«Vor em Hüüsli of de Stege
singid ali, grooss ond chlii,
ond de Vollmoo geed de Sege
met sim milde Silberschii.
Monter chlingled ääs am ääne,
s Singe macht äm nomme müed.
S ischt so fiirlig, chöntntischt määne,
s chäm en Bsuech os jedem Lied.
Singid, singid ohni Note,
was das Herz mag use gee!
Jo, globs, du heschs verroote,
s chönntid Engel om üs see.»
Von der Trage vernahm man das gedämpfte Weinen des Neugeborenen und Röslis Stöhnen. Viele Dorfleute, die von dem Vorfall gehört hatten, kamen ihnen mit Decken entgegen, um Rösli warm zuzudecken. Andere Männer lösten die Träger ab.
Unterwegs legte die Hebamme Ueli die Hand auf die Schulter und murmelte: «Gott hat dir eine Tochter geschenkt. Gottes Gaben muss man annehmen, so wie sie sind. Wir müssen zu Ihm beten, um Ihm zu danken. Wir Knechte Gottes können den Wert Seiner Gaben nicht beurteilen. Unsere Pflicht ist es, sie mit Freude anzunehmen und Ihm dafür zu danken. Unsere Aufgabe ist es, dieses Geschenk in unsere Obhut zu nehmen, es zu behüten und zu lieben. Gott liebt und beschützt uns genauso sehr, wie wir seine Gabe lieben und beschützen.» Dann betete sie leise weiter.
Man trug Rösli und das Neugeborene bis zu ihrem Haus, das am Geissenpfad lag. Sie hatten darin drei Zimmer. Beim Ofen stand die Wiege bereit, die Ueli für sein Kind gebaut hatte. Als man das Kind hineinlegte, konnte Ueli zum ersten Mal sein Gesicht sehen.
«Mein Gott, was hat sie für lange Haare!»
Rösli flüsterte: «Du kannst Maria zu ihr sagen.»
«Weine nicht, Maria, mein schönes Schneeglöckchen!» Ueli beugte den Zeigefinger, um die Wangen des Säuglings zu streicheln. Erst eine Woche war vergangen, seit sie in dieses Haus eingezogen waren, und es fehlte noch an vielem. Das Haus war vom harzigen Geruch der Holztäfelung erfüllt. Der Grossvater hatte dem jungen Paar einen guten Ofen aus dickem Gusseisen geschenkt. Was einem im Innern des Hauses aber ins Auge stach, waren der Holztisch und die Stühle, die Wiege und der noch unfertige Kleiderschrank – Möbelstücke, die Ueli sämtlich selbst angefertigt hatte. Seit Tagen arbeitete er nur an diesem Schrank, denn ansonsten gab es für ihn nicht viel zu tun. Auf einem der beiden viereckigen Felder in der Mitte der Türen befand sich das Bild einer Kirche mit Bergen im Hintergrund. Auf dem anderen waren Männer in der Tracht beim Alpaufzug abgebildet. Sie trugen en gebogenen Schellenstecken über der Schulter, an dessen beiden Enden riesige Schellen baumelten. Alle Männer hatten rote Westen an und trugen mit Kuhmotiven verzierte Hosenträger. Wenn Ueli an dem Schrank schnitzte, liess er seiner Fantasie freien Lauf, und das bereitete ihm grosses Vergnügen. Den kleinsten Einzelheiten widmete er stundenlange Arbeit.
Später am Tag von Marias Geburt nahm die Hebamme ihn zur Seite und sagte: «Du musst zwei Wochen lang im Elternhaus wohnen. Ich bleibe mit euren beiden Müttern hier. Rösli und das Kind brauchen uns. Es reicht, wenn du uns genug Brennholz und Wasser bringst.»
Eine Woche nach Marias Geburt eröffnete der Grossvater ihm: «Sieh mal, mein Junge. Maria ist nicht ganz gesund geboren worden. Die Hebamme hat gesagt, dass ihre Beine nicht richtig entwickelt sind. Sie wird nie laufen können. Vielleicht überlebt sie nicht. Wir müssen akzeptieren, was Gott uns gegeben hat. Das Einzige, was wir tun können, ist beten. Eine andere Wahl haben wir nicht. Alles kommt von Gott, alles geht zu Gott. Wir müssen Gott für alles danken, was er uns gibt. Du weisst ja, dass diese Geburt deine Frau sehr mitgenommen hat und dass wir auch für sie beten müssen.»
Ueli rannte sofort zu seinem Haus am Geissenpfad. Er löste Marias gewickelte Beine, betastete sie und küsste sie. Die Frauen im Raum beobachteten ihn staunend. Rösli lag erschöpft im Bett. Sie konnte die Erregung und Sorge ihres Mannes nachvollziehen. «Gott steh uns bei, denn es ist unser Kind. Der Allmächtige hat es uns gegeben», murmelte sie und blickte ihm eindringlich in die Augen.
Ueli wollte an Röslis Bett treten und ihre Hand halten, aber weil die Frauen im Raum ihre Augen an ihn geheftet hatten, liess er es sein. Stattdessen rannte er zurück ins andere Haus zu seinem Grossvater. Der alte Mann sass am Ofen und war damit beschäftigt, aus Tannenholz kleine Kühe zu schnitzen.
«Sag, Grossvater, ist die Kleine behindert, weil sie im Wald geboren wurde?»
Der Grossvater hob die Späne auf, die sich am Boden angesammelt hatten und warf sie in den Ofen. Die Flammen loderten auf, und der Geruch nach Tannenholz verbreitet sich im Raum. «Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das halbe Dorf ist im Stall oder im Wald geboren. Auch dein eigener Vater kam in der Hütte auf der Schwägalp zur Welt. Und die Hebamme war noch dazu ich. Oder nein, das stimmt eigentlich nicht. Ich hatte Angst und habe eine Nachbarin aus der Hütte auf dem Berg weiter oben gerufen. Alles geschieht nach Gottes Willen. Maria wurde zu früh geboren, sie ist nicht voll entwickelt und deshalb behindert. Aber sagen wir besser trotzdem, dass Gott es so gewollt hat.»
«Warum sagen wir immer, wenn uns etwas Schlechtes zustösst, Gott hat es so gewollt? Warum macht Gott uns das Leben nur schwer statt leichter, statt uns zu beschützen? Ist Gott für die vielen schlimmen Dinge verantwortlich, die passieren? Bedeutet das denn nicht, Gott zu beschuldigen?»
«Sieh mal, mein Junge. Gott hat uns reichlich Brennholz gegeben, aber es ist im Wald. Wir müssen es holen, sonst erfrieren wir. Das Holz kommt nicht von alleine her. Wenn wir im Wald Holz fällen, kann es uns passieren, dass wir einen Arm oder ein Bein verlieren. Oder wenn man einen Haufen schweres Holz auf dem Buckel schleppt, kann man ausrutschen und von dem Holz erschlagen werden. Das alles geschieht mit Gottes Billigung.»
Manchmal verstand Ueli überhaupt nicht, was sein Grossvater sagen wollte. Trotzdem nickte er zustimmend mit dem Kopf. «Hm, ja. Wenn wir das Holz nicht im Wald holen, bestraft uns Gott, indem er uns vor Kälte erfrieren lässt. Wenn wir einen gesunden Baum fällen, bestraft Gott uns auch. Hast du das gemeint?»
Der Grossvater klemmte sich den Stumpen zwischen die Zähne und murmelte kaum verständlich etwas Zustimmendes: «Genau so hab ich das gemeint.»
Im Ofen knisterten die Tannenscheite. Der alte Mann schnitzte nun wieder an der kleinen Kuhfigur, die er fest mit der linken Hand umklammert hatte.
Auch Ueli Kurt zog das Klappmesser hervor und machte sich daran, eine Kuh aus den Tannenholzstücken zu schnitzen, die der Grossvater bereitgelegt hatte. Es machte ihm grossen Spass, die kleinen Holzstücke in der Hand zu halten und daraus eine Kuh entstehen zu lassen. Beim Schnitzen mit dem kleinen Klappmesser konnte er stundenlang die Gedanken schweifen lassen. Doch eine seiner allerliebsten Beschäftigungen war es, je nach Lust und Laune etwas in das braune Heft zu notieren, das er ständig bei sich trug. Manchmal brachte er viele Stunden damit zu, die treffenden Worte zu suchen, um seine alltäglichen Erlebnisse dem Heft zu überantworten.
Sein Grossvater hatte einmal gesagt: «Dieses Heft ist dein Zwillingsbruder. Es weicht dir nicht von der Seite und denkt vielleicht dasselbe wie du. Mich würde schon sehr interessieren, was da für Geschichten drinstehen. Warum lässt du es niemanden lesen?»
Uelis Antwort war immer gleich: «Lass gut sein, Grossvater. Das ist eine kleine Welt, die ich mir auf dem Papier gebaut habe. Ich möchte nicht, dass jemand dort eindringt, und das kann sogar der Mensch nicht ändern, den ich am meisten lieb hab, nämlich du.»
Mit der Zeit akzeptierte der Grossvater Uelis Entscheidung und gab die Hoffnung auf, in dem Heft lesen zu dürfen. Er wurde sogar – neben Ueli selbst – zum grössten Beschützer des Tagebuchs. Wenn der Enkel es einmal an einem Ort liegen liess, an dem sie zusammengearbeitet hatten, war die erste Tat des Grossvaters, das braune Heft an sich zu nehmen und es dem Enkel auszuhändigen.
Auch Rösli war sehr neugierig auf den Inhalt des Hefts. «Was hast du bloss davon, den ganzen Tag etwas in das Heft zu schreiben? Manchmal denke ich, du schreibst von deiner Liebe zu Julia! Woher soll ich wissen, dass das nicht stimmt? Los, sag, hab ich etwa Unrecht? Oder stimmt es nicht, dass du dieses hochnäsige, herausgeputzte Mädchen mehr liebst als mich? Mich liebst du ja gar nicht. Anstatt in diesem Heft herumzukritzeln würdest du besser in der Heiligen Schrift lesen! Dann würdest du wenigstens von Gott erleuchtet und könntest auch mich erleuchten. Für mich ist es schwer, dass ich nicht in die Schule gegangen bin und nicht lesen kann. Dabei würde ich so gern in der Bibel lesen. Und ich möchte wissen, was du in das Heft kritzelst. Der einzige Grund, warum ich so im Hintertreffen bin, ist mein Vater. Wenn er nicht gedacht hätte, wozu soll ein Mädchen denn lesen und schreiben lernen, das hilft ihr doch nicht bei der Arbeit, sondern mich zur Schule geschickt hätte, könnte ich die Heilige Schrift und dein Heft lesen», beklagte sie sich.
Nach Marias Geburt begann eine schwere Zeit für das junge Paar. Maria entwickelte sich schlecht, wuchs nur langsam und war ständig krank. Sie bekam schwer Luft. Uelis Mutter kochte Tee aus allen möglichen Kräutern, die sie in den Bergen sammelte, und flösste ihn Maria ein. Ueli versuchte, die Leiden des Töchterchens zu lindern, indem er in den nächstgelegenen grösseren Ortschaften, Appenzell und Herisau, von Arzt zu Arzt lief und keinen Mönch oder Naturheiler ausliess. Jeder, an den er sich in seiner Not wandte, meinte, er hätte als Einziger das Patentrezept, um das Kind zu heilen. Ihnen allen musste Ueli Geld geben, und das war schwer. Deswegen schleppte er neben dem Kind noch Stühle und Schemel, geschnitzte Kühe und andere Tierfiguren auf dem Rücken mit, um sie den Heilern als Lohn anzubieten. Es gab sowieso wenig Arbeit für Zimmerleute und Schreiner, und die paar Gulden, die er verdiente, reichten nicht einmal, um die Familie satt zu bekommen.
Der Tod des Grossvaters war für Ueli Kurt ein schwerer Schlag. Er war ihm Freund und Meister, einfach alles gewesen. Ihm kam es vor, als sei ihm die Orientierung im Leben abhandengekommen. Der Ast war gebrochen, an dem er sich festhielt, der Pfad verschwunden, auf dem er ging; es war, als sei er mutterseelenallein in einer Einöde zurückgeblieben.
Als Ueli klein war, versammelten sich an kalten Wintertagen alle Kinder der ganzen Sippe um den Grossvater, um atemlos den Geschichten zu lauschen, die er erzählte. Uelis Mutter konnte ihren Kindern keine Geschichten erzählen, weil sie stotterte. Aber der Grossvater imitierte beim Erzählen die Stimmen von Mensch und Tieren aller Art und zog die Zuhörer in seinen Bann. Doch der Grossvater hatte Ueli nicht nur Geschichten erzählt und sein Handwerk gelehrt, sondern ihn auch in allen Facetten in die Geheimnisse des Lebens eingeführt. Zeitlebens hatte Ueli alles Erdenkliche von ihm gelernt. Der Grossvater wurde niemals müde, sein ganzes Wissen wieder und wieder vor dem Enkel auszubreiten. Wenn er über die Geheimnisse des Handwerks sprach, pflegte er zu sagen: «Was du bei mir lernst, sind keine unverrückbaren Gesetze der Zimmerei und Schreinerei. Es liegt in deiner Hand, das Handwerk weiterzuentwickeln, und das kannst du so tun, wie es dir richtig erscheint. Das ist der goldene Weg zum Erfolg. Führe das, was du von anderen gelernt hast, so aus, wie es dein Gespür dir sagt. Lass nicht zu, dass andere sich da einmischen. Aber vergiss nicht: Wir sind nicht die besten Experten auf unserem Gebiet. Es gibt Leute, die es noch besser können. Hör auf sie und nutze ihr Wissen und Können für dich. Und tu deine Arbeit nicht nur für Geld. Tu sie mit deiner ganzen Seele und werde glücklich dabei. Sei mit Freude bei der Arbeit. Und vergiss auch das nicht: Du musst dich daran gewöhnen, dass deine Arbeit dir nicht viel Geld ins Haus bringt. Deine Frau wird dann meckern und dir den Kopf voll schwatzen, daran musst du dich gewöhnen. Du musst lernen, dass dir solches Genörgel zum einen Ohr hinein- und zum anderen wieder hinausgeht.»
Der schlagende Beweis dafür, dass der Grossvater lebenslang nicht um des Geldes willen gearbeitet hatte, war der Menschenauflauf anlässlich seiner Beerdigung. Nicht nur aus den nahe gelegenen Dörfern, auch aus entfernteren Ortschaften strömten die Menschen herbei. In Urnäsch erlebte man einen solchen Andrang zum ersten Mal. Kutschen und Pferde fanden keinen Platz mehr zum Halten.
Pfarrer Johannes eröffnete seine lange Ansprache mit den Worten: «Zum ersten Mal erlebe ich, dass jemand in solch einer grossen Trauergemeinde beigesetzt wird. Der Grund dafür ist, dass es in der ganzen Gegend kein Haus gibt, in das der Zimmermann Kurt keinen Nagel geschlagen hätte, und dass der materielle Gewinn für ihn nicht im Vordergrund stand. Das ist die höchste Gnade, die man von Gott empfangen kann. Möge Gott uns allen gnädig sein. Trotz dieses Regenwetters seid ihr aus grosser Ferne zu dieser Trauerfeier gekommen. Gott hat euch mit den Wohltaten des Zimmermanns Kurt beschenkt, und Gottes Lohn ist der höchste Lohn. Möge Er uns allen einen solchen Abschied bescheren.» Da der Pfarrer nun schon einmal einer so grossen Gemeinde gegenüberstand, nutzte er die Gelegenheit für eine sehr, sehr lange Predigt.
Maria war gerade vier, Ueli zwanzig Jahre alt geworden. Zuletzt hatte Ueli zwei Jahre zuvor im kleinen Ort Heiden den Doktor Leuenberger aufgesucht. Dank des Sirups, den der Arzt dem Kind gegeben hatte, waren ihre Atemwegprobleme verschwunden. Lediglich die Schmerzen in ihren verkrüppelten Beinen nahmen von Zeit zu Zeit ein unerträgliches Ausmass an. Die beste Behandlung waren Umschläge aus Maismehl nach dem Rezept von Uelis Grossmutter. Sobald die Schmerzen häufiger auftraten, wurden diese Umschläge gemacht.
Maria war ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Das kräftige, blonde Haar fiel ihr über die blauen Augen und die gerade Nase wie ein Vorhang, der ihr Gesicht verbarg. Trotz ihrer Gehbehinderung konnte sie – dank der Knieschoner, die Doktor Leuenberger ihr gegeben hatte – auf Berge rutschen, Brennholz sammeln, die Kuh melken und ihrer Mutter bei Hausarbeiten aller Art zur Hand gehen. Morgens stand sie in aller Herrgottsfrühe auf und noch bevor ihre Eltern aus den Federn kamen, beobachtete sie die Umgebung, um später in allen Einzelheiten zu berichten, wer vorbeigegangen war und wessen Kühe oder sonstiges Vieh schon in den Wald getrieben worden war. Am liebsten hätte sie den ganzen Tag im Freien verbracht. Wenn es regnete und sie nicht nach draussen konnte, sass sie vor dem zum Bach gelegenen Küchenfenster und sah stundenlang dem dahinfliessenden Wasser zu. Gab es Hochwasser, schrie sie jedes Mal auf, wenn Baumstämme vorbeitrieben, womit sie ihre Mutter heftig erschreckte. Hinter dem Haarvorhang spielte stets ein heimliches Lächeln um ihren Mund. Sie hatte einen unglaublichen Verstand. Von der Herstellung von Käse über Butter bis hin zum Brotteig erteilte sie ihrer Mutter Lektionen, wie man diese Nahrungsmittel schmackhafter zubereiten konnte. Sie ermahnte die Familie sogar, Scheite nicht senkrecht, sondern waagrecht in den Ofen zu legen, damit sie nicht so schnell herunterbrannten und man Brennholz sparen konnte.
Die Mutter wunderte sich: «Maria, woher weisst du das alles bloss? Von mir kannst du es ja nicht haben, denn ich höre es von dir zum ersten Mal.»
«Vom Grossvater, von der Grossmutter, von den alten Leuten, von allen möglichen Leuten hab ich das halt.»
«Alle diese Leute kenne ich ja nicht einmal! Warum erfahre ich solche Sachen nicht?»
«Was weiss denn ich? Vielleicht fragst du nicht danach. Aber ich will alles wissen, und Gott hilft mir dabei.»
Pfarrer Johannes meinte: «Gott hat dem Kind die Energie fürs Laufen ins Hirn gegeben. Das Mädchen sieht und spürt vielleicht viele Dinge, die wir gar nicht bemerken. Warum hat Gott nicht dich oder mich, sondern sie krank werden lassen? Darüber müssen wir nachdenken. Sie ist eindeutig etwas Besonderes. Und damit ist die Antwort auf unsere Frage auch einfach: Gott liebt dieses Kind ganz besonders. Gott hat sie auserwählt und sie vielleicht für eine heilige Aufgabe erschaffen.»
Diese Worte des Pfarrers machten Maria in den Augen ihrer Eltern zu einem noch wertvolleren Geschöpf.
Rösli und Ueli
Ueli Kurt kannte Rösli, solange er denken konnte, denn sie war die Tochter seines Onkels Karl und im selben Haus geboren. Im Parterre des zweigeschossigen Hauses der Kurts lebten die Grosseltern und Uelis Familie mit ihren sechs Kindern, im Obergeschoss die Familie von Onkel Karl mit acht Kindern. Ueli und Rösli waren wie Geschwister. Gemeinsam lauschten sie in den Wintermonaten stundenlang den Geschichten des Grossvaters, sie zogen sich an den Haaren und rauften sich, sie teilten in ihrem jungen Leben gute wie schlechte Zeiten.
Ueli hatte sein sechzehntes Lebensjahr noch nicht vollendet, da eröffnete ihm eines Tages der Vater: «Diesen Sommer wirst du Rösli heiraten. Ich habe das mit Karl so beschlossen. Rösli ist ein sehr fleissiges Mädchen, da wollen wir, dass sie in der Familie bleibt. Und ihr beide passt gut zusammen. Dass mein Bruder Karl und ich ein- und derselben Meinung sind, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass es mit Gottes Segen so sein soll. Das Haus am Geissenpfad wollen wir bis in einem Jahr fertig haben. Den Innenausbau machst du zusammen mit deinem Grossvater. Wir haben genug Holz dafür gelagert. Nimm die Masse für die Fensterrahmen und fang gleich mit den Vorbereitungen an. Wir gehen bald nach Herisau und besorgen Glasscheiben und Fensterkitt. Natürlich nur, wenn das Geld reicht – wenn wir dieses Jahr die Schafe und Geissen auf der Alp gut füttern, oder besser gesagt, wenn ihr sie gut füttert, denn diesmal gehst du mit Rösli auf die Alp. Deine Mutter kommt später nach und hilft euch, den Käse zu machen. Ich bringe euch dieses Jahr nur mit dem Vieh hinauf und muss gleich wieder hinunter, denn in Jakobsbad wird ein riesiges Kloster gebaut. Das ist für mich eine einmalige Gelegenheit. Der Polier Tobler hat gesagt, die Arbeiten dauern mindestens drei Monate, vielleicht sogar mehr. Im Moment hat ja keiner Geld, aber andernorts geht es den Menschen besser. Vielleicht findest du dort für dich eine Arbeit. Wenn ich dich benachrichtige, kommst du sofort herunter. Und dass du mir auf der Alp nur keine ruhige Kugel schiebst! Du erledigst dort alles, was an Holzarbeiten anfällt. Geh übers Dach und tausch die morschen Bretter aus. Es gibt dort viele Bauern, die einen Zimmermann brauchen können. Wenn du länger als einen halben Tag für sie arbeitest, lass dich dafür bezahlen! Sag, dass du frisch verheiratet bist und das Geld dringend brauchst. Sag ihnen, dass du nicht wie dein Grossvater für Gotteslohn oder auf Anschreiben arbeiten kannst. Wer kein Geld hat, von dem kannst du Käse, Wolle oder Holz verlangen. Aber lasst das Vieh nie aus den Augen! Da oben kann das Wetter von einem Moment zum anderen umschlagen. Wenn alles im Nebel liegt, kannst du nichts sehen und findest die Tiere nicht mehr. Das ist eine willkommene Gelegenheit für Diebe und Wölfe. Ihr müsst ständig Augen und Ohren aufsperren. Du kannst die Schafe nicht selbst scheren, du verdirbst die Wolle. Das soll Joseph Glockner machen. Grüss ihn von mir, dann macht er es. Er hat eine gute Schere und kennt sich damit aus. Die Schurwolle müsst ihr gut waschen und trocknen. Dann soll Rösli sie kämmen, bis Gras und Dreck draussen sind. Schafwolle ist jetzt sehr teuer. In St. Gallen haben sie anscheinend Werkstätten aufgemacht, sie weben Stoff aus der Wolle und nähen alle möglichen Kleider daraus. Der Polier Tobler hat berichtet, dass in den Werkstätten zwanzig, dreissig Leute arbeiten. Den fertigen Stoff verschicken sie bis nach England. Er hat sogar gesagt, dass sie bald noch mehr Weber brauchen werden. Wer weiss, vielleicht findest du mit deinen Geschwistern später dort Arbeit. Die Familie Kurt wird immer grösser, und das Land reicht nicht für alle. Wenn ihr später noch Kinder bekommt, könnt ihr sie nicht ernähren. Auch wenn man ein Handwerk beherrscht, hilft einem das nicht weiter. Ich bekomme oft keinen Lohn für meine Arbeit. Immer, wenn es ans Zahlen geht, sagen die Leute: Ich geb es dir später. Aber die Leute haben weder jetzt noch später Geld. Vielleicht ist es sogar besser, wenn du dich eine Zeitlang nur mit dem Vieh beschäftigst. Ihr wohnt jetzt erst noch einige Zeit bei uns, dann zieht ihr in das Haus am Geissenpfad.»
Ueli war die endlosen Ratschläge seines Vaters schon gewöhnt. Schweigend hörte er der Litanei zu, mit der der Vater der Reihe nach ein Thema nach dem anderen herunterbetete, und nickte leicht mit dem Kopf, so als wäre er mit allem einverstanden.
Dabei war ihm danach zumute, herauszuschreien: «Nein, ich will nicht heiraten, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht! Rösli ist für mich wie eine Schwester. Wir haben das Bett geteilt, haben Milch aus derselben Schale getrunken, wurden in demselben Korb auf die Schwägalp getragen. Und ich will mich auch nicht mit Viehzucht beschäftigen! Ich liebe die Arbeit mit Holz! Das ist es, was ich machen will!» Doch er schwieg, wohl wissend, dass es ihm nicht zustand, sich gegen den Vater aufzulehnen. Den Vater brachte es schon aus dem Häuschen, wenn man nur eine kleine Anmerkung machte. In solchen Momenten scheute Ueli sich sogar, ihm nur ins Gesicht zu sehen.
Der Grossvater pflegte zu sagen: «Wenn du jemanden gegenüber hast, der dich nicht verstehen will, dann schweig und bleib ruhig. Das ist die beste Antwort. Manchmal kann man sich mit Schweigen besser ausdrücken als mit vielen Worten.»
Sepp Kurt, der Vater, war ein sehr harter Mensch. Von Kindesbeinen an hatte Ueli gelernt, dass man ihm ständig zustimmen musste: «Ja, das stimmt, genauso ist es.» Das Wort des Vaters war Gesetz. Was andere dachten, zählte nicht. Kinder wurden in die Welt gesetzt, um nach dem Willen des Vaters zu leben.
Nach diesem Gespräch mit dem Vater liess Ueli den Kopf hängen. Er wurde rot im Gesicht und wich den Blicken der anderen aus. Morgens stand er zeitig auf, um mit seinem kleinen Bruder den Viehbestand der gesamten Familie Kurt, zehn Ziegen und fünf Schafe, die Berghänge hinaufzutreiben. Rösli musste auch in die Heiratspläne eingeweiht worden sein, denn sie sah ihn nicht an. Manchmal dachte er darüber nach, ganz weit wegzulaufen. Doch er war noch nie weiter als bis nach Appenzell gekommen, und dort war es sehr schwer, Arbeit und Obdach zu finden. Von seinem Grossvater hatte Ueli viel über die Zimmerei und das Schreinerhandwerk gelernt, aber es gab noch viel mehr zu lernen. Der Grossvater beschäftigte sich tagelang mit den feinen Verzierungen an seinen Schränken. Seine Schnitzereien stellten die Viehzucht, den dörflichen Alltag und die Natur mit ihrer Vielfalt an Blumen, Kräutern und Bäumen dar. Jedermann betrachtete diese Bilder voller Bewunderung und Anerkennung, nur der Vater nörgelte: «In der Zeit, die du mit diesen komischen Verzierungen zubringst, hättest du noch einen Schrank machen können. Ein Schrank ist dazu da, um Kleider hineinzuhängen. Niemand kauft einen Kleiderschrank, um sich die Bilder anzuschauen. Was nützt dir ein Schrank, wenn du keine Kleider zum Reinhängen hast? Aber dafür musst du Geld verdienen. Und kannst du die Kuhfiguren etwa melken, die du da schnitzt? Du kannst sie zusammendrücken, so viel du willst, es kommt kein Tropfen Milch heraus. Sie taugen höchstens als Brennholz! Mein Gott! Wenn ich auf meine Mauern auch Bilder malen würde, würde mir niemand mehr Arbeit geben. Hör doch auf mit diesem verspielten Quatsch und arbeite schneller, mach mehr Schränke. Davon hättest du mehr!»
Der Grossvater aber pflegte daraufhin Ueli zärtlich bei der Schulter zu nehmen und zu sagen: «Achte nicht auf das, was er sagt. Er ist Maurermeister, und der Sinn für solche Feinheiten geht ihm ab. In seiner Welt ist kein Platz für Kreativität. Es ist Unsinn, wenn er sich in unsere Angelegenheiten mischt. Er ist nicht in der Lage zu erkennen, dass Arbeit auch etwas mit Gefühl zu tun hat. Wenn es keine Leute gegeben hätte, die in der Arbeit des Maurers mehr gesehen hätten, als Stein auf Stein zu schichten, gäbe es heute keine kunstvollen Bauten. Aber die armen Leute haben kein Geld für andere Maurer als deinen Vater, und sie haben weder ihre eigene Fantasie, die sie innerlich bereichert, noch haben sie das Geld, um jemanden für so etwas zu bezahlen. Dein Vater kann nichts anderes, als Stein auf Stein zu setzen. Man muss allerdings dazu sagen, dass er ein wirklich guter Maurer ist, denn sein Ruf ist bis nach Appenzell gedrungen.»
Ueli konnte sich noch gut erinnern, dass der Vater früher oft in Appenzell gearbeitet hatte und von dort immer Süssigkeiten mitbrachte; beim Gedanken daran lief ihm jetzt noch das Wasser im Mund zusammen. Er und seine vier Geschwister warteten ungeduldig und voller Vorfreude auf seine Rückkehr. Wenn sie ihn aus der Ferne kommen sahen, rannten sie ihm entgegen und warfen sich ihm in die Arme. Der Vater gab jedem von ihnen ein, zwei Bonbons, und die Kinder setzten sich auf einen Stein, um sie glücklich zu lutschen. Diese Momente gehörten zu Uelis glücklichsten Kindheitserinnerungen.
Nun war gar nicht mehr an solche Freuden zu denken. Er war sechzehn Jahre alt und würde bald heiraten. Wer weiss, vielleicht bekomme ich bald selbst Kinder und bringe ihnen Süssigkeiten, dachte er. Zu heiraten hätte er sich schon vorstellen können, nur dass es Rösli sein sollte, machte ihn wütend. Der einzige Mensch, mit dem er über das Thema sprechen konnte, war seine Mutter, doch als er ihr eröffnete, dass er Rösli nicht zur Frau haben wolle, bekam er zur Antwort: «Das eigene Kupfer ist besser als fremdes Gold.»
Uelis Mutter Anna Maria hatte eine Sprachbehinderung, deshalb ging sie Gesprächen mit Fremden aus dem Weg. Die Worte stolperten und holperten ihr in Bruchstücken über die Lippen. Die Familie verstand zwar auch nicht immer, was sie meinte, konnte es aber meist erraten. Manchmal, wenn sie sich gar nicht auszudrücken vermochte, verkroch sie sich in einen Winkel und hing düsteren Gedanken nach. Märchen konnte sie ihren Kindern nie erzählen. Aber sie machte Faxen, um die Kinder aufzuheitern, bemalte sich das Gesicht mit Kohle, verkleidete sich und imitierte die Tiere. Immer morgens, wenn sie zum Melken in den Stall ging, sprach sie lang mit den Tieren. Es war, als erzählte sie den Kühen, Schafen, Ziegen und Hühnern im Stall all das, was sie ihrer Familie nicht sagen konnte.
Der Vater spottete darüber: «Dieses Weib versteht sich am besten mit dem Vieh, soll sie doch gleich im Stall schlafen!» Die Mutter hörte stumm zu, wenn er solche gefühllosen, überheblichen Angriffe machte.
Wenn man dem Vater widersprach oder ungehorsam war, setzte es eine gehörige Tracht Prügel. Den grössten Teil davon bekam die Mutter ab. In den Augen des Vaters war sie ein wertloses, nichtsnutziges Geschöpf, das nichts anderes als Schläge und Verachtung verdiente. Der Anlass für Hiebe und Ohrfeigen konnte sein, dass zu wenig Salz in der Suppe war, die Kinder beim Spiel lärmten oder er einen seiner Socken nicht fand. War die Mutter schwer geschlagen worden, ging sie zum Kleinberg, um dort im Wald zu verschwinden, damit die Kinder ihr Schluchzen nicht hören sollten. An solchen Tagen sassen Ueli und seine Geschwister stundenlang am Fenster und warteten auf sie.
Oft betete Ueli dann: «Lieber Gott, bitte mach, dass die Mutter nicht mehr wiederkommt. Rette sie vor diesem Grobian. Versteck sie im Wald. Mach, dass nur wir sie sehen können, wenn wir sie brauchen. Nur so ist sie vor der Grausamkeit des Vaters geschützt.»
Eine Weile glaubte er dann, Gott hätte die Gebete erhört, die Mutter würde nicht wiederkommen und wäre erlöst. Unvergleichliche Seligkeit erfüllte ihn, wenn er sich vorstellte, wie er die Mutter im Wald besuchte, wo sie den ganzen Tag mit den Vögeln und wilden Tieren sprach und sich nicht mehr grämen musste.
Wenn die Mutter viel später mit einem Bündel Holz auf dem Rücken heimkehrte, liefen die Geschwister freudig zur Tür und fielen ihr um den Hals. In solchen Momenten bemerkte Ueli erst richtig, wie sehr er die Mutter liebte. Es war ihm doch lieber, wenn sie nicht im Wald, sondern zu Hause lebte.
Dann betete er noch einmal: «Lieber Gott, ich habe etwas Falsches gebetet, aber du hast mich verstanden. Eigentlich wollte ich, dass der Vater nicht mehr heimkommt. Bitte lieber Gott, mach, dass er nicht mehr heimkommt!»
Als er der Mutter einmal von diesen Gebeten erzählte, ermahnte sie ihn: «Aber, mein Junge, wie kannst du Gott um so etwas bitten? Wovon sollten wir denn leben, wenn dein Vater nicht mehr da wäre? Wir hätten noch nicht einmal Brot im Haus! Ich will nicht, dass du Gott noch einmal um so etwas bittest.»
Nun war es also beschlossene Sache, dass Ueli seine Cousine heiraten würde. An den Gedanken musste er sich erst gewöhnen. Bei den Schreinerarbeiten mit seinem Grossvater wendete sich Ueli noch stärker den feinen Details zu. Er hatte gelernt, viele verschiedene Dinge anzufertigen: Holzvertäfelungen, Fensterrahmen, mit Reliefs beschnitzte Haustüren, Tische, Bänke, Schränke, Käseformen. Sogar die Tür der Dorfkirche machte er. Sorgsam fügte er auf der Werkbank Bretter aus Kirschbaumholz aneinander, dann stellte er im Kopf lange Berechnungen an und murmelte dazu, als spräche er mit dem Holz, schliesslich setzte er mit dem Bleistift viele Markierungen, um dann die Motive, die der Grossvater auf braunes Papier gezeichnet hatte, mit grösster Sorgfalt in das Holz zu schnitzen. Stundenlang stach er Vertiefungen ins Holz, betrachtete das Schnitzwerk mit halb zugekniffenen Augen aus verschiedenen Blickwinkeln, strich mit den Fingerspitzen über das entstehende Relief, blies die Späne fort und liess so die einzelnen Motive des Reliefs hervortreten. Diese Arbeit tat er mit grosser Freude.
Als die Kirchentür fertig war, strich der Grossvater mit der flachen Hand zärtlich über deren Oberfläche und lobte ihn: «Sehr schön. Nicht einmal ich hätte das fertig gebracht. Die Reliefs sind makellos. Die Proportionen stimmen genau. Dabei bist du erst sechzehn. Aus dir wird einmal ein sehr guter Schreiner. Wie sehr habe ich mich abgemüht, deinem Vater das beizubringen! Dieser Steinemann konnte in deinem Alter noch nicht einmal einen Nagel gerade einschlagen. Gut, ich geb’s zu, ein guter Maurer ist schon aus ihm geworden, aber Stein ist schwerer als Holz, und man braucht beim Mauern viel Kraft. Nun schau ihn dir an, er ist schon ganz verbraucht und sieht beinahe älter aus als ich. Na ja, lassen wir das. Diese Tür wird dir ein Tor zur jenseitigen Welt und in der diesseitigen viele Türen öffnen. Gott lässt gute Taten nicht unbelohnt. Wenn du in Gottes Diensten Gutes tust, gibt er es dir vielfach zurück. Jesus kam nach einer langen Wanderung einmal durch ein Dorf und war sehr erschöpft und hungrig. Da kam ein Hirte zu ihm und gab ihm eine Schale Milch. Jahre vergingen, bis Jesus wieder durch dieses Dorf kam. Der Bauer lief eilig zu ihm und sprach: ‹Herr, vor vielen Jahren habe ich Euch eine Schale Milch zu trinken gegeben, das entspricht einem Tageslohn. Seit dieser Zeit gibt meine Kuh drei Schalen Milch am Tag.› Jesus wandte sich zu dem Hirten und sprach: ‹Was du Gott Gutes tust, wird dir tausendfach vergolten.› Dann ging er weiter.»
Das Lob des Grossvaters für die Kirchentür, die Ueli mit Bravour vollendet hatte, gab ihm Selbstvertrauen. In seinem Streben, ein guter Schreiner zu werden, war er ein grosses Stück vorangekommen. Die Arbeit lag Ueli, doch der Hauptgrund seines Erfolgs war, dass der Grossvater nimmer müde wurde, ihn in alle Geheimnisse dieses Berufs einzuweihen. Der Grossvater war der beste Schreiner und Zimmermann in der ganzen Umgebung. Er tat seine Arbeit hauptsächlich für Gotteslohn und mit dem Herzen. Ständig betonte er, dass auch Jesus Schreiner gewesen sei. Wenn es eine gute Sache zu tun gab, eilte er unverzüglich hin.
Die Grossmutter hingegen beklagte sich. «Wir haben noch nicht einmal Mehl im Haus, und du arbeitest für nichts. Du bist doch nicht der Herrgott, so dass du jedermann helfen musst. Wie oft gehst du zur Arbeit und kommst mit leeren Händen heim. In der ganzen Gegend gibt es kein Haus, in dem du nicht gearbeitet hast. Du arbeitest Tag und Nacht für Leute, die haben zehnmal mehr Mehl in der Vorratskammer als wir. Die Leute nutzen dich aus, weil sie wissen, dass du ein weiches Herz hast: Schreib es auf, ich komme später und zahle. In deinem Heft über die offenen Beträge ist bald keine Seite mehr frei!»
Der Grossvater nahm sich diese Nörgeleien seiner Frau niemals zu Herzen. «Ihr Weibsbilder sitzt den ganzen Tag auf der Ofenbank und häkelt Spitzen oder lasst die Spindel surren. Von dort aus schaut ihr auf die Welt, aber es gibt so viel, was ihr da nicht sehen könnt.»
Die Grossmutter war nicht auf den Mund gefallen und legte nach: «Nun hör mir mal gut zu, du grosser Kindskopf! Ich habe von ganz oben auf dem Säntis auf die Welt heruntergeschaut. Ich war sogar auf dem Hohen Kasten und hab von dort aufs Rheintal und nach Österreich geschaut. Und was hab ich gesehen? Überall nur Berge und Wald. Hast du mich einmal in eine Stadt ausgeführt? Von welcher Welt redest du denn? Sogar der Schornsteinfeger Zwicker hat seine Frau zum Einkaufen nach St. Gallen mitgenommen. Und dort hat er ihr Geschenke gekauft. Die Frau hat von den Häusern und Geschäften erzählt, da kann man nur neidisch werden! Du weisst das natürlich nicht, weil du so etwas auch noch nie gesehen hast! Du kommst ja höchstens bis auf die Schwägalp und wieder zurück nach Urnäsch. Das ist eben mein Schicksal. Alles, was ich am Leib trage, hab ich selbst genäht, und meine Kleider sind überall geflickt. Ich möchte auch ab und zu ein Stück Fleisch essen! Aber du bist ja nicht einmal imstande, die Wildschweine und Rehe im Wald zu jagen, die Gott uns allen gegeben hat. Wenn mir Gott nicht einen Mann gegeben hätte, der für die anderen umsonst arbeitet, wär mir all das erspart geblieben!»
Der Grossvater erwiderte die Klagen seiner Frau bloss mit einem leisen Schmunzeln in seinen Bart hinein.
Die ersten Gehversuche als Zimmermann
Es war im September 1838. Bei ungewöhnlicher Hitze sammelten Ueli und sein Grossvater im Wald Pilze.
«Mein Gott, so eine Hitze, und das zu dieser Jahreszeit!», stöhnte der Grossvater. «Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Dieser warme Föhnwind dörrt alles aus. Es ist erst eine Woche her, da hat es ununterbrochen geregnet, aber jetzt ist schon alles wie versengt. Dass die Pilze so aus dem Boden schiessen, muss an diesem warmen Wetter liegen.»
Genau in diesem Moment sahen sie am Horizont dicke Rauchschwaden aufsteigen, es musste im Dorf Heiden sein. Ueli merkte, wie der Grossvater vor Furcht zitterte.
«Was für ein Qualm! Ich hab mein Lebtag kein so grosses Feuer gesehen.»
Sofort machten sie sich auf den Rückweg. Einen Korb Pilze hatten sie gesammelt, beim Tragen wechselten sie sich ab. Auf dem Heimweg sprach der Grossvater rhythmisch vor sich hin, als sänge er ein Lied:
«Meine Damen, meine Herren!
Die Speisekarte für diesen Winter:
Pilzsuppe hmmm
Eingelegte Pilze hmmm
Gebratene Pilze hmmm
Graupen mit Pilzen hmmm
Jawohl, wie man schon sieht
Diesen Winter gibt’s sonst nichts
Als lauter Pilze!»
Ueli fügte hinzu: «Etwas hast du aber vergessen, Pilzgrossvater!»
«Was denn?»
«Pilzschnaps!»
«Du bist doch erst zwölf, du kleiner Pilzkopf, aber du weisst wohl schon alles!»
«Das liegt vielleicht daran, dass ich dein Enkel bin!»
Sie kicherten.
Schlechte Nachrichten verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Heiden lag sieben Stunden Fussmarsch entfernt. Doch jedermann weit und breit wusste bereits, dass in der Werkstatt des Schmieds Konrad ein Brand ausgebrochen war, dessen Flammen auf das ganze Dorf übergegriffen hatten, so dass die aneinander gebauten Häuser sämtlich abgebrannt waren.
Sofort am Tag nach dem Brand versammelte der Grossvater die ganze Familie Kurt um sich, um zu verkünden: «In einer solchen Lage kann man die Heidener nicht im Stich lassen. Wir gehen gleich morgen dorthin. Niemand weiss, wie lange wir bleiben werden. Für euch hier wird das Leben vielleicht mühselig, solange wir weg sind» – als er das sagte, wandte er den Blick den Frauen zu, um sie eindringlich anzusehen – «aber ihr habt wenigstens ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Die Obdachlosen dort haben nicht einmal das. Der Winter steht vor der Tür. Wenn wir ihnen nicht helfen, erfrieren sie. Und in den Augen unseres Herrgotts sind dann auch wir gestorben.»
Am nächsten Morgen ritten Ueli Kurt, der Grossvater, der Vater und der Onkel auf den fünf Rössern, die es im Dorf gab, nach Heiden. Die Besitzer der Pferde hatten sie der Familie Kurt mit auf den Weg gegeben, denn zu Fuss wäre es unmöglich gewesen, das ganze Zimmermanns- und Maurerwerkzeug bis nach Heiden mitzunehmen, und sie schleppten alles mit, was sie an Werkzeug besassen. Einer der Pferdebesitzer begleitete sie, um die Tiere wieder zurückzubringen.
Auch viele andere Urnäscher vergassen ihre eigene Armut. Sie packten alles in Säcke, was sie an Lebensmitteln und Kleidung entbehren konnten und machten sich nach Heiden auf.
Dass Ueli mit seinen zwölf Jahren vom Grossvater mitgenommen und wie ein Erwachsener behandelt wurde, gefiel dem Jungen natürlich sehr und erfüllte ihn mit Stolz. Als sie unterwegs eine Verschnaufpause einlegten, ging Ueli zum Grossvater, um ihn zu fragen: «Was bedeutet es, wenn wir in den Augen unseres Herrgotts gestorben sind?»
Der Grossvater fuhr sich mit der Ellbogenbeuge über die Nase, um den Schweiss abzuwischen. «Von wem hast du dieses leere Gerede?»
«Von dir! Erst gestern hast du gesagt, wenn wir den Heidenern nicht helfen, sterben sie alle, und dann sind wir für unseren Herrgott auch tot. Hast du das etwa vergessen?»
«Das soll ich gesagt haben?»
«Ja, du, und zwar vor der ganzen Familie! Gestern Abend erst, als du uns alle zusammengerufen hast.»
Schnell machte der Grossvater sich auf und ging weiter, als liefe er vor etwas davon. Ueli verstand die Antwort trotzdem. Der alte Mann war keiner, der auf jede Frage eine Antwort parat hatte. Fragen, auf die er keine Antwort wusste oder keine geben wollte, überhörte er einfach oder wich ihnen aus.
Als sie nach Heiden kamen, erstarrten sie. Der Grossvater stammelte: «Um Gottes willen! Was für eine Brandkatastrophe, unglaublich! Ich hatte nicht gedacht, dass es so schlimm wäre.» Er legte Ueli die linke Hand auf die Schulter und deutete mit der rechten auf die Überreste eines Gebäudes. «Das Haus da hat den Steiners gehört. Alles ausser den Grundmauern haben zwei Meister aus Heiden und ich gebaut. Die ganzen Verzierungen an der Fassade habe ich geschnitzt. Du warst damals noch nicht auf der Welt.»
Das Dorf war kohlrabenschwarz. Vor den Mauerresten sassen verzweifelt blickende Menschen, deren Kleidung, Haare und Gesichter ebenso schwarz waren wie ihre verkohlten Häuser. Auf den Wegen war einfacher, kleiner Hausrat aufgestapelt. Die Dorfbewohner hatten alles, was sie vor den Flammen bewahren konnten, weit entfernt von den Brandherden aufgeschichtet.
Alte Leute und Kinder lagen ausgestreckt auf Matratzen, die kreuz und quer auf die Wege geworfen waren. Frauen kochten in grossen Kesseln auf offenem Feuer Graupensuppe und Ribelmais. In manchen Kesseln schmorte das Fleisch der verendeten Tiere und wurde Einheimischen wie von weither kommenden Fremden gereicht. Die Menschen hatten sich auf der Strasse versammelt. In ihren Gesichtern erkannte man die schrecklichen Spuren von düsterer Hoffnungslosigkeit und Erschöpfung. Aus vielen Ruinen stieg immer noch pechschwarzer Rauch auf. Alles war abgebrannt ausser einer Handvoll Häuser, die etwas abseits des Dorfs lagen.
Als der älteste Sohn von Albert Sonderegger beim Versuch, Mobiliar zu retten, den Flammen zum Opfer fiel, schrie Pfarrer Hohl in einem fort: «Ins Feuer zu gehen bedeutet, sich gegen Gott aufzulehnen, es bedeutet, ihn zu missachten! Das ist eine unverzeihliche Sünde. Wenn ihr überlebt, wird Gott euch wieder Bett und Tisch, Schüsseln und Geschirr bescheren. Aber dazu müsst ihr überleben. Gott, der Allmächtige, gibt euch alles, was ihr braucht, wenn ihr euch nur ehrlich darum bemüht. Geht nicht ins Feuer! Euer Leben ist doch wertvoller als ein hölzerner Milchtopf! Lehnt euch nicht gegen Gott auf!»
Ein Heidener reichte den vier Ankömmlingen Wasser aus einem Tonkrug. «Seht ihr, genau hundertfünfzig Häuser sind abgebrannt. Nur sieben Häuser konnten erhalten werden. Dafür danken wir Gott. Alles geschieht nach seinem Willen.»
Genau in diesem Moment stieg Pfarrer Hohl auf eine Erhöhung auf dem Dorfplatz vor der halb abgebrannten Kirche, um





























