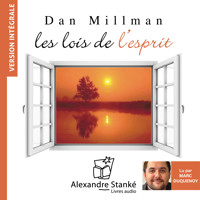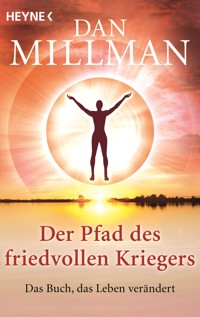
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
Das Kultbuch des berühmten Lebenslehrers
Eines Nachts an einer Tankstelle in Kalifornien: Der junge Sportstudent Dan Millman stößt auf einen wunderlichen alten Mann. Eine Begegnung, die zum Wendepunkt in Dans Leben wird. Socrates führt ihn auf eine abenteuerliche innere Reise: durch Licht und Dunkelheit, Triumph und Zweifel – hin zum Erwachen in einer neuen, grenzenlosen Bewusstheit. Dieses Buch hat weltweit Millionen von Lesern begeistert. Es lässt jenes innere Potenzial entdecken, das in jedem von uns steckt: die unendliche Kraft, Weisheit und Genialität des friedvollen Kriegers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DAS BUCH
Dieses Buch ist eine innere Reise, auf die uns der friedvolle Krieger mitnimmt. Ein Pfad, der in eine versunkene, fast vollständig vergessene Welt führt. In der Tiefe unseres Herzens, in unseren geheimnisvollen Träumen hat sie jedoch nie aufgehört zu existieren. Inmitten des Lärms, der Hetze und des Drucks unseres Alltags lebt sie im Verborgenen weiter: die Kraft, die Weisheit und die Genialität des friedvollen Kriegers – in jedem Einzelnen von uns.
Dies ist ein Lehrbuch, das nicht belehrt. Es lässt das Bewusstsein in die höchsten Höhen des Wunderbaren aufsteigen und bleibt doch ganz und gar irdisch, praktisch und verständlich. Der Humor, die Spannung und die Inspiration dieser unglaublichen, dabei absolut glaubwürdigen Geschichte sorgen dafür, dass die Reise zu uns selbst zum kostbaren, unvergesslichen Erlebnis wird.
DER AUTOR
Dan Millman, in jungen Jahren einer der besten Kunstturner Amerikas, später Coach von Spitzensportlern, unterrichtet seit nunmehr fast zwanzig Jahren verschiedenste Formen des körperlich-geistigen Trainings. Seine Werke über die Lebenshaltung des »friedvollen Kriegers« sind zu wahren Kultbüchern geworden und haben eine Auflage von mehreren Millionen Exemplaren in neunundzwanzig Sprachen erreicht.
www.peacefulwarrior.com
DAN
MILLMAN
Der Pfad des
friedvollen Kriegers
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Thomas Lindquist
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel Way of the Peaceful Warrior im Verlag H. J. Kramer Inc., P.O. Box 1082, Tiburon, CA 94920, USA.
Copyright © 1980, 1984 by Dan Millman
Copyright © 2000 der deutschsprachigen Ausgabe by Ansata Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH , Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © 2013 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Guter Punkt GmbH & Co. KG
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-07875-1V006
www.heyne.de
Inhalt
Danksagung
Vorwort
Die Tankstelle am Rainbow’s End
ERSTES BUCH
Sturm der Veränderung
1 Ein Hauch von Magie
2 Das Netz der Illusionen
3 Der Sprung in die Freiheit
ZWEITES BUCH
Lehrjahre eines Kriegers
4 Das Schwert wird geschärft
5 Der Weg in die Berge
6 Freude jenseits des Denkens
DRITTES BUCH
Glücklich ohne Grund
7 Die letzte Suche
8 Die Pforte öffnet sich
Epilog: Lachen im Wind
Dem allerhöchsten Friedenskrieger,
dessen leuchtender Abglanz Socrates ist,
der keinen und doch viele Namen hat
und der unser aller Ursprung ist.
Danksagung
Dank und Anerkennung möchte ich allen aussprechen, die unmittelbar oder indirekt zur Entstehung dieses Buches mitgeholfen haben. Danken möchte ich vielen Lehrern, Schülern und Freunden, die mir Geschichten aus der großen spirituellen Tradition erzählt haben und mir Inspiration schenkten. Mein besonderer Dank gilt Hal und Naomi vom Verlag H. J. Kramer, die alles taten, um einen möglichst weiten Leserkreis zu erreichen.
Ganz herzlich danken möchte ich auch meiner Frau Joy, die mir so viel Kraft gab, und meinen Eltern, Herman und Vivian Millman, die mir mit ihrer Liebe und ihrem Vertrauen den Mut schenkten, voranzugehen auf dem Weg.
Krieger, Krieger heißen wir,
für leuchtende Tugend kämpfen wir,
für hohes Streben, für erhabene Weisheit –
darum nennt man uns Krieger.
Anguttara Nikaya
Vorwort
Sonderbare Begebenheiten haben sich in meinem Leben zugetragen, und alles fing an im Dezember 1966, in meinem ersten Studienjahr an der University of California, in Berkeley. Und zwar eines Morgens, kurz nach drei, als ich Socrates zum ersten Mal begegnete – an einer Tankstelle, die die ganze Nacht offen hatte. Seinen wirklichen Namen wollte er nicht verraten, aber nachdem wir in dieser Nacht eine Weile miteinander geredet hatten, taufte ich ihn auf den Namen des alten griechischen Weisen. Der Name gefiel ihm, und so blieb es dabei. Diese Zufallsbegegnung und die Abenteuer, die daraus folgten, haben mein Leben verändert.
Bis dahin, vor 1966, hatte das Leben mich immer nur angelächelt. Aufgewachsen war ich bei liebevollen Eltern, in einem geborgenen Zuhause. Später gewann ich in London die Weltmeisterschaft auf dem Trampolin, ich machte Reisen durch Europa und genoss manche Ehrungen. Das Leben schenkte mir reichen Lohn – aber keine Zufriedenheit, keinen inneren Frieden.
Heute weiß ich, dass ich all diese Jahre geschlafen hatte. Ich hatte nur geträumt, ich sei wach. Bis ich Socrates traf, meinen Freund und Lehrer. Vorher war ich immer der Meinung gewesen, ich hätte von Geburt ein Anrecht auf ein erfülltes Leben, reich an Freuden und an Erkenntnissen. Nie war es mir in den Sinn gekommen, dass ich erst lernen müsste, richtig zu leben; dass es bestimmte Fähigkeiten gab und eine gewisse Art, die Welt zu sehen, die ich erst kennenlernen musste, bevor ich erwachen konnte für ein einfaches, glückliches und unkompliziertes Leben.
Socrates lehrte mich, meine Irrwege zu erkennen, indem er mir seinen Weg zeigte – den Weg des Friedenskriegers.
Immer wieder konnte er mich auslachen, weil ich mir selbst so viele Sorgen und Probleme schuf – bis ich dann lernte, die Welt mit seinen Augen zu sehen, die voll Weisheit und Güte waren. Er ließ mir keine Ruhe, bis ich entdeckte, was es bedeutet, ein Leben als Krieger zu leben.
Oft saßen wir bis in die frühen Morgenstunden in seiner Tankstelle beisammen. Ich konnte ihm zuhören, mit ihm streiten und trotz allem mit ihm zusammen lachen. Dieses Buch beruht auf der Geschichte meines Abenteuers mit Socrates – aber es ist auch ein Roman. Der Mann, den ich hier Socrates nenne, hat wirklich gelebt. Aber seine Art, in meiner Welt in Erscheinung zu treten, war so vielfältig mit anderem verwoben, dass ich nicht immer sagen könnte, wo die Grenze liegt zwischen ihm und anderen Lehren und Erfahrungen.
Die Dialoge habe ich frei nacherzählt, manchmal habe ich die zeitliche Reihenfolge verändert. Und ich habe Gleichnisse und Geschichten eingestreut, um seine Lehren zu verdeutlichen, die ich – dies war Socrates’ Wille – weitergeben sollte.
Unser Leben ist keine Privatsache. Eine Geschichte, die du erlebt hast, kann auch für andere hilfreich sein, aber nur, wenn du sie weitererzählst. Und so möchte ich meinen Lehrer ehren, indem ich dich teilhaben lasse an seinem tiefen Wissen und seinem Humor.
Die Tankstelle am Rainbow’s End
Jetzt fängt das Leben an«, so dachte ich, als ich Mom und Dad »Goodbye« winkte und mich mit meiner alten Karre, Marke Valiant, in den Straßenverkehr stürzte. Hinten im Kofferraum und auf den Sitzen lagen die Siebensachen, die ich für mein erstes Collegejahr eingepackt hatte. Ich war gut aufgelegt, ich war frei und zu allem bereit.
Ich drehte das Radio auf, sang zur Musik und flog über die Autobahn nach Norden. Von Los Angeles ging es über die Grapevine und weiter über die Nationalstraße 99, vorbei an sattgrünen Feldern am Fuß der San Gabriel Mountains.
Es dämmerte schon, als ich die Serpentinen von den Oakland Hills hinunterrollte. Phantastisch, der Ausblick auf die Bucht von San Francisco. Immer aufgeregter wurde ich, je näher ich der Studentenstadt kam, dem Campus von Berkeley.
Mein Platz im Studentenheim war schnell gefunden. Ich packte meine Sachen aus, und dann stand ich staunend am Fenster und sah die Golden Gate und die funkelnden Lichter von San Francisco in der Ferne.
Zuerst aber hieß es, die nähere Umgebung erforschen. Fünf Minuten später schlenderte ich die Telegraph Avenue entlang, ich bestaunte die Schaufenster und schmeckte die herbe Luft Nordkaliforniens und all die verwirrenden Düfte, die aus kleinen Straßencafés herüberwehten. Ganz überwältigt wanderte ich bis Mitternacht hin und her auf romantischen Parkwegen des Uni-Campus.
Am nächsten Morgen, gleich nach dem Frühstück, schaute ich nur das Harmon-Gymnasium an, unser Sport-Institut, und die Turnhalle, wo ich von nun an trainieren würde. Jeden Tag in der Woche, sechs schweißtreibende, muskelzerrende, saltoschlagende Stunden lang! Mein Traum war, Weltmeister zu werden.
Schon am zweiten Tag fürchtete ich, in einer Flut von Studenten, Seminaren und Stundenplänen zu ertrinken. Aber ich schaffte es irgendwie. Und dann flossen die Monate dahin, im Wechsel der freundlichen Jahreszeiten in Kalifornien. Im Unterricht überlebte ich – in der Turnhalle aber lebte ich. »Du bist der geborene Akrobat«, hatte ein Freund mal zu mir gesagt. Äußerlich – ja: schmal und drahtig, die dunklen Haare ordentlich kurzgeschnitten. Und für gewagte Kunststückchen hatte ich schon als Kind etwas übrig. Es machte mir Spaß, die Angst in mir wachzukitzeln. Die Turnhalle war meine Zuflucht, mein Zuhause. Hier fand ich Spannung, Herausforderung und auch eine gewisse Zufriedenheit.
Bevor mein zweites Studienjahr um war, flog ich nach Europa und vertrat den Kunstturner-Verband der USA bei internationalen Wettkämpfen. Ich wurde Weltmeister auf dem Trampolin. Meine Pokale und Trophäen stapelten sich in einer Ecke meines Zimmers. Mein Foto erschien regelmäßig in der Zeitung, und die Leute sprachen mich auf der Straße an. Auch Mädchen lachten mich an. Zum Beispiel Susie, die appetitliche, süße Freundin – mit ihrem kurzen blonden Haar und ihrem Zahnpasta-Reklamelächeln –, klopfte immer öfter an meine Tür. Sogar das Studium lief ziemlich glatt. Ich fühlte mich ganz obenauf.
Aber im Herbst 1966, im dritten Studienjahr, fiel ein geheimnisvoller dunkler Schatten auf mein Leben. Ich wohnte nicht mehr im Studentenheim, sondern allein in einer kleinen Studentenbude etwas abseits vom Haus meines Vermieters. Und ich litt zunehmend an einer Traurigkeit, die mich sogar inmitten all meiner Erfolge bedrückte.
Dann fing es an mit diesen Albträumen. Schweißgebadet schrak ich fast jede Nacht mit einem Ruck aus dem Schlaf. Und fast immer war es derselbe Traum:
Ich wandere durch eine dunkle Straße. Hohe Häuser, ohne Fenster und Türen, ragen im düster wirbelnden Nebel empor.
Eine dürre Gestalt, schwarz vermummt, kommt mir entgegen. Ich spüre es mehr, als ich es sehe: ein grauenhaftes Gespenst, ein weißlich schimmernder Schädel mit schwarzen Augenhöhlen, die mich anstarren. Tödliches Schweigen. Ein weißer Knochenfinger deutet auf mich. Die Knochenhand krümmt sich zu einer Kralle, die mich heranwinkt. Ich fröstele.
Jetzt taucht ein weißhaariger Mann hinter dem Schreckgespenst auf. Sein Gesicht leuchtet friedlich, und es ist faltenlos glatt. Er geht mit lautlosen Schritten. Ich spüre, er ist meine einzige Hoffnung auf Rettung. Nur er hat die Macht, mich zu befreien, aber er sieht mich nicht. Und ich kann ihn nicht rufen.
Das schwarz verhüllte Totengerippe dreht sich um und geht auf den weißhaarigen Mann los. Er aber lacht ihm ins Gesicht. Ich stehe wie betäubt und kann nur zuschauen, wie der Tod den Mann zu packen versucht. Im nächsten Moment aber geht das Gespenst auf mich los. Doch der Mann packt es an seiner Kutte und schleudert es in die Luft.
Und plötzlich ist der Schnitter Tod verschwunden. Der Mann mit dem leuchtend weißen Haar sieht mich an und heißt mich mit ausgebreiteten Armen willkommen. Ich gehe zu ihm hin, ich gehe direkt in ihn hinein und verschmelze mit ihm. Als ich an mir hinunterschaue, sehe ich, dass ich eine schwarze Kutte anhabe. Ich hebe die Hände und sehe, dass es gebleichte weiße Knochen sind, zum Gebet gefaltet. Ich erwache – immer mit einem Schreckensschrei.
Eines Abends, es war Anfang Dezember, lag ich im Bett und lauschte dem Wind, der durch eine Fensterritze heulte. Ich konnte sowieso nicht schlafen, also stand ich auf, zog meine Levi’s-Jeans und die Daunenjacke an und lief in die Nacht hinaus. Es war kurz nach drei Uhr.
Ziellos marschierte ich drauflos und atmete in tiefen Zügen die kalte Nachtluft ein. Ich schaute zum sternklaren Himmel hinauf und horchte auf die wenigen Geräusche in den nächtlichen Straßen. Ich hatte Hunger bekommen in der Kälte, darum beschloss ich, mir an einer Nachttankstelle ein paar Kekse und einen Drink zu holen. So lief ich, die Hände tief in die Taschen meiner Jacke vergraben, über den schlafenden Campus, bis ich in der Ferne die Lichter der Tankstelle sah: eine leuchtende Oase inmitten der toten Wüste von Stadtkneipen, Kinos und Kaufhäusern.
Als ich bei der Werkstatt neben der Tankstelle um die Ecke bog, stolperte ich beinah über einen Mann, der dort, mit dem Rücken zur Wand, im Schatten saß. Ich fuhr erschrocken zurück. Der Mann hatte eine rote Wollmütze auf, er trug graue Cordhosen, weiße Socken und offene Japan-Sandalen. Ich bezweifelte, ob seine leichte Windjacke ihm viel Schutz bot gegen die Kälte. Das Thermometer an der Wand zeigte knapp über null Grad!
Ohne aufzublicken, sagte er mit einer volltönenden, beinah singenden Stimme: »Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe.«
»Ach, schon gut. Hätten Sie vielleicht ein Soda, Pop?«
»Hier gibt es nur Fruchtsaft – und nenn mich nicht Pop!«, sagte er. Und dann drehte er sich ganz zu mir um, lachte freundlich und nahm die Mütze ab. Er hatte volles weißes Haar – und er lachte!
Dieses Lachen! Wo hatte ich es schon mal gesehen? Ich starrte ihn fassungslos an. Ja – es war der alte Mann aus meinem Traum! Das weiße Haar, das klare, faltenlose Gesicht, ein großer, schlanker Mann von fünfzig, vielleicht sechzig Jahren.
Und wie er lachte. Trotz meiner Verwirrung fand ich irgendwie die Tür mit der Aufschrift »Büro«. Ich stieß sie auf, und mir war, als würde ich damit eine Tür zu neuen Dimensionen aufstoßen. Drinnen ließ ich mich zitternd auf ein altes Sofa fallen und fragte mich, woher dieses komische Gefühl kommen mochte? Was würde durch diese Tür in mein wohlgeordnetes Leben einbrechen?
Ich schaute mich um in diesem Büro. Welch ein Unterschied zum üblichen, sterilen Durcheinander einer normalen Tankstelle. Das Sofa, auf dem ich saß, war mit einer verschlissenen, aber in bunten Farben leuchtenden mexikanischen Decke bezogen. Links neben dem Eingang, auf einem Regal, säuberlich geordnet, allerlei Nützliches für den Autofahrer: Landkarten, Sicherungen, Sonnenbrillen und dergleichen. Hinter einem kleinen Schreibtisch aus dunklem Nussbaum ein Stuhl, mit braunem Cord gepolstert. Ein Wasserspender neben der Tür mit dem Schildchen »Privat«. Noch eine zweite Tür, die zur Werkstatt nebenan führte.
Auffallend war die freundliche Atmosphäre in diesem Raum. Der Fußboden war in seiner ganzen Breite mit einem hellgelben Veloursteppich bespannt. Die Wände waren frisch gekalkt. Ein paar schöne Landschaftsbilder sorgten für farbliche Akzente. Die Lampen verbreiteten sanftes Licht – ein willkommener Gegensatz zum Neongeflimmer draußen. Der ganze Raum vermittelte einen Eindruck von Wärme, Geborgenheit und Ordnung.
Wie hätte ich wissen können, dass er für mich ein Ort ungeahnter Abenteuer sein würde? Ein Ort voller Schrecken, Magie und Romantik. Damals dachte ich: Was hier nur noch fehlt, ist ein gemütlicher Kamin!
Inzwischen hatte ich mich beruhigt. Mein Atem ging wieder gleichmäßiger, und meine Gedanken wirbelten nicht mehr so im Kopf herum. Die Ähnlichkeit dieses Mannes mit dem Mann aus meinem Traum war doch rein zufällig! Seufzend stand ich auf, zog den Reißverschluss meiner Jacke hoch und trat hinaus in die kühle Nacht.
Er saß noch immer dort. Im Vorbeigehen sah ich ihm ins Gesicht – und da sprang etwas wie ein elektrischer Funke aus seinen Augen auf mich über. Diese Augen! Solche Augen hatte ich noch bei keinem Menschen gesehen. Sie schwammen in glitzernden Tränen, schien mir. Aber dann sah ich in diesem Glitzern den Abglanz der Sterne. So tief nahm sein Blick mich auf, dass mir war, als sei der ganze Sternenhimmel nur ein Widerschein seiner leuchtenden Augen. Ich blieb unwillkürlich stehen und verlor mich in diesem Blick – dem fragenden, vertrauensvollen Blick eines Kindes.
Ich weiß nicht, wie lange ich dort so stand. Vielleicht nur Sekunden, vielleicht Minuten, vielleicht länger. Plötzlich besann ich mich, wo ich war. »Gute Nacht«, murmelte ich verlegen und wandte mich hastig zur Straße.
Auf dem Bürgersteig blieb ich instinktiv stehen. Es war so ein komisches Kitzeln im Nacken. Ich wusste, er beobachtete mich. Vorsichtig spähte ich über die Schulter. Keine fünfzehn Sekunden waren vergangen – aber er stand dort oben auf dem Dach! Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt und schaute zum Sternenhimmel hinauf.
Fassungslos starrte ich den leeren Stuhl an, wo er eben noch gesessen hatte. Ich schaute hinauf, wo er stand. Es war unmöglich! Hätte ich zugeschaut, wie jemand an einem von Mäusen gezogenen Riesenkürbis ein Rad wechselt – es hätte mich weniger überrascht.
Ungläubig schaute ich, in der lautlosen Nacht, zu der schlanken Gestalt hinauf. Auch aus der Ferne war er eine respektgebietende Erscheinung. Die Sterne über mir klingelten wie vom Wind bewegte Glöckchen. Irgendwann drehte er den Kopf und sah mir direkt in die Augen. Er stand zwanzig Meter von mir entfernt, und doch glaubte ich seinen Atem an meinem Gesicht zu spüren. Mich schauderte – aber nicht vor Kälte. Jene Pforte, die aus der Wirklichkeit in die Träume führt, sprang wieder auf.
Ich starrte und staunte. »Ja?«, sagte er. »Kann ich was für dich tun?« – Prophetische Worte!
»Entschuldigen Sie, aber …«
»Du bist entschuldigt«, lachte er. Ich spürte, dass ich rot wurde. Allmählich fand ich die ganze Sache ärgerlich. Der Kerl spielte sein Spiel mit mir – aber ich kannte die Spielregeln nicht.
»Also, gut. Wie sind Sie da aufs Dach gekommen?«
»Aufs Dach gekommen?«, fragte er mit Unschuldsmiene.
»Ja doch. Wie sind Sie von diesem Stuhl« – ich deutete hin – »auf dieses Dach gekommen? Und zwar in knapp zwanzig Sekunden? Eben saßen Sie noch da, an die Wand gelehnt. Ich dreh mich um – und schon haben Sie …«
»Junge, ich weiß ganz gut, was ich getan habe. Du brauchst es mir nicht zu erzählen. Die Frage ist nur, weißt auch du, was du getan hast?«
»Sicher weiß ich, was ich getan habe!« Ich hatte allmählich genug. War ich denn ein kleines Kind, dass er mich schulmeistern durfte? Andererseits wollte ich unbedingt wissen, wie der Alte dies Kunststück bewerkstelligt hatte. Darum beherrschte ich mich und fragte höflich: »Verraten Sie mir bitte, Sir, wie sind Sie auf dieses Dach gekommen?«
Er blickte schweigend auf mich herunter, bis mir ganz mulmig wurde. Endlich antwortete er: »Mit einer Leiter. Dort hinten, an der Wand.« Er kümmerte sich nicht mehr um mich und betrachtete weiter die Sterne.
Ich lief schnell hinter die Werkstatt, und wirklich, da stand eine klapprige Leiter, schief an die Wand gelehnt. Doch die oberste Sprosse der Leiter war mindestens zwei Meter von der Dachkante entfernt. Und selbst wenn er sie benutzt hatte, was mir höchst zweifelhaft vorkam, blieb doch die Frage: Wie hatte er das in zwanzig Sekunden geschafft?
In der Dunkelheit landete etwas auf meiner Schulter. Ich wirbelte herum – und sah seine Hand. Irgendwie war er vom Dach heruntergekommen und hatte mich angesprungen. Nein, unmöglich! Es gab nur eine vernünftige Erklärung. Der Kerl musste einen Zwillingsbruder haben. Anscheinend machten die beiden Alten sich einen Spaß daraus, harmlosen Passanten einen Schreck einzujagen.
»Schön, Mister, wo ist Ihr Zwillingsbruder? Mich können Sie nicht zum Narren halten.«
Er verzog das Gesicht und lachte schallend. Na, ich hatte doch recht gehabt; hatte ihn bei seinem Schwindel ertappt. Doch als ich seine Antwort hörte, war ich gleich etwas weniger siegesgewiss.
»Und wenn ich einen Zwillingsbruder hätte? Meinst du, ich wollte mit einem Narren – wie du sagst – meine Zeit vertrödeln?« Lachend verschwand er um die Ecke der Werkstatt. Mir klappte die Kinnlade herunter. So eine Frechheit!, dachte ich. Ich konnte es nicht fassen.
Mit einem Sprung war ich bei ihm. Er ging unbekümmert in die Werkstatt und machte sich unter der Motorhaube eines zerbeulten grünen Ford-Lieferwagens zu schaffen. »Was?«, schimpfte ich. »Ich bin ein Narr, sagen Sie?« Es klang streitlustiger, als ich wollte.
»Wir sind doch allesamt Narren«, meinte er gutmütig. »Manche wissen es, und manche wissen es nicht. Du bist mir, so scheint’s, einer von letzterer Sorte. Ach ja, gib mir mal den Schraubenschlüssel herüber.«
Ich gab ihm seinen verflixten Schraubenschlüssel und wollte gehen. Zuvor aber musste ich es wissen: »Bitte, sagen Sie mir endlich, wie Sie in so kurzer Zeit auf das Dach gelangt sind? Es ist mir ein Rätsel.«
Er gab mir den Schraubenschlüssel zurück. »Die Welt ist ein Rätsel. Ist doch egal, ob wir sie verstehen.«
Er zeigte auf das Regal hinter mir. »Jetzt brauche ich den Hammer und den Schraubenzieher.«
Ziemlich sauer schaute ich ihm bei der Arbeit zu. Ich überlegte, wie ich ihn dazu bringen konnte, mir seinen Trick zu verraten. Er aber hatte mich anscheinend ganz vergessen.
Ich gab es auf und wandte mich zur Tür. Da hörte ich hinter mir seine Stimme: »Bleib da.« Es klang nicht wie eine Bitte, es klang nicht wie ein Befehl. Es war eine Feststellung. Ich schaute ihn an. Freundlich erwiderte er meinen Blick.
»Warum soll ich bleiben?«, fragte ich.
»Ich könnte dir behilflich sein«, meinte er wie nebenbei und schraubte mit geschickten Händen den Vergaser ab. Wie ein Chirurg bei einer Herztransplantation, dachte ich. Er stellte den Vergaser auf die Werkbank und sah mich aufmerksam an.
Trotzig starrte ich zu ihm hinüber.
»Hier«, sagte er und drückte mir den Vergaser in die Hand. »Nimm das Ding auseinander. Die Teile kannst du zum Einweichen in den Kanister werfen. Das wird dich ablenken von unnützen Fragen.«
Meine Wut löste sich in Lachen. Der alte Mann mochte mich beleidigen – aber irgendwie war er auch interessant. Ich beschloss, mich von meiner versöhnlichen Seite zu zeigen.
»Ich heiße Dan«, sagte ich mit einem unaufrichtigen Lächeln und hielt ihm die Hand hin. »Und du?«
Er drückte mir den Schraubenzieher in die ausgestreckte Hand. »Der Name tut nichts zur Sache. Meiner nicht, und deiner auch nicht. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, was hinter den Namen liegt, und hinter den Fragen. Ja, den Schraubenzieher wirst du brauchen, um den Vergaser auseinanderzunehmen.«
»Hinter den Fragen?«, lachte ich. »Wie wär’s zum Beispiel mit dieser: Wie bist du auf das Dach geflogen?«
»Ich bin nicht geflogen«, sagte er mit einem Pokergrinsen, »ich bin gesprungen. Mach dir keine falschen Hoffnungen, das hat nichts mit Zauberei zu tun. In deinem Fall aber könnte Zauberei nötig werden – um einen Esel in ein Menschenwesen zu verwandeln.«
»Wer bist du eigentlich, verdammt, dass du glaubst, so mit mir reden zu können?«
»Ich bin ein Krieger«, fauchte er. »Und was ich sonst noch bin, hängt davon ab, was du in mir sehen möchtest.«
»Kannst du niemals eine klare Antwort auf eine klare Frage geben?« Wütend bearbeitete ich den Vergaser.
»Los, stell mir eine klare Frage, ich will’s versuchen«, sagte er mit Unschuldsmiene.
Mir glitt der Schraubenzieher aus, und ich schnitt mich in den Finger. »Au, verdammt!«, schrie ich und lief zum Waschbecken, um die Wunde auszuspülen. Socrates hielt mir ein Pflaster hin.
»Also gut«, sagte ich resigniert. »Hier ist eine klare Frage: Wie glaubst du, könntest du mir behilflich sein?«
»Ich bin dir schon behilflich gewesen«, sagte er und deutete auf das Pflaster an meinem Finger.
Ich hatte genug. »Tut mir leid«, sagte ich. »Ich kann nicht meine ganze Zeit bei dir vertrödeln. Ich brauche meinen Schlaf.«
Ich schob den Vergaser beiseite und wandte mich zur Tür.
»Woher weißt du, dass du nicht schon dein ganzes Leben verschlafen hast? Woher weißt du, dass du nicht auch jetzt schläfst, in diesem Moment?« Er sprach mit seltsamem Nachdruck in der Stimme.
»Ach, ist mir egal«, sagte ich. Ich war zu müde, um mich mit ihm zu streiten. »Nur eines will ich wissen, bevor ich gehe. Verrätst du mir, wie du dieses Kunststück fertiggebracht hast?«
Ganz freundlich auf einmal, kam er herüber, nahm meine Hand und sagte: »Morgen, Dan, morgen.« Er lächelte warm. Meine Unsicherheit und meine Wut waren wie weggewischt. Ich spürte ein heißes Prickeln in der Hand, auch im Arm und am ganzen Körper. »Hat mich gefreut, dich wiederzusehen«, fügte er noch hinzu.
»Halt – was sagst du da? Du hättest mich wiedergesehen?«, platzte ich heraus. Aber ich besann mich. »Gut, ich weiß schon, morgen. Also bis morgen.« Wir mussten beide lachen.
Schon in der Tür, schaute ich mich noch einmal um und sagte: »Goodbye, Socrates!«
Er blickte verwundert auf, dann zuckte er die Schultern. Anscheinend gefiel ihm der Name. Ich sagte nichts mehr und ging.
Die Acht-Uhr-Vorlesung am nächsten Morgen verschlief ich. Aber beim Training am Nachmittag, in der Halle, war ich wieder hellwach.
Zum Aufwärmen jagte uns Hal, unser Trainer, die Tribünen hinauf und hinunter, und dann lagen Rick und Sid und ich und die anderen Kameraden aus unserer Mannschaft schwitzend und schnaufend auf der Bodenmatte und dehnten unsere Bein-, Schulter- und Rückenmuskeln. Sonst war ich immer ziemlich schweigsam bei diesem täglichen Ritual, aber jetzt brannte ich darauf, mein seltsames Abenteuer loszuwerden: »Gestern abend hab ich einen merkwürdigen Typ getroffen, an einer Tankstelle …«
Mehr brachte ich nicht heraus. Meine Freunde interessierten sich auch anscheinend mehr für ihren Muskelkater als für meine Storys.
Noch mal ein kurzes Aufwärmtraining – Handstand, Rumpfbeugen, Beinegrätschen –, und dann ging es an die Geräte. Wenn ich in hohem Sprung über den Bock flog, wenn ich bei der Riesenwelle um die Reckstange rotierte, wenn ich mich am Barren in den Handstand drückte oder eine neue, muskelzerrende Übung an den Ringen probte – immer wieder konnte ich nur staunen über das Bravourstück jenes geheimnisvollen Alten, den ich »Socrates« getauft hatte. Er war mir unheimlich, aber andererseits musste ich mir Klarheit verschaffen über den rätselhaften Mann!
Ich schlang mein Abendessen hinunter, überflog noch schnell ein paar Seiten Geschichte und Psychologie, schrieb einen flüchtigen Entwurf für einen Englischaufsatz und schlug die Wohnungstür hinter mir zu. Es war mittlerweile elf Uhr abends – und da war auch schon die Tankstelle. Aber jetzt kamen mir Zweifel. Ob er mich wirklich sehen wollte? Und wie konnte ich ihn überzeugen, dass ich kein Esel war und kein Narr, sondern ein ziemlich intelligenter Mensch?
Jetzt hatte er mich gesehen. Er hielt mir die Tür auf und winkte mich in sein Büro. »Aber, sei so gut, und zieh die Schuhe aus – eine alte Gewohnheit von mir.«
Ich setzte mich auf das Sofa und stellte die Schuhe griffbereit neben mich, für den Fall, dass ein hastiger Rückzug notwendig werden würde. Ich traute dem geheimnisvollen Fremden noch nicht ganz.
Draußen fing es an zu regnen. Die Wärme, die bunten Farben hier im Büro, all dies war ein freundlicher Gegensatz zu der dunklen, wolkenverhangenen Nacht dort draußen. Meine Angst war verschwunden. Ich machte es mir auf dem Sofa bequem und sagte: »Mir scheint, Socrates, als hätte ich dich schon mal gesehen.«
»Ja, das hast du«, sagte er.
Und wieder sprang diese Tür in meinem Inneren auf, wo Traum und Wirklichkeit in eins verschmelzen.
»Jetzt weiß ich es, Socrates!«, rief ich. »Ich hatte immer wieder einen Traum, und du kamst darin vor.«
Ich schaute gespannt zu ihm hinüber, aber sein Gesicht verriet keine Regung.
»Weißt du, ich komme in den Träumen vieler Menschen vor. Du übrigens auch. Also gut, erzähle mir deinen Traum.«
Sein freundliches Lächeln machte mir Mut.
Und so erzählte ich ihm von meinem Albtraum – mit allen Einzelheiten, an die ich mich erinnern konnte. Und als ich erzählte, als die Schreckensbilder wieder lebendig wurden, da wurde es dunkel um mich her, und die vertraute Welt versank.
Als ich fertig war, meinte er nur: »Ja, Dan, das ist ein guter Traum.« Ich hätte gerne gewusst, was er damit meinte, aber die Tankstellenglocke läutete, und draußen wartete ein Kunde auf Benzin.
Socrates zog seinen Regenponcho an und ging hinaus. Ich stand am Fenster und schaute ihm zu. Es war viel Betrieb an diesem Abend – kein Wunder, am Freitagabend! Die Autos rasten die Straße entlang, ein Kunde nach dem anderen kam zum Tanken. Ich wollte nicht untätig herumsitzen, darum ging ich hinaus, um ihm bei der Arbeit zu helfen. Er schien mich aber nicht zu bemerken.
Eine endlose Autoschlange begrüßte mich: Kabrios und Limousinen, zweifarbige, rote und grüne, Lastwagen und teure Sportwagen aus Europa. Die Fahrer waren so verschieden wie ihre Autos. Kaum einer schien Socrates zu kennen, aber viele drehten sich nach ihm um, als ob sie etwas Besonderes an ihm bemerkten, auffällig, aber unerklärlich.
Etliche waren in Partystimmung. Sie ließen ihr Radio dröhnen, während wir sie bedienten. Socrates störte das alles nicht. Er lachte und plauderte mit den Leuten. Andere waren schlechter Laune und gaben sich besondere Mühe, unfreundlich zu sein. Aber jeden behandelte er mit derselben Höflichkeit, als ob er sein persönlicher Gast wäre.
Nach Mitternacht wurde es ruhiger, und nur hin und wieder kam noch ein Kunde vorgefahren. Die kühle Nacht schien unnatürlich still nach dieser Hektik und dem Lärm. Als wir ins Büro zurückgingen, dankte Socrates mir für meine Hilfe.
»Ach, gern geschehen«, wehrte ich ab, aber es freute mich doch, dass er es bemerkt hatte. Es war lange her, seit ich jemandem geholfen hatte.
Zurück in dem freundlichen, warmen Raum, kamen auch meine Zweifel wieder. »Socrates, ich hätte ein paar Fragen.«
Er hob stumm die Hände, wie zum Gebet gefaltet, und schickte einen flehenden Blick zur Decke, als hoffte er auf göttlichen Beistand – oder göttliche Geduld.
»Was für Fragen?«, seufzte er.
»Also«, fing ich an, »erst mal möchte ich wissen, wie du auf dieses Dach gesprungen bist. Und wieso hast du gesagt, du freutest dich, mich wiederzusehen? Außerdem möchte ich wissen, was ich für dich tun kann? Und wieso kannst du mir behilflich sein? Vor allem möchte ich wissen: Wie alt bist du?«
»Viele Fragen auf einmal«, lachte er. »Aber fangen wir mit der leichtesten an. Ich bin sechsundneunzig – nach deiner Zeitrechnung.«
Unsinn!, dachte ich. Er konnte niemals sechsundneunzig Jahre alt sein. Vielleicht sechsundfünfzig, höchstens sechsundsechzig. Sechsundsiebzig? Möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Aber sechsundneunzig? Er schwindelte mich an! Aber warum sollte er schwindeln?
Und er hatte schon wieder solch eine rätselhafte Bemerkung gemacht; es ließ mir keine Ruhe.
»Wie hast du das gemeint, Socrates – nach meiner Zeitrechnung? Lebst du vielleicht, hier an der Westküste, nach der New Yorker Normalzeit?«, witzelte ich. »Oder kommst du vielleicht gar aus dem Weltraum?«
»Kommen wir nicht alle von dort?«, antwortete er ganz ernsthaft. Inzwischen war ich so weit, dass mich nichts mehr wunderte.
»Du hast mir noch immer nicht gesagt, wie wir uns gegenseitig behilflich sein können.«
»Sehr einfach«, sagte er. »Ich hätte ganz gerne noch ein letztes Mal einen Schüler. Und du – das sieht doch jeder – brauchst dringend einen Lehrer.«
»Oh, Lehrer habe ich genug«, protestierte ich ein wenig vorschnell.
»Wirklich?«, er sah mich an. »Aber ob du den richtigen Lehrer hast oder nicht, das hängt davon ab, was du lernen willst.«
Er stand auf und ging zur Tür. »Komm. Ich will dir etwas zeigen.«
Wir gingen hinüber zur Straßenecke, wo wir das menschenleere Geschäftsviertel sahen, und dahinter den Glanz der Lichter von San Francisco.
»Die ganze Welt«, sagte er, mit einer Handbewegung den Horizont umfassend, »ist eine Schule, Dan. Das Leben ist der einzige wirkliche Lehrer. Es bietet uns so viele Erfahrungen! Und wenn es nur auf die Erfahrung ankäme, um den Menschen Weisheit und Glück zu schenken, dann müsste jeder alte Mensch ein erleuchteter Meister sein, weise und glücklich.
Aber die Lehren, die wir aus der Erfahrung ziehen könnten, sind meistens versteckt. Ich kann dir helfen, die Welt klarer zu sehen und sie zu erfahren. Klarheit – das ist’s, was du dringend brauchst. Dein Gefühl sagt dir, dass es sich so verhält. Dein Verstand aber lehnt sich auf dagegen. Gewiss, du hast manches erfahren, aber du hast wenig daraus gelernt.«
»Ich weiß nicht recht, Socrates. Ich möchte nicht so weit gehen, dies zu behaupten.«
»Nein, Dan. Du weißt es noch nicht, aber du wirst es wissen. Du wirst so weit gehen, und viel weiter. Das verspreche ich dir.«
Wir standen vor der Tür zum Büro, als ein roter Toyota mit Schwung in die Tankstelle einbog. Socrates schraubte den Tankdeckel auf, ohne seine Erklärung zu unterbrechen: »Wie die meisten Menschen, Dan, hast du gelernt, Informationen aus zweiter Hand zu sammeln, aus Zeitschriften, Büchern und von Experten.« Er schob das Ventil in den Stutzen. »Wie dieses Auto machst du einfach deinen Tank auf und lässt Informationen in dich hineinfließen. Manchmal sind diese Informationen ›Super‹, manchmal sind sie nur ›Normal‹. Du kaufst dir dein Wissen zum Tagespreis, nicht anders als dieses Benzin.«
»Vielen Dank, ja! Du erinnerst mich: Übermorgen sind meine Studiengebühren fällig.«
Socrates nickte und ließ unbeirrt das Benzin strömen. Der Tank wurde voll, und Socrates zapfte weiter Benzin, bis es aus dem Stutzen schwappte und eine Pfütze den Bürgersteig überschwemmte.
»Socrates! Der Tank ist voll. Pass doch auf!«
Ohne mich zu beachten, ließ er das Benzin weitersprudeln. »Siehst du, Dan, wie dieser Tank fließt du über vor lauter Informationen und Vorurteilen. Nichts als unnützes Wissen! Du glaubst alle möglichen Fakten – aber wissen tust du nichts. Bevor du etwas lernen kannst, musst du deinen Tank ausleeren.« Er zwinkerte mir zu und stellte mit einem »Klick« das Benzin ab. »Ach ja, kannst du die Überschwemmung beseitigen?« Und ich hatte das unbestimmte Gefühl, als meinte er nicht nur das Benzin.
Ich machte also das Pflaster sauber, und Socrates nahm den Geldschein des Fahrers und gab ihm das Wechselgeld heraus, alles mit dem freundlichsten Lächeln. Dann gingen wir wieder ins Büro und setzten uns. Socrates erzählte mir eine Geschichte:
Ein Professor wanderte weit in die Berge, um einen berühmten Zen-Mönch zu besuchen. Als der Professor ihn gefunden hatte, stellte er sich höflich vor, nannte alle seine akademischen Titel und bat um Belehrung.
»Möchten Sie Tee?«, fragte der Mönch.
»Ja, gern«, sagte der Professor.
Der alte Mönch schenkte Tee ein. Die Tasse war voll, aber der Mönch schenkte weiter ein, bis der Tee überfloss und über den Tisch auf den Boden tropfte.
»Genug!«, rief der Professor. »Sehen Sie nicht, dass die Tasse schon voll ist? Es geht nichts mehr hinein.«
Der Mönch antwortete: »Genau wie diese Tasse sind auch Sie voll von Ihrem Wissen und Ihren Vorurteilen. Um Neues zu lernen, müssen Sie erst Ihre Tasse leeren.«
Socrates grinste und fragte mich: »Möchtest du Tee?«
Ich lachte: »Ich will’s riskieren.«
Während Socrates den Teekessel mit Quellwasser aus dem Wasserspender füllte, erklärte er: »Auch du, Dan, bist voll von unnützem Wissen. Du schleppst viele Informationen über die äußere Welt mit dir herum. Über dich selbst aber weißt du wenig.«
»Was hast du vor mit mir? Willst du mich vielleicht mit deinen Informationen füllen?«, protestierte ich.
»Nein, nein, ich will dich nicht mit neuen Informationen vollstopfen. Ich will dir das ›Körperwissen‹ zeigen. Alles, was du wissen musst, steckt in dir. Alle Geheimnisse des Universums sind in deinen Körperzellen enthalten. Aber du hast den Blick nach innen noch nicht gelernt. Du kannst nicht in deinem Körper lesen. Bisher hast du nur Bücher gelesen und deinen Professoren gelauscht – und gehofft, sie möchten recht haben. Aber wenn du das ›Körperwissen‹ gelernt hast, wirst du ein Lehrer unter den Lehrern sein.«
Ich gab mir Mühe, nicht spöttisch zu grinsen. Dieser alte Tankwart wollte behaupten, dass meine Professoren unwissend seien und meine Collegebildung nutzlos!
»Klar, Socrates, ich verstehe. Aber diese Idee von deinem Körperwissen, die kaufe ich dir nicht ab.«
Er schüttelte den Kopf. »Dan, du magst dies und das verstehen – aber erkannt hast du nichts.«
»Sag mal, was soll das wieder heißen?«
»Verstehen, weißt du, ist eindimensional. Es ist ein Begreifen mit dem Intellekt. Das Ergebnis ist ein Wissen, wie du es hast. Erkennen dagegen ist dreidimensional. Es ist ein Begreifen mit dem ganzen Körper – mit Kopf, Herz und Instinkten zugleich. Die Voraussetzung dafür ist eine klare Erfahrung.«
»Socrates, ich kann dir nicht folgen.«
»Weißt du noch, wie es war, als du Autofahren lerntest? Vorher hast du immer auf dem Beifahrersitz gesessen. Da hast du vielleicht verstanden, wie das Autofahren geht. Aber erkannt hast du’s erst, als du selber zum ersten Mal den Wagen steuern durftest.«
»Ja, richtig!«, rief ich. »Ich kann mich genau an das Gefühl erinnern: ›Aha, so geht das.‹«
»Genau. Dieses Aha ist die beste Beschreibung für das, was Erkenntnis ist. Eines Tages wirst du auch zum Leben ›Aha‹ sagen.«
Ich war sprachlos, aber ich gab mich nicht geschlagen: »Du hast noch immer nicht verraten, was Körperwissen ist.«
»Komm«, sagte er und führte mich zu der Tür mit dem Schildchen »Privat«. Wir traten ein, und drinnen war es stockfinster. Ich erstarrte vor Schreck, aber andererseits war ich doch neugierig. Ich sollte mein erstes echtes Geheimnis erfahren: Körperwissen!
Das Licht ging an – und wir standen in der Toilette. Socrates pinkelte geräuschvoll in die Schüssel. »Das«, verkündete er stolz, »ist Körperwissen.« Sein Gelächter schallte durch den gekachelten Raum, während ich hinausrannte, mich auf das Sofa fallen ließ und auf den Teppich starrte.
Bis er wiederkam, hatte ich mich ein wenig beruhigt. »Socrates, ich möchte immer noch wissen …«
»Also, hör mal zu«, sagte er. »Wenn du mich unbedingt Socrates nennen willst, musst du auch einverstanden sein, dass ich hier die Fragen stelle – genau wie der alte Grieche. Und du kannst antworten – ist das klar?«
»Ja, klar, weiser Mann«, lachte ich. »Also schön, das war deine Frage, und ich habe geantwortet. Jetzt bin ich wieder an der Reihe. Wie war das eigentlich, diese Luftakrobatik gestern Abend?«
»Du bist hartnäckig, nicht wahr?«
»Ja, das bin ich. Ohne Hartnäckigkeit stünde ich nicht da, wo ich heute stehe. Übrigens, mein Lieber – das war schon wieder ’ne Frage von dir. Und ich habe klar geantwortet! Darf ich dich jetzt etwas fragen?«
Ohne mich zu beachten, fragte er: »Nun, wo stehst du denn heute? Wo bist du jetzt – in diesem Augenblick?«
Das war mein Stichwort. Ich fing an und erzählte ihm lang und breit von meinen Problemen. Ich merkte zwar, dass er es schon wieder geschafft hatte, meinen Fragen auszuweichen. Aber ich war froh, mich einmal über meine Hoffnungen und Ängste aussprechen zu können – und über meine unerklärlichen Depressionen. Er hörte mir geduldig zu, als hätte er alle Zeit dieser Welt gepachtet. Erst Stunden später schwieg ich erschöpft.
»Schön und gut«, sagte er, »aber du hast noch immer nicht auf meine Frage geantwortet. Wo bist du?«
»Sicher hab ich dir geantwortet – hast du’s vergessen? Ich habe dir ganz genau erzählt, wie ich dorthin gekommen bin, wo ich heute bin – durch harte Arbeit!«
»Wo bist du?«
»Wie meinst du das? Wo soll ich sein?«
»Wo bist du?«, wiederholte er leise und eindringlich.
»Ich bin hier.«
»Wo ist hier?«
»In diesem Büro in dieser Tankstelle!« Ich hatte allmählich genug von diesem Spiel!
»Wo ist diese Tankstelle?«
»In Berkeley.«
»Wo ist Berkeley?«
»In Kalifornien.«
»Wo ist Kalifornien?«
»In den Vereinigten Staaten.«
»Wo sind die Vereinigten Staaten?«
»Auf einem Erdteil, auf einem Kontinent der westlichen Hemisphäre. Socrates, ich …«
»Wo sind die Kontinente?«
Ich seufzte geduldig. »Auf der Erde. Bist du noch nicht fertig?«
»Wo ist die Erde?«
»Im Sonnensystem, drittnächster Planet von der Sonne. Die Sonne ist ein kleiner Stern in der Galaxie namens Milchstraße. Zufrieden?«
»Wo ist die Milchstraße?«
»Oh, hör auf, Mann!«, stöhnte ich und verdrehte die Augen. »Im Universum.« Ich hatte endgültig genug von dem Spiel.
»Und wo«, grinste Socrates, »ist das Universum?«
»Hm, das Universum ist …« Ich überlegte. »Da gibt es verschiedene Theorien, wie es entstanden ist.«
»Ich habe dich nicht gefragt, wie es entstanden ist, sondern wo es ist?«
»Ich … ich weiß nicht. Woher soll ich das wissen?«
»Ja, das ist der springende Punkt. Du kannst es nicht wissen, und du wirst es niemals wissen. Das zu wissen ist unmöglich. Du weißt also nicht, wo das Universum ist, und folglich weißt du nicht, wo du bist. Tatsache ist, du kannst überhaupt nicht wissen, wo irgendetwas ist. Du kannst auch nicht wissen, wie etwas ist oder wie es entstanden ist. Alles ist ein Rätsel.«
Socrates besann sich einen Moment. »Meine Unwissenheit beruht auf dieser Erkenntnis. Deine Erkenntnisse beruhen auf Unwissenheit. Ich bin ein spaßiger Narr. Du bist ein ernsthafter Esel!«
»He, pass auf«, protestierte ich. »Du weißt anscheinend nicht, wer ich bin. Auf meine Art bin ich auch so etwas wie ein Krieger. Ich bin ein verdammt guter Turner.« Um meine Worte zu unterstreichen, sprang ich auf und machte aus dem Stand einen Salto rückwärts, mit federnder Landung auf dem Teppich.
»Oh«, sagte Socrates. »Prima! Mach das nochmal!«
»Ach, das ist keine Kunst. Eher ’ne Kleinigkeit für mich, Socrates.« Ich bemühte mich, nicht allzu herablassend zu klingen. Aber ein gönnerhaftes Lächeln konnte ich mir doch nicht verkneifen. Solche Kunststückchen führte ich manchmal den Kindern im Park vor. Auch sie riefen dann immer: »Mach das nochmal!«
»Also gut, Soc, pass auf!« Ich schnellte hoch und wollte gerade rückwärts abkippen, als etwas – oder jemand – mir einen Stoß versetzte. Mit einer schiefen Bauchlandung plumpste ich auf das Sofa. Die mexikanische Decke flog hoch und hüllte mich ein. Beschämt streckte ich meinen Kopf unter der Decke hervor und sah mich nach Socrates um, er saß seelenruhig auf seinem Stuhl hinter dem Schreibtisch und lächelte spöttisch.
»Wie hast du das gemacht?« Ich war verdattert.
»Wie hat dir die kleine Luftreise gefallen?«, lachte er unschuldig. »Machst du’s nochmal?« Aber nach einem Weilchen fügte er tröstlich hinzu: »Nimm’s nicht so tragisch, Dan. Auch ein gewaltiger Krieger wie du kann mal eine Eselei anstellen.«
Verwirrt stand ich auf und strich die Decke auf dem Sofa glatt. Ich musste irgendetwas mit den Händen machen. Ich brauchte Zeit, um meine Gedanken zu sammeln. Was hatte Socrates mit mir gemacht? Schon wieder so eine Frage, auf die ich keine Antwort bekommen würde.
Soc war inzwischen hinausgegangen, um einen hoch mit Gerümpel beladenen Lastwagen aufzutanken. »Da geht er, dieser wunderliche Heilige, um irgendwelchen Verirrten Mut zu machen!«, dachte ich. Wieso konnte Socrates sich über die Naturgesetze hinwegsetzen? Es ging über meinen normalen Menschenverstand.
»Bist du noch immer neugierig auf Geheimnisse?« Ich hatte ihn nicht hereinkommen hören. Da saß er wieder in seinem Stuhl, bequem die Beine übereinandergeschlagen.
Gespannt beugte ich mich vor, aber ich hatte nicht mit den ausgeleierten Polstern des alten Sofas gerechnet. Bautz!, kippte ich vor und landete auf dem Teppich.
Socrates krümmte sich vor Lachen. Ich sammelte belämmert meine Knochen auf und setzte mich kerzengerade hin. Vielleicht war es mein todernstes Gesicht, jedenfalls schaute Soc mich an und bekam wieder einen Lachanfall. Ich war mehr an Beifall gewöhnt als an Spott, und so sprang ich beleidigt auf und wollte gehen.
Socrates wurde plötzlich ernst; sein Gesicht und seine Stimme waren ehrfurchtgebietend.
»Setz dich hin!«, befahl er und deutete auf das Sofa. Ich setzte mich. »Ich habe dich gefragt, ob du ein Geheimnis wissen willst.«
»Ja – wie man auf Hausdächer springt.«
»Hör mal gut zu, mein Freund«, sagte er. »Du kannst entscheiden, ob du ein Geheimnis wissen willst. Lass mich entscheiden, welches ich dir erzähle.«
»Warum sollen wir immer nach deinen Spielregeln spielen?«
»Weil es meine Tankstelle ist. Darum!« Socrates sprach mit übertriebener Geduld auf mich ein – wie mit einem armen Irren. »Und jetzt pass gut auf … Übrigens, Dan, sitzt du gut?« Er zwinkerte mir zu. Ich biss die Zähne zusammen.
»Ich kann dir Dinge zeigen und Geschichten erzählen, Dan, ich kann dir Geheimnisse offenbaren. Wir können zusammen auf die Reise gehn – zuvor aber musst du begreifen, dass es bei solchen Geheimnissen nicht ankommt auf das, was du weißt, sondern auf das, was du tust.«
Socrates zog ein zerlesenes Lexikon aus der Schreibtischschublade und hielt es hoch. »Hier, lerne die Tatsachen, nutze das Wissen, das du dir erworben hast. Aber erkenne die Grenzen des Wissens. Denn Wissen allein genügt nicht, wenn das Herz dabei fehlt! Mit Wissen allein kannst du deine Seele nicht nähren, kannst du nicht am Leben bleiben. Das höchste Glück, den wahren Frieden findest du nicht durch das Wissen. Das Leben verlangt mehr von dir als bloße Kenntnisse. Es verlangt Gefühle; starke Gefühle und Energie. Das Leben verlangt von dir richtiges Handeln – falls es dir darauf ankommt, deine Kenntnisse anzuwenden.«
»Das weiß ich doch längst, Soc.«
»Ja, das ist dein Problem. Du weißt alles, aber du tust es nicht. Du bist kein Krieger.«
»Ich kann dir einfach nicht glauben, Soc«, sagte ich. »Ich habe durchaus schon gehandelt wie ein Krieger. Du solltest mich mal in der Turnhalle sehen!«
»Vielleicht spürst du tatsächlich die Entschlossenheit, die Klarheit und Wendigkeit eines Kriegers in dir. Vielleicht hast du durch dein sportliches Training den Körper eines Kriegers bekommen – kräftig, elastisch und voll Energie. Vielleicht hast du sogar das Herz eines Kriegers in dir gespürt – voll Liebe zu allem, was dir begegnet.
Aber ich sage dir, diese Eigenschaften sind bei dir isoliert. Was dir fehlt, ist die Verbindung. Meine Aufgabe könnte es sein, dich wieder zusammenzubauen, mein Kleiner.«
»He, warte mal, alter Freund. Du willst mich zusammenbauen? Dass ich nicht lache! Betrachte die Situation doch realistisch. Ich bin ein Collegestudent, du bist Nachtwächter in einer Tankstelle. Ich habe eine Weltmeisterschaft gewonnen, und du darfst springen, wenn draußen ein Kunde hupt. Du bastelst in deiner Werkstatt an Schrottautos herum, und wenn ein armer Irrer vorbeispaziert wie ich, dann erschreckst du ihn mit deinen Kunststückchen zu Tode. Und du willst mir helfen? Vielleicht könnte ich dir helfen, dich wieder zusammenzubauen!« – In meiner Wut wusste ich nicht, was ich redete. Aber jedenfalls tat es mir gut.
Socrates lachte mich nur aus. Anscheinend war es ihm ganz egal, was ich von seiner sozialen Stellung dachte. Er kam herüber und hockte sich vor mir auf den Boden. »Du willst mich zusammenbauen? Gut, vielleicht kommt eines Tages die Gelegenheit. Einstweilen aber musst du begreifen, welch ein Unterschied besteht zwischen uns!«
Er boxte mich in die Rippen, nur so zum Spaß, aber es tat trotzdem weh. »Ein Krieger agiert …«
Er boxte mich noch einmal. »Au! Lass das gefälligst«, schrie ich. »Du gehst mir auf die Nerven!«
»… und ein Esel reagiert.«
»Na, was hattest du andres erwartet?«
»Ich box dich in die Rippen, und du wirst wütend. Ich beleidige dich, und du reagierst mit einem Wutausbruch. Ich rutsche auf einer Bananenschale aus …«
Er trat einen Schritt zurück, glitt aus und plumpste wie ein Slapstick-Komiker auf den Hintern. Ich lächelte schadenfroh.
Er richtete sich auf dem Teppich auf und sah mich ernst an. »Alle deine Gefühle und Reaktionen sind automatisch, vorprogrammiert und vorhersehbar. Meine sind es nicht! Ich lebe spontan. Dein Leben ist festgelegt durch deine Vergangenheit.«
»Wieso weißt du das alles – von meiner Vergangenheit und so?«
»Weil ich dich seit Jahren beobachte«, sagte er.
»Ach, ja?«, höhnte ich und wartete auf den Witz, mit dem er sich aus der Affäre ziehen würde. Aber es kam keiner.
Es war spät geworden, und ich hatte viel nachzudenken. Ich wusste nicht, ob ich mich dieser neuen Herausforderung gewachsen fühlte. Inzwischen kam Socrates von draußen herein, wischte sich die Hände an einem Lappen ab und füllte seinen Becher mit frischem Quellwasser aus dem Wasserspender. Während er mit kleinen Schlucken trank, erklärte ich: »Es ist spät geworden, Soc. Ich muss jetzt gehen. Ich habe wichtige Dinge zu tun, weißt du, für die Schule.«
Socrates blieb ungerührt sitzen. Ich stand auf und zog meine Jacke an. Als ich schon in der Tür stand, sprach er endlich. Er sprach langsam und ruhig, und jedes seiner Worte traf mich wie eine Ohrfeige.
»Überlege sie dir gut, deine wichtigen Dinge. Ob sie dir wichtiger sind als die Chance, eines Tages ein Krieger zu sein? Einstweilen, sage ich dir, bist du ein Esel mit Stroh im Hirn. Gewiss, es gibt wichtige Dinge, um die du dich kümmern solltest. Allerdings in einer anderen Schule als der, an die du denkst.«
Ich hatte die ganze Zeit verlegen auf den Teppich gestarrt. Jetzt hob ich den Kopf und versuchte ihn anzusehen. Aber ich schaffte es nicht, ihm in die Augen zu blicken. Achselzuckend wandte ich mich ab.
»Du wirst viel Energie brauchen«, sagte er. »Wenn du die Lehren bestehen willst, die die Zukunft für dich bereithält, wirst du mehr Energie brauchen, als du heute hast. Du musst die Verkrampfungen deines Körpers lösen. Du musst deinen Kopf von unnützem Wissen befreien. Du musst dein Herz für die Kräfte wahren Gefühls öffnen.«
»Schön und gut, Socrates. Vielleicht sollte ich dir mal meinen Stundenplan erklären. Ich würde dich gerne öfter besuchen – aber es geht wirklich nicht. Ich hab keine Zeit.«