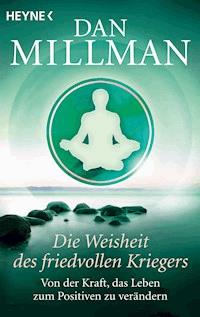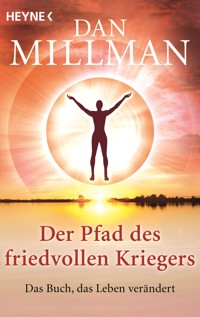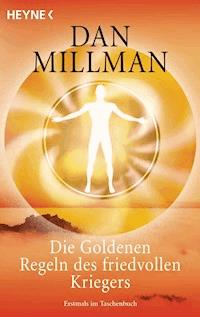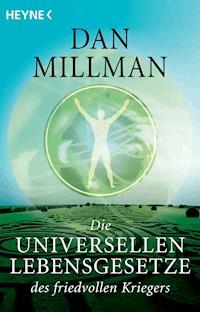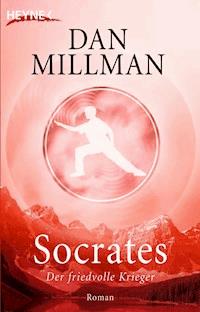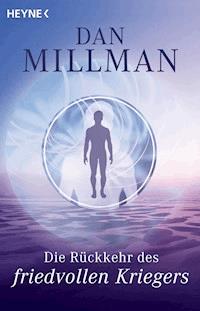
9,99 €
Mehr erfahren.
Die hohe Schule des friedvollen Kriegers
Geheimnisvollen Andeutungen seines Lehrers Socrates folgend, findet Dan Millman auf einer abgelegenen Insel Hawaiis eine Kahuna-Heilerin. In der Einsamkeit des Regenwaldes führt sie ihn in die Geheimnisse der Schamanen ein.
Mit großartigen Visionen, aufregenden Initiationen und spannend wie ein Roman, ist dieser Erlebnisbericht aus erster Hand ein Klassiker der spirituellen Entwicklung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DAS BUCH
In »Der Pfad des friedvollen Kriegers« verfolgten Zigtausende von Lesern begeistert Dan Millmans spirituelle Entwicklung zu einer neuen, faszinierenden Bewußtheit. »Die Rückkehr des friedvollen Kriegers« beschreibt die zweite Stufe dieser Schulung – spannend geschrieben wie ein Roman, inspiriert durch Erkenntnis und Erfahrung aus erster Hand.
Andeutungen eines geheimnisvollen Lehrers Socrates führen Dan Millman auf eine abgelegene Insel Hawaiis. Dort findet er eine Kahuna-Heilerin, die in der Einsamkeit des Regenwaldes die Unterweisung fortsetzt.
Doch der Weg zu den höchsten Mysterien der Schamanen ist beschwerlich und verläuft über eine Vielzahl körperlicher, seelischer und geistiger Herausforderungen. Schon bald muß der Autor schmerzlich erfahren, daß er zuerst über seinen Schatten siegen muß, bevor er den allumfassenden Geist wirklich begreifen kann …
DER AUTOR
Dan Millman, in jungen Jahren einer der besten Kunstturner Amerikas, später Coach von Spitzensportlern, unterrichtet seit nunmehr fast zwanzig Jahren verschiedenste Formen des körperlich-geistigen Trainings. Alle seine Werke sind zu wahren Kultbüchern geworden und haben eine Auflage von weit über zwei Millionen in vierzehn Sprachen erreicht.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
»The Sacred Journey of the Peaceful Warrior. Teachings from the lost years« bei H. J. Kramer Inc., P.O. Box 1082, Tiburon, California 94920, USA
Copyright © 1991 by Dan Millman
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe by Ansata Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Herstellung: Helga Schörnig
Umschlaggestaltung: HildenDesign, München
Umschlagmotiv © Craig Tuttle/CORBIS
Satz: Datentechnik, Wels
ISBN 978-3-641-07874-4V004
www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
WIDMUNG
Meiner Frau Joy für ihre beständige Führung und Unterstützung und meinen Töchtern Holly, Sierra und China, die mich an die wichtigen Dinge erinnern.
VORWORT
Was wäre, wenn du schliefest, und in deinem Schlaf träumtest du und im Traum kämst du in den Himmel und pflücktest eine seltsame, schöne Blume? Und wenn du dann aufwachtest und die Blume immer noch in der Hand hieltest – was dann?
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
In meinem ersten Buch, Der Pfad des friedvollen Kriegers1, erzählte ich von Erlebnissen, die mir Herz und Augen geöffnet und den Horizont meiner Weltsicht erweitert haben. Wer es gelesen hat, weiß sicher noch, daß Socrates – der alte »Tankstellenkrieger«, der mein Meister wurde – mich nach einer Zeit der Einweihung und Ausbildung bei ihm im Jahr 1968 für acht Jahre fortschickte, um seine Lehren zu verarbeiten und mich auf die letzte große Offenbarung vorzubereiten.
Ich habe nicht viel über diese acht Jahre in meinem ersten Buch geschrieben. Das wollte ich erst tun, wenn ich wirklich alles begriffen hatte, was in dieser Zeit passiert war. Sie begann mit inneren Kämpfen und zerbrochenen Träumen, die mich rastlos rund um die Welt reisen ließen. Ich wollte zu mir selbst zurückfinden und die Zuversicht, die Zukunftsvision, den Sinn meines Lebens wiederentdecken, den ich bei Socrates gefunden hatte und der mir dann irgendwie abhanden gekommen war.
Dieses Buch erzählt von meinen ersten Schritten auf dieser Reise. Sie begann 1973. Damals war ich sechsundzwanzig.
Ich bin tatsächlich um die ganze Welt gereist, habe viele außergewöhnliche Dinge erlebt und viele bemerkenswerte Menschen kennengelernt. Doch in meiner Geschichte möchte ich Tatsachen und Phantasie ineinanderfließen lassen. Ich möchte die Fäden meines Lebens zu einer farbigen Decke verweben, die verschiedene Realitätsebenen umschließt.
Dadurch, daß ich mystische Lehren in eine Geschichte kleide, gelingt es mir hoffentlich, uralten Weisheiten neues Leben einzuhauchen und meine Leser daran zu erinnern, daß alle unsere Reisen etwas Heiliges und die Leben aller Menschen ein Abenteuer sind.
DAN MILLMAN San Rafael, KalifornienIm Winter 1991
DANK
Großen Dank schulde ich folgenden Freunden, die direkt oder indirekt zur Entstehung dieses Manuskripts beigetragen haben: Michael Bookbinder für seinen Sinn fürs Praktische, seinen Scharfblick und seine innere Kraft; Sandra Knell, die mir bei meinen Recherchen geholfen hat; Richard Marks, einem Experten auf dem Gebiet der hawaiianischen Geschichte; Carl Farrell, David Berman, M. D., und Tom McBroom für ihre Sachkenntnis; Wayne Guthrie und Bella Karish, die meinen Weg erleuchteten; und Serge Kahili King, dem Großstadtschamanen.
Ganz besonderer Dank gebührt auch meiner Lektorin Nancy Grimley Carleton, die mir viele wertvolle Ratschläge gegeben hat. Außerdem danke ich Linda Kramer, Joy Millman, John Kiefer, Edward Kellogg III., Jan Shelley und Michael Guenley für ihre Mithilfe bei den Korrekturarbeiten. Den tiefsten Dank schulde ich jedoch meinen Verlegern und Freunden Hal und Linda Kramer für ihre Begeisterung und dafür, daß sie mir immer wieder Mut machten.
PROLOG
EIN VORSCHLAG VON SOCRATES
Willensfreiheit bedeutet nicht, daß du deinen Lehrplan selber bestimmen darfst. Es heißt nur, daß du entscheiden kannst, wann du welchen Stoff durchnehmen möchtest.
A COURSE IN MIRACLES
Während meines nächtlichen Unterrichts in der alten Texaco-Tankstelle, der Meditation und Toilettenputzen, Tiefenselbstmassage und Zündkerzenwechsel umfaßte, erwähnte Socrates hin und wieder Leute oder Orte, die ich vielleicht eines Tages besuchen müßte, um »meine Ausbildung fortzusetzen«.
Einmal sprach er von einer Schamanin2 auf Hawaii, ein andermal erwähnte er eine besondere Schule für Krieger irgendwo an einem abgelegenen Ort in Japan. Er erzählte mir auch von einem heiligen Buch in der Wüste, das den Sinn des menschlichen Lebens erläuterte.
Das machte mich natürlich alles sehr neugierig; aber jedesmal, wenn ich ihn nach näheren Einzelheiten befragte, wechselte er das Thema, so daß ich nie sicher war, ob die Frau, die Schule oder das Buch, von denen er gesprochen hatte, auch wirklich existierten.
Im Jahr 1968, kurz bevor er mich fortschickte, sprach Socrates wieder von dieser Schamanin. »Ich habe ihr vor ungefähr einem Jahr geschrieben und von dir erzählt«, sagte er. »Und sie hat mir geant-wortet, daß sie unter Umständen bereit wäre, dich zu unterweisen. Eine ziemlich große Ehre für dich.« Er schlug mir vor, bei ihr vorbeizuschauen, wenn ich das Gefühl hätte, daß der richtige Zeitpunkt dafür gekommen sei.
»Schön, aber wie soll ich sie denn finden?« fragte ich.
»Sie hat mir auf dem Briefpapier einer Bank geschrieben.«
»Von welcher Bank?«
»Weiß ich nicht mehr. Irgendwo aus Honolulu, glaube ich.«
»Kann ich den Brief mal sehen?«
»Hab ihn nicht mehr.«
Allmählich geriet ich in Wut. »Hat diese Dame auch einen Namen?«
»Sie hat schon verschiedene Namen gehabt. Keine Ahnung, welchen sie jetzt gerade trägt.«
»Und wie sieht sie aus?«
»Schwer zu sagen, ich habe sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen.«
»Verdammt noch mal, Socrates, jetzt gib mir doch endlich einen Tip!«
»Ich habe dir schon mal gesagt, Danny – ich bin da, um dir zu helfen, aber nicht, um dir alle Erkenntnisse in den Schoß zu legen«, erwiderte er mit einer ungeduldigen Handbewegung. »Wenn du sie nicht findest, dann bist du sowieso noch nicht bereit dafür.«
Ich holte tief Luft und zählte langsam bis zehn. »Und was ist mit den anderen Orten und Leuten, die ich besuchen soll? Wo finde ich die?«
Socrates warf mir einen wütenden Blick zu. »Bin ich etwa dein Reisebüro? Geh nur immer deiner Nase nach. Vertraue auf deine Instinkte. Erst einmal mußt du sie finden, dann ergibt sich alles andere von selbst.«
Als ich in der frühmorgendlichen Stille nach Hause ging, dachte ich darüber nach, was Socrates mir erzählt hatte – und vor allem darüber, was er mir verschwiegen hatte. Falls ich »zufällig mal in der Gegend sein sollte«, hatte er gesagt, könnte ich vielleicht eine Frau besuchen, die keinen Namen und keine Adresse hatte und vielleichtimmer noch bei einer Bank irgendwo in Honolulu arbeitete. Vielleicht arbeitete sie aber auch nicht mehr da. Und falls ich sie finden sollte, konnte sie mir vielleicht etwas beibringen und würde mir vielleicht den Weg zu den anderen Menschen und Orten zeigen, von denen Socrates gesprochen hatte.
Als ich im Bett lag und weiter nachgrübelte, wäre ich am liebsten sofort zum Flughafen gefahren und hätte das nächste Flugzeug nach Honolulu genommen. Aber es gab zur Zeit wichtigere Dinge, die meine ganze Aufmerksamkeit beanspruchten: Ich sollte zum letzten Mal an den Turnmeisterschaften der National Colleges teilnehmen, mein Abschlußexamen machen und heiraten – also wohl kaum der ideale Zeitpunkt, um nach Hawaii zu fliegen und einem Phantom nachzujagen.
Über diesem Gedanken schlief ich schließlich ein – und man könnte sagen, daß ich von nun an fünf Jahre lang schlief. Bevor ich dann wieder aufwachen konnte, mußte ich feststellen, daß ich trotz meiner spirituellen Unterweisung und Erfahrung, auf die ich mir so viel einbildete, nicht auf das Leben vorbereitet war. Ich gelangte buchstäblich vom Regen in die Traufe: aus Socrates’ Bratpfanne ins Kreuzfeuer des Alltags.
ERSTES BUCH
Wohin der Geist uns führt
Das Wichtigste ist:Wir müssen jederzeit bereit sein, das, was wir sind,aufzugeben für das,was wir vielleicht werden könnten.
CHARLES DUBOIS
1
IM SUMPF DES ALLTAGS
Erleuchtung heißt nicht nur, daß man leuchtende Gestalten undVisionen sieht, es bedeutet, daß man Licht in die Dunkelheit bringenmuß. Letzteres ist schwieriger und daher nicht so beliebt.
C. G. JUNG
In meiner Hochzeitsnacht weinte ich. Ich erinnere mich noch genau daran. Linda und ich hatten in meinem vierten Studienjahr an der Universität in Berkeley geheiratet. Ich erwachte kurz vor Morgengrauen, unerklärlich deprimiert, schälte mich leise aus den zerknüllten Bettlaken und trat hinaus in die kühle Morgenluft. Die Welt war noch in Dunkel gehüllt. Ich schob die Glastür hinter mir wieder zu, um meine Frau nicht zu wecken. Dann stieg plötzlich ein Schluchzen in mir auf. Ich weinte lange, hatte aber keine Ahnung, warum.
Weshalb war mir so elend zumute, obwohl ich doch eigentlich allen Grund haben sollte, glücklich zu sein? fragte ich mich. Die einzige Antwort, die mir einfiel, war eine vage Ahnung, die mich zutiefst beunruhigte: daß ich irgend etwas Wichtiges vergessen hatte, daß ich irgendwie vom richtigen Kurs abgekommen war. Dieses Gefühl sollte unsere ganze Ehe überschatten.
Nach meiner Abschlußprüfung ließ ich den Erfolg und die Ovationen hinter mir, mit denen ein Starathlet verwöhnt wird, und mußte mich an ein relativ anonymes Leben gewöhnen. Linda und ich zogen nach Los Angeles, und ich mußte mich zum erstenmal im Leben den Verantwortungen des täglichen Lebens stellen. Ich besaß eine bewegte Vergangenheit, einen Universitätsabschluß und eine schwangere Frau. Es war höchste Zeit, mich nach einer Stellung umzusehen. Nachdem ich ohne großen Erfolg versucht hatte, Lebensversicherungen zu verkaufen, ein Engagement als Stuntman in Hollywood zu bekommen oder über Nacht Schriftsteller zu werden, bekam ich schließlich eine Stellung als Sporttrainer an der Stanford University.
Trotz dieser glücklichen Fügung und der Geburt unserer süßen Tochter Holly quälte mich immer wieder das Gefühl, etwas Wichtiges zu versäumen. Linda gegenüber konnte ich dieses Gefühl unmöglich rechtfertigen; ich brachte es nicht einmal fertig, ihr davon zu erzählen. Und da mir auch Socrates’ leitende Hand fehlte, schob ich meine Zweifel einfach beiseite und versuchte die Rolle eines »Ehemanns« und »Vaters« zu spielen, obwohl ich mir dabei vorkam wie in einen zu engen Anzug gezwängt.
Vier Jahre vergingen. Vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs, der ersten Mondlandung und der Watergateaffäre lief mein unbedeutendes kleines Leben ab – Universitätspolitik, berufliche Pläne, familiäre Verpflichtungen.
Während des Studiums war mir mein Leben viel einfacher vorgekommen. Aber jetzt hatten die Regeln sich geändert; meine Prüfungen mußte ich im täglichen Leben bestehen, und diesen Lehrer konnte ich nicht zum Narren halten, auch wenn ich es noch so geschickt anstellte. Zum Narren halten konnte ich nur mich selbst, und das tat ich mit entschlossener Beharrlichkeit.
So gut es ging, fixierte ich mich also auf die Ideale eines weißgestrichenen Gartenzauns und zweier Autos in der Garage, gestand mir meine vagen Sehnsüchte nicht ein und beschloß, es zu etwas zu bringen. Schließlich war Linda in jeder Hinsicht eine vorbildliche Ehefrau, etwas ganz Besonderes. Und ich mußte ja auch an meine kleine Tochter denken.
So verbarrikadierte ich mich in der »Realität«, die um mich her allmählich hart und starr wurde wie Beton. Meine Erlebnisse mit Socrates und die Lektionen, die ich bei ihm gelernt hatte, begannen zu verblassen wie Bilder in einem alten Fotoalbum. Sie wurden zu nebelhaften Eindrücken aus einer anderen Zeit und einem anderen Reich. Von Jahr zu Jahr kamen mir Socrates’ Worte von der Frau auf Hawaii, der Schule in Japan und dem Buch in der Wüste unwirklicher vor – bis ich sie schließlich ganz vergaß.
Ich bekam eine Stellung am Oberlin College in Ohio und verließ die Stanford University in der Hoffnung, daß diese Ortsveränderung meine Beziehung zu Linda verbessern würde. Aber in der neuen Umgebung wurde uns nur noch klarer, daß wir völlig verschiedene Vorstellungen vom Leben hatten. Linda kochte z. B. gern und liebte Fleisch; ich bevorzugte rohe vegetarische Kost. Sie wollte unsere Wohnung mit möglichst vielen Möbeln vollstellen; ich war mehr für zen-buddhistische Schlichtheit und hätte mich am liebsten mit einer Matratze auf dem Fußboden begnügt. Sie liebte Partys und wollte immer Menschen um sich haben; ich arbeitete lieber. Sie war eine typische amerikanische Ehefrau. Ihre Freunde hielten mich für einen esoterischen komischen Kauz, und ich zog mich immer mehr in mein Schneckenhaus zurück. Sie fühlte sich wohl in ihrer konventionellen Welt, die mich abstieß; und trotzdem beneidete ich sie um ihre Zufriedenheit.
Linda spürte, wie unwohl ich mich fühlte, und wurde immer frustrierter. Schon nach einem Jahr lag mein Privatleben in Scherben, meine Ehe wurde von Tag zu Tag schlechter. Ich konnte nicht mehr die Augen davor verschließen.
Und ich hatte gedacht, meine Ausbildung bei Socrates würde mir das Leben leichter machen! Aber es schien alles nur immer schlimmer zu werden. Die Wogen von Arbeit, Familienleben, Fakultätssitzungen und privaten Sorgen hatten fast alles davongespült, was ich bei Socrates gelernt hatte.
Trotz seiner Mahnung: »Ein Krieger muß für alles offen sein, wie ein Kind«, lebte ich nur in meiner eigenen Welt und hatte mich in einen schützenden Kokon zurückgezogen. Ich hatte das Gefühl, daß niemand mich wirklich kannte oder verstand – auch Linda nicht. Ich fühlte mich isoliert und war keine angenehme Gesellschaft mehr, nicht einmal für mich selbst.
Und obwohl Socrates mir beigebracht hatte, »alle Gedanken loszulassen und nur im Jetzt zu leben«, dröhnte und brodelte es immer noch in mir: Zorn, Schuldgefühle, Reue und Sorgen ließen mich nicht zur Ruhe kommen.
Socrates’ befreiendes Lachen, das früher wie ein Kristallglockenspiel in meinem Inneren nachgeklungen hatte, war jetzt nur noch ein dumpfes Echo, eine blasse Erinnerung.
Gestreßt und aus den Fugen geraten, hatte ich kaum mehr Zeit und Energie für meine kleine Tochter. Ich hatte zugenommen, und das beeinträchtigte nicht nur meine Sportlichkeit, sondern auch meine Selbstachtung. Und was am allerschlimmsten war: Ich hatte den Faden verloren, den tieferen Sinn meiner Existenz.
Auch meine Beziehungen zu anderen Menschen sah ich plötzlich in einem sehr fragwürdigen Licht. Ich hatte mich stets als Mittelpunkt der Welt gesehen und nie gelernt, anderen Menschen Aufmerksamkeit zu schenken. Ich war es immer nur gewohnt gewesen, selbst im Rampenlicht zu stehen. Wahrscheinlich wollte ich jetzt meine Ziele und Prioritäten nicht für Linda und Holly oder irgendeinen anderen Menschen opfern, oder ich konnte es einfach nicht.
Allmählich ging mir auf, daß ich vielleicht egozentrischer als alle Menschen war, die ich je kennengelernt hatte. Das beunruhigte mich, und ich klammerte mich noch hartnäckiger an mein einstiges Selbstbild. Aufgrund meiner Unterweisung bei Socrates und all meiner früheren Leistungen sah ich mich immer noch als eine Art Ritter in glänzender Rüstung. Ich wollte nicht wahrhaben, daß die Rüstung inzwischen gerostet war.
Socrates hatte einmal zu mir gesagt: »Verkörpere stets das, was du lehrst, und lehre nur das, was du auch verkörperst.« Aber ich tat immer noch so, als sei ich der kluge, ja sogar weise Lehrer, und fühlte mich innerlich wie ein Scharlatan und Narr. Das wurde mir immer schmerzlicher bewußt.
Trotzdem konzentrierte ich mich ganz auf meine Arbeit als Trainer und Lehrer, die mir wenigstens noch so etwas wie Erfolgserlebnisse gab. Um die frustrierende Arena der zwischenmenschlichen Beziehungen, der ich mich am dringendsten hätte widmen müssen, machte ich einen großen Bogen.
Linda und ich entfernten uns innerlich immer mehr voneinander. Sie suchte sich Liebhaber, und ich suchte mir Freundinnen, bis das immer dünner werdende Band, das uns noch zusammenhielt, schließlich riß und wir beschlossen, uns zu trennen.
An einem kalten Tag im März zog ich aus. Der Schnee war gerade zu Schneematsch geworden. Ich verfrachtete meine wenigen Habseligkeiten in einen Lieferwagen, den ich mir von einem Freund geliehen hatte, und suchte mir ein Zimmer in der Stadt. Mein Verstand redete mir ein, das sei das beste für mich, aber mein Körper sprach eine ganz andere Sprache: Magenbeschwerden plagten mich, und ich bekam Muskelkrämpfe, die ich früher nie gekannt hatte. Selbst kleine Wunden – z. B. wenn ich mir die Haut an einer scharfen Papierkante oder einem vorstehenden Nagel aufriß – entzündeten sich.
In den nächsten Wochen funktionierte ich allein deshalb, weil ich noch den vergangenen Alltagstrott in mir hatte. Mechanisch ging ich meiner täglichen beruflichen Routine nach. Aber meine Identität, das Leben, das ich für mich geplant hatte – all das war in sich zusammengestürzt wie ein Kartenhaus. Ich fühlte mich elend und verloren und wußte nicht, wohin.
Doch eines Tages, als ich in meinem Postfach im Institut für Sport und Körpererziehung nachsah, ob etwas für mich gekommen war, rutschte mir ein Rundschreiben meiner Fakultät aus den Händen und fiel geöffnet auf den Boden. Während ich mich bückte, um es aufzuheben, überflog ich die Mitteilung: »Alle Mitglieder unserer Fakultät sind herzlich eingeladen, sich um ein Powers-Auslandsstipendium zu bewerben, das Ihnen die Möglichkeit bieten soll, auch in anderen Ländern und Kulturen Erfahrungen auf Ihrem Fachgebiet zu sammeln.«
Da durchfuhr mich plötzlich ein schicksalhaftes Gefühl: Ich wußte, daß ich mich um dieses Stipendium bewerben und daß ich es auch irgendwie bekommen würde. Es war ein Wissen, das ich mir nicht erklären konnte, ein Wissen, das aus dem Bauch heraus kam.
Zwei Wochen später fand ich den Antwortbrief in meinem Briefkasten, riß ihn auf und las: »Der Vorstand des Treuhänderausschusses freut sich, Ihnen mitteilen zu können, daß Sie ein Powers-Auslandsstipendium in Höhe von zweitausend Dollar für Reisen und Forschungen auf Ihrem Studiengebiet erhalten. Die Reise muß im Sommer des Jahres 1973 stattfinden. Wenn Sie möchten, können Sie sie auch noch während Ihres kommenden sechsmonatigen Forschungsurlaubs fortsetzen …«
Ein Fenster hatte sich geöffnet. Es gab wieder eine Richtung, in die ich gehen konnte.
Aber wo sollte ich hinreisen? Die Antwort fiel mir während eines Yogakurses ein, den ich mitmachte, um meinen Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Einige der Atem- und Meditationsübungen erinnerten mich nämlich an die Techniken, die ich bei Joseph gelernt hatte, einem früheren Schüler von Socrates, der in Berkeley ein kleines Café gehabt hatte. Wie ich seinen buschigen Bart und sein sanftes Lächeln vermißte!
Joseph war in Indien gewesen und hatte sich sehr positiv über die Erfahrungen geäußert, die er dort gemacht hatte. Ich hatte schon etliche Bücher über indische Heilige, Weise und Gurus und auch über Yogaphilosophie und -metaphysik gelesen. In Indien würde ich vielleicht die geheimen Lehren und Praktiken lernen, durch die man zur Befreiung gelangt – und wenn nicht, würde ich dort zumindest meinen Weg wiederfinden.
Ja, ich würde nach Indien reisen; das war das naheliegendste. Und ich würde nicht viel Gepäck mitnehmen, nur einen kleinen Rucksack und ein Flugticket mit offenem Rückflugdatum, um möglichst flexibel zu sein. Ich vertiefte mich in Landkarten und Reiseführer über Indien und besorgte mir einen Reisepaß und die nötigen Impfungen.
Als mein Plan feststand, erzählte ich Linda davon und erklärte ihr, daß ich versuchen würde, Holly hin und wieder eine Postkarte zu schicken, aber ansonsten würden sie vielleicht längere Zeit nichts von mir hören.
Sie sagte, das sei nichts Neues.
An einem warmen Frühlingsmorgen kurz vor Semesterende saß ich mit meiner vierjährigen Tochter auf dem Rasen und bemühte mich, ihr meine Entscheidung zu erklären. »Schatz, ich muß für eine Weile wegfahren.«
»Wo fährst du denn hin, Vati?«
»Nach Indien.«
»Da, wo es Elefanten gibt?«
»Ja.«
»Können Mami und ich auch mitkommen?«
»Diesmal nicht. Aber irgendwann machen wir zwei eine Reise zusammen – nur du und ich. Okay?«
»Okay.« Sie überlegte. »Wo liegt denn Indien?« fragte sie dann.
»Dort«, zeigte ich.
»Bleibst du lange weg?«
»Ja, Holly«, antwortete ich ehrlich. »Aber egal, wo ich bin – ich werde dich immer liebhaben und an dich denken. Denkst du auch an mich?«
»Ja. Mußt du denn wirklich weggehen, Vati?« Genau diese Frage hatte ich mir auch schon oft gestellt.
»Ja.«
»Warum?«
Ich suchte nach den richtigen Worten. »Es gibt Dinge, die du erst verstehen wirst, wenn du älter bist. Ich muß einfach – obwohl ich dich sehr vermissen werde.«
Als Linda und ich beschlossen hatten, uns zu trennen, und ich auszog, hatte Holly sich an mein Bein geklammert und mich nicht loslassen wollen. »Geh nicht weg, Vati! Bitte! Geh nicht weg!« hatte sie geweint. Ich hatte mich sanft, aber bestimmt losgemacht, sie umarmt und dann von mir weggeschoben. Das war so ziemlich das Schwerste gewesen, was ich bisher in meinem Leben hatte tun müssen.
Als ich Holly diesmal sagte, daß ich fortgehen würde, weinte sie nicht mehr; und sie bat mich auch nicht dazubleiben. Sie senkte nur die Augen und blickte aufs Gras. Das tat mir am meisten weh, denn ich spürte, was in ihr vorging: Sie hatte einfach die Hoffnung aufgegeben.
Eine Woche später war das Semester zu Ende. Nach einem bittersüßen Abschied von Linda nahm ich meine kleine Tochter noch einmal in die Arme und ging dann. Die Taxitür knallte hinter mir zu. Während das Taxi losfuhr, schaute ich durch das Rückfenster und sah mein Zuhause und die Welt, die mir vertraut war, allmählich immer kleiner werden, bis mich nur noch mein Spiegelbild in der Fensterscheibe anstarrte. Mit gemischten Gefühlen wandte ich mich dem Taxifahrer zu: »Hopkins-Flughafen.«
Ich hatte den ganzen Sommer und anschließend noch einen sechsmonatigen Forschungsurlaub vor mir, insgesamt also neun Monate, um auf die Suche zu gehen und mich überraschen zu lassen, was für ein neues Leben auf mich wartete.
2
DIE GEHEIMNISVOLLE UNBEKANNTE
Sicher ist ein Schiff nur im Hafen – aber dafür sind Schiffe nicht gebaut.
JOHN A. SHEDD
Ich hing zwischen Himmel und Erde, schaute aus dem Fenster meiner 747 auf die Wolkendecke hinunter, die den Indischen Ozean überspannte, und fragte mich, ob die Antworten, nach denen ich suchte, wohl da unten irgendwo lagen.
Während mir diese und andere Fragen durch den Kopf gingen, fielen mir allmählich die Augen zu. Ich wachte erst wieder auf, als die Maschine zur Landung ansetzte.
In Indien herrschte die feuchte Monsunzeit. Ständig von Regen oder Schweiß durchnäßt, fuhr ich mit uralten Taxis, Rikschas, Bussen und Zügen durch das Land. Ich wanderte über schlammige Landstraßen und durch lärmende Basare, wo Hindufakire ihre Fähigkeiten demonstrierten und mich mit ihrer strengen Selbstdisziplin und Askese beeindruckten.
Von Kalkutta nach Madras und dann nach Bombay. Überall sah ich Menschenscharen, die hin und her liefen wie Ameisen und sich durch die Straßen drängten. Heiliges, überbevölkertes Indien, wo auf jedem Quadratkilometer, jedem Quadratmeter, jedem Quadratzentimeter unzählige Menschenseelen zusammengepfercht sind …
Mit unermüdlichem Eifer machte ich etliche Yogaschulen ausfindig, wo ich eine Menge Positionen, Atem- und Meditationstechniken lernte, so ähnlich wie die, die Socrates und Joseph mir beigebracht hatten.
In Kalkutta sah ich die Ärmsten der Armen, die in Schmutz und Elend dahinvegetierten. Wo ich auch hinschaute, sah ich Bettler – Männer, Frauen und verkrüppelte Kinder in zerlumpten Kleidern. Kaum hatte ich einem ein Geldstück gegeben, waren auch schon zehn andere da. Das bildete einen krassen Gegensatz zur prunkvollen Erhabenheit des Taj Mahal und anderer heiliger Stätten voll Schönheit und spirituellem Gleichgewicht.
Ich pilgerte zu den Ashrams, begegnete Weisen, die von der monistischen Weisheit des Advaita-Vedanta erfüllt waren und lehrten, daß Samsara und Nirvana, Fleisch und Geist in Wirklichkeit eins sind. Ich erfuhr von der Göttlichkeit und heiligen Dreiheit von Brahma, dem Schöpfer, Vishnu, dem Erhalter, und Shiva, dem Zerstörer.
Ich saß Gurus zu Füßen, die mich einfache Weisheiten lehrten und von denen eine große Liebe und Überzeugungskraft ausging. Ich erlebte die inbrünstige Religiosität heiliger Männer und Frauen. Ich wanderte sogar mit Sherpaführern in Tibet, Nepal und im Pamir-Gebiet, wo ich Einsiedlern und Asketen begegnete. Ich atmete die dünne Gebirgsluft, saß in den Höhlen und meditierte.
Und doch wurde ich von Tag zu Tag mutloser, denn nirgends fand ich einen Lehrer wie Socrates, und ich lernte nichts, was ich nicht auch in einer Buchhandlung an der amerikanischen Ostküste hätte entdecken können. Ich hatte das Gefühl, in die geheimnisvolle Welt des Ostens gereist zu sein, nur um festzustellen, daß die weisen Lehrer und Meister gerade nicht da waren. Wahrscheinlich hatten sie Urlaub und besuchten ihre Verwandten in Kalifornien!
Ich hatte die größte Hochachtung vor den spirituellen Traditionen Indiens. Ich bewunderte seine alte Kultur und seine geistigen Schätze. Doch wohin ich auch ging – überall hatte ich das Gefühl, nur ein Außenstehender zu sein. Nichts und niemand berührte mich wirklich. Aber daran war nicht Indien schuld, sondern ich! Nachdem mir das klargeworden war, zog ich entmutigt, aber entschlossen die Konsequenzen: Ich beschloß, nach Hause zurückzufahren. Ich wollte versuchen, mein Familienleben wieder in Ordnung zu bringen. Das war das einzig Richtige, das einzig Verantwortungsvolle.
Ich hatte vor, die östliche Route über Hawaii zu nehmen, dort ein paar Tage Pause zu machen und dann nach Ohio zurückzukehren – zu Holly und Linda. Sie fehlten mir alle beide. Irgendwie ließ sich die Sache vielleicht doch noch reparieren …
Vielleicht war es ein Wink mit dem Zaunpfahl, daß Indien mir nichts gegeben hatte, sagte ich mir. Vielleicht war meine Zeit bei Socrates schon die ganze spirituelle Unterweisung, die mir bestimmt war. Aber andererseits, wenn das stimmte, woher kam dann diese Unruhe in mir, die immer stärker wurde?
Mein Jet flog durch die Nacht; die Lichter an seinen Tragflächen funkelten wie winzig kleine Sterne, während wir über einer schlafenden Welt dahinglitten. Ich versuchte zu lesen, aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich versuchte zu schlafen, aber unruhige Träume verfolgten mich. Immer wieder tauchte Socrates’ Gesicht vor mir auf, und ich hörte Fetzen von Gesprächen, die ich vor vielen Jahren mit ihm geführt hatte. Als wir auf Hawaii landeten, wurde dieses Gefühl, etwas Wichtiges verpassen zu können, allmählich immer unerträglicher, wie ein Feuer in meinem Bauch. Ich brannte innerlich. Mir war, als müßte ich laut schreien: Was soll ich denn bloß tun?
Ich stieg aus dem Flugzeug und streckte im strahlenden Sonnenschein meine Glieder. Der feuchte hawaiianische Wind beruhigte ein wenig meine Nerven.
Legenden behaupten, daß von diesen Inseln seit alter Zeit eine starke heilende Energie ausgeht. Ich hoffte, daß davon unter dem falschen Glanz der Zivilisation noch etwas übrig war und diesen bellenden Hund in meinem Inneren zum Schweigen bringen würde.
Nach einem kleinen Imbiß am Flughafen, einer unbequemen Busfahrt durch die Straßen von Waikiki, in denen reges Leben herrschte, und einem einstündigen Fußmarsch fand ich ein kleines Zimmer abseits der ausgetretenen Wege des Tourismus. Ich probierte die Toilette aus, stellte fest, daß sie ein Leck hatte, und packte dann rasch die wenigen Habseligkeiten aus meinem alten Rucksack aus. In der halboffenen Schublade des Nachttischs sah ich ein Telefonbuch mit Eselsohren und eine kaum benutzte Bibel. Dieses Zimmer würde meinen Ansprüchen für ein paar Tage genügen.
Ich war auf einmal sehr müde. Ich legte mich auf das viel zu weiche Bett, dessen Federn quietschten, und fiel sofort in den Schlaf. Aber nur wenig später riß ich die Augen auf und schnellte kerzengerade hoch. »Die Schamanin!« rief ich laut, und mir war kaum bewußt, was ich sagte. »Wie konnte ich das nur vergessen?« Ich schlug mir an die Stirn. Was hatte Socrates über sie erzählt? Nacheinander stiegen die Erinnerungen wieder in mir auf. Er hatte mich eindringlich ermahnt, irgendeine Frau auf Hawaii zu suchen, und er hatte eine Schule erwähnt – wo war sie doch gleich? – in Japan. Und dann hatte er noch irgend etwas von einem heiligen Buch in der Wüste gesagt – einem Buch über den Sinn des Lebens!
Ich wollte dieses Buch und diese Schule suchen; aber zuerst einmal mußte ich die Frau ausfindig machen. Deshalb also war ich hier; das war der Grund für das schicksalhafte Gefühl, das mich damals beschlichen hatte; deswegen hatte ich diese Reise unternommen!
Bei dieser Erkenntnis lockerte meine Bauchmuskulatur sich wieder, und der Schmerz in meinem Inneren verwandelte sich in gespannte Aufregung. Ich konnte kaum noch ruhig sitzen. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf: Was hat er mir über sie erzählt? Sie hat ihm auf Briefpapier geschrieben – Briefpapier von einer Bank! Ja, das war es!
Hastig griff ich nach dem Branchenbuch und schlug die Rubrik »Banken« auf. Schon allein in Honolulu gab es zweiundzwanzig! »Es hat keinen Zweck«, murmelte ich vor mich hin. Er hatte mir weder ihren Namen noch ihre Adresse gesagt, und ich wußte auch nicht, wie sie aussah. Ich hatte so gut wie gar keinen Anhaltspunkt. Es schien unmöglich zu sein.
Da stieg wieder dieses Gefühl in mir auf, daß das alles Schicksal war. Nein, es konnte nicht alles vergeblich gewesen sein. Immerhin war ich hier. Irgendwie würde ich sie schon finden. Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Wenn ich mich beeilte, konnte ich mir noch ein paar Banken ansehen, ehe die Geschäfte schlossen.
Aber ich war auf Hawaii und nicht in New York, hier hatten die Menschen es nirgends eilig. Und was sollte ich denn tun, wenn ich bei der ersten Bank angelangt war – hineingehen und ein Schild vor mir hertragen mit der Aufschrift: »Ich suche eine ganz besondere Frau«? Oder sollte ich jeder Bankangestellten geheimnisvoll zuraunen: »Socrates hat mich geschickt«? Vielleicht nannte diese Frau ihn gar nicht Socrates – falls sie immer noch bei einer Bank arbeitete, falls es sie überhaupt gab.
Ich starrte aus dem Fenster auf eine Ziegelsteinmauer an der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Strand war nur zehn Straßen entfernt. Ich würde irgendwo zu Abend essen, einen Spaziergang am Meer entlang machen und mir darüber klarwerden, was ich tun sollte.
Ich kam gerade noch rechtzeitig zum Sonnenuntergang an den Strand, stellte aber dann fest, daß die Sonne auf der anderen Seite der Insel unterging. »Das ist ja phantastisch«, murmelte ich leise vor mich hin. »Wie soll ich diese geheimnisvolle Frau ausfindig machen, wenn ich nicht einmal einen Sonnenuntergang finde?«
Ich legte mich in der milden Abendluft in den weichen, noch warmen Sand und blickte zu einem Palmwipfel empor. Während die grünen Palmwedel in der leichten Meeresbrise hin und her schaukelten, zerbrach ich mir den Kopf nach einem Plan.
Als ich am nächsten Tag an einer Zeitungsredaktion vorbeiging, kam mir der rettende Gedanke. Ich ging hinein und verfaßte rasch eine Annonce, die unter der Rubrik »Private Kleinanzeigen« erscheinen sollte. Sie lautete: »Friedvoller junger Krieger, Freund von Socrates, sucht gleichgesinnte Bankangestellte. Laß uns gemeinsam etwas bewirken.« Dazu gab ich meine Telefonnummer in meinem Motel an. Wahrscheinlich war das eine blöde Idee, und ich hatte nicht viel mehr Aussicht auf Erfolg als jemand, der eine Flaschenpost ins Meer wirft. Mein Plan war sicherlich weit hergeholt – aber immerhin besser als gar nichts!
Mehrere Tage vergingen. Ich besuchte Kunstgalerien, tauchte im Meer, lag am Strand – und wartete und wartete. Auf meine Anzeige meldete sich jedoch niemand, und einfach nur durch die Straßen zu wandern in der Hoffnung, sie zufällig irgendwo zu treffen, kam mir ziemlich sinnlos vor. Entmutigt rief ich beim Flughafen an und buchte einen Flug nach Hause. Ich war im Begriff, die Hoffnung aufzugeben.
Im Bus zum Flughafen war ich wie betäubt und nahm nichts von meiner Umgebung wahr. Erst als ich am Flughafenschalter stand, kam ich wieder zu mir. Und als ich dann in der Abflughalle saß und mein Flug aufgerufen wurde, sagte eine innere Stimme: Nein. Und da wußte ich, daß ich nicht aufgeben konnte. Weder jetzt noch später. Egal, was passierte. Ich mußte sie finden.
Ich stornierte meinen Flug, kaufte mir einen Stadtplan und fuhr mit dem nächsten Bus zurück nach Honolulu. Alle Banken, die ich unterwegs sah, trug ich auf meinem Stadtplan ein.
Erleichtert betrat ich die erste Bank – die übliche Einrichtung und um diese Tageszeit noch fast leer. Prüfend ließ ich meine Blicke umherwandern und entdeckte sofort eine Frau, die vielleicht die richtige war – eine schlanke, sportlich aussehende Dame ungefähr Mitte Vierzig. Sie drehte sich um und schenkte mir ein flüchtiges Lächeln. Als unsere Blicke sich trafen, hatte ich das intuitive Gefühl, daß sie diejenige war, die ich suchte – unglaublich! Warum hatte ich mich nicht von Anfang an auf meine Eingebungen verlassen?
Als sie ihr Gespräch mit einem Kollegen beendet hatte, kehrte sie an ihren Schreibtisch neben den Schließfächern und dem Tresor zurück. Geduldig wartete ich einen geeigneten Augenblick ab. Dann holte ich tief Luft und ging auf sie zu.
»Entschuldigen Sie«, sagte ich und setzte mein strahlendstes, intelligentestes Lächeln auf, um wenigstens nicht völlig verrückt zu erscheinen. »Ich suche eine Frau – nein, warten Sie, ich muß es anders ausdrücken –, ich suche jemanden, der zufällig weiblichen Geschlechts ist; aber ich weiß ihren Namen nicht. Wissen Sie, ein älterer Herr – na ja, ein Herr ist er eigentlich nicht –, also jedenfalls ein alter Mann namens Socrates hat mir geraten, sie zu suchen. Sagt Ihnen dieser Name etwas?«
»Socrates?« wiederholte sie. »War das nicht irgend so ein alter Grieche oder Römer?«
»Ja, das ist er – war er …«, antwortete ich. Meine Hoffnung schwand allmählich wieder dahin. »Aber vielleicht kennen Sie ihn unter einem anderen Namen. Er ist ein Lehrer von mir. Ich lernte ihn an einer Tankstelle kennen«, flüsterte ich beschwörend und betonte das Wort Tankstelle, »an einer Tankstelle in Kalifornien.« Dann wartete ich mit angehaltenem Atem.
Allmählich weiteten sich ihre Augen, und dann schien ein Licht in ihnen aufzuleuchten. »Ja! Ich hatte mal einen Freund, der an einer Tankstelle in Kalifornien arbeitete. Aber der hieß Ralph. Könnte es sein, daß Sie Ralph meinen?«
»Hm … Nein«, erwiderte ich enttäuscht. »Ich glaube nicht.«
»Tja … Ich muß jetzt wieder an die Arbeit. Hoffentlich finden Sie Ihren Archimedes …«
»Socrates«, korrigierte ich sie. »Und außerdem suche ich nicht ihn, ich suche eine Frau!«
Ich merkte, wie ihr Blick frostig wurde. Ihr Tonfall veränderte sich. »Tut mir leid, ich muß jetzt gehen. Ich hoffe, daß Sie bald eine Frau finden!«
Ich spürte ihren Blick im Nacken, als ich auf die nächste Bankangestellte zuging, eine etwa fünfzigjährige Frau mit einer dicken Schicht Make-up und viel Rouge, um mein Sprüchlein in leicht veränderter Form wieder aufzusagen. Diese Dame war zwar keine sehr vielversprechende Kandidatin, aber ich durfte niemanden auslassen. Sie wechselte einen Blick mit der ersten Angestellten und sah mich dann wieder an. Ihre Augen waren voller Mißtrauen. »Was kann ich für Sie tun?« fragte sie.
Die müssen irgendeine Art von Telepathie können, dachte ich.
»Ich suche eine Frau, die bei einer Bank arbeitet«, erklärte ich, »aber ich habe den Zettel mit ihrem Namen verlegt. Sie kennen nicht zufällig einen Mann namens Socrates …?«
»Sie sollten sich lieber an jemand anders wenden«, sagte sie kühl. Zuerst dachte ich, sie wollte einen von den Sicherheitsmännern herbeiwinken, doch dann zeigte sie auf eine Angestellte in einem dunklen Kostüm, die hinter einem Schalter saß und gerade den Telefonhörer auflegte.
Ich nickte ihr dankend zu, ging zu der Frau hinüber und stellte mich vor: »Hallo! Ich bin ein friedvoller Krieger. Kennen Sie Socrates von der Tankstelle …?«
»Wie bitte?« antwortete sie und warf einen bedeutungsvollen Blick zum Wachtposten am Eingang hinüber.
»Ich habe gesagt, ich bin ein potentieller Kunde. Ich suche eine Bankangestellte, die sich in Wertpapieren auskennt …«
»Ach so«, meinte sie lächelnd und strich sich ihre Jacke glatt. »Ich glaube, da kann ich Ihnen weiterhelfen.«
»O je, so spät ist es schon. Ich muß weg«, sagte ich bedauernd mit einem Blick auf meine Uhr. »Ich komme ein andermal wieder. Dann können wir zusammen essen gehen. Auf Wiedersehen, ciao, aloha, tschüß.« Mit diesen Worten machte ich mich aus dem Staub.
Diesen Spruch vom friedvollen Krieger und potentiellen Kunden sagte ich den ganzen Nachmittag über immer wieder auf. Schließlich entdeckte ich eine Bar und trank zum erstenmal seit langem wieder ein Bier. Und dabei mag ich überhaupt kein Bier!
Nachdem ich acht weitere Banken absolviert hatte und schon wieder vor der nächsten stand, nahm ich mir vor, nie im Leben auch nur auf den Gedanken zu verfallen, Privatdetektiv zu werden! Der Rücken tat mir weh, und ich hatte das Gefühl, gleich ein Magengeschwür zu bekommen. Eigentlich war das Ganze eine verrückte Idee. Vielleicht arbeitete die Frau gar nicht bei einer Bank, und das Briefpapier hatte ihr nur jemand gegeben. Warum sollte eine Schamanin ausgerechnet bei einer Bank angestellt sein? Andererseits – warum arbeitete ein alter Krieger wie Socrates an einer Tankstelle?
Ich war verwirrter und mutloser denn je. Der Glaube an meine Intuition, den ich vorher noch gehabt hatte, war inzwischen genauso plattgedrückt wie die Coladose neben mir auf dem Bürgersteig. Ich hob sie auf und warf sie in einen Abfallkorb – eine gute Tat. Dann war dieser Tag wenigstens nicht völlig verschwendet.
In dieser Nacht schlief ich wie ein Toter – und das war nicht weit von der Wahrheit weg.
Am nächsten Tag machte ich bei weiteren zehn Banken die Runde und kehrte am Abend erschöpft und wie betäubt in mein Zimmer zurück. In zwei Spar- und Darlehnskassen hatte man mich aufgefordert, sofort zu verschwinden. Bei der letzten Bank war ich aggressiv geworden. Beinahe hätte die Polizei mich verhaftet. Ich war völlig mit den Nerven am Ende und beschloß, für heute Schluß zu machen.
In dieser Nacht träumte ich, ich liefe immer hinter der Frau her, die ich suchte, und verpaßte sie jedesmal nur um Haaresbreite. Es war wie in einem Film, wenn die beiden Hauptfiguren schon fast nebeneinander stehen, sich dann aber im letzten Augenblick noch den Rücken zukehren und sich verfehlen. Diese Szene wiederholte sich immer wieder von neuem und brachte mich zum Wahnsinn.
Müde und zerschlagen wachte ich auf. Heute war ich zu allem bereit – wirklich zu allem –, nur nach einer namenlosen Bankangestellten wollte ich nicht mehr suchen. Aber irgendwie zahlte sich mein Training bei Socrates jetzt tatsächlich aus, denn ich zwang mich, aufzustehen, mich anzuziehen und wieder auf die Suche zu gehen. Kleine Siege der Selbstdisziplin wie dieser können viel bewirken.
An diesem dritten Tag meiner Suche hatte ich wirklich die Grenzen meiner Willenskraft erreicht. Doch es gab wenigstens einen Lichtblick, eine heitere Oase in einem Meer finsterer Gesichter: In der vierten Bank traf ich eine außerordentlich hübsche Kassiererin, ungefähr in meinem Alter. Als ich ihr erklärte, ich suchte eine ganz besondere Frau, fragte sie mich mit einem Lächeln, das ihre Grübchen zur Geltung brachte: »Bin ich besonders genug?«
»Ich … ja … eigentlich sind Sie eine der besondersten Frauen, die mir seit langem über den Weg gelaufen sind«, grinste ich. Ich hatte zwar meine Zweifel, ob sie wirklich die Schamanin war, nach der ich suchte. Aber in meinem Leben waren schon merkwürdigere Dinge passiert, und bei Socrates konnte man schließlich nie wissen …
Sie sah mir unverwandt in die Augen, als warte sie auf etwas. Aber vielleicht wollte sie auch nur flirten. Oder sie wollte, daß ich ein Konto bei ihrer Bank eröffnete. Aber sie konnte ja auch die Tochter der Schamanin sein! Ich durfte keine Chance ungenutzt lassen, sagte ich mir. Und ein bißchen Spaß konnte mir auch nicht schaden.
»Wissen Sie, wer ich bin?« fragte ich.
»Sie kommen mir irgendwie bekannt vor«, antwortete sie.
Verflixt noch mal. Wußte sie, was ich meinte, oder nicht? »Ich will Ihnen was sagen, Fräulein … äh …«, ich warf einen Blick auf das Namensschild an ihrem Schalter, »… Barbara. Ich heiße Dan. Ich bin Professor an einem College und mache ein paar Tage Urlaub hier in Honolulu, und – na ja, es ist ein bißchen einsam, wenn man seine Ferien so ganz allein verbringt. Ich weiß, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich möchte Sie trotzdem gern zum Essen einladen, wenn Sie Feierabend haben. Vielleicht können Sie mir zeigen, wo die Sonne untergeht, oder wir können uns über Tankstellen und alte Lehrer unterhalten …«
Wieder lächelte sie – eindeutig ein gutes Zeichen. »Wenn das aus einem Buch ist«, sagte sie, »ist es zumindest originell. Ich mache um fünf Uhr Schluß; wir treffen uns dann draußen vor dem Eingang.«
»Wunderbar! Also bis nachher.«
Beschwingt verließ ich die Bank. Ich hatte eine Verabredung, vielleicht sogar einen Anhaltspunkt, wo ich meine Schamanin finden konnte. Aber warum sagte dann eine leise Stimme in meinem Inneren: Du Idiot! Was soll das? Socrates hat dich auf eine wichtige Suche geschickt, und du gabelst eine Bankangestellte auf!
»Ach, halt die Klappe!« rief ich laut. Ein Passant drehte sich nach mir um und warf mir einen seltsamen Blick zu.
Jetzt war es fünf Minuten nach halb drei. Vor fünf Uhr konnte ich noch zwei, vielleicht sogar drei Banken abklappern. Ich studierte meinen Stadtplan. Die First Bank of Hawaii lag genau um die Ecke.
3
EINE RÄTSELHAFTE BOTSCHAFT
Wenn man sich mit allem Eifer und aller Kraft bemüht, helfen die Götter mit.
AISCHYLOS
Kaum hatte ich die Bank betreten, warf die Wache auch schon einen Blick in meine Richtung und kam auf mich zu, ging dann aber direkt an mir vorbei. Erleichtert atmete ich auf und warf einen Blick nach oben zu den Kameras. Sie schienen alle auf mich gerichtet zu sein. In geschäftsmäßiger Haltung ging ich zu einem Schalter, tat, als füllte ich einen Einzahlungsbeleg aus, und sah mir den Laden erst einmal genauer an.
Etwa einen Meter von mir entfernt stand ein sehr nüchtern wirkender Schreibtisch, hinter dem eine ebenso nüchtern aussehende Bankangestellte saß – eine große, aristokratisch wirkende Dame in den Fünfzigern. Sie blickte zu mir auf, als ich auf sie zuging. Doch ehe ich sie etwas fragen konnte, war sie schon aufgestanden. »Tut mir leid – ich habe jetzt Mittagspause, aber ich glaube, Mrs. Walker kann Ihnen weiterhelfen«, sagte sie und zeigte nach hinten auf den anderen Schalter. Dann drehte sie sich um und war verschwunden.
»Hm … danke«, murmelte ich ihr nach.
Mrs. Walker ignorierte mich jedoch genauso wie die anderen Angestellten. Bei der nächsten Bank ging es mir ebenso. Dort wurde ich sogar vom Wachmann hinausbegleitet und aufgefordert, mich ja nie wieder blicken zu lassen.
Resigniert lehnte ich mich an eine Hauswand und ließ mich langsam hinabgleiten, bis ich auf dem Bürgersteig saß. Ich wußte nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. »Ich habe es satt«, sagte ich laut. »Das war’s. Schluß damit. Keine Banken mehr.«
Ich begriff zwar, wie wichtig es ist, niemals aufzugeben; aber irgendwann erreicht man einen Punkt, wo man nicht mehr mit dem Kopf gegen die Wand rennen will. Es funktionierte einfach nicht. Ich würde zu meiner Verabredung gehen, mir den Sonnenuntergang ansehen und dann zurück nach Ohio fliegen.
Während ich so dasaß und mich selbst bemitleidete, hörte ich eine Stimme fragen: »Alles in Ordnung?« Ich blickte auf und sah eine kleine, mollige Asiatin mit silbernem Haar, die einen zu weiten Muumuu trug und einen Bambusstock in der Hand hielt. Sie war etwa sechzig Jahre alt und lächelte mit einem Ausdruck mütterlicher Besorgnis zu mir herunter.
»Ja, danke, es geht schon«, antwortete ich und stand mühsam auf.
»Sieht aber nicht so aus«, widersprach sie. »Sie machen einen müden Eindruck.«
Beinahe hätte ich sie gereizt angefahren: Was geht Sie das an? Statt dessen holte ich tief Luft. »Stimmt«, gab ich zu. »Ich bin müde. Aber ich war schon öfter müde; es geht mir gleich wieder besser. Vielen Dank.« Ich erwartete, daß sie nicken und weitergehen würde. Aber sie blieb stehen und sah mich unverwandt an.
»Trotzdem«, sagte sie, »ich wette, ein Glas Saft würde Ihnen guttun.«
»Sind Sie Ärztin? Oder Krankenschwester?« fragte ich halb im Scherz.
»Nein«, lächelte sie. »Eigentlich nicht. Aber ich kenne das. Victor – mein Patensohn – verausgabt sich auch immer so.«
»Ach so«, sagte ich und lächelte. Sie schien eine nette Frau zu sein. »Ein Saft würde mir tatsächlich nicht schaden. Darf ich Sie zu einem Glas einladen?«
»Das ist sehr nett von Ihnen«, sagte sie. Wir gingen in ein Straßencafé neben der Bank. Mir fiel auf, daß sie stark hinkte.
»Ich heiße Ruth Johnson«, stellte sie sich vor, lehnte ihren alten Bambusstock an die Theke und streckte mir die Hand entgegen. Johnson war kein typisch asiatischer Nachname; wahrscheinlich war sie mit einem Weißen verheiratet.
»Dan Millman«, sagte ich, ergriff ihre Hand und bestellte einen Karottensaft.
»Für mich bitte auch einen«, sagte Mrs. Johnson. Als sie sich der Kellnerin zuwandte, sah ich mir ihr Gesicht genauer an – sie hatte leicht hawaiianische Gesichtszüge, vielleicht mit einem japanischen Einschlag. Ihr Teint war zart gebräunt.
Die Kellnerin stellte unsere Gläser auf den Tisch. Ich ergriff das meine. Da fiel mir auf, daß Mrs. Johnson mich unverwandt anstarrte. Sie sah mir in die Augen, und ihr Blick ließ mich nicht mehr los. Sie hatte unergründliche Augen, wie Socrates. Ach was, dachte ich. Laß doch endlich diese Hirngespinste.
Aber sie starrte mich weiter an. »Kenne ich Sie irgendwoher?«
»Ich glaube nicht«, antwortete ich. »Ich bin zum erstenmal hier.«
»In Honolulu?«
Nein, auf dem Planeten Erde, dachte ich. »Ja«, sagte ich laut.
Sie musterte mich noch ein paar Sekunden lang intensiv und meinte dann: »Na ja, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Sie machen also Urlaub hier?«
»Ja, ich arbeite am Oberlin College und bin auf einer Forschungsreise hier«, antwortete ich.
»Oberlin? Tatsächlich? Dort studiert eine Nichte von mir!«
»Ach, wirklich?« sagte ich und warf einen Blick auf meine Armbanduhr.
»Ja. Und mein Patensohn Victor will nächstes Jahr auch dorthin. Er hat gerade seine Abschlußprüfung an der Punaho School gemacht. Kommen Sie mich doch heute abend besuchen! Dann könnten Sie sich mit Victor unterhalten. Er wäre begeistert, einen Professor vom Oberlin College kennenzulernen!«
»Vielen Dank für die Einladung! Aber ich habe schon etwas anderes vor.«
Keineswegs entmutigt, kritzelte sie mit ihren zitternden Händen eine Adresse auf ein Stück Papier und gab es mir. »Falls Sie es sich doch noch anders überlegen.«
»Vielen Dank«, sagte ich und stand auf, um zu gehen.
»Ich habe zu danken«, erwiderte sie, »für den Saft.«
»Keine Ursache«, wehrte ich ab und warf einen Fünfdollarschein auf die Theke. Nach kurzem Zögern fragte ich sie: »Sie arbeiten nicht zufällig bei einer Bank?«
»Nein«, antwortete sie. »Warum?«
»Ach, nichts.«
»Also dann, aloha«, winkte sie mir zu. »Erschaffen Sie sich einen schönen Tag!«
Ich blieb stehen und drehte mich entgeistert nach ihr um. »Was haben Sie da gesagt – erschaffen Sie sich einen schönen Tag?«
»Ja.«
»Aber die meisten Leute sagen doch: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.«
»Ja, vermutlich.«
»Ich hatte nämlich mal einen Lehrer – der hat das auch immer gesagt.«
»Ach, wirklich?« sagte sie und lächelte mich seltsam an. »Interessant.«
Der Realitätsmesser in meinem Inneren begann Alarm zu schlagen; ich hatte plötzlich ein pelziges Gefühl auf der Zunge. Ging hier alles mit rechten Dingen zu?
Wieder musterte sie mich – erst prüfend und dann mit einem so intensiven, durchbohrenden Blick, daß alles um mich her versank. »Ich kenne Sie«, sagte sie.
Meine ganze Umgebung erstrahlte plötzlich in leuchtenden Farben. Ich spürte, wie ich errötete. In meinen Händen begann es zu kribbeln. Wann hatte ich das letzte Mal so ein Gefühl gehabt? Dann fiel es mir wieder ein. In einer sternklaren Nacht an einer alten Tankstelle!
»Was, Sie kennen mich?«
»Ja. Am Anfang war ich mir nicht sicher, aber jetzt habe ich Sie erkannt – als einen gutherzigen Menschen. Sie sind nur ein bißchen streng mit sich selber.«
»Ach so«, sagte ich enttäuscht. »Das meinen Sie!«