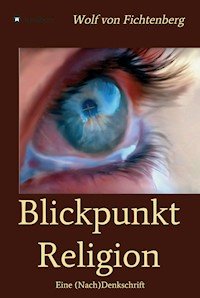3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Historischer Roman
Das E-Book Der Pfeifer wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Abenteuer, Geschichte, Roman, Historie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Wolf von Fichtenberg
Der Pfeifer
Historischer Romanaus der Zeit des Interregnums
© 2020 Wolf von Fichtenberg
Zweite Auflage
Umschlaggestaltung, Illustration: Wolf von Fichtenberg
Verlag: tredition GmbH
978-3-347-03120-3 (Paperback)
978-3-347-03121-0 (Hardcover)
978-3-347-03122-7 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Jegliche Genehmigungen bedürfen der vertraglichen Schriftform. Mündliche Absprachen sind ungültig. Der Autor behält sich alle Rechte vor.
Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z. B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten. (§§ 97 UrhG).
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Heute
„Du spinnst!“
Peter Baumgart drehte sich in seinem Sessel.
Er saß hinter einem quadratischen Schreibtisch und sog paffend an seiner, anscheinend nie verglühenden, Zigarre. Aus dem Fenster sah man, trotz des Winters, den typisch englischen Nieselregen, dessen feine Tropfen an den Scheiben des postmodernen Hochhauses hinabliefen. Seine faltige Hand griff nach dem Manuskript, welches ich ihm in der letzten Woche gegeben hatte.
„Glaubst Du wirklich den Unfug, den Du da verzapft hast?“
Wieder sog Baumgart an der Zigarre und eine neblige Qualmwolke verschleierte sein Gesicht:
„Mensch Wolf! Das ist ausgemachter Quatsch!“
Mit einer ausladenden Bewegung hielt er das Manuskript in der Hand.
„Mach daraus eine Kindergeschichte… Oder besser noch, wirf es einfach weg. Das liest niemand.“
Baumgart drehte sich um und wandte sich dem Panorama der Stadt zu, über deren Dächern er sein Büro hatte und trat dicht an das Fenster.
„Schau Dir das an Wolf. Das ist die Wirklichkeit; das einundzwanzigste Jahrhundert. Wolkenkratzer, Computer, Datenautobahnen, Television, Raumfahrt. Darüber solltest Du schreiben, das ist aktuell. Aber was ist das hier…? Du schreibst…, “ er rang hustend nach Worten, „so ein Zeug wie das hier…“.
Asche fiel von seiner Zigarre herab und staubte auf das Manuskript, mit dem er nun herumwedelte, als wolle er eine Fliege verjagen.
Ich räusperte mich:
„Das ist das einundzwanzigste Jahrhundert, sagst Du? Nun gut. Das was ich schrieb, ist aber genau dies. Das hier und heute. Es ist passiert. Es ist mir passiert und Du nennst es Unfug? Pah!“
Unwillig ging ich einige Schritte auf und ab.
„Peter, was stört Dich an der Geschichte?“
Baumgart griff erneut zu der Zigarre und betrachtete einen gerade entdeckten Aschekegel, der auf dem Boden lag.
„Wolf, hör zu! Das liest niemand. Niemand sage ich Dir. Ich bin Verleger und ein Verlag lebt davon, Bücher zu verkaufen. Bücher Wolf, - keine hirnlosen Spinnereien.“
Trotz seines alten, hageren Körpers huschte er elegant um den Schreibtisch herum und blies den Rauch der Zigarre schnaubend aus. Scheinbar teilnahmslos fuhr er fort:
„Wolf, wir kennen uns nun schon einige Jahre. Du hast den Abgabetermin bereits um zwei Monate überzogen. Ich habe immer wieder für Dich Partei ergriffen. Deinen Vorschuss habe ich auch pünktlich gezahlt. Sage mir bitte, wo ist die Fortsetzung des Kriminalromans, der geschrieben werden sollte? Man kann keinen Zweiteiler schreiben und dann die Fortsetzung einfach nicht bringen. Weißt Du, wie ich jetzt dastehe?“
Ärgerlich drehte er sich wieder der Panoramascheibe zu.
„Die Werbung für die Fortsetzung läuft bereits auf Hochtouren. Was sage ich den Händlern und was sage ich den Lesern?“
Nervös paffte er weiter an der Zigarre und blies dicke Rauchwolken gegen die Scheibe. Abrupt drehte er sich um.
„Soll ich sagen: Einen Krimi haben wir nicht, aber dafür eine…“, er stockte und rang nach Atem: „Eine… Ja, was ist das eigentlich?“
Wieder wedelte er mit dem Manuskript herum, welches er immer noch verkrampft in der Hand hielt.
„Peter!“
Ich machte eine ausladende Geste mit den Armen und ging einen Schritt auf ihn zu:
„Du verstehst es nicht. Du magst vom Geschäft etwas verstehen, aber … Aber das hier, das ist die Realität. Glaubst Du nicht, dass die Leser sich für die Wirklichkeit interessieren?“
Baumgart schüttelte den Kopf, trat zu seinem Sessel zurück und setzte sich umständlich. Mit einer abwertenden Geste schob er mir das Manuskript zu. Ich biss mir auf die Lippen und wandte mich zur Tür.
„Wolf, ich gebe Dir genau noch vier Wochen… Achtundzwanzig Tage! Bis dahin will ich den Krimi. Verflixt noch einmal, ich will ein brillantes Meisterstück. Das wird verdammt schwer werden, das weiß ich. Aber wenn ich das Manuskript bis dahin nicht habe, dann bist Du draußen. Dann kannst Du bei einem Lokalblättchen Artikel über gestohlene Fahrräder schreiben oder als Highlight etwas über die Jahreshauptversammlung der Kaninchenzüchter. – Mensch Wolf! Was hast Du da nur für einen Quatsch geschrieben … ?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Schade Peter. Du verstehst es wirklich nicht. Nun gut, ich werde es versuchen, das Meisterstück fristgerecht zu liefern…“
Baumgart fiel mir ins Wort:
„Nicht versuchen, Wolf. Schreiben! Ich müsste sonst nämlich den gezahlten Vorschuss zurückverlangen.“
Ich zuckte mit den Schultern und wandte mich zur Tür. Noch einmal drehte ich mich von dort um:
„Übrigens Peter, der Ganove in dem Krimi wird Baumgart heißen…“
Ein spöttisches Lächeln verzog meine Lippen und etwas missgestimmt verließ ich das Büro.
„Na, alles gut verlaufen?“
Die Vorzimmerdame lächelt mich an und versuchte rasch eine Modeillustrierte unter dem Schreibtisch zu verbergen, in der sie gerade geblättert hatte.
„Ach, - es geht so“, antwortete ich etwas gequält und setzte ein aufgesetztes Lächeln hinzu:
„Rufen sie mir bitte ein Taxi. Ich warte unten.“
Als ich das Gebäude verließ, wartete das Taxi bereits auf mich, eines jener zeitlosen englischen Fahrzeuge, die es schon vor unzähligen Jahren gab und auch zukünftig wohl immer geben wird.
„To the railway station, please. “
Meine Flugangst hatte mich bewogen, London per Fahrt durch den Kanaltunnel mit dem Zug zu verlassen. Dieses schien mir sicherer als in dem Metallteil zu reisen, das man Flugzeug nannte.
Am Bahnhof angekommen hatte ich gerade noch Zeit ein Sandwich zu essen. Ein Blick auf die Uhr zeigte mir, dass der Zug schon auf dem Gleis zur Abfahrt bereit stand und eilig hastete ich zum Bahnsteig und bestieg den Waggon. Im Abteil setzte ich mich neben eine ältere Dame, die Unmengen Zeitungen in einem Beutel bei sich trug. Etwas ermüdet schloss ich die Augen.
„Do you want a journal, Sir? “
Ich schreckte aus dem gerade beginnenden Halbschlaf auf und sah auf die „London-Post“, welche mir die Dame unter die Nase hielt. Freundlich lehnte ich ab und schloss wieder die Augen…
*
…Ich fühlte den milden Herbsttag und ich glaubte fast die Sonne noch zu spüren.
Wie ein Kind eine Puppe in den Arm nimmt, so hielt ich das Manuskript vor der Brust fest. Meine Wange berührte den Vorhang des Abteilfensters und vor meinen Augen tauchten greifbare Bilder auf…
Mein Kopf wiegte sich im Takt mit dem Rattern der Räder des Zuges und meine Gedanken wanderten zurück zu dem Tag, an dem alles begann…
Einige Wochen zuvor…
„Hast Du’s?“
Petra stand fragend vor mir, als ich die Haustür hinter mir schloss.
„Was habe ich?“
Ich stellte mich schelmisch unwissend.
„Was genau soll ich haben?“
„Nun sag schon! Spann‘ mich nicht auf die Folter.“
Ich grinste:
„Natürlich habe ich es. Baumgart ist begeistert. Sie wollen den Krimi sofort drucken und…“ ich setzte eine Kunstpause ein „ …sie wollen sogar eine Fortsetzung… Und einen Vorschuss habe ich auch schon bekommen.“
Etwas umständlich zog ich den Scheck aus der Brieftasche hervor und wedelte damit vor dem Gesicht meiner Frau herum. Sie strahlte:
„Ich wusste es. Ich habe immer daran geglaubt.“
Fordernd griff sie meine Hand.
„Das müssen wir feiern. Ich hab’ schon einen Tisch im Purzelbaum bestellt.“
Ich stutzte.
Der „Purzelbaum“ war ein Gartenlokal und es war bereits Herbst, doch Petra hatte des Öfteren obskure Einfälle.
„Du, es ist schon etwas kalt draußen.“
„Ach was! Ungewöhnliche Erfolge muss man ungewöhnlich feiern. Wir haben eben noch Zeit uns umzuziehen.“
Wer weiß, was geworden wäre, wenn Petra diesen Tisch nicht bestellt hätte, - doch weiß man wirklich je, was sein wird? Ist man hinterher nicht immer klüger als zuvor?
Als wir im „Purzelbaum“ ankamen, erwartete uns der Ober gelangweilt an der Tür stehend und rauchte mit spitzen Fingern eine Zigarette.
„Sie können sitzen wo Sie möchten“, begrüßte er uns unfreundlich.
„Bei diesem Wetter will eh niemand nach draußen.“
Ich vermeinte zu spüren, dass er uns für etwas spinnert hielt, denn im Lokal waren noch einige Tische frei, aber wir wollten nach draußen, wo wiruns an einen Tisch unter eine Kastanie setzten, deren Laub sich mit bunten Farben durchzogen hatte. Dann und wann segelte ein zeppelinförmiges Blatt taumelnd zu Boden. Wir saßen allein.
Allein?
Nein, einige Meter von uns entfernt, an dem äußersten der aufgestellten Tische, saß ein abgerissen wirkender Mann, der langsam und bedächtig an einer Brotscheibe kaute und bei den üblichen Restaurantbesuchern wohl den Eindruck des ‚Nicht-hier-her-gehörens‘ hinterlassen würde.
Petra sah meinen Blick:
„Hoffentlich lässt man ihn in Ruhe“, flüsterte sie leise zu mir, denn wir wussten, wie die Menschen auf Stadt - oder Landstreicher – wie er mir erschien - reagierten. Aber an diesem Abend schien niemand den Mann zur Kenntnis zu nehmen.
Ich winkte den Ober heran:
„Bringen Sie dem Herrn die gleichen Speisen wie für uns“, sagte ich und deutete auf den Mann, neben dem ein lumpenartiger, geflickter Beutel auf dem Boden lag.
„Dem Herrn?“
Anzüglich zog der Ober die Augenbrauen hoch:
„Welchem Herrn?“
„Wir zahlen“, warf Petra rasch ein.
Uns verächtlich musternd, drehte sich der Ober um und verschwand im Lokal.
Nach mehr als einer Weile kam er zurück und stellte den Teller mit weit gestrecktem Arm vor dem Zerlumpten ab. Nein, er ließ ihn fast fallen. Hart schallte das Aufsetzen zu uns herüber. Der Mann schaute überrascht auf und wir nickten ihm freundlich zu. Etwas zögerlich erwiderte er unseren Gruß.
Wir sahen jetzt, dass er nicht alleine war.
Neben ihm lag, zu seinen Füßen, ein struppiger Hund, der sehnsüchtig zu seinem Herrn – oder war es das Essen - aufschaute.
Der Himmel klarte etwas auf und einige letzte Sonnenstrahlen tanzten durch die noch spärlich belaubten Bäume. Wir redeten vertieft über dies und das, was Baumgart gesagt hatte, was man von mir wolle und anderes, als wir eine Stimme hörten.
„Vielen Dank“, klang es plötzlich. Der alte Mann stand neben dem Tisch.
„Es ist nicht leicht, freundliche Menschen zu finden“, sagte er, „denn mit uns will niemand etwas zu tun haben.“
Er setzte den Beutel auf dem Boden ab und gab dem Hund das letzte Stückchen Brot, an dem er bei unserem Eintreffen gekaut hatte.
„Ich hörte aus Ihrem Gespräch - verzeihen Sie, aber ich saß so nah, dass ich es hörte - das Sie schreiben. Bücher und so. Vielleicht habe ich eine Geschichte für Sie.“
Fragend sah ich ihn an.
„Eine Geschichte? Bitte setzen Sie sich.“
Der Alte zog einen Stuhl heran und Petra fragte:
„Was für eine Geschichte?“
Der Mann fuhr sich mit der Hand über die Wange und rieb eine tiefe Narbe, die er unter einem Bart zu verstecken suchte. Er setzte seinen eigenartig geformten Hut ab und fuhr sich durch sein Haar, welches er lang, bis in den Nacken trug.
„Welche Geschichte fragen Sie?“
Er hustete etwas und begann in seinem Beutel zu kramen.
„Meine Geschichte.“
Ohne aufzuschauen kramte er weiter in seinem Beutel herum.
„Was haben Sie denn zu erzählen?“ fragte ich und winkte den Ober erneut herbei.
„Herr Ober, einen guten Wein für unseren Gast.“
Während der Ober stapfend davonzog, kramte der Alte immer noch in dem Flickenbeutel herum und zog dann einen Knochen hervor, den er auf den Tisch legte. Beim genaueren Betrachten sah ich, dass es sich hierbei um eine, aus einem Knochen geschnitzte, Flöte handelte.
„Ich erzähle Ihnen meine Geschichte. Mein Name ist Falk von Ingo. Geboren wurde ich aber als Falk vom Fichtenberg.“
Als sei er sich der Wirkung der nun folgenden Worte bewusst, atmete er tief ein:
„Ich bin der Rattenfänger von Hameln.“
Petra lachte schallend auf und auch ich konnte ein Grinsen nicht verbergen. Der Mann lächelte ebenfalls, griff die Flöte und blies hinein. Wir hörten nichts, aber der Hund sprang auf, spitzte die Ohren und schaute gebannt zu seinem Herrn.
Der Alte, der sich Falk nannte, fuhr ihm durch das Fell. Erneut stieß er etwas Atem in die Flöte und der Hund rollte sich zu seinen Füßen ein.
Missmutig kam der Ober zurück und stellte den Wein schwappend vor den Mann hin. Einige Tropfen liefen am Glasrand hinab und bildeten eine kleine Pfütze auf dem Tischtuch. Naserümpfend ging er davon.
„So, so, der Rattenfänger von Hameln - ein guter Scherz, “ sagte ich und hob prostend das Glas.
„Ich weiß“, erwiderte er, „es hört sich merkwürdig an, aber ich bin es. Wollen Sie meine Geschichte hören?“
Wieder strich sich der Alte durch den Bart und rieb mit den Fingern erneut über die Narbe auf seiner Wange.
„Na, dann mal los, Sie steinalter Mann“, lachte Petra und rutschte auf dem Stuhl umher.
„Soll ich mitschreiben?“ fragte ich mehr scherzhaft als das es mir ernst war und zog zugleich einen Notizblock hervor und legte ihn auf den Tisch.
„Das wird sich sicherlich nicht umgehen lassen“, sagte der Alte, der sich Falk nannte, „ sofern Sie Interesse an meiner Geschichte haben. Aber das Erzählen der Geschichte wird etwas Zeit beanspruchen.“
Er hob sein Weinglas, tat einen tiefen Schluck, räusperte sich und wir hörten seine leise Stimme:
„… Mein Name ist, wie ich schon sagte, Falk von Ingo. Ich weiß, es ist ein merkwürdiger Name, aber dazu komme ich später. Um meine Geschichte besser zu verstehen, erzähle ich Ihnen jetzt erst einmal etwas von damals.
Geboren wurde ich als Falk vom Fichtenberg, genau am Weihnachtstag des Jahres 1254. Das waren zwei Jahre vor dem Tod des damaligen Kaisers Wilhelm von Holland, der 1256 beim Kriegszug gegen die Friesen in der Nähe von Alkmar umkam. Nach seinem Tod begann die schreckliche Zeit, die wir heute als Interregnum kennen.
Das damalige Deutsche Reich wurde zum Handelsgut. Verschiedenste Herrscher verschacherten ihre Macht und ihre Stimme an denjenigen, der am meisten dafür zahlte. Richard von Cornwall überbot sie schließlich alle und er wurde, am Himmelfahrtstag 1257, auf dem Thron Karls des Großen in Aachen zum König gekrönt.
Aber die Reichsfürsten waren weiter uneins und es gab auf einmal einen zweiten König, Alfons von Kastilien, den sie aus unerfindlichen Gründen auch den ‚Weisen‘ nannten. Er war zugleich auch noch König von Leon, und er hatte Deutschland nie betreten. Wohl gesehen hat er aber die Steuern und Abgaben, die er fleißig erhob und aus dem Volk presste.
Das Deutsche Reich hatte also zwei Könige, die sich mehr um sich selbst als um das Volk oder das Land kümmerten. Der Papst konnte sich für keinen der beiden Herrscher entscheiden und als dann Papst Alexander der Vierte starb und der Franzose Urban der Vierte ihm nachfolgte, da schwanden vor allem Richards Aussichten alleiniger König zu sein, da er Engländer war, gründlich. Zu diesem Umstand kam hinzu, dass es in England zu einem Aufstand der Barone kam und Richard deshalb nach England zurückkehrte. Dort nahm ihn der Graf von Leicester gefangen und sperrte ihn sechzehn Monate in den Tower ein.
Doch auch Alfons wurde nicht zum Kaiser gekrönt und somit hatte das Land keinen Kaiser - ja mehr noch - das Land hatte keinen Herrn, außer, dass es dem Namen nach zwei Deutsche Könige gab. Von all diesem hier erfuhr ich aber erst später, als ich älter wurde. Wie gesagt, ich erzähle ihnen dies nur, damit sie wissen, in welcher Zeit ich zur Welt kam.
Es war eine schreckliche Zeit.
Die Herren brauchten Geld und jeder tat nur das, was ihm beliebte und gerade richtig erschien. Jeder Ritter dünkte sich als großer Herr auf seinen Ländereien und wenn es nur ein winziges Dorf war. Man handelte, als gehöre einem die ganze Welt. Nichts galt mehr, gar nichts. Raub und Diebstahl waren an der Tagesordnung und jeder nahm sich das, was er gerade wollte. Aus ehemals edlen Rittern wurde ein übles Raubgesindel, das, von festen Plätzen und Burgen aus, das Land verheerte und plünderte. Das Leben jedes einzelnen galt nur so viel, wie es dem Herrn gerade dünkte.
Händel und Fehden beherrschten das Land. Grafen und Fürsten zogen mit bewaffneten Heerhaufen aufeinander los. Der Anlass war nichtig. Oft ging es nur um Kleinigkeiten. Söldner wurden angeworben, die für ein Stück Brot oder etwas Kupfergeld gedankenlos töteten. Wenn die Händel der Herren kurzzeitig zu Ende waren, zogen sie herrenlos plündernd und brandschatzend durch das Land. Ziellos, nur um den nächsten Herren zu suchen, der sie dann als willige Mordbrenner anwarb, um seine Macht zu erweitern oder weil er selbst etwas rauben wollte.
Das Recht war das Recht des Schwertes. Die Menschen, das einfache Volk, zahlte mit seinem Schweiß und seinem Blut. In diese Zeit wurde ich hineingeboren.
Unser Haus, oder besser gesagt unsere Hütte, lag in der Nähe von Marburg am Hang eines Berges, der dicht mit Fichten bewachsen war.
Mein Vater schlug Holz für die Burgen der Herren und meine Mutter verspann die Wolle von unseren schlecht genährten Schafen. Vater war in einer Fehde gezwungen worden, als Trossknecht mitzuziehen, wobei er ein Bein verloren hatte. Eine rostige Pfeilspitze hatte ihn in den Schenkel getroffen und der eingetretene Wundbrand zwang den Feldscher, es ihm abzunehmen. Glücklicherweise überlebte er den Eingriff, denn das war damals überaus selten. Ich sehe noch heute vor meinem inneren Auge den entsetzten Blick meiner Mutter, als er auf zwei Astgabeln gestützt in die Hütte hineinhumpelte. Das war im Herbst des Jahres 1258 und ich war nicht einmal vier Jahre alt. Damals kannte ich die Jahreszahl noch nicht.
Wir waren sechs Kinder daheim, die nur schwerlich ernährt werden konnten. Das Wenige, was Vater für das Holz und das, was Mutter für das Garn erhielt, welches sie spann, reichte nur für das Nötigste. Ja, vielleicht hätte es ganz gut gereicht, wären nicht immer wieder Räuberbanden durch das Land gezogen, die alles stahlen, was ihnen gefiel.
Sie selbst nannten sich Söldner oder Reisige und sie dienten Herren, deren Namen wir noch nie gehört hatten und kamen oftmals aus Gebieten, die uns gänzlich unbekannt waren.
Etwas Zubrot bekamen wir noch dadurch, dass meine älteren Brüder im Herbst Fichtenzapfen pflückten und an den Forstvogt verkauften, der damit neue Haine anlegen ließ. Holz war damals ein gefragter Baustoff und Fichten wuchsen schnell und gerade. Mein ältester Bruder, Jasper, verunglückte hierbei, als er aus einem Baumwipfel fiel und starb.
Vater begrub ihn in der Nähe des Hauses und Mutter legte immer wieder frisches Farnkraut auf den kleinen Erdhügel. Blumen wuchsen bei uns nicht, nur Buschwindröschen zeigten beim Nahen des Frühlings ihre Blüten und am Waldrand stand im Sommer giftiger Fingerhut.
So hätten wir leben können, mehr schlecht als recht, wenn es nicht wieder einmal zu einer Fehde gekommen wäre. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, denn es war das Fest der Geburt des Herrn im Jahre 1264 und ich wurde gerade zehn Jahre alt.
Vater hatte mir eine kleine Axt aus Holz gemacht, deren Schneide er im Feuer gehärtet hatte. Es war gutes, hartes Eichenholz aus einem der Scheite, die er auf dem Hohlweg nach Marburg gefunden hatte. Die Scheite sahen aus wie Dachschindeln, denn sie waren flach und glatt geschliffen. Irgendein Wagen musste sie wohl auf seiner rumpelnden Fahrt verloren haben.
Mit der kleinen Axt könne ich Kienspäne spalten, sagte mein Vater zu mir und ich befühlte mit dem Daumen die auf einem Stein geschliffene Klinge, die er zuvor im Feuer rußig gehärtet hatte. Mutter hatte mir einen Becher Holundersaft eingeschenkt, gesüßt mit einigen Bröckchen von einer Honigwabe, die sie in einen Stock wilder Bienen gefunden hatte. Bröckchen, die zu klein waren, um daraus Kerzen für den Abt zu machen, der unser Lehnsherr war, doch nach all dem, was ich über ihn gehört hatte, hätte er gewiss auch diese Wabenkrümel zu seinem Zehnten gezählt. Ein Becher Holundersaft für mich allein. Ich fühlte mich glücklich.
„Trink, mein Junge“, sagte Mutter zu mir: „ Es ist allein Dein Saft.“
Sehnsüchtig sahen meine Geschwister zu mir herüber, während sie frierend vor dem offenen Feuer saßen, welches schwach rauchend inmitten der Stube in einer steinernen Mulde brannte. Über dem Feuer hang an einer rußgeschwärzten Stange ein Kessel mit einer dünnen Suppe, in der einige Stücke eines Eichhorns schwammen, welches mein Vater in einer Falle gefangen hatte. Das Fell hing, auf einem Gestell aufgespannt, am Feuer und würde für das Kind, welches meine Mutter in wenigen Tagen erwartete, eine schöne und warme Kappe abgeben.
„Trink nur Falk“, forderte meine Mutter mich nochmals auf und legte eine Handvoll Schafwolle beiseite, die sie zu Garn spinnen wollte.
Auch mein Vater lächelte mich freundlich an und kam auf seinen Krücken zu mir herüber.
Von draußen hörte ich das Pfeifen des Windes und durch die kleinen Ritzen der Kate drangen vereinzelte Schneeflocken in die Stube herein. Das Feuer wärmte uns kaum und ich zog meinen zerschlissenen Kittel enger um mich.
Auf einmal hörten wir, trotz des tobenden Wintersturmes und des hohen Schnees der uns eingeschneit hatte, Lärm von draußen. Es war das Gejohle von Männern. Laut wieherten Pferde und irgendetwas Metallisches schlug aufeinander wobei zudem auch etwas auf den Boden vor unserer Tür gefallen schien.
„He, Ihr da!“
Laut dröhnte der Ruf von draußen und verband sich mit einigen kräftigen Schlägen auf unsere Tür.
„He! Aufmachen! Los, aufmachen!“
Vater humpelte zur Tür und öffnete sie einen Spalt. Weiße Flocken drangen herein, gedrückt von einem eisigen Wind. Obwohl die Tür nur zwei Handspannen breit geöffnet war, sah ich einen Mann, der sich ganz in eine durchnässte Decke gehüllt hatte. Er hielt ein Schwert in der Hand, mit dem er wohl gegen die Tür geschlagen hatte. Hinter ihm standen zwei weitere Männer. Die beiden hielten die Halfter ihrer Pferde in der Hand, während diese, hufscharrend, mit den Nüstern im Schnee nach verfrorenen Grashalmen suchten.
„Das wurde aber auch Zeit!“
Der Fremde drückte die Tür auf und schob meinen Vater beiseite. Dann ging er geradewegs zum Feuer.
„Weg da“, knurrte er und mit einem angedeuteten Fußtritt verjagte er meine Geschwister von der einzigen warmen Stelle in unserer kleinen Hütte. Ängstlich drängten sich meine Geschwister um unsere Mutter. Ich stand immer noch abseits und beobachtete das Geschehen.
„Ruhig Kinder, ruhig.“
Mutter flüsterte und legte die Hand auf die Schulter meiner kleineren Schwester Hildegard. Langsam und mit kleinen Schritten ging sie etwas zurück. Auch die beiden anderen Männer traten jetzt ein und schüttelten ihre feuchten und mit Schnee bedeckten Wolltücher in der Hütte aus. Rasch wandte ich mich zur Tür und zog sie zu. Die wenige Wärme des Raumes sollte nicht in den Eiswind des Winters entweichen.
„Wir wollen Wein, - los!“ sagte mit lauter Stimme der Mann, welcher zuerst eingetreten war. Gierig erblickte er meinen Becher mit dem Holundersaft, griff ihn und trank. Doch kaum hatte er den Becher angesetzt, da spie er den Saft auch schon aus und mit voller Wucht zerbrach der geworfene Becher auf dem hart gefegten Boden.
„Was ist das denn für ein Gesöff? He, ich will Wein! Und Fleisch!“
Er packte meinen Vater mit seiner eisenbehandschuhten Faust und schüttelte ihn.
„Wir haben keinen Wein, Herr. Nur etwas Milch von den Schafen und Holundersaft. Ihr könnt aber gern von der Suppe mitessen, die meine Frau kocht. Es ist das Fleisch von einem Eichhorn darin.“
Der Mann ließ meinen Vater los und mein Vater humpelte zum Feuer. Einer der Männer, der einen braunen Filzhut trug, folgte ihm und schaute in den darüber hängenden Kessel.
„Äh! Da drin sind ja nur Wasser und das Fleisch einer winzigen Baumratte. Los, ihr Gesindel, wo bleibt der Wein und das Brot?“
Der ältere der beiden Männer, jener, der bis jetzt neben mir an der Tür gestanden hatte, wandte sich zu meiner Mutter und legte den Arm um sie. Mit einem Ruck zog er sie an sich:
„Na mein Täubchen, soll es Dir mal ein richtiger Mann besorgen und nicht nur so ein Krüppel?“
Hämisch grinste er und deutete auf meinen Vater, den der Ersteingetretene mit der Faust festhielt. Mutter sagte nichts und drückte meine Geschwister noch enger an sich.
„Herr, wir… wir haben auch noch etwas Eichelbrot. Wenn,… wenn Ihr dies möchtet?“
Mein Vater stammelte. So hatte ich ihn noch nie reden gehört.
„Pfui!“ sagte der Große und trat mit dem Fuß so gegen den Kessel das er umfiel und das Feuer fast zum Erlöschen brachte.
„Brot und Wein sagte ich!“
Man konnte die Wut in den Augen des Mannes förmlich sehen.
„Herr, Herr wir haben doch keinen Wein“, versuchte mein Vater noch einmal zu erklären.
„Keinen Wein?“
Der Große schüttelte meinen Vater und schlug ihm dann die Eisenfaust direkt in das Gesicht. Etwas knackte und Blut schoss aus Nase und Ohren. Stöhnend brach mein Vater zusammen.
„Nein!“ schrie ich, rannte zum Tisch und griff meine kleine Holzaxt.
Ehe er noch reagieren konnte stieß ich sie dem Mann in den Magen, direkt unter dem eisernen Brustharnisch, den ein Stierkopf zierte. Er lacht nur laut auf und schlug mir ebenfalls mit der Eisenfaust auf den Kopf. Mir wurde schwarz vor den Augen und alles versank in tiefstem Dunkel.
Wie lange ich so gelegen hatte, kann ich nicht mehr sagen. Als ich zu mir kam, war es bitterkalt. Ich lag halb unter dem Tisch und etwas feucht-klebriges tropfte in mein Gesicht. Ich wischte mit der Hand darüber und kroch unter dem Tisch hervor. Das Feuer glomm noch schwach und ob der Dunkelheit sah ich zuerst nichts. Als sich meine Augen an das diffuse Licht gewöhnt hatten hinkte ich zum Feuer und blies hinein. Ich griff nach einem Kienspan und hörte zugleich, dass sich draußen galoppierende Pferde entfernten. Mein Kopf schmerzte höllisch und auch mein Blick war schleierhaft getrübt.
Der Schrei den ich ausstoßen wollte, erstarb auf meinen Lippen. Das klebrige Etwas in meinem Gesicht war Blut. Vater lag noch immer an der Stelle, wohin ihn die Eisenfaust geschleudert hatte und atmete nicht mehr. Hinter mir wimmerte es.
„Mutter! Mutter!“
Ich schrie. In sich verkrümmt kauerte sie an der Wand. Blut quoll aus ihrer Brust und sie hielt meine kleine Schwester an sich gedrückt, der eine klaffende Wunde über den Kopf ging.
„Mutter!“
Sie hörte mich nicht. Ich strich ihr über das Haar und mühsam hob sie den Kopf.
„Falk“, las ich von ihren Lippen, bevor sie sich noch einmal krümmte. Ihr Blick starb mit ihr.
Ich schluchzte und schrie:
„Vater!…Mutter !….Vater…Mutter!“
Im düsteren Schein des Kienspans sah ich es dann: Sie waren alle tot. Tot. Erschlagen. Vater, Mutter und alle meine Geschwister.
Man musste auch mich wohl für tot gehalten haben, - wie könnte ich sonst noch leben? Ich sank zusammen und weinte. Tränen rannen wie Bäche über mein Gesicht und der Schmerz der Trauer raste durch meinen Körper. Ein Würgen erfasste mich und ich erbrach mich über meinen Kittel. Wieder wurde mir schwarz vor den Augen und ich verlor das Bewusstsein.
Jemand schüttelte mich.
„He! Aufwachen!“
Mühsam öffnete ich die Augen. Oh, wie schmerzte mein Kopf. Ich sah nur eine Kutte, so wie Mönche sie trugen, die ich im Kloster beim Abt einmal gesehen hatte. Doch diese Kleidung war von einer anderen Farbe und sehr schmutzig.
Ich zuckte zusammen. Waren die Mörder zurückgekommen und hatten sich nur verkleidet? Ich schrie, doch eine Hand legte sich sanft über meinen Mund. Die grobe und schwielige Hand eines Mannes, der harte Arbeit gewohnt war.
„Ruhig, Junge. Ruhig.“
Vor mir kniete ein Mann mit auffallend rotem Haar.
„Ich tue dir nichts, Junge“, versuchte er mich zu beruhigen. Ich schluckte. „Ich bin Pater Anselm und das da ist Pater Gernot. Wir sahen Spuren im Schnee und da fanden wir diese Hütte. Ist…sind…war das Deine Familie?“
Ich schrie erneut los und Pater Anselm drückte mich fest an sich. „Psst, Junge, ruhig.“
Ich schluchzte und wieder wurde mir schwarz vor den Augen.
Petra stand auf.
„Du, ich glaube es ist spät geworden.“
Ich nickte. Der Alte spielte mit dem Weinglas zwischen seinen Finger und sah nicht auf. Seine Gedanken schienen in eine andere Zeit gereist zu sein.
„Wo schlafen Sie heute Nacht?“fragte ich ihn.
Er zuckte mit den Schultern.
„Es ist Herbst und da ist es schwer etwas zu finden. Ich bleibe noch ein wenig hier sitzen.
„Nichts da!“ bestimmte Petra und ich legte die Hand auf seine Schulter. „Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann kommen Sie mit zu uns.“
„Erstaunt sah er auf und auch der struppige Hund spitzte die Ohren.
„Zu Ihnen?… Ja, aber… geht das denn…?“
Petra fiel ihm ins Wort:
„Natürlich, sofern Sie in einem Gästebett schlafen können.“
Unmerklich schlug er die Augen nieder und nickte leicht zustimmend. Der Hund sprang auf und schwanzwedelnd tollte er um uns umher.
„Kommen Sie“, sagte ich und winkte nach dem Ober. Ich ersparte uns, ob seiner unwirschen Art, die Kosten eines Trinkgeldes und missmutig räumte er den Tisch ab.
Da der Abend für die Jahreszeit noch angenehm mild war, gingen wir gemeinsam zu Fuß zu unserem Haus am Rand der kleinen Stadt im Ruhrgebiet. Schweigend durchquerten wir ein Waldstück und wir beobachteten, wie der Alte in die Nacht durch die Bäume spähte, als suche er etwas, aber wir fragten nicht, wonach er schaue.
„Soll ich wirklich?“ fragte der Alte, als wir vor unserer Haustür standen und sich zögernd etwas abseits hielt. Statt einer Antwort schob ich ihn in den Hausflur und Petra öffnete bereits gastgebend die Wohnungstür.
„Stellen Sie Ihre Sachen ruhig hier ab, ich hole eine Decke für den Hund. Zeig dem Herrn doch das Bad ist, Wolf“, sagte Petra und verschwand, während ich Falk, ihrem „Befehl“ nachkommend, den Weg wies. Etwas zögernd folgte er mir.
„Bitte. Handtücher liegen bereit.“
„Und Fux?“
Er deutete auf den Hund.
„Natürlich, Fux auch.“
Als Petra mit einer Decke unter dem Arm zurückkam, hörten wir durch die geschlossene Tür das Plätschern des Wassers und eines Art quiekendes Gebell des struppigen Hundes.
„Glaubst Du das alles, was er uns erzählt hat?“ fragte ich meine Frau, aber sie zog nur die Schultern an.
„Ach weißt Du Wolf, kann es nicht jedem von uns so gehen? Wären wir nicht auch froh, wenn man jemanden zum Reden hätte, wenn man alleine ist?“
Sie hatte Recht.
„Ich hole schon mal das Gästebett“ sagte ich und stellte es anschließend im Wohnzimmer ab.
Es klopfte. Falk hatte seinen nassen Kopf aus der Badezimmertür gesteckt.
„Entschuldigen Sie bitte, aber hätten sie vielleicht etwas trockene Kleidung? Gestern war es sehr feucht und meine Kleider sind es immer noch ein wenig.“
Zwischen seinen Beinen hindurch drückte sich Fux und schüttelte sich das Wasser aus dem frisch gewaschenen Fell. Mit dem Instinkt des Überlebens lief er eilends in die Küche, in der wir Wasser und klein geschnittene Wurst für ihn bereitgestellt hatte. Petra brachte etwas Kleidung von mir, denn wir besaßen eine ähnliche Statur und nachdem Falk das Bad verlassen hatte, setzte er sich zu uns in einen Sessel. Er verneinte das Angebot noch etwas zu essen und schaute verlegen zu Boden.
Da saß er nun, der Mann, der von sich behauptete über siebenhundert Jahre alt zu sein und dessen Alter ich selbst nur schwer einschätzen konnte.
Er konnte sowohl fünfzig Jahre alt sein, aber auch schon älter. Sein Haar war graublond und es musste früher einmal sehr hell gewesen sein. Obwohl er sehr müde aussah, schauten seine blauen Augen hellwach umher und passten irgendwie nicht zu seinem Gesicht. Zwar machte er einen leicht abwesenden Eindruck, doch man hatte stets das Gefühl, er würde alles genau beobachten und dass ihm selbst Kleinigkeiten nicht entgingen.
Während ich ihn so verstohlen betrachtete, kam mir das Bild eines Greifvogels in den Sinn, der Kreise ziehend am Himmel flog und bedächtig die Felder überschaute und doch jedes Blattzittern bemerkte.
Ohne auf das „Nein“ des Alten zu achten hatte Petra Kaffee eingeschenkt. Obwohl er zuvor abgelehnt hatte, nippte er nun doch an dem heißen Getränk.
„Das Gästebett steht bereit“, sagte ich.
Falk winkte mit der Hand schwach ab und Fux nutzte die Gelegenheit, es sich dort gemütlich zu machen.
„Danke, aber ich benötigte fast keinen Schlaf. Wenn Sie möchten erzähle ich gerne weiter.“
„Aber gerne. Bitte fahren Sie fort.“
Zwischenzeitlich hatte ich ein Diktiergerät geholt und stellte es eingeschaltet auf den Tisch.
„Sie gestatten?“
„Natürlich“, antwortete Falk und lehnte sich in dem Sessel zurück.
So vergingen die Tage. Wir saßen beisammen, aßen, tranken und hörten Falk zu, der uns eine schier unglaubliche Geschichte erzählte:
„…Pater Anselm und Pater Gernot nahmen mich mit sich. Wie ich später erfuhr hatten sie in einem kleinen Weiler, dessen Hufen zum Kloster gehörte, am Nordhang des Burgwaldes, zu dem auch der Fichtenberg gehörte, die Weihnachtsmette gehalten. Eine Messe unter freiem Himmel, denn dort gab es keine Kirche, ja nicht einmal eine Kapelle. Es gab dort nur einen ausgewaschenen Hang, der eine kleine Grotte bildete. Dort war ein Kreuz hineingestellt worden, ein grobes Ding, aus Stämmen zusammengefügt. Ein fast quadratischer Felsen bildete den schmucklosen Altar. Die Bauern und Holzfäller, Köhler und Hirten der Umgegend trafen sich dort zur Ostern - und Weihnachtsmette, nachdem die Frauen zuvor den Boden mit Fichtenzweigen vom Schnee befreit hatten.
Etwas abseits staken stets einige Pechfackeln in der Erde und brachten ein schwaches Licht zu den Menschen, die dort in der Kälte ausharrten und den Mönchen zuhörten.
Ich erwachte erneut aus meiner Ohnmacht, die mich auch später in meinem Leben noch oftmals zu sich reißen sollte. Es schaukelte und ich spürte, dass ich in den Armen von Pater Anselm lag. Er ritt auf einem Esel, den Pater Gernot führte.
„Gernot, der Junge ist wach.“
Pater Gernot drehte sich um.
„Ich glaube da vorn stehen die Bäume dicht. Das schützt uns bei der Rast etwas vor dem Schnee.“
Pater Anselm nickte und stieg mit mir auf seinen Armen von dem Esel. Ich bemühte mich alleine zu laufen, doch meine Beine versagten ihren Dienst und in meinem schmerzenden Kopf dröhnte es. Pater Gernot zog ein Messer hervor und schnitt einige Fichtenzweige ab, die er unter einem Baum, der das Dach bildete, einem Bette gleich, auf den Boden legte. Pater Anselm legte mich darauf und brachte mir eine feuchte Decke, die zuvor auf dem Esel festgebunden war. Pater Gernot öffnete eine Tonflasche und flößte mir etwas eiskalte Milch ein. Ich hustete. Die beiden Männer setzten sich neben mich, während der Esel steif und starr neben uns stand und nur ein klägliches „IA“ hervorbrachte.
Pater Anselm zog unter seiner Kutte ein Stück Brot hervor und brach mir ein Stück davon ab.
„Iss, Junge.“
Es war helles Brot, so hell, wie ich es nie zuvor gesehen hatte und es schmeckte anders als das Eichelbrot, das ich bis dahin gewohnt war. War es das Manna, von dem Mutter immer erzählte, nachdem sie davon gehört hatte, als einmal ein Wanderprediger davon sprach, der eines Sommers an unserer Kate vorbeigezogen war? Bedächtig kaute ich um den angenehmen Geschmack möglichst lange im Mund zu halten.
„Wie heißt Du, Junge?“
Pater Gernot schaute mich freundlich an.
„Falk. Falk heiße ich. Was ist geschehen?“
Pater Anselm strich mir über das Haar.
„Es sind schwere Zeiten mein Junge und die Wege des Herrn sind unergründlich.“
Fragend sah ich ihn an.
„Du lebst, Junge. Das ist schon viel, aber…, “ er stockte“ …sie sind tot.“
Erschrocken blickte ich auf und obwohl ich es wusste, begriff ich damals noch gar nicht, was dies zu bedeuten hatte. Tod! Ich war allein und obwohl ich noch ein Kind war, ahnte ich, dass ich meine Familie niemals wiedersehen würde. Allein! Nur diesen beiden Männern verdankte ich, dass ich in der Eiskälte nicht erfroren war.
„Junge, du lebst“, wiederholte Pater Gernot. „Deine Familie ist tot. Wir haben sie unter dicken Fichtenstämmen gelegt, damit die Wölfe sie nicht holen. Im Lenz kommen wir zurück und sie bekommen ein christliches Grab. Ihr wart…Du bist doch Christ?“
Fragend zog der Pater die Augenbraue hoch.
„Ja, sicher. Wir beten immer zum Heiland.“
Ich nickte heftig und musste an den Köhler denken, von dem Vater einmal erzählt hatte, er würde einem ‚Wotan‘ opfern.
„Wir haben…hatten auch ein Kreuz.“ Ich schluchzte.
„Mein Vater hatte es selber geschnitzt“, fügte ich dann schniefend, aber stolz hinzu.
Pater Anselm nickte: „Dann ist es ja gut.“
Beide schwiegen und bissen ebenfalls in ihr Brotstück.
„Lasst uns hier übernachten, Gernot“, sagte Pater Anselm, „heute schaffen wir es doch nicht mehr bis zum Kloster.“
Dann wandte er sich zu mir:
„Du kommst mit uns, Junge.“
Verständnislos nickte ich und wieder riss mich die dunkle Schwärze zu sich hinab.
Als ich erneut zu mir kam, musste ich niesen. Mit wollener Kleidung versehen und in einer Decke eingehüllt, lag ich im Heu und schaute auf die Beine von einigen Eseln. Draußen schien es hell zu sein, denn Lichtstrahlen krochen durch die ungefügten Bretter der Wände hinein und beendeten ihren Weg an einigen aufgeschichteten Strohballen, die ordentlich an der Wand gestapelt waren. Also bin ich in einem Stall, dachte ich mir, - aber wo? Wieder fiel ich in diese tiefe Ohnmacht zurück und als ich aus dieser erneut erwachte, stand Pater Anselm vor mir.
„Na Falk, ausgeschlafen?“
Hinter Anselm stand ein dicker, in den Schultern gebeugter weiterer Pater, der eine Schüssel in der Hand hielt, aus der es verführerisch dampfte.
„Komm Junge! Du brauchst Kraft, denn Du hast lange geschlafen. Fast eine ganze Woche lang.“
Der dicke Pater reichte mir die Schüssel, in der ein hölzerner Löffel steckte, denn die Suppe war mehr als sämig. Umständlich und schwach richtete ich mich auf. Oh, - ich glaube, ich habe niemals in meinem Leben zuvor etwas Besseres gegessen als diese breiige Rübensuppe. Eine Suppe, die nicht nur aus Wasser bestand, - nein, dick und wohlschmeckend war sie, angefüllt mit reichlich Fleisch darin. Sie war höllisch heiß und ich pustete hinein.
War dies hier das Paradies, waren die Pater in vielleicht die Engel?
Doch wo waren dann nur ihre Flügel? Bestand das Paradies aus einem Bett im Heu und dieser köstlichen Suppe?
Schweigend beobachteten mich die Pater und als ich den letzten Rest aus der Schüssel gekratzt hatte, sagte Pater Anselm zu mir:
„Komm Falk, der Prior möchte Dich sehen.“
Er nahm mir die leere Schüssel ab und half mir beim Aufstehen. Gestützt auf seine kräftigen Arme verließen wir den Eselstall und überquerten den verschneiten Hof, auf dem kreuz und quer Fußspuren getrampelt waren. Etwas unsicher setzte ich meine Beine voreinander und Pater Anselm zeigte auf die Gebäude:
„Links befinden sich die Werkstatt und die Scheune. Rechts unsere Kapelle zu Ehren der Heiligen Jungfrau und dort, geradeaus, wohnen wir.“
Die Gebäude waren ordentlich mit Stroh gedeckt, das auf Fachwerkstreben lag und die Gefache sauber mit Lehm verschmiert.
Der dicke, schweigsame Mönch verschwand in der kleinen Kapelle und wir erreichten das Haupthaus.
Der Raum, den wir betraten, war gefüllt mit einigen groben Strohlagern, die nebeneinander auf dem Boden lagen. Gelbes Licht fiel durch die mit Haut bespannten Fenster hinein und tauchte alles in einen eigenartigen gelben Farbton. Zwischen den Strohlagern stand inmitten des Raumes ein langer Tisch, an dem auf beiden Seiten Bänke standen. Am Kopfende befand sich ein einzelner Schemel, auf dem ein hagerer Mann mit einem dünnen Bart saß. Hinter ihm waren zwei Türen zu sehen. Später erfuhr ich, dass eine der Türen zur Kammer des Priors führte, der als einziger das Recht auf einen eigenen Raum besaß. Die andere Tür führte in die Küche. Wir drei waren allein in dem Raum.
„Ehrwürdiger Prior, das ist Falk.“
Pater Anselm schob mich etwas vor. Es ist merkwürdig, aber bis heute weiß ich nicht, wie der Prior hieß. Er wurde nur „ehrwürdiger Prior“ genannt und auch wenn ich danach fragte, erhielt ich nie eine Antwort. Das weitere Eigentümliche an dem Prior war, dass er sich manchmal tagelang in seiner Kammer einriegelte und wir ihn nicht zu sehen bekamen. Dann hörte man ein Stöhnen aus dem Raum und wenn er dann die Kammer wieder verließ, musste einer der Pater seine Kutte waschen, deren Rückenteil mit Blut verschmiert war.
„Komm her, Junge.“
Er zog mich an sich heran. Ein eigenartig fauler Geruch kam aus seinem Mund. Er küsste mich auf die Wange und strich über meinen Rücken bis hinab zu den Schenkeln. Dann verharrte er kurz zwischen meinen Beinen und strich mir dann durch das Gesicht.
„Ich bin der Hüter dieser frommen Gemeinschaft. Setze Dich.“
Der Prior zog mich auf seinen Schoß, so, wie es Mutter manchmal getan hatte.
„Gott der Herr hat in seiner Gnade Dein Leben gerettet. Du bist Christ. Das sagte mir Pater Gernot jedenfalls und christliche Pflicht ist es einander zu helfen. Das gilt für uns ebenso, wie auch für Dich. Du bekommst Obdach und Speise von uns. Ora et labora ist das Wort unserer Gemeinschaft. Bete und arbeite, genauso, wie es der heilige Benedikt gelehrt hat. Wenn Du bei uns bleiben möchtest, musst Du Dich dieser Regel unterwerfen. Jeder tut es. Wir werden Dir Arbeit geben, Dein Essen und ein Lager für die Nacht.“
Wieder strich er mir mit der Hand über den Körper und ich spürte plötzlich etwas Hartes aus ihm herauswachsen, das unter meine Pobacken drückte. Er aber fuhr unbeachtet dieses Hornes – so dachte ich es mir damals – mit leiser Stimme fort:
„Aber wir halten Dich auch nicht. Wenn Du willst, dann kannst Du auch gehen. Du bekommst dann Speise für drei Tage als Wegzehrung und unser aller Segen.“
Welch‘ eine Frage für ein zehnjähriges Kind! Ich hatte gerade meine Familie verloren und war schwach und unter fremden Menschen an einem Ort, den ich nicht kannte. Ratlos und scheu schaute ich ihn an.
„Willst Du bei uns bleiben?“
Schüchtern nickte ich und ein kaum merkliches Lächeln umspielte das Gesicht des Priors.
„Was kannst Du?“ fragte er mich dann.
„Ich…ich…ich kann Kienspäne machen. Aber auch Beeren und Pilze sammeln und Reisig. Auch Fichtenzapfen habe ich schon gepflückt, --- äh, aber erst einmal. Und Vaters Messer durfte ich auf einem Stein schärfen.“
„So, so. Nun gut, wir werden sehen.“
Der Klang eines hellen Glöckchen bimmelte von draußen herein und die Mönche traten in den Raum.
„Die Brüder waren bei der Andacht. Wenn Du bei uns bleiben willst, dann gehst Du stets mit ihnen.“
Erneut nickte ich schüchtern. Schweigend setzten sich die Mönche auf die Bänke an den Tisch und einer von ihnen nahm aus einer Ledertasche etwas heraus, was ich noch nie gesehen hatte:
Ein Buch.
Während die anderen schwiegen, las er ihnen laut aus dem Buch vor. Es war eine Geschichte, in der Jesus Wasser zu Wein verwandelte. Ich saß mit offenem Mund da und dachte daran, wie Mutter mir einmal erzählt hatte, dass gelehrte Männer Zeichen malen könnten und diese dann in Worte umsetzten. Doch bis zu diesem Tage hatte ich mir das nicht vorstellen können.
Als der Mönch seine Vorlesung beendet hatte, begannen die Männer über die Geschichte zu reden und jeder lobte die Wunder des Herrn. Der Prior beobachtete alle und nach einer Weile klatschte er mit seinen dürren Händen.
„Brüder! Dieser Junge hier ist Falk, den Gott der Herr zu uns, in seiner unermesslichen Güte, durch die Brüder Gernot und Anselm bringen ließ. Er wird bei uns bleiben und für sein Brot und sein Lager arbeiten. Wer benötigt Hilfe?“
Die Mönche redeten leise miteinander und ich erfuhr hieraus, dass jeder der Mönche ein anderes Arbeitsfeld zu betreuen hatte. Es gab den Gärtner, den Schneider, den Koch, den Schmied, den Lektor, den Hirten, den Wollspinner, den Pferde- und Eselversorger, den Feldscher und andere. Wer gerade nichts zu tun hatte, half dann stets den anderen.
„Ehrwürdiger Prior. Wäre es recht, wenn ich den Jungen nehme?“ Ein kräftiger Mann mit gebeugtem Rücken stand auf und krümmte sich dabei etwas, was wohl eine Verneigung andeuten sollte.
„Ich weiß, Bruder Josef, euch plagt sicher wieder die abscheuliche Gicht.“
Der Prior deutete dem Pater sich wieder zu setzen.
„Nun gut. So soll es sein. Er schläft in der Schmiede.“
Pater Josef nickte und nach dem einfachen Mahl aus Hirsebrei und Brot, standen die Mönche auf und gingen zu ihren Strohbetten.
Pater Josef nahm mich bei der Hand und führte mich über den Hof zur Schmiede. Leichter Schneefall bedeckte unsere Spuren sofort wieder mit weißglitzernden Kristallen.
Pater Josef war der Schmied der Gemeinschaft, doch da er dauernd unter Gichtanfällen litt, fiel es ihm schwer die Holzkohlen zu tragen oder den Blasebalg zu bedienen, der die Glut in der Esse entfachte. Diese Arbeit kam nun mir zu. Am Anfang erschrak ich noch, allein in diesem dunklen, rußigen Raum zu sein, doch später erkannte ich, dass ich in der Nacht ohne Aufsicht war. Ein kleines Stückchen Freiheit in dem so genau geregelten Tagesablauf der Mönche.
Pater Josef wies auf einen großen Haufen Lumpen und Werg, der in einer Ecke lag.
„Dort kannst Du schlafen, Falk. Gib Acht, dass das Feuer nicht verlöscht. Es muss immer etwas Glut darin sein. Am besten legst Du vor Deiner Nachtruhe einen dicken Balken hinein. Der hält die Glut dann schon eine geraume Zeit, aber nachschauen musst Du regelmäßig. Hast Du verstanden?“
Etwas verschüchtert nickte ich und Pater Josef ließ mich allein. Dies war also mein neues Heim. Rußig roch es in dem Raum und es lagen viele Eisenteile herum, - so viel Eisen hatte ich noch nie gesehen, denn Eisen war rar und teuer.
Ich stolperte über einige, zu einem Haufen gelegter Hufeisen und sah Werkzeuge, aber auch Gartengeräte die nur halb fertig bearbeitet waren. Zudem fand ich zwei Schwerter. Diese weckten besonders mein Interesse, obwohl sie rostig und voller Scharten waren. Ich wiegte sie in der Hand und beschloss selbst einmal ein Schwert zu besitzen. Damals wusste ich noch nicht, dass ein gutes Schwert den Gegenwert von acht Kühen besaß. Selbst für schlechtere Schwerter bekam man einige Kälber und diese rostigen Dinger hätten dem Kloster zusammen vielleicht noch drei Kühe eingebracht.
Ach, ich törichter Junge.
Was wusste ich damals überhaupt, ja, geschweige denn, was ein Schwert wirklich bedeutete… ?
Ein fahler Mond schien durch das aus Weidenruten verschlossene Fenster hinein und tauchte den Raum in Verbindung mit der Glut in der Esse in ein geheimnisvolles Licht. Wenn ich durch das Strohdach schaute, konnte ich durch einige Ritzen den Himmel sehen und auch das Leuchten der Sterne, die über der Erdscheibe schwebten.
Die Werkstatt war nicht so sorgfältig wie die anderen Gebäude gebaut und es zog durch alle Ritzen. Aber das Feuer in der Esse hielt mich warm, wärmer als man es sich vorstellen kann. Soweit ich mich erinnere, habe ich dort nie gefroren und im Sommer kühlte stets ein Windhauch den Raum. Ich legte mich auf den Lumpenhaufen, ja, ich kroch fast - Geborgenheit suchend - in ihn hinein, und fiel in einen tiefen Schlaf, der jedoch abrupt endete. Eine Hand schüttelte mich an der Schulter. Es war Pater Josef.
„Komm Falk, es ist die dritte Stunde des Tages. Wir gehen zur Andacht.“
Verschlafen reckte ich mich und trottete hinter ihm her.
In der kleinen Kapelle waren die anderen der Gemeinschaft bereits versammelt und begannen nach meinem Eintreffen mit ihren rauen Stimmen einen Choral anzustimmen. In dem ungeheizten Raum war es kalt und die Mönche trugen auch hier, wie in all den anderen Jahreszeiten auch, außer ihrer Kutte, nur mit Leder festgeschnürte Holzbretter unter ihren Füßen. Im Sommer ging jeder barfuß.
Obwohl der Gesang der Mönche wahrlich nicht schön klang, so ging doch etwas Feierliches von der Andacht aus. Ich stand neben Pater Josef, der besonders laut sang und ich beobachtete seine Lippen, aus denen, eingebunden in seine kräftige Stimme, kalter Atemhauch stieg.
Leise versuchte ich in meinem Unvermögen in den Choral einzustimmen. Pater Josef schenkte mir darauf ein feines Lächeln.
Nach der Andacht gingen die Mönche wieder in ihren Schlafsaal und auch ich begab mich erneut zu meinen Haufen aus Lumpen. So vergingen die Tage. Am Anfang war es schwer für mich, die Nachtruhe zu unterbrechen, um an der Morgenandacht teilzunehmen, aber mit der Zeit gewöhnte ich mich daran. Auch gewöhnte ich mich an mein Tagewerk, welches zur sechsten Stunde begann. Hierzu musste Pater Josef mich aber so manches Mal wachrütteln.
Pater Josef war ein besonnener Mann, den nichts aus der Ruhe bringen konnte. Er war stets freundlich zu mir und hatte mit allem Nachsicht, zumal ich mich anfänglich noch nicht besonders geschickt anstellte. Nach einiger Zeit jedoch beherrschte ich alle Handgriffe, die er von mir erwartete und die Tage strichen dahin.
Jeden Tag, nach dem Abendläuten, legten sich die Mönche zur Ruhe und ich war allein. So hatte ich Zeit bis zur dritten Morgenstunde all das zu tun, was ich wollte. Manchmal war die Arbeit sehr anstrengend, denn wenn es in der Schmiede nichts zu tun gab, halfen wir den anderen. Besonders in der Küche wurde ich sehr oft zum Sieben des Mehls oder zum Verlesen der Linsen und Erbsen eingesetzt. Auch das Wasser aus der Zisterne schöpfte ich oder trieb die Ziegen in den Wald, wo ich im Sommer und Herbst auch Kräuter und Blätter sammelte, die mir gezeigt worden waren. Hauptsächliches Getränk im Sommer war eine Art Tee, der aus Brombeerblättern gemacht wurde. Die Milch der einzigen Kuh, aber auch die Milch der Ziegen, wurde zu Käse verarbeitet. Man ließ die Milch dick werden und schüttete sie durch ein grobes Nesseltuch, welches in der Küche unter der Decke an einem Haken aufgehängt wurde. Die herauslaufende Molke wurde in einer großen Schüssel aufgefangen und wir mischten sie unter unseren täglichen Brei.
Oft mussten wir aber auf die Hunde aufpassen, die auch einen Teil der Gemeinschaft bildeten. Sie schlichen sich manchmal in die Küche, um sich an der Molke gut zu tun. Der Käse schmeckte säuerlich, aber zusammen mit einem Stück Brot und dem warmen Brombeertee war er sehr nahrhaft. Überhaupt hatte ich - wenn ich es heute so bedenke - während der Zeit bei den Mönchen niemals Hunger. Nun, natürlich gab es auch Tage, an denen die Speisen nicht so reichhaltig waren, aber auch diese gingen vorüber.
An den Abenden, an den ich nicht sofort einschlafen konnte, schlich ich mich aus der Schmiede und erkundete die Umgebung. Ich blieb jedoch nie so lange aus, dass mein Fehlen bemerkt wurde.
Als der Schnee im Frühjahr endlich geschmolzen war und die Sonne den Frost aus dem Boden gesaugt hatte, zogen einige Mönche mit Pater Anselm los, um meiner toten Familie ein christliches Begräbnis zu bereiten. Mein Schmerz und meine Trauer waren noch immer so groß, so dass der Prior meinte, ich solle lieber nicht mitgehen. Stattdessen betete ich zu jeder möglichen Gelegenheit in der Kapelle um das Seelenheil der so Dahingeschlachteten.
Als die Mönche zurückkamen und die Hacken und Schaufeln in der Schmiede abstellten, berichteten sie mir, dass sie zwei tiefe Gräber ausgehoben und Fichtenzweige über die Körper gelegt hatten, bevor sie die Ruhestätte mit Erde bedeckten. Jedes der Gräber schmückte ein Kreuz, welches Pater Sixtus gefertigt hatte.
Traurig weinte ich vor mich hin und beschloss die Gräber alsbald zu besuchen.
Als ich mit verheultem Gesicht in die Werkstatt kam, arbeitete Pater Josef an einem Rechen und wohl um mich aufzumuntern erzählte er mir allerlei von Gott und dem Leben und den weiten Reisen, die er früher gemacht hatte. Oh ja, - Pater Josef war in seinem Leben sehr weit herumgekommen. In jungen Jahren war er Pferdeknecht gewesen und hatte als solcher auch das Beschlagen von Pferdehufen gelernt. Da er auch als Schmied sehr geschickt war, reparierte er das Werkzeug der Bauern und manchmal stellte er auch Neues her. Ja, er hatte sogar Messer und Schwerter geschmiedet. Zwar sagte er, dass diese nicht von besonderer Güte gewesen seien, doch seinem damaligen Herrn, der ein kleiner Ritter war, mit einem festen Hof, den eine Holzpalisade umschloss, genügten sie stets. Als dieser feste Hof bei einer der unzähligen Fehden niederbrannte, war Pater Josef davongelaufen und in das Kloster eingetreten. Aus dieser Zeit stammten auch die beiden rostigen Schwerter, die achtlos in der Ecke standen. Er erzählte mir, dass er in einer großen Stadt gewesen war, die weit westlich lag, an einem Fluss, den er Rhenus nannte und welche Köln hieße. Von ihr hatte ich noch nie gehört. Dort habe man vor einigen Jahren begonnen eine Kirche zu bauen, die riesig groß werden solle. Aber ob sie schon fertig sei, das wusste er nicht.
Auch in Frankfurt war er schon gewesen. Ich staunte, denn diese großen Städte waren viele Tagesreisen weit entfernt und ich fand es wenig glaubwürdig, als er sagte, in ihnen würden über tausend Menschen leben. Wie könnte das sein? Dann müsste es dort ja auch riesige Felder geben. Pater Josef erklärte mir, dass es dort Menschen gäbe, die nur vom Handel lebten und überhaupt keine Felder bestellten. Das schien mir besonders merkwürdig, zumal sie auch kein Holz fällen müssten.
So vergingen die Tage mit Gebeten und mit Arbeit. Etwa zweimal in der Woche rief der Prior nach mir und ich musste mich dann auf seinen Schoß setzen, während er mir aus der Bibel vorlas. Ab und zu strich er mit seiner dürren Hand über mein Gesicht und jedes Mal spürte ich unter mir etwas Hartes aus ihm herauswachsen, das gegen meine Schenkel drückte. Wenn das geschah, stand er immer rasch auf und verschwand für kurze Zeit in seiner Kammer.
Die Zeit seiner Abwesenheit nutzte ich stets, um in der Bibel zu blättern. Es war ein kostbares Exemplar, mit der Hand auf Pergament geschrieben und auf einigen Seiten gab es auch Bilder, die mir besonders gefielen. Sie zeigten Engel, Jesus und auch das Feuer der Hölle. Ich bedauerte, dass ich nicht Lesen konnte, was dort alles geschrieben stand. Später erfuhr ich, dass die Worte in dem Buch in einer Sprache geschrieben waren, die man Latein nannte und der Prior es mir beim Vorlesen übersetzte, so dass ich es verstehen konnte.
So kam es, dass ich nach einiger Zeit die Bibel immer besser kennenlernte, obwohl ich so manches nicht verstehen konnte.
Eines Tages, der Prior kam gerade wieder mit verschobener Kutte aus seiner Kammer zurück, sah er, wie ich in dem Buch blätterte.
„Gefällt Dir das Buch, Falk?“
„Ja, ehrwürdiger Vater. Sehr sogar. Ist das Lesen schwer zu erlernen?“
Der Prior lächelte und strich mir sanft über das Haar.
„Etwas, aber es geht schon, wenn man tüchtig übt. Aber Lesen allein genügt nicht. Man muss auch Schreiben können.“
Ich kaute auf den Lippen und sah ihn skeptisch an:
„Ihr… Ihr meint,…ich,…ich könnte das auch lernen?“
„Warum nicht, Falk. Wenn Du möchtest, bringen wir es Dir bei. Jeder Bruder innerhalb unserer Gemeinschaft kann es.“
Ich sah dass er mächtig stolz darauf war, keine Ungebildeten – wie er es nannte - zu seiner Gemeinschaft zu zählen.
„Wenn Du später einmal auch als Bruder zu unserer Gemeinschaft gehörst, dann ist es gut, wenn auch Du es kannst.“
Wie selbstverständlich ging er davon aus, dass auch ich dereinst Mönch werden würde.
„Ab morgen bekommst Du täglich eine Stunde Unterricht. Pater Gernot wird Dich lehren. Halte Dich nach der Frühandacht bereit.“
So kam es, dass ich morgens, gleich nach der Messe, täglich von Pater Gernot unterrichtet wurde. Nur am Sonntag hatte ich keinen Unterricht. Mein Lehrer hatte ein Stück Wachs in einen kleinen Holzrahmen gestrichen und Pater Josef schmiedete mir einen dünnen Griffel, mit dem ich in dem Wachs ritzen konnte. So wurde die Nachtruhe gekürzt, aber mein Wissen erweiterte sich. Trotzdem konnte ich es nicht lassen, auch weiterhin manchmal nachts in der Gegend herumzustreifen. Wie stolz wären Vater und Mutter gewesen. Ich, ihr Sohn lernte Lesen und Schreiben… Dieser Gedanke machte mich dann aber stets traurig, denn – obwohl es mir an nichts mangelte - vermisste ich sie sehr.
Anfangs fiel es mir schwer, die Buchstaben ungelenk in die Wachstafel zu ritzen, doch Pater Gernot war geduldig und je mehr ich übte, umso leichter fiel es mir mit der Zeit. Während ich das Schreiben übte, begann Pater Gernot auch damit, mir Latein beizubringen, jene geheimnisvolle Sprache, in der die Bibel geschrieben worden war.
Als der Sommer kam, hatte der Unterricht schon Fortschritte bei mir gemacht. Ich konnte meinen Namen schreiben und bereits einige lateinische Sätze in der Bibel lesen. Ja, manchmal verstand ich sogar den Sinn der Worte. Es war am Tag des Festes der beiden Heiligen, Petrus und Paulus, des folgenden Jahres, als Pater Gernot mir eine Überraschung bereitete. Er hatte ein handtellergroßes Stück Pergament mitgebracht, sowie Tinte und eine Gänsefeder.
„Falk, heute darfst Du etwas mit Tinte schreiben.“
Die Tinte gewannen die Mönche aus dem Sekret des Gallapfels, der an den Blättern der Eichenbäume wuchs und dem sie dann Ruß beimischten. Er reichte mir das Blatt und zeigte mir, wie ich den Gänsekiel richtig zu halten habe.
„Was soll ich schreiben?“ fragte ich unsicher.
„Was immer Du willst, Falk. Das, was Du bereits kannst.“
Ich tauchte den Federkiel vorsichtig in die Tinte ein, überlegte kurz und schrieb:
„Falk vom Fichtenberg, Sohn von Dost und Katherina.“
„Wunderbar!“
Pater Gernot jauchzte vor Freude, denn, obwohl die Schrift ungelenk war, war es doch ohne Fehler. Als das Pergament trocken war, rollte Pater Gernot es eng zusammen und steckte es in ein schmales Lederfutteral, welches er mir dann reichte.
„Es gehört Dir, Falk.“
Ich lächelte und befestigte später einen Lederstreifen daran und trug es dann um den Hals.
Weiter vergingen die Tage und auch die Zeit. Warme Sommer wurden von den Stürmen des Herbstes abgelöst, bevor kalte, schneereiche Winter über das Land zogen, deren frostige Kraft wieder von der milden Sonne des Frühlings vertrieben wurde.
Der Prior ließ mich, da ich nun allmählich älter wurde, nicht mehr so oft auf seinen Knien sitzen. Zumeist wies er mir den Platz auf der Bank zu. Doch an Tagen, an denen er missmutig war, musste ich neben ihm knien, während er aus der Bibel vorlas.
Pater Josef brachte mir bei, wie man schmiedete und auf meinen Wunsch hin, reparierte er die schartigen Schwerter, allerdings mit der Auflage für mich, sie blitzend blank zu polieren, was ich dann auch freudig tat.
Auch die anderen Mönche zeigten mir von ihrer Kunst. Ich lernte Fleisch zu zerteilen, eine Suppe zu kochen und auch einen Braten. Weiter lernte ich Brot zu backen und Käse herzustellen, zu nähen und mit Pilzen und Kräutern kannte ich mich ganz gut aus. Kurz gesagt ich lernte allerlei Sachen und viele nützliche Dinge.
Nun war ich bereits im siebten Jahr im Kloster. Mein alter Wollkittel war mir bereits zu klein geworden und ich lief, so wie die anderen, in einer grobe Kutte herum. Ja, vom Äußeren her gesehen, hätte man mich für einen Mönch halten können, nur die Tonsur trug ich nicht. Meine Kenntnisse in Latein, im Lesen und im Schreiben hatten gute Fortschritte gemacht und ich durfte sogar einmal aus der Bibel vorlesen, als alle Mönche abends beisammen waren.
Durch Pater Josefs Anleitung hatte ich auch gelernt, mit dem Werkzeug in der Schmiede umzugehen. Ich fertigte bereits Gerätschaften aller Art an und erlernte auch die Kunst, Metalle miteinander zu verbinden. ‚Feuerschweißen‘ nannte Pater Josef dies. Die zu verbindenden Metallteile wurden weißglühend erhitzt und dann mittels schneller Hammerschläge ineinander geschlagen, während Pater Josef immer wieder eine Hand voll quarzhaltigen Sandes auf die Verbindungsstelle warf. Dadurch wurde die Verbindung fest und haltbar.
Der Prior bestellte mich nicht mehr so oft zu sich, außer, um mir aus der Bibel vorzulesen. Den sonstigen Unterricht überließ er fast völlig Pater Gernot. Nur ab und zu erkundigte er sich bei ihm nach meinen Fortschritten.
Meine nächtlichen Streifzüge gingen nun auch in die weitere Umgebung, die ich so nach und nach besser kennen lernte.
Ich entdeckte, dass die Nacht ein eigenes Leben besaß. Mit Vorliebe beobachtete ich die Eulen und Käuzchen auf ihrem nächtlichen Jagdflug oder erfreute mich an dem lautlosen Gleiten der Fledermäuse, die in einer kleinen Felsenhöhle, etwas vom Kloster entfernt, hausten.
Oft hing ich so, in einer Astgabel einer mächtigen Buche sitzend, meinen Gedanken nach und wenn die Abendstunden des Sommers noch hell waren, kletterte ich bis in die Spitze des Baumes und betrachtete die waldreiche Umgebung. Einige Male sah ich in weiter Ferne auch etwas Rauch; vielleicht von einem Reisenden, vielleicht auch von einem Köhler, der dort seinen Meiler abbrannte. Zu unserem Kloster kamen sie nie. Es war merkwürdig, aber seit ich in dem Kloster war, hatte ich außer den Mönchen niemanden zu Gesicht bekommen. Kein Reisender hatte den Weg zu uns gefunden, bis an jenem Tag:
Die Abendglocke läutete gerade, da klopfte es fest und energisch an das Hoftor. Pater Anselm öffnete und ein prächtig gekleideter Mann in voller Rüstung ritt auf einem Schimmel herein. An seinen Sattel hatte er zwei Packpferde gebunden, die mit irgendwelchen Ballen beladen waren.