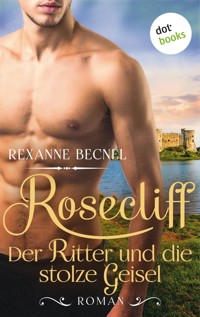4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Paradies für eine englische Lady … und für die Liebe? Duftende tropische Gärten, Lorbeerwälder und der salzige Duft des Meeres … Madeira scheint wie ein wahr gewordener Traum für die junge Eliza und ihren Cousin Aubrey, die das feuchtkalte englische Wetter gewohnt sind. Hier in ihrem herrschaftlichen Anwesen soll Eliza sich von den Verletzungen eines Reitunfalls auskurieren. Doch kaum sind sie angekommen, werden sie von Piraten unter der Führung des berühmt-berüchtigten Cyprian Dare angegriffen. Er entführt die beiden, um Rache an Aubreys Vater zu nehmen, der seine Familie ins Unglück stürzte. Eliza jedoch lässt sich nicht einschüchtern und verteidigt ihren Cousin bis aufs Blut. Ihr Kampfgeist scheint Eindruck auf Cyprian zu machen – aber kann sie auch sein Herz erweichen? »Ein romantischer Liebesroman, der das Zeug zum Bestseller hat.« ROMANTIC TIMES
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Um die Verletzungen eines Reitunfalls auszukurieren, reisen die junge Lady Eliza und ihr Cousin Aubrey nach Madeira. Doch kaum haben sie ihr herrschaftliches Anwesen bezogen, schlagen Piratenkapitän Cyprian Dare und seine Männer zu: Mit der Entführung Aubreys will der berühmt-berüchtigte Pirat Rache an dessen Vater nehmen, der einst seine Mutter verstieß und ihn zum Bastard machte. Doch Cyprian hat nicht mit Eliza gerechnet, die ihren Cousin bis aufs Blut verteidigt. Die zarte Lady mit dem überraschenden Kampfgeist kommt Cyprians Herz unerwartet nahe … und stellt ihn schließlich vor eine Wahl, die sein Leben verändern wird.
eBook-Neuausgabe September 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Heart of the Storm« bei St. Martin’s Press. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Venus im Sturm« bei Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1995 by Rexanne Becnel.
Copyright © der deutschen Ausgabe 1998 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Published by Arrangement with Rexanne Becnel
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Johannes Frick, Neusäß, unter Verwendung von Motiven von iStock (TomasSereda, Kharchenko_irina7, mammuth)
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (CdR)
ISBN 978-3-69076-104-8
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Rexanne Becnel
Das Leuchten der Pfefferblüten
Roman
Aus dem Amerikanischen von Ingrid Laufenberg
Kapitel 1
London, England, 1844
Das offizielle Speisezimmer von Diamond Hall war der Raum in der Londoner Residenz ihrer Eltern, den Eliza am wenigsten mochte. Er war zu höhlenartig, zu überladen. Und an diesem besonderen Abend war der Raum trotz der vielen guten Wünsche, die man ihr entgegenbrachte, viel zu übervölkert.
Auf der anderen Seite der polierten Mahagonitafel mit dem funkelnden Arrangement aus kostbarem Silber, Kristall und Porzellan sah sie, wie ihr Vater verstohlen Michael anschubste, und einen Moment später erhob sich der jüngere Mann gehorsam. Alle Augen wandten sich ihm erwartungsvoll zu. Und warum auch nicht? Michael Geoffrey Johnstone, einziger Erbe des Earl of Marley und selbst Viscount Cregmore, hatte eine natürliche Ausstrahlung, die ihm Aufmerksamkeit sicherte, wohin er auch ging. Unterstützt wurde sein Auftreten noch durch die breiten Schultern, die goldblonden Haare und ein Profil, das Eliza an die zahlreichen griechischen Statuen erinnerte, die sie studiert hatte. Jedermann hörte zu, wenn er sprach. Ihr Vater zitierte ihr gegenüber ständig Michaels Ansichten zu irgendwelchen Themen. Ihr jüngster Bruder Perry ahmte die Art nach, wie Michael seine Haare kämmte und seine Krawatte band, während ihr ältester Bruder LeClere sowohl seinen Gang als auch seine Art zu sprechen imitierte. Das hätte für ein junges Mädchen ausgereicht, um Kopfschmerzen vorzutäuschen und sich in ihr Zimmer zurückzuziehen. Nur konnte sie das heute Abend nicht tun. Es war ihr Geburtstag. Alle waren gekommen, um mit ihr zu feiern, und sie musste erfreut wirken.
»Auf Miss Eliza Victorine Thoroughgood ...«
»Die bald Lady Cregmore sein wird«, warf LeClere von seinem Platz weiter unten an der Tafel ein.
»Genau«, fügte Perry hinzu. »Meine große Schwester soll mich nicht länger herumkommandieren. Stattdessen soll sie lieber Sie herumkommandieren«, meinte er und lachte Michael an.
Michael zwinkerte Perry zu, und ein Lächeln spielte um seine sinnlichen Lippen. Er bewegte sich geschickt auf gesellschaftlichem Parkett, und so wartete er, bis das leise Lachen der Gäste verebbt war, bevor er fortfuhr. »Auf meine liebste Eliza anlässlich ihres neunzehnten Geburtstags. Herzlichen Glückwunsch!«
Er hob sein mit einem Goldrand verziertes Weinglas und trank es aus. Dann lächelte er sie direkt an. »Nächstes Jahr werde ich versuchen, ein ebenso vergnügtes Fest zu Ihrem zwanzigsten Geburtstag auszurichten, Eliza. Aber dann wird es in Ihrem Haus stattfinden.« Er ließ seinen klaren Blick über die Gästeschar gleiten. »Sie sind alle herzlich dazu eingeladen.«
Elizas Kopfschmerzen waren vorher schon schlimm genug gewesen. Die Erwähnung ihrer Hochzeit mit einem der begehrtesten und bestaussehenden Junggesellen im gesamten britischen Königreich verursachte ein schlimmes Hämmern in ihren Schläfen. In dem nun folgenden Trubel – noch mehr Trinksprüche, die Schar der Diener, die die Gläser erneut mit Champagner füllte, und die zahlreichen Stimmen, die mit zunehmendem Alkoholgenuss immer ausgelassener wurden – geriet Eliza beinahe in Panik. In ihrem Kopf hämmerte es und ihr Atem ging stockend. Trotz ihrer guten Gesundheit in der letzten Zeit fürchtete sie, jeden Moment einen ihrer Anfälle zu bekommen. Sie warf ihrer Mutter einen verzweifelten Blick zu.
Trotz der Entfernung über die schier endlos lange Tafel verstand Constance Thoroughgood den Ausdruck auf dem Gesicht ihrer Tochter. Ohne ihr anmutiges und heiteres Lächeln zu verlieren, gab sie dem Majordomus ein Zeichen, und als dieser läutete, stand sie auf. »Ich glaube, die Damen werden sich für ein paar Minuten zurückziehen. Mr. Thoroughgood?«
Gerald Thoroughgood trank den Rest seines Champagners und stand dann ebenfalls auf, während er sich den Mund mit seiner bestickten Leinenserviette abtupfte. »Sehr gut, meine Liebe. Meine Herren, lassen Sie uns in den Rauchsalon hinübergehen. Ich habe ein paar sehr gute Zigarren von den Westindischen Inseln.«
Wenn Eliza sich auch vorher über Perry geärgert hatte, so war sie doch außerordentlich dankbar, dass er es war, der ihr von ihrem Stuhl aufhalf, und nicht Michael. Sie fürchtete, wenn der perfekte Michael Johnstone ihren Arm genommen hätte, hätte ihre Lunge ihre kläglichen Möglichkeiten überschritten, und sie wäre auf der Stelle erstickt.
Weshalb hatten ihre Eltern nur darauf bestanden, sie mit einem solchen Mustermann zu vermählen? Ja, oberflächlich betrachtet, passten sie beide gut zusammen aufgrund ihrer sozialen Stellung und ihres Reichtums. Aber er sah unglaublich gut aus, umwerfend gut. Und auch wenn sie recht attraktiv war – zumindest hatten das ihre früheren Verehrer geschworen –, so reichte sie doch kaum an Michaels Standard heran. Zudem war er klug, geistreich und jeder gesellschaftlichen Herausforderung gewachsen. Egal in welcher Situation – auf der Jagd, im Spielzimmer, bei der Verwaltung des Familienbesitzes oder bei einer Sitzung im Oberhaus –, Michael beherrschte jedes Feld. Sie wusste das, weil ihre Eltern und Brüder – und jeder Verwandte – sie ständig darauf hinwiesen.
Im Gegensatz dazu war sie eine scheue und in sich zurückgezogene kleine Maus. Sie war zufrieden damit, zu lesen oder zu sticken. Sie fiel nicht auf, war nicht einmal amüsant. Ihre Cousine Jessica Haberton entsprach diesen Vorstellungen viel eher als sie. Weshalb Michael ihr den Hof machte und nicht Jessica, würde sie niemals verstehen.
Zunächst war sie natürlich geschmeichelt gewesen, als er ihr seine Aufmerksamkeit zugewandt hatte. Während der Saison hatte er jedes Fest besucht, das sie besuchte, und so oft mit ihr getanzt, wie noch schicklich war. Er hatte sie zumindest einmal pro Woche aufgesucht und ihr sorgfältig ausgewählte Geschenke mitgebracht, darunter einen emaillierten Fingerhut, ein graviertes Nadeletui und ein Nadelkissen, das mit winzigen Muscheln verziert war. An diesem Punkt, als seine Absicht deutlich wurde, hatte ihre Panik begonnen. Wenn sie Michael heiratete, würde sie seine verschiedenen Häuser führen müssen, seine zahlreichen Freunde und Geschäftspartner unterhalten und im Prinzip dieselbe Rolle in seinem Leben ausfüllen müssen, die ihre Mutter für ihren Vater spielte. Nur in größerem Rahmen.
Eliza war stolz auf ihr Zuhause und verschönerte es gerne, aber sie war keine gute Unterhalterin. Ihre Mutter hingegen schon. Sie zog Menschen mühelos an und besaß das Talent, dass sich in ihrer Gegenwart jeder wohl fühlte. Aber Eliza wusste, dass sie selbst das nicht konnte. Sie hatte nicht einmal eine Ahnung, wie sie das anstellen könnte.
Und außerdem war sie auch noch krank. Ihr ganzes Leben hatte sie gekränkelt.
Oh, warum musste sie Michael heiraten? Warum musste sie überhaupt jemanden heiraten? Sie würde viel lieber zu Hause bleiben, wenigstens noch ein paar Jahre.
»Ist alles in Ordnung, mein Liebes?« fragte ihre Mutter, während sie Elizas Arm nahm und sie zum Salon führte. »Kannst du richtig atmen?«
»Wenn ich nur eine Minute allein sein könnte«, murmelte Eliza, und ihre Stimme klang zittrig und dünn.
Ohne weiteren Kommentar führte ihre Mutter sie in das Schlafzimmer, das für Eliza in diesem Geschoß des riesigen Hauses eingerichtet worden war. Sie spürten, dass sie noch nicht kräftig genug war, um regelmäßig die Treppe hinaufzugehen. Zu anstrengend für ihre Lunge, sagten sie. Es könnte einen ihrer Anfälle von Kurzatmigkeit verursachen, warnten sie. Aber Eliza würde lieber die Mühe des Treppensteigens auf sich nehmen als die Unbilden, Michael zu heiraten.
»Clothilde, würdest du bitte ein Dampfzelt vorbereiten?« sagte Constance, nachdem sie die Türen hinter sich geschlossen hatten. »Wenn ich einfach nur ihr Kleid öffne und ihre Handgelenke und ihren Hals bade. Schnell. Wir haben nur ein paar Minuten.«
Constance Thoroughgood sah ihre Tochter mit sanften braunen Augen an. »Eliza, du darfst dich nicht so aufregen. Es ist doch nur eine Geburtstagsparty.«
»Ja, Mama«, antwortete Eliza gehorsam. Aber sie lehnte ihren Kopf zurück an die goldverzierte Couch und schloss die Augen. »Ich versuche es«, fügte sie hinzu, und ihre Stimme wurde noch schwächer.
Die gewünschte Wirkung trat ein. Ihre Mutter legte ihre Finger auf Elizas Handgelenk und zählte still die Herzschläge ihrer Tochter. »Kannst du jetzt besser atmen? Langsam. Und zähle deine Atemzüge, wie Dr. Smalley es geraten hat. Beruhige dich. Es ist nur eine Geburtstagsfeier«, wiederholte sie, aber dieses Mal klang sie nicht so überzeugend.
Eliza nutzte die Gelegenheit. »Ich weiß, dass es nur ein Fest ist. Aber Michael ... die Hochzeit ... oh, Mama, bitte sprich noch einmal mit Papa.« Eliza öffnete die Augen und sah ihre Mutter flehend an. »Bitte sag, dass du versuchen willst, ihn umzustimmen.«
Nach einem Moment runzelte Constance die Stirn. »Lass uns allein, Clothilde.« Nachdem das Mädchen gegangen war, ergriff Constanze Elizas Hände. »Es ist deine Pflicht zu heiraten. Du weißt das. Dein Vater hat sich große Mühe gemacht, jemanden zu finden, der so gut ist wie Michael. Sanft und gebildet. Jemand, dessen Stammbaum durch unsere finanziellen Mittel ergänzt wird.«
»Ja, Michael ist sicher in jeder Hinsicht perfekt«, gab Eliza bitter zu.
»Ich verstehe dich nicht, meine Tochter. Du benimmst dich, als sei das ein Makel.«
Eliza stützte sich auf den crème- und goldfarbenen Kissen des Ruhesofas auf und schwang ihre Beine herum, so dass ihre Füße auf dem antiken Aubusson-Teppich standen. »Er ist perfekt und ich ... ich bin im Vergleich dazu jämmerlich.«
»Eliza! Das stimmt einfach nicht. Du bist reizend. Jeder Mann wäre glücklich, dich zu heiraten.«
Sie lächelte ihre Mutter gequält an. »Ich gebe zu, dass wir ein ›reizendes Paar‹ abgeben. Ich höre das ständig von allen, die ich kenne – und von zahllosen Menschen, die ich nicht kenne –, seit du und Papa unsere Verlobung bekanntgegeben habt. Aber das ist es nicht, Mama. Es geht tiefer. Es ist ...« Sie brach ab, weil sie nicht die richtigen Worte fand, um es zu erklären. »Michael ist einfach ... einfach zu großartig und zu bedeutend für mich.«
»Das ist schlichtweg falsch«, beharrte ihre Mutter.
Aber sie wussten beide, dass es stimmte. Eliza Victorine Thoroughgood war zweifellos eine der reichsten Erbinnen Englands im heiratsfähigen Alter. Aber sie war ein kränkliches Kind gewesen und im Laufe der Jahre zurückhaltend und ein ziemlicher Bücherwurm geworden. Im Vergleich zu dem beliebten, aufgeschlossenen Michael war sie beinahe eine Einsiedlerin. Er strahlte wie das Leuchtfeuer zu Hause auf dem Lantern Rock, während sie nur wie ein gelbes Talglicht flackerte.
»Michael macht überhaupt keine Anstalten zu zögern«, mahnte ihre Mutter. »Und du solltest es auch nicht.«
»Das liegt daran, dass er mich überleben wird«, stellte Eliza fest. Sie klammerte sich jetzt an jeden Strohhalm und versuchte schamlos, ihre Mutter umzustimmen, indem sie ihr Angst machte. Aber welche andere Wahl hatte sie? Und bei ihrer medizinischen Vorgeschichte konnte es sehr gut die Wahrheit sein.
»Es ist furchtbar, so etwas zu sagen!«
»Aber es ist die Wahrheit! Ich werde die Qualen einer Geburt niemals überleben – falls ich überhaupt seine Aufmerksamkeiten als Ehemann überlebe.« Falls er sie auch nur im Entferntesten anziehend fand, fügte eine klägliche Stimme in ihrem Kopf hinzu. Schließlich hatte er sie noch nie um einen Kuss gebeten. Nur bei ihrer Verlobungsfeier hatte er sie geküsst, und das war ein so züchtiges und flüchtiges Küsschen gewesen, wie es ihre Gratulanten erwartet hatten. Es war auf keinen Fall zu vergleichen gewesen mit den leidenschaftlichen Küssen, von denen sie in Lady Morgans Buch oder bei ihrem kurzen Blick in LeCleres zerfledderte Ausgabe von Aristoteles gelesen hatte.
»Eliza Victorine. So etwas möchte ich nicht hören. Die Ehe wird dir guttun. Eine veränderte Umgebung. Eine Reise durch Europa. Wir werden dich wahrscheinlich bei deiner Rückkehr kaum wiedererkennen, denn du wirst viel kräftiger sein. Da bin ich ganz sicher.«
Aber Constance Thoroughgood war nicht einmal ansatzweise so zuversichtlich, wie sie vorgab zu sein. Eliza war nie kräftig gewesen. Sie hatte zwar schon lange keinen ihrer schlimmen Asthmaanfälle mehr gehabt, aber das lag nur daran, dass sie so vorsichtig waren. Dr. Smalley kümmerte sich um ihre Beschwerden, und sie befolgten seine Anweisungen strikt. Kein Reiten. Keine Spaziergänge im Freien, außer an sehr warmen und sonnigen Tagen. Sie brauchte Wärme und Ruhe, damit ihre Lunge nicht überfordert wurde. Constance musste sich nur daran erinnern, wie das Gesicht ihrer Tochter wegen Atemnot blau geworden war, und an die schrecklichen keuchenden Geräusche, als sie um Luft gerungen hatte, und schon hatte sie wieder Angst um sie.
LeClere und Perry waren mit einer robusten Gesundheit gesegnet. Nur ihr Liebling Eliza kränkelte. Die gesamte Familie nahm viele Mühen auf sich, um sie zu beschützen. Sie musste nur mit ihrer Glocke klingeln, und schon war jemand bei ihr. Aufgrund ihres Leidens hatte sie sich jedoch schon in frühen Jahren den Büchern zugewandt. Jetzt zeichnete sie, malte und las und verbrachte ihre gesamte Zeit drinnen, es sei denn, das Wetter erlaubte es, dass sie morgens eine Zeitlang auf der Terrasse verbrachte.
Sie war auf eine zarte Art schön mit ihrem hellen Teint, den ausdrucksvollen grauen Augen und den glänzenden dunklen Haaren. Sie war zwar zierlich, aber ihr Körper rundete sich auf vorteilhafte Art. Trotz ihrer weiblichen Schönheit hatte sie etwas Fragiles, wie eine reizende Porzellanpuppe, die zerbrechen könnte, wenn man sie zu rau anfasste.
Die meiste Zeit über wurde ihre Familie mit Elizas anfälliger Gesundheit spielend fertig. Sie bezogen sie, soweit es ging, in alle Aktivitäten ein und sorgten sich nicht, wenn sie sich in die Bibliothek zurückzog. Ihre Verlobung jedoch ließ Eliza erneut schwächer werden.
Als Constance ihrer widerwilligen Tochter wieder auf die Füße half und sie zurück zu ihren Gästen brachte, überlegte sie, ob sie nicht doch noch einmal mit ihrem Mann sprechen sollte.
Im Esszimmer setzte sich Eliza in einen der Chippendale-Sessel in der Nähe des riesigen Kamins, denn sie fror immer ein wenig in diesem Haus. Sie bat die Schwester ihrer Mutter, Judith, sich zu ihr zu setzen – damit Michael es auf keinen Fall tun konnte. Perry schob Judiths Sohn, den kleinen Aubrey, zu ihnen, als die Männer sich wieder zu den Frauen gesellten, und für ein paar Augenblicke vergaß Eliza ihren Verlobten vollkommen. Ihr zehn Jahre alter Cousin Aubrey war auf einen Rollstuhl angewiesen, seit er sich bei einem Reitunfall im Sommer den Fuß gebrochen hatte. Die Fraktur war schlecht verheilt, und er konnte immer noch nicht laufen. Sein Vater, Sir Lloyd Haberton, hatte den Rollstuhl extra anfertigen lassen, aber der Junge mochte es offensichtlich nicht, darin gesehen zu werden.
»Hallo, Aubrey. Ich glaube, ich habe mich bei dir noch nicht dafür bedankt, dass du zu meinem Geburtstagsdinner gekommen bist. Und auch nicht für ...«
»Wann können wir nach Hause?« unterbrach Aubrey sie und wandte sich an seine Mutter. »Alle starren mich an. Ich möchte nach Hause.«
»Psssst«, ermahnte Judith ihn und sah sich verstohlen um. »Du darfst dich nicht so aufführen, Schatz.«
»Aber mein Fuß tut weh«, sagte das Kind störrisch, und sein bleiches Gesicht verzog sich zu einem Stirnrunzeln. »Du weißt, dass es noch mehr weh tut, wenn ich friere.«
»Ich schiebe dich näher an den Kamin«, sagte Eliza und stand auf, um ihm zu helfen.
»Eliza, nicht. Du weißt, dass du nicht kräftig genug bist.« Judith gab einem Diener ein Zeichen, ihr zu helfen. Genau in diesem Moment kam Elizas Vater mit Michael im Schlepptau herein.
»Da bist du ja, Tochter. Michael und ich haben gerade ...«
»Oh, Michael. Genau derjenige, den ich gesucht habe«, flunkerte Eliza, als ihr eine verzweifelte Idee kam. Er war immer so höllisch aufmerksam ihr gegenüber. Er konnte ihre Bitte einfach nicht abschlagen. »Aubrey fühlt sich nicht wohl. Ich dachte, er würde vielleicht gerne mit Tattie spielen. Würden Sie wohl so freundlich sein, sie zu suchen?«
»Aber Eliza«, begann ihr Vater.
»Nein, nein, lassen Sie. Ich werde Tattie gerne für Eliza suchen. Und für Aubrey.« Michael verbeugte sich kurz aber galant und lächelte sie gleichzeitig strahlend an. »Haben Sie irgendeine Idee, wo sie sich verstecken könnte?«
Eliza machte ein nachdenkliches Gesicht, das allerdings dazu diente, die Panik zu verbergen, die sie immer überfiel, wenn er seinen Charme bei ihr spielen ließ. »Wahrscheinlich im Frühstückszimmer«, log sie wieder. Aber das war reiner Selbsterhaltungstrieb, sagte sie sich, als Michael sich entfernte, um ihrer Bitte nachzukommen. Elizas alte Katze war vermutlich in der Küche und hatte sich in den schmalen Spalt zwischen Kohlenkiste und Wasserbehälter des Ofens gequetscht, wo es warm und behaglich war und wo niemand sie finden würde, der nicht genau wusste, wo er sie zu suchen hatte. Michael würde sie niemals finden, und vielleicht würde sie heute Abend keine Zeit mehr mit ihm verbringen müssen.
Aber das änderte nichts an Aubreys Brummigkeit.
»Meine Katze wird dir gefallen«, meinte sie, obwohl das Gesicht des Jungen zu einem Schmollen verzogen war.
»Ich hasse Katzen«, antwortete er.
»Ich auch, ich auch«, murmelte Gerald Thoroughgood und funkelte Eliza zornig an. »Besonders wenn sie unter einem solchen Vorwand benutzt werden ...«
»Welche Tiere magst du denn?«, fragte Eliza das Kind und war fest entschlossen, ihren Vater vollkommen zu ignorieren.
»Er hat Hunde gemocht. Und Pferde«, antwortete Tante Judith für ihren Sohn.
»Katzen können Spaß machen«, fuhr Eliza beharrlich fort in dem Bemühen, den Jungen dazu zu bringen, selbst für sich zu sprechen. »Besonders kleine Kätzchen sind so komisch. Wie kleine Äffchen tollen sie herum und balgen sich die ganze Zeit.«
»Wir haben ihm ein kleines Schoßhündchen angeboten.« Judith streckte die Hand aus, um Aubrey eine schwarze Locke aus der Stirn zu streichen. aber er drehte seinen Kopf abrupt weg, und Judith zog ihre Hand widerstrebend zurück.
Eliza hatte ihren jungen Cousin in den vier Monaten seit seinem Sturz nur selten gesehen, aber ihre Mutter hatte sie über seine Fortschritte – beziehungsweise den Mangel daran – auf dem Laufenden gehalten. Als Eliza das schmollende Kind jetzt ansah, auf den unförmigen Rollstuhl angewiesen, gezwungen, an einer Gesellschaft teilzunehmen, die ihn spürbar ausschloss, wusste sie genau, wie er sich fühlte. Obwohl ihre körperlichen Gebrechen nicht so deutlich sichtbar waren wie Aubreys – sie konnte wenigstens aufstehen und gehen –, fühlte sie sich trotzdem ebenso wie er von dem täglichen Leben abgeschnitten. Es war zu schade, dass es keinen Ort gab, an dem so arme Kreaturen wie sie zusammenkommen konnten. Wo es die Norm war, kränklich oder verkrüppelt oder einfach anders zu sein, und niemand das für seltsam hielt.
Plötzlich kam ihr eine absurde Idee. Woher sie kam, konnte sie nicht sagen. Vielleicht hatte sie etwas darüber gelesen. Es konnte aus der Times stammen, die ihr Vater Eliza jeden Abend brachte. Es konnte in dem Reisebericht gestanden haben, den sie letztes Frühjahr gelesen hatte, von dieser exzentrischen Herzogin, die in Cornwall lebte. Aber vielleicht kam es auch von diesem Buch über Zugvögel an der Atlantikküste, das sie gelesen hatte.
Was auch immer die Quelle ihrer Eingebung war, Eliza kannte plötzlich die Antwort auf ihr Dilemma. Madeira. Die Insel Madeira, Zufluchtsort für unzählige Zugvögel und auch für zahllose Reisende, die vor Englands kalten und feuchten Wintern fliehen wollten. Das milde Klima der Südküste hatte die Insel zu einer Winterkolonie für kränkelnde britische Bürger gemacht. Wenn sie und Aubrey sich dort erholen könnten, wären sie unter ihresgleichen – und sie wäre fort von Michael und der entschlossenen Kuppelei ihres Vaters wenigstens für eine Weile.
Sie beugte sich vor, und ihre grauen Augen glühten vor Hoffnung. »Ich habe eine großartige Idee«, begann sie.
Die meisten Gäste waren schon lange gegangen, nur Aubrey, seine Eltern und Michael blieben immer noch da. Tante Judith hatte sich sehr früh von der Debatte zurückgezogen. Sie saß auf der Kaminbank und hörte einfach nur zu. Aber Eliza war sicher, dass sie auf ihrer Seite war. Michael stand beim Kamin, einen Ellbogen auf den Sims gestützt. Den Drink in der anderen Hand hatte er offensichtlich vergessen, während er sie anstarrte. Auch Elizas Mutter war still. Nur Onkel Lloyd und Elizas Vater äußerten ihre Meinungen, und beide waren sie dagegen.
»Wenn es um die Kälte geht, dann könnten wir ihn auch nach St. Mary's schicken, unten auf den Scilly-Inseln«, sagte Sir Lloyd. Seine dicken Koteletten schienen sich unabhängig von seinem Kiefer zu bewegen.
»Madeira ist viel zu ... weit weg«, fügte Elizas Vater hinzu.
Nicht weit genug, wollte Eliza entgegnen, aber sie war so klug, ihre Zunge im Zaum zu halten. »Du bist mit LeClere nach Portugal gesegelt. Schon mehrere Male«, wandte sie statt dessen ein.
»Ja, aber auch wenn Madeira portugiesisch ist, so liegt es doch mehrere hundert Meilen weiter weg. Und außerdem war das geschäftlich.«
»Und Geschäfte sind wichtiger als Aubreys Gesundheit? Und meine?« Eliza verlangte eine Antwort, ihre Wangen waren gerötet vor Aufregung. Sie versuchte nicht einmal, ihre Verärgerung über ihre Gesprächspartner zu verbergen.
»Der Punkt geht an sie, Gerald.« Alle Augen richteten sich auf Constance. »Obwohl ich nicht einmal wage, mir vorzustellen, dass die beiden eine so beschwerliche Reise unternehmen, glaube ich, dass Eliza und auch Aubrey von einem Winter auf Madeira profitieren würden. Dame Franklin hat ihren Schwiegersohn dort hingeschickt – der so sehr unter den Folgen des Unfalls bei der Fuchsjagd litt. Sie hat mir erzählt, dass der Aufenthalt bei ihm wahre Wunder bewirkt hat.«
Gerald Thoroughgood runzelte die Stirn. »Aber was ist mit ihrer Hochzeit?« Er machte eine Handbewegung zu Michael. »Es wäre kaum fair dem Bräutigam gegenüber.«
»Ich glaube, Eliza sollte fahren.«
Michaels überraschende Bemerkung sicherte ihm die Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Er richtete sich auf und stellte sein Glas auf den marmornen Kaminsims. Aber obwohl er ihren Vater angesprochen hatte, hielt er seinen klaren Blick direkt auf Eliza gerichtet. »Ich halte ihre Idee für vernünftig. Welches Unterfangen könnte edler sein, als das Leben eines Kindes zu verbessern? Ich weiß, dass Eliza in ihrem Leben genug Krankheit erfahren hat. Wer wäre besser geeignet, Aubrey zu begleiten? Wer könnte ihn besser verstehen und ihm helfen, wieder gesund zu werden?«
Selbst Sir Lloyd konnte nicht widerstehen, wenn der strahlendste Stern der Gesellschaft ihm die geballte Kraft seiner Überredungskunst entgegensetzte. Michaels Lächeln war entwaffnend, aber es waren seine Worte, die schließlich den Ausschlag gaben. Wer konnte einem leidenden Kind seine vielleicht letzte Chance auf Heilung verwehren?
Als die beiden Väter schließlich zustimmten, konnte Eliza ihren Verlobten nur mit offenem Mund anstarren. Es hatte ihr die Sprache verschlagen. Wollte er sie gerne für die Monate loswerden, die ihre Reise in Anspruch nehmen würde? Oder hoffte er auf eine Möglichkeit, einen Rückzieher zu machen, die für sie weniger demütigend sein würde? Oder wollte er ihr die Möglichkeit geben, einen Rückzieher zu machen? Eine so noble Geste würde ihm ähnlichsehen.
Aber das Funkeln in seinen Augen strafte all diese Möglichkeiten Lügen. Er betrachtete sie so seltsam, als hätte er sie nie zuvor richtig angesehen. Durch seine Aufmerksamkeit war sie jedoch längst nicht so beunruhigt, wie sie es normalerweise war.
Aber sie hatte sich in ihrer leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit ihrem Vater und Sir Lloyd unterbrechen lassen.
»Ich werde morgen früh die Schiffsbücher prüfen«, bemerkte Sir Lloyd, während ihm ein Diener in seinen schweren Mantel half. »Ich denke, eines meiner Schiffe kann sie sicher hinbringen.«
»Und wir müssen uns um eine Anstandsdame kümmern«, fügte Elizas Vater hinzu.
Eliza stand auf und ging langsam zu Aubrey, der während der gesamten Diskussion geschwiegen hatte. »Wir werden ein richtiges Abenteuer erleben, du und ich.« Sie legte eine Hand auf seinen dünnen Arm. »Wir segeln zu einer exotischen Insel und genießen einen warmen sonnigen Winter anstelle eines kalten und ungemütlichen.«
»Ich fahre nicht, wenn ich diesen verdammten Stuhl mitnehmen muss«, schnauzte der Junge.
»Also, Aubrey«, begann Sir Lloyd. »Du wirst das tun, was wir für das Beste halten, und ich ...«
»Es wird nicht lange dauern, bis Aubrey diesen Stuhl überhaupt nicht mehr brauchen wird.« Wieder war es Michael, der die Situation rettete, indem er die Debatte beendete, noch bevor sie richtig begonnen hatte. Mit derselben Sanftheit, mit der er Sir Lloyd entwaffnet hatte, zog er Eliza jetzt ein wenig von den anderen fort. Sie war bestürzt, als er seine Hände auf ihre Schultern legte, seinen Kopf näher zu ihrem neigte und sie so leise ansprach, dass nur sie ihn verstehen konnte.
»Und vielleicht wird meine zukünftige Braut bei ihrer Rückkehr etwas eifriger auf unsere Heirat bedacht sein.«
»Ich ... es ist nicht ... ich meine ...«
Er unterbrach ihr Stottern, indem er mit seinem Mund sanft und leicht über ihren strich, so dass sie vollkommen durcheinander war. Aber sie spürte das Lächeln auf seinen wohlgeformten Lippen, und als er sich wieder aufrichtete, überlegte sie zusammenhanglos, ob er das erstaunte Oh auf ihren spüren konnte.
»Ich werde da sein, um dich zu verabschieden, Eliza. Aber ich werde auch da sein, um dich zu begrüßen, wenn du zurückkehrst«, sagte er, sein schönes Gesicht dicht über ihrem. »Ich hoffe, meine Liebe, dass deine Zweifel wegen unserer bevorstehenden Heirat sich während deiner Reise zerstreuen werden und du bei deiner Rückkehr unsere Verbindung ebenso ungeduldig erwartest wie ich.«
Kapitel 2
»Er hat drei Töchter und einen Sohn.«
»Wie alt? Der Sohn, nicht die Töchter.«
Der hagere Rechtsanwalt musste das unheilvolle Interesse, das in seinen Augen aufflackerte, unterdrücken. Weshalb wollte dieser Mann wissen, wie alt Sir Lloyd Habertons einziger männlicher Erbe war? Aber er würde diese Frage nicht laut stellen. Er hatte einen Riecher für Ärger, jawohl, den hatte er. Und es war unverkennbar, dass dieser Kerl hier nichts als Ärger bedeutete. Nicht laut und randalierend, sondern verstohlen und leise. Also die schlimmste Art. Gott sei dem armen Sir Lloyd Haberton gnädig.
»Neun. Zehn. Ist es wichtig, wie alt er ist?«
Dumme Frage, erkannte er schnell. Denn der Mann hob seinen Kopf von dem Blatt Papier, das er studiert hatte, einer Auflistung von Habertons verschiedenen Geschäfts- und Privatadressen, und sah ihn kalt an. Diese Augen waren tödlich. Kalt und tödlich wie der Tod selbst. Der Anwalt schluckte und rutschte auf der harten Holzbank hin und her. »Er ist zehn. Ja, zehn. Das hat mir die Küchenmagd erzählt. Oh, und er wird über den Winter fortgeschickt.«
Der Mann zog eine dunkle Braue hoch, aber seine Augen verrieten keine Gefühlsregung.
»Er ist gestürzt und wird auf irgendeine Insel zur Erholung geschickt«, fuhr der Anwalt fort.
»Welch ein Zufall.«
Cyprian Dare glaubte nicht an Schicksal oder Glück. Er wünschte sich nichts und betete auch zu nichts und niemand. Ein Mann war selbst verantwortlich für sein Glück oder Unglück. Er machte sich zunutze, was um ihn herum geschah, und arbeitete an seinem eigenen Geschick. Cyprian hatte sein ganzes Leben darauf gewartet, die Rechnung mit Haberton zu begleichen. Jetzt würde sich seine Hartnäckigkeit auszahlen. Die Zeit war gekommen.
Er zog einen Umschlag hervor und schob ihn in die Mitte des verkratzten Tavernentisches. »Ihre Bezahlung. Wenn Sie auch nur ein Wort zu irgendjemand darüber sagen ...«
Er musste nicht deutlicher werden. Hinter ihm verlagerte Xavier sein beachtliches Gewicht von einem Bein aufs andere, und Cyprian beobachtete, wie das teigige Gesicht des Anwalts noch zwei Stufen blasser wurde. Xavier hatte nun mal diese Wirkung auf Menschen.
Nachdem der Anwalt den Raum fluchtartig verlassen hatte, bedeutete Cyprian seinen beiden Männern, sich zu ihm an den Tisch zu setzen. Im selben Moment steckte die Bedienung ihren Kopf durch die Tür.
»Kann ich noch mal voll machen?«
Der jüngere von Cyprians beiden Männern, Oliver, wackelte mit den Augenbrauen. »Was für eine nette Idee. Du kannst mich voll machen. Ich kann dich voll machen.« Der Junge grinste. »Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen.«
Sie kicherte und schob sich in den Raum. Sie war klein und brünett, und ihre großen Brüste drohten ihr festgeschnürtes Oberteil jeden Moment zu sprengen. Das vollkommene Gegenteil der blonden Melkerin, von der Cyprian ihn vor nicht ganz einer Stunde fortgezerrt hatte, und das, nachdem der Halunke die Nacht mit einer feinen Witwe verbracht hatte, die beinahe doppelt so alt war wie er.
»Schenk nach und verschwinde«, brummte Cyprian ungeduldig. Jetzt, da die Vergeltung so nahe war, musste Olivers frisch geweckter Appetit auf die Damen erst einmal warten.
Die Magd beeilte sich, Cyprians Anweisung Folge zu leisten, aber sie beugte sich weit vor, während sie nachschenkte, und bot Oliver und den anderen einen freizügigen Anblick dessen, was sie einem Mann zu bieten hatte. Als Oliver eine Hand unter ihren Rock gleiten ließ, stieß sie einen netten kleinen Schrei aus und dann einen Seufzer. Aber sie achtete sorgfältig darauf, den Wein nicht zu verschütten. Als sie hinausstolzierte, warf sie noch einen vielsagenden Blick auf Oliver, bevor sie die Tür schloss. Oliver hielt seinen Mittelfinger hoch und grinste.
»Ich war da. Und sie ist nass und bereit für mich, so schnell.« Er schnüffelte an seinem Finger und stieß einen tiefen Seufzer aus.
Xavier schüttelte den Kopf. »Vermutlich ist sie immer noch voll von irgendeinem Kerl, der sie unter der Treppe genommen hat. Oder in der Scheune. Oder auf der Wiese.«
»Du kannst mich mal«, antwortete Oliver aufgebracht. Er steckte seinen Finger in den Krug des anderen Mannes und rührte damit um. »Du bist nur eifersüchtig, weil du bei dieser Reise nicht näher als so an eine Muschi rankommst.«
»Meine Ana ist mehr wert als hundert von deinen Weibern. Als tausend. Es macht mir überhaupt nichts aus, auf sie zu warten. Du bist noch jung – einfach nur ein grüner Junge«, fügte er hinzu, offensichtlich, um Olivet zu irritieren. »Du wirst auch noch lernen, dass an einer Frau noch andere Dinge wichtig sind, nicht nur die Stelle zwischen ihren Beinen.« Dann wandte sich Xavier von dem Jungen zu Cyprian. »Machen wir uns jetzt auf den Heimweg?«
Cyprian trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. »Bald«, meinte er nachdenklich zu seinem ersten Maat und ältesten Freund. »Sehr bald.«
Dann richtete er sich auf und lächelte, ein kaltes, berechnendes Lächeln, das seinen beiden Männern jeden Gedanken an Frauen austrieb. Wenn Cyprian Dare diesen Gesichtsausdruck aufsetzte, dann sollte man besser auf der Hut sein.
Xavier und Oliver sahen sich an. Sie wussten nur wenig von diesem Sir Lloyd Haberton, den Cyprian so wild entschlossen jagte. Aber sie wussten, dass dieser Mann etwas außerordentlich Dummes getan haben musste, um in ihrem Kapitän solche Gefühle hervorzurufen. Wer immer es auch war, er würde bald wissen, dass mit Cyprian Dare nicht zu spaßen war.
Der Himmel war grau und unfreundlich, und sämtliche Mitglieder der Gesellschaft um Habertons und Thoroughgoods wurden von dem Nebel mit feuchten Perlen wie Diamantenstaub bedeckt. Auf dem Weg in der vollen Kutsche zum St. Catherine's Dock hatten sie nach feuchter Wolle gerochen. Jetzt jedoch überwog der Gestank nach altem Fisch. Eliza hoffte von Herzen, dass sie nicht gezwungen sein würden, diesen Gestank während der gesamten Reise zu ertragen.
Sie hatte noch nie eine Seereise unternommen. Sie hatte noch nie ein Boot betreten, geschweige denn ein hochseetüchtiges Schiff. Aber sie hatte es sich ausgemalt. Sie hatte einmal gelesen, dass das Meer nach Salz und anderen seltsamen Dingen roch, ganz anders als das Land. Trotz ihrer kürzlich aufgetretenen Zweifel an ihrem verrückten Plan konnte sie nicht leugnen, dass ihre Neugier zusehends wuchs. Sie wollte das Meer riechen und über seine lebendigen, wogenden Wellen blicken. Sie wollte sehen, wo und wann der Mond aufging, und herausfinden, wie die Gezeiten von diesem entfernten Gestirn beeinflusst wurden.
Sie hoffte nur, dass es nicht immer so kalt sein würde wie heute. Sie hatte das Gefühl, dass ihre Haut langsam blau wurde.
»Du weißt, es ist nicht zu spät für dich, deine Meinung zu ändern«, murmelte Elizas Mutter, so dass nur ihre Tochter sie hören konnte. »Deine Cousine Agnes könnte ...«
»Nein, könnte sie nicht. Außerdem möchte ich fahren.«
Perry drängte sich zwischen sie und legte ihnen beiden jeweils einen Arm um die Schulter. »Also, Mum. Sie möchte fahren. Und ich möchte fahren.«
»Du hast Schule, kleiner Bruder«, neckte Eliza freundlich. Jüngere Brüder machten beinahe ebenso viel Ärger wie ältere, aber sie wusste, dass sie beide furchtbar vermissen würde.
»Ich bin nicht klein«, widersprach er und sah hochmütig von oben auf sie herab. »Außerdem ...«, fügte er hinzu, »könnte ich eine Menge lernen: Geografie, Geschichte ...« Er warf seiner Mutter einen flehenden Blick zu, aber seine Argumente trafen auf taube Ohren, wie schon so oft in den vergangenen zwei Wochen. Mit einer resignierten Grimasse küsste er Eliza auf die Wange.
»Pass auf dich auf, Bleichgesicht«, befahl er streng und benutzte den Namen, den er ihr gegeben hatte, nachdem er Geschichten über Amerika gelesen hatte.
Eliza lächelte ihn matt an. Es wurde doch schwerer, als sie gedacht hatte. »Wachse nicht zu sehr, während ich weg bin.«
LeClere war der nächste. Er umarmte sie fest. Er war derjenige, der immer auf sie achtgab, und erst jetzt wurde ihr bewusst, wie sehr sie sich immer auf ihn verlassen hatte. Konnte sie das wirklich schaffen?
Dann kam Michael zu ihr, und eine neue Welle des Zweifels durchfuhr sie. Weshalb lief sie vor ihm weg? Er war ein so perfekter Mensch. Ihr Verstand musste noch schwächer sein als ihre Lunge, dass sie ein solches Musterexemplar von Mann zurückweisen wollte.
Als er dann vorbildlich lächelte und sie mit seinen sinnlichen Lippen küsste, dachte sie, ob sie es sich mit der Reise nach Madeira nicht doch noch anders überlegen sollte. Dann räusperte sich ihr Vater, und Michael trat zurück. »Hab' eine gute Reise, Eliza. Ich werde die Tage zählen, bis du zu mir zurückkehrst.«
Bis du zu mir zurückkehrst. Seine Worte gingen ihr nicht mehr aus dem Kopf, während sie sich von den anderen verabschiedete. Ihr Vater umarmte sie so fest und so lange, dass sie dachte, sie würde nie wieder Luft bekommen. Ihre Mutter hielt Elizas Gesicht in Händen, während Tränen in ihren Augen glitzerten. »Wenn du zurückkommst, wird es an der Zeit sein, die Hochzeit voranzutreiben. Verstehst du?«
»Ja, Mama. Ich verstehe. Und ich werde bereit sein.« Und sie würde es sein, sagte sie sich.
In den vergangenen beiden Wochen war Michael noch aufmerksamer gewesen als zuvor. Er hatte mit der Familie gegessen, sie ins Theater begleitet. Sie war von seiner Anwesenheit wie immer aus der Ruhe gebracht worden. Aber jetzt war es irgendwie anders. Früher hatte er sich verhalten, als würde er sie mögen, fände sie aber nicht sonderlich anziehend – als sei ihre Ehe eine geschäftliche Verbindung, –was ja auch stimmte. Jetzt jedoch schien er ein persönlicheres Interesse an ihr zu haben – und auch ein mehr körperliches.
Einmal, als er ihr aus seiner Kutsche geholfen hatte, hatte sie dem Ausdruck seiner Augen angesehen, dass er sie küssen wollte. Und wenn sie nur einen Moment innegehalten hätte, hätte er sich diesen Kuss gestohlen. Aber sie hatte sich abgewandt, völlig durcheinander, und der Augenblick war verloren. Danach hatte sie sich daran erinnert, wie er sie das eine Mal geküsst hatte, und sich gescholten, dass sie die Gelegenheit verpasst hatte, ihre Neugier durch einen zweiten Kuss zu befriedigen. Heute, in Anwesenheit ihrer Familie, hatte er sich natürlich darauf beschränken müssen, sie auf die Stirn zu küssen. Aber das hatte ihre Neugier nur gesteigert.
Sie sah an ihrer Mutter vorbei zu Michael, der sie mit einem halben Lächeln beobachtete. Trotz der Kälte stieg ihr eine heiße Röte in die Wangen. Bald würden sie verheiratet sein, und dann würde ihre Neugier, was Küsse – und andere Dinge – anging, gestillt werden. Vielleicht würde diese Reise ihnen beiden guttun und ihren Appetit für die bevorstehende Vermählung anregen.
Der Abschied hätte sich noch endlos ausgedehnt, hätte der Kapitän des Schiffes nicht seinen Arbeitgeber, ihren Onkel Lloyd, gebeten einzuschreiten. »Die Flut wartet nicht auf die Lady Haberton.«
»Ja, ja«, gab Sir Lloyd zu. Er hatte angeordnet, dass eines seiner Linienschiffe in Madeira hielt. Jetzt sah er nicht allzu erfreut über das gesamte Unternehmen aus. »Kommt schon«, murmelte er. »Bringen wir es hinter uns.«
Ein ängstlicher Aubrey wurde von seinem Diener Robert über die Laufplanke getragen. Elizas Dienstmädchen Clothilde folgte ihnen ebenso wie eine Armee von Gepäckträgern und ein verdutzter Matrose, der Aubreys Rollstuhl schob. Cousine Agnes wurde an Bord geholfen, während sie über den Regen, den Gestank und das armselig kleine Schiff schimpfte.
Als es an Eliza war, die schmale Laufplanke zu betreten, wappnete sie sich, um nicht zu stolpern oder zu zögern oder auch nur im Geringsten überwältigt auszusehen. Madeira würde gut sein für Aubreys Zustand und ganz bestimmt auch für ihren. Sie musste auf dieser Reise alles mit Zuversicht auf sich zukommen lassen. Aber nachdem LeClere ihren Arm losgelassen hatte und auf den Kai zurückgekehrt war, schwand ihre Sicherheit, dass sie es schaffen würde. Sie stand an der Reling und winkte wild mit ihrem feuchten Taschentuch, als die Laufplanke hochgezogen wurde.
Aber Agnes schob sie vom Deck. »Du holst dir noch den Tod, Kind. Deine Lunge ist auch so schon schwach genug. Komm mit, hier entlang.«
Bei ihrem letzten Blick auf die Familie sah Eliza ihre Eltern Arm in Arm stehen, und ihre Mutter betupfte sich die Augen. LeClere, Perry und Michael hatten ihre Kragen hochgeschlagen und die Hüte gegen den Regen und die Kälte ins Gesicht gezogen. Aber sie lächelten, und sie musste schwer schlucken. Sechs Monate, bis sie alle wiedersah. Sechs lange Monate. Wer wusste, wie sehr sich die Dinge bis dahin vielleicht verändert hatten?
Die Lady Haberton glitt um neun Uhr aus dem St. Catherine's Dock und auf die Themse hinaus. Eine knappe halbe Stunde später folgte die Chameleon. Cyprian Dare stand vorne am Bug und beugte sich über den Bugspriet direkt oberhalb der verwitterten Galionsfigur einer Frau, um die sich eine dicke Schlange wand.
Nicht mehr lange. Überhaupt nicht mehr lange. Er würde sie unbehelligt auf das Meer hinausfahren lassen. Vielleicht bis zu den Kanalinseln. Dann würde er angreifen, und Sir Lloyd Habertons Kind würde sein.
Ein Regenschwall ergoss sich über ihn, brannte in seinem Gesicht und klatschte über das Deck. Dann ein weiterer Schwall und noch einer, bis die ganze Welt kalt und nass und verschwommen war und nur noch aus Regen und Deck und trübem Fluss zu bestehen schien. Aber der Wind blies kräftig aus Norden, und sie kamen gut voran. Er schüttelte die Kapuze seiner Regenjacke ab und blickte zum Himmel. Der heftige Regen klatschte ihm die kurzgeschnittenen Haare an seinen Schädel, und eisige Wasserfinger bahnten sich einen Weg unter den Kragen seines Mantels und seines Hemdes.
Aber Cyprian scherte sich nicht darum. Wenn überhaupt, dann half der eiskalte Regen nur, das schreckliche Feuer zu lindern, das immer noch in ihm loderte. Endlich würden achtundzwanzig Jahre gerächt werden. Er hatte seine Suche an dem Tag begonnen, als seine Mutter gestorben war – das war jetzt fünfzehn Jahre her. Aber die Erinnerung war so frisch wie eh und je in Cyprians Gedanken. Bis zuletzt hatte sie niemals von seinem Vater gesprochen, auch nicht, wenn er gefragt hatte. Erst als sie im Sterben lag, hatte sie endlich seinen Namen preisgegeben – Sir Lloyd Haberton – und ihn dafür verflucht, dass er sie und ihr gemeinsames Kind verlassen hatte. Dann hatte auch sie Cyprian verlassen. Er wusste jetzt natürlich, dass sie hatte bleiben wollen. Aber damals hatte er sich allein gelassen gefühlt.
Cybil Burns war einst sicher ein hübsches Mädchen gewesen. Aber aufgrund des jugendlichen Leichtsinns und der ungewollten Schwangerschaft hatte ihre Familie sie in Schande verstoßen. Allein, von allen im Stich gelassen, hatte sie ihr Kind bekommen und war ihren Weg gegangen, so gut sie konnte. Aber die Musikstunden, der Privatunterricht und die guten Manieren, die sie gelernt hatte, waren keine Hilfe gewesen, als es darum ging, ein Kind zu ernähren und großzuziehen. Obwohl sie als Tochter eines wohlhabenden Vikars aufgewachsen war, musste sie schließlich als Dienstmädchen in Hafenkneipen arbeiten. Sie hatte auch gehurt, wie Cyprian Jahre später bewusstwurde. Sie hatte mit jedem geschlafen, der bessere Möglichkeiten für ihr Kind versprach. Seinen ersten Posten als Schiffsjunge hatte er auf diese Art bekommen, und Gott allein wusste, was sonst alles noch. Weil sein Vater sich nicht darum scherte, dass sie ihm ein Kind geboren hatte, war sie gezwungen gewesen, ihren Körper zu verkaufen, damit sie für sich und ihren Sohn den Lebensunterhalt verdienen konnte.
Daraus ergab es sich, dass er bei einer Hure niemals wahre Befriedigung finden konnte.
Gott sei Dank gab es genügend andere Frauen, die gerne mit ihm ins Bett gingen, ohne dass er dafür bezahlen musste. Sonst hätte er enthaltsam wie ein Mönch gelebt.
Falls die Mönche wirklich enthaltsam waren.
Ein Zittern durchfuhr ihn, aber er ignorierte es. Irgendwo da vor ihm war seine Möglichkeit zur Rache. Wenn er erst einmal Habertons Sohn in seiner Gewalt hatte, konnte Cyprian endlich beginnen, sich von dem Hass zu befreien, der ihn zu verschlingen drohte. Der Junge würde leiden, so wie Cyprian gelitten hatte: der Schmerz des Verlassenseins, die Angst und Hilflosigkeit, die Demütigung, als Kind seinen Weg zu finden in einer grausamen Welt, die für Kindlichkeit oder Schwäche keine Entschuldigung fand. Und Cyprian würde dafür sorgen, dass Sir Lloyd Haberton über jede gemeine Einzelheit auf dem Laufenden gehalten wurde. Sie würden von Hafen zu Hafen ziehen, und von jedem neuen Ort würde Cyprian an Haberton schreiben.
Der Mann würde wissen, dass sein geliebtes Kind unter einer dünnen Decke zitterte, im Schuppen hinter dem Haus seines letzten Arbeitgebers schlief. Er würde darüber im Bilde sein, wie sein Sohn so weit erniedrigt wurde, dass er mit Hunden um ihr Futter kämpfen musste, um seinen Magen einigermaßen zu füllen. Er würde Lumpen an den Füßen tragen, wenn seine Schuhe zu klein geworden waren.
Cyprian biss die Zähne zusammen, und seine Finger umklammerten die nasse Reling, als er sich an seine unglückliche Kindheit erinnerte. Aber er hatte zu kämpfen gelernt. Er hatte gelernt, wie man am Leben blieb, und er war dadurch stärker geworden. So würde es auch diesem Jungen ergehen, Krüppel oder nicht. Haberton war derjenige, der viel mehr leiden würde. Mit jedem Brief würde Haberton ein bisschen mehr sterben, so wie es Cyprians Mutter ergangen war. Der Mann würde immer noch reich, gut genährt und in seinen Kreisen hoch angesehen sein. Aber Cyprian wusste, dass er innerlich sterben würde. Nicht zu wissen, wo sein Sohn war, würde ihn umbringen.
Den Gedanken an diese Rache hatte Cyprian all die Jahre genossen, während er nach seinem Bastard-Vater – so bezeichnete er den Mann – gesucht hatte. Cyprian mochte als Bastard geboren sein, aber es war sein Vater gewesen, der die Entscheidung getroffen hatte, nicht er selbst. Und auch nicht seine Mutter. Seine Mutter hatte ihm gesagt, dass er keinen Nachnamen hatte. Sie hatte ihren verloren, als ihre Familie sie verstoßen hatte, und sein Vater hatte ihm seinen Namen nicht gegeben. Also hatte Cyprian sich Dare genannt. Selbst als sie ihm den Namen seines Vaters genannt hatte, hatte er sich geweigert, ihn anzunehmen. Er würde es niemals tun. Er wollte weder den Namen des Mannes noch seinen Reichtum. Nicht einen Heller. Aber seinen einzigen Halbbruder ...
Ja, das Schicksal von Habertons einzigem rechtmäßigen Erben in der Hand zu haben, Haberton seinen Stolz und seine Freude zu nehmen – das schien kein unangemessener Preis für achtundzwanzig Jahre Verlassensein.
Kapitel 3
Die Fahrt auf der Themse und der lange Tag, den sie brauchten, um über den Fluss zum Meer zu gelangen, war die schlimmste Erfahrung, die Eliza je gemacht hatte. Es regnete immer wieder, so dass sie in ihren kühlen Kabinen bleiben mussten. Der Blick hinaus zeigte eine dreckige Wasserstraße voller Unrat, die eher wie eine Kloake als wie der größte Fluss des Landes aussah. Und es stank.
»Gott im Himmel, bitte bewahre uns vor mehr von diesem ... Geruch«, intonierte Agnes und presste ihr Gebetbuch an ihren üppigen Busen. Die Cousine von Sir Lloyd lebte von der mageren Unterstützung, die ihr verschwenderischer Vater ihr hinterlassen hatte. Sir Lloyds Großzügigkeit ihr gegenüber in den vergangenen acht Jahren war ein Segen für sie gewesen, und zumindest in ihren Augen konnte dieser Mann nichts Unrechtes tun. Obwohl sie entsetzliche Angst davor gehabt hatte, über die Laufplanke zu gehen und jetzt ein nach Flieder duftendes Taschentuch an ihre Nase presste, wusste Eliza, dass die Frau keine heftigere Beschwerde äußern würde als dieses gemurmelte Gebet.
Eliza, Agnes und Clothilde teilten sich eine Kabine, die nicht einmal ein Viertel der Größe von Elizas prunkvollem Schlafzimmer zu Hause hatte. Die Betten waren zwar großzügig mit dicken Kissen und Decken bestückt, aber doch ziemlich schmal. Sie waren in die Wände eingelassen, und darunter befand sich Stauraum, während rundum ein Geländer angebracht war, damit man im Schlaf nicht hinausfiel, wie sehr das Schiff auch schwanken mochte. Ihre Koffer waren an der Außenwand festgebunden und alles andere – Krug, Schüssel und Nachttopf – war in kleinen Teakholzfächern verstaut, die mit verschließbaren Riegeln versehen waren. Von einem Haken in der Mitte der Kassettendecke hing eine Messinglaterne, flankiert von zwei Glasprismen, die Licht hereinließen, was allerdings bei diesem Regen nicht allzu viel war.
»Soll ich auspacken, Miss Eliza?« fragte Clothilde.
Dem Himmel sei Dank für Clothilde, dachte Eliza und lächelte ihre stämmige Zofe an. Mit ihrem gesunden Menschenverstand und ihrer übersprudelnd guten Laune, mit der sie alle aufheiterte, konnte ihnen nichts passieren. »Wenn du möchtest. Aber nicht alles. Nachthemden, ein paar Tageskleider. Oh, und meinen Block und meine Stifte. Ich würde gern ein paar Skizzen machen, wenn das Wetter besser wird.« Aber das Wetter blieb ungemütlich und kalt. Sie nahmen ein leichtes Mittagessen in ihrer Kabine ein und dann das Dinner in dem engen Speiseraum des Kapitäns. Aubrey schmollte, und Robert schien verärgert über den Jungen. Um des lieben Friedens willen setzte Eliza Robert mit Clothilde zusammen und Agnes neben den Kapitän, so dass dieser sie unterhalten konnte. Sie setzte sich neben Aubrey.
»Wie ist deine Kabine?« fragte sie den Jungen. »Unsere ist klein, aber reizend und erstaunlich eingerichtet.«
»Zu klein«, murmelte er und schob seine Unterlippe vor. »Und sie stinkt.«
»Morgen werden wir auf dem Meer sein. Dort wird die Luft sauber und belebend sein.«
Aubrey sah nicht auf. Er schob seinen Lauch auf dem Teller mit der Gabel hin und her.
»Ich habe vor, morgen zu zeichnen. Werden wir tagsüber Dover passieren?« fragte sie den Kapitän.
»Ja, Miss. Die weißen Klippen werden steuerbord sein. Und sie bieten einen großartigen Anblick.«
Aubrey sah ebenfalls den Kapitän an, wenn sich auch sein Gesichtsausdruck nicht im Geringsten aufhellte. »Sind sie wirklich weiß?«
»Weiß wie Kalk, denn daraus bestehen sie«, antwortete Eliza. »Ich habe das gelesen«, fügte sie hinzu und sah den Kapitän schüchtern an.
»Das haben Sie richtig gelesen, denn sie sind so weiß, dass man kaum seinen Augen traut.«
»Vielleicht möchtest du auch ein paar Zeichnungen machen«, wandte sich Eliza wieder an Aubrey. »Ich habe haufenweise Papier und Stifte dabei. Du kannst dir so viel nehmen, wie du willst.«
»Nicht in diesem Stuhl.« Er stocherte wieder in seinem Gemüse.
»Also, Aubrey.« Cousine Agnes beugte sich vor und sah ihn eindringlich an. »Du weißt, was dein Vater gesagt hat. Jeden Tag eine erfrischende Runde über das Deck. Robert wird dich schieben ... «
»Nein!« Die Gabel knallte auf den Teller, und Lauch und Karotten flogen über den Tisch. »Nicht im Rollstuhl!« schrie der Junge. Sein Gesicht wurde rot, und seine Augen glitzerten und sahen verdächtig nach Tränen aus.
Eliza hasste Gefühlsausbrüche wie diesen. Ihr Herz klopfte dann laut, und ihr Atem ging zu schnell. Und doch erkannte sie, dass jemand einschreiten musste. Cousine Agnes wollte Sir Lloyds genaue Anweisungen ausführen, als wären sie zusammen mit den Zehn Geboten geschickt worden. Und Aubrey würde sie ebenso heftig bekämpfen, wie er zu Hause gegen seinen Vater rebellierte. Unglücklicherweise fiel es ihr zu, zwischen ihnen Frieden zu stiften.
»Wenn wir erst auf See sind, werden die unruhigen Bewegungen des Schiffes den Rollstuhl ein bisschen zu unsicher machen. Stimmt das nicht, Kapitän?«
Er hatte sich bei Aubreys Ausbruch in seinem Stuhl zurückgelehnt. Jetzt sah er sie an. »Das hängt natürlich vom Wellengang ab. Es könnte aber tatsächlich ein Problem sein. «
»Siehst du?« Eliza sah zwischen dem schmollenden Kind und der selbstgerechten Agnes hin und her. »Um sicherzugehen, wird Robert Aubrey tragen müssen — ich meine, Aubrey an Deck helfen und ihn in einen hübschen stabilen Stuhl setzen. Auf diese Weise werden Onkel Lloyds Wünsche ausgeführt, und Aubrey ist ebenfalls zufrieden. Damit bist du doch einverstanden, Aubrey, oder?«
»Ich möchte in meine Kabine«, antwortete er und weigerte sich, ihre Frage zu beantworten. »Jetzt«, fügte er hinzu und funkelte Robert wütend an.
So endete der Tag damit, dass alle mürrisch waren und sich unbehaglich fühlten. Aber als Eliza kurze Zeit später in dem ungewohnten Bett lag, schwor sie sich, dass es morgen besser würde. Sie musste Agnes von Aubrey fernhalten und den so sehr verhassten Rollstuhl außer Sichtweite bringen. Wieso war Onkel Lloyd der Meinung gewesen, seine pingelige alte Jungfer von Cousine wäre die richtige Begleitung für einen zehnjährigen Jungen?
Aber als sie endlich einschlief, träumte sie weder von ihrem jungen Cousin noch von sonst jemandem auf dem Schiff, sondern davon, dass ein großer starker Mann sie bei den Schultern fasste und sich hinunterbeugte, um sie zu küssen. Und in ihren Träumen lächelte sie und stellte sich auf die Zehenspitzen, um seinen Kuss zu erwidern.
»Deine Zeichnung ist genauso gut wie meine«, versicherte Eliza Aubrey.
»Ist sie nicht. Ich kann überhaupt nicht zeichnen.« Mit einem wütenden Aufschrei knüllte er das Papier zusammen und warf es fort. Es wurde von der frischen Seebrise erfasst und flog über die Reling in das aufgewühlte Wasser des Kanals. Zu ihrer Rechten verschwanden langsam die Klippen. Morgen würden sie die Kanalinseln erreichen, wo sie für eine Nacht in St. Peter Fort in Guernsey anlegen würden.
Aber obwohl ihre Reise gerade erst begonnen hatte, hegte Eliza Zweifel, ob sie auch nur einen weiteren Tag mit Aubrey ertragen würde. Er war äußerst sensibel und wütend auf die ganze Welt. Die geringste Provokation reichte schon aus, um seine sprunghafte Laune zu erregen, und dann mussten alle darunter leiden.
»Niemand zeichnet gleich beim ersten Versuch ein Meisterwerk«, stieß Eliza hervor und versuchte freundlich zu klingen, obwohl sie alles andere empfand. »Man braucht beachtliche Übung.«
»Ich will aber nicht üben!« Aubrey schwang sich auf dem Liegestuhl herum, in den Robert ihn gesetzt hatte, und stellte beide Füße auf den Boden. Bevor Eliza ihn aufhalten konnte, stand er aufrecht, und dann brach er mit einem Schmerzensschrei zu einem Häuflein Elend auf dem Deck zusammen.
»Aubrey! Aubrey!« Sofort kniete sie neben ihm. »Ist alles in Ordnung. Sag, dass alles gut ist. Oh, bitte.«
Zu ihrer Überraschung vergrub er sich in ihren Armen und brach in Tränen aus. Der schreckliche kleine Tyrann, der er wenige Minuten zuvor gewesen war, war verschwunden. Stattdessen war er ein verängstigtes Kind, verletzt und verwirrt, und schluchzte an ihrer Schulter. Sie zog ihn hoch und drückte einen Kuss auf seine dunklen Locken.
»Schhh, ganz ruhig, Schatz. Alles wird gut. Du wirst sehen.«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Es wird nie wieder gut. Ich werde immer ein Krüppel bleiben. Ein Krüppel! Ich werde nie wieder gehen oder reiten oder irgendetwas tun können!«
»Das ist nicht wahr, Aubrey. Es gibt eine Menge Dinge, die du tun kannst. Du musst dir nur mehr Zeit lassen und dich mehr anstrengen.«
»Aber ich kann nicht. Ich kann nicht«, schluchzte er.
»Doch, du kannst«, beschwor sie ihn und winkte den besorgten Robert fort. »Aber alles braucht Übung. Viele Stunden Übung.«
»Ich meine nicht das Zeichnen«, klagte er, zog sich von ihr zurück und wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht. »Zeichnen ist was für Mädchen – und für Memmen. Ich möchte so wie früher sein. Ich möchte gehen und laufen ...« Wieder brach er in herzzerreißendes Schluchzen aus, aber dieses Mal hielt Eliza ihn einfach fest, während er weinte. Was konnte sie sagen, um ihn zu trösten? Alle Versprechen, die sie machte, würden nichts als unbegründete Vermutungen und Hoffnungen sein, denn sie wusste nicht, ob er diese Dinge jemals wieder würde tun können.
Sie hatte diese Reise mit Aubrey angetreten, damit sie vor Michael fliehen konnte. Aubrey war nur der Vorwand gewesen. Aber seitdem war alles auf den Kopf gestellt. Aubreys Not war viel schlimmer als ihre. Und was Michael betraf ... sie war immer noch von Ehrfurcht ergriffen, aber sie begann auch zu glauben, dass er sich etwas aus ihr machte. Zumindest ein wenig. Die Ehe mit ihm war vielleicht gar nicht so schrecklich, wie sie immer gefürchtet hatte. Aber da war immer noch Aubrey und die nächsten sechs Monate, die sie überstehen musste.
»Jetzt hör mir mal zu, Aubrey Haberton. Ich denke, wir beide sollten einen Pakt schließen. Du wirst dich um mich kümmern und ich mich um dich.« Sie tupfte seine feuchten Wangen mit ihrem Spitzentaschentuch ab. »Für einen Teil des Tages sagen wir eine Stunde – bin ich vollkommen verantwortlich für deine Aktivitäten, und eine weitere Stunde musst du dich vollkommen um mich kümmern.«
»Was meinst du damit?« fragte er unsicher.
»Ich meine, dass wir jeder eine Stunde pro Tag haben, in der der andere das tun muss, was wir für das Beste für seine Genesung halten.«
Er dachte einen Moment nach. »Was ist los mit dir? Du siehst nicht krank aus.«
Ja, was eigentlich? Es war ein solcher Teil ihrer Existenz, dass sie es oft vergaß. »Ich habe eine Krankheit, die man Asthma nennt. Es war noch viel schlimmer, als ich in deinem Alter war. Aber mein Arzt hat mir geraten, immer sehr vorsichtig zu sein und mich niemals zu überanstrengen. Wenn ich zu tief atme, ist das überhaupt nicht gut für mich.«
»Warum?«
Eliza zuckte die Schultern. »Meine Lunge ist schwach. Ich bin damit geboren worden. Als ich noch jünger war, hat sie manchmal ganz aufgehört zu arbeiten. Dann bin ich ohnmächtig geworden und blau angelaufen.«
»Blau?« Er sah sie zweifelnd an.
»Nun, zumindest haben LeClere und Perry mir das erzählt.«
»Wird dir das auf dieser Reise passieren?«
Sie lächelte über seinen neugierigen, hoffnungsvollen Tonfall. »Ich glaube nicht. Tatsächlich habe ich einen richtigen Anfall dieser Art schon seit ... lass mich überlegen ... seit vier Jahren nicht mehr gehabt. Also, haben wir eine Abmachung?« fragte sie, um wieder auf ihre ursprüngliche Idee zurückzukommen.
Er seufzte tief, sah aber schon viel fröhlicher aus als zuvor. »Oh, ich glaube schon. Es ist ja nur eine Stunde. Und außerdem kann man sowieso nicht viel anderes machen.«
Gemeinsam gelang es ihnen, ihn wieder auf seinen Stuhl zu manövrieren, und gerade noch rechtzeitig, bevor Agnes auf das Deck kam. Sie keuchte wegen der kurzen steilen Treppe, die sie heraufgekommen war. »Aubrey braucht seine Medizin«, verkündete sie und zog eine braune Flasche aus ihrer Tasche. »Und es ist Zeit für ihn, sich auszuruhen.«
Eliza legte Aubrey warnend eine Hand auf den Arm, damit er die ältere Frau nicht anschnauzte. »Gib mir die Medizin, Agnes. Ich werde dafür sorgen, dass er sie nimmt. Wir sind gerade mitten in einer ... Geographiestunde«, flunkerte sie. Bloß keine neue Auseinandersetzung.
Zu ihrer Erleichterung gab Agnes ihr die Flasche ohne Widerrede. Dann griff die Frau nach der nächsten Reling, als das Schiff sich ein wenig steiler als gewöhnlich stellte. »Oje, oje«, murmelte sie. »Es geht mir gar nicht gut. Überhaupt nicht gut.«
Ihr Gesicht war blass. Beinahe grün. Eliza gab Robert ein Zeichen, und er führte die Frau zurück in ihre Kabine. Die arme Agnes, sie musste seekrank sein. Aber Elizas Mitgefühl wurde durch johlendes Gelächter unterbrochen.
»Sie ist seekrank«, rief Aubrey. »Welch ein Glück! Sie kann mich nicht mehr rumkommandieren!«
Eliza musste ein Kichern unterdrücken. Es war eigentlich gar nicht komisch, aber auf der anderen Seite war Agnes ziemlich spießig. Aubrey hatte recht. Sie hatten Glück.
Eliza räusperte sich. »Sie kann dich vielleicht nicht rumkommandieren. Aber ich habe das für die kommende Stunde vor.«
Am nächsten Tag näherte sich die Sonne im Westen gerade dem Meer, als sie in St. Peter Port auf Guernsey festmachten. Obwohl es eine der Kanalinseln war und immer noch gute englische Erde, war England außer Sichtweite. Stattdessen hatten sie' früher am Nachmittag die französische Küste gesehen, und als Eliza jetzt das Dorf am Ufer der Insel betrachtete, wirkte es doch ziemlich fremdländisch. Eher französisch als englisch, fand sie.
»Du hältst deinen Atem nicht an«, beschuldigte Aubrey sie und lenkte damit ihre Aufmerksamkeit von dem faszinierenden Anblick getünchter Häuser, Ziegeldächer und gepflasterter Straßen ab. »Ich bin dran. Schon vergessen?«
»Ist deine Stunde nicht fast vorbei?« fragte sie hoffnungsvoll. Aubrey hatte ihren Vorschlag ernster genommen, als sie erwartet hatte. Er hatte in den vergangenen beiden Tagen hart an jeder Aufgabe gearbeitet, die sie ihm gestellt hatte: die Baluster der Seitenreling zählen, indem er mit seinen Zehen darauf zeigte; ein Lied singen und dabei mit seinem verletzten Fuß ein imaginäres Orchester dirigieren. Er hatte sie nach nur kurzem Protest einen Blick auf seinen schlecht verheilten Knöchel werfen lassen, und er hatte all ihre Fragen beantwortet, wo es am stärksten schmerzte, was er spüren konnte und was nicht.
Aber schließlich hatte ihre Stunde für den heutigen Tag geendet und seine begonnen. Es schien, dass er sie viel länger als nur sechzig Minuten lang singen und pusten und immer wieder die Luft anhalten ließ. Ein- oder zweimal war ihr sogar schwindlig geworden.
»Nur noch einmal«, forderte Aubrey. »Ich werde stoppen, wie lange du die Luft anhalten kannst, und dann hören wir auf.«
Gehorsam atmete sie tief ein und hielt dann die Luft an, während er langsam und gleichmäßig zählte. Bei dreißig wollte sie aufhören. Bei vierzig schielte sie, und er begann zu lachen. Aber trotz seines Kicherns zählte er weiter. Bei fünfzig jedoch keuchte sie.
»Genug! Genug. Ich kann nicht länger als fünfzig. Da bin ich sicher.«