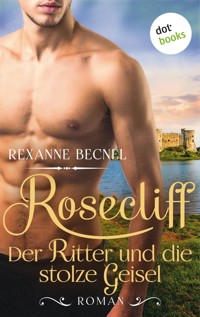Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie sollte sein Herz bändigen – und entflammte es auf ewig: »Die Sehnsucht des Lords« von Romance-Königin Rexanne Becnel jetzt als eBook bei dotbooks. England, im 19. Jahrhundert. Die schöne Lucy Drysdale wird als Anstandsdame für eine junge Lady nach London eingeladen. Dort macht sie die Bekanntschaft des unverschämt gutaussehenden, aber auch berüchtigten Grafen Ivan Westcott. Vor seinem gefährlichen Charme ist keine Frau sicher – und gerade deshalb muss Lucy ihn von ihrem Schützling ganz besonders fernhalten. Gegen ihren Willen kommt sie ihm dabei viel zu nahe – und plötzlich muss sie um ihr eigenes Herz fürchten. Doch könnte es sein, dass sich hinter Ivans Fassade gar kein Frauenheld, sondern ein Mann verbirgt, der zu wahren, tiefen Gefühlen fähig ist – und der zum ersten Mal lernt, was es heißt, für die Liebe einer Frau kämpfen zu müssen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Regency-Roman »Die Sehnsucht des Lords« von der Bestsellerautorin historischer Liebesromane, Rexanne Becnel. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England, im 19. Jahrhundert. Die schöne Lucy Drysdale wird als Anstandsdame für eine junge Lady nach London eingeladen. Dort macht sie die Bekanntschaft des unverschämt gutaussehenden, aber auch berüchtigten Grafen Ivan Westcott. Vor seinem gefährlichen Charme ist keine Frau sicher – und gerade deshalb muss Lucy ihn von ihrem Schützling ganz besonders fernhalten. Gegen ihren Willen kommt sie ihm dabei viel zu nahe – und plötzlich muss sie um ihr eigenes Herz fürchten. Doch könnte es sein, dass sich hinter Ivans Fassade gar kein Frauenheld, sondern ein Mann verbirgt, der zu wahren, tiefen Gefühlen fähig ist – und der zum ersten Mal lernt, was es heißt, für die Liebe einer Frau kämpfen zu müssen?
Über die Autorin:
Rexanne Becnel ist gefeierte Autorin zahlreicher historischer Liebesromane. Während mehrerer Aufenthalte in Deutschland und England in ihrer Jugend begeisterte sie sich so sehr für mittelalterliche Geschichte, dass sie Architektur studierte und sich für den Denkmalschutz mittelalterlicher Gebäude einsetzt. In ihren Bestseller-Romanen haucht sie der Geschichte auf ganz andere Art neues Leben ein. Sie lebt glücklich verheiratet in New Orleans.
Bei dotbooks erschienen bereits folgende eBooks:
»Das Herz des Lords«
»Das Verlangen des Ritters«
»Der Pirat und die Lady«
»Das wilde Herz des Ritters«
»Ein ungezähmter Gentleman«
»In den Armen des Edelmanns«
»Rosecliff – Der Ritter und die zarte Lady«
»Rosecliff – Der Ritter und die schöne Rächerin«
»Rosecliff – Der Ritter und die stolze Geisel«
»Gefangen – Die Rosecliff-Saga in einem Band«
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe November 2020
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Dangerous to Love« bei St Martin’s Press, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Spiel der Sehnsucht« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1997 by Rexanne Becnel
Published by Arrangement with Rexanne Becnel
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Vewendung von shutterstock/Elzbieta Sekowska, dherrmann79, mpashakotcur, ArtOfPhotos
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96148-158-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Sehnsucht des Lords« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Rexanne Becnel
Die Sehnsucht des Lords
Roman
Aus dem Amerikanischen von Lydia Nahas
dotbooks.
Für RichOscar Richard Becnel, Jr.1973 – 1997und für Sara,die ihn so glücklich machte.
Prolog
Burford Hall, Yorkshire, November 1807
Die Schulleiterin, Mrs. Drinkwell, starrte den Jungen mit gerümpfter Nase an. »Der ist aber ziemlich dunkel.«
Die Gouvernante umklammerte seine knochige Schulter mit hartem Griff. »Zigeunerblut, von seiner Mutter her«, erklärte sie mißbilligend.
Mrs. Drinkwell war keineswegs erstaunt, denn das Internat ›Burford Hall‹ beherbergte eine nicht geringe Zahl von Jungen dubioser Herkunft. Da die Schule ziemlich weit von London entfernt und außerdem recht isoliert lag, nutzte so mancher Edelmann sie gerne, um seine unehelichen Kinder dort unterzubringen. Ein Zigeunerbastard jedoch war ihr bisher noch nie zur Erziehung anvertraut worden.
Mrs. Drinkwell schürzte verächtlich die Lippen. Es ging ihr einfach gegen den Strich, mit welch gewöhnlichen Frauen die Herren der Gesellschaft sich oft einließen.
»Haben Sie die Gebühr für das erste Jahr dabei?« fragte sie. »Wir gewähren grundsätzlich keinen Kredit, nicht einmal dem Bastard des Königs.«
Die Augen der Gouvernante leuchteten auf. »Sie haben einen königlichen Bastard hier? Ihre Ladyschaft wird erfreut sein, das zu hören. Sehr erfreut sogar.«
Mrs. Drinkwell lächelte verkniffen. »Ach, die Dame weiß von dem Fehltritt ihres Gatten?«
Die Gouvernante verstärkte ihren Griff um die Schulter des Jungen. »Nein! Und Sie werden ihr auch nichts mitteilen, wenn Sie Wert darauf legen, daß die Gräfinwitwe Ihre horrenden Gebühren – Au!« Sie unterbrach sich mit einem spitzen Aufschrei. »Oh! Der freche Lausebengel hat mich gebissen! Gebissen hat er mich!« zeterte sie und schüttelte dabei die verletzte Hand, als wollte sie das schmerzende Glied von sich schleudern.
Während sie vor sich hinjammerte, flitzte der dunkelhaarige Knabe zur Tür. Mrs. Drinkwell aber, die seit Jahren im Umgang mit aufsässigen Jungen geübt war, kannte jeden Trick. Sie war vor ihm an der Tür, und als er versuchte, seine Zähne auch an ihr auszuprobieren, schlug sie ihn mitten ins Gesicht.
Sie war eine große, starke Frau, und daß der Junge klein und schmächtig war, kümmerte sie nicht. Der Schlag warf seinen Kopf nach hinten gegen die Wand, daß es nur so krachte. Wie eine zerbrochene Puppe fiel das Kind zu Boden und rührte sich nicht mehr.
Die Gouvernante starrte auf die reglose Gestalt. »Bei allen Heiligen!« murmelte sie und bückte sich zu dem Kind hinab. »Er wird doch nicht tot sein? Sie haben ihn doch nicht getötet? Denn wenn Sie es getan haben …
Anstatt einer Antwort stupste Mrs. Drinkwell den Jungen mit dem Fuß. Als das keine Reaktion hervorrief, trat sie ihm gegen das Schienbein. Das Kind wimmerte, und Mrs. Drinkwell warf der Gouvernante einen triumphierenden Blick zu. »Sie brauchen mir keineswegs Ratschläge zu erteilen, wie ich meine eigene Schule zu führen habe. Die Herstellung von Zucht und Ordnung ist mein Spezialgebiet. Eines kann ich Ihnen versprechen: Wenn Ihre Herrin ihren Enkel wiedersieht, wird er vorzügliche Manieren haben. Und nun geben Sie mir bitte das Geld.«
Die Gouvernante öffnete ihren Beutel und reichte der Schulleiterin eine Börse. »Ich soll Ihnen sagen, daß Sie ihn auch in den Ferien dabehalten sollen. Hier ist genug Geld, und Myladys Anwalt wird Ihnen noch mehr anweisen.«
»Sie will sich wohl nicht mit ihm abgeben, wie?«
»Kann man ihr daraus einen Vorwurf machen?« Die Gouvernante ging zur Tür. »Wie würde es Ihnen gefallen, wenn Ihr einziger Enkel ein heidnischer Zigeuner wäre? Er kann von Glück sagen, daß seine Großmutter reich genug ist, um für seine Erziehung aufzukommen.«
»Mein Name ist Ivan!«
»Nein, du heißt John!« höhnte der große Junge.
»Johnnyboy!« rief ein anderer.
Ivan betrachtete die drei, die ihn in eine Ecke gedrängt hatten, und versuchte, seine Furcht nicht zu zeigen. Aber das war schwierig. Er wollte nicht an diesem gräßlichen Ort sein, weit weg von allem, was er kannte. Und nun sollte er sogar seinen Namen ändern. Doch das würde er auf keinen Fall tun, obwohl er selbst nicht genau wußte, weshalb. Er war Ivan und nicht John. Alles in seinem Leben hatten sie verändert, doch seinen Namen würde er nicht hergeben.
»Ich bleibe dabei, mein Name ist Ivan!«
Der größte seiner drei Kontrahenten grinste. »Ivan? Das ist ein ausländischer Name, ein Zigeunername. Bist du ein Zigeuner, Ivan?« fragte er verächtlich.
Ivan hob den Kopf und ballte die Fäuste. Wenn sie einen Kampf wollten, so konnten sie ihn haben. Er versuchte sich alles ins Gedächtnis zu rufen, was Peta ihm beigebracht, und die Griffe, die Guerdon in seinen Ringkämpfen angewandt hatte.
Der Große kam noch näher. Seine beiden Trabanten folgten ihm. »Also – bist du John oder bist du Ivan, der Zigeunerbastard?« fragte er drohend.
Etwas in Ivan zerriß, und ohne Vorwarnung warf er sich auf seinen Gegner. Er war zwar klein, hatte aber das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Beide gingen, Fußtritte und Faustschläge austeilend, zu Boden, doch bald hatte der größere Junge die Oberhand gewonnen.
Ivan wollte jedoch nicht nachgeben. Man hatte ihn seiner Mutter und deren Sippe brutal geraubt, ihn auf dem Dachboden eines riesigen Hauses eingesperrt und ihn danach in diese gefängnisartige Erziehungsanstalt verbracht. Und hier wurde er ständig von Jungen wie diesen angegriffen und verspottet. Das war einfach, zuviel, das konnte er nicht ertragen. Also biß und zwickte er trotz der erbarmungslosen Schläge, die er einstecken mußte.
Ein Hieb spaltete seine Lippe, ein weiterer ließ Sterne vor seinen Augen tanzen. Doch all das steigerte nur seine Entschlossenheit. Verwirre deinen Gegner, finde seine Schwächen heraus. Petas Ratschläge klangen in Ivan Ohren. Er brüllte seine Wut hinaus, und dann, wie durch ein Wunder, schaffte er es, mit dem Knie nach oben zu stoßen. Kreischend und seine empfindlichste Stelle haltend, klappte der andere Junge zusammen.
»Zeigt es ihm«, schluchzte er, »schnappt ihn euch!«
Die zwei anderen zögerten nur einen Moment, bevor sie sich auf Ivan stürzten. Seine Niederlage war unvermeidlich, doch noch immer gab er nicht auf. Erst die Schulleiterin und ihr Lohndiener konnten den ungleichen Kampf beenden.
Mrs. Drinkwell befrachtete die blutbesudelten Jungen, und ihre farblosen Augen verengten sich vor bösartigem Vergnügen zu schmalen Schlitzen. »Bringen Sie Mr. Dameron zur Holzhütte!« befahl sie. »Es gehört sich, daß der Sohn eines Kaufmanns etwas Ordentliches lernt. Also züchtigen Sie ihn mit dem Riemen und lassen ihn danach Holz hacken. – Mr. Pierce wird das Vergnügen haben, die Toiletten zu reinigen, selbstverständlich erst, nachdem auch er gründlich gezüchtigt wurde. Eine gute Kombination: Schmutz, der von Abschaum beseitigt wird …«
Ihre Nasenflügel blähten sich vor Abscheu.
Dann wandte sie sich an den großen Jungen. Zu Ivans Erstaunen nahm ihr Gesicht einen freundlicheren Ausdruck an. »Alexander, Alexander. Was soll ich nur mit dir anfangen? Siehst du denn nicht ein, daß es unter deiner Würde ist, dich mit einer so niederen Kreatur wie einem Zigeunerbastard einzulassen? Trotzdem mußt du bestraft werden. Also, bis nächsten Sonntag darfst du das Schulgebäude nicht verlassen und bekommst außerdem zusätzliche Schulaufgaben. Ich hoffe, daß dein Vater es anerkennt, daß ich sogar dann um deine Bildung bemüht bin, wenn ich dich strafe.«
Als sie sich endlich Ivan zuwandte, verfinsterten sich ihre Gesichtszüge. »Was dich angeht, so erhältst auch du eine Strafe, die zu dir paßt.« Sie lächelte ein Lächeln, das dem Jungen das Blut in den Adern gefrieren ließ.
»Sehen Sie zu, Lester, daß er am ausgiebigsten gezüchtigt wird. Und danach ziehen Sie ihn den Schornstein hinauf. Bei seiner dunklen Haut wird ein bißchen Ruß gar nicht auffallen.«
Obwohl er blutete und benommen war, wehrte sich Ivan gegen den bulligen Diener. Er versuchte sogar, ihm einen Schlag in die Weichteile zu verpassen, wie er es bei Alexander getan hatte. Aber es brachte ihm nichts weiter ein als eine harte Kopfnuß und einen zermalmenden Griff um die Schulter.
Die Schläge waren schrecklich – zehn Hiebe mit einem fürchterlich langen Paddel. Doch inzwischen empfand Ivan die Schmerzen kaum noch. Weder jammerte noch schrie er, nur ein leises Stöhnen kam zwischen seinen Lippen hervor. Hätte der Mann ihn nicht mit seiner fleischigen Hand festgehalten, wäre er zusammengebrochen. Dann wurde er in den Salon gebracht, und man schob ihn in den Kamin und den Schornstein hinauf, wo er in dem fettigen Ruß krabbelte und zappelte und bei jeder Bewegung Hautfetzen und Blut auf dem rauhen Mauerwerk zurückließ.
»Mach den Schornstein schön sauber, Junge! Und beeil' dich, sonst zünde ich dir ein Feuer unter dem Hintern an«, grinste der Hausknecht hinter ihm her.
Doch es brannte schon ein Feuer, und zwar tief in Ivans Herzen, und bei jedem grausamen Wort, jedem schmerzhaften Schlag und jeder böswilligen Bestrafung loderte es heißer. Es begann an diesem Tag zu brennen, und dieses Brennen wurde stärker mit jeder Ungerechtigkeit, die ihm in den folgenden Monaten und Jahren zugefügt wurde. Es verzehrte ihn mit unbeschreiblicher Macht und schrie nach Vergeltung.
Zu jener Zeit wußte er noch nicht, wie oder an wem er sich rächen konnte, doch der Tag sollte kommen, an dem der Weg zur Vergeltung klar vor ihm lag.
Kapitel 1
London, März 1829
Ivan Thornton hielt kurz inne, bevor er die Treppe hinaufstieg. Gleich würde es beginnen. Und richtig, ein Raunen ging durch die Menschenansammlung im Ballsaal – zuerst eine kurze Pause in den Gesprächen, dann setzte ein eifriges Tuscheln ein.
»Das ist Lord Westcott.«
»Der neue Graf von Westcott.«
»Westcotts Zigeunerbastard.«
Ivan brauchte die Worte nicht zu hören, um zu wissen, was gesagt wurde. Seit mehr als zwanzig Jahren mußte er sich das anhören, und Schlimmeres als das. Seit er als Siebenjähriger den Armen seiner Mutter entrissen worden war, hatte er gelernt, sich gegen seine Peiniger zur Wehr zu setzen. Und seither hatte er sich in einem ständigen Kampf befunden.
Doch er hatte inzwischen auch gelernt, daß es bessere Methoden gab, als sich mit Fäusten, Degen oder Pistolen für das zu rächen, was sie ihm angetan hatten, diese Esel, die sich für das Salz der Erde hielten.
Gelangweilt ließ er, ganz der reiche, junge Lord, seinen Blick nachlässig durch den Raum schweifen, wobei ihm nicht die kleinste Einzelheit entging. Die älteren Männer begannen bereits, sich zum Spielzimmer mit seinem unerschöpflichen Vorrat an Brandy und Zigarren zurückzuziehen. Die Matronen und Anstandsdamen säumten in Grüppchen den Rand des Ballsaals und hatten ein wachsames Auge auf ihre Schutzbefohlenen, während sie unermüdlich über Kleider, Frisuren, Geld oder Titel der Tänzer und Tänzerinnen schwatzten.
Auch die Objekte ihrer Wachsamkeit, unschuldige, weißgekleidete Mädchen, die in dieser Saison zum ersten Mal in der Gesellschaft erschienen, standen in kleinen Gruppen beieinander. Sie hatten ausgiebig gekichert, mit ihren Fächern gewedelt und mit den anwesenden Jünglingen geflirtet, doch nun starrten sie mit großen Augen auf Ivan.
Der bezwang den Wunsch, sie anzufauchen und die ganze Schar dummer Gänschen hilfesuchend in die Arme ihrer Mütter zu scheuchen.
Beherrsche dich. Endlich lag die Vergeltung in Reichweite. Er wollte sich nicht alles wegen einiger herausgeputzter, ungezogener Gören verderben. Bevor diese Saison vorüber war, würde jede von ihnen schmachtend zu seinen Füßen liegen. Jede Mutter und jeder Vater sollten danach lechzen, die eigene Familie mit dem Namen Westcott zu vereinen.
Und er würde endlich die Möglichkeit haben, sich an seiner herzlosen Großmutter zu rächen.
»Nun, Westcott, hättest du dir träumen lassen, daß du eines Tages der beachtetste Junggeselle von ganz London sein würdest?« Elliot Pierce gab Ivan einen kräftigen Stoß in die Rippen. »Los, Mann, laß dich vom Haushofmeister ankündigen! Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, wild zu spielen, viel zu trinken und mindestens zwei Hausmädchen zu verführen.«
Ohne zu antworten trat Ivan vor.
»Ivan Thornton, Graf von Westcott, Viscount Seaforth, Baron Turner«, rief der hochnäsige Bedienstete mit tönender Stimme.
Sogar die Diener verachten mich, dachte Ivan. Doch das machte ihm schon seit Jahren nichts mehr aus. Und inzwischen besaß er Titel und genügend Geld, um Herren und Diener nach seiner Pfeife tanzen zu lassen.
Er zupfte an seinen Manschetten und schritt dann fünf breite, teppichbedeckte Stufen hinab auf sein Schlachtfeld. Nach ihm wurden seine drei besten Freunde angekündigt. Seine einzigen Freunde.
Mister Elliot Pierce und Mister Giles Dameron wurden von der neugierigen Menge, die sich bei dieser Abendgesellschaft versammelt hatte, wenig beachtet. Als jedoch Mister Alexander Blackburns Name ausgerufen wurde, begann das Geraune von neuem.
Ein Bastard-Graf und ein Bastard-Prinz – der Graf im Besitz seiner Titel und unermeßlicher Reichtümer, der Prinz verleugnet und arm wie eine Kirchenmaus. Doch jedermann wußte, daß sich das schnell ändern konnte, wenn der König starb.
Man schloß, daß auch ihre beiden unbekannten Begleiter Bastarde sein mußten, denn alle kamen aus Burford Hall, der Schule, die überall unter dem Namen Bastard Hall geläufig war.
Ob man im Publikum erschreckt oder fasziniert war, abgestoßen von der zweifelhaften Herkunft des jungen Grafen oder angezogen von seinem Reichtum – über eines waren sich alle, die den Einzug der vier jungen Herren beobachteten, einig: Diese Saison würde nicht langweilig werden, o, nein, keinesfalls.
Davon war niemand so überzeugt wie Lady Antonia Thornton, Gräfinwitwe von Westcott, Großmutter des neuen Grafen und Urheberin der ganzen Geschichte.
Sie war noch lange nicht willens, ihre Pläne als fehlgeschlagen zu betrachten. Schließlich war Ivan vor drei Monaten zur Übernahme der Titel erschienen. Nachdem er die Schule in Burford Hall beendet hatte und zur weiteren Vervollkommnung seiner Bildung auf den Kontinent geschickt worden war, hatte er es strikt abgelehnt, die Titel seines Vaters anzunehmen, sollte dieser sterben. Doch er hatte sie angenommen, als es soweit war, genauso, wie Lady Antonia es vorausgesehen hatte. Wer hätte schließlich den Titeln und dem damit einhergehenden Reichtum widerstehen können? Diese Schlacht hatte sie für sich entschieden. Sie war der festen Überzeugung, auch die nächste gewinnen zu können, denn die begehrenswertesten jungen Damen, die in dieser Saison debütierten, waren hier zugegen. Ivan sollte heiraten, und zwar bald, denn sie wollte die Geburt ihres ersten Urenkels noch erleben. Erst dann wäre ihr Ziel erreicht.
»Das ist also der Junge«, sagte eine Stimme hinter ihr. Antonia wandte die Augen nicht von ihrem Enkel ab. »Du hast ihn früher schon gesehen, Laurence.«
»Ja, aber da war er noch viel jünger und zorniger. Damals wollte er lieber Straßenfeger werden, als das Familienerbe anzutreten, und ich muß sagen, daß ich ihm geglaubt habe.«
»Das ist zehn Jahre her. Jetzt ist er älter und klüger. Und sein Vater ist tot. Aber laß dich von seinem respektierlichen Aussehen nicht täuschen, das verdankt er lediglich den Talenten seines Schneiders und seines Barbiers – die er völlig übertrieben bezahlt, wie man mir sagte. Unter dieser hübschen Fassade schlägt das Herz eines zornigen Wilden.«
Laurence Caldridge, Graf von Dunleith, der vier Frauen und sechs Kinder überlebt hatte, betrachtete von der Seite Antonias ausgeprägtes Profil und verstand gar nichts. »Weshalb erkennst du ihn als Jeromes Sohn an, wenn du ihn für einen Wilden hältst? Warum hast du ihm den Titel überlassen? Du hättest ihn genausogut deinem Neffen …«
»Weil ich den Titel lieber bei einem Straßenfeger sähe als bei einem von Harolds stumpfsinnigen Abkömmlingen«, gab sie zurück. »Und das weißt du. Also hör auf, herumzustehen und mir unsinnige Ratschläge zu erteilen. Hol mir lieber ein Glas Punsch. – Oder nein, ich habe eine bessere Idee. Geh hin zu Ivan und führe ihn herum. Stell ihn der Gräfin Grayer, der Herzogin von Whetham und der Viscountess Talbert vor. Zusammen haben sie sieben Töchter, dazu Enkelinnen und Nichten, die allesamt keine schlechten Partien wären.«
Mit einer Handbewegung entließ sie ihren Freund. »Los, Laurence, stell ihn allen vor, die ihn noch nicht kennen. Ich werde inzwischen überlegen, wie ich in Zukunft am besten mit meinem sturen Enkelsohn verfahren werde.«
Brummend und kopfschüttelnd machte Laurence sich davon. Doch Antonia wußte, daß er tun würde, was sie ihm aufgetragen hatte. Bei ihrem Enkel konnte sie da allerdings nicht so sicher sein. Sie betrachtete ihn aus der Ferne und stellte wieder einmal fest, wie gut er aussah mit seinem rabenschwarzen Haar und der zigeunerhaft dunklen Haut. Und dazu besaß er die Keckheit, einen auffallenden Ohrring zu tragen.
In gewisser Weise konnte sie ihm ihre Bewunderung nicht versagen. Eines war sicher: Er besaß die Arroganz eines Grafen. Leider besaß er aber auch die unverhüllte Anziehungskraft, die der verabscheuungswürdigen Rasse seiner Mutter zu eigen war.
Antonia fragte sich, ob Ivan wohl zu ihr herüberkommen und sie begrüßen würde. Schließlich war sie seine einzige nähere Verwandte, die Frau, die ihn aus den Klauen der Heiden erlöst und ihm ein Geburtsrecht eingeräumt hatte, das keinen Vergleich im Königreich zu scheuen brauchte.
Sie beobachtete, wie er Laurence begrüßte – nicht übertrieben höflich, aber auch nicht unfreundlich. Sie studierte jede Nuance seines Benehmens, als er Lady Fordham vorgestellt wurde: wie er sich verbeugte, wie lang er ihre behandschuhte Hand in der seinen hielt und wie er mit ihr sprach. Als Lady Fordham über eine Bemerkung von Laurence lächelte, runzelte Ivan die Stirn. Er war mehr als gutaussehend, stellte Antonia fest. Zum ersten Mal fiel ihr auf, wie sehr er seinem Großvater ähnelte.
Bis auf die eisblauen Augen, die er von ihr hatte, hatte sie an dem Jungen bisher noch nie eine Familienähnlichkeit bemerkt. Er war für sie immer nur ein abscheulicher Zigeunerbengel gewesen. Doch nun weckte sein Lächeln, die Krümmung seines Mundes und das Blitzen seiner ebenmäßigen Zähne eine Erinnerung an ihren Mann Gerald. Dreißig Jahre war es nun her, daß er von ihr gegangen war. Seitdem hatte sie sich alleine um alles kümmern müssen, was mit Titel und Besitz der Westcotts zusammenhing. Wie er ihr fehlte! Ihr einziges Kind, Jerome, war geschäftlich völlig untauglich gewesen. Schlimmer, er hatte außer diesem Bastard nicht einmal einen Erben hinterlassen. Nun konnte sie nur noch beten, daß Ivan aufgrund der Erziehung, die sie ihm hatte zuteil werden lassen, seinen Verpflichtungen gewachsen war.
Als Laurence zurückkam, war Lady Westcott erschöpft vom angespannten Beobachten. Ivan tanzte gerade mit der jüngsten Tochter der Feltons, einem üppigen Rotschopf, recht hübsch, aber viel zu albern,, um eine Gräfin zu werden.
»Nun, wird er kommen und mich begrüßen?« fragte Antonia.
Laurence räusperte sich und fischte erfolglos in seinen Taschen nach seiner Schnupftabaksdose. Er zupfte an seinem dichten Backenbart. »Das hat er nicht gesagt. Aber ich glaube, er wird kommen, Toni. Schließlich hat er dich seit der Titeleinsetzung im Januar nicht mehr gesehen.«
Erst lange nach Mitternacht kam der unausstehliche Kerl auf sie zu. Normalerweise hätte sie die Gesellschaft schon längst verlassen. Doch sie wollte unbedingt so lange bleiben, bis er sie begrüßt hatte. Keinesfalls konnte sie zu ihm hingehen. Also mußte sie warten, bis er sich zu ihr bequemte, denn sonst hätten alle Anwesenden bemerkt, daß Ivan sie schnitt.
Als er endlich auf die Couch zusteuerte, auf der sie mit Laurence und Lady Fordham saß, nahm sie sich vor, ihn ordentlich abzukanzeln. Wie konnte er es wagen, sie so zu behandeln!
Doch ein Blick in seine eisigen Augen belehrte sie eines Besseren. Er suchte Streit, und zwar einen öffentlichen Streit mit ihr; das drückten die Kälte seiner Augen und die Anspannung seiner breiten Schultern deutlich aus.
Genau wie bei Gerald, kam es ihr flüchtig in den Sinn. Sie hatte ihren Mann abgöttisch geliebt; trotzdem hatten sie immer gestritten wie Hund und Katze, sich dabei aber gut verstanden. Vielleicht konnten sie und der Junge – nein, er war jetzt ein Mann – auf einer solchen Ebene gleichfalls zu einem besseren Auskommen gelangen.
»Madam.« Ivan verbeugte sich kurz vor Antonia. »Darf ich Ihnen meine Begleiter vorstellen?« Er deutete auf die drei Männer, die neben ihm standen. »Mr. Elliot Pierce, Mr. Giles Dameron, Mr. Alexander Blackburn.«
Gegen die Manieren der drei Vorgestellten ließ sich. nichts einwenden. Antonia betrachtete Blackburn eingehend und versuchte, etwas zu entdecken, was auf sein königliches Blut hindeutete. Den König bekam man dieser Tage selten zu Gesicht, obwohl er in jüngeren Jahren dem gesellschaftlichen Treiben ausgiebig gefrönt hatte.
»Es heißt, ich hätte seine Augen und sein Haar«, antwortete Blackburn grinsend auf ihre unausgesprochene Frage. Er hatte zwar geflüstert, dies allerdings mit Absicht laut genug, daß alle Umstehenden ihn hören konnten.
Antonias Augen verengten sich. »Tatsächlich? Und ich hatte gedacht, es wäre vor allem Ihr Vorwitz, der von der Verwandtschaft zeugt.«
Blackburns Grinsen wurde noch vergnügter. »Endlich! Eine Dame, die den Wahnsinn in meinen Augen erkennt und doch nicht erschrocken fortschaut.« Er ließ sich auf ein Knie fallen und preßte seine Hände auf sein Herz. »Geben Sie mir Ihr Jawort, Lady Westcott, denn Sie sind es, nach der ich so lange, einsame Jahre gesucht habe.«
Laurence wollte sich wütend erheben, doch Lady Antonia hielt ihn zurück. Sie schnitt dem Bastardenkel des verrückten Königs George eine Grimasse. »Stehen Sie auf, Sie Narr, bevor ich Ihren frechen Antrag annehme.«
Pierce und Dameron brachen in helles Lachen aus, Lady Fordham und Laurence kicherten nervös. Doch Ivan verzog nicht einmal seine Lippen. Lady Antonia wandte sich an seinen kecken Freund. »Ich bedaure es, daß mein Enkelsohn kein Quentchen Ihres Witzes besitzt, Mr. Blackburn.«
»Sein Mangel an Witz ist auch uns schon oft aufgefallen«, erwiderte Blackburn. Doch Antonia wartete auf eine Antwort von Ivan.
»Sie wünschen, daß ich witzig sei, Madam? Ich hatte immer geglaubt, es sei mein Gehorsam, den Sie wünschen, und meine Dankbarkeit, und mein Wille, ja mein ganzes Wesen. Und nun wollen Sie nur meinen Witz. Wenn ich mich bemühe, witzig zu sein, würden Sie sich dann auf Ihren Landsitz zurückziehen und mich in Frieden lassen?«
Lady Antonia starrte in Ivans Augen, die so beunruhigend ihren eigenen glichen. »Wenn dieser Witz mit guten Manieren und besseren Absichten einhergeht, ja, dann werde ich mich gerne aus deinem Leben zurückziehen.«
»Habe ich mich heute abend nicht vorzüglich benommen? Ich habe die Matronen bezaubert und mit ihren Töchtern getanzt.«
»Und beabsichtigst du, eine dieser Töchter zu heiraten?« fragte Antonia ihn geradeheraus.
Er erwiderte ihren Blick, und sie konnte darin nicht nur seine tiefe Abneigung ihr gegenüber erkennen, sondern noch etwas anderes. War es Triumph? Nein, das konnte nicht sein.
Ivan zuckte die Schultern. »Ich habe vor, eine von ihnen zu heiraten – falls ich eine finde, die mir zusagt.«
»Heißt das, daß du die Saison in der Stadt verbringen wirst?« fragte seine Großmutter gespannt und hoffte auf eine bejahende Antwort. In der Tat lief ihr die Zeit davon. Sie wollte ihn verheiratet und als Vater eines Erben sehen, ehe sie starb.
Ivan lächelte, und dieses Lächeln war keineswegs beruhigend. »Um nichts in der Welt würde ich diese Saison verpassen wollen.«
Kaum eine Stunde später unterhielten sie sich wieder, diesmal jedoch weit weniger formell. Sie waren separat nach Westcott House zurückgekehrt, und Ivan hatte seine Großmutter in dem riesigen Wohnraum zur Rede gestellt.
»Noch bin ich die Gräfinwitwe«, gab sie auf seine Anrede zurück, »du wirst es nicht wagen, mich aus meinem eigenen Haus zu werfen!«
Ivan blickte Lady Antonia gleichmütig an. Innerlich jedoch glühte er vor Wut. Wenn sie beabsichtigte, mit ihm unter einem Dach zu leben, so hatte sie sich gründlich getäuscht. Sollte sie sich in dem Glauben wiegen, ihr Leben würde weiterhin so einfach verlaufen wie bisher, so war sie schlichtweg eine Närrin.
Ivan schenkte ihr ein dünnes Lächeln. »Soweit ich weiß, bin ich der Erbe des Titels und daher auch der Besitzer dieses widerlichen Steinhaufens. Ich, nicht Sie. Der Familienbesitz gehört jetzt mir, und ich bin es, der alle Entscheidungen darüber trifft.«
Er wußte, daß sie das zum Schweigen bringen würde, denn die Verfügung über den Westcott-Titel und die dazugehörigen Güter war alles, was dieser kaltherzigen alten Frau etwas bedeutete. So tief sie Ivan auch verachtete, den Familienzweig ihres Schwagers verachtete sie noch tiefer. Solange Ivan keinen Sohn gezeugt hatte, blieb die Gefahr bestehen, daß einer ihrer schwachköpfigen Neffen den Besitz erbte oder daß Ivan ihn einem seiner Vettern übertrug. Diesen Gedanken konnte sie nicht ertragen. Noch weniger konnte sie die Tatsache ertragen, daß sie keine Macht mehr über Ivan besaß und demzufolge auch nicht mehr über den großen Familienbesitz gebot. Zwanzig Jahre hatte Ivan gewartet, um seine Großmutter seinem Willen zu unterwerfen.
Er verzog grimmig die Lippen, als er sah, wie sie ihren Zorn hinunterschluckte. Welch eine Ironie des Schicksals, daß er durch seine Heirat oder Nichtheirat Macht über ihr Leben besaß. Obwohl sein Vater sich an jede erreichbare Frau – außer seiner eigenen – herangemacht hatte, schien er doch nur ein einziges Kind gezeugt zu haben. Im Gegensatz zu seinem Vater hatte Ivan die feste Absicht, mit seiner Gunst sehr haushälterisch umzugehen, damit er sicherstellen konnte, keinen Erben zu hinterlassen, zumindest nicht, solange sie nicht unter der Erde war.
Trotzdem war ihm klar, daß er die alte Frau nicht völlig zum Schweigen bringen konnte. Wäre sie nicht so durch und durch berechnend, er hätte ihre Zähigkeit durchaus bewundern können. Sie hatte sowohl ihren Mann als auch ihren Sohn überlebt. Ihn, Ivan, jedoch würde sie keinesfalls überleben. Er würde letzten Endes über seine Großmutter triumphieren, und sei es nur dadurch, daß er ihrem Begräbnis beiwohnte.
»Westcott House ist wirklich groß genug für uns beide«, stellte Antonia in einem für sie versöhnlichen Ton fest.
»Ich halte mich zumeist in meinen eigenen Gemächern auf, die sich zudem im anderen Flügel befinden.«
»Sie werden sich im Landhaus wesentlich wohler fühlen«, unterbrach Ivan sie. »Ich lege nicht den geringsten Wert auf Ihre Anwesenheit, solange ich mich in der Stadt aufhalte.«
»Und was willst du tun? Mich hinauswerfen? Ich möchte mal sehen, wie du das anstellst.« Ihre knochigen Finger umklammerten den Kristallknauf des Gehstockes, während ihre blauen Augen in kaltem Feuer blitzten.
Doch Ivans Augen waren ebenso blau und eisig. »Ich werde hier während der Saison einen Junggesellenhaushalt führen. Das sollte eigentlich in Ihrem Sinne sein. Denn wenn man dem Gesellschaftsklatsch Glauben schenkt, bin ich der aufregendste und begehrenswerteste Junggeselle in der Stadt und muß dringend verheiratet werden.«
Lady Antonia warf ihm einen mißtrauischen Blick zu. »Du willst dir wirklich eine Frau suchen?«
»Ja«, antwortete Ivan vergnügt.
O ja, er wollte eine Frau suchen. Allerdings hatte er nicht die geringste Absicht, eine zu finden. Sollte die alte Vogelscheuche sich ruhig etwas vormachen und voller Hoffnung ins Grab sinken.
Die Gräfinwitwe beugte sich vor, unfähig, ihre wachsende Aufregung zu verbergen. »Ich kenne alle vornehmen Familien und die meisten der reichen jungen Damen. Ich kann dich vorstellen, vielleicht sogar einen Empfang geben.«
»Das wird nicht nötig sein.«
»Aber John, denk doch nur …«
»Ich heiße Ivan«, herrschte er sie an, »und ich werde immer Ivan bleiben!«
Bis jetzt hatte er lässig an dem breiten Kaminsims gelehnt, doch nun begann er, rastlos auf und ab zu gehen.
»Schon gut, schon gut«, gab seine Großmutter zurück. »Ich werde mich bemühen, nicht zu vergessen, daß du bei deinem Zigeunernamen gerufen werden möchtest. Ich habe dich eben in meinen Gedanken so lange als John gesehen.«
Ivan stieß ein häßliches Lachen hervor. »In Ihren Gedanken? Tatsache ist, daß Sie überhaupt nicht an mich gedacht haben!«
»In meinen Gedanken warst du immer der Graf von Westcott«, erwiderte sie schneidend. »Nun, da der Titel dir offiziell zuerkannt wurde, solltest du mir die Dankbarkeit und den Respekt erweisen, die mir zukommen!«
»Dankbarkeit!« rief Ivan aufgebracht. »Respekt! Wie käme ich dazu? Das einzige Gefühl, das Sie von mir zu erwarten haben, ist Verachtung!« Er konnte in ihrer Gegenwart nicht so emotionslos bleiben, wie er es sich vorgenommen hatte.
Zehn Jahre hatte er sich von seiner Großmutter und dem gottverlassenen Familienbesitz, der ihr so viel bedeutete, ferngehalten. Zehn Jahre war er in der Welt umhergezogen, ohne den Frieden zu finden, nach dem er sich so sehnte. Die Erinnerung an seine Mutter und ihre Zigeunersippe war längst zu schwachen Schemen verblaßt, ebenso wie seine eigene Identität, und nichts war ihm geblieben als die verhaßten Bande, die ihn an die Familie der Thorntons ketteten.
Nachdem er das Internat verlassen hatte, hatte er äußerst sparsam gelebt und so sein großzügig bemessenes Taschengeld zu einer ordentlichen Summe angehäuft. Und er hatte hart gearbeitet, hatte oft gewagt, wo andere Männer zurückgeschreckt waren.
Auf diese Weise hatte er ein kleines Vermögen angesammelt, das ihn unabhängig vom Reichtum seiner Familie machte. Weshalb also war er zurückgekommen? Wieso hatte er sich diese verfluchten Titel anhängen lassen?
Der Grund war die Gräfinwitwe gewesen.
Es hätte Ivan nicht gereicht, seine unbekannten Vettern das Westcottvermögen erben zu lassen. Das wäre nicht Strafe genug gewesen für das, was sie ihm angetan hatte. Deshalb war er zurückgekehrt, als er vom Tod seines Vaters hörte. Er wollte Graf werden, wie sie es die ganze Zeit über geplant hatte, doch ihr zum Trotz wollte er es vermeiden, einen Erben zu zeugen. Der Stammbaum sollte mit ihm enden, und im Gegensatz zu all ihren Plänen sollte sie alles, was ihr lieb war, in die Hände ihrer verachteten Neffen übergehen sehen – so wie er ihretwegen alles verloren hatte, was er liebte.
Mit einem tiefen Atemzug brachte er sich wieder unter Kontrolle. »Ich werde bei Blackburn wohnen, bis Sie dieses Haus verlassen haben.«
Bei der Nennung dieses Namens fuhr sie zusammen. »Oh, ja, Blackburn, der Bastard-Prinz.«
Ivan lächelte kalt. »Wir Bastarde müssen zusammenhalten, zumal unsere Familien sich nicht um uns kümmern.«
Lady Antonias Gesicht nahm einen abweisenden Ausdruck an. »Wenn ich mich nicht um dich gekümmert hätte, wäre aus dir irgend ein jämmerlicher Pferdedieb geworden. Du wärst jetzt entweder tot oder im Gefängnis.«
Ivan biß verärgert die Zähne zusammen. Diese Feststellung hörte er nur ungern, aber sie stimmte. So kläglich seine Kindheit auch verlaufen war, den anderen Kindern aus der Sippe seiner Mutter war es noch schlechter ergangen. Vielleicht hatten einige von ihnen die vergangenen zwanzig Jahre überlebt; er war jedenfalls nicht in der Lage gewesen, sie aufzuspüren.
Doch das war keine Entschuldigung für die Handlungsweise der alten Frau. Er schenkte sich Whisky ein und schluckte ihn ohne Genuß hinunter. Dann setzte er das Glas hart auf den Tisch. »Ich gehe. Schicken Sie eine Nachricht zu Blackburns Haus am Compton Square, wenn Sie abreisen.«
»Ich habe nicht die Absicht, mein eigenes Heim zu verlassen«, erwiderte Antonia frostig.
An der Tür drehte Ivan sich noch einmal um und betrachtete seine Großmutter. Vor zwanzig Jahren hatte sie ihn aus der Sippe seiner Mutter gerissen, doch damals war er bereit gewesen, ihre Existenz zu begrüßen. Er hätte die Existenz eines jeden Menschen in seinem Leben begrüßt. Seine Großmutter jedoch hatte das verängstigte Kind der Grausamkeit von Burford Hall überlassen. Der Grausamkeit des ständig betrunkenen Schulleiters und dessen sadistischer Frau; der Grausamkeit einer Knabengemeinschaft, in der die Stärkeren herrschten und die Schwächeren untergingen.
Aber eine wichtige Lektion hatte sich ihm in Burford Hall eingeprägt, eine Lektion, nach deren Regel er heute noch lebte: Macht bedeutet Recht zu bekommen.
Nun besaß er diese Macht, und sie gab ihm das Recht zu tun, was er wollte.
Er musterte das alte Weib, das da vor ihm saß, mit kaltem, gleichgültigem Blick. Es war zu spät für ihre Versuche, sich jetzt noch in sein Leben einzuschleichen. Viel zu spät.
Und das, was ihr am wichtigsten war, nämlich eine gehobene Position in der Gesellschaft und die Fortführung des Stammbaums, galt ihm nichts; ja sogar weniger als nichts.
»Sie können gegen mich nicht gewinnen«, knurrte er. »Bleiben Sie hier, wenn Sie wollen; doch ich warne Sie, Sie werden dabei nicht glücklich. Sie sollten lieber aufs Land zurückkehren, in den Schoß Ihrer Familie. Ach, Sie haben ja gar keine Familie, nicht wahr? Zumindest keine Familie, die Sie lieben – oder die Sie liebt. Doch vielleicht kann Ihre Dienerschaft Sie darüber hinwegtrösten.«
Damit drehte er sich auf dem Absatz um und ging gemessenen Schrittes aus dem eleganten Salon in die marmorne Eingangshalle und schließlich durch die hohen Portale und über die Granitstufen hinab ins Freie. Obwohl Westcott House zu den nobelsten Häusern von London gehörte, war es für ihn nur ein Haufen öder Steine. Es mochte das großartige Zeugnis eines Titels sein, der seit nahezu vierhundert Jahren von Generation zu Generation weitergereicht worden war; für Ivan jedoch war es nur ein Werkzeug der Vergeltung. Die. mondäne Welt, die Saison, das Geld – all das betrachtete er eigentlich als Zeitverschwendung, nützlich nur insoweit, als sie es ihm ermöglichten, sich an denen zu rächen, die ihn so sehr verletzt hatten.
Daß diese Rache ihm keine Genugtuung brachte, leugnete er vor sich selbst. Denn wenn Vergeltung nicht sein Ziel war, wenn sein Leben sich nicht darum drehte, alle, die einst auf ihn herabgeblickt hatten, in den Staub zu treten, was zum Teufel sollte er dann mit dem Rest dieses Lebens anfangen?
Kapitel 2
Hougthon Manor, nahe Wellington, Somerset
Mai 1829
Lucy Drysdale hörte die zornigen Schreie ihrer Neffen, aber sie zog es vor, sie zu ignorieren. Mit dem Rücken zur Tür des Morgenzimmers las sie noch einmal den letzten Absatz des Briefes, den sie soeben erhalten hatte:
»… Ich werde während dieser Saison in der Fatuielle Hall lesen. Falls Sie sich in London aufhalten werden, würde ich Ihnen empfehlen, sich die ganze Vorlesungsreihe anzuhören. Besonders meine Theorien über die geistige und moralische Entwicklung von Kindern werden Sie interessieren. Bis dahin verbleibe ich aufrichtig der Ihre,
Sir James Mawbey, B.A.«
Lucy drückte den Brief an ihre Brust und seufzte. Aufrichtig der Ihre. Obwohl sie wußte, daß es kindisch war, aus dieser schlichten Abschiedsformel etwas Besonderes herauszulesen, konnte sie nicht anders. Wenn es je einen Mann gegeben hatte, von dem sie wünschte, er wäre aufrichtig der ihre, so war das Sir James Mawbey. Seit sie zum ersten Mal seine Artikel gelesen hatte, war sie von größter Bewunderung für ihn erfüllt.
Endlich war ein Mann aufgetaucht, dessen Interessen über Jagd und Würfelspiel, Landbesitz und Pferde hinausgingen.
Endlich ein Mann, der über dieselben Dinge nachdachte wie sie und der seine Gedanken sogar zu Papier gebracht und in brillanten Artikeln veröffentlicht hatte.
Sie hatte alles gelesen, was er über Psychologie geschrieben hatte, und war von seinem fundierten Wissen zutiefst beeindruckt. Und was noch wichtiger war, er hatte viele ihrer eigenen halbausgegorenen Gedanken darüber, warum Menschen dies oder jenes taten, zu Ende gedacht.
Eines Tages hatte Lucy es gewagt, ihm einen Brief zu schreiben, und er hatte ihr geantwortet. Von da an kannte ihre Bewunderung für ihn keine Grenzen. Sie hatten seither noch einige Briefe gewechselt, doch niemals hatte sie zu hoffen gewagt, daß sie ihn je persönlich kennenlernen würde. Bis jetzt.
Allerdings gab es da noch ein großes Hindernis: Ihr Bruder wollte sie nicht weglassen. Sie wußte, wie kleinlich Graham war, wenn es um Geld ging. Von ihren intellektuellen Ambitionen gar nicht zu sprechen. Er hatte es strikt abgelehnt, sie eine Universität besuchen zu lassen, obwohl es schon einige Frauen gab, die das wagten. Lucy mochte bitten, wie sie wollte, Graham blieb stur bei seiner Behauptung, sie sei bereits besser ausgebildet, als es für eine Frau zuträglich sei.
Es war närrisch zu glauben, er würde ihr die Reise nach London bezahlen, nur damit sie eine Vorlesungsreihe besuchen konnte, noch dazu, wenn diese sich mit Themen befaßte, die Graham als albern und nutzlos betrachtete. Er hatte ihr oft vorgehalten, sie könne ihren Wissensdurst anhand der Bibliothek ihres Vaters und durch ihre Arbeit als Gouvernante für seine Kinder hinreichend stillen.
Lucy fühlte sich eingeengter als je zuvor. Längst hatte sie jedes Buch in der Bibliothek gelesen, und was die Kinder anging, nun, sie waren eben Kinder. Sie konnten das Gespräch mit gebildeten Erwachsenen nicht ersetzen. Und einem Vergleich mit dem brillanten Sir James Mawbey konnten sie schon gar nicht standhalten.
Lucy starrte auf den Brief, befühlte das Papier und träumte einen unmöglichen Traum. Was, wenn sie irgendwie nach London gelangte? Was, wenn sie Sir James träfe und er noch ledig wäre? Wäre es so unwahrscheinlich, daß sie sich voneinander angezogen fühlten? Selbstverständlich dachte sie nicht an so frivole Dinge wie Leidenschaft, nicht im Zusammenhang mit dem ernsten Sir James. Mit Sicherheit glaubte er nicht an romantische Liebe, ebensowenig wie sie selbst. Doch Liebe konnte auch aus gegenseitigem Respekt und Bewunderung erwachsen … Eine solche Form der Zuneigung mußte auch zwischen ihnen möglich sein.
Lucy fühlte sich wegen ihrer Gedanken plötzlich schuldig und blickte wie ertappt um sich. Doch eines war gewiß: Sie mußte nach London! Wenn sie sich noch lange hier auf dem Land vergrub, würde ihr Verstand verwelken wie eine vernachlässigte Pflanze.
Wieder war ein lauter Schrei zu hören, doch sie achtete nicht darauf. Sie war an die Lautstärke ihrer Neffen gewöhnt. Obwohl Lucy sich nach Kräften bemühte, ihren Schutzbefohlenen bessere Manieren beizubringen, hatte sie es nicht geschafft, ihnen das Schreien abzugewöhnen. Stanley, der ältere, war ein hochnäsiges kleines Monster und nur zu ertragen, wenn er schlief. Nachdem er der älteste Sohn und Erbe war, wurde er bereits jetzt als Herr behandelt. Dagegen hatte Derek, sein jüngerer Bruder, es sich zum Lebenszweck gemacht, Stanley dafür zu strafen, daß er der Erstgeborene war. Was Lucys Nichten, Prudence, Charity und Grace betraf, so hegte sie keine Illusionen über deren Charakter- und Geistesgaben.
Als der Lärm nicht aufhören wollte, steckte sie Sir James' Brief seufzend in ihre Tasche. Jetzt mußte sie wohl Frieden stiften zwischen den zwei kleinen streitsüchtigen Jungen. Immerhin hatte sie den älteren Kindern heute früh schon einige Unterrichtsstunden erteilt und danach mit den kleineren einen ausgedehnten Spaziergang unternommen. Da konnte man doch erwarten, daß ihr gelegentlich ein paar ruhige Minuten vergönnt waren. Damit war's heute wohl nichts.
Da hörte man etwas auf den Marmorboden krachen, und Lucy rannte aus dem Morgenzimmer.
»Stanley! Derek!« rief sie schneidend, und die beiden Jungen fuhren auseinander. Sie waren zehn und neun Jahre alt, fast gleich groß und auch von gleichem Temperament.
»Er hat mich einen Furz genannt!«
»Und er mich einen Pferdearsch!«
Trifft beides zu, dachte Lucy, behielt diese Meinung jedoch wohlweislich für sich.
Wie aus dem Nichts erschienen plötzlich die drei Mädchen. Prudence fühlte sich mit ihren zwölf Jahren ihren Brüdern weit überlegen und ließ sich das deutlich anmerken. »Du meine Güte, sind die Kinder wieder unartig?«
»Halt die Klappe, Pru!«
»Halt du die Klappe!«
In diesem Augenblick tauchte ihre Mutter, Hortense, in der Halle auf. »Was in aller Welt …« Sie hielt mitten im Satz inne, als sie die Scherben der pseudochinesischen Vase über den ganzen Boden verstreut sah. »O je, o je, da wird euer Vater aber verärgert sein, sehr verärgert.« Dann bemerkte sie Lucy. »Oh Lucy, wie konntest du das zulassen?«
Lucy zog es vor, nicht zu antworten. Obwohl sie meistens versuchte, Mitgefühl für ihre weinerliche Schwägerin aufzubringen – die Ärmste war schließlich mit Graham verheiratet und hatte an dieser Last genug zu tragen –, hatte sie im Augenblick andere Sorgen.
»Prudence, geh mit Charity und Grace in den Rosengarten«, wies sie das älteste Mädchen an. »Auf der Stelle«, fügte sie hinzu, als Prudence den Mund zum Widerspruch öffnete. Zu ihrer Schwägerin sagte sie mit einem knappen Lächeln: »Ich werde mich darum kümmern, Hortense.«
»Oh, ja. Aber was ist mit der Vase?«
»Schick Lydia herauf, damit sie die Scherben zusammenfegt.«
»Ja, aber – was wird Graham sagen? Wegen der Vase, meine ich. Er wird es sicher bemerken. Er sitzt ja an diesem Platz, an diesem Tisch, seit ich zum ersten Mal nach Houghton Manor kam, da war ich noch ein Kind, und das sind jetzt bestimmt schon, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, und …«
»Bitte, Hortense«, unterbrach Lucy das Geplapper ihrer Schwägerin.
»O ja, natürlich.« Hortense zog sich zurück. Sie war äußerst unpraktisch veranlagt, sowohl als Ehefrau wie auch als Mutter. Doch sie war fruchtbar, und das war es schließlich, was Graham gewollt hatte. Das war es, was alle Männer wollten, dachte Lucy zornig. Sicher würden auch die beiden Rabauken, die jetzt nervös vor ihr standen, das eines Tages von ihren Frauen erwarten. Eine Gebärmaschine ohne eigene Vorstellungen und Gedanken.
Sie betrachtete die beiden mit finsterem Blick. »Sagt die Wahrheit und erzählt ganz genau, wie es passiert ist.«
»Es war seine Schuld!«
»Nein, er hat angefangen!«
»Genau, wie es passiert ist«, wiederholte Lucy. »Ich lasse euch beide heute nachmittag jedes einzelne Adelswappen von England auswendig lernen, wenn ihr nicht sofort mit der Wahrheit herausrückt.«
Die Brüder tauschten einen Blick, der besagte, daß Lucy die Oberhand gewonnen hatte. Sie versuchte meistens, die Kinder auf eine Weise zu bestrafen, die einen Bezug zur begangenen Untat herstellte. Manchmal griff sie jedoch auf die ehrwürdige Tradition zurück, die kleinen Missetäter einen langen Text abschreiben zu lassen. Anstelle von Bibelzitaten bevorzugte sie jedoch die hierarchische Auflistung der Adelsgeschlechter. Das war ihr eigener kleiner Seitenhieb auf eine Gesellschaftsordnung, die so einengend und restriktiv war, daß sie jeden kreativen Gedanken im Keim erstickte. Wider besseres Wissen hoffte sie, daß gerade diese Strafe den beiden Knaben eine lebenslängliche Abneigung gegen die starren gesellschaftlichen Regeln einimpfen würde, unter denen sie aufwuchsen.
»Derek hat Sunny gefüttert«, sagte Stanley anklagend.
»Es war nur ein Apfel!«
»Sunny gehört mir, nicht Derek!«
»Und was geschah dann?« unterbrach Lucy.
»Er hat mich umgeworfen!« antwortete Derek.
»Aber du hast mich mit Schmutz beworfen!«
»Nachdem du mich umgeworfen hast!«
»Du hast es verdient!«
»Hab' ich nicht!«
»Hast du doch!«
»Jungs! Jungs! Und wie seid ihr hier hereingekommen und habt die Vase runtergeworfen?«
»Stanley hat mich gejagt!«
»Den ganzen Weg von den Ställen? Und vermutlich hat sich keiner von euch die Zeit genommen, sich den Schmutz von den Schuhen zu streifen?«
Derek runzelte die Stirn. »Ich konnte nicht anhalten. Er war hinter mir her.«
»Er wäre mir sonst entwischt«, erklärte Stanley. Beide blickten schuldbewußt zu Lucy auf.
Sie waren im Grunde keine schlechten Jungen. Und wenn sie schon etwas zerschmissen hatten, so war es wenigstens die scheußliche alte Vase gewesen. Aber darum ging es nicht. Sie waren Brüder, die in gegenseitigem Haß aufwuchsen, wie so viele andere ihres Standes. Jüngere Brüder, die nichts erbten, haßten ihre älteren Brüder, ebenso wie diese ihre Väter haßten und ungeduldig auf deren Tod warteten. Und all das war das Ergebnis dieses antiquierten Rechtes des Erstgeborenen.
»Beginnen wir mit dir, Stanley. Ich möchte dich daran, erinnern, daß die Verantwortung für die Ställe von Houghton House eines Tages dir zufallen wird. Wenn du dieser Verantwortung gerecht werden willst, mußt du auf jedes Pferd dort achten …«
»Das tue ich! Ich liebe alle unsere Pferde!«
Als Lydia, das Hausmädchen, ins Zimmer huschte, nahm Lucy ihr Besen und Kehrblech aus der Hand. Den Besen gab sie Stanley und das Kehrblech Derek.
Dann blickte sie ihre Neffen eindringlich an. »Erst werdet ihr diese Unordnung beseitigen, und zwar gemeinsam.« Mit einer Geste schnitt sie jeden Einwand ab. »Danach geht ihr hinüber zu den Ställen und tut jedem einzelnen Pferd, gleich ob Springpferd, Zugpferd oder Pony, etwas Gutes. Das kann ein Apfel sein, eine Handvoll Hafer oder einfach nur ein liebevolles Streicheln. Auch das sollt ihr bei jedem Pferd gemeinsam tun. Wenn ihr damit fertig seid, kommt wieder zu mir, dann gehen wir gemeinsam zu eurem Vater. Wir werden ihm erzählen, was geschehen ist und wie wir die Angelegenheit bereinigt haben.«
Alles in allem war das eine gerechte Lösung, fand Lucy. Derek wußte, daß sie ihm eine Züchtigung durch seinen Vater erspart hatte, und lächelte erleichtert. Stanley hatte etwas Neues über seine zukünftige Verantwortung gelernt. Außerdem waren die Ställe sein liebster Aufenthalt.
Lucy seufzte. Sie löste zwar gerne solche Probleme, aber auf Dauer konnte das doch nicht ihr Lebensinhalt sein. Sie faßte in ihre Tasche und befühlte den kostbaren Brief. Es gab noch so viel zu lernen im Leben, doch sie würde nie die Möglichkeit dazu erhalten, fürchtete sie. Anstatt selbst das Leben zu erfahren, wurde sie mit ihren achtundzwanzig Jahren bereits als alte Jungfer betrachtet und war dazu verurteilt, die Kinder ihres Bruders zu erziehen, damit diese das Leben erfahren konnten.
Doch sie schwor sich, daß es nicht dabei bleiben sollte. Irgendwie würde sie einen Weg finden, Houghton Manor zu verlassen. Sie hatte ihr eigenes, bescheidenes Einkommen, das ihr Großvater mütterlicherseits ihr hinterlassen hatte. Aber hundert Pfund im Jahr reichten nicht aus, um völlig unabhängig zu sein. Wenn sie eine Möglichkeit fände, etwas hinzu zu verdienen, konnte sie aus dem einengenden Familienkreis heraustreten und sich in der Stadt auf eigene Füße stellen.
Und wieder ein Schrei, diesmal von einem Mädchen. Sie mußte bald einen Ausweg finden. Sie mußte einfach!
»Sie ist bei den Fordhams zu Besuch«, teilte Hortense Lucy am folgenden Nachmittag mit »Graham sagt, wir müssen ihr unsere Aufwartung machen, zusammen mit den Kindern, weil sie eine Gräfin ist, sagt er, und weil das Westcott-Vermögen sagenhaft groß ist. Graham sagt, es sei eine große Ehre …«
»Sie ist eine Gräfinwitwe«, verbesserte Lucy ihre aufgeregte Schwägerin. »Ich habe in der Times gelesen, daß einer ihrer Enkel kürzlich als Graf von Westcott eingesetzt wurde.«
»Nun, ja. Aber Graham sagt, daß dieser Enkel – ihr einziger Enkel – noch unverheiratet ist. Graham hat mir sehr genaue Anweisungen gegeben. Prudence muß ihr schönstes Kleid anziehen und sich der Gräfin von ihrer besten Seite zeigen.«
Lucy versuchte, ihren Unwillen zu verbergen, auch wenn es ihr schwerfiel. Prudence war erst zwölf und noch ein Kind. Und doch wollte Graham schon die Aufmerksamkeit des Grafen von Westcott auf sie lenken? Lucys Magen zog sich vor Ärger zusammen. Der neue Graf war ein erwachsener und weitgereister Mann, wenn man dem Artikel in der Times glauben durfte. Wie konnte ihr Bruder seine Tochter mit ihm verkuppeln wollen?
Doch dann meldete sich ihr Gerechtigkeitssinn. Jeder vernünftige Vater wünschte sich, daß seine Tochter einen so wohlhabenden und bedeutenden jungen Mann heiratete. Trotzdem hatte sie diese geschäftsmäßig geplanten Eheschließungen immer abgelehnt.
»Warum ist Lady Westcott in Somerset?« fragte sie.
Hortense runzelte die Stirn und zupfte nervös an ihren Spitzenmanschetten. »Ich weiß es nicht, und ich habe Angst, etwas Falsches zu sagen. Du weißt doch, daß ich nie eine richtige Saison hatte. Ich hatte keine Gelegenheit, mich an die Gesellschaft zu gewöhnen. Was, wenn ich etwas tue, für das Graham sich schämt? Er würde mir das nie verzeihen!«
Lucy nahm Hortenses flatternde Hände in ihre eigenen. »Es gibt gar keinen Grund, nervös zu sein, Hortense. Wirklich keinen. Sei einfach du selbst, und alles wird glattgehen.«
Hortense stieß einen tiefen Seufzer aus. »Du hast leicht reden. Nichts macht dir Angst. Aber ich habe durch Lady Babcock – du weißt, drüben bei Symington – von Lady Westcott gehört. Lady Babcock ist die Kusine von Darcy Harrigan, dessen Schwester mit Viscount Prufrock verheiratet ist. Sie halten ein Stadthaus und erfahren so den ganzen Klatsch aus erster Hand.«
»Und was hat Lady Babcock über Lady Westcott gesagt?« unterbrach Lucy den wirren Redefluß ihrer Schwägerin.
Hortense machte runde Augen. »Es heißt, sie sei, naja, ziemlich streng.« Sie hielt kurz inne und fuhr dann flüsternd fort: »›Schreckschraube‹ war das Wort, das Lady Babcock benutzte.«
»Dann wird sie sich mit Graham ausgezeichnet verstehen«, bemerkte Lucy trocken, bedauerte aber sofort ihre vorschnellen Worte, als sie Hortenses verletzten Blick bemerkte.
»Du bist so unfreundlich, Lucy. Graham ist immer gut zu dir. Er ist zu allen gut.«
Lucy verzog das Gesicht. »Es tut mir leid. Du hast ganz recht. Ich hätte das nicht sagen sollen.« Wenigstens nicht in deiner Gegenwart, setzte sie im stillen hinzu. »Wird Mutter auch mitkommen?« fragte sie, um das Thema zu wechseln.
»O ja, Graham sagt, sie muß. Wir alle müssen gehen, sogar du.«
Sogar du. Lucy zwang sich, nicht auf diesen Hinweis zu reagieren, daß sie das unbedeutendste Mitglied der Familie sei. Sie war Grahams ledige Schwester, zu jung, um den Respekt zu erwarten, den man Älteren zollte, und zu alt, um noch vorteilhaft verheiratet zu werden. Sie besaß kein großes Vermögen, keinen eigenen Titel. Und wenn sie auch wußte, daß sie leidlich hübsch war, so reichte das doch nicht aus, die unglückliche Neigung zu kaschieren, stets ihre Meinung zu sagen. Doch man erwartete, daß sie zu den Fordhams mitging, um Lady Westcott die Aufwartung zu machen.
Vermutlich sollte sie für solche Vergünstigungen dankbar sein.
Auf jeden Fall wollte sie sich gut unterhalten, beschloß Lucy, während sie eilig ihre Neffen und Nichten zusammensuchte. Endlich würde sie einen Menschen kennenlernen, dessen Gedanken und Meinungen ihr neu waren. Es würde eine angenehme Unterbrechung des faden täglichen Einerlei sein, etwas anderes als Unterrichten, Friedenstiften und oberflächliche Unterhaltungen.
Bitte, laß Lady Westcott einigermaßen gescheit sein, betete Lucy.
Denn sollte sich Lady Westcott als gescheit und witzig herausstellen und zudem noch eine Weile im Haus der Fordhams bleiben, so hätte Lucy zumindest eine Zeitlang einen Menschen, mit dem sie die anregenden Gespräche über Bücher, Ideen und Politik führen konnte, nach denen sie sich so sehnte. Einen Menschen, der ihr neue geistige Nahrung vermitteln könnte, bis sie einen Weg gefunden hatte, nach London zu entkommen.
Das Landhaus der Fordhams, das außerhalb des Ortes Taunton lag, bestand aus einer Anhäufung von antiken Räumen und stammte noch aus der Zeit Heinrichs III. Die Fordhams selbst waren nicht ganz so alt, obwohl sie so aussahen. Und auch Lady Westcott sah nach uraltem Adel aus, fand Lucy, als man sie der würdevollen Dame vorstellte.
Die Gräfinwitwe saß auf dem Ehrenplatz der Fordhams, einem riesigen Sessel aus geschnitzter englischer Eiche, gepolstert mit chinesischen Kissen. Ihr Kleid war. streng geschnitten, der Stoff jedoch war aus der kostbarsten ebenholzfarbenen Seide, die Lucy je gesehen hatte. So schwer die Seide war, so umfloß sie doch die Gestalt der alten Frau wie die feinste Gaze.
Lady Westcotts einziger Schmuck bestand aus einem Paar schwarzer Jettohrringe, einer schweren goldenen Uhrkette und einem Ebenholzstock mit Kristallknauf. Trotz ihrer kleinen Statur und ihrer vogelhaften Züge machte sie auf Lucy einen imponierenden Eindruck. Jede andere Frau hätte in diesem Sessel, umgeben von dem enorm großen Raum, zwergenhaft gewirkt. Nicht so Lady Westcott.
Die Gräfinwitwe begrüßte die Besucher mit ausgesuchter Höflichkeit. Lord Fordham stellte ihr zuerst Viscount Houghton vor, danach präsentierte Graham den Rest seiner Familie. Lucy war natürlich als Letzte an der Reihe. Doch aus unerfindlichen Gründen betrachtete die alte Frau gerade Lucy besonders eingehend.
Als Lucy ihren korrekten Knicks angebracht hatte, sprach Lady Westcott sie an: »Wie alt sind Sie, Miss Drysdale?«
Das war ziemlich direkt. »Achtundzwanzig. Weshalb wollen Sie das wissen?« fragte Lucy ebenso direkt zurück.
Die Augenbrauen der Gräfinwitwe hoben sich leicht. Graham räusperte sich, Hortense schien einer Ohnmacht nahe, und Lucys Mutter, Lady Irene, kicherte nervös, als habe ihre vorwitzige Tochter einen Spaß gemacht.
»Kein Wunder, daß Sie noch unverheiratet sind«, bemerkte Lady Westcott, »Sie gehören nicht zur zuckersüßen Sorte, wie?«
»Ich fürchte, nein«, erwiderte Lucy lächelnd, »aber bitte geben Sie dafür nicht meiner Mutter die, Schuld.« Sie warf Lady Irene einen tröstenden Blick zu. »Sie hat sich redlich bemüht, mich mit allen weiblichen Tugenden auszustatten. In den meisten Bereichen war sie dabei erfolgreich, doch ich muß gestehen, daß ich einige ihrer Lektionen nicht verinnerlicht habe.«
»Meine Schwester hatte durchaus Heiratsangebote, Lady Westcott. Gute Angebote«, warf Graham ein, »doch sie hat noch keinen Mann gefunden, der ihr gefällt.«
Lucy sah ihn mitleidig an. »Mylady, wenn er ganz aufrichtig wäre, hätte er ihnen erzählt, daß ich jedesmal die eine oder andere Ausrede gefunden habe, diese Anträge abzulehnen. Es hat ihn fast zur Verzweiflung gebracht. Doch ich blieb, wie Sie mich sehen: unverheiratet, jetzt und wohl auch in Zukunft.«
»Und dieser Zustand befriedigt Sie?«
Lucy musterte die Gräfinwitwe. Klein war sie, wie ein Spatz, jedoch mit dem glänzenden Gefieder eines Raben und dem scharfen Blick eines Falken, und Lucy fragte sich, aus welchen Gründen die alte Dame es gerade auf sie abgesehen hatte.
Die Antwort war ihr plötzlich klar. Lady Westcott war gewiß auf der Suche nach einer Frau für ihren Enkel, den neuen Grafen. Doch weshalb sollte sie dabei eine alte Jungfer ohne Titel oder großes Vermögen ins Auge fassen? Allein aufgrund seines Reichtums konnte der Graf sich doch die beste Partie aussuchen. Nahm man noch seine Titel hinzu, so mußte er der noblen Gesellschaft wie das Wunschbild eines Bräutigams erscheinen.
Doch dann kam Lucy ein schlimmer Verdacht. Wenn seine Großmutter sogar alte Jungfern wie sie in Betracht zog, so mußte irgend etwas mit dem jungen Mann nicht stimmen. Und das mußte mehr sein, als nur der Makel seiner unehelichen Geburt mit einer Zigeunerin als Mutter, denn darüber wußte schließlich alle Welt Bescheid. Und alle Welt würde ihm diesen Makel verzeihen, nun, da er der Graf von Westcott war. Es mußte noch etwas anderes im Spiel sein.
»Ich fühle mich ganz wohl«, antwortete Lucy schließlich. »Ich habe meine Bücher und meine Brieffreundschaften. Wahrscheinlich habe ich schon zu feste Gewohnheiten entwickelt, um mich jetzt noch den Wünschen eines Mannes unterzuordnen.«
Wieder musterte Lady Westcott sie lange. Lucy fühlte sich unter diesem sezierenden Blick ziemlich ungemütlich – ein Zustand, an den sie nicht gewöhnt war und der ihr überhaupt nicht gefiel.
Es war Lucys Mutter mit ihrem Drang, keine Pausen in der Konversation entstehen zu lassen, die sie erlöste. »Lady Westcott«, sagte sie ehrerbietig, »wenn ich mir die Kühnheit erlauben dürfte, zu bemerken, daß meine älteste Enkelin, Miss Prudence Drysdale, obwohl noch ein Schulmädchen, eine ausgezeichnete Musikerin ist. Wünschen Sie, daß sie Ihnen – äh, uns – ich meine, der geschätzten Gesellschaft hier – etwas vorspielt …«
Mit einer nachlässigen Handbewegung unterbrach Lady Westcott sie. »Aber ja, natürlich. Lassen Sie das Mädchen spielen.«
Alle ließen sich nieder, doch noch immer fühlte Lucy sich unter Lady Westcotts scharfer Beobachtung.
Lucy setzte sich in der Nähe der Kinder auf einen einfachen Stuhl, so daß sie sie im Auge behalten konnte, während Prudence spielte. Trotzdem rutschte sie selbst weit unruhiger auf ihrem Stuhl hin und her als die Kinder. Als Prudence ihre simple Version einiger beliebter Menuette heruntergespielt hatte und die kleineren Kinder weggeschickt worden waren, um ihren Tee separat einzunehmen, war Lucy zu der Überzeugung gelangt, daß sie noch nie zuvor einer so starken Persönlichkeit begegnet war wie Antonia Thornton, Gräfinwitwe von Westcott.
»Lady Westcott ist eine alte Freundin«, bemerkte Lady Fordham und nahm damit die Konversation wieder auf. Sie bedeutete dem Dienstmädchen, das Teeservice vor ihr abzustellen.
»Ja, eine sehr alte Freundin«, gab die ehrwürdige Dame zurück. »Alt genug, um sich ein paar Exzentritäten zu erlauben, nicht wahr, Gladys?«
»Aber natürlich, meine Liebe …«
»Dann wird es dir nichts ausmachen, wenn ich Miss Drysdale bitte, den Tee auszuschenken. Miss Lucy Drysdale«, sagte sie nachdrücklich, als Graham sich erwartungsvoll vorbeugte.
Lucy unterdrückte ihren Ärger über ihren wichtigtuerischen Bruder. Hatte er erwartet, eine Dame wie Lady Westcott würde ein Schulmädchen bitten, den Tee auszuschenken? Die arme Prudence hätte keine zwei Minuten unter dem prüfenden Blick der alten Frau durchgehalten.
»Soll ich?« vergewisserte sich Lucy bei Lady Fordham.
»Nun – nun ja, selbstverständlich, meine Liebe. Natürlich, bitte«, antwortete diese. Doch auf ihrem Gesicht spiegelte sich die gleiche Verwirrung wie bei Graham und Hortense. Lucys Mutter jedoch hatte das Gewicht von Lady Westcotts Ersuchen sofort erfaßt und strahlte. Sie hatte es schon lange aufgegeben, ihre Tochter verheiraten zu wollen. Mit einem Schlag jedoch hatte die Gräfinwitwe all diese Hoffnungen wieder aufleben lassen.
Lucy wußte nicht, was sie davon halten sollte. Sie hatte gehofft, in Lady Westcott eine muntere Frau zu finden, mit der sie ein intelligentes Gespräch führen konnte, das – über Wetter, Mode, Klatsch und Kinder hinausging. Dieses Interesse an ihrer eigenen Person hatte sie .nicht erwartet.
Sie schenkte den Tee aus, wobei sie von dem Dienstmädchen unterstützt wurde, das die Tassen und Kuchenteller herumreichte. Lady Fordham plauderte indessen über die Auslandsreise ihres Enkels und über die Vielfalt der neuen Rosensorten, die neuerdings jedermann entzückten.
Graham versuchte vergebens, Lord Fordham in ein Gespräch über einen komplizierten Gerichtsfall zu verwickeln, der in der Presse Aufsehen erregt hatte. Der Lord brachte in Gesellschaft der Damen kaum ein Wort über die Lippen. Sein Schweigen und Lady Westcotts Wortkargheit machten es für Lady Fordham immer schwieriger, die Konversation aufrecht zu erhalten. Hortense war von Lady Westcotts Persönlichkeit so eingeschüchtert, daß sie nichts zu sagen wagte. Seit der Begrüßung hatte sie kein Wort zur Unterhaltung beigetragen. Lucys Mutter, sonst sehr gesprächig, war von der Vision eines möglichen Schwiegersohns, der einen Grafentitel trug, so überwältigt, daß sie nur noch stumm auf Lucy starrte.
Lucy wurde gewahr, daß es nun an ihr lag, das sich zäh dahinschleppende Gespräch wieder zu beleben. Zu ihrem Bedauern durfte sie dabei ihrer Neugierde über Lady Westcotts Enkel nicht freien Lauf lassen.
Sie war erleichtert, als die Gräfinwitwe ihr Schweigen brach. »Hatten Sie schon eine Saison, Miss Drysdale? Ich kann mich nicht erinnern, daß Sie bei Hofe vorgestellt worden sind.«
»Meine Anwesenheit in der Stadt ist ziemlich untergegangen. Das war 1819, kurz bevor der alte König starb.«
»Ach ja. Ich war in jenem Jahr nicht in London.«
»Nun, da haben Sie auch nichts verpaßt. Es sei denn, Sie stünden auf gutem Fuß mit Lady Nullingham. Es war schließlich auch das Jahr ihres, man könnte sagen, Emporkommens.«
Lucys Mutter schnappte nach Luft, und Hortense fing wieder an, sich zu fächeln. Lady Nullinghams öffentlicher Sündenfall war keineswegs ein Thema für eine gepflegte Konversation in gemischter Gesellschaft. Lucys Absicht war es jedoch, Lady Westcott zu schockieren oder zumindest aus der Reserve zu locken.
Der Funke von Humor, der in Lady Westcotts Augen aufglomm, überraschte sie kaum. »Ich habe diese Geschichte oft gehört, sie soll sehr amüsant gewesen sein. Ich bedaure es, daß ich nicht selbst dabei war«, meinte Lady Antonia. Dann erhob sie sich abrupt. »Ich würde gerne ein wenig im Garten spazierengehen, Miss Drysdale. Gewähren Sie mir dabei ein wenig Ihre Unterstützung«, sagte sie und streckte Lucy den Arm hin.
Verblüfft beeilte Lucy sich, dem Wunsch Folge zu leisten. Als auch die anderen sich erheben wollten, winkte Lady Westcott ab.